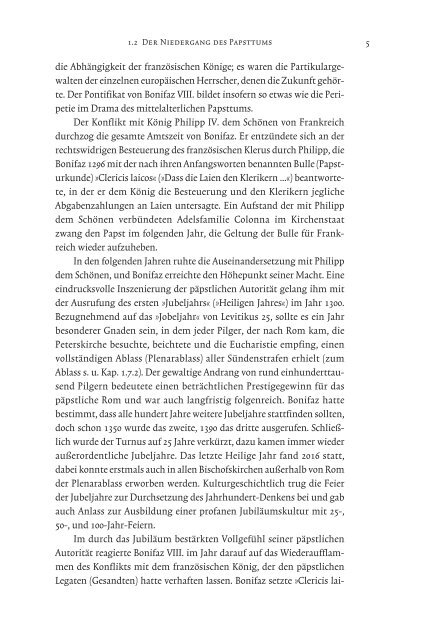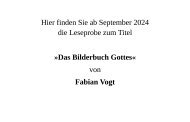Wolf-Friedrich Schäufele: Kirchengeschichte II: Vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart (Leseprobe)
Der Band behandelt in sieben großen Kapiteln die Geschichte des Christentums vom Spätmittelalter über die Reformation im deutschsprachigen Raum und in Europa, das Konfessionelle Zeitalter, das Zeitalter von Pietismus und Aufklärung, das »lange 19. Jahrhundert« und das »kurze 20. Jahrhundert«. Die Darstellung will vor allem die großen Zusammenhänge und Entwicklungslinien erschließen. Sie soll angehenden Pfarrerinnen und Pfarrern sowie Religionslehrerinnen und Religionslehrern ein historisch begründetes Verständnis jener Gestalt des Christentums eröffnen, mit der sie in ihrem Wirkungskreis aktuell zu tun haben. Zugleich vermittelt sie das zur Orientierung und für Examenszwecke nötige Grundgerüst der wichtigsten Namen und Daten.
Der Band behandelt in sieben großen Kapiteln die Geschichte des Christentums vom Spätmittelalter über die Reformation im deutschsprachigen Raum und in Europa, das Konfessionelle Zeitalter, das Zeitalter von Pietismus und Aufklärung, das »lange 19. Jahrhundert« und das »kurze 20. Jahrhundert«. Die Darstellung will vor allem die großen Zusammenhänge und Entwicklungslinien erschließen. Sie soll angehenden Pfarrerinnen und Pfarrern sowie Religionslehrerinnen und Religionslehrern ein historisch begründetes Verständnis jener Gestalt des Christentums eröffnen, mit der sie in ihrem Wirkungskreis aktuell zu tun haben. Zugleich vermittelt sie das zur Orientierung und für Examenszwecke nötige Grundgerüst der wichtigsten Namen und Daten.
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
1.2 Der Niedergang des Papsttums 5<br />
die Abhängigkeit der französischen Könige; es waren die Partikulargewalten<br />
der einzelnen europäischen Herrscher, denen die Zukunft gehörte.<br />
Der Pontifikat von Bonifaz V<strong>II</strong>I. bildet insofern so etwas wie die Peripetie<br />
im Drama des mittelalterlichen Papsttums.<br />
Der Konflikt mit König Philipp IV. dem Schönen von Frankreich<br />
durchzog die gesamte Amtszeit von Bonifaz. Er entzündete sich an der<br />
rechtswidrigen Besteuerung des französischen Klerus durch Philipp, die<br />
Bonifaz 1296 mit der nach ihren Anfangsworten benannten Bulle (Papsturkunde)<br />
»Clericis laicos« (»Dass die Laien den Klerikern …«) beantwortete,<br />
in der er dem König die Besteuerung und den Klerikern jegliche<br />
Abgabenzahlungen an Laien untersagte. Ein Aufstand der mit Philipp<br />
dem Schönen verbündeten Adelsfamilie Colonna im Kirchenstaat<br />
zwang den Papst im folgenden Jahr, die Geltung der Bulle für Frankreich<br />
wieder aufzuheben.<br />
In den folgenden Jahren ruhte die Auseinandersetzung mit Philipp<br />
dem Schönen, und Bonifaz erreichte den Höhepunkt seiner Macht. Eine<br />
eindrucksvolle Inszenierung der päpstlichen Autorität gelang ihm mit<br />
der Ausrufung des ersten »Jubeljahrs« (»Heiligen Jahres«) im Jahr 1300.<br />
Bezugnehmend auf das »Jobeljahr« von Levitikus 25, sollte es ein Jahr<br />
besonderer Gnaden sein, in dem jeder Pilger, der nach Rom kam, die<br />
Peterskirche besuchte, beichtete und die Eucharistie empfing, einen<br />
vollständigen Ablass (Plenarablass) aller Sündenstrafen erhielt (zum<br />
Ablass s. u. Kap. 1.7.2). Der gewaltige Andrang von rund einhunderttausend<br />
Pilgern bedeutete einen beträchtlichen Prestigegewinn für das<br />
päpstliche Rom und war auch langfristig folgenreich. Bonifaz hatte<br />
bestimmt, dass alle hundert Jahre weitere Jubeljahre stattfinden sollten,<br />
doch schon 1350 wurde das zweite, 1390 das dritte ausgerufen. Schließlich<br />
wurde der Turnus auf 25 Jahre verkürzt, dazu kamen immer wieder<br />
außerordentliche Jubeljahre. Das letzte Heilige Jahr fand 2016 statt,<br />
dabei konnte erstmals auch in allen Bischofskirchen außerhalb von Rom<br />
der Plenarablass erworben werden. Kulturgeschichtlich trug die Feier<br />
der Jubeljahre <strong>zur</strong> Durchsetzung des Jahrhundert-Denkens bei und gab<br />
auch Anlass <strong>zur</strong> Ausbildung einer profanen Jubiläumskultur mit 25-,<br />
50-, und 100-Jahr-Feiern.<br />
Im durch das Jubiläum bestärkten Vollgefühl seiner päpstlichen<br />
Autorität reagierte Bonifaz V<strong>II</strong>I. im Jahr darauf auf das Wiederaufflammen<br />
des Konflikts mit dem französischen König, der den päpstlichen<br />
Legaten (Gesandten) hatte verhaften lassen. Bonifaz setzte »Clericis lai-