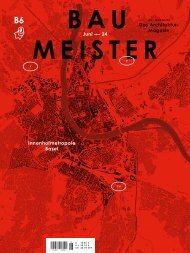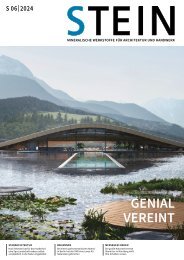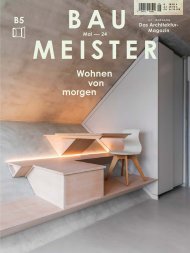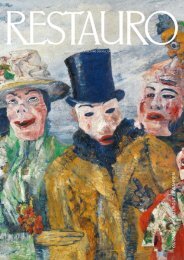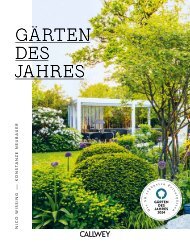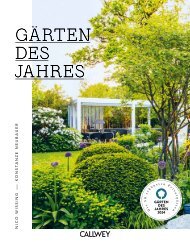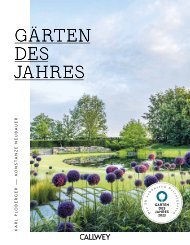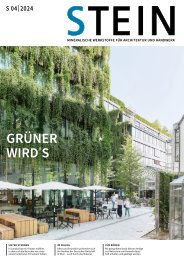Baumeister 12/2022
Anbauen
Anbauen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
A<br />
B<strong>12</strong><br />
B A U<br />
Dezember 22<br />
119. JAHRGANG<br />
Das Architektur-<br />
Magazin<br />
MEISTER<br />
Weiterbauen!<br />
<strong>12</strong><br />
D 16,50 €<br />
A,L 19 €<br />
I 19,90 €<br />
CH 2 4 S F R<br />
W<br />
I I<br />
T<br />
I<br />
E<br />
I<br />
R<br />
E<br />
U<br />
B A<br />
E<br />
N<br />
: A<br />
U<br />
F<br />
4 194673 016508<br />
II<br />
S<br />
T O C<br />
K<br />
E<br />
N<br />
•<br />
N<br />
B A<br />
U<br />
E<br />
N<br />
V O<br />
I I<br />
N<br />
E<br />
U<br />
B A<br />
U M<br />
•<br />
N
NOVEMBER<br />
DEZEMBER<br />
JANUAR<br />
BAUMEISTER SONDERSERIE: WEITERBAUEN<br />
B11/22: AUFSTOCKEN, B<strong>12</strong>/22: ANBAUEN , B1/23: UMBAUEN<br />
33% PREISVORTEIL GEGENÜBER EINZELHEFTKAUF<br />
+ CURATED AUSGABE „SAUERBRUCH HUTTON“ ALS GESCHENK<br />
SHOP.GEORG-MEDIA.DE
A<br />
Editorial<br />
Liebe Leserinnen<br />
und Leser,<br />
COVERFOTO: STEFAN MÜLLER<br />
noch immer liegen die Vorstellungen darüber,<br />
was nachhaltige Architektur ist, weit<br />
auseinander. Das fängt mit Kontroversen<br />
darüber an, ob mit „nachhaltiger“ Architektur<br />
1:1 weitergebaut werden kann wie zuvor –<br />
nur dann eben klimaschonend. Kann es ein<br />
nachhaltiges Wohnhochhaus, einen nachhaltigen<br />
Bürobau mit Tausenden von Arbeitsplätzen,<br />
einen nachhaltigen Flughafen geben?<br />
Oder verlangen solche hochkomplexen<br />
Architekturen zwingend CO2-intensive Baumethoden,<br />
die selbst durch die aufwendigsten<br />
Plus-Energie-Technologien nicht wettgemacht<br />
werden können? Die Grenzen dessen,<br />
was heutzutage mit lokalen, nachwachsenden<br />
und quasi unbegrenzt vorhandenen<br />
Baumaterialien und mit minimalem Energieeinsatz<br />
– sprich mit Holz, Lehm, Sand und<br />
Naturstein – gebaut werden kann, sind jedenfalls<br />
eng gesteckt. Und dies nicht zuletzt aus<br />
ökonomischen Gründen.<br />
Einer der wenigen Punkte, über die in der<br />
Architektenschaft (und darüber hinaus) relative<br />
Einigkeit herrscht, ist die notwen dige<br />
Konzentration auf den Bestand. Die Einsicht,<br />
dass erhalten fast immer klimaschonender<br />
ist, als neu zu bauen, führt inzwischen sogar<br />
zu der von einer breiten Allianz aus Architekten-<br />
und Umweltverbänden getragenen<br />
Forderung nach einem Abriss-Moratorium-<br />
(siehe S. 78). Eine so weitgehende Selbstbeschränkung<br />
dürfte allerdings vielen Architekturbüros<br />
ebenso wenig schmecken wie<br />
Immobilienentwicklern oder privaten Häuslebauern<br />
in spe. Und wie aufgeschlossen die<br />
Politik einem solchen Vorschlag gegenüber<br />
ist, wird sich spätestens dann zeigen, wenn<br />
im heimischen Wahlkreis Investitionsprojekte<br />
nicht genehmigt oder Neubaugebiete nicht<br />
ausgewiesen werden können.<br />
Gleichzeitig würde ein solches Moratorium<br />
wohl dazu führen, dass dort, wo die Nachfrage<br />
nach Wohn- oder Büroraum besonders hoch<br />
ist, also in den wachsenden Metropolen, der<br />
Verwertungsspielraum immer weiter ausgereizt<br />
würde. Das hätte nicht nur Folgen für<br />
Miet- und Kaufpreise. Es wäre auch eine Bedrohung<br />
für Baudenkmale und gewachsene<br />
Stadtbilder – es sei denn, der Gesetzgeber<br />
steuerte mit weitreichenden Schutzbestimmungen<br />
gegen. Bereits jetzt spricht Berlins<br />
Landesdenkmalpfleger Christoph Rauhut<br />
von der Gefahr der „Übernutzung“, die historischer<br />
Bausubstanz vielfach im Zusammenhang<br />
mit Nachverdichtungs- und Umnutzungsprojekten<br />
droht (siehe S. 10).<br />
Gleichzeitig hätte der Teil des Bestands, der<br />
in Landstrichen mit schrumpfender Bevölkerung<br />
liegt, Zuwendung oft bitter nötig. Und<br />
zwar egal, ob Denkmal oder nicht. Nutzungsstrategien<br />
für den Bestand jenseits der Großstädte<br />
müssen mit einem Abriss-Moratorium<br />
einhergehen, damit wir nicht zeitgleich den einen<br />
Teil des Bauerbes durch Übernutzung und<br />
den anderen durch Verwahrlosung verlieren.<br />
W<br />
Fabian Peters<br />
f.peters@georg-media.de<br />
I I<br />
T<br />
I<br />
E<br />
I<br />
N<br />
R<br />
E<br />
V O<br />
B A<br />
I I<br />
II<br />
@baumeister_architekturmagazin<br />
U<br />
E<br />
N<br />
N<br />
: A<br />
E<br />
U<br />
B A<br />
U<br />
F<br />
S<br />
U M<br />
T O C<br />
•<br />
K<br />
E<br />
N<br />
N<br />
•<br />
N<br />
B A<br />
U<br />
E
Weiterbauen:<br />
I B11 Aufstocken<br />
II B<strong>12</strong> Anbauen<br />
III B1 Umbauen<br />
6<br />
Einführung<br />
Ideen:<br />
Verwandlung eines Achtzigerjahre-Anbaus<br />
in das Schuhmuseum von Waalwijk S. 44<br />
18<br />
Dokumentationszentrum<br />
in Berlin<br />
30<br />
Flüchtlingsmuseum<br />
in Oksbøl<br />
Fragen:<br />
78<br />
Abriss-Moratorium:<br />
Wie viel kostet ein<br />
Gebäudewirklich<br />
?<br />
80<br />
Denkmalschutz<br />
gleich Klimaschutz:
44<br />
Schuhmuseum<br />
in Waalwijk<br />
58<br />
Josef-Albers-<br />
Museum<br />
in Bottrop<br />
je älter, desto<br />
nachhaltiger<br />
?<br />
84<br />
Wer siegt bei den<br />
„Wohnbauten<br />
des Jahres <strong>2022</strong>“<br />
?<br />
I<br />
.<br />
T E<br />
W E B S<br />
M E H R<br />
Z U M<br />
T H E M A<br />
BAU<br />
MEISTER.<br />
DE<br />
L E S E N<br />
5<br />
U N S E R E R<br />
I E<br />
S<br />
A U F<br />
68<br />
Kloster<br />
Neustift<br />
bei Brixen<br />
Schwungvoll erweitert: Flüchtlingsmuseum<br />
in Oksbøl S. 30<br />
FOTO LINKS: STIJN BOLLAERT; RECHTS: RASMUS HJORTSHØJ<br />
LÖSUNGEN<br />
88<br />
BRANCHENFEATURE:<br />
FASSADENMOSAIK<br />
92<br />
FASSADE<br />
100<br />
BAD<br />
RUBRIKEN<br />
42<br />
KLEINE WERKE<br />
56<br />
UNTERWEGS<br />
98<br />
REFERENZ<br />
107<br />
IMPRESSUM + VORSCHAU<br />
108<br />
PORTFOLIO: BAD<br />
114<br />
KOLUMNE
6 Einführung<br />
n---<br />
aue<br />
Im zweiten Teil unserer<br />
„Weiterbauen!“-<br />
Serie beschäftigen wir<br />
uns mit dem Thema
uns mit dem Thema<br />
„Anbauen“. Wir zeigen<br />
Bauten, die durch eine<br />
Erweiterung fit für<br />
die Zukunft gemacht<br />
wurden – und dabei<br />
zugleich an architektonischer<br />
Qualität<br />
gewonnen nhaben.<br />
F<br />
A U<br />
S<br />
T O C<br />
K<br />
E N<br />
•<br />
7<br />
:<br />
E N<br />
A N<br />
B A U<br />
B A U<br />
R<br />
E<br />
E N<br />
II / III<br />
T<br />
I<br />
E<br />
W<br />
E N<br />
B A U<br />
U M<br />
•
8<br />
Einführung<br />
Verloren<br />
Im Jahr 2019 entstand<br />
der „Emscherkunstweg“,<br />
für den der Künstler<br />
Julius von Bismarck gemeinsam<br />
mit der Künstlerin<br />
und Architektin<br />
Marta Dyachenko eine<br />
Installation namens<br />
„Neustadt“ schuf. Insgesamt<br />
23 Skulpturen<br />
bilden eine fiktive Stadt<br />
im Maßstab 1:25 aus<br />
verschiedenen realen<br />
Gebäuden, die seit der<br />
Jahrtausendwende<br />
im Ruhrgebiet abgerissen<br />
wurden – darunter<br />
teilweise einst gefeierte<br />
Architektur der Nachkriegsmoderne.<br />
Jetzt fordert eine Initiative<br />
von Institutionen und<br />
Personen aus der Baubranche<br />
die Politik zu<br />
einem Abriss-Moratorium<br />
auf. Mehr zum Thema<br />
auf Seite 78. Den offenen<br />
Brief und weitere Informationen<br />
sind zu finden<br />
unter:<br />
abrissmoratorium.de<br />
FOTO: EMSCHERKUNSTWEG/JULIUS VON BISMARCK, MARTA DYACHENKO
FOTO / QUELLE: VORNAME NAME
10<br />
Einführung<br />
Goldene Zeiten für<br />
Denkmale<br />
?<br />
Ein Interview<br />
mit Christoph<br />
Rauhut<br />
Brechen mit der Konzentration auf den Bestand,<br />
die allerorten ausgerufen wird, goldene Zeiten<br />
für die Denkmalpflege an? Christoph Rauhut,<br />
Landeskonservator von Berlin, bleibt skeptisch.<br />
Denn Klimaschutz und Renditeerwartungen<br />
könnten den Druck auf die historische Bausubstanz<br />
eher zu- als abnehmen lassen.<br />
FOTO: LANDESDENKMALAMT BERLIN/ANNE HERDIN
11<br />
BAUMEISTER: Gerade redet<br />
die gesamte Architektenschaft<br />
darüber, dass sich die Bautätigkeit<br />
zur Bekämpfung des<br />
Klimawandels zu einem Großteil<br />
auf den Bestand verla gern<br />
muss. Verfolgen Sie als Denkmalpfleger<br />
diesen sich abzeichnenden<br />
Paradigmenwechsel<br />
eher mit Hoffnung oder<br />
mit Sorge?<br />
CHRISTOPH RAUHUT: Beides<br />
trifft zu. Mein Eindruck ist einerseits,<br />
dass aktuell der Schutz<br />
von Objekten einfacher wird,<br />
weil man nun in der Diskussion<br />
über Abriss oder Erhalt nicht<br />
nur mit dem kulturellen, sondern<br />
auch mit den ökologischen<br />
Werten argumentieren kann.<br />
Andererseits kann man aber im<br />
Umgang mit den Objekten<br />
feststellen, dass der Druck auf<br />
den Bestand und damit auch<br />
auf die Denkmale wächst –<br />
nicht zuletzt dadurch, dass wir<br />
von unseren Gebäuden immer<br />
mehr fordern. Sie sollen in<br />
verschiedenerlei Hinsicht immer<br />
leistungsfähiger werden. Zum<br />
einen ökonomisch, etwa im<br />
Hinblick auf die Flächenausnutzung.<br />
Zum anderen aber<br />
auch ökologisch, wenn es zum<br />
Beispiel um den Energieverbrauch<br />
geht.<br />
B: Wo zeigt sich das?<br />
CR: Etwa bei den Themen Energiegewinnung<br />
und -speicherung.<br />
Das sind Themen, bei<br />
denen Denkmale zunehmend<br />
unter Druck stehen. Allerdings<br />
stellen wir fest, dass dieser<br />
Druck nicht gleichmäßig auf<br />
allen Denkmalen lastet. Es gibt<br />
zum Beispiel einen großen<br />
Unterschied zwischen städtischem<br />
und ländlichem Raum.<br />
Dort, wo Leerstand herrscht,<br />
ist die Diskussion ganz anders<br />
gelagert als in den teuren<br />
Zentren. Wenn wir in den Zentren<br />
von regenerativen Energien<br />
sprechen, bedeutet das häufig<br />
Solarenergie. Allerdings sind<br />
Photovoltaikanlagen in einer<br />
Stadt wie Berlin mit seiner<br />
Bebauung, die schwerpunktmäßig<br />
aus dem 19. und 20.<br />
Jahrhundert stammt und viele<br />
flache oder flach geneigte<br />
Dachflächen besitzt, weitaus<br />
unproblematischer als in<br />
historischen Dorfkernen. Das<br />
hilft vielen Bauten aus den<br />
Siebziger- und Achtzigerjahren,<br />
die gerade besonders gefährdet<br />
sind. Vielleicht werden<br />
wir deshalb zukünftig weniger<br />
spektakuläre Debatten über<br />
Abriss und Neubau erleben.<br />
Diese Diskussionen sind ja gerade<br />
in Berlin mit großer Anteilnahme<br />
der Öffentlichkeit<br />
gelaufen. Aber wir müssen<br />
gleichzeitig auch auf den langsamen<br />
Verlust kultureller Werte<br />
achten und diesen gezielt<br />
aufhalten oder zumindest<br />
steuern in Anbetracht der vie l-<br />
fältigen Herausforderungen.<br />
B: Nicht nur in Berlin gibt es<br />
viele Beispiele zu besichtigen,<br />
bei denen „energetische Sanierungen“<br />
dem Erscheinungsbild<br />
von Gebäuden enormen<br />
Schaden zugefügt haben.<br />
Wie agiert die Denkmalpflege<br />
in diesem Spannungsfeld?<br />
CR: Eine gute energetische<br />
Sanierung macht ein Denkmal<br />
eigentlich fit für die Zukunft<br />
und liegt insofern auch durchaus<br />
im Interesse der Denkmalpflege.<br />
Aber natürlich ist es<br />
notwendig, eine solche Sanierung<br />
fachlich zu begleiten,<br />
damit sie gelingt. Dafür gibt es<br />
bewährte Instrumente, wie<br />
etwa den Energieberater im<br />
Baudenkmal. Wir haben in<br />
Berlin Beispiele für sehr gelungene<br />
Sanierungen – etwa die<br />
Wohnanlage „Bremer Höhe“<br />
im Prenzlauer Berg. Hier wurde<br />
der Bestand aus dem 19. Jahrhundert<br />
vor etwa zehn Jahren<br />
mit Augenmaß und unter<br />
Wahrung des Denkmalwerts<br />
energetisch ertüchtigt. So<br />
etwas kann natürlich aber nur<br />
gelingen, wenn nicht die<br />
falschen Prämissen gesetzt<br />
werden. Und es gibt viele Beispiele,<br />
wo man eigentlich zu viel<br />
vom Bestand will und es deshalb<br />
dann nicht möglich ist,<br />
eine Lösung zu finden, die gut<br />
für den Bestand ist. Wichtig<br />
ist, dass man jedes Gebäude<br />
als Einzelfall betrachtet und<br />
dabei versucht, einerseits<br />
Potenziale auszuloten, aber<br />
andererseits auch bestimmte<br />
rote Linien zu ziehen.<br />
B: Wie kann ein solcher Kompromiss<br />
in der Praxis aussehen?<br />
CR: Im Moment müssen wir lernen,<br />
energetische Sanierungen<br />
umfassender zu sehen, und<br />
dabei auch über die Potenziale<br />
für regenerative Energien im<br />
Bestand sprechen. Möglicherweise<br />
stellt eine Solaranlage<br />
auf dem Dach die Möglichkeit<br />
dar, Maßnahmen an der Fassade<br />
überflüssig zu machen.<br />
Bei den WDV-Systemen sind wir<br />
auch deshalb oft in eine Falle<br />
gelaufen, weil wir keine Einzelfallüberlegungen<br />
gemacht<br />
haben. Zumindest der denkmalgeschützte<br />
Bestand braucht<br />
dies aber, um zu überleben.<br />
B: Nachverdichtung ist ein<br />
wichtiges Schlagwort, wenn es<br />
um das Schaffen neuen Wohnraums<br />
in den begehrten Innenstadtlagen<br />
geht. Vor welche<br />
Herausforderungen stellt das<br />
die Denkmalpflege?<br />
CR: In Berlin betrifft diese Diskussion<br />
inzwischen nicht mehr<br />
nur die innerstädtischen Lagen<br />
innerhalb des S-Bahn-Rings,<br />
sondern auch architekturhistorisch<br />
bedeutsame Ensembles<br />
in den Randbereichen<br />
wie etwa die Siemensstadt<br />
oder die AEG-Bauten von Peter<br />
Behrens in Oberschöneweide.<br />
Die schwierigsten Fälle sind<br />
dabei diejenigen, bei denen es<br />
auch um Umnutzungen geht.<br />
Nicht selten sollen die Gebäude<br />
dann nämlich aus ökonomischen<br />
Gründen „übernutzt“<br />
WEITER
18<br />
1931<br />
Auf den ersten Blick<br />
unverändert: Dabei<br />
bleiben dem Eckhaus<br />
am Berliner Askanischen<br />
Platz vom ursprünglich<br />
quadratischen<br />
Grundriss nur<br />
diese beiden Straßenfassaden<br />
und eine<br />
schmale Raumschicht.<br />
Heutiger Nutzer des<br />
„Deutschlandhauses“<br />
ist das „Dokumentationszentrum<br />
für<br />
Flucht, Vertreibung,<br />
Versöhnung“.<br />
FOTO LINKS: ARCHIV ADB EWERIEN UND OBERMANN; RECHTS: ROLAND HORN
Ideen<br />
19<br />
— 2021
20<br />
Ideen<br />
Wunder-<br />
höhle<br />
hinter<br />
Architekten:<br />
Marte.Marte<br />
Text:<br />
Florian Heilmeyer<br />
Fotos:<br />
Roland Horn<br />
historischem<br />
Kleid<br />
E N<br />
B A U<br />
:<br />
F<br />
A U<br />
S<br />
T O C<br />
K<br />
E N<br />
•<br />
A N<br />
B A U<br />
R<br />
E<br />
E N<br />
T<br />
I<br />
E<br />
W<br />
•<br />
Mitten in Berlin machen<br />
Marte.Marte Architekten<br />
einen radikalen Schnitt<br />
und nehmen damit dem<br />
historischen „Deutschlandhaus“<br />
fast alle Innen-<br />
E N<br />
B A U<br />
U M
landhaus“ fast alle Innen<br />
räume. Nur zur Straße<br />
bleiben dem Eckhaus zwei<br />
Fassaden und dahinter<br />
eine alte Raumachse –<br />
dahinter beginnt der Neubau.<br />
Und was für einer!<br />
21<br />
Der Eingriff ist von außen kaum zu sehen. Steht<br />
man an der Portalruine des Anhalter Bahnhofs<br />
mitten in Berlin und blickt über die große Straßenkreuzung<br />
zum sogenannten „Deutschlandhaus“,<br />
dann sieht dieses heute völlig unverändert aus.<br />
Doch was für aufgeregte Diskussionen hatte es<br />
gegeben um die Umnutzung dieses unauffälligen,<br />
sachlich-modernen Bürohauses als „Dokumentationszentrum<br />
Flucht, Vertreibung, Versöhnung“!<br />
Schon dieser komplexe Name zeugt<br />
davon, wie es jahrzehntelang hin und her ging:<br />
um Sinn und Zweck und den richtigen Ort für ein<br />
Museum, das lange den Geruch der Ewiggestrigen<br />
an sich hatte.<br />
Komplexe Entstehungsgeschichte<br />
Wer verstehen will, wie genial der Entwurf der<br />
österreichischen Architektenbrüder Bernhard<br />
und Stefan Marte ist, der muss die lange Vorgeschichte<br />
dieses Projekts kennen. Denn was heute<br />
als „Deutschlandhaus“ unter Denkmalschutz<br />
steht, war ursprünglich nur ein eher unscheinbarer<br />
Seitenflügel des benachbarten, zwölfgeschossigen<br />
„Europahauses“, das in Sichtweite des<br />
damals rauschhaften Potsdamer Platzes und<br />
nach Entwürfen von Richard Bielenberg und Josef<br />
Moser 1926 bis 1931 am Askanischen Platz errichtet<br />
wurde. Dem Hochhaus hatten Bielenberg und<br />
Moser zwei Seitengebäude im Norden und Süden<br />
zur Seite gestellt. Auf annähernd quadratischem<br />
Grundriss (50 auf 51,5 Meter) verrieten nur die<br />
übergroßen Schaufenster im Erdgeschoss, dass es<br />
sich auch bei den wuchtigen Seitengebäuden im<br />
Kern um filigrane Stahlskelettbauten handelte.<br />
Bielenberg und Moser waren Profis im Bürohausbau<br />
ihrer Zeit, sie entwarfen nach den Wünschen<br />
der Bauherren. Modisch sind alleine die kräftigen<br />
Eckpfeiler und die über die weiße Putzfassade<br />
verstreuten Elemente aus rotem Porphyr, die aber<br />
an keiner Stelle den Wiederverkaufswert des<br />
Gebäudes infrage stellten. Bekannt wurde das<br />
Europahaus dann auch weniger wegen seiner<br />
Architektur, sondern aufgrund der beliebten Vergnügungsgelegenheiten<br />
im Inneren – Kino, Restaurants<br />
und Tanzsäle – sowie wegen der gewaltigen<br />
Leuchtreklamen, die zum Sinnbild des flirrenden<br />
Berliner Nachtlebens in den letzten Tagen der<br />
Weimarer Republik wurden.<br />
Zum Ende des Zweiten Weltkriegs wurde das<br />
Europahaus schwer beschädigt. Der Nordflügel<br />
wurde ganz abgerissen, Hochhaus und Südflügel<br />
blieben bis Ende der 1950er-Jahre Ruinen. Statt<br />
neuer Vergnügungen zog schließlich das Fernmeldeamt<br />
der Deutschen Post in das Hochhaus,<br />
dann wurde direkt dahinter die Mauer gebaut,<br />
und die ganze Gegend versank im West-Berliner<br />
Dornröschenschlaf. Irgendwie passend, dass die<br />
Bundesregierung den Südflügel zum „Haus der<br />
ostdeutschen Heimat“ erklärte und es dem Bund<br />
der Vertriebenen als Büro zur Verfügung stellte.<br />
Hier träumte man gemeinsam von der Rückgewinnung<br />
Pommerns, Schlesiens und Bessarabiens<br />
und wetterte gegen die Oder-Neiße-Grenze.<br />
Natürlich waren nicht alle Vertriebenen alte Nazis,<br />
jedoch machte sich der Bund der Vertriebenen<br />
immer wieder für revanchistische oder schlicht<br />
rechtsextreme Positionen stark – und es war<br />
dieser Bund, der 1974 schließlich den Schriftzug<br />
„Deutschlandhaus“ über die Tür hängen ließ und<br />
damit ganz sicher kein Deutschland meinte, das<br />
„nur“ bis zur Oder reichte.<br />
Und es war ebenfalls dieser Bund, der noch 1999 –<br />
als klar wurde, dass er das Deutschlandhaus würde<br />
verlassen müssen – ein erstes Konzept für ein<br />
„Zentrum gegen Vertreibungen“ präsentierte, mit<br />
dem aus dem Deutschlandhaus ein Museum über<br />
die Vertreibungen deutscher Zivilisten während<br />
und nach dem Weltkrieg werden sollte. Dieses<br />
Konzept stieß auf breite Kritik und löste jahre-<br />
WEITER
FOTO OBEN: MIRJAM BLEEKER; UNTEN: SWEETS HOTEL
Unterwegs im …<br />
57<br />
Sweets Hotel<br />
Amsterdam<br />
Ein außergewöhnliches Hotelkonzept wurde in Amsterdam verwirklicht.<br />
Die ortsansässigen Architekten Space & Matter haben<br />
28 teilweise historische Kanalwärterhäuschen saniert, die über<br />
die Stadt verstreut sind. Unser Autor übernachtete in einem Haus<br />
von 1969 an der „Meeuwenplein“-Brücke.<br />
Die Kulturmanagerin Suzanne Oxenaar eröffnete<br />
vor Jahren in Amsterdams Östlichem Hafengebiet<br />
das Lloyds Hotel. Das Gebäude, in dem einst osteuropäische<br />
Juden auf ihre Schiffsreise ins amerikanische<br />
Exil gewartet hatten, bevor dort die<br />
Gestapo einzog, wurde von MVRDV großzügig zu<br />
einem einzigartigen Hotel umgebaut. Oxenaar<br />
hatte wenig später das Konzept für ein Designhotel<br />
am touristischen Damrak abgewandelt. Doch der<br />
Paukenschlag sollte danach kommen.<br />
Vor etwas über zehn Jahren wurde bekannt, dass<br />
der Personalbetrieb in den Amsterdamer Brückenhäuschen<br />
eingestellt wird, da die Hafenverwaltung<br />
die Kanalschleusen künftig<br />
durch eine digitale Steuerung ersetzen<br />
wollte. Damit standen plötzlich 28 Wärterhäuschen<br />
zwischen dem Süden und<br />
Norden der Stadt leer. Gebaut wurden<br />
die Unikate, bis heute von den Amsterdamern<br />
kaum beachtet, von 1673 bis<br />
2009 in unterschiedlichen Stilen – sogar<br />
von bekannten Architekten wie Berlage<br />
und van Eyck. Für Oxenaar war die Umstellung<br />
die einzigartige Chance, ihr ungewöhnliches<br />
Hotelkonzept auf eine Klientel auszuweiten,<br />
die neue Erfahrungen sucht und die nötigen<br />
Ausgaben nicht scheut. Auf jeden Fall ließ sich<br />
die Kulturmanagerin auf ein ehrgeiziges und wagemutiges<br />
Projekt ein. Für die Sanierung und den Umbau<br />
der Brückenhäuser gewann sie das Amsterdamer<br />
Büro Space & Matter.<br />
Der Umbau der Häuser, deren Äußeres erhalten<br />
bleiben sollte, stellte ganz besondere Herausforderungen<br />
dar. Am Beispiel des „Bridge House<br />
Meeuwenpleinbrug“, von Dirk Sterenberg 1969 am<br />
Nord-Holland-Kanal errichtet, lässt sich nachvollziehen,<br />
wie Space & Matter mit der beengten Arbeitsfläche<br />
umging, um sie in ein mehr oder weniger<br />
behagliches Hotelzimmer zu verwandeln. Das<br />
Sterenberg-Häuschen fasziniert durch die moderne<br />
Eleganz einer über dem Kanal schwebenden weißen<br />
Kiste. Elegant ist auch das Entree, geschützt<br />
PREISE<br />
Aufenthalt<br />
ab<br />
<strong>12</strong>5 Euro<br />
pro Nacht<br />
durch das auskragende Dach sowie das Fensterband,<br />
das den Blick hinaus auf den Kanal und den<br />
Noorderpark lenkt. Zu Recht gilt das Wärterhaus mit<br />
seiner klaren Betonkonstruktion als ein gelungenes<br />
Beispiel des niederländischen Strukturalismus.<br />
Aber: Wer für eine Übernachtung zwischen <strong>12</strong>5 Euro<br />
und 290 Euro bezahlen will, sollte wissen, worauf er<br />
sich einlässt.<br />
Denn die Ausstattung ist, gemessen an durchschnittlichen<br />
Hotelzimmern, gelinde gesagt,<br />
grenzwertig. Man kann sich kaum vorstellen, dass<br />
dieser Raum im Normalfall ausreichend Platz für<br />
zwei Personen bietet. Gespart wurde an<br />
allen Ecken und Kanten. Entstanden ist<br />
eine minimalistische Raumökonomie, in<br />
der sich kaum die nötigsten Mitbringsel<br />
verstauen lassen. Die Trennwand zwischen<br />
Bad und Flur wurde aufgeschnitten,<br />
um im Zwischenraum Spiegel und<br />
Waschbecken unterzubringen. Wer in<br />
diesem Fall an Funktionalität denkt,<br />
muss schon recht fantasiebegabt sein.<br />
Und die Dusche? Weil die verschiebbare<br />
Duschtür eingespart wurde, tritt man<br />
nach dem Duschen auf Holzdielen und greift zum<br />
Wasserschieber, um den nassen Boden aufzuwischen.<br />
Eine weitere Kuriosität im Bad: eine Packung<br />
Ohropax. Die erweist sich angesichts des Lärms auf<br />
der vierspurigen Meeuwenpleinbrug als notwendige<br />
Bereicherung. Doch das Problem: Ohropax<br />
versagt leider bei den vibrierenden Betondecken<br />
der Brücke. Selbst die optimierte digitale Ausstattung<br />
macht die räumlichen Mängel nicht vergessen.<br />
Der Frühstücks-Service wurde, trotz des üppigen<br />
Preises, offenbar ein Opfer der Coronakrise.<br />
Auch daran sollte man denken. Dafür stand pünktlich<br />
um elf Uhr die lächelnde Reinigungskraft mit<br />
einem blauen Müllsack vor der Tür.<br />
Sweets Hotel „Meeuwenpleinbrug“<br />
Johan van Hasseltweg 150<br />
www.sweetshotel.amsterdam<br />
Text Klaus Englert