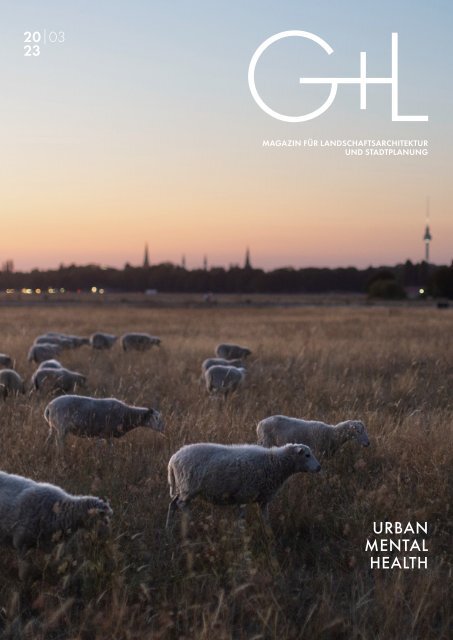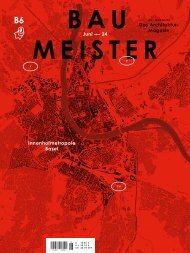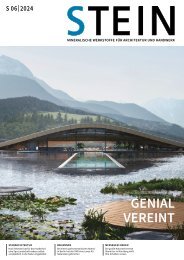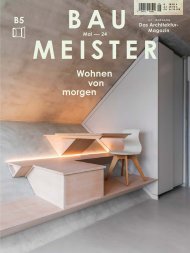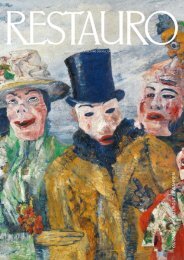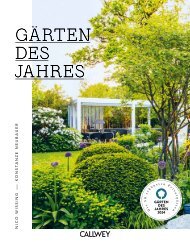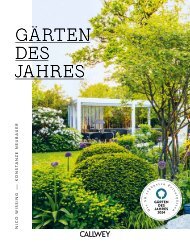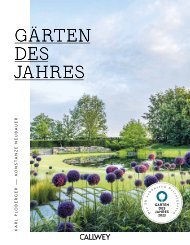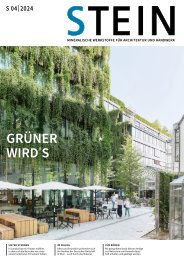G+L 03/2023
Urban Mental Health
Urban Mental Health
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
20|<strong>03</strong><br />
23<br />
MAGAZIN FÜR LANDSCHAFTSARCHITEKTUR<br />
UND STADTPLANUNG<br />
URBAN<br />
MENTAL<br />
HEALTH
EDITORIAL<br />
Vom Tempelhofer Feld in Berlin heben keine<br />
Flugzeuge mehr ab; stattdessen grasen dort<br />
Schafe. Dieser Raum kommt Psychotherapeutin<br />
und Berlinerin Nora Dietrich in den<br />
Sinn, wenn sie an einen „gesunden“ Ort in<br />
der Stadt denkt. Mehr zu ihren Gedanken<br />
ab Seite 14.<br />
Ab Seite 32: Wer an<br />
Einsamkeit leidet und<br />
warum das ein<br />
Problem ist.<br />
Das Leben in der Stadt birgt ein deutlich erhöhtes Risiko für<br />
psychische Krankheiten gegenüber dem Leben auf dem Land.<br />
Erschreckend viele Studien bestätigen das. Welche Maßnahmen<br />
aber die mentale Gesundheit von Stadtbewohner*innen stärken,<br />
dazu gibt es wenig Wissen. Gleichzeitig hält sich die Zahl derer,<br />
die in dem Bereich der „Urban Mental Health“ forschen und<br />
arbeiten, ziemlich in Grenzen. Um Licht ins Dunkel zu bringen,<br />
appellieren diese sogenannten Stressforscher*innen für die<br />
verstärkte Zusammenarbeit zwischen Stadtforschung, Medizin<br />
und Neurowissenschaften.<br />
In dem vorliegenden Heft machen wir den Faktencheck. Wir<br />
wollen wissen, was der aktuelle Forschungsstand sagt und<br />
welche Verantwortung die Stadtgestalt im Bereich der urbanen<br />
mentalen Gesundheit wirklich trägt. Hierzu haben wir Nora<br />
Dietrich, Psychotherapeutin und Expertin für mentale Gesundheit<br />
am Arbeitsplatz aus Berlin, um einen Beitrag gebeten. Die<br />
Wiener Psychologin Shanti Hetz erläutert wiederum, warum<br />
Einsamkeit eine so große Gefahr für viele Städter*innen darstellt<br />
und welche Präventionsarbeit hierbei Landschaftsarchitektur<br />
übernehmen kann. Journalistin und Landschaftsarchitektin Julia<br />
Treichel stellt zudem fünf Akteur*innen vor, die bereits in dem<br />
jungen Forschungsfeld tätig sind; darunter natürlich auch Mazda<br />
Adli, Psychiater und Stressforscher. Mit seinem Buch „Stress<br />
and the City“ brachte der Arzt der Berliner Charité das Thema<br />
der urbanen mentalen Gesundheit erstmals groß in die<br />
deutschen Medien.<br />
Das Thema der urbanen mentalen Gesundheit ist auf den ersten<br />
Blick kein klassisch planerisches. Aber es zeigt drastisch auf,<br />
welche gesellschaftliche Bedeutung heute der interdisziplinären<br />
Zusammenarbeit zukommt, und gleichzeitig die Rolle, die dabei<br />
Landschaftsarchitekt*innen und Stadtplaner*innen einnehmen<br />
müssen. Wir planen Räume für Menschen. Was aber, wenn<br />
diese in den von uns entwickelten Städten immer kränker und<br />
kränker werden? Gesundheit ist und bleibt schließlich unser<br />
höchstes Gut.<br />
Den Beitrag lesen<br />
Sie auf Seite 14.<br />
Das Porträt finden<br />
Sie auf Seite 19.<br />
Coverbild: Raphael Wild via Unsplash; Illustration: Laura Celine Heinemann<br />
THERESA RAMISCH<br />
CHEFREDAKTION<br />
t.ramisch@georg-media.de<br />
<strong>G+L</strong> 3
INHALT<br />
AKTUELLES<br />
06 SNAPSHOTS<br />
10 NEWS<br />
11 MOMENTAUFNAHME<br />
Übergangszone<br />
URBAN MENTAL HEALTH<br />
12 WELCHE BEDEUTUNG HAT URBAN MENTAL HEALTH?<br />
Heftfrage<br />
14 ZWISCHEN BURN-OUT UND YOGAMATTE<br />
Wie es um die mentale Gesundheit in unseren Städten steht<br />
18 DIE PIONIER*INNEN<br />
Wer es sich zur Aufgabe gemacht hat, Stadtstress zu erforschen<br />
24 UNDER PRESSURE<br />
Wie wirkt sich immer höherer Leistungsdruck auf uns aus?<br />
26 THERAPIE: GRÜN UND BLAU<br />
Der Einfluss von Grün- und Blauräumen auf mentale Gesundheit<br />
32 DIAGNOSE: EINSAMKEIT<br />
Was Einsamkeit mit uns macht und was wir dagegen tun können<br />
36 KÖRPER VS. COUCH<br />
Wie Sport und Stadt, Bewegung und mentale Gesundheit zusammenhängen<br />
42 BEFUND: KLIMAANGST<br />
Was Natur und Landschaftsgestaltung zur Bewältigung beitragen können<br />
46 WIR BRAUCHEN DAS SPIEL WIE DIE LUFT ZUM ATMEN.<br />
Appell des Stuttgarter Planungsbüros KuKuk Freiflug<br />
PRODUKTE<br />
Herausgeber:<br />
Deutsche Gesellschaft<br />
für Gartenkunst und<br />
Landschaftskultur e.V.<br />
(DGGL)<br />
Pariser Platz 6<br />
Allianz Forum<br />
10117 Berlin-Mitte<br />
www.dggl.org<br />
50 LÖSUNGEN<br />
Spielräume<br />
58 REFERENZ<br />
Historie neu interpretiert<br />
60 REFERENZ<br />
Bande geknüpft<br />
RUBRIKEN<br />
62 Impressum<br />
62 Lieferquellen<br />
63 Stellenmarkt<br />
64 DGGL<br />
66 Sichtachse<br />
66 Vorschau<br />
<strong>G+L</strong> 5
SNAPSHOTS<br />
LAURA PUTTKAMER ÜBER DAS …<br />
KUNSTPROJEKT FÜR ROZELLE BAY<br />
In Sydney entsteht über drei Abluftkaminen ein<br />
neues Projekt von Studio Chris Fox, das die Türme<br />
in die Parklandschaft integrieren soll.<br />
AUTORIN<br />
Laura Puttkamer ist<br />
freiberufliche<br />
Journalistin und<br />
beratend im Bereich<br />
partizipative<br />
Stadtplanung tätig.<br />
Sie lebt in London<br />
und bloggt auf<br />
parcitypatory.org.<br />
Die Rozelle Bay in Sydney bestand einst<br />
aus einem diversen Ökosystem mit<br />
Wattenmeer und Mangrovenwäldern. In<br />
den letzten Jahrhunderten entwickelte sich<br />
die Bucht zu einem industriellen Zentrum<br />
mit maritimer Nutzung und Bahnlinien.<br />
Entsprechend musste die Natur größtenteils<br />
weichen. Ein neues Projekt des Studios<br />
Chris Fox möchte dies ändern: Mit einem<br />
in die Landschaft integrierten Projekt aus<br />
drei Monolithen soll ein lebendiges System<br />
entstehen. Diese Monolithe verstecken ein<br />
Trio bestehender Abluftkamine über der<br />
Rozelle Interchange.<br />
Die drei Türme haben eine modulierte<br />
Zinkverkleidung und eine gewundene<br />
Stahlstruktur. Damit nehmen sie Bezug auf<br />
die turbulente Luftströmung der Anlage<br />
sowie auf die räumlichen Bewegungen im<br />
unterirdischen Straßennetz unter Rozelle<br />
Bay. Sie sind jeweils von einem lebendigen,<br />
grünen System umgeben, das Brücken<br />
für Fußgänger*innen und Radfahrende<br />
bietet. Grüne Wandmodule integrieren<br />
die Türme in die Parklandschaft. Zudem<br />
verwandeln sie die Infrastruktur in einen<br />
Lebensraum für urbane Biodiversität.<br />
Der Bau auf dem Land der indigenen<br />
Gruppen Gadigal und Wangal polarisiert<br />
Sydney. Denn die ambitionierten Skulpturen<br />
betonen die großen Abluftkamine von<br />
Rozelle Bay weiter. Sie greifen zwar die<br />
früheren Ökosysteme auf, verschönern<br />
aber letztendlich große Rohre,<br />
die Abgase in die Luft pumpen.<br />
Seit 2019 entstehen die drei großen<br />
Monolithen, die das Studio Chris Fox nun<br />
verschönert. An dieser Stelle trifft die<br />
WestConnex-Autobahn auf die Anzac<br />
Bridge. Hier entsteht eine neue unterirdische<br />
Verkehrsführung, die wichtig für Sydneys<br />
Straßennetzwerk ist. Die bereits existierenden<br />
Kamine sind 40 Meter hoch und sind<br />
schon jetzt Teil der Skyline der Stadt.<br />
„Ich wusste, dass dies eine anspruchsvolle<br />
Aufgabe sein würde“, sagt Architekt<br />
Chris Fox. „Die Stadt muss funktionieren,<br />
und die Infrastruktur ist Teil dieser Funktionalität.<br />
Aber genau wie die Menschen<br />
braucht die Stadt mehr als nur ihre<br />
Grundfunktionalität, um erfüllt zu werden.<br />
Momente der Neugier und des Staunens<br />
geben der Stadt ein eigenes Leben – sie<br />
sind es wert, dass man sie besucht und<br />
sich mit ihr beschäftigt.“<br />
Dies ist seine Antwort auf die Skepsis, was<br />
die „Verschönerung einer Monstrosität“<br />
angeht. Er erklärt, dass der Entwurf eine<br />
Zukunft visualisiert, in der die Infrastruktur<br />
bereits eine Ruine ist und von der Natur<br />
zurückerobert wurde. Die spezielle<br />
Verkleidung der Türme soll die Aufmerksamkeit<br />
auf den geometrischen Kontrast<br />
legen. Grün wird auf den Oberflächen<br />
der Türme wachsen und eine von Bäumen<br />
und Sträuchern gesäumte Fußgängerbrücke<br />
wird den Fußverkehr über Rozelle<br />
Interchange leiten. Diese grüne Attraktion<br />
soll sowohl Einheimische als auch<br />
Tourist*innen anziehen.<br />
Der Bau des Kunstprojekts hat bereits<br />
begonnen: Erste Pflanzen sind am<br />
östlichsten Turm zu erkennen. Bis Ende<br />
<strong>2023</strong> könnte es abgeschlossen sein.<br />
Rendering: Studio Chris Fox<br />
6 <strong>G+L</strong>
AKTUELLES<br />
SNAPSHOTS<br />
ANNA MARTIN ÜBER DIE …<br />
GÄRTEN DES JAHRES <strong>2023</strong><br />
AUTORIN<br />
Anna Martin<br />
studierte Kunstgeschichte<br />
in<br />
München. Sie ist<br />
Editorial Trainee<br />
bei Georg Media.<br />
Foto: Jochen Braband Photography<br />
Die Gewinner*innen des Wettbewerbs<br />
„Gärten des Jahres <strong>2023</strong>“ stehen fest.<br />
Zum achten Mal lobte der Münchner<br />
Callwey Verlag mit der <strong>G+L</strong> und weiteren<br />
Partner*innen den Wettbewerb im<br />
vergangenen Jahr aus. Dieser richtet sich<br />
zum einen an Landschaftsarchitekt*innen,<br />
Garten- und Landschaftsbauer*innen aus<br />
dem deutschsprachigen Raum. Sie<br />
konnten bis Juli private Gartenprojekte<br />
einreichen. Zum anderen konnten sich<br />
Hersteller*innen aus der Branche bis<br />
November mit Produkten für die „Lösungen<br />
des Jahres“ bewerben. Am 14. Februar<br />
fand nun die Preisverleihung auf<br />
Schloss Dyck nahe Düsseldorf statt.<br />
Aus den eingereichten Privatgärten<br />
wählte eine Jury aus Expert*innen<br />
50 Projekte aus. Unter diesen vergaben<br />
sie einen mit 5 000 Euro dotierten ersten<br />
Preis sowie vier Anerkennungen. Gärten<br />
als erweiterter Wohn- und Genussraum,<br />
und das individuell umgesetzt – auf<br />
ganzheitliche Konzepte, die das erreichen,<br />
achtete die Jury. Dahinter soll<br />
zudem eine starke Idee stehen.<br />
Den ersten Preis erhielt das Büro Feldmann<br />
Gartenarchitektur für das Projekt<br />
„Erlebnisraum Garten“ in Bensheim an<br />
der Bergstraße. Der Garten gehört zu<br />
einer historischen Villa. Beide sind am<br />
Hang gelegen, umgeben von Wäldern.<br />
Landschaftsarchitekt Christoph Feldmann<br />
wollte mit der Gestaltung unter anderem<br />
den Garten in die umliegende Landschaft<br />
einfügen. Er und sein Team errichteten<br />
Trockenmauern – aus geböschten Flächen<br />
entstanden so mehrere Ebenen. Verschiedene<br />
Räume des Gartens sollen unterschiedliche<br />
Atmosphären vermitteln. Auf<br />
der einen Ebene befindet sich ein Pool,<br />
Auf einer der Ebenen des Gartens in Bensheim, den das Büro Feldmann Gartenarchitektur gestaltete, sitzt<br />
man unter alten Birnbäumen. Das Projekt erhielt den ersten Preis im Wettbewerb „Gärten des Jahres <strong>2023</strong>“.<br />
umgeben von Rasenfläche. Auf einer<br />
anderen stehen ein Feuerring, Hochbeete<br />
und ein Gewächshaus. An anderer Stelle<br />
sitzt man unter alten Birnenbäumen, die<br />
aus einer Obstplantage stammen. Die<br />
Planer*innen ergänzten vorhandenen<br />
Baumbestand um weitere Großbäume,<br />
worauf Thomas Banzhaf, Vizepräsident<br />
des BGL, in seiner Laudatio zum Preisträger<br />
lobend eingeht. Weiter schreibt er: „In<br />
höchster Ausführungsqualität ist hier ein<br />
Landhausgarten entstanden, der einen<br />
wirklichen Gegenpol zum Leben in einer<br />
Metropole darstellt – fernab von einer<br />
durch Beton, Straßen und Autos geprägten<br />
digitalen Welt.“<br />
Die Jury zeichnete vier weitere Büros mit<br />
Anerkennungen aus. Darunter ist etwa<br />
„Die Erschaffung aus dem Nichts“ von<br />
Petra Hirsch Gartenplanung. Der parkartige<br />
Garten entstand über 25 Jahre hinweg<br />
aus einer ehemaligen landwirtschaftlichen<br />
Nutzfläche. Und mit „Begrünt mehr<br />
Dächer!“ in Berlin von Potsdamer Gartengestaltung<br />
GmbH erhielt ein Gründach<br />
eine Anerkennung.<br />
Für die „Lösungen des Jahres“, nun zum<br />
fünften Mal vergeben, bestand die Jury<br />
aus Fach-Redakteuren aus dem Bereich<br />
Landschaftsarchitektur und Gartengestaltung.<br />
Sie wählten zehn Produkte in<br />
mehreren Kategorien zum Thema Gartengestaltung,<br />
darunter etwa Gartenhäuser,<br />
Bodenbelag oder Gartengeräte. Über<br />
den ersten Preis entschied ein öffentliches<br />
Onlinevoting: Dieses Jahr geht er an die<br />
Pflanzenreich App von Landschaftsarchitektin<br />
Petra Pelz. Mit der App soll es einfacher<br />
sein, die richtigen Pflanzen für eine<br />
bestimmte Gartensituation zu finden. Und<br />
nicht nur Privatgärten und Produkte<br />
erhielten Würdigungen: Mit einem<br />
Fotografiepreis wird Ferdinand Graf<br />
Luckner bereits zum zweiten Mal für sein<br />
fotografisches Schaffen geehrt.<br />
Die begleitende Publikation stellt die 50<br />
Gärten des Jahres <strong>2023</strong> sowie die ausgezeichneten<br />
Lösungen vor. Mit Farbabbildungen<br />
und Gartenplänen, Details zu<br />
Grundstücken und Konzepten, Materialien<br />
und Pflanzen vermitteln die Gartenporträts<br />
die Vielfalt der ausgewählten Gärten. Alle<br />
50 Gärten, die ausgezeichneten Lösungen<br />
und den Fotografiepreis kann man zudem<br />
bis zum 2. April in einer Ausstellung auf<br />
Schloss Dyck sehen.<br />
<strong>G+L</strong> 7
„GUTEN<br />
MORGEN<br />
BERLIN, DU<br />
KANNST SO<br />
HÄSSLICH SEIN,<br />
SO DRECKIG<br />
UND GRAU…“<br />
PETER FOX<br />
14 <strong>G+L</strong>
URBAN MENTAL HEALTH<br />
LEITARTIKEL: ZWISCHEN BURN-OUT UND YOGAMATTE<br />
ZWISCHEN<br />
BURN-OUT UND<br />
YOGAMATTE<br />
Das Paradoxon „Stadt“ – Asphaltwüste oder hippe Metropole? Gestresste Städter*innen oder<br />
selbst erfüllte Kosmopolit*innen? Die Forschung zeigt: Die Stadt ist Heimat für alles und jedes<br />
Gefühl. Sie ist vielseitig, ihr Erleben hochindividuell – und birgt gleichzeitig eine erhöhte Gefahr<br />
für die mentale Gesundheit. Wie es um die mentale Gesundheit in unseren Städten steht und was<br />
es für eine gesunde Stadtplanung braucht.<br />
NORA DIETRICH<br />
AUTORIN<br />
Nora Dietrich ist<br />
Psychotherapeutin<br />
und Expertin für<br />
mentale Gesundheit<br />
am Arbeitsplatz. Sie<br />
glaubt, dass es<br />
längst überfällig ist,<br />
mit verstaubten<br />
Tabus zu brechen<br />
und eine Zukunft<br />
mitzugestalten, die<br />
vor allem eins ist:<br />
gesund. Als<br />
Organisationsdesignerin<br />
und<br />
Speakerin (unter<br />
anderem für das<br />
Zukunftsinstitut)<br />
kombiniert sie ihr<br />
Wissen über die<br />
Komplexität der<br />
menschlichen<br />
Psyche mit den<br />
Trends in der<br />
New-Work-Welt<br />
und macht so<br />
Psychologie wieder<br />
salonfähig.<br />
Die gute Nachricht ist: Noch nie waren<br />
unsere Städte der westlichen Welt so<br />
gesund, grün und sauber wie heute.<br />
Gleichzeitig zeigen die neuesten Erkenntnisse<br />
der Forschung rund um Prof. Mazda<br />
Adli von der Berliner Charité und Prof.<br />
Andreas Meyer-Lindenberg vom Zentralinstitut<br />
für Seelische Gesundheit in<br />
Mannheim: Das Aufwachsen und Leben<br />
in der Stadt kann sich negativ auf unsere<br />
mentale Gesundheit auswirken. Das Risiko,<br />
an einer Depression zu erkranken, ist etwa<br />
1,4-mal so hoch, das Schizophrenie-<br />
Risiko etwa doppelt so groß, und die<br />
Wahrscheinlichkeit, an einer Angststörung<br />
zu erkranken, liegt 21 Prozent höher als<br />
auf dem Land.<br />
EINSAM UNTER VIELEN. NEBENEINAN-<br />
DER STATT MITEINANDER.<br />
Das Risiko für psychische Erkrankungen<br />
führt Prof. Adli auf das erhöhte soziale<br />
Stresserleben zurück, auch als „Social<br />
Stress“ bekannt. „Social Stress“ definiert<br />
er als die paradoxe Kombination aus<br />
sozialer Dichte und sozialer Isolation: zu<br />
viele Menschen auf engem Raum, die in<br />
keinerlei Verbindung zueinander stehen.<br />
Einen weiteren Grund sieht die Forschung<br />
in der Veränderung der Amygdala – dem<br />
emotionalen Teil unseres Gehirns –, die bei<br />
Städter*innen deutlich aktiver ist. Die<br />
Reizflut in der Stadt führt dazu, dass wir<br />
unsere Umwelt kontinuierlich und überproportional<br />
häufig auf mögliche Bedrohungsreize<br />
scannen, und davon gibt es dank<br />
Verkehr, Dichte und Lärm deutlich mehr als<br />
auf dem Land. Wir sind also immer, wenn<br />
auch unbewusst, in Alarmbereitschaft. Um<br />
der Überstimulierung zu entfliehen und uns<br />
aufzuladen, ziehen wir uns zurück.<br />
EIN TEUFELSKREIS<br />
Die Stadtplanung der Zukunft muss sich<br />
also fragen: Wie schaffen wir die Balance<br />
zwischen echter sozialer Interaktion und<br />
regenerativen Rückzugsmöglichkeiten?<br />
Doch bedeutet das, dass „Stadt“<br />
grundsätzlich ungesund ist?<br />
Zum Glück nicht. Denn mentale Gesundheit<br />
ist viel mehr als das Fehlen einer<br />
psychischen Erkrankung. Sie ist ein<br />
Zustand des Wohlbefindens, in dem jeder<br />
von uns in der Lage ist, sein volles<br />
Potenzial zu nutzen, die normalen<br />
<strong>G+L</strong> 15
DIE PIONIER*INNEN<br />
Die Forschung an Stadtstress ist Pionierarbeit. Die Gruppe an Personen, die es sich zur Aufgabe<br />
gemacht haben, das Phänomen zu untersuchen, ist noch recht überschaubar. In Forschungsberichten<br />
und auf Symposien tragen sie ihre Erkenntnisse in die Welt. Hierdurch werden die<br />
interdisziplinären Netzwerke, in denen sie agieren, zukünftig idealerweise an Gehör und Zulauf<br />
gewinnen. Ihre Themenfelder betreffen letztlich einen Großteil der Menschheit. Hier stellen wir<br />
ein paar der Pionier*innen vor.<br />
JULIA TREICHEL<br />
UD/MH – LAYLA MCCAY<br />
„Cities are associated with higher rates of most mental health<br />
problems compared to rural areas: an almost 40% higher risk<br />
of depression, over 20% more anxiety, and double the risk of<br />
schizophrenia, in addition to more loneliness, isolation and<br />
stress“ – das stellten die Professorin und Psychiaterin Layla<br />
McCay und ihre Mitstreiter*innen schon 2015 fest. Sie riefen<br />
daraufhin das Centre for Urban Design and Mental Health<br />
(UD/MH) ins Leben.<br />
Der Think Tank hat sich zusammengefunden, um die elementare<br />
Frage zu klären: Wie können Städte so gestaltet werden, dass<br />
sie besser auf die mentale Gesundheit einwirken? Dazu versucht<br />
UD/MH den Wissensstand zum Thema – und vor allem<br />
die bestehenden Lücken – aufzuarbeiten. Sie vernetzen<br />
Akteur*innen im Feld der psychischen Gesundheit und der<br />
Stadtplanung, um einen Dialog in Gang zu setzen, der sowohl<br />
interdisziplinär als auch international stattfindet. Aus der empirischen<br />
Auseinandersetzung entstehen Empfehlungen für die<br />
Praxis, um so psychische Krankheiten, die aus der Stadtgestaltung<br />
resultieren, zu verringern. Mittlerweile hat das Team Case<br />
Studies zu über 30 Städten angefertigt. Weiterhin veranstalten<br />
sie Gesprächsrunden in beteiligten Städten, um dem Thema mehr<br />
Reichweite und lokalen Stimmen eine Bühne zu geben. Neben<br />
der Arbeit vor Ort publiziert UD/MH in unregelmäßigen<br />
Abständen ein Magazin. Dieses legt in jeder Ausgabe einen<br />
Schwerpunkt auf einen anderen Aspekt mentaler Gesundheit.<br />
Zuletzt erschien im August 2021 die „Aging City Edition“ zur<br />
altersgerechteren Stadt. Im Jahr zuvor prägte – naheliegenderweise<br />
– die Covid-19-Pandemie die Publikation. Zudem<br />
veröffentlichte Layla McCay zusammen mit Jenny Roe das Buch<br />
„Restorative Cities“. Roe ist Teil des UD/MH-Kollegs und unter<br />
anderem langjährige Landschaftsarchitektin im Londoner Büro<br />
Sprunt. Aus fünfjähriger intensiver Recherche entstand eine<br />
wissenschaftliche Grundlage im Bereich City Mental Health.<br />
Das Buch bietet Definitionen, Leitlinien und Beispielprojekte für<br />
die Entwicklung einer lebenswerteren Stadt.<br />
Foto: NHS Confederation<br />
18 <strong>G+L</strong>
URBAN MENTAL HEALTH<br />
DIE PIONIER*INNEN<br />
Foto: © Annette Koroll<br />
MAZDA ADLI<br />
„Warum Städte uns krank machen. Und<br />
warum sie trotzdem gut für uns sind.“ Mit<br />
diesem Untertitel bewarb Mazda Adli<br />
2017 sein Buch „Stress and the City“.<br />
Darin setzt sich der Psychiater mit der<br />
Frage auseinander, ob das Stadtleben<br />
der psychischen Gesundheit schadet<br />
– und resümiert, dass die permanenten<br />
Reize der Stadt sowie der soziale Stress<br />
tatsächlich ungesund sind. Gleichzeitig<br />
betont er aber auch, dass die Stadt viele<br />
positive Effekte haben kann. So böten<br />
sie die Möglichkeit zur persönlichen<br />
Entfaltung und kulturelle Diversität. Adli<br />
spricht sich dafür aus, die Stadtplanung<br />
und -gestaltung zu über denken. Sein<br />
Plädoyer: Unter dem Schlagwort Neurourbanistik<br />
eine lebenswertere städtische<br />
Umwelt zu gestalten.<br />
Mazda Adli studierte in Bonn, Wien und<br />
Paris. Im Anschluss an seine Dissertation<br />
ging er an die Klinik für Psychiatrie der<br />
Freien Universität Berlin, wo er als<br />
wissenschaftlicher Mitarbeiter und<br />
Assistenzarzt tätig war. Seit 2004 ist er<br />
Oberarzt der Klinik für Psychiatrie und<br />
Psychotherapie der Charité am Campus<br />
Mitte. Hier etablierte er „Affektive<br />
Störungen“ als sein Forschungsfeld.<br />
Darunter versteht sich die Auseinandersetzung<br />
mit stressassoziierten Symptomen,<br />
Depression und manisch-depressiven<br />
Erkrankungen. Einen wesentlichen<br />
Teil seiner Forschung widmet er dabei<br />
den Einflussfaktoren, die das Stadtleben<br />
auf Emotionen und Verhalten hat. In<br />
diesem Zuge rief er das „Interdisziplinäre<br />
Forum Neurourbanistik“ ins Leben.<br />
Hier erforschen Neurowissenschaftler*innen,<br />
Architekt*innen, Sozialwissenschaftler*innen<br />
und Stadtplaner*innen<br />
gemeinsam, wie neurowissenschaftliche<br />
Erkenntnisse in der (Planungs-)Praxis<br />
angewendet werden können.<br />
<strong>G+L</strong> 19
THERAPIE:<br />
GRÜN UND BLAU<br />
Viele kennen wahrscheinlich das Gefühl, dass ein Spaziergang im Grünen<br />
gut tut. Ebenso bestätigen zahlreiche Studien, dass Grün- und Blau räume in<br />
der Stadt einen positiven Einfluss auf mentale Gesundheit, Psyche und Wohlbefinden<br />
haben. Was genau Forscher*innen herausgefunden haben und was<br />
das für Stadt planung und Landschaftsarchitekt*innen heißen kann.<br />
ANDREAS EBERT<br />
AUTOR<br />
Andreas Ebert<br />
studierte Landschaftsarchitektur<br />
an der<br />
TU München und der<br />
TU Berlin. Er arbeitete<br />
in verschiedenen<br />
Landschaftsarchitekturbüros<br />
in<br />
Rotterdam, Freising<br />
und Berlin. Aktuell ist<br />
er wissenschaftlicher<br />
Mitarbeiter und<br />
Doktorand am<br />
Institut für Freiraumentwicklung,<br />
Fachgebiet<br />
Entwerfen<br />
urbaner Landschaften<br />
an der<br />
Leibniz Universität<br />
in Hannover.<br />
Für das Fachgebiet Umweltmedizin und<br />
gesundheitliche Bewertung des Umweltbundesamtes<br />
untersucht eine eigene<br />
Fachgruppe für Umweltanalysen und<br />
-prognosen den Einfluss von Naturräumen<br />
auf die Gesundheit. Sie misst<br />
Naturräumen und insbesondere „Stadtgrün“<br />
sowie „Stadtblau“ gesundheitsschützendes<br />
und förderndes Potenzial<br />
bei. „Grün“ und „Blau“ können sich<br />
positiv auf die psychische, physische<br />
und soziale Gesundheit auswirken. Das<br />
funktioniert direkt durch die Minderung<br />
von Lärm, Feinstaub und Hitze oder<br />
indirekt durch die Förderung gesundheitsförderlicher<br />
Verhaltensweisen<br />
wie Bewegung, Sport oder Kontakt<br />
im Außenraum.<br />
Zu diesem Ergebnis kommt auch die<br />
Weltgesundheitsorganisation. Sie stellt<br />
fest, dass zur mentalen Gesundheit<br />
neben individuellen Faktoren und den<br />
sozialen Umständen als dritter wichtiger<br />
Punkt die Umgebung beiträgt, in der wir<br />
leben. Die WHO schlägt deshalb vor,<br />
gesundheitsförderliche Außenräume<br />
und den Kontakt zur Natur zu fördern,<br />
zu schützen und wiederherzustellen,<br />
gerade in Städten.<br />
45 PROZENT GERINGERES RISIKO FÜR<br />
PSYCHISCHE ERKRANKUNGEN BEI<br />
„NATUR-KINDERN“<br />
Eine dänische Studie stellte 2019 fest,<br />
dass sich Grünräume positiv auf die<br />
mentale Gesundheit auswirken und das<br />
Risiko psychischer Erkrankungen verringern<br />
können. Die landesweite Studie mit<br />
mehr als 900 000 Menschen zeigt, dass<br />
Kinder ein 55 Prozent höheres Risiko<br />
haben, psychische Erkrankungen zu<br />
entwickeln, wenn sie in einer wenig<br />
grünen Umgebung groß werden. Für<br />
die Studie werteten die Wissen schaftler*innen<br />
der Universität Aarhus Satellitenbilder<br />
aus den Jahren 1985 bis 2013<br />
aus. Dabei untersuchten sie die Landschaft<br />
rund um die Eltern häuser und<br />
glichen anschließend die Daten mit dem<br />
Risiko ab, im Laufe des Lebens eine von<br />
16 verschiedenen psychischen Erkrankungen<br />
zu entwickeln. Umgeben von<br />
Wäldern, Wiesen, Gärten oder Parks,<br />
haben Kinder, die von Geburt bis zum<br />
zehnten Lebensjahr in der Nähe von<br />
Grünflächen aufwachsen, demnach<br />
ein geringeres Risiko, an psychischen<br />
Störungen zu erkranken. Die<br />
26 <strong>G+L</strong>
URBAN MENTAL HEALTH<br />
THERAPIE: GRÜN UND BLAU<br />
Forscher*innen sehen durch die Studie<br />
bewiesen, dass die Implementierung von<br />
Grünräumen in Städten ein wirkungsvoller<br />
Ansatz ist, um die mentale Gesundheit<br />
zu verbessern und psychischen Erkrankungen<br />
vorzubeugen.<br />
ZUFRIEDENHEIT UND PSYCHISCHE<br />
GESUNDHEIT IN DER NÄHE VON<br />
„GRÜN“ HÖHER<br />
GRÜN<br />
STADT-<br />
STADT-<br />
BLAU<br />
Grafik: Laura Celine Heinemann<br />
Dies bestätigt auch eine Studie der<br />
University of Exeter, Großbritannien,<br />
von 2013. Die Forscher*innen fanden<br />
heraus, dass im Schnitt alle 10 000<br />
untersuchten Individuen sowohl weniger<br />
mentalen Stress als auch ein größeres<br />
Wohlbefinden haben, wenn sie in<br />
urbanen Gebieten mit mehr Grünräumen<br />
leben. Dafür dokumentierten<br />
Wissenschaftler*innen 18 Jahre lang<br />
den Wohnort, die psychische Gesundheit<br />
und die Zufriedenheit. Dabei<br />
berücksichtigten sie auch andere<br />
Faktoren, wie den Arbeitsplatz oder<br />
Partnerschaften. So fanden die<br />
Forscher*innen heraus, wie hoch der<br />
Effekt von Grünflächen im Gegensatz zu<br />
anderen positiven Faktoren ist. Eine<br />
MENTALE<br />
GESUNDHEIT<br />
<strong>G+L</strong> 27
DIAGNOSE:<br />
EINSAMKEIT<br />
Wie soll ich einsam sein, bin ich doch ständig in Gesellschaft?<br />
Gerade in Metropolen tendiert man so zu denken. Schon<br />
lange weiß man aus der Psychologie jedoch, dass Einsamkeit<br />
nicht nur mit der Anzahl der Kontakte einhergeht, sondern mit<br />
dem erlebten Ausmaß an Intimität, Verbundenheit und praktischer<br />
Unterstützung. Doch wie viel Verbundenheit erleben wir<br />
in der Anonymität der Großstadt? Und wer hat den Mut sich<br />
einzugestehen, unter Millionen Menschen im Grunde doch<br />
einsam zu sein? Wer unter Einsamkeit leidet, was sie mit uns<br />
macht und was wir dagegen tun können.<br />
SHANTI HETZ<br />
AUTORIN<br />
Shanti Hetz,<br />
Psychologin mit<br />
Schwerpunkt<br />
Entwicklung und<br />
Bildung, hat ihren<br />
Lebensmittelpunkt in<br />
Wien. Sie arbeitet in<br />
der Kinder- und<br />
Jugendberatung,<br />
gibt Studien-<br />
Vorbereitungskurse<br />
und befindet sich in<br />
Ausbildung zur<br />
Psychotherapeutin.<br />
Einsamkeit zu definieren, ist gar nicht so<br />
leicht, wie man vielleicht zunächst annehmen<br />
möchte. Im alltäglichen Sprachgebrauch<br />
werden „einsam“ und „allein“ oft<br />
synonym oder als Redewendung sogar<br />
zusammen verwendet. Aber ist Einsamkeit<br />
wirklich das Gleiche wie Alleinsein? Wir<br />
benötigen keine psychologische Forschung,<br />
um dies zu verneinen. Bei der<br />
Einsamkeit geht es nicht nur um ein<br />
faktisches Alleinsein. Es geht vielmehr um<br />
ein subjektives Erleben der Isolation, das<br />
sich von Person zu Person unterscheidet.<br />
Während manche Menschen nur sehr<br />
wenige Kontakte pflegen und viel alleine<br />
sind, sich aber trotzdem wohl und<br />
verbunden fühlen, gibt es andere, die<br />
ständig unter Leuten sind und doch unter<br />
Einsamkeit leiden. Dabei spielt die eigene<br />
Persönlichkeit eine ebenso große Rolle<br />
wie die erlebte Qualität der geführten<br />
Beziehungen. Auch psychologische<br />
Fragebögen zu Einsamkeit und sozialer<br />
Unterstützung beziehen sich größtenteils<br />
auf die subjektive Wahrnehmung, nicht<br />
auf die quantitative Größe des Freundesoder<br />
Bekanntenkreises. Mit Aussagen wie<br />
„Ich fühle mich isoliert.“ oder „Es gibt<br />
Menschen, mit denen ich reden kann.“<br />
(wie sie in der UCLA Loneliness Scale<br />
verwendet werden) wird der Subjektivität<br />
der Einsamkeit Rechnung getragen.<br />
EINSAMKEIT – NA UND?<br />
Soziale Isolation – so wissen wir aus der<br />
Gesundheitspsychologie – ist ein unterschätzter<br />
Risikofaktor für die psychische,<br />
aber auch körperliche Gesundheit. Mit<br />
dieser Thematik beschäftigt sich die<br />
psychologische Forschung bereits seit den<br />
1960er-Jahren. Die bekannte Alameda-<br />
County-Studie untersuchte beispielsweise<br />
fast 7 000 Personen und ging dabei der<br />
Frage nach, wie soziale Eingebundenheit<br />
mit Gesundheit und Sterblichkeit zusammenhängt.<br />
Über fast zwanzig Jahre<br />
wurden die Proband*innen untersucht.<br />
Das erschreckende Ergebnis: Die Wahrscheinlichkeit,<br />
über den Zeitraum der<br />
Untersuchung zu versterben, war bei<br />
nicht ausreichend sozial eingebundenen<br />
Personen doppelt so hoch wie bei<br />
solchen, die über viele und gute Beziehungen<br />
verfügten.<br />
Eine ebenfalls groß angelegte Metaanalyse<br />
von House, Landis und Umberson<br />
aus den 1980er-Jahren schlussfolgert aus<br />
ihrer Arbeit: Fehlender sozialer Rückhalt<br />
ist ein Risikofaktor, der mit dem Rauchen<br />
vergleichbar ist.<br />
Woher kommt also dieser immense<br />
Zusammenhang zwischen Gesundheit und<br />
Einsamkeit, und wie kommt es, dass nicht<br />
die mentale, sondern auch die körperliche<br />
32 <strong>G+L</strong>
URBAN MENTAL HEALTH<br />
DIAGNOSE: EINSAMKEIT<br />
Illustration: Laura Celine Heinemann<br />
<strong>G+L</strong> 33
KÖRPER VS. COUCH<br />
Es ist das alte Lied. Sport ist wichtig. Wir sollten uns alle mehr bewegen. Sport macht<br />
glücklicher, und Sport hält nicht nur körperlich, sondern auch mental gesund. Daran ist mit<br />
Sicherheit etwas dran. Doch wer tiefer in das Thema einsteigt, merkt schnell, dass noch viele<br />
Fragen unbeantwortet bleiben und vor allem dass das moderne Leben in einer Stadt ganz<br />
eigene Herausforderungen für die mentale Gesundheit und das vermeintliche Wundermittel<br />
Sport bereithält.<br />
TOBIAS HAGER<br />
Sport in der Freizeit: Um von den positiven<br />
Effekten regelmäßiger Bewegung zu profitieren,<br />
braucht man kein*e Leistungssportler*in zu sein.<br />
Foto: Jannes Glas via Unsplash<br />
36 <strong>G+L</strong>
URBAN MENTAL HEALTH<br />
KÖRPER VS. COUCH<br />
AUTOR<br />
Tobias Hager ist<br />
Journalist und<br />
Digitalisierungs-<br />
Experte. Seit 2020<br />
leitet er als Chief<br />
Content Officer die<br />
Medienmarken von<br />
Georg Media und ist<br />
dort ebenfalls für<br />
alle digitalen<br />
Themen zuständig.<br />
Eines sollte uns allen bereits klar sein:<br />
Sport hält fit und kann großen Spaß<br />
machen, sogar zum freizeitfüllenden<br />
Hobby werden. Klar ist auch, dass man<br />
kein*e Leistungs- oder Extremsportler*in<br />
werden muss, um von den positiven<br />
Effekten regelmäßiger Bewegung zu<br />
profitieren. Doch welchen Einfluss hat<br />
ein trainierter Körper auf das mentale<br />
Wohlbefinden oder gar die Psyche? Oder<br />
geht es möglicherweise eher um die<br />
negativen Effekte der berühmten Work-<br />
Couch-Balance als um das Fit-Sein?<br />
Zwischen mentaler Gesundheit und Sport<br />
gibt es durchaus einen Zusammenhang.<br />
Allerdings sollte man einschränkend<br />
vorwegnehmen, dass es wohl eher einen<br />
Zusammenhang zwischen regelmäßiger<br />
Bewegung und mentaler Gesundheit gibt.<br />
Das Wort „Sport“ kann für den einen<br />
oder anderen ja durchaus abschreckend<br />
wirken, und die Erkenntnis dieses Artikels<br />
ist sicherlich, dass es mehr um die<br />
Regel mäßigkeit und moderate Bewegung<br />
als um wirklichen Sport geht.<br />
EINFLUSS AUF DIE MENTALE<br />
GESUNDHEIT<br />
Bereits 2018 wies die WHO auf den<br />
eklatanten Bewegungsmangel in Industrieländern<br />
hin. Dieser sei so stark und<br />
bedrohlich, dass unter dem Titel „More<br />
Active People for a Healthier World“ ein<br />
„Global Action Plan on Physical Activity<br />
2018–2<strong>03</strong>0“ veröffentlicht wurde. Laut<br />
der WHO sitzen wir zu viel vor Computern<br />
und verbringen den Feierabend lieber<br />
auf der Couch oder sitzend mit Alkohol in<br />
Bars, Kneipen und Restaurants. Gut, diese<br />
Studie wurde vor der Pandemie veröffentlicht.<br />
Das leidige Thema mit Bars und<br />
Restaurants hatte sich nun ja für eine<br />
Zeit lang erledigt. Doch schieben wir den<br />
Galgenhumor mal bei Seite: Die meisten<br />
Menschen in Städten arbeiten inzwischen<br />
mit Computern, und der Arbeitsalltag<br />
vieler Menschen lässt kaum Bewegung zu.<br />
Auch wenn die WHO empfiehlt, mehr mit<br />
dem Rad zur Arbeit zu fahren, pendeln<br />
nach wie vor viele Menschen sitzend im<br />
Auto oder in öffentlichen Verkehrsmitteln.<br />
Vor der Arbeit klappt das mit dem Sport<br />
für viele Berufe nicht zuverlässig, und danach<br />
ist man schnell zu erschöpft und vom<br />
lahmenden Computeralltag erschlagen.<br />
Da liegt der Gedanke nahe, dass sich<br />
nicht nur der Körper dem sitzenden Verfall<br />
ergeben muss, sondern auch der Geist<br />
eingeschränkt oder gar verletzt wird.<br />
Um diesen Phänomenen entgegenzuwirken,<br />
empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation<br />
moderates Ausdauertraining von<br />
mindestens 150 Minuten pro Woche.<br />
Erwiesen ist, dass derartiges Training bei<br />
Menschen zwischen 18 und 64 Jahren<br />
<strong>G+L</strong> 37
WIR BRAUCHEN<br />
DAS SPIEL WIE DIE<br />
LUFT ZUM ATMEN.<br />
Wie kreative und naturnahe Spielräume unsere Kinder bestärken und fördern.<br />
Ein Appell des Stuttgarter Planungsbüros KuKuk Freiflug.<br />
KUKUK FREIFLUG<br />
Den Abenteuerspielplatz des Kinderzentrums<br />
SPIELI in Würzburg gestalteten die Planer*innen<br />
von KuKuk Freiflug neu.<br />
Foto: KuKuk Freiflug<br />
46 <strong>G+L</strong>
URBAN MENTAL HEALTH<br />
WIR BRAUCHEN DAS SPIEL WIE DIE LUFT ZUM ATMEN.<br />
„WIR BRAUCHEN NICHT SO<br />
FORTZULEBEN, WIE WIR GESTERN<br />
GELEBT HABEN. MACHEN WIR UNS<br />
VON DIESER ANSCHAUUNG LOS,<br />
UND TAUSEND MÖGLICHKEITEN<br />
LADEN UNS ZU NEUEM LEBEN EIN.“<br />
CHRISTIAN MORGENSTERN<br />
AUTOR*INNEN<br />
KuKuk Freiflug aus<br />
Stuttgart erforscht,<br />
konzipiert, berät,<br />
plant, entwirft<br />
und betreut<br />
Landschafts, Stadtund<br />
Spielräume.<br />
„Spielplätze sind ein Armutszeugnis<br />
unserer Gesellschaft!“ – diese provokante<br />
Aussage von KuKuk Freiflug-Gründer<br />
Bernhard Hanel führt die Tatsache vor<br />
Augen, dass es sich bei den meisten<br />
Spielplätzen unserer Städte nur um ein<br />
Nebenprodukt handelt. Die ersten Spielplätze<br />
entstanden Anfang des 20. Jahrhunderts<br />
und sollten den Arbeiterkindern,<br />
in der dicht bewohnten Stadt, einen<br />
Rückzugsraum bieten. Zwar bringen<br />
Kinder von Natur aus die Fähigkeit mit,<br />
ihr Umfeld zum Spiel zu machen, jedoch<br />
hat ihnen der Städtebau den Raum dafür<br />
genommen und damit auch die spielerische<br />
Freiheit. Höchste Zeit, der nachkommenden<br />
Generation erneut Zugang<br />
zu natürlich gestalteten Spielräumen<br />
zu ermöglichen.<br />
Der Megatrend „Urbanisierung“ lässt<br />
die Städte weiterwachsen. Inzwischen<br />
lebt mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung<br />
in städtischen Gebieten. Zu den<br />
zahlreichen positiven Entwicklungen,<br />
wie zum Beispiel diverse Bildungsmöglichkeiten,<br />
technische Innovationen und<br />
eine verbesserte Gesundheitsinfrastruktur,<br />
gesellen sich jedoch auch immer<br />
mehr soziale Herausforderungen. Die<br />
wachsende Dichte erhöht den sozialen<br />
Stress – und statt das wir uns vereinen,<br />
isolieren wir uns voneinander. Oft aus<br />
Überforderung und Selbstschutz. So<br />
leben wir Menschen in Städten oft<br />
einsam. Ein Effekt, den wir während der<br />
Covid-Pandemie auf extreme Weise<br />
spüren konnten.<br />
„Wer in der Stadt lebt, hat ein höheres<br />
Risiko, psychisch zu erkranken“, weiß<br />
Psychiater und Stressforscher Prof. Dr.<br />
med. Mazda Adli (Klinik für Psychiatrie<br />
und Psychotherapie/Charité Berlin).<br />
Und da immer mehr Familien im städtischen<br />
Raum leben, sind auch Kinder<br />
diesem Risiko ausgesetzt. Sie werden<br />
viel zu früh außernatürlichen Strapazen<br />
ausgesetzt, die einer kindgerechten,<br />
gesunden Entwicklung entgegenwirken.<br />
Und hier kommen wir ins Spiel: die<br />
Freiraum- und Landschaftsplaner*innen.<br />
Durch die Gestaltung des urbanen<br />
Außenraumes können wir grundlegend<br />
ausgleichende Gegenpole setzen und<br />
dem sozialen Stress entgegenwirken: mit<br />
neuen Spielräumen für Kinder sowie mit<br />
Plätzen für Jugendliche und Erwachsene<br />
zum Chillen, Bewegen und Austauschen.<br />
Kurz: ein „Wohnzimmer für die Bürger*innen“.<br />
Wenn wir es schaffen, die<br />
Stimmen der Kinder ernst zu nehmen<br />
und mit dieser Haltung Entscheidungsträger*innen<br />
der Stadtentwicklung mit<br />
ins Boot zu holen, kann Resilienz vom<br />
Kindesalter an in unseren komplexen<br />
Systemen wachsen.<br />
Ob im Hinterhof eines Wohnungsbaus,<br />
in der Parkanlage nebenan, auf dem<br />
Schulhof, dem Kirchenvorplatz, auf den<br />
Bahnhofstreppen, dem Bürgersteig,<br />
dem Bolzplatz, auf dem Marktplatz, in<br />
<strong>G+L</strong> 47