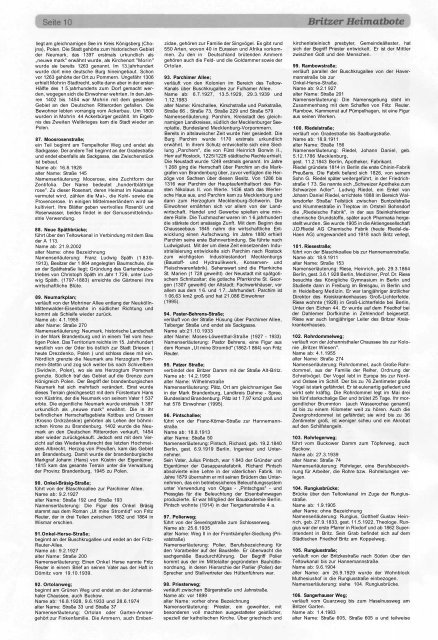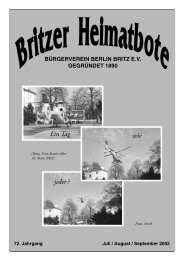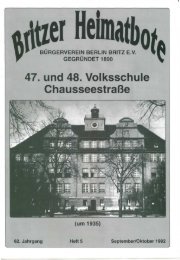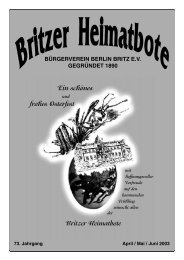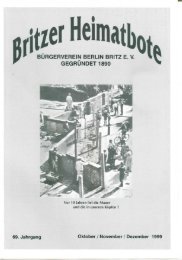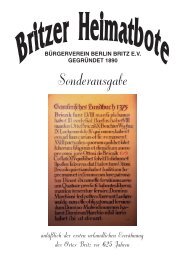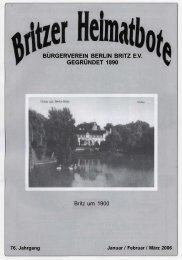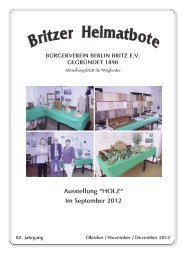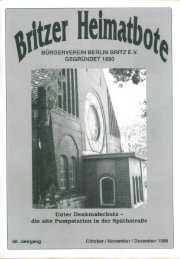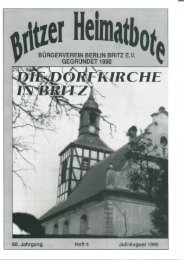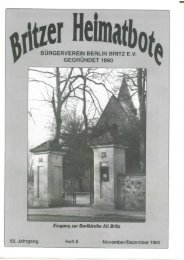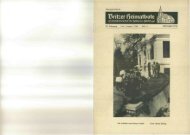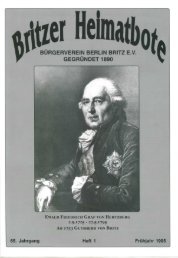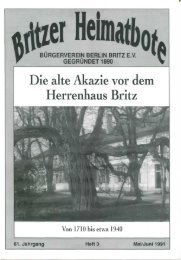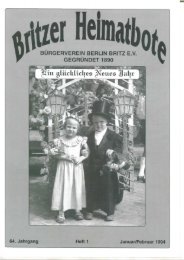Berlin - Britzer Bürgerverein
Berlin - Britzer Bürgerverein
Berlin - Britzer Bürgerverein
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
liegt am gleichnamigen See im Kreis Königsberg (Chojna),<br />
Polen. Die Stadt gehörte zum historischen Gebiet<br />
der Neumark, das 1397 erstmals urkundlich als<br />
„neuwe mark" erwähnt wurde, als Kirchenort "Morin"<br />
wurde sie bereits 1263 genannt. Im 13.|ahrhundert<br />
wurde dort eine deutsche Burg hineingebaut. Schon<br />
vor 1263 gehörte der Ort zu Pommern. Ungefähr 1306<br />
erhielt Mohrin Stadtrecht, sollte dann aber in der ersten<br />
Hälfte des 1 5.)ahrhunderts zum Dorf gemacht werden,<br />
wogegen sich die Einwohner wehrten. In den Jahren<br />
1402 bis 1454 war Mohrin mit dem gesamten<br />
Gebiet an den Deutschen Ritterorden gefallen. Die<br />
Bewohner lebten vorrangig vom Ackerbau. Um 1800<br />
wurden in Mohrin 44 Ackerbürger gezählt. Im Ergebnis<br />
des Zweiten Weltkrieges kam die Stadt wieder an<br />
Polen.<br />
87. Moosrosenstraße;<br />
ein Teil beginnt am Tempelhofer Weg und endet als<br />
Sackgasse. Der andere Teil beginnt an der Gradestraße<br />
und endet ebenfalls als Sackgasse, das Zwischenstück<br />
ist bebaut.<br />
Name ab: 16.8.1928<br />
alter Name: Straße 145<br />
Namenserläuterung: Moosrose, eine Zuchtform der<br />
Zentifolia. Der Name bedeutet „hundertblättrige<br />
rose". Zu dieser Rosenart, deren Heimat im Kaukasus<br />
vermutet wird, zählen die Mai-, die Kohl- sowie die<br />
Provencerose. In einigen Mittelmeerländern wird sie<br />
kultiviert. Ihre Blätter geben wertvolles Rosenöl und<br />
Rosenwasser, beides findet in der Genussmittelindustrie<br />
Verwendung.<br />
88. Neue Späthbrücke;<br />
führt über den Teltowkanal in Verbindung mit dem Bau<br />
der A 113.<br />
Name ab: 21.9.2002<br />
alter Name: ohne Bezeichnung<br />
Namenserläuterung: Franz Ludwig Späth (1 839-<br />
1913), Besitzer der 1 864 angelegten Baumschule, die<br />
an der Späthstraße liegt; Gründung des Gartenbaubetriebes<br />
von Christoph Späth im Jahr 1 726, unter Ludwig<br />
Späth. (1797-1883) erreichte die Gärtnerei ihre<br />
wirtschaftliche Blüte.<br />
89. Neumarkplan;<br />
verläuft von der Mohriner Allee entlang der Neukölln-<br />
Mittenwalder-Eisenbahn in südlicher Richtung und<br />
kommt als Schleife wieder zurück.<br />
Name ab: 4.1.1955<br />
alter Name: Straße 270<br />
Namenserläuterung: Neumark, historische Landschaft<br />
in der Mark Brandenburg und in einem Teil vom heutigen<br />
Polen. Das Territorium reichte im 15. Jahrhundert<br />
westlich von der Oder bis östlich zur Stadt Driesen (<br />
heute Drezdenko, Polen ) und schloss diese mit ein.<br />
Nördlich grenzte die Neumark ans Herzogtum Pommern-Stettin<br />
und zog sich weiter bis nach Schivelbein<br />
(Swidwin, Polen), wo sie ans Herzogtum Pommern<br />
grenzte. Südlich traf das Gebiet auf die Grenze zum<br />
Königreich Polen. Der Begriff der brandenburgischen<br />
Neumark hat sich mehrfach verändert. Einst wurde<br />
dieses Terrain gleichgesetzt mit dem Fürstentum Hans<br />
von Küstrins, der die Neumark von seinem Vater 1 537<br />
erbte. Die eigentliche Neumark wurde erstmals 1 397<br />
urkundlich als „neuwe mark" erwähnt. Die in ihr<br />
befindlichen Herrschaftsgebiete Kottbus und Crossen<br />
(Krosno Ordrzänskie) gehörten als Lehen der böhmischen<br />
Krone zu Brandenburg. 1402 wurde die Neumark<br />
an den Deutschen Ritterorden verkauft, 1454<br />
aber wieder zurückgekauft. Jedoch erst mit dem Verzicht<br />
auf das Wiederkaufsrecht des letzten Hochmeisters<br />
Albrecht, Herzog von Preußen, kam das Gebiet<br />
an Brandenburg. Damit wurde der brandenburgische<br />
Markgraf Johann (Hans) von Küstrin der Eigentümer.<br />
1815 kam das gesamte Terrain unter die Verwaltung<br />
der Provinz Brandenburg, 1945 zu Polen.<br />
90. Onkel-Bräsig-Straße;<br />
führt von der Blaschkoallee zur Parchimer Allee.<br />
Name ab: 9.2.1927<br />
alter Name: Straße 192 und Straße 193<br />
Namenserläuterung: Die Figur des Onkel Bräsig<br />
stammt aus dem Roman „Ut mine Stromtid" von Fritz<br />
Reuter, der in drei Teilen zwischen 1862 und 1864 in<br />
Wismar erschien.<br />
91.Onkel-Herse-Straße;<br />
beginnt an der Buschkrugallee und endet an der Fritz-<br />
Reuter-Allee.<br />
Name ab: 9.2.1927<br />
alter Name: Straße 200<br />
Namenserläuterung: Einen Onkel Herse nannte Fritz<br />
Reuter in einem Brief an seinen Vater aus der Haft in<br />
Dömitz vom 19.10.1939.<br />
92. Ortolanweg;<br />
beginnt am Grünen Weg und endet an der Johannisthaler<br />
Chaussee, auch Buckow.<br />
Name ab: 16.8.1928, 9.6.1933 und 28.6.1974<br />
alter Name: Straße 33 und Straße 37<br />
Namenserläuterung: Ortolan oder Garten-Ammer<br />
gehört zur Finkenfamilie. Die Ammern, auch Emberi-<br />
zidae, gehören zur Familie der Singvögel. Es gibt rund<br />
550 Arten, wovon 40 in Eurasien und Afrika vorkommen.<br />
Zu den in Deutschland brütenden Ammern<br />
gehören auch die Feld- und die Goldammer sowie der<br />
Ortolan.<br />
93. Parchimer Allee;<br />
verläuft von den Kolonien im Bereich des Teltow-<br />
Kanals über Buschkrugallee zur Fulhamer Allee.<br />
Name ab: 6.7.1927, 13.5.1929, 29.3.1939 und<br />
1.12.1983<br />
alter Name: Kirschallee, Kirschstraße und Parkstraße,<br />
Straße 66 , Straße 73, Straße 229 und Straße 579<br />
Namenserläuterung: Parchim, Kreisstadt des gleichnamigen<br />
Landkreises, südlich der Mecklenburger Seenplatte,<br />
Bundesland Mecklenburg-Vorpommern.<br />
Bereits in altslawischer Zeit wurde hier gesiedelt. Die<br />
Burg Parchim wurde 1170 erstmals urkundlich<br />
erwähnt. In ihrem Schutz entwickelte sich eine Siedlung<br />
„Parchem", die von Fürst Heinrich Borwin II.,<br />
Herr auf Rostock, 1225/1226 städtische Rechte erhielt.<br />
Die Neustadt wurde 1249 erstmals genannt. Im Jahre<br />
1 268 ging die Herrschaft über Parchim an die Markgrafen<br />
von Brandenburg über, zuvor verfügten die Herzöge<br />
von Sachsen über diesen Besitz. Von 1286 bis<br />
1316 war Parchim der Hauptaufenthaltsort des Fürsten<br />
Nikolaus II. von Werle. 1436 starb das Werlersche<br />
Haus aus, und Parchim kam zu Mecklenburg und<br />
dann zum Herzogtum Mecklenburg-Schwerin. Die<br />
Einwohner ernährten sich vor allem von der Landwirtschaft.<br />
Handel und Gewerbe spielten eine mindere<br />
Rolle. Die Tuchmacher waren im 1 6.jahrhundert<br />
die stärkste dort ansässige Zunft. Mit dem Beginn des<br />
Chausseebaus 1845 nahm die wirtschaftliche Entwicklung<br />
einen Aufschwung. Im Jahre 1880 erhielt<br />
Parchim seine erste Bahnverbindung. Sie führte nach<br />
Ludwigslust. Mit der um diese Zeit einsetzenden Industrialisierung<br />
entwickelte sich Parchim nach Rostock<br />
zum wichtigsten Industriestandort Mecklenburgs<br />
(Baustoff- und Hydraulikwerk, Konserven- und<br />
Fleischwarenfabrik). Sehenswert sind die Pfarrkirche<br />
St. Marien (1 728 geweiht) der Neustadt mit spätgotischem<br />
Schnitzaltar; die gotische Pfarrkirche St. Georgen<br />
(1307 geweiht) der Altstadt; Fachwerkhäuser, vor<br />
allem aus dem 1 6. und 1 7. Jahrhundert. Parchim ist<br />
1 06,63 km2 groß und hat 21.086 Einwohner<br />
(1995).<br />
94. Paster-Behrens-Straße;<br />
verläuft von der Straße Hüsung über Parchimer Allee,<br />
Talberger Straße und endet als Sackgasse.<br />
Name ab:21.10.1933<br />
alter Name: Moses-Löwenthal-Straße (1927 - 1933)<br />
Namenserläuterung: Pastor Behrens, eine Figur aus<br />
dem Roman „Ut mine Stromtid" (1862-1 864) von Fritz<br />
Reuter.<br />
95. Patzer Straße;<br />
verbindet den <strong>Britzer</strong> Damm mit der Straße Alt-Britz.<br />
Name ab: 14.2.1950<br />
alter Name: Wilhelmstraße<br />
Namenserläuterung: Pätz, Ort am gleichnamigen See<br />
in der Mark Brandenburg, Landkreis Dahme - Spree,<br />
Bundesland Brandenburg. Pätz ist 1 7,97 km2 groß und<br />
hat 578 Einwohner (1995).<br />
96. Pintschallee;<br />
führt von der Franz-Körner-Straße zur Hannemannstraße.<br />
Name ab: 18.8.1913<br />
alter Name: Straße 50<br />
Namenserläuterung: Pintsch, Richard, geb. 19.2.1840<br />
<strong>Berlin</strong>, gest. 6.9.1919 <strong>Berlin</strong>, Ingenieur und Unternehmer.<br />
Sein Vater, Julius Pintsch, war 1 843 der Gründer und<br />
Eigentümer der Gasapparatefabrik. Richard Pintsch<br />
absolvierte eine Lehre in der väterlichen Fabrik. Im<br />
Jahre 1879 übernahm er mit seinen Brüdern das Unternehmen,<br />
das ein betriebssicheres Beleuchtungssystem<br />
unter Verwendung von Olgas - „Pintschgas" - und<br />
Pressglas für die Beleuchtung der Eisenbahnwagen<br />
produzierte. Er war Mitglied der Bauakademie <strong>Berlin</strong>.<br />
Pintsch wohnte (1914) in der Tiergartenstraße 4 a.<br />
97. Polierweg;<br />
führt von der Severingstraße zum Schlosserweg.<br />
Name ab: 25.6.1935<br />
alter Name: Weg II in der Frontkämpfer-Siedlung (Privatstraße)<br />
Namenserläuterung: Polier, Berufsbezeichnung für<br />
den Vorarbeiter auf der Baustelle. Er überwacht die<br />
sachgemäße Baudurchführung. Der Begriff Polier<br />
kommt aus der im Mittelalter gegründeten Bauhüttenordnung,<br />
in deren Hierarchie der Parlier (Polier) der<br />
Sprecher und Stellvertreter des Hüttenführers war.<br />
98. Priesterweg;<br />
verläuft zwischen Bürgerstraße und Jahnstraße.<br />
Name ab: vor 1899<br />
alter Name: vorher ohne Bezeichnung<br />
Namenserläuterung: Priester, ein geweihter, mit<br />
besonderen voll machten ausgestatteter geistlicher,<br />
speziell der katholischen Kirche. Über griechisch und<br />
kirchenlateinisch presbyter, Gemeindeältester, hat<br />
sich der Begriff Priester entwickelt. Er ist der Mittler<br />
zwischen Gott und den Menschen.<br />
99. Rambowstraße;<br />
verläuft parallel der Buschkrugallee von der Havermannstraße<br />
bis zur<br />
Onkel-Herse-Straße.<br />
Name ab: 9.2.1 927<br />
alter Name: Straße 201<br />
Namenserläuterung: Die Namensgebung steht im<br />
Zusammenhang mit dem Schaffen von Fritz Reuter.<br />
Rambow, Kammerrat auf Pümpelhagen, ist eine Figur<br />
aus seinen Werken.<br />
100. Riedelstraße;<br />
verläuft von Gradestraße bis Saalburgstraße.<br />
Name ab: 18.9.1911<br />
alter Name: Straße 156<br />
Namenserläuterung: Riedel, Johann Daniel, geb.<br />
5.12.1786 Mecklenburg,<br />
gest. 11.2.1843 <strong>Berlin</strong>, Apotheker, Fabrikant.<br />
Riedel gründete 1814 in <strong>Berlin</strong> die erste Chinin-Fabrik<br />
Preußens. Die Fabrik befand sich 1826, von seinem<br />
Sohn G. Riedel später weitergeführt, in der Friedrichstraße<br />
1 73. Sie nannte sich „Schweizer Apotheke zum<br />
Schwarzen Adler". Ludwig Riedel, ein Enkel von<br />
Johann Daniel Riedel, errichtete 1888 im Bereich Waltersdorfer<br />
Straße/ Teilstück zwischen Buntzelstraße<br />
und Krummestraße in Treptow im Ortsteil Bohnsdorf<br />
die „Riedeische Fabrik", in der aus Steinkohlenteer<br />
chemische Grundstoffe, später auch Pharmaka hergestellt<br />
wurden. Sie wurde 1905 in die Aktiengesellschaft<br />
J.D.Riedel AG Chemische Fabrik (heute Riedel-de-<br />
Haen AG) umgewandelt und 1918 nach Britz verlegt,<br />
101. Riesestraße;<br />
führt von der Blaschkoallee bis zur Hannemannstraße.<br />
Name ab: 18.9.1911<br />
alter Name: Straße 153<br />
Namenserläuterung: Riese, Heinrich, geb. 29.3.1864<br />
<strong>Berlin</strong>, gest. 3.6.1 928 <strong>Berlin</strong>, Mediziner, Prof. Dr. Riese<br />
besuchte das Königliche Gymnasium in <strong>Berlin</strong> und<br />
Studierte dann in Freiburg im Breisgau, in <strong>Berlin</strong> und<br />
in Heidelberg Medizin. Er war langjähriger ärztlicher<br />
Direktor des Kreiskrankenhauses Groß-Lichterfelde.<br />
Riese wohnte (1928) in Groß-Lichterfelde bei <strong>Berlin</strong>,<br />
Unter den Eichen 44. Er wurde auf dem Friedhof bei<br />
der Dahlemer Dorfkirche in Zehlendorf beigesetzt.<br />
Riese war auch langjähriger Leiter des <strong>Britzer</strong> Kreiskrankenhauses.<br />
102. Rohrdommelweg;<br />
verläuft von der Johannisthaler Chaussee bis zur Kolonie<br />
„<strong>Britzer</strong> Wiesen".<br />
Name ab: 4.1.1955<br />
alter Name: Straße 274<br />
Namenserläuterung: Rohrdommel, auch Große Rohrdommel,<br />
aus der Familie der Reiher, Ordnung der<br />
Schreitvögel. Der Vogel lebt in Europa bis zur Nordund<br />
Ostsee im Schilf. Der bis zu 76 Zentimeter große<br />
Vogel ist stark gefährdet. Er ist eulenartig gefiedert und<br />
wirkt sehr kräftig. Die Rohrdommel legt im Mai drei<br />
bis fünf starkschalige Eier und brütet 25 Tage. Ihr morgendlicher<br />
Brummton (auch Wasserochse genannt)<br />
ist bis zu einem Kilometer weit zu hören. Auch die<br />
Zwergrohrdommel ist gefährdet; sie wird bis zu 36<br />
Zentimeter groß, ist weniger scheu und ein Akrobat<br />
auf den Schilfstengeln.<br />
103. Rohrlegerweg;<br />
führt vom Buckower Damm zum Töpferweg, auch<br />
Buckow.<br />
Name ab: 27.3.1939<br />
alter Name: Straße 74<br />
Namenserläuterung: Rohrleger, eine Berufsbezeichnung<br />
für Arbeiter, die Rohre bzw. Rohrleitungen verlegen.<br />
104. Rungiusbrücke;<br />
Brücke über den Teltowkanal im Zuge der Rungiusstraße.<br />
Name ab: 1.9.1905<br />
alter Name: ohne Bezeichnung<br />
Namenserläuterung: Rungius, Gotthelf Gustav Heinrich,<br />
geb. 27.9.1833, gest. 11.5.1922, Theologe. Rungius<br />
war der erste Pfarrer in Rixdorf und ab 1862 Superintendent<br />
in Britz. Sein Grab befindet sich auf dem<br />
Städtischen Friedhof Britz am Koppelweg.<br />
105. Rungiusstraße;<br />
verläuft von der Britzkestraße nach Süden über den<br />
Teltowkanal bis zur Hannemannstraße.<br />
Name ab: 9.6.1904<br />
alter Name: am 26.9.1929 wurde der Wohnblock<br />
Muthesiushof in die Rungiusstraße einbezogen.<br />
Namenserläuterung: siehe 104. Rungiusbrücke.<br />
106. Sangerhauser Weg;<br />
verläuft vom Quarzweg bis zum Haselnussweg am<br />
<strong>Britzer</strong> Garten.<br />
Name ab: 1.4.1983<br />
alter Name: Straße 605, Straße 605 a und teilweise