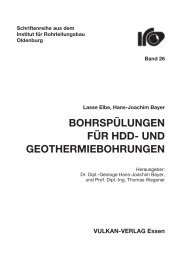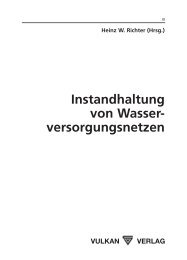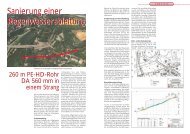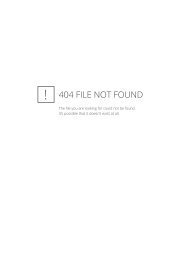Kurze Leitungswege durch HDD - Nodig-Bau.de
Kurze Leitungswege durch HDD - Nodig-Bau.de
Kurze Leitungswege durch HDD - Nodig-Bau.de
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Kurze</strong> <strong>Leitungswege</strong> <strong>durch</strong> <strong>HDD</strong>-Technologie<br />
von Dr. Hans-Joachim Bayer<br />
Heutige Einsätze <strong>de</strong>r verlaufsgesteuerten Horizontalbohrtechnik (<strong>HDD</strong>)<br />
Das Horizontal Directional Drilling, wie diese grabenlose Leitungslegetechnik<br />
international heißt und abgekürzt als <strong>HDD</strong>-Verfahren bekannt ist, dient heute<br />
überwiegend <strong>de</strong>r Versorgungs- und Glasfaser-Leitungsverlegung unter natürlichen<br />
(Flüsse, Kanäle, usw.) und künstlichen Hin<strong>de</strong>rnissen (Verkehrswege, Dämme,<br />
Mauern, usw.) und <strong>de</strong>m innerstädtischen Netzbau unter vorhan<strong>de</strong>nen Straßen und<br />
Gehwegen. In Län<strong>de</strong>rn und Regionen, in <strong>de</strong>nen auch Verkehrsbeeinträchtigungen,<br />
Umweltfaktoren und die Qualität von Straßen- und Gehwegoberflächen einen<br />
Stellenwert haben, hat <strong>de</strong>r Leitungsbau im <strong>HDD</strong>-Verfahren einen <strong>de</strong>utlichen Anteil im<br />
Leitungsbau gewonnen und in Regionen, in <strong>de</strong>nen Wirtschaftlichkeit,<br />
<strong>Bau</strong>zeitverkürzung und gute Leitungsbettung wichtig sind, ist die <strong>HDD</strong>-Technologie<br />
ebenfalls auf <strong>de</strong>m Vormarsch. Doch <strong>HDD</strong> kann mehr, es ermöglicht auch neue Wege<br />
in <strong>de</strong>r Trassenplanung und es ermöglicht vor allem auch in erheblicher Weise – wo<br />
netztechnisch möglich – kürzere bis sehr kurze Wege, wie sie im konventionellen<br />
Leitungsbau we<strong>de</strong>r planbar noch <strong>durch</strong>führbar sind.<br />
<strong>Kurze</strong> Wege helfen sparen<br />
<strong>Kurze</strong> Wege sparen Material, Zeit und Geld – dies ist bekannt und dies gilt überall.<br />
<strong>Kurze</strong> Wege im <strong>HDD</strong>-Verfahren wer<strong>de</strong>n bislang vor allem unter natürlichen o<strong>de</strong>r<br />
künstlichen Hin<strong>de</strong>rnissen eingesetzt und oftmals ist gar nicht bekannt, welche<br />
vielfältigen Möglichkeiten <strong>de</strong>r Wegeabkürzungen bestehen, die nicht <strong>durch</strong><br />
Hin<strong>de</strong>rnisse geprägt sind, son<strong>de</strong>rn nur einen kurzen Weg darstellen. Vielfach ist auch<br />
nicht bekannt, dass die <strong>HDD</strong>-Technologie keine bo<strong>de</strong>nbedingten<br />
Anwendungsgrenzen mehr kennt. Noch vor wenigen Jahren waren Fels im<br />
Untergrund o<strong>de</strong>r Geröll, Grobkies o<strong>de</strong>r Blöcke echte Hin<strong>de</strong>rnisse, die nur <strong>durch</strong><br />
beson<strong>de</strong>re Aufwändungen <strong>durch</strong>örtert wer<strong>de</strong>n konnten und daher in <strong>de</strong>r Trassenwahl<br />
gerne vermie<strong>de</strong>n wur<strong>de</strong>n. Auch hier hat sich die technische Anwendungswelt <strong>de</strong>s<br />
Horizontal Directional Drilling (=<strong>HDD</strong>) erheblich gewan<strong>de</strong>lt. Für Fels im Untergrund<br />
gibt es hervorragen<strong>de</strong> technische Lösungen mit Felsbohrmotoren, sogenannten<br />
Mudmotoren, die Gestein je<strong>de</strong>r Festigkeitsklasse bewältigen können, jedoch eine<br />
klare Bohrmeißelauswahl im Hinblick auf die Druckfestigkeit <strong>de</strong>s Felsmaterials<br />
benötigen. Für die sehr komplexen Fels- und Lockergesteins-Wechselabfolgen im<br />
Untergrund sind <strong>HDD</strong>-Bohranlagen mit Felsbohrköpfen und Doppelbohrgestängen<br />
die richtige Lösung, um solche Gesteinsabfolgen zu bewältigen. Die Geologie <strong>de</strong>s<br />
Untergrun<strong>de</strong>s sollte man kennen, um die dafür richtige <strong>HDD</strong>-Bohranlage und die<br />
richtigen <strong>HDD</strong>-Bohrwerkzeuge auszuwählen. Im <strong>HDD</strong>-Verfahren ist jedoch<br />
mittlerweile je<strong>de</strong> geologische Untergrundsituation beherrschbar und <strong>durch</strong>bohrbar,<br />
Anwendungsgrenzen, wie früher, gibt es nicht mehr.<br />
<strong>Bau</strong>stellenbeispiele<br />
Nachfolgend sind einige Beispiele für kurze Wege zur Leitungsverlegung dargestellt.<br />
Oft war die Unterfahrung von Hin<strong>de</strong>rnissen das Ziel, sie mögen jedoch auch indirekt
aufzeigen, dass natürlich auch Abkürzungsbohrungen ohne Hin<strong>de</strong>rnisse je<strong>de</strong>rzeit<br />
machbar sind und oft die bessere Trassenwahl darstellen können.<br />
Steilhangbohrung am Raichberg <strong>de</strong>r Zollernalb<br />
Die <strong>Bau</strong>stelle liegt nur wenige Kilometer vom Stammschloss <strong>de</strong>r Hohenzollern entfernt, bei<br />
Hechingen (Landkreis Balingen), im Südwesten <strong>de</strong>r Schwäbischen Alb. Dieses sogenannte<br />
Zollernalb-Gebiet zeichnet sich <strong>durch</strong> mehrere Beson<strong>de</strong>rheiten aus: Die sogenannte<br />
Traufkante <strong>de</strong>r Schwäbischen Alb (Albtrauf). Die Traufkante ist die steile Abbruchkante <strong>de</strong>r<br />
Schwäbischen Alb, die auch oft als Felskante zu erkennen ist und sie liegt 400 bis 450 m<br />
höher als das Vorland <strong>de</strong>r Alb. Die Steigung <strong>de</strong>r Traufkante beträgt bis zu 55%. Der Albtrauf<br />
selbst wird meist von Wald eingenommen und dieser Wald hat Bannwaldfunktion, er steht<br />
unter beson<strong>de</strong>rem Schutz, weil er die hohe Bergkante vor Rutschungen und Erosion schützen<br />
muss.<br />
Die Zollernalbregion ist zu<strong>de</strong>m Erdbebengebiet, das letzte <strong>de</strong>utlich vernehmbare Erdbeben<br />
war 2003, das letzte Erdbeben mit vielfachen Gebäu<strong>de</strong>schä<strong>de</strong>n fand am 3.9.1978 hier statt.<br />
Die Lage <strong>de</strong>r Bohrtrasse liegt direkt unter <strong>de</strong>r Gebirgskante <strong>de</strong>r Schwäbischen Alb also unter<br />
<strong>de</strong>m Steilhang <strong>de</strong>s Albtraufes, unter <strong>de</strong>m Bannwald, mitten im immer wie<strong>de</strong>r Erdbeben<br />
erschütterten Zollerngrabengebiet.<br />
Abb. 1: Geologische Untergrundsituation im Trassenbereich am Raichberg<br />
Die <strong>Bau</strong>aufgabe bestand in <strong>de</strong>r Verlegung einer 5 km Erdgasleitung für die Albstadtwerke,<br />
wovon 1000 m unter <strong>de</strong>m Steilhang <strong>de</strong>s Albtraufes zu verlegen waren. Im Sommer 2007<br />
wur<strong>de</strong> die kunststoff-ummantelte Stahlpipeline DA 273 auf 4 km Länge im Albvorland und<br />
auf <strong>de</strong>r Albhochfläche offen verlegt, während unter <strong>de</strong>m Steilhang (230 m Höhenunterschied<br />
bei bis zu 40 % Gefälle) die Verlegung in Form<br />
von 2 <strong>HDD</strong>- Bohrungen zu etwa jeweils 500m Länge erbracht wur<strong>de</strong>. Eine mittlere <strong>Bau</strong>grube<br />
an einem Waldweg am Steilhang war gestattet wor<strong>de</strong>n. Innerhalb <strong>de</strong>r Steilhangstrecke sollte<br />
die Erdgaspipeline zu<strong>de</strong>m in ein DA 450 – Schutzrohr aus Polyethylen verlegt wer<strong>de</strong>n, d.h. es<br />
mussten Bohrlöcher von über 600 mm Durchmesser (24 Zoll) erzeugt wer<strong>de</strong>n.
Abb. 2: Typischer Bannwaldausschnitt über <strong>de</strong>r <strong>HDD</strong>-Bohrung im Zollernalb-Gebiet<br />
Für die Bohrtechnik dieser sehr anspruchsvollen Steilhangbohrung waren zwei Bohranlagen<br />
von sehr unterschiedlicher Größe im Einsatz.<br />
Abb. 3: Bohrstartpunkt für die erste Pilotbohrung auf <strong>de</strong>r Albhochfläche<br />
Zum einen eine Grundodrill 20S – Bohranlage von Tracto-Technik (20 Tonnen Vor- und<br />
Rückschubkraft) für die Pilotbohrungen und zum an<strong>de</strong>ren eine Prime Drilling 80 – Tonnen –<br />
Bohranlage für die Aufweitungen und <strong>de</strong>n Rohreinzug im Fels. Die Pilotbohrungen erfolgten<br />
mit <strong>de</strong>r Grundodrill 20 S mit Mudmotoren im z.T. 220 MPa harten Gestein <strong>de</strong>s Weißen Juras.<br />
Die Aufweitungen wur<strong>de</strong>n mit <strong>de</strong>r Prime Drilling - Anlage in jeweils 3 Aufweitstufen (12“,<br />
20“ und 24“) mit speziellen Hole Openern vorgenommen, wobei z.T. die 20 Tonnen- und die
80 Tonnen-Bohranlage zeitweise Rücken an Rücken stan<strong>de</strong>n. Nach <strong>de</strong>m letzten Aufweitgang<br />
erfolgte nochmals ein Räumgang, bevor das 450er PE-Schutzrohr ins Bohrloch eingebracht<br />
wur<strong>de</strong>.<br />
Abb. 4: Der einzige Eingriff im Wald war eine Zwischengrube zwischen zwei 500 m langen<br />
Bohrungen. Links die 20-Tonnen - Grundodrill-Bohranlage bei einer <strong>de</strong>r bei<strong>de</strong>n<br />
Pilotbohrungen<br />
Die gesamte Bohrmaßnahme wur<strong>de</strong> innerhalb weniger Monate im Sommer 2007 von <strong>de</strong>r sehr<br />
erfahrenen Bohrfirma Max Wild GmbH aus Berkheim erstellt, und dies zur besten<br />
Zufrie<strong>de</strong>nheim <strong>de</strong>s Auftraggebers, <strong>de</strong>s Generalbauunternehmers, <strong>de</strong>s privaten Waldbesitzers<br />
und <strong>de</strong>r Naturschutzbehör<strong>de</strong>n.<br />
(Bericht: H.-J. Bayer und S. Bunger (Fa. Max Wild GmbH), Fotos und Grafikvorlage: H.-J. Bayer, Grafik: Y.<br />
Hennecke)<br />
Enge Kurve unter <strong>de</strong>r Enz<br />
Im Nord-Schwarzwald gibt es sehr viele enge Täler, die von Flüssen eingekerbt wur<strong>de</strong>n.<br />
Diese Flusstäler bil<strong>de</strong>n auch wichtige Verkehrswege, so dass sich dicht bewal<strong>de</strong>te Hanglagen,<br />
Straßen und Forstwege über <strong>de</strong>m wil<strong>de</strong>n Flussgrund die Talenge teilen müssen. Wenn<br />
Versorgungsleitungen solch eine Talkerbe queren müssen, geht es in je<strong>de</strong>r Weise eng zu. Bei<br />
Simmersfeld musste die Enz und eine Bun<strong>de</strong>sstraße nahezu rechtwinklig gequert wer<strong>de</strong>n, um<br />
eine Stromleitung (bisher witterungsanfällige Freileitung) als Erdkabel verlegen zu können.<br />
Große Teile <strong>de</strong>s Nordschwarzwal<strong>de</strong>s wer<strong>de</strong>n von einem sehr harten, rötlichem Sandstein<br />
geprägt, <strong>de</strong>m so genannten oberen Buntsandstein, welcher Druckfestigkeiten bis zu 240 MPa<br />
aufweisen kann. Gera<strong>de</strong> in engen Talabschnitten und unter <strong>de</strong>m Flussgrund steht dieser<br />
Sandstein zum Teil schon direkt in Form von Felsnasen an <strong>de</strong>r Oberfläche an, in <strong>de</strong>n<br />
Bereichen dazwischen und unter <strong>de</strong>r Flusssohle ist er nach wenigen Zentimetern bis<br />
Dezimetern zu fin<strong>de</strong>n. Die <strong>Bau</strong>aufgabe für die 144 m lange <strong>HDD</strong>-Bohrung war sehr<br />
herausfor<strong>de</strong>rnd, zumal ein Höhenunterschied von 26 m über zwei Hangflanken bewältigt<br />
wer<strong>de</strong>n musste, wobei <strong>de</strong>r Eintrittswinkel bei -40 % und <strong>de</strong>r Austrittwinkel bei +70 % lagen.
Drei Leerrohre in PE-HD 90 mm sollten in einem 10“ - Bohrloch im Buntsandsteinfels Platz<br />
fin<strong>de</strong>n.<br />
Abb. 1: Bohranlage 25 N im eingeschnittenen Waldweg<br />
Allein die Aufstellung <strong>de</strong>r Grundodrill 25 N - Bohranlage in einer engen und steilen<br />
Waldwegnische war nicht einfach und die enge Kurve unter <strong>de</strong>r wil<strong>de</strong>n Enz verlangte<br />
steuerungstechnisch ein Höchstmaß an Aufmerksamkeit. Der eingesetzte Grundorock 3 ¾<br />
Zoll Mudmotor mit einer Abwinkelung von 2,25° konnte seine beson<strong>de</strong>re Kurvengängigkeit<br />
beweisen und erlaubte die Fertigstellung <strong>de</strong>r Pilotbohrung innerhalb einer Tagesschicht.<br />
Abb. 2: Ankunft <strong>de</strong>s Bohrkopfes und Blick auf die Bohrtrasse
Zwei weitere Tage wur<strong>de</strong>n benötigt, um das Bohrloch mit einem 10“ Hole Opener<br />
aufzuweiten und das Rohr einzuziehen. Dabei wur<strong>de</strong> bei <strong>de</strong>r Aufweitung ein Schleppgestänge<br />
mit eingezogen. Nach erfolgter Aufweitung musste nur noch an das bereits im Bohrloch<br />
befindliche Gestänge ein Backreamer und die einzuziehen<strong>de</strong>n Rohre befestigt wer<strong>de</strong>n und <strong>de</strong>r<br />
Rohreinzug konnte problemlos abgeschlossen wer<strong>de</strong>n. Das Erdkabel unter <strong>de</strong>r Enz sorgt<br />
heute für eine sichere Stromverbindung, die we<strong>de</strong>r <strong>durch</strong> Sturmschä<strong>de</strong>n, <strong>durch</strong> Eislast, <strong>durch</strong><br />
abgeknickte Bäume o<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re Witterungseinflüsse unterbrochen wer<strong>de</strong>n kann.<br />
(Bericht: R. Schrinner und H.-J. Bayer, Fotos: R. Schrinner)<br />
Unter <strong>de</strong>r E<strong>de</strong>r im Kellerwald<br />
Flusstäler weisen häufig auch wichtige Verkehrswege auf, auch wenn <strong>de</strong>r Fluss eine weite<br />
Talaue besitzt. In Vöhl im nördlichen Kellerwald in Mittelhessen musste im Ortsteil<br />
Herzhausen eine Stromleitung unter <strong>de</strong>r E<strong>de</strong>r und unter einem stillgelegten Bahngleis verlegt<br />
wer<strong>de</strong>n. Die ruhige Lage hinter <strong>de</strong>m ehemaligen Bahndamm nutzt heute ein beliebter<br />
Campingplatz. Die Trasse für die Erdkabellegung lag laut Erkundungsbericht in einer<br />
Wechselfolge aus Grauwacken und Schieferfels, wobei an einem Waldweg Schiefer sichtbar<br />
anstehend vorgefun<strong>de</strong>n wur<strong>de</strong>. Der Stromversorger benötigte eine sichere Kabelverlegung<br />
unter <strong>de</strong>r E<strong>de</strong>r und <strong>de</strong>m Bahngleis, somit auf eine Querungslänge von fast 150 m. Gewünscht<br />
war ein Schutzrohr in PE-HD 160 mm zur Aufnahme <strong>de</strong>s neuen Erdkabels. Die E<strong>de</strong>r wur<strong>de</strong><br />
daher mit einer Grundodrill 15 N, bestückt mit einem Grundorock 2 7/8“ - Mudmotor, in einer<br />
Pilotbohrung unterfahren.<br />
Abb. 1+2: Bohrgerät in Arbeitsposition und Ortung vom Boot aus auf <strong>de</strong>r Hochwasser<br />
führen<strong>de</strong>n E<strong>de</strong>r
Durch Aufweitung mit einem Hole Opener konnte das Bohrloch auf über 210 mm aufgeweitet<br />
wer<strong>de</strong>n, so dass das gewünschte Schutzrohr als Abrollware eingezogen wer<strong>de</strong>n konnte. Die<br />
E<strong>de</strong>r führte zum Zeitpunkt <strong>de</strong>r Bohrarbeiten Hochwasser, für die Ortung <strong>de</strong>s Mudmotors unter<br />
<strong>de</strong>r Flusssohle musste das Ortungsboot mit einem quer gespannten Seil gesichert wer<strong>de</strong>n.<br />
Innerhalb weniger Tage, bevor das Wasser <strong>de</strong>r E<strong>de</strong>r noch höher steigen konnte, war die<br />
Bohrmaßnahme samt Rohreinzug been<strong>de</strong>t.<br />
(Bericht: R. Schrinner und H.-J. Bayer, Fotos: R. Schrinner)<br />
Stromkabel im Stadtgebiet <strong>durch</strong> Fels<br />
Die Hochschulstadt Freiberg in Sachsen, einst Hauptstadt <strong>de</strong>s Silberbergbaus im Erzgebirge,<br />
wird südlich <strong>de</strong>r Altstadt von <strong>de</strong>r mehrgleisigen Bahnlinie Dres<strong>de</strong>n - Chemnitz <strong>durch</strong>quert.<br />
Diese Bahnstrecke hat zwar viele Straßen<strong>durch</strong>lässe, für die Versorgungstechnik stellt sie<br />
<strong>de</strong>nnoch eine Trennlinie im Stadtgebiet dar, da sie die Bebauung <strong>de</strong>r Stadt in zwei Hälften<br />
trennt. So mussten von <strong>de</strong>r Silberhofstraße aus 20 kV - Erdkabel unter <strong>de</strong>m Bahnkörper und<br />
unter einer benachbarten Bergehal<strong>de</strong> (Abraumgestein <strong>de</strong>s Bergbaus) auf die auf die Südseite<br />
<strong>de</strong>r Bahnstrecke verlegt wer<strong>de</strong>n. Benötigt wur<strong>de</strong>n zwei Leerrohre in PE-HD mit 160 mm<br />
Außen<strong>durch</strong>messer. Der Versorgungsbetrieb entschied sich für zwei parallele jeweils 138 m<br />
lange <strong>HDD</strong>-Bohrungen, die aufgrund einer Bergbauhal<strong>de</strong> zum Teil bis in 16 m Tiefe geführt<br />
wur<strong>de</strong>n. Nahezu unter <strong>de</strong>m gesamten Stadtgebiet von Freiberg steht <strong>de</strong>r sehr harte Freiberger<br />
Gneis an (bis 250 MPa), <strong>de</strong>r zum Teil nur eine Verwitterungsüber<strong>de</strong>ckung von wenigen<br />
Dezimetern aufweist. Felsbohrungen waren gefragt, die mit einem Grundodrill 20 S und mit<br />
einem Grundrock 3 3/4 Zoll-Mudmotor, beginnend in einem Garagenhof, <strong>durch</strong>geführt<br />
wur<strong>de</strong>n.
Abb. 1+2: Bohranlage 20 S bei und nach <strong>de</strong>r Nie<strong>de</strong>rbringung <strong>de</strong>r 2. Bohrung<br />
Diese Bohrungen wur<strong>de</strong> jeweils mit einem 10“ Hole Opener in einem Arbeitsgang<br />
aufgeweitet. Beim Aufweiten wur<strong>de</strong> hinter <strong>de</strong>m Hole Opener ein Schleppgestänge<br />
eingezogen, hinter <strong>de</strong>m nochmals ein Backreamer befestigt war. Dieser Backreamer diente als<br />
Räum- und Reinigungs-Kopf für das daran angekoppelte Leerrohr. Für je<strong>de</strong> <strong>de</strong>r bei<strong>de</strong>n<br />
Bohrungen wur<strong>de</strong>n bis zum Einzug <strong>de</strong>r Leerrohre jeweils drei Arbeitstage benötigt.<br />
(Bericht: R. Schrinner und H.-J. Bayer, Fotos: R. Schrinner)
Abkürzung <strong>durch</strong> einen Felsrücken<br />
In <strong>de</strong>r Schwäbischen Alb, in einem Seitental zur Donau, entspringt die Zwiefaltener Ach in<br />
einer hochinteressanten Quellhöhle. Diese Quellhöhle, die Wimsener Höhle (auch<br />
Friedrichshöhle genannt) ist die einzige Tropfsteinhöhle Deutschlands, die mit einem<br />
Besucherboot befahren wer<strong>de</strong>n kann. Entsprechend hoch ist an vielen Wochenen<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>n<br />
Besuchszeiten von Frühjahr bis Herbst <strong>de</strong>r Besucherandrang, auch für die benachbarte<br />
Höhlengaststätte. Die Höhlengaststätte hat daher auch ein zeitweise sehr hohes<br />
Abwasseraufkommen, auf die Dauer zu viel für eine Sammelgrube. Über das<br />
För<strong>de</strong>rprogramm „Ländlicher Raum“ wur<strong>de</strong> daher vom Umweltministerium Ba<strong>de</strong>n-<br />
Württemberg <strong>de</strong>r <strong>Bau</strong> einer Abwasserfernleitung (Druckleitung) angeordnet, die auch die<br />
benachbarten Gebäu<strong>de</strong> sowie das im Tal etwas höher gelegene Schloss Ehrenfels anbin<strong>de</strong>n<br />
musste. Das obere Tal <strong>de</strong>r Zwiefaltener Ach steht teilweise unter Naturschutz, teilweise unter<br />
Landschaftsschutz. Unterhalb <strong>de</strong>s Höhlenhauses fließt die Ach in Schleifenform <strong>durch</strong> eine<br />
herrliche Felsenge, Grund genug, diesen Abschnitt vom Leitungsbau völlig zu verschonen.<br />
Man entschied, <strong>de</strong>n bis zu 50 Meter hohen und steilen Felsrücken in abkürzen<strong>de</strong>r Weise im<br />
Basisbereich zu <strong>durch</strong>bohren.<br />
Abb 1: Schematisches Vertikalprofil <strong>de</strong>r Bohrstrecke<br />
Hinter <strong>de</strong>m Nebengebäu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Höhlenhauses wur<strong>de</strong> eine 20t-<strong>HDD</strong>-Anlage (Typ Grundodrill<br />
20 S) und mit einem Grundorock-Mudmotor 3 ¾“ aufgebaut und leicht schräg geneigt, aber<br />
geradlinig <strong>durch</strong> <strong>de</strong>n Fels gebohrt. Das Gestein, ein klüftiger Weißjura-Massenkalk mit über<br />
200 mPa Druckfestigkeit wur<strong>de</strong> auf 90 m Länge, bis zur Gegenseite <strong>de</strong>s Felsrückens, z.T.<br />
unter 45 m Felsbe<strong>de</strong>ckung, an einem Tag mit einem 4 ½“-TCI-Rollenmeißel <strong>durch</strong>bohrt und<br />
am nächsten Tag wur<strong>de</strong> in <strong>de</strong>r Pilotbohrung die Abwasserdruckleitung eingezogen. Die<br />
Befürchtungen auf Felshohlräume im Massenkalk waren berechtigt, die Hohlräume blieben<br />
jedoch im Dezimeterbereich und führten zu keinen Bohrbeeinträchtigungen o<strong>de</strong>r<br />
Lageabweichungen. Die Ortung <strong>de</strong>s Bohrkopfsen<strong>de</strong>rs konnte nur bis etwa 15 m Tiefe
wahrgenommen wer<strong>de</strong>n und verlangte beinahe bergsteigerische Fähigkeiten vom<br />
Bohrmeister. Die ortungsfreie Strecke (etwa 50 m) wur<strong>de</strong>, wie gewünscht, geradlinig bei<br />
gleichmäßigen Gefälle, realisiert und <strong>de</strong>r geplante Anbin<strong>de</strong>punkt <strong>de</strong>r Leitung an die<br />
Talgrundstrecke sehr genau erreicht.<br />
Abb. 2 + 3: Grundodrill 20 S am Startplatz im Berghang oberhalb <strong>de</strong>r Zwiefalter Ach. Für die<br />
Ortung <strong>de</strong>s Bohrkopfsen<strong>de</strong>rs war Klettern an Hangfelsen angesagt.<br />
(Bericht: U. Harer und H.-J. Bayer, Fotos: H.-J. Bayer, Grafik: A. Knour)<br />
Unterbohrung <strong>de</strong>s Alpsees bei Immenstadt<br />
Der Alpsee befin<strong>de</strong>t sich 720 m über Meeresspiegel und liegt westlich von Immenstadt in <strong>de</strong>n<br />
Allgäuer Alpen (Südwest-Bayern). Die Berge nördlich <strong>de</strong>s Sees erreichen eine Höhe von<br />
1100 m, die südlich <strong>de</strong>s Sees sind mehr als 1800 m hoch. Der Alpsee selbst hat eine Ost-
West-Erstreckung von etwa 4 km und eine Nord-Süd-Erstreckung von maximal 1100 m. Die<br />
Tiefe <strong>de</strong>s Sees beträgt maximal 24 m. Die Geologie um <strong>de</strong>n See und unter <strong>de</strong>m See ist von<br />
Molassesedimenten <strong>de</strong>s Tertiärs bestimmt, am Seebo<strong>de</strong>n selbst ist Grundmoränematerial<br />
sedimentiert.<br />
Die Stadt Immenstadt hatte vom Land Bayern die Pflichtauflage erhalten, ein<br />
Ringentwässerungssystem um <strong>de</strong>n See zu bauen. Dieses System umfasste 560 m<br />
Gefälleleitungen, 9100 m Druckleitungen, 35 Pumpstationen und ihre notwendigen<br />
Ausrüstungen. Von <strong>de</strong>n Druckleitungen waren 2300 m unter <strong>de</strong>m Seegrund angeordnet,<br />
wobei die größte Herausfor<strong>de</strong>rung in einer nord-süd-gerichteten Seeunterquerung von 600 m<br />
Länge im westlichen und damit schmäleren Bereichs <strong>de</strong>s Sees lag. Die Tiefe <strong>de</strong>s Alpsees<br />
beträgt hier 16 m. Die Druckleitung hatte eine Min<strong>de</strong>stüber<strong>de</strong>ckung von 3 m unterhalb <strong>de</strong>s<br />
Seebo<strong>de</strong>ns einzuhalten. Die Stadtverwaltung von Immenstadt vergab diese Seeunterbohrung<br />
an das erfahrene Unternehmen Max Wild aus Illerbachen. Die Fa. Max Wild benutzte für<br />
diese Aufgabe einen Grundodrill 20S von Tracto-Technik und ein schmales Boot für die<br />
Ortung <strong>de</strong>s Bohrkopfes von <strong>de</strong>r Wasseroberfläche. Die Pilotbohrung wur<strong>de</strong> mit einem<br />
Lockergesteinskopf vorgenommen, da die Grundmoräne und die darunter folgen<strong>de</strong> Molasse<br />
diesen Bohrvortrieb erlaubten. Geschiebeblöcke (run<strong>de</strong> Felsbrocken) wur<strong>de</strong>n umbohrt und<br />
eine erfolgreiche Pilotbohrstrecke wur<strong>de</strong> innerhalb einer Tagesschicht und <strong>de</strong>r<br />
darauffolgen<strong>de</strong>n Nacht <strong>durch</strong>geführt. Der erste Aufweitprozess wur<strong>de</strong> gleich mit <strong>de</strong>m<br />
Rohreinzug von <strong>de</strong>r an<strong>de</strong>ren Seeseite kombiniert und benötigte ebenfalls eine Tages- und eine<br />
Nachtschicht. Die tatsächliche Bohrstrecke unter <strong>de</strong>m See betrug 650 m, es war die längste<br />
Seeunterquerung in <strong>de</strong>n Alpen und dies mit einer 20 t-Bohranlage. Die gesamte Bohrung und<br />
Rohrverlegung erfolgte in einer extrem kurzen Zeit und beeindruckte die Auftraggeber in<br />
je<strong>de</strong>r Weise.<br />
Abb.1+2 (oben und unten): Grundodrill 20 S – Bohranlage unterbohrt vom Ufersaum aus <strong>de</strong>n<br />
gesamten Alpsee in Nord-Süd-Richtung
(Fotoaufnahmen <strong>de</strong>r Fa. Max Wild)<br />
(Bericht: J. Schad und H.-J.Bayer, Fotos J. Schad)<br />
Weitere Vorteile<br />
<strong>Kurze</strong> Wege be<strong>de</strong>uten nicht nur geringere Investionen, son<strong>de</strong>rn auch dauerhaft<br />
geringere Unterhaltskosten. Doch es gibt weitere Vorteile, die immer wichtiger<br />
wer<strong>de</strong>n. In dicht besie<strong>de</strong>lten Räumen ist die Schonung von noch verbliebenen<br />
Landschaftsresten, aber auch die Schonung <strong>de</strong>r Kulturlandschaft und ihrer<br />
hochwertigen Infrastruktur, recht wichtig. Der Erhalt <strong>de</strong>s Bo<strong>de</strong>ngefüges, die<br />
Vermeidung von teurem Bo<strong>de</strong>naustausch o<strong>de</strong>r die Vermeidung von nachteiliger<br />
Bo<strong>de</strong>nverdichtung, sind beachtenswerte Faktoren gewor<strong>de</strong>n.<br />
Anhand <strong>de</strong>r beschriebenen <strong>Bau</strong>stellenbeispiele wur<strong>de</strong> aufgezeigt, dass die<br />
Überwindung von Hin<strong>de</strong>rnissen bzw. die unter Bohrung dieser Hin<strong>de</strong>rnisse auf<br />
kurzem Wege, technisch elegant und bautechnisch und recht geringen<br />
Aufwendungen möglich ist. Hin<strong>de</strong>rnisse, wie zum Beispiel felsige Berghänge,<br />
Felskuppen und Bergrücken, Steilkanten und steile Berghänge, aber auch Moor und<br />
Sumpfgebiete, Flüsse und Seen, Biotope, Landschafts- und Naturschutzgebiete,<br />
aber auch künstliche Hin<strong>de</strong>rnisse, wie Deiche und Dämme, Verkehrswege, Gebäu<strong>de</strong><br />
und Ingenieurbauwerke, lassen sich je<strong>de</strong>rzeit bohrtechnisch unterfahren. Jedoch<br />
auch ein hin<strong>de</strong>rnisfreien Bereichen kann und sollte an bohrtechnische Leitungsbau-<br />
Maßnahmen gedacht wer<strong>de</strong>n, sie sind umweltschonend, oberflächenschonend,<br />
kostengünstig im Hinblick auf Investitionen und Unterhalt, und sie erbringen noch<br />
einen weiteren Vorteil, <strong>de</strong>r viel zu selten berücksichtigt wird: im <strong>HDD</strong>-Verfahren<br />
grabenlos verlegte Leitungen sind, unter Beachtung <strong>de</strong>r Qualitätsmaßstäbe aus <strong>de</strong>r<br />
DVGW GW 321 und <strong>de</strong>n technischen Regeln <strong>de</strong>s DCA (= Verband Güteschütz für<br />
Horizontalbohrungen), sehr langlebig. Der Erhalt <strong>de</strong>s Bo<strong>de</strong>ngefüges über <strong>de</strong>r<br />
Leitung, die da<strong>durch</strong> bedingte erdstatisch i<strong>de</strong>ale Bettungssituation für die Leitung und
die sehr gute, ringförmig umschließen<strong>de</strong>n und bettungselastische Einbettung <strong>de</strong>r<br />
Leitung in Bohrsuspension mit gesteuerter Dichte und Zusammensetzung, bil<strong>de</strong>n<br />
optimale Voraussetzungen für eine hohe Lebensdauer. Leitungsbettungen im<br />
offenen Graben stellen hingegen sehr raue und ungleiche erdstatische<br />
Rahmenbedingungen dar, die oftmals nicht annähernd an die Bettungsqualität von<br />
<strong>HDD</strong> verlegten Leitungen heranreichen. Langlebige Leitungen sind auch beson<strong>de</strong>rs<br />
wirtschaftliche Leitungen.<br />
Literaturhinweise<br />
BAYER, H.-J. (2005): <strong>HDD</strong>-Praxis-Handbuch, 196 S., Vulkan-Verlag, Essen.<br />
BAYER, H.-J. & HARER, U. (2006): <strong>HDD</strong>-Felsbohren – Gesteuerte Bohrungen im<br />
Fels. – tis 1-2/2006, Gütersloh.<br />
BAYER, H.-J. & BUNGER, S. (2008): 1000 m <strong>HDD</strong>-Felsbohrung am Steilhang im<br />
Erdbebengebiet. 3R Int. 47, Nr.1/2008<br />
BAYER, H.-J. (2010): Berg<strong>durch</strong>bohrungen für <strong>de</strong>n Pipelinebau in Felsregionen<br />
und Anlandungsbohrungen unter Küstenzonen. – Felsbaumagazin 2010, Heft 1:<br />
S. 38 – 46, Essen.<br />
BAYER, H.-J. (2011): Tunnelnachrüstungen und Tunnelverbesserungen mit <strong>de</strong>m<br />
<strong>HDD</strong>-Verfahren. – Felsbaumagazin 2011, Heft 4, Essen.<br />
BOHLSEN Ingenieure (2007): Trinkwasser für Trais. – bi Umweltbau 5/2007, S. 29<br />
–30, Kiel.<br />
ELBE, L. & BAYER, H.-J. (Herausg., 2010): Bohrspülungen für <strong>HDD</strong>- und<br />
Geothermie-Bohrungen; IRO-Bd. 26, Inst. für Rohrleitungsbau Ol<strong>de</strong>nburg, 273 S.,<br />
Vulkan-Verlag, Essen.<br />
FENGLER, E. G. / BUNGER, S. (2007): Grundlagen <strong>de</strong>r Horizontalbohrtechnik<br />
(Herausgeg.: Wegener, T.), Iro-Schriftreihe Nr. 13, Essen: Vulkan-Verlag.<br />
GASVERBUND MITTELLAND AG (2005): Gemein<strong>de</strong> Reigoldswil – Umlegung <strong>de</strong>r<br />
Erdgasleitung. Projektbericht, 5 p., Arlesheim, Switzerland.<br />
HAMERS, M., SCHAUERTE, Th. & BAYER, H.-J. (2010): High-Tech in <strong>HDD</strong>-Anlagen<br />
– Technischer Generationensprung. – bi Umweltbau, 1/2010, S. 32 – 35, Kiel.<br />
HASHASH, Y. & JAVIER, J. (2011) Evaluation of Horizontal Directional Drilling<br />
(<strong>HDD</strong>). – Illinois Center for Transportation, Research Report ICT-11-095.<br />
HOBOHM, St. et al. (2011) : Grabenlose Einbauverfahren mit duktilen Gussrohren. –<br />
125 S., Fa. DUKTUS Rohrsysteme Wetzlar.<br />
LÜBBERS, H. (2011): www.documentation.erf - Powerpoint-Präsentation über die<br />
erfor<strong>de</strong>rliche Dokumentation bei <strong>HDD</strong>-Projekten. – DCA / RBV -<br />
Weiterbildungsseminar, Kassel.
MASSELLA, N. (2010): <strong>HDD</strong> successfully used for challenging rock drilling at Riva<br />
<strong>de</strong>l Garda. – Report Trenchless Techn. Italia s.r.l, Arbizzano.<br />
MAX WILD GmbH (2005): Firmenpräsentation 50 Jahre Max Wild (inkl.<br />
<strong>Bau</strong>stellenberichte). – Illerbachen-Berkheim, Germany.<br />
NAUJOKS. G. (2011): Erdverkabelung im Fels unter ICE-Strecke, Autobahn und<br />
Landstraße. - <strong>Bau</strong>stellenreportage, Tracto-Technik GmbH & Co KG, Lennestadt.<br />
NAUJOKS, G. (2011): Bohrung im Steilhang. - <strong>Bau</strong>stellenreportage, Tracto-Technik<br />
GmbH & Co KG, Lennestadt.<br />
PRIME-DRILLING GmbH (2011): Bohrgeräte und Zubehör-Informationen. – Wen<strong>de</strong>n<br />
bei Olpe.<br />
RAMEIL, M. (2010): Rohrleitungserneuerung mit Berstverfahren. – 2. Aufl., 376 S.,<br />
Vulkan-Verlag, Essen.<br />
ROSCHER, H. & RICHTER, B. (2009): Vorteile <strong>de</strong>r grabenlosen <strong>Bau</strong>weise im<br />
Druckrohrbereich – Ergebnisse <strong>de</strong>s RSV-Arbeitskreises. – IRO-Band 33, Ol<strong>de</strong>nburg,<br />
(Vulkan-Verlag, Essen.<br />
SAUER, F. & HERMSMEIER, M. (2010): <strong>HDD</strong>-Querung <strong>de</strong>r A 44 in Ratungen. – bi<br />
Umweltbau, 5/2010, S. 38 – 40, Kiel.<br />
TRACTO-TECHNIK GmbH & Co KG. (Hrsg., 2008): Horizontal-Spülbohrungen –<br />
Intelligent gelöst. Booklet, 95 S., Lennestadt.<br />
TRACTO-TECHNIK GmbH & Co KG. (2012): Der neue Grundodrill 18 ACS (All<br />
condition system). – Tractuell 46/12, S. 4 – 6, Lennestadt.<br />
Van <strong>de</strong>r WERFF, H. (2011): Horizontal Directional Drilling – <strong>de</strong>aling with the<br />
challanges. State of the Art <strong>de</strong>velopments. – Session P, Deltares Aca<strong>de</strong>my, Delft.<br />
WILLOUGHBY, D. A, (2005): Horizontal Directional Drilling. Utility and Pipeline<br />
Applications. – McGraw-Hill, Civil Engineering, 393 p., New York.<br />
Anschrift <strong>de</strong>s Verfassers<br />
Dr. Hans-Joachim Bayer, Im Grund 24, 72664 Kohlberg