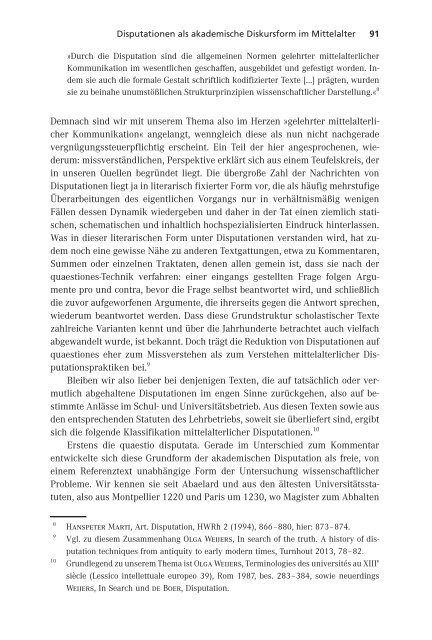Michael Beyer | Martin Hauger | Volker Leppin (Hrsg.): Ausstrahlung und Widerschein (Leseprobe)
Der Theologische Arbeitskreis für Reformationsgeschichtliche Forschung (TARF) gibt seit über 50 Jahren vor allem in Wittenberg der internationalen Luther- und Reformationsforschung einen Ort des Austauschs zwischen den großen Lutherkongressen. Damit bot er während der 1970er und 1980er Jahre dem Lutherhaus in Wittenberg Schutz vor ideologischer Überfremdung sowie der kirchlich- und theologisch verantworteten Lutherforschung in Ost und West eine Vergleichsebene. In der Reformationsdekade 2008 bis 2017 entstand der später noch weitergeführte Plan, der europäischen Rezeption von reformatorischen Impulsen nachzugehen, die Wittenberg ausgestrahlt hatte und die unter anderen historischen Bedingungen an unterschiedlichen Orten ihre spezifische Wirkung entfalteten. Dieser Band bietet eine Auswahl der entstandenen Beiträge.
Der Theologische Arbeitskreis für Reformationsgeschichtliche Forschung (TARF) gibt seit über 50 Jahren vor allem in Wittenberg der internationalen Luther- und Reformationsforschung einen Ort des Austauschs zwischen den großen Lutherkongressen. Damit bot er während der 1970er und 1980er Jahre dem Lutherhaus in Wittenberg Schutz vor ideologischer Überfremdung sowie der kirchlich- und theologisch verantworteten Lutherforschung in Ost und West eine Vergleichsebene. In der Reformationsdekade 2008 bis 2017 entstand der später noch weitergeführte Plan, der europäischen Rezeption von reformatorischen Impulsen nachzugehen, die Wittenberg ausgestrahlt hatte und die unter anderen historischen Bedingungen an unterschiedlichen Orten ihre spezifische Wirkung entfalteten. Dieser Band bietet eine Auswahl der entstandenen Beiträge.
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Disputationen als akademische Diskursform im Mittelalter 91<br />
»Durch die Disputation sind die allgemeinen Normen gelehrter mittelalterlicher<br />
Kommunikation im wesentlichen geschaffen, ausgebildet <strong>und</strong> gefestigt worden. Indem<br />
sie auch die formale Gestalt schriftlich kodifizierter Texte […] prägten, wurden<br />
sie zu beinahe unumstößlichen Strukturprinzipien wissenschaftlicher Darstellung.« 8<br />
Demnach sind wir mit unserem Thema also im Herzen »gelehrter mittelalterlicher<br />
Kommunikation« angelangt, wenngleich diese als nun nicht nachgerade<br />
vergnügungssteuerpflichtig erscheint. Ein Teil der hier angesprochenen, wiederum:<br />
missverständlichen, Perspektive erklärt sich aus einem Teufelskreis, der<br />
in unseren Quellen begründet liegt. Die übergroße Zahl der Nachrichten von<br />
Disputationen liegt ja in literarisch fixierter Form vor, die als häufig mehrstufige<br />
Überarbeitungen des eigentlichen Vorgangs nur in verhältnismäßig wenigen<br />
Fällen dessen Dynamik wiedergeben <strong>und</strong> daher in der Tat einen ziemlich statischen,<br />
schematischen <strong>und</strong> inhaltlich hochspezialisierten Eindruck hinterlassen.<br />
Was indieser literarischen Form unter Disputationen verstanden wird, hat zudem<br />
noch eine gewisse Nähe zu anderen Textgattungen, etwa zu Kommentaren,<br />
Summen oder einzelnen Traktaten, denen allen gemein ist, dass sie nach der<br />
quaestiones-Technik verfahren: einer eingangs gestellten Frage folgen Argumente<br />
pro <strong>und</strong> contra, bevor die Frage selbst beantwortet wird, <strong>und</strong> schließlich<br />
die zuvor aufgeworfenen Argumente,die ihrerseits gegen die Antwort sprechen,<br />
wiederum beantwortet werden. Dass diese Gr<strong>und</strong>struktur scholastischer Texte<br />
zahlreiche Varianten kennt <strong>und</strong> über die Jahrh<strong>und</strong>erte betrachtet auch vielfach<br />
abgewandelt wurde,ist bekannt. Doch trägt dieReduktion von Disputationen auf<br />
quaestiones eher zum Missverstehen als zum Verstehen mittelalterlicher Disputationspraktiken<br />
bei. 9<br />
Bleiben wir also lieber bei denjenigen Texten, die auf tatsächlich oder vermutlich<br />
abgehaltene Disputationen imengen Sinne zurückgehen, also auf bestimmte<br />
Anlässe im Schul- <strong>und</strong> Universitätsbetrieb. Aus diesen Texten sowie aus<br />
den entsprechenden Statuten des Lehrbetriebs, soweit sie überliefert sind, ergibt<br />
sich die folgende Klassifikation mittelalterlicher Disputationen. 10<br />
Erstens die quaestio disputata. Gerade im Unterschied zum Kommentar<br />
entwickelte sich diese Gr<strong>und</strong>form der akademischen Disputation als freie, von<br />
einem Referenztext unabhängige Form der Untersuchung wissenschaftlicher<br />
Probleme. Wir kennen sie seit Abaelard <strong>und</strong> aus den ältesten Universitätsstatuten,<br />
also aus Montpellier 1220<strong>und</strong> Paris um 1230, wo Magisterzum Abhalten<br />
8<br />
9<br />
10<br />
Hanspeter Marti, Art. Disputation, HWRh 2(1994), 866–880, hier: 873–874.<br />
Vgl. zu diesem Zusammenhang Olga Weijers, Insearch of the truth. Ahistory of disputation<br />
techniques from antiquity to early modern times, Turnhout 2013, 78–82.<br />
Gr<strong>und</strong>legend zu unserem Thema ist Olga Weijers, Terminologies des universités au XIII e<br />
siècle (Lessico intellettuale europeo 39), Rom 1987, bes. 283–384, sowie neuerdings<br />
Weijers, InSearch <strong>und</strong> de Boer, Disputation.