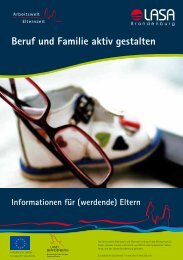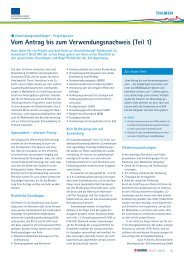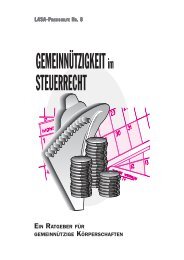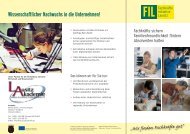Endbericht Formative Evaluation der Innopunkt- Kampagne - LASA ...
Endbericht Formative Evaluation der Innopunkt- Kampagne - LASA ...
Endbericht Formative Evaluation der Innopunkt- Kampagne - LASA ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Endbericht</strong><br />
Institut für Sozialökonomische Strukturanalysen GmbH<br />
<strong>Formative</strong> <strong>Evaluation</strong> <strong>der</strong> <strong>Innopunkt</strong>-<br />
<strong>Kampagne</strong> „Wissenstransfer zwischen<br />
Wissenschaft und Unternehmen stärken“<br />
Auftraggeber:<br />
Landesagentur für Struktur und Arbeit (<strong>LASA</strong>)<br />
Brandenburg<br />
Ansprechpartner:<br />
Institut SÖSTRA GmbH<br />
Institut für Sozialökonomische Strukturanalysen<br />
Dr. Gerd Walter<br />
Dr. Herbert Berteit<br />
Berlin, 04.12.2008
I n h a l t<br />
<strong>Endbericht</strong> <strong>der</strong> wissenschaftlichen Begleitung<br />
1. Einleitung 3<br />
1.1 Ziele <strong>der</strong> formativen <strong>Evaluation</strong> 3<br />
1.2 Projektdesign 4<br />
2. Wissenstransfer in Brandenburg 5<br />
2.1 Transferstellen an Hochschulen 5<br />
2.2 Branchentransferstellen 7<br />
2.3 Spezifische Ansatzpunkte <strong>der</strong> <strong>Innopunkt</strong>-<strong>Kampagne</strong> 7<br />
3. Profil <strong>der</strong> beteiligten Betriebe 8<br />
4. Erfolgsvoraussetzungen für den Wissenstransfer 11<br />
4.1 Rahmenbedingungen <strong>der</strong> Branchen und Technologiefel<strong>der</strong> 12<br />
4.2 Transfermanagement 17<br />
4.3 Betriebe 20<br />
4.4 Fazit 21<br />
5. Relevante Instrumente für den Wissenstransfer 23<br />
5.1 Aktivierende und aufsuchende Beratung 25<br />
5.2 Vertrauensbildung 26<br />
5.3 Dialogisches Vorgehen 29<br />
5.4 Flexibler und bedarfsgerechter Einsatz von Instrumenten 31<br />
5.5 Personaltransfer 33<br />
5.6 Fazit 34<br />
6. Ausgewählte Good-Practices 35<br />
6.1 Auswahlkriterien 35<br />
6.2 Einstieg in ein neues Technologiefeld 38<br />
6.3 Innovationskompetenz durch Personaltransfer 39<br />
6.4 Verbesserung des anwendungsnahen Ausbildungsprofils 41<br />
6.5 Fazit 43<br />
7. Handlungsempfehlungen 43<br />
Anhang 1 48<br />
Vorhaben-Steckbrief 48<br />
Anhang 2 49<br />
Indikatorenset 49<br />
2
1 . E i n l e i tung<br />
1.1 Ziele <strong>der</strong> formativen <strong>Evaluation</strong><br />
<strong>Endbericht</strong> <strong>der</strong> wissenschaftlichen Begleitung<br />
Im Rahmen <strong>der</strong> <strong>Innopunkt</strong>-<strong>Kampagne</strong> haben 6 Projektträger in 6 verschiedenen<br />
Branchen und Kompetenzfel<strong>der</strong>n Brandenburgs Wissenschaftler mit Unterneh-<br />
men vernetzt, um den aktiven Wissenstransfer zu unterstützen und Produkt- und<br />
Verfahrensinnovationen in den beteiligten Unternehmen zu för<strong>der</strong>n.<br />
Das Ziel <strong>der</strong> Projektnetzwerke bestand in <strong>der</strong> Entwicklung und Erprobung neuer<br />
innovativer Kommunikationsformen und –strukturen des Wissenstransfers. Das<br />
Kernziel <strong>der</strong> <strong>Evaluation</strong> bestand darin, die am besten geeigneten Instrumente für<br />
einen erfolgreichen Wissenstransfer zu identifizieren. Diese Zielsetzung wurde<br />
durch spezifische Fragestellungen präzisiert, die sowohl Erfolgsvoraussetzungen<br />
und Einflussfaktoren für den Wissenstransfer betreffen als auch Good-Practices.<br />
Im Einzelnen wurden folgende Aufgabenschwerpunkte bearbeitet:<br />
Entwicklung eines Indikatorensets zur Bewertung <strong>der</strong> Vorhaben<br />
Um erfolgreiche und übertragbare Muster des Wissenstransfers zu identifizieren,<br />
wurden Indikatoren zur Innovationsfähigkeit <strong>der</strong> Unternehmen, zum Innovations-<br />
grad des geplanten Vorhabens, zu Outputs während des Wissenstransfers, zum<br />
Verlauf <strong>der</strong> För<strong>der</strong>ung und zu den Ergebnisse und Wirkungen des Transferma-<br />
nagements entwickelt. 1<br />
Bestimmung von Einfluss- und Erfolgsfaktoren des Wissenstransfers<br />
Um die Arbeit <strong>der</strong> Projektträger vor dem Hintergrund unterschiedlicher Ausgangs-<br />
lagen und Rahmenbedingungen in <strong>der</strong> Branche vergleichen und beurteilen zu<br />
können, wurden externe Einflussfaktoren bestimmt, welche das Transfermana-<br />
gement <strong>der</strong> Projektträger för<strong>der</strong>n o<strong>der</strong> einschränken.<br />
Bestimmung von Good-Practices im Transfermanagement<br />
Die konkreten Instrumente im Wissenstransfer wurden auf ihre Wirksamkeit hin<br />
überprüft. Dazu wurden Kriterien zur Kontrolle des Projektfortschritts und Maß-<br />
stäbe für die Beurteilung von Good-Practices entwickelt.<br />
Entwicklung von Handlungsempfehlungen<br />
Aus <strong>der</strong> Gesamtschau <strong>der</strong> empirischen Befunde wurden Aussagen dazu entwi-<br />
ckelt, ob und wie <strong>der</strong> Wissenstransfer weiter geführt werden sollte, in welchen<br />
1 Die Indikatoren sind im Anhang 2 einzusehen.<br />
3
<strong>Endbericht</strong> <strong>der</strong> wissenschaftlichen Begleitung<br />
Strukturen und mit welchen Akteuren <strong>der</strong> Wissenstransfer weiter geführt werden<br />
und auf welche Schwerpunkte und Ziele sich künftige Aktivitäten zum Wissens-<br />
transfer konzentrieren sollten.<br />
Projektbegleitung durch Erfahrungsaustausch<br />
Alle Arbeitschritte wurden in Erfahrungsaustauschrunden und Workshops mit den<br />
Projektträgern und dem Auftraggeber diskutiert. Die Workshops wurden dazu ge-<br />
nutzt, Befunde aus <strong>der</strong> <strong>Evaluation</strong>sarbeit vorzustellen und weitere Schritte abzu-<br />
stimmen. Der Erfahrungsaustausch auf den Workshops sollte dazu beigetragen,<br />
Projektfortschritte und Probleme zu kommunizieren, Leistungsvergleiche zu er-<br />
möglichen und gemeinsame Lernprozesse zu ermöglichen, indem sowohl gute<br />
Projektbeispiele, als auch Probleme in <strong>der</strong> konkreten Projektarbeit diskutiert wur-<br />
den. Auf diese Weise hat die <strong>Evaluation</strong> auch an <strong>der</strong> Erfolgskontrolle und Quali-<br />
tätssicherung in <strong>der</strong> <strong>Kampagne</strong> mitgewirkt.<br />
1.2 Projektdesign<br />
Die folgende Abbildung verdeutlicht die wesentlichen Arbeitsmodule <strong>der</strong> formati-<br />
ven <strong>Evaluation</strong> und gibt eine Übersicht zu ihren Zielen und Arbeitsmethoden.<br />
Abb. 1: Arbeitsmodule und Methoden im Überblick<br />
4
2 . W i s s e n s transfer in Brandenburg<br />
<strong>Endbericht</strong> <strong>der</strong> wissenschaftlichen Begleitung<br />
Ende 2005 hat Brandenburg das „Landesinnovationskonzept 2006“ (LIK) verab-<br />
schiedet, in dem strategische Leitlinien für die Entwicklung <strong>der</strong> Branchenkompe-<br />
tenzfel<strong>der</strong> in Brandenburg formuliert werden. Ein zentraler Ansatzpunkt wird<br />
demnach in <strong>der</strong> stärkeren Vernetzung zwischen Wirtschaft und Wissenschaft ge-<br />
sehen. Zwar verfügt Brandenburg bereits über ein differenziertes System aus<br />
Transferstellen an Hochschulen und Branchennetzwerken, die Technologie- und<br />
Wissenstransfer für ihre Mitglie<strong>der</strong> organisieren. Aber nur in wenigen Branchen-<br />
kompetenzfel<strong>der</strong>n besteht ein Gleichgewicht bzw. eine Verknüpfung zwischen<br />
Forschung, Entwicklung, Produktion und Markterschließung (Landesinnovations-<br />
konzept Brandenburg 2006: 19f.). Als verbesserungsfähig wird insbeson<strong>der</strong>e die<br />
regionale Vernetzung zwischen Forschung und Entwicklung (FuE) und kleinen<br />
und mittleren Unternehmen (KMU) eingestuft. Aus diesem Grund nimmt <strong>der</strong> Wis-<br />
senstransfer zwischen Wissenschaft und Wirtschaft eine zentrale Rolle in <strong>der</strong> In-<br />
novationsstrategie des Landes ein.<br />
Die ZAB ZukunftsAgentur Brandenburg GmbH koordiniert mit ihrem Transfer-<br />
zentrum für Existenzgründung, Innovation und Netzwerke den Technologietrans-<br />
fer in Brandenburg. Neben <strong>der</strong> inhaltlichen Betreuung des gesamten Transfersys-<br />
tems unterstützt die ZAB die Transferstellen bei ihren Marketing-Aktivitäten.<br />
2.1 Transferstellen an Hochschulen<br />
Brandenburgs Wirtschaft steht eine vielschichtige Wissenschaftslandschaft mit 9<br />
Hochschulen und mehr als 20 außeruniversitären Forschungseinrichtungen für<br />
den Wissenstransfer zur Verfügung. An 8 Hochschulen sind Technologie- und<br />
Innovationsberatungsstellen (TIBS) eingerichtet worden, <strong>der</strong>en Aufgabenspekt-<br />
rum unterschiedlichste Formen des Austausches zwischen Wissenschaft und<br />
Wirtschaft umfasst. Zu den Methoden und Instrumenten des Wissenstransfers<br />
aus Brandenburger Hochschulen in die Wirtschaft zählen:<br />
� Auftragsforschung, Gutachten o<strong>der</strong> Beratungen<br />
� Ergebnisoffene För<strong>der</strong>ung wissenschaftlicher Einrichtungen durch Unternehmen<br />
(Wissenschafts-Sponsoring)<br />
� Tagungen, Konferenzen, Workshops<br />
� Informelle Treffen<br />
� Nutzung von Transfereinrichtungen (z.B. für Qualifizierung, Beratung, Information,<br />
Kontaktherstellung usw.),<br />
� Entwicklung, Durchführung und Organisation von Weiterbildungsmaßnahmen<br />
zugeschnitten auf die Bedürfnisse von Unternehmen<br />
5
<strong>Endbericht</strong> <strong>der</strong> wissenschaftlichen Begleitung<br />
� Transfer über Köpfe (Mitarbeiter wissenschaftlicher Einrichtungen gehen in<br />
KMU als Praktikanten, Innovationsassistenten, Absolventen, o<strong>der</strong> zeitlich befristet<br />
im Rahmen von Kooperationsprojekten usw.),<br />
� Ausgründungen<br />
� Patente, Lizenzen<br />
� Öffentlichkeitsarbeit <strong>der</strong> FuE-Einrichtungen z.B. durch Messebeteiligungen<br />
� Mitwirkung in Verbundprojekten (z.B. Industrielle Gemeinschaftsforschung,<br />
ProInno)<br />
� Mitwirkung in Netzwerken (Bündelung von Kompetenzen, Potenzialen und<br />
Ressourcen). 2<br />
Von den Experten ausgewählter Hochschultransferstellen wurde betont, dass<br />
keine dieser Formen des Wissenstransfers <strong>der</strong> „Königsweg“ sei, <strong>der</strong> allen ande-<br />
ren Instrumenten überlegen wäre und sie überflüssig mache. Sie seien vielmehr<br />
als komplementäre Wege des Transfers zu verstehen, die jeweils verschiedenen<br />
Situationen, Themen und Zielgruppen anzupassen wären.<br />
Mit diesen Instrumenten sorgen die Transferstellen an den Hochschulen dafür,<br />
dass aktuelle Ergebnisse wissenschaftlicher FuE auch Betrieben zugänglich ge-<br />
macht werden. Sie agieren allerdings in erster Linie als Dienstleister für ihre je-<br />
weilige Wissenschaftseinrichtung. Und mit ihren Strategien zur Informations- und<br />
Öffentlichkeitsarbeit erreichen sie hauptsächlich ein interessiertes Fachpublikum,<br />
für das Hochschul-Kooperationen und FuE-Projekte grundsätzlich als Hand-<br />
lungsoption in Frage kommen.<br />
Wenn <strong>der</strong> Wissenstransfer als Innovationsför<strong>der</strong>ung für KMU wirken und insbe-<br />
son<strong>der</strong>e auch solche Betriebe ansprechen soll, die bislang wenig o<strong>der</strong> keine Er-<br />
fahrung mit Hochschulkooperationen haben, muss <strong>der</strong>en betriebliche Perspektive<br />
zum Ausgangspunkt für FuE genommen werden. Ihr Bedarf an wissenschaftli-<br />
chen Dienstleistungen entsteht häufig aus Kundenanfor<strong>der</strong>ungen o<strong>der</strong> aus <strong>der</strong><br />
Kenntnis <strong>der</strong> Nachfrage eines spezifischen Marktes. Eine bedarfsgerechte Förde-<br />
rung des Wissenstransfers setzt an diesen Markt- bzw. Branchen-getriebenen<br />
Impulsen zur Innovation an und richtet die Ziele <strong>der</strong> wissenschaftlichen FuE dar-<br />
auf aus, entsprechende Probleme mit den Betrieben zu lösen. Eine spezifische<br />
Branchenkompetenz und Kenntnis <strong>der</strong> relevanten regionalen Akteure in einer<br />
Branche o<strong>der</strong> einem Technologiefeld sind dafür eine wesentliche Voraussetzung.<br />
2 Vgl. dazu auch: Schmoch U., Licht G., Reinhard M. 2000: Wissens- und Technologietransfer<br />
in Deutschland, Fraunhofer-IRB-Verlag, Stuttgart, S. 8<br />
6
2.2 Branchentransferstellen<br />
<strong>Endbericht</strong> <strong>der</strong> wissenschaftlichen Begleitung<br />
Um mehr Nähe zu den betrieblichen Bedarfen herzustellen, agieren Branchen-<br />
transferstellen in branchenbezogenen betrieblichen Netzwerken. An <strong>der</strong> Inno-<br />
punkt-<strong>Kampagne</strong> zum Wissenstransfer waren die Branchennetzwerke Automoti-<br />
ve, Informations- und Kommunikationstechnologien, Metall- und Elektroindustrie<br />
und Logistik beteiligt. Diese Netzwerke verfolgen das Ziel, die Wettbewerbs- und<br />
Innovationsfähigkeit <strong>der</strong> Unternehmen ihrer jeweiligen Branchen zu stärken. Da-<br />
zu nehmen sie u.a. auch Aufgaben im Technologie- und Wissenstransfer wahr.<br />
Die <strong>Innopunkt</strong>-<strong>Kampagne</strong> hatte deswegen auch das Ziel, die Branchennetzwerke<br />
mit Erkenntnissen über geeignete und vorbildliche Instrumente und Methoden<br />
des Wissenstransfers zu unterstützen. Beson<strong>der</strong>s in den Branchenkompetenzfel-<br />
<strong>der</strong>n sollen Forschungsergebnisse für die Wirtschaft nutzbar gemacht und offene<br />
Fragen zu Innovationsvorhaben aus den Unternehmen in die Forschung einge-<br />
bracht werden.<br />
2.3 Spezif ische Ansatzpunkte <strong>der</strong> <strong>Innopunkt</strong>-<strong>Kampagne</strong><br />
Zusammen mit den Hochschulen und FuE-Einrichtungen in Berlin steht den Un-<br />
ternehmen Brandenburgs deutschlandweit die höchste Konzentration an Fach-<br />
hochschulen, Hochschulen und Universitäten für Kooperationen zur Verfügung.<br />
Dieses vielfältige und einmalige Potenzial sollte mit <strong>der</strong> <strong>Innopunkt</strong>-<strong>Kampagne</strong><br />
noch stärker für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes erschlossen werden.<br />
Insbeson<strong>der</strong>e ging es darum, das Problemlösungspotenzial <strong>der</strong> anwendungsbe-<br />
zogenen Fachhochschulen für innovationsorientierte Fragestellungen <strong>der</strong> Unter-<br />
nehmen zu nutzen.<br />
Im Vergleich zum breiten Spektrum an Instrumenten, die von den Hochschul-<br />
transferstellen eingesetzt werden, konzentrierte sich die <strong>Innopunkt</strong>-<strong>Kampagne</strong><br />
von vornherein auf einen ausgewählten Fokus von Methoden. Im Mittelpunkt<br />
stand die Vernetzung von Hochschulen und Betrieben in gemeinsamen Projekten<br />
zur Durchführung von Innovationsvorhaben, die den beteiligten Betrieben z.B.<br />
den Einstieg in ein neues Technologiefeld ermöglichen o<strong>der</strong> die Realisierung ei-<br />
nes technologisch komplexen Kundenauftrages. Im Rahmen dieser gemeinsa-<br />
men Innovationsprojekte wurden weitere methodische Bausteine verwendet, wie<br />
z.B. <strong>der</strong> Personaltransfer, Weiterbildungen und Coaching für Geschäftsführung<br />
und Mitarbeiter. Der beson<strong>der</strong>e Ansatz <strong>der</strong> <strong>Kampagne</strong> im Unterschied zur bishe-<br />
rigen Praxis des Wissenstransfers lässt sich in folgenden Punkten zusammen<br />
fassen:<br />
� Branchen- und Betriebs-bezogene Perspektive: Wissenschaftler waren aufgefor<strong>der</strong>t,<br />
sich auf die Perspektiven <strong>der</strong> Unternehmen einzulassen und geeignete<br />
Antworten und anwendungsorientierte Lösungsansätze zu entwickeln.<br />
7
<strong>Endbericht</strong> <strong>der</strong> wissenschaftlichen Begleitung<br />
� Aktivierende und aufsuchende Beratung: Die Projektträger mussten eine<br />
vorab abgestimmte Anzahl von Unternehmen akquirieren. Auf diese Weise<br />
wurden nicht nur FuE-intensive Unternehmen von <strong>der</strong> <strong>Kampagne</strong> erfasst,<br />
son<strong>der</strong>n auch solche, die bislang keine o<strong>der</strong> nur sporadisch FuE-Projekte<br />
durchgeführt haben.<br />
� Kontinuierliche Begleitung: Die Projektträger haben ihre Partner aus Wirtschaft<br />
und Wissenschaft kontinuierlich durch verschiedene Phasen des<br />
Transferprozesses begleitet und auf diese Weise einen größeren Einfluss auf<br />
den Verlauf und den Erfolg des Wissenstransfers gewonnen.<br />
� Kombination verschiedener Wissensarten: Die Projektträger haben die Betriebe<br />
nicht nur im Hinblick auf technische Lösungen beraten, son<strong>der</strong>n auch<br />
zu Fragen des Managements von Innovationen, zu strategischen Fragen <strong>der</strong><br />
Unternehmensentwicklung und zu Fragen <strong>der</strong> Platzierung <strong>der</strong> Innovation auf<br />
dem Markt.<br />
3 . P r o fil <strong>der</strong> beteiligten Betriebe<br />
Insgesamt konnten die 6 Projektträger 87 Unternehmen und 50 Einrichtungen<br />
aus <strong>der</strong> Wissenschaft für die Teilnahme an <strong>der</strong> <strong>Kampagne</strong> gewinnen. Für die Unternehmen<br />
entstanden daraus 51 Realisierungskonzepte, 18 Konzepte waren<br />
zum Zeitpunkt <strong>der</strong> Berichtslegung noch in Bearbeitung, 3 Konzepte sind bereits<br />
umgesetzt.<br />
Unter den beteiligten Betrieben waren 10 Unternehmen, die nanotechnologische<br />
Verfahren adaptierten und in Innovationsvorhaben umsetzen konnten. 20 Betrie-<br />
be aus den Informations- und Kommunikationstechnologien, 15 Betriebe aus <strong>der</strong><br />
Logistik, 12 aus <strong>der</strong> Kunststofftechnik und 17 aus <strong>der</strong> Metall- und Elektroindustrie<br />
konnten Technologien und Know-how aus den Hochschulen für jeweils ihre spe-<br />
zifischen Probleme nutzen, um innovative Lösungen zu entwickeln.<br />
Abb. 2: Verteilung <strong>der</strong> Betriebsgrößen (absolute Werte)<br />
< 5<br />
< 20<br />
< 50<br />
< 100<br />
< 250<br />
0 5 10 15 20 25 30 35 40<br />
4<br />
14<br />
14<br />
21<br />
Die Abbildung zeigt, dass kleine und kleinste Betriebe mit weniger als 20 Be-<br />
schäftigten am stärksten vertreten sind. Dies entspricht sowohl den Zielen <strong>der</strong><br />
8<br />
34
<strong>Endbericht</strong> <strong>der</strong> wissenschaftlichen Begleitung<br />
<strong>Kampagne</strong>, die in erster Linie auf diese Gruppe abzielt, als auch <strong>der</strong> Wirtschafts-<br />
struktur des Landes, in <strong>der</strong> sie den größten Anteil <strong>der</strong> Betriebe stellt.<br />
Die nächste Abbildung zeigt, wie sich die verschiedenen Betriebsgrößenklassen<br />
auf die an <strong>der</strong> <strong>Kampagne</strong> beteiligten Branchenkompetenzfel<strong>der</strong> verteilen. Deut-<br />
lich wird, dass kleine Betriebe mit weniger als 20 Mitarbeitern beson<strong>der</strong>s häufig<br />
im Informations- und Kommunikationssektor vertreten sind, größere Betriebe bis<br />
zu 250 Mitarbeitern dagegen vor allem in <strong>der</strong> Metall- und Elektroindustrie. Ein Be-<br />
fund, <strong>der</strong> die Betriebsgrößenstrukturen in diesen Branchen sehr gut wi<strong>der</strong>spie-<br />
gelt.<br />
Abb. 3: Verteilung <strong>der</strong> Betriebsgrößenklassen nach Branchenkompetenzfel<strong>der</strong>n (absolute<br />
Werte)<br />
Nanotech<br />
MEI<br />
Kunststoffe<br />
Logistik<br />
IKT<br />
Automotive<br />
0 5 10 15 20 25<br />
< 5 < 20 < 50 < 100 < 250<br />
Die nächste Abbildung zeigt den hohen Anteil an Produktinnovationen, die in Re-<br />
alisierungskonzepten geplant wurden. Daran wird deutlich, dass ein großer Teil<br />
<strong>der</strong> Innovationen tatsächlich am Markt und an Kundenwünschen ausgerichtet<br />
war. I.d.R. ist es die Kenntnis einer spezifischen Nachfrage o<strong>der</strong> die Auseinan-<br />
<strong>der</strong>setzung mit Kundenwünschen, die dazu führt, dass gewohnte Wege verlas-<br />
sen und neuartige Formen <strong>der</strong> Zusammenarbeit ausprobiert werden. Auch <strong>der</strong><br />
hohe Anteil an geplanten Prozessinnovationen weist in diese Richtung.<br />
9
Abb. 4: Art <strong>der</strong> Innovationen (absolute Werte)<br />
Produkt<br />
Prozess<br />
Organisation<br />
Marketing<br />
7<br />
14<br />
<strong>Endbericht</strong> <strong>der</strong> wissenschaftlichen Begleitung<br />
0 5 10 15 20 25 30 35 40<br />
Hier stehen Innovationen im Mittelpunkt, die auf eine Optimierung <strong>der</strong> Prozessab-<br />
läufe abzielen, z.B. Steuerungsprozesse, die Energie sparen helfen o<strong>der</strong> be-<br />
stimmte Verarbeitungsprozesse rascher und effizienter gestalten. Prozessinnova-<br />
tionen können sich sowohl auf betriebsinterne Abläufe beziehen als auch auf<br />
Dienstleistungen, die für Kunden erbracht wurden. Häufig ist beides <strong>der</strong> Fall, weil<br />
eine Prozessinnovation eine effizientere Bewältigung von Aufgaben zur Folge hat<br />
und damit auch eine Dienstleistung für einen Kunden günstiger und rascher er-<br />
bracht werden kann.<br />
Abb. 5: Marktbezug <strong>der</strong> Innovationsvorhaben (absolute Werte)<br />
neuer Markt<br />
Neuheit in<br />
bestehendem Markt<br />
keine Neuheit<br />
0 5 10 15 20 25 30 35 40<br />
4<br />
16<br />
Der weitaus größte Teil <strong>der</strong> beteiligten Unternehmen wurde bei <strong>der</strong> Planung von<br />
Innovationen in bestehenden Märkten unterstützt. Dies entspricht den Potenzia-<br />
len <strong>der</strong> kleinbetrieblichen Struktur des Samples. Für viele Betriebe bot die Kam-<br />
pagne die erste Gelegenheit zur Kooperation mit Wissenschaftlern. Forschung<br />
und Entwicklung und die Entwicklung von Innovationen gehören bei kleinen und<br />
kleinsten Betrieben nicht zu den Routinen des Tagesgeschäftes. Umso wichtiger<br />
sind die Impulse <strong>der</strong> <strong>Kampagne</strong> zum Einstieg in den Austausch mit Wissen-<br />
schaftlern zu bewerten.<br />
10<br />
26<br />
34<br />
37
<strong>Endbericht</strong> <strong>der</strong> wissenschaftlichen Begleitung<br />
Abb. 6: Notwendigkeit zur zusätzlichen Qualifizierung <strong>der</strong> Belegschaften<br />
Notwendigkeit zusätzlicher<br />
Qualifizierung<br />
hoch<br />
mittel<br />
niedrig<br />
0 5 10 15 20 25 30<br />
3<br />
Diese Einschätzung unterstreicht auch die obige Abbildung, die zeigt, wie wichtig<br />
den Unternehmen die Weiterbildung ihrer Belegschaften ist, um das Innovations-<br />
vorhaben auf den Weg zu bringen. Die Impulse <strong>der</strong> <strong>Kampagne</strong> haben also nicht<br />
nur praktische Konsequenzen auf das Angebot an Produkten und Prozessen <strong>der</strong><br />
Unternehmen, son<strong>der</strong>n auch auf die Qualifizierung <strong>der</strong> Belegschaften. In dieser<br />
Hinsicht wirkt <strong>der</strong> Wissenstransfer auch zur Sicherung des Fachkräftebedarfs.<br />
Dies unterstreicht auch ein weiterer empirischer Befund aus <strong>der</strong> <strong>Kampagne</strong>: An<br />
den 87 Innovationsvorhaben haben neben 47 Praktikanten auch 25 Diplomanden<br />
teilgenommen, die verschiedene Facetten des Vorhabens in ihren Diplomarbei-<br />
ten bearbeitet haben. Fast alle Diplomanden (23) wurden nach Beendigung ihres<br />
Studiums in feste sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse übernommen.<br />
Damit wird deutlich, dass <strong>der</strong> Wissenstransfer für die Betriebe offenbar ein sehr<br />
gutes Instrument ist, um akademisch qualifiziertes Personal zu gewinnen.<br />
4 . E r folgs voraussetzungen für den Wissenstransfer<br />
Welche Instrumente und Methoden für den Wissenstransfer beson<strong>der</strong>s gut ge-<br />
eignet sind, kann nicht unabhängig von den Rahmenbedingungen <strong>der</strong> Branche,<br />
<strong>der</strong> Dynamik des Technologiefeldes und <strong>der</strong> Vernetzung <strong>der</strong> Akteure beurteilt<br />
werden. Dieselben Instrumente und Methoden können unter verschiedenen<br />
Rahmenbedingungen unterschiedliche Wirkungen zur Folge haben. In einem dy-<br />
namischen und gut vernetzten Kompetenzfeld treffen Initiativen zum Wissens-<br />
transfer auf fruchtbaren Boden. In strukturschwachen Fel<strong>der</strong>n sind die Rahmen-<br />
bedingungen für Hochschulkooperationen und Innovationen dagegen ungünsti-<br />
ger. Zwischen den Instrumenten und Methoden im Wissenstransfer und ihren Er-<br />
folgen gibt es also keinen monokausalen Wirkungszusammenhang. Vielmehr be-<br />
einflussen sich die Potenziale im Kompetenzfeld und <strong>der</strong> Betriebe sowie das<br />
konkrete Transfermanagement wechselseitig:<br />
11<br />
24<br />
26
Abb. 7: Einflussfaktoren im Wissenstransfer<br />
Rahmenbedingungen im<br />
Branchenkompetenzfeld<br />
Vernetzung <strong>der</strong> Branche<br />
Wettbewerb und Kooperation<br />
Branchentransferstelle<br />
Verfügbarkeit von FHS/HS/Unis<br />
<strong>Endbericht</strong> <strong>der</strong> wissenschaftlichen Begleitung<br />
Kompetenzen und Ressourcen<br />
des Transfermanagements<br />
Vernetzung mit Branche<br />
Technolog. Know-how<br />
Bekanntheit bei Zielgruppen<br />
12<br />
Potenziale <strong>der</strong> Betriebe<br />
Offenheit und Mitwirkungsbereitschaft<br />
Affinität zur Wissenschaft<br />
Persönliche Netzwerke<br />
Impulse von Kunden<br />
Im Folgenden werden deswegen für alle 3 Seiten des Transferprozesses die er-<br />
folgskritischen Faktoren herausgearbeitet, die für Anbahnung, Verlauf und Er-<br />
gebnisse maßgeblichen Einfluss ausüben.<br />
4.1 Rahmenbedingungen <strong>der</strong> Branchen und Technologiefel<strong>der</strong><br />
Um Instrumente und Methoden <strong>der</strong> Projektträger im Hinblick auf ihre Relevanz<br />
für den Wissenstransfer beurteilen zu können, wurden Vergleichsmaßstäbe ge-<br />
wählt, die unterschiedliche Ausgangslagen und Rahmenbedingungen <strong>der</strong> Pro-<br />
jektträger angemessen reflektieren. Die Indikatoren für die Bewertung externer<br />
Einflüsse sollten sowohl aussagekräftig sein als auch auf leicht zugänglichen Da-<br />
tenquellen beruhen. Die für den Vergleich <strong>der</strong> Rahmenbedingungen in den Bran-<br />
chen und Technologiefel<strong>der</strong>n ausgewählten Indikatoren berücksichtigen diesen<br />
Umstand und konzentrieren sich auf eine qualitative Einschätzung folgen<strong>der</strong><br />
zentrale Eckpunkte.<br />
1. die Vernetzung und <strong>der</strong> Erfahrungsaustausch in <strong>der</strong> Branche,<br />
2. die Möglichkeit des Projektträgers zur Kooperation mit Branchennetzwerken,<br />
3. das Profil <strong>der</strong> FuE an Hochschulen und in KMU,<br />
4. das Kompetenzprofil <strong>der</strong> Branche und thematische Schwerpunktbildungen.<br />
Mit diesen Indikatoren lassen sich Rückschlüsse auf die Relevanz von Innovatio-<br />
nen im Feld und auf die Bereitschaft zur Mitwirkung an Innovationsvorhaben zie-<br />
hen. Vernetzung und Erfahrungsaustausch in <strong>der</strong> Branche ermöglichen ein ge-<br />
meinsames Lernen über regionale Benchmarks und vorbildliche Beispiele. Wenn
<strong>Endbericht</strong> <strong>der</strong> wissenschaftlichen Begleitung<br />
die Projektträger im Branchennetzwerk integriert sind, erleichtert dies den Zu-<br />
gang zu den Unternehmen. Sie können dann Projekte zur Innovationsför<strong>der</strong>ung<br />
und zum Wissenstransfer leichter akquirieren und durchführen. Ein zentrales Kri-<br />
terium für die Innovationsfähigkeit einer Branche ist schließlich die Qualität <strong>der</strong><br />
Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten (FuE) von Hochschulen und Unterneh-<br />
men in <strong>der</strong> Region. Je mehr kompetente Hochschul-Partner für Kooperationen<br />
mit Betrieben zur Verfügung stehen, desto besser sind die Chancen für eine<br />
passgenaue Vermittlung <strong>der</strong> richtigen Partner. Ebenso wichtig ist die FuE-<br />
Kompetenz <strong>der</strong> KMU. Sofern Betriebe Erfahrungen mit Hochschulkooperationen<br />
haben, lassen sie sich für Projekte zum Wissenstransfer leichter gewinnen.<br />
Die Bewertung dieser Indikatoren wurde auf <strong>der</strong> Grundlage von Gesprächen mit<br />
den Projektträgern und <strong>der</strong> Auswertung ihrer Anträge vorgenommen. Ihre Ein-<br />
schätzungen wurden ergänzt durch die Bewertung <strong>der</strong> Branchenkompetenzfel<strong>der</strong><br />
im Landesinnovationskonzept Brandenburg und durch Expertengespräche.<br />
Metall- und Elektroindustrie<br />
Das Land Brandenburg unterstützt die Vernetzung <strong>der</strong> Metallindustrie mit Mitteln<br />
aus <strong>der</strong> GA-Netzwerkför<strong>der</strong>ung. Die EEPL wirkt als Koordinator und Organisator<br />
des Südbrandenburger Metallnetzwerkes und seines Kerns, <strong>der</strong> Arbeitsgemein-<br />
schaft Metall- und Elektroindustrie (Arge). Mit den Mitteln aus <strong>der</strong> GA-<br />
Netzwerkför<strong>der</strong>ung und <strong>der</strong> <strong>Innopunkt</strong>-<strong>Kampagne</strong> sowie <strong>der</strong> langjährigen Erfah-<br />
rung in <strong>der</strong> Zusammenarbeit mit den südbrandenburgischen Metall- und Elektro-<br />
betrieben hat die EEPL optimale Voraussetzungen für die Organisation von Wis-<br />
senstransferprojekten. Hinzu kommt ein offenkundig innovatives Potenzial unter<br />
den KMU und wenig Berührungsängste gegenüber öffentlicher För<strong>der</strong>ung von<br />
Seiten <strong>der</strong> Betriebe. Der Projektträger schätzt den Anteil <strong>der</strong> innovativen Unter-<br />
nehmen <strong>der</strong> MEI Brandenburgs auf rd. zwei Drittel <strong>der</strong> Betriebe.<br />
Das Landesinnovationskonzept bekräftigt diese Einschätzung. Zu den Stärken<br />
<strong>der</strong> Branche werden viele kleine Unternehmen mit Innovationskompetenz auf luk-<br />
rativen Märkten gezählt und eine ausgeprägte Metallkompetenz im Hochschulbe-<br />
reich. Allerdings leidet die Branche an einem generellen Strukturproblem Ost-<br />
deutschlands: Standorte großer Konzernzentralen fehlen in <strong>der</strong> Region, folglich<br />
gibt es auch wenig überregionale Profilbildungen, die Brandenburg einen beson-<br />
<strong>der</strong>en Wettbewerbsvorteil verschaffen könnten.<br />
Informations- und Kommunikationstechnologien<br />
Es gibt Häufungen von Medien- und IT-Unternehmen in Potsdam und am südli-<br />
chen Berliner Rand. Das professionelle Milieu hat keine Berührungsängste mit<br />
<strong>der</strong> Wissenschaft und steht Initiativen zur För<strong>der</strong>ung von Innovationen und Ko-<br />
operationen mit Wissenschaftlern prinzipiell aufgeschlossen gegenüber.<br />
13
<strong>Endbericht</strong> <strong>der</strong> wissenschaftlichen Begleitung<br />
Viele KMU haben Projekte o<strong>der</strong> Innovationsideen, die sie ohne externe Hilfe<br />
nicht realisieren können. In solchen Fällen genügt oft ein kleiner Impuls von au-<br />
ßen. Ebenso gibt es an Brandenburger Unis, Hochschulen und FHS eine große<br />
Breite und Vielfalt von Wissenschaftlern und Forschungsthemen. Die Nähe zu<br />
Berlin sorgt für ein großes Potenzial an Fachkräften und jungen Talenten, die<br />
sich wegen <strong>der</strong> Attraktivität <strong>der</strong> Metropole in <strong>der</strong> Region aufhalten.<br />
Allerdings ist die Branche segmentiert in verschiedenste Spezialisierungen mit<br />
wenig Berührungspunkten und Defiziten im Vernetzungssystem. Auf betrieblicher<br />
Seite sind kaum die Mittel zur Vorfinanzierung von FuE-Projekten vorhanden. Die<br />
Netzwerkför<strong>der</strong>ung für Medien und IKT konzentriert sich bislang auf die Koopera-<br />
tionsnetzwerke „SeSamBB – Security and Safety made in Berlin-Brandenburg“<br />
und MOBKOM.Net, die von <strong>der</strong> ZAB koordiniert und seit Herbst 2006 bzw. 2007<br />
geför<strong>der</strong>t werden. Beide Netzwerke stehen noch am Beginn ihrer Aktivitäten. Ei-<br />
ne Zusammenarbeit zwischen dem Projektträger und den Netzwerken war nicht<br />
möglich. Beide waren während <strong>der</strong> Laufzeit <strong>der</strong> <strong>Kampagne</strong> noch mit dem Aufbau<br />
eigener Strukturen und Netzwerke beschäftigt. Die Entwicklung eines eigenen<br />
Profils und dessen Kommunikation ins professionelle Milieu hat unter diesen Um-<br />
ständen die Zusammenarbeit blockiert, wenngleich beide Netzwerke ähnliche<br />
Ziele wie die <strong>Innopunkt</strong>-<strong>Kampagne</strong> verfolgen.<br />
Nanotechnologie<br />
Die Nanotechnologie zählt zwar zu den aktuell beson<strong>der</strong>s prominenten Schlüs-<br />
seltechnologien, ihre Anwendbarkeit erstreckt sich aber auf verschiedenste Bran-<br />
chen, so dass <strong>der</strong> Projektträger nicht auf ein eingespieltes Branchennetzwerk zu-<br />
rück greifen konnte. Außerdem gibt es keine öffentlich geför<strong>der</strong>ten Transferstel-<br />
len wie in den o.g. Bereichen, <strong>der</strong>en Unterstützung <strong>der</strong> Träger in Anspruch neh-<br />
men konnte. Für die Anwendung kommt ein prinzipiell sehr breites Spektrum an<br />
Betrieben und Branchen in Frage, in denen es auch eine große Variation in Be-<br />
zug auf die Innovationsfähigkeit <strong>der</strong> Unternehmen und die Qualifikationen ihrer<br />
Beschäftigten gibt. Auch <strong>der</strong> Innovationsdruck ist damit je nach Branche ver-<br />
schieden. Es kann folglich nicht von einem einheitlichen Set an branchenspezifi-<br />
schen Erfahrungshintergründen und betrieblichen Entwicklungsperspektiven<br />
ausgegangen werden.<br />
Kunststoffe<br />
Am Standort konzentrieren sich konzerngebundene Unternehmen mit sekundä-<br />
ren FuE-Aktivitäten innerhalb <strong>der</strong> Region, eine thematische Schwerpunktbildung<br />
ist in dem breiten Spektrum an Aktivitäten kaum erkennbar. Firmenprofile und<br />
Kompetenzen sind segmentiert, je nach <strong>der</strong> Art des Kunststoffs und dem damit<br />
zusammenhängenden technologischen Wissen: Querverbindungen und übergrei-<br />
fende Kompetenzen sind schwach ausgebildet. Hinzu kommt, dass am Standort<br />
14
<strong>Endbericht</strong> <strong>der</strong> wissenschaftlichen Begleitung<br />
zwar ein breites Spektrum an Betrieben und Branchen vorhanden ist, sich aber<br />
nur wenige Unternehmen durch systematische Neu- und Weiterentwicklungen<br />
von Produkten und Verfahren profiliert haben. Ihr Schwerpunkt liegt in <strong>der</strong> Ferti-<br />
gung, weniger in <strong>der</strong> Entwicklung und Planung. Die Beschäftigten sind häufig<br />
Quereinsteiger und angelernte Kräfte.<br />
Die Unternehmen im Netzwerk empfangen ihre stärksten Signale vom Großkun-<br />
den, sind aber von an<strong>der</strong>en Entwicklungszusammenhängen weitgehend abge-<br />
schnitten. Kontakte zu Hochschulen sind vorhanden, die Region bekommt aber<br />
den gegenwärtigen Fachkräftemangel deutlich zu spüren.<br />
Das Kunststoff-Netzwerk Berlin-Brandenburg (Kubra) setzt sich für eine engere<br />
Zusammenarbeit zwischen den kleinen und mittleren Kunststoffverarbeitern ein<br />
und hat sich zum Ziel gesetzt, die gesamte Branchenkompetenz <strong>der</strong> Kunststoff-<br />
industrie in Berlin und Brandenburg weiter auszubauen und ihr Image zu för<strong>der</strong>n.<br />
Das Netzwerk wurde 2005 von 8 Unternehmen und Institutionen <strong>der</strong> Kunststoff-<br />
branche gegründet. Insgesamt sind ca. 60 Unternehmen, 8 Hochschuleinrichtun-<br />
gen sowie verschiedene Ausbildungsträger in die Arbeit einbezogen.<br />
Die Branche ist am Standort zwar gut vernetzt, aber die strukturellen Schwächen<br />
<strong>der</strong> abhängigen Zulieferer und Fertigungsspezialisten engen das Spektrum mög-<br />
licher Hochschulkooperationen ein.<br />
Automotive<br />
Leuchttürme <strong>der</strong> Branche in Brandenburg sind <strong>der</strong> Fahrzeugbau von Daimler-<br />
Chrysler in Ludwigsfelde sowie die Zulieferbetriebe von Thyssen-Krupp (Umform-<br />
technik und Guss) in Ludwigsfelde, <strong>der</strong> ZF-Getriebeproduktion in Brandenburg<br />
a.d.H. und das Pneumant- Reifenwerke in Fürstenwalde. Das Landesinnovati-<br />
onskonzept bescheinigt <strong>der</strong> Branche eine punktuell wettbewerbsfähige FuE-<br />
Kompetenz, die breite Mehrheit <strong>der</strong> kleinen Betriebe sieht sich aber als einfache<br />
Komponenten-Zulieferer und Fertigungsbetriebe.<br />
Die Vernetzung <strong>der</strong> Branche befindet sich noch im Aufbau. An <strong>der</strong> TFH Wildau<br />
arbeitet das „Kooperationsnetzwerk Automotive Berlin Brandenburg“ an <strong>der</strong> Ent-<br />
wicklung <strong>der</strong> Branche. „Car-Net“ – eine Zulieferdatenbank aus Berlin-<br />
Brandenburg – gibt einen umfassenden Überblick über Betriebe <strong>der</strong> Branche. Die<br />
ZAB betreut das Branchenkompetenzfeld Automotive mit Mitteln aus <strong>der</strong> GA-<br />
Netzwerkför<strong>der</strong>ung.<br />
Die Zusammenarbeit zwischen Projektträger und den Netzwerken entwickelte<br />
sich spät und nur zögernd, so dass wechselseitige Vorteile aus <strong>der</strong> Kooperation<br />
kaum realisiert werden konnten.<br />
15
Logistik<br />
Fazit<br />
<strong>Endbericht</strong> <strong>der</strong> wissenschaftlichen Begleitung<br />
Es gibt sowohl einen hohen Marktdruck (Osterweiterung, Preiskonkurrenz, Inter-<br />
nethandel) als auch einen starken „Technology-Push“: Die neuen Technologien<br />
ermöglichen eine Optimierung innerbetrieblicher Verfahren, Arbeitsabläufe und<br />
Transportwege. Fahrten können besser geplant, Wege und an<strong>der</strong>e Transport-<br />
und Serviceleistungen besser aufeinan<strong>der</strong> abgestimmt werden. Im Effekt können<br />
damit Waren schneller beim Kunden landen. Wichtig ist auch, dass z.B. durch<br />
den Internethandel <strong>der</strong> Warentransport stark zugenommen hat. Die dadurch in-<br />
duzierten Warenströme sind jedoch sehr individualisiert und erfor<strong>der</strong>n ein kom-<br />
plett an<strong>der</strong>es Transportmanagement als Massengüter.<br />
Brandenburg unterhält ein Logistiknetz, dessen Geschäftstelle die Region zu ei-<br />
ner <strong>der</strong> führenden europäischen Drehscheiben im Warenverkehr profilieren will.<br />
Dafür sind sehr gute Potenziale vorhanden: Zwischen den zahlreichen Betrieben<br />
<strong>der</strong> Branche, zu denen auch viele größere Unternehmen gehören, existieren gute<br />
Verbindungen, Hochschuleinrichtungen haben sich über FuE-Aktivitäten in <strong>der</strong><br />
Branche einen Namen gemacht und über innovative Themen profiliert. An <strong>der</strong><br />
TFH Wildau arbeitet eine Branchentransferstelle Logistik. Die Brandenburger Po-<br />
litik för<strong>der</strong>t im Branchenkompetenzfeld systematisch die Vernetzung, den Erfah-<br />
rungsaustausch und den Wissenstransfer.<br />
Der Projektträger arbeitet eng mit <strong>der</strong> Branchentransferstelle Logistik zusammen.<br />
Die folgende Übersicht fasst die Bewertungen <strong>der</strong> Branchen und Technologiefel-<br />
<strong>der</strong> nach <strong>der</strong> Organisation <strong>der</strong> Branche in Netzwerken, <strong>der</strong> Vernetzung des Pro-<br />
jektträgers mit dem Branchenfeld, den Potenzialen <strong>der</strong> FuE an Brandenburger<br />
Hochschulen und dem Profil <strong>der</strong> FuE-Kompetenz in den Unternehmen zusam-<br />
men.<br />
Tabelle 1: Rahmenbedingungen in den Technologie- und Branchenkompetenzfel<strong>der</strong>n<br />
Kompetenzfeld Branchennetzwerk Kooperation<br />
mit Netzwerk<br />
16<br />
FuE-Profil <strong>der</strong><br />
Hochschulen<br />
Kompetenzprofil<br />
<strong>der</strong> KMU<br />
Metall/ Elektro ++ ++ + +<br />
IKT ++ - ++ +<br />
Nanotech. - - + +/-<br />
Kunststoffe ++ ++ + +/-<br />
Automotive ++ - +/- +/-<br />
Logistik ++ ++ + ++
<strong>Endbericht</strong> <strong>der</strong> wissenschaftlichen Begleitung<br />
Für den Zugang <strong>der</strong> Projektträger zu den Betrieben eines Branchenkompetenz-<br />
feldes und damit für die Akquisition von Unternehmen für den Wissenstransfer ist<br />
die Kooperation mit dem jeweiligen Netzwerk von zentraler Bedeutung. In dieser<br />
Hinsicht hatten die Projektträger sehr unterschiedliche Voraussetzungen:<br />
Tabelle 2: Vernetzung <strong>der</strong> Projektträger<br />
Typus Branchen Wirkungen<br />
Transfermanagement ist in<br />
Branchennetzwerk integriert<br />
Transfermanagement ist<br />
nicht in Branchennetzwerk<br />
integriert<br />
Es gibt kein Branchennetzwerk<br />
4.2 Transfermanagement<br />
Vertrauen<br />
Metall- und Elektroindustrie<br />
Kunststoffe<br />
Logistik<br />
Informations- und Kommunikationstechnologien<br />
Automotive<br />
17<br />
Erleichterter Zugang<br />
Akquisitionserfolge<br />
Konkurrenz zum Branchennetzwerk<br />
Nanotechnologie Erschwerter Zugang<br />
Aufwändige Akquisition<br />
Eine zentrale Voraussetzung für eine produktive Zusammenarbeit ist das gegen-<br />
seitige Vertrauen. Kein Aspekt wird in den zahlreichen Studien zu Netzwerken<br />
zwischen Wissenschaft und Wirtschaft so nachdrücklich hervorgehoben wie die<br />
entscheidende Bedeutung persönlicher Kontakte (vgl. z.B. Schmoch/ Licht/ Rein-<br />
hard 2000). Auch die im Rahmen <strong>der</strong> wissenschaftlichen Begleitung interviewten<br />
Experten und die Projektträger heben diesen Aspekt im Wissenstransfer beson-<br />
<strong>der</strong>s hervor. Persönliche und vertrauensvolle Kontakte gelten als das „A&O“ einer<br />
erfolgreichen Kooperation, weil sie Brücken zwischen verschiedenen beruflichen<br />
Milieus, Technologiefel<strong>der</strong>n und Branchen ermöglichen. In <strong>der</strong> systematischen<br />
Herstellung und Gestaltung dieser „Brücken“ liegt auch eine große Herausforde-<br />
rung für ein erfolgreiches Wissenstransfermanagement.<br />
In den Projekten zum Wissenstransfer könne man zwar viele Aspekte <strong>der</strong> Zu-<br />
sammenarbeit vertraglich regeln und damit für Sicherheit sorgen. Für Innovati-<br />
onsvorhaben sei aber typisch, dass zu Beginn noch nicht <strong>der</strong> gesamte Verlauf<br />
des Vorhabens und sämtliche Details des Pflichtenheftes absehbar seien. Gera-<br />
de weil das nicht möglich sei, erfor<strong>der</strong>e ein Innovationsvorhaben ein ausgepräg-<br />
tes Vertrauen zwischen den Akteuren.<br />
FuE-Partnerschaften haben meist einen langen Vorlauf und lassen sich nur<br />
schwer spontan und ad hoc vermitteln. Aus einer persönlichen Bekanntschaft
<strong>Endbericht</strong> <strong>der</strong> wissenschaftlichen Begleitung<br />
kann ein gemeinsames Projekt zum Wissenstransfer entstehen, muss aber nicht.<br />
Branchen- und Hochschultransferstellen haben den Vorteil dauerhafter und ver-<br />
lässlicher Strukturen des Wissenstransfers. Eine „Kalt-Akquise“, wie sie von den<br />
Projektträgern <strong>der</strong> InnoPunkt-<strong>Kampagne</strong> praktiziert wurde, steht demgegenüber<br />
vor dem Problem, dass die Betriebe in einer Situation angesprochen werden<br />
müssen, in <strong>der</strong> sie offen für Verän<strong>der</strong>ungen und unkonventionelle Lösungen sind.<br />
Die Akquisition und Sensibilisierung <strong>der</strong> Unternehmen fand daher für Projektträ-<br />
ger, die auf kein Branchennetzwerk zurück greifen konnten o<strong>der</strong> in Konkurrenz<br />
zum Branchennetzwerk agierten, unter erschwerten Bedingungen statt. Die Er-<br />
folgsvoraussetzungen für Projekte in <strong>der</strong> Metall- und Elektroindustrie, in <strong>der</strong><br />
Kunststoffbranche und <strong>der</strong> Logistik waren vor dem Hintergrund gefestigter Netz-<br />
werke, enger professioneller Bindungen und persönlicher Kontakte deutlich bes-<br />
ser.<br />
Unabhängig von <strong>der</strong> Vernetzung <strong>der</strong> Projektträger in <strong>der</strong> jeweiligen Branche<br />
konnten aber auch dann Akquisitionserfolge verzeichnet werden, wenn die Trä-<br />
ger z.B. über eigene Beratungskontakte Firmen kannten o<strong>der</strong> mit Firmen bereits<br />
Projekte durchgeführt haben, die aus an<strong>der</strong>en Mitteln geför<strong>der</strong>t wurden. In jedem<br />
Fall war die genaue Kenntnis <strong>der</strong> Branche und <strong>der</strong> betrieblichen Bedarfslagen ei-<br />
ne wichtige Voraussetzung dafür, das Vertrauen <strong>der</strong> Betriebe zu gewinnen und<br />
sie zur Mitwirkung an <strong>der</strong> <strong>Kampagne</strong> zu motivieren.<br />
Branchen- und Technologiekompetenz<br />
Die Branchen- und Technologiekompetenz war für alle Projektträger eine zentra-<br />
le Erfolgsvoraussetzung im Wissenstransfer. Diese Kompetenz umfasst umfang-<br />
reiche Erfahrungen und Kenntnisse über die Strukturen und Entwicklungen in <strong>der</strong><br />
Branche und über Personen, Institutionen und <strong>der</strong>en FuE-Kompetenzen.<br />
Zur Branchenkompetenz gehört die Fähigkeit, sich auf die konkreten betriebli-<br />
chen Perspektiven einzulassen und auf <strong>der</strong> Grundlage des Aufgabenprofils und<br />
<strong>der</strong> Ressourcen <strong>der</strong> Betriebe die Ziele und Reichweite von Innovationsvorhaben<br />
mit den Betrieben abstimmen und bewerten zu können. Wenn es gelungen ist,<br />
Unternehmen für den Wissenstransfer zu interessieren, kommt es v.a. darauf an,<br />
die richtigen Partner aus <strong>der</strong> Wissenschaft zu finden und zu vermitteln. Die Part-<br />
ner aus <strong>der</strong> Wissenschaft müssen sich auf die konkreten Probleme <strong>der</strong> Unter-<br />
nehmen einlassen und bedarfsgerechte bzw. maßgeschnei<strong>der</strong>te Lösungen ent-<br />
wickeln können, die das Unternehmen weiterbringen aber nicht überfor<strong>der</strong>n. Hier<br />
ist viel Fingerspitzengefühl notwendig bei <strong>der</strong> Verständigung über Ziele und<br />
Reichweite des Innovationsvorhabens sowie über die Arbeitsteilung und Meilen-<br />
steine des Kooperationsprozesses. Wissenschaftliche Interessen sind behutsam<br />
auf die Ressourcen und Möglichkeiten <strong>der</strong> Unternehmen abzustimmen. Das<br />
18
<strong>Endbericht</strong> <strong>der</strong> wissenschaftlichen Begleitung<br />
Transfermanagement muss Wissensbarrieren überbrücken helfen und eine<br />
Scharnier- und Übersetzungsfunktion zwischen Wissenschaft und KMU über-<br />
nehmen.<br />
Für kleine und kleinste Betriebe sind Innovationsvorhaben – im Vergleich zu mitt-<br />
leren und großen Unternehmen – jeweils spezifische Vorgänge, die sich nur sel-<br />
ten in <strong>der</strong> selben Weise wie<strong>der</strong>holen lassen. Anlass, Ziele, Prozesse und die<br />
entwickelten technologischen Lösungen sind i.d.R. kundenspezifisch und inso-<br />
fern einmalig. Für das strategische und das operative Management von Innovati-<br />
onsvorhaben und Wissenstransferprozessen bedeutet dies, dass es kein einfa-<br />
ches und dauerhaftes Standardkonzept in <strong>der</strong> Steuerung von Innovations- bzw.<br />
Transferprozessen gibt. Wichtiger als formalisierte Prozesse und idealtypische<br />
Ablaufmuster von Projekten ist eine stark individualisierte Vorgehensweise,<br />
die sich auf die jeweils beson<strong>der</strong>en Ressourcen, die Bereitschaft und die internen<br />
und externen Rahmenbedingungen des betrieblichen Einzelfalles einlässt.<br />
Um den Betrieben passende Partner aus <strong>der</strong> Wissenschaft vermitteln zu können,<br />
ist eine genaue Kenntnis <strong>der</strong> Hochschullandschaft Brandenburgs notwendig. Vor<br />
allem bedarf es ausgeprägter Verbindungen zu Wissenschaftspartnern, die eine<br />
beson<strong>der</strong>s betriebsnahe und anwendungsorientierte FuE betreiben und bereit<br />
sind, sich auch auf Projekte einzulassen, die aus wissenschaftlicher Sicht weni-<br />
ger relevant sind. Z.T. konnten sich die Projektträger bei ihrer Suche nach Wis-<br />
senschaftlern von den Hochschultransferstellen unterstützen lassen, die ihre An-<br />
fragen nach spezifischen Kompetenzen an die entsprechenden Fachbereiche ih-<br />
rer Hochschule weiterleiteten und den Kontakt vermittelten. Für die Sensibilisie-<br />
rung von Unternehmen für den Wissenstransfer ist es aber von Vorteil, bereits im<br />
Aufschlussgespräch auf mögliche Partner aus <strong>der</strong> Wissenschaft und <strong>der</strong>en Kom-<br />
petenzen verweisen zu können.<br />
Die Festlegung auf nur einen regionalen Hochschulpartner kann problematisch<br />
werden, wenn für spezifische Aufgaben keine kompetenten Wissenschaftler ge-<br />
funden werden können, o<strong>der</strong> die vorhandenen Wissenschaftler aus an<strong>der</strong>en<br />
Gründen für ein Projekt nicht zur Verfügung stehen. In solchen Fällen war es für<br />
die Projektträger wichtig, selbst Alternativen bestimmen und für das Innovations-<br />
vorhaben gewinnen zu können. Zu Hilfe kam ihnen in solchen Situationen die<br />
dichte Struktur aus TIBS und sowohl Brandenburger als auch Berliner Hochschu-<br />
len, in denen für jede Aufgabe ein passen<strong>der</strong> Partner aus <strong>der</strong> Wissenschaft ge-<br />
funden werden konnte.<br />
19
4.3 Betriebe<br />
Offenheit und Mitwirkungsbereitschaft<br />
<strong>Endbericht</strong> <strong>der</strong> wissenschaftlichen Begleitung<br />
Im Mangel an personellen Freiräumen und zeitlichen Kapazitäten für nicht unmit-<br />
telbar produktive Arbeit, für Experimente und Versuchsanordnungen sehen Ex-<br />
perten das zentrale Entwicklungshin<strong>der</strong>nis bei kleinen Unternehmen. Eine Entlas-<br />
tung <strong>der</strong> Geschäftsführer o<strong>der</strong> <strong>der</strong> für Innovationsvorhaben mitverantwortlichen<br />
Mitarbeiter sei daher ein zentraler Erfolgsfaktor für Innovationen. Um auf <strong>der</strong> Sei-<br />
te <strong>der</strong> Betriebe die Voraussetzungen für erfolgreichen Wissenstransfer zu<br />
verbessern, so ein Experte im Interview, muss man „eine Kultur <strong>der</strong> Innovation<br />
erreichen, in <strong>der</strong> es im Unternehmen Leute o<strong>der</strong> einzelne Personen gibt, die ge-<br />
wisse Freiheiten haben, um sich umzusehen. Unternehmen brauchen Freiräume,<br />
in denen Visionen entwickelt werden können, ungestört von hierarchischen Struk-<br />
turen und Regeln.“<br />
Diese Voraussetzung traf in den seltensten Fällen auf die an <strong>der</strong> <strong>Kampagne</strong> be-<br />
teiligten Betriebe zu. I.d.R. handelte es sich immer um Betriebe, die zu klein wa-<br />
ren, als dass sie einzelne Mitarbeiter für die Entwicklung von Innovationsvorha-<br />
ben beauftragen konnten. In allen Fällen war <strong>der</strong> Wissenstransfer „Chefsache“. In<br />
allen Fällen bedeutete dies aber auch, dass die Geschäftsführer bereit waren,<br />
viel Zeit in Gespräche, Workshops und eigene Aktivitäten zur Konkretisierung<br />
und Umsetzung von Innovationsideen einzubringen. Außerdem mussten sie als<br />
zentrale Ansprechpartner und Projekt-Verantwortliche im Unternehmen zur Ver-<br />
fügung stehen.<br />
Die Ideen für Innovationsvorhaben entstanden fast immer aus einer genauen<br />
Kenntnis von Märkten und Nachfragetrends. Sie waren nicht das Ergebnis von<br />
Experimenten o<strong>der</strong> freien Versuchsanordnungen, son<strong>der</strong>n stets eingebettet in<br />
Kundenbeziehungen. Für die meisten Unternehmen war dies auch <strong>der</strong> Haupt-<br />
grund für ihre Mitwirkungsbereitschaft: die Aussicht auf ein lohnendes Marktpo-<br />
tenzial <strong>der</strong> Innovation und die Chance, Kundenbeziehungen zu festigen o<strong>der</strong> zu<br />
erweitern.<br />
Wenn das Unternehmen eine Innovationsidee verfolgt und das Angebot zum<br />
Wissenstransfer auf einen aktuellen Bedarf zur Lösung eines Entwicklungsprob-<br />
lems stößt, sind sie eher bereit, unkonventionelle Wege bei <strong>der</strong> Auftrags- o<strong>der</strong><br />
Projektbearbeitung zu gehen. Umgekehrt bedeutet dies für die Projektträger und<br />
Transfermanager, dass <strong>der</strong> Zeitpunkt für das Angebot zum Wissenstransfer zu<br />
den Bedarfslagen <strong>der</strong> Betriebe passen muss. Einige Beispiele haben gezeigt,<br />
dass es aber auch reichen kann, wenn eine aktuelle Situation im Unternehmen<br />
als unbefriedigend empfunden und Handlungsbedarf gesehen wird. Der Wis-<br />
20
<strong>Endbericht</strong> <strong>der</strong> wissenschaftlichen Begleitung<br />
senstransfer war in solchen Fällen eine nützliche Hilfe bei <strong>der</strong> Präzisierung des<br />
Problems und <strong>der</strong> Entwicklung eines innovativen Lösungsansatzes.<br />
Damit Unternehmen vom Wissenstransfer profitieren können, müssen sie ein<br />
grundsätzliches Interesse an <strong>der</strong> Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern haben<br />
und bereit sein, sich auf Neues einzulassen. Diese Offenheit gegenüber wissen-<br />
schaftlichen Erkenntnissen wird zwar vom Bildungsabschluss <strong>der</strong> Unternehmer<br />
und Unternehmerinnen positiv beeinflusst – wenn die Mitwirkenden aus den Un-<br />
ternehmen selbst einen akademischen Abschluss haben, sind sie aufgeschlos-<br />
sener gegenüber FuE-Ergebnissen – ihre Offenheit und Mitwirkungsbereitschaft<br />
ist aber nicht abhängig von eigenen akademischen Erfahrungen. Auch Hand-<br />
werksmeister o<strong>der</strong> Techniker und Unternehmer mit an<strong>der</strong>en Berufen waren zum<br />
Wissensaustausch bereit. Wichtiger als akademische Erfahrungen sind persönli-<br />
che Netzwerke <strong>der</strong> Unternehmen. Unternehmen die in Branchenforen, Netzwer-<br />
ken und Kooperationen engagiert sind, verfügen über „Brückenbeziehungen“ in<br />
an<strong>der</strong>e Wissensbereiche und erhalten auf diese Weise leichter Zugang zu Infor-<br />
mationen, die sie für ihre eigene Entwicklung verwerten können.<br />
Persönliche und berufliche Netzwerke<br />
Die Projektträger aus <strong>der</strong> Kunststofftechnik, in <strong>der</strong> Logistik und <strong>der</strong> Metall- und<br />
Elektroindustrie konnten alle Betriebe aus ihren Branchennetzwerken akquirie-<br />
ren. Der enge Kontakt, <strong>der</strong> Erfahrungsaustausch über Projekte, Branchenent-<br />
wicklungen und an<strong>der</strong>e Neuigkeiten schafft eine wichtige Basis für neue Projekte<br />
und Kooperationen: ein grundsätzliches Vertrauen in die Partnerschaft, das aus<br />
<strong>der</strong> professionellen und regionalen Nähe <strong>der</strong> Mitwirkenden entsteht und in ge-<br />
meinsamen Projekten erneuert und bestätigt wird.<br />
Die Anbindung des Wissenstransfers an die Branchennetzwerke ist daher ein<br />
zentraler Erfolgsfaktor. Unternehmen, die in Branchenforen organisiert sind, sind<br />
für Initiativen und Impulse aus dem Netzwerk grundsätzlich offen und bewerten<br />
ihre Ziele und Ansätze zunächst im Licht ihrer Erfahrungen im Netzwerk. Sofern<br />
das Netzwerk stabil und für die Beteiligten zum Vorteil arbeitet, werden auch An-<br />
regungen aus dem Netzwerk wohlwollend beurteilt.<br />
4.4 Fazit<br />
Die kritischen Erfolgsfaktoren, die sich auf den Verlauf eines Vorhabens unmit-<br />
telbar för<strong>der</strong>lich auswirken, lassen sich in folgen<strong>der</strong> Übersicht zusammenfassen:<br />
21
<strong>Endbericht</strong> <strong>der</strong> wissenschaftlichen Begleitung<br />
Tabelle 3: Übersicht <strong>der</strong> kritischen Erfolgsfaktoren für den Wissenstransfer<br />
Rahmenbedingungen<br />
Aktive Branchennetzwerke<br />
Integration des Wissenstransfers in Branchennetzwerke o<strong>der</strong> Kooperation mit<br />
Branchennetzwerk<br />
Profilierte Hochschullandschaft und FuE-Einrichtungen<br />
Transfermanagement (Angebotsseite)<br />
Bekanntheit bei Zielgruppen<br />
Gute persönliche und berufliche Kontakte in die Branche<br />
Umfassende Kenntnis <strong>der</strong> Brandenburger und Berliner Hochschulen und FuE-<br />
Einrichtungen<br />
Individualisiertes Vorgehen im Transferprozess<br />
Betriebe (Nachfrageseite)<br />
Eigene Ideen für Innovationen<br />
Aktueller Beratungs- bzw. Entwicklungsbedarf<br />
Affinität zur Wissenschaft<br />
Engagement in Branchennetzwerk<br />
Prinzipielle Offenheit zur Mitwirkung<br />
Die meisten Erfolgsfaktoren wirken sich auf die Startphase des Transferprozes-<br />
ses aus. Alle betrieblichen Erfolgsfaktoren erleichtern das Zustandekommen<br />
von Partnerschaften. Auf <strong>der</strong> Seite des Transfermanagements kommt es in <strong>der</strong><br />
Startphase auf die Bekanntheit bei den Zielgruppen an, die in <strong>der</strong> Regel durch<br />
gute persönliche und berufliche Kontakte in die Branche unterstützt wird. Wenn<br />
die Rahmenbedingungen dazu führen, dass Projektträger gut in das Branchen-<br />
netzwerk integriert sind o<strong>der</strong> gut mit ihm zusammen arbeiten können, sind ideale<br />
Voraussetzungen für die Akquisition und Sensibilisierung von Unternehmen vor-<br />
handen.<br />
Das A&O für die Durchführung des Transferprozesses ist die passgenaue Ver-<br />
mittlung von Partnern aus <strong>der</strong> Wissenschaft. Dafür benötigt das Transfermana-<br />
gements umfassende Kenntnisse <strong>der</strong> Wissenschaftslandschaft. Die Zusammen-<br />
arbeit zwischen Unternehmen und Wissenschaftler wird erleichtert, wenn die Ge-<br />
schäftsführung aus den Unternehmen o<strong>der</strong> verantwortliche Mitarbeiter selbst ei-<br />
nen akademischen Hintergrund haben o<strong>der</strong> sogar bereits als Wissenschaftler tä-<br />
tig waren.<br />
Wichtiger als formalisierte Muster und vorgegebene Ablaufschemata für den<br />
Wissenstransferprozess sind Einzelfall-bezogene und individualisierte Vorge-<br />
hensweisen, die sich flexibel auf die Ressourcen, Ziele und Möglichkeiten des<br />
Betriebes einstellen und sich an die Dynamik <strong>der</strong> Kommunikation zwischen Un-<br />
ternehmen und Wissenschaftlern anpassen.<br />
22
<strong>Endbericht</strong> <strong>der</strong> wissenschaftlichen Begleitung<br />
Die Projektträger aus den Branchennetzwerken hatten einen Startvorteil bei <strong>der</strong><br />
Akquisition und Sensibilisierung von Unternehmen für die Ziele <strong>der</strong> <strong>Kampagne</strong>.<br />
Auf einen ähnlichen Vertrauensvorschuss und auf eine vergleichbare Bekannt-<br />
heit bei den Zielgruppen konnten die Projektträger aus dem Bereich Automotive,<br />
Informations- und Kommunikationstechnologien und <strong>der</strong> Nanotechnologie nicht<br />
aufbauen. Im Hinblick auf die weiteren Schritte des Transferprozesses gelten je-<br />
doch gleiche Bedingungen für alle Projektträger: Sind die Betriebe am Wissens-<br />
transfer interessiert und bereit, mit Wissenschaftlern zusammen zu arbeiten, sind<br />
für den Erfolg <strong>der</strong> Kooperation v.a. folgende Faktoren verantwortlich:<br />
� die passgenaue Vermittlung <strong>der</strong> Partner aus <strong>der</strong> Wissenschaft<br />
� die fachlich und sozial kompetente Mo<strong>der</strong>ation <strong>der</strong> Partnerschaft<br />
� die individualisierte und auf die konkreten Bedarfe des Unternehmens abgestimmte<br />
sowie kontinuierliche Beratung und Begleitung des Transferprozesses.<br />
Im folgenden Kapitel werden die relevanten Verfahren und Instrumente für den<br />
Wissenstransfer genauer analysiert und dargestellt.<br />
5 . Releva n te Instrumente für den W i s s e n s transfer<br />
Der schematisierte Ablauf eines Wissenstransferprozesses sieht verschiedene<br />
Phasen vor, die von <strong>der</strong> Akquisition über die Feststellung <strong>der</strong> Innovationsfähigkeit<br />
bis hin zur letztendlichen Durchführung des Vorhabens reichen. Folgendes<br />
Schaubild illustriert die einzelnen Abschnitte beispielhaft:<br />
23
Abb. 8: Phasen des Wissenstransferprozesses<br />
Akquisition<br />
Sensibilisierung<br />
Innovationsaudit<br />
Erarbeitung <strong>der</strong><br />
Aufgabenstellung<br />
Durchführung des<br />
Wissenstransfers<br />
<strong>Endbericht</strong> <strong>der</strong> wissenschaftlichen Begleitung<br />
24<br />
• Informationsveranstaltungen,<br />
• Forschungsnetze,<br />
• Branchen- und Hochschultransferstellen,<br />
• eigene Kontakte<br />
Persönliche Information und Erstberatung über<br />
Ziele, Ablauf und Chancen des Wissens-transfers<br />
Feststellung <strong>der</strong> Innovationsfähigkeit<br />
des Unternehmens<br />
Ausrichtung des Vorhabens auf Bedarfe des<br />
Unternehmens und dessen Kunden.<br />
Beteiligte: KMU, Wissenschaftler, externe Experten,<br />
Projektträger<br />
• Innovationswerkstatt,<br />
• Ablauf- und Ergebnisplanung, Meilensteine,<br />
• Weiterbildung und Coaching<br />
• Personaltransfer<br />
• Realisierungskonzept<br />
Für den Auftraggeber sind in diesem Kontext ganz beson<strong>der</strong>s alle Fragen rele-<br />
vant, die auf die praktische Durchführung des Wissenstransfers zielen und Er-<br />
kenntnisse darüber bringen,<br />
� welche Kommunikationsformen gewählt wurden,<br />
� welche Kommunikationsstrukturen zwischen den Partnern entstehen<br />
� wie <strong>der</strong> Personaltransfer zwischen Wissenschaft und Unternehmen erfolgt<br />
und wie Realisierungskonzepte erstellt werden.<br />
Die Projektträger sind zwar mit unterschiedlichen Voraussetzungen im Hinblick<br />
auf ihr Verhältnis zum jeweiligen Branchennetzwerk gestartet, hatten aber für die<br />
weiteren Schritte im Wissenstransfer relativ genaue Vorgaben einzuhalten und<br />
bereits im Projektantrag zu erläutern. U.a. wurden darin die potenziellen Partner<br />
aus den Hochschulen benannt und Ansätze zum Transfer von Wissen aus Hoch-<br />
schulen in Unternehmen skizziert. In den weiteren Beratungen zwischen Auftrag-<br />
geber und Projektträgern wurden Einzelheiten wie die Überprüfung <strong>der</strong> Innovati-<br />
onsfähigkeit <strong>der</strong> Unternehmen abgestimmt und Rahmenbedingungen für den
<strong>Endbericht</strong> <strong>der</strong> wissenschaftlichen Begleitung<br />
Wissenstransfer festgelegt, wie z.B. <strong>der</strong> Einsatz bestimmter Instrumente wie Per-<br />
sonaltransfer o<strong>der</strong> die Durchführung von Innovationswerkstätten und Workshops.<br />
Die oben skizzierte Ablaufform des Wissenstransfers war insofern für alle Pro-<br />
jektträger verbindlich. Grundsätzliche Alternativen dazu wurden daher auch nicht<br />
praktiziert. Folglich sind die Vorgehensweisen <strong>der</strong> Projektträger vergleichbar und<br />
Good-Practices gut identifizierbar.<br />
Im Folgenden werden die Instrumente und Vorgehensweisen konkreter darge-<br />
stellt, die in allen Fällen den Projektverlauf positiv beeinflusst haben und deswe-<br />
gen generell als erfolgsför<strong>der</strong>nd bewertet werden können. Im anschließenden<br />
Kapitel wird erläutert, nach welchen Kriterien aus dem vorhandenen Pool <strong>der</strong> In-<br />
novationsvorhaben „Good-Practices“ bestimmt wurden. Am Beispiel einer Aus-<br />
wahl von Vorhaben werden die Vorgehensweisen und Erfolge im Detail vorge-<br />
stellt.<br />
5.1 Aktivierende und aufsuchende Beratung<br />
Der <strong>Kampagne</strong>n-Charakter des <strong>Innopunkt</strong>-Programms impliziert, dass eine be-<br />
stimmte Anzahl von Projekten innerhalb einer festgelegten Zeit durchgeführt wird.<br />
Die Projektträger mussten auf die Betriebe zugehen und dabei mit verschiedens-<br />
ten Mitteln versuchen, Unternehmen von den Vorteilen des Wissenstransfers und<br />
einer Hochschul-Kooperation zu überzeugen. Der projektspezifische Erfolgsdruck<br />
<strong>der</strong> Projektträger hatte vielfältige Akquisitions-Aktivitäten im jeweiligen Branchen-<br />
bzw. Technologiefeld zur Folge, in <strong>der</strong>en Kontext viele Firmen zum ersten Mal<br />
von den Möglichkeiten des Wissenstransfers und den Potenzialen von Hoch-<br />
schulkooperationen erfahren haben. Die mobilisierende Wirkung dieser Informa-<br />
tions- und Akquisitionsstrategien ist für die Entwicklung des Wissenstransfers in<br />
Brandenburg nicht zu unterschätzen:<br />
� Die Chancen und Potenziale von Hochschul-Kooperationen zum Zweck des<br />
Wissenstransfers wurden in zahlreichen Informationsveranstaltungen, „Vor-<br />
Werkstätten“ und Fachgesprächen mit Unternehmen, Wissenschaftlern und<br />
Verbandsvertretern einem breiten Fachpublikum vermittelt;<br />
� Interessierte Unternehmen konnten in Informationsveranstaltungen unverbindlich<br />
Kontakt mit Wissenschaftlern aufnehmen und sich über Möglichkeiten<br />
<strong>der</strong> Zusammenarbeit erkundigen;<br />
� Die thematische Bandbreite von FuE an Brandenburger und Berliner Hochschulen<br />
wurde im jeweiligen Branchen- und Technologiefeld vorgestellt.<br />
Es ist davon auszugehen, dass die mobilisierende Wirkung dieser Informations-<br />
strategien nicht allein in abgeschlossenen Kooperationsvereinbarungen zu mes-<br />
sen ist. In die Bewertung müssten im Prinzip auch die nicht erfassten und nicht<br />
messbaren Wirkungen berücksichtigt werden. Dazu zählen etwa die Unterneh-<br />
men, die nur deshalb nicht an einem Kooperationsprojekt teilgenommen haben,<br />
25
<strong>Endbericht</strong> <strong>der</strong> wissenschaftlichen Begleitung<br />
weil es aktuell für sie keinen Handlungsbedarf gibt, die aber für die Zukunft nicht<br />
ausschließen, dass wissenschaftliche Expertise zur Lösung von Entwicklungs-<br />
problemen in ihrem Unternehmen sinnvoll verwendet werden könnte.<br />
Abgesehen davon konnten mit den Akquisitionsstrategien nicht nur jene Unter-<br />
nehmen erreicht werden, die aufgrund ihrer strukturellen Voraussetzungen be-<br />
reits sporadisch o<strong>der</strong> regelmäßig FuE-Projekte zusammen mit Hochschul-<br />
Partnern durchführen können, son<strong>der</strong>n auch Betriebe, die diese Erfahrung mit<br />
<strong>der</strong> <strong>Kampagne</strong> zum ersten Mal gemacht haben. Die aufsuchende Beratung und<br />
Information in Kombination mit einer kontinuierlichen Begleitung <strong>der</strong> Kooperati-<br />
onspartner durch den Transfer- und Innovationsprozess hat die Schwellen für die<br />
Durchführung von Innovationsvorhaben bei diesen Betrieben gesenkt. Für den<br />
Wissenstransfer konnten damit Zielgruppen erreicht werden, die nicht zu den<br />
„Stammkunden“ in <strong>der</strong> Technologie- und Innovationsför<strong>der</strong>ung zählen. Ange-<br />
sichts <strong>der</strong> nur gering ausgeprägten FuE-Kompetenz in den Branchen und Tech-<br />
nologiefel<strong>der</strong>n <strong>der</strong> <strong>Kampagne</strong> ist dieser Erfolg nicht hoch genug zu schätzen.<br />
Schließlich soll die FuE-Kompetenz <strong>der</strong> Wirtschaft nicht nur in den bereits vor-<br />
handenen Stärken gestärkt, son<strong>der</strong>n auf einer möglichst breiten Basis entwickelt<br />
werden.<br />
Konsequenzen?<br />
Die vorhandenen Strukturen des Wissenstransfers in Brandenburg schöpfen die<br />
Möglichkeiten einer aufsuchenden und aktivierenden Beratung bislang noch nicht<br />
weit genug aus. Die gut vernetzten Branchentransferstellen und Hochschultrans-<br />
ferstellen wenden sich zwar mit gezielten Marketing- und Öffentlichkeitsstrategien<br />
an die Wirtschaft Brandenburgs, um ihr Wissen und ihre Kompetenzen für den<br />
Transfer und für die Innovationsför<strong>der</strong>ung anzubieten. Mit ihren Öffentlichkeits-<br />
strategien erreichen sie aber überwiegend jene Unternehmen, die bereits prinzi-<br />
piell offen sind für Hochschulkooperationen. Um den Wissenstransfer auszuwei-<br />
ten, sind aber nicht nur die FuE- sowie Innovationsstarken Unternehmen wichtig,<br />
son<strong>der</strong>n auch neue Unternehmen, die erst auf dem Weg sind, ihre Produkte und<br />
Verfahren wissensintensiver zu gestalten.<br />
5.2 Vertrauensbildung<br />
Die Projektträger haben sich nicht auf einmalige Impulse zum Start von Transfer-<br />
prozessen beschränkt, son<strong>der</strong>n den weiteren Verlauf <strong>der</strong> Zusammenarbeit aktiv<br />
motiviert und strukturiert. Wie stark das Engagement <strong>der</strong> Projektträger im konkre-<br />
ten Vorhaben jeweils war, hing von den Rahmenbedingungen des Einzelfalles<br />
ab. Im Prinzip aber haben sie „ihre“ Betriebe durch das Innovationsvorhaben hin-<br />
durch bis zum Realisierungskonzept und z.T. sogar bis zur Vertriebsberatung<br />
begleitet. Die Betriebe erhielten auf diese Weise „Leistungen aus einer Hand“.<br />
26
<strong>Endbericht</strong> <strong>der</strong> wissenschaftlichen Begleitung<br />
Die kontinuierliche Begleitung hatte auf den Erfolg <strong>der</strong> Innovationsvorhaben auch<br />
noch einen an<strong>der</strong>en Effekt: Sie war notwendig, um die Barrieren und „Berüh-<br />
rungsängste“ zwischen Wissenschaftlern und Unternehmern zu min<strong>der</strong>n und Un-<br />
sicherheiten über Ziele, Arbeitsschritte und erreichbare Erfolge aufzulösen und<br />
die Beteiligten immer wie<strong>der</strong> durch strukturierende Vorgaben zu Terminen, Ver-<br />
fahren und Ergebnissen zu motivieren.<br />
Das Hauptproblem des Wissenstransfers liegt für beide Seiten in einem offenen<br />
und vertrauensvollen Informations- und Wissensaustausch, <strong>der</strong> meist nicht von<br />
alleine reibungslos funktioniert, z.T. weil die am Innovationsprozess Beteiligten in<br />
an<strong>der</strong>en Kontexten als Konkurrenten auftreten o<strong>der</strong> weil zwischen den KMU und<br />
den beteiligten Wissenschaftlern ernsthafte Anreiz- und Bewertungsprobleme<br />
bestehen. Typisch für Innovationsvorhaben ist, dass zu Beginn noch nicht <strong>der</strong><br />
gesamte Verlauf des Vorhabens und sämtliche Details des Pflichtenheftes ab-<br />
sehbar sind. Die Arbeitsteilung und Zusammenarbeit kann also nur bedingt ver-<br />
traglich fixiert werden. 3 Die Herausfor<strong>der</strong>ung für das Transfermanagement liegt<br />
unter diesen Bedingungen darin, zwischen den Beteiligten Vertrauen aufzubau-<br />
en, so dass „barrierefrei“ kommuniziert werden kann und hohe Anreize gesetzt<br />
werden können, um innovative Ideen in wirtschaftlich verwertbare Projekte zu<br />
überführen.<br />
Dieses Vertrauen konnte von den Projektträgern mit verschiedenen Instrumenten<br />
aufgebaut werden. Wenn Projektträgern die Betriebe ihrer Branchen nur zu ei-<br />
nem geringen Teil persönlich bekannt waren, wurde Wert darauf gelegt, mög-<br />
lichst frühzeitig persönlich die potenziellen Partner aus <strong>der</strong> Wissenschaft vorzu-<br />
stellen, so dass sich interessierte Betriebe „ein Bild“ von ihnen machen und sich<br />
zunächst noch unverbindlich und zwanglos informieren konnten. Ein weiterer Ef-<br />
fekt dieser Vorgehensweise war, dass den Betrieben mit <strong>der</strong> Anwesenheit aus-<br />
gewählter Wissenschaftler zugleich die Kompetenz und Glaubwürdigkeit <strong>der</strong> Ver-<br />
anstaltung und <strong>der</strong> Projektträger demonstriert werden konnte. In <strong>der</strong> Informati-<br />
ons- und Kommunikationsbranche wurde dieses Modell über die sog. „Vor-<br />
Werkstätten“ praktiziert. Hier konnten sich Unternehmen über die <strong>Kampagne</strong>, ih-<br />
re Ziele und Vorgehensweisen informieren und von den geladenen Wissenschaft-<br />
3 Dennoch sind Verträge wichtig für die Zusammenarbeit. Sie wurden deswegen auch<br />
von allen Projektträgern für jedes Innovationsvorhaben abgeschlossen. Sie geben<br />
<strong>der</strong> Partnerschaft einen offiziellen Rahmen und sichern jeden einzelnen Beteiligten<br />
ab. Die Regelung <strong>der</strong> Arbeitsteilung und <strong>der</strong> Arbeitsleistungen klärt für jeden <strong>der</strong> Beteiligten<br />
die eigene Verantwortung und die <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en Partner für das Projekt. Die<br />
Herausfor<strong>der</strong>ung für das Transfermanagement liegt unter diesen Bedingungen darin,<br />
zwischen den Beteiligten Vertrauen aufzubauen, so dass „barrierefrei“ kommuniziert<br />
werden kann und hohe Anreize gesetzt werden können, um innovative Ideen in wirtschaftlich<br />
verwertbare Projekte zu überführen.<br />
27
<strong>Endbericht</strong> <strong>der</strong> wissenschaftlichen Begleitung<br />
lern erfahren, welche Leistungen in welchen Bereichen zu erwarten waren. In <strong>der</strong><br />
Informations- und Kommunikationsbranche war dieses relativ aufwändige Vorge-<br />
hen in <strong>der</strong> Akquisition zumindest zeitweise gerechtfertigt, weil das Feld <strong>der</strong> po-<br />
tenziell interessierten Unternehmen unübersichtlich weitläufig war und Vertrauen<br />
in die <strong>Kampagne</strong> daher nur in wenigen Fällen über bereits vorhandene persönli-<br />
che Kontakte aufgebaut werden konnte.<br />
Eine vergleichbare Strategie wählte das Projektteam in <strong>der</strong> Nanotechnologie,<br />
das mit einem ähnlich weitläufigen und v.a. sehr heterogenen Feld aus Betrieben<br />
konfrontiert war und deswegen nicht auf eingespielte Beziehungen in etablierten<br />
Branchennetzwerken zurück greifen konnte. Der Projektträger ging daher auch<br />
den Weg von den Wissensträgern (Hochschulen, wissenschaftliche Einrichtun-<br />
gen) zu den Unternehmen und versuchte mit <strong>der</strong> Kompetenz <strong>der</strong> Wissenschaftler<br />
zu werben. Den Firmen sollte auf diese Weise verdeutlicht werden, welche Vor-<br />
teile die Anwendung nanotechnologischer Verfahren für eigene betriebliche Inno-<br />
vationen haben kann.<br />
Die Stakehol<strong>der</strong>-Dialoge des Teams aus <strong>der</strong> Logistik erfüllten eine ähnliche<br />
Funktion. Sie hatten das Ziel, gemeinsam mit Wissenschaftlern und interessier-<br />
ten Unternehmen die Aufgabenstellung zu präzisieren und den weiteren Ablauf<br />
des Transferprozesses vorzubereiten. Als beson<strong>der</strong>s wichtig für die Vertrauens-<br />
bildung hat sich erwiesen, wenn die Unternehmen in den Dialogen genügend<br />
Spielräume haben, um ihre Ziele selber zu formulieren. Der Dialog muss den<br />
Zielfindungsprozess unterstützen, aber keinesfalls die Ziele vorab bestimmen. Es<br />
kommt darauf an, die richtigen Fragen zu stellen, die den Unternehmer zur Re-<br />
flexion seiner Möglichkeiten und Perspektiven animieren. Eine Erfahrung aus den<br />
Dialogen war, dass man „nicht mit Technologien hausieren gehen darf“, son<strong>der</strong>n<br />
je<strong>der</strong> seinen eigenen Weg in <strong>der</strong> Kooperation mit den Wissenschaftlern definie-<br />
ren muss.<br />
In <strong>der</strong> Metall- und Elektroindustrie Südbrandenburgs bestehen enge persönli-<br />
che Kontakte zwischen den Mitglie<strong>der</strong>n des Netzwerks. Das Netzwerk selbst ist<br />
mit rd. 40 Mitglie<strong>der</strong>n relativ überschaubar strukturiert. Die Arbeitsgemeinschaft<br />
<strong>der</strong> Metall- und Elektroindustrie trifft sich regelmäßigen Abständen (alle 6-8 Wo-<br />
chen) in einem <strong>der</strong> beteiligten Unternehmen zu einer Gesprächsrunde. In diesem<br />
Kontext sind Neuigkeiten unkompliziert zu vermitteln und entsprechende Vorha-<br />
ben und Projekte relativ leicht anzubahnen. Eine aufwändige Akquisition und ver-<br />
trauensbildende Maßnahmen sind hier nicht notwendig, weil sich die Kontakte<br />
untereinan<strong>der</strong> bereits in an<strong>der</strong>en Projektkontexten bewährt haben. Unter diesen<br />
Bedingungen sind neue Vorhaben mit geringerem Aufwand zu realisieren.<br />
28
<strong>Endbericht</strong> <strong>der</strong> wissenschaftlichen Begleitung<br />
In <strong>der</strong> Automobilbranche gelang <strong>der</strong> Aufbau von Kontakten zum Automotive-<br />
Netzwerk nur zögerlich und <strong>der</strong> Projektträger hatte kaum die Möglichkeit, von den<br />
Kontakten innerhalb des Netzwerkes zu profitieren. In diesem Fall fehlte aber<br />
auch eine Strategie zur Kompensation des anfänglichen Vertrauensdefizites.<br />
Ggf. wären vorbereitende Maßnahmen zum unverbindlichen Kennenlernen von<br />
potenziellen Partnern aus <strong>der</strong> Wissenschaft nützlich gewesen, um den Unter-<br />
nehmen den Schritt in eine Hochschul-Kooperation zu ebnen.<br />
Konsequenzen?<br />
Die Beziehungen in den Branchennetzwerken sind von unterschiedlicher Dichte<br />
und Intensität. Manche Netze, wie z.B. in <strong>der</strong> Informationstechnologie, befinden<br />
sich erst im Aufbau. In an<strong>der</strong>en existieren bereits umfangreiche Erfahrungen aus<br />
gemeinsamen Projekten und eine ausgeprägte Kultur wechselseitigen Vertrau-<br />
ens. Letzteres ist insbeson<strong>der</strong>e im Netzwerk <strong>der</strong> Metall- und Elektroindustrie und<br />
im Kunststoffnetzwerk <strong>der</strong> Fall. Diese Erfolgsvoraussetzungen sind aber nicht auf<br />
an<strong>der</strong>e Branchenkompetenzfel<strong>der</strong> und Technologien übertragbar. Vertrauensbil-<br />
dung bleibt eine Herausfor<strong>der</strong>ung im Wissenstransfer. Ein wichtiger Schritt in<br />
diese Richtung ist die Organisation eines möglichst frühzeitigen Kontaktes inte-<br />
ressierter Unternehmen mit Wissenschaftlern ohne Druck, Ideen preiszugeben<br />
und ohne Zwang, Verpflichtungen einzugehen. Ein offenes Werkstattgespräch, in<br />
dem über die Ziele, die möglichen Unterstützungsleistungen und die Kompeten-<br />
zen <strong>der</strong> wissenschaftlichen Partner informiert werden kann, signalisiert den inte-<br />
ressierten Unternehmen die Verantwortung, die einzelne Personen für das Gelin-<br />
gen eines Projektes übernehmen und macht das Vorhaben insgesamt glaubwür-<br />
dig. Allerdings sind solche offenen Werkstattgespräche als Akquisitionsstrategie<br />
auch relativ aufwändig in <strong>der</strong> Organisation und Durchführung.<br />
Kooperationsvereinbarungen sind ein weiterer wichtiger Schritt zur Strukturierung<br />
<strong>der</strong> Zusammenarbeit und zur Klärung <strong>der</strong> Verantwortung, die je<strong>der</strong> Partner für<br />
das Projekt übernimmt.<br />
Schließlich kommt es darauf an, ein offenes Gesprächsklima in den anschließen-<br />
den Beratungen und Werkstattgesprächen zu schaffen. Dies erreicht man nur, so<br />
die einhellige Erfahrung <strong>der</strong> Projektträger, indem sich Unternehmen, Wissen-<br />
schaftler und externe Experten als gleichrangige Partner gegenübertreten kön-<br />
nen und die Unternehmen nicht in die Rolle abhängiger Empfänger wissenschaft-<br />
licher „Patentlösungen“ gedrängt werden.<br />
5.3 Dialogisches Vorgehen<br />
Die Vertrauensbildung wird unmittelbar unterstützt durch das „dialogische Prin-<br />
zip“. Demnach wird <strong>der</strong> Wissenstransfer nicht als einseitiger Prozess <strong>der</strong> Vermitt-<br />
29
<strong>Endbericht</strong> <strong>der</strong> wissenschaftlichen Begleitung<br />
lung von Wissen aus <strong>der</strong> Forschung in die Praxis <strong>der</strong> Unternehmen verstanden,<br />
son<strong>der</strong>n als Erfahrungsaustausch, <strong>der</strong> unterschiedliche Kompetenzen als gleich-<br />
wertig anerkennt. Entscheidend ist die Entwicklung von Brückenbeziehungen<br />
zwischen Akteuren aus komplementären Wissensbereichen, Technologie- und<br />
Handlungsfel<strong>der</strong>n, die allen Partnern einen attraktiven Lernzusammenhang bie-<br />
ten. Für die Wissenschaftler geht es darum, Anregungen für die Entwicklung ei-<br />
nes industrie- und anwendungsnahen Ausbildungs- und Forschungsprofils zu<br />
gewinnen. Für die Unternehmen geht es darum, Ideen in marktfähige Produkte<br />
und Verfahren umzusetzen. Sie profitieren vom wissenschaftlichen Know-how,<br />
<strong>der</strong> technischen Ausstattung und dem wissenschaftlichen Personal, das ihre Ar-<br />
beit an <strong>der</strong> Entwicklung innovativer Produkte und Verfahren unterstützt. Anstelle<br />
des Begriffs Wissenstransfer, <strong>der</strong> eine einseitige Übertragung von Wissen impli-<br />
ziert, sollte daher besser von Wissensaustausch gesprochen werden.<br />
Eine zentrale Erkenntnis aus den Erfahrungen <strong>der</strong> <strong>Kampagne</strong> ist, dass die Wis-<br />
senschaften im Kontakt mit den Unternehmen keine „Patentlösungen“ vertreten<br />
sollten, son<strong>der</strong>n sich auf den jeweils individuellen Einzelfall einstellen müssen.<br />
Die Vertrauensbildung gelingt umso besser, je eher im Verlauf des Transferpro-<br />
zesses die potenziellen Partner einan<strong>der</strong> kennen lernen und sich aufeinan<strong>der</strong><br />
einstellen können. Gut geeignet dafür sind die „Vor-Werkstätten“, die mit den Be-<br />
trieben aus <strong>der</strong> Informations- und Kommunikationsbranche durchgeführt wurden.<br />
Eine ähnliche Bedeutung haben die Stake-hol<strong>der</strong>-Dialoge im Bereich <strong>der</strong> Logis-<br />
tik. In <strong>der</strong> Metall- und Elektroindustrie z.B. sind manche Wissenschaftler <strong>der</strong> FHS<br />
aus <strong>der</strong> Region selbst Teil des Netzwerkes und als solche bereits bekannt und<br />
vertraut. Dasselbe gilt für das Kunststoff-Netzwerk. Mit an<strong>der</strong>en Worten: Welche<br />
Instrumente im Transferprozess sinnvoll einzusetzen sind, muss den gegebenen<br />
Rahmenbedingungen <strong>der</strong> Branche und Region angepasst werden. Nicht jedes<br />
Instrument kann als Passe-Partout auf jede Situation übertragen werden. Dies<br />
gilt auch vor dem Hintergrund, dass Innovationsprozesse in kleinen Unterneh-<br />
men, die FuE nur sporadisch durchführen, i.d.R. einmalige Kunden-induzierte<br />
und deswegen kaum wie<strong>der</strong>holbare Einzelfälle sind, für die jedes Mal aufs Neue<br />
entschieden werden muss, welches Vorgehen mit welchen Instrumenten am bes-<br />
ten geeignet ist, um einen offenen Dialog zu unterstützen.<br />
Konsequenzen?<br />
Für die Klärung <strong>der</strong> Aufgabenstellung, die Verteilung von Arbeit und Verantwor-<br />
tung und die Entwicklung von Lösungen in Innovationsworkshops ist ein run<strong>der</strong><br />
Tisch am besten geeignet. Das Transfermanagement darf nicht nur Wissen an-<br />
bieten, son<strong>der</strong>n die Vermittlung von Wissen als dialogischen Prozess begreifen<br />
und ihn entsprechend offen und gleichberechtigt gestalten. Dies bedeutet, dass<br />
Wissenschaftler in solche Runden nicht mit dem Auftrag geladen werden sollten,<br />
eine Technologie vorzustellen, die als Lösung für das betriebsspezifische Prob-<br />
30
<strong>Endbericht</strong> <strong>der</strong> wissenschaftlichen Begleitung<br />
lem präsentiert wird. Wichtig ist, dass die Mo<strong>der</strong>ation/<strong>der</strong> Transfermanager einen<br />
Gesprächsprozess anregt, <strong>der</strong> zunächst auf Zuhören und voneinan<strong>der</strong> Lernen<br />
ausgerichtet ist und dann eine Diskussion stimuliert, in <strong>der</strong> alle Beteiligten ge-<br />
meinsam eine Lösung entwickeln können.<br />
5.4 Flexibler und bedarfsgerechter Einsatz von Instrumenten<br />
Alle Projektträger betonen einhellig, wie wichtig für den erfolgreichen Verlauf ein<br />
einzelfallorientierter, flexibler und bedarfsgerechter Instrumenteneinsatz war. Da-<br />
zu gehört eine große Flexibilität bei <strong>der</strong> Kombination unterschiedlicher Bera-<br />
tungsbausteine und Coaching-Methoden. So vollzog sich <strong>der</strong> Transferprozess in<br />
keinem Fall schematisch und nach formalisierten Mustern. Entscheidend für den<br />
Projekterfolg waren vielmehr die individuelle und projektbezogene Ausrichtung<br />
<strong>der</strong> Unterstützung und das Vorgehen in Zwischenetappen und Rückkoppelungs-<br />
schleifen, die Korrekturen und Anpassungen <strong>der</strong> Ziele, <strong>der</strong> Partner und <strong>der</strong> Bera-<br />
tungs- und Coaching-Methoden erlaubten.<br />
Konkret bedeutet dies:<br />
� Die individuelle Ausrichtung <strong>der</strong> Unterstützung und das Vorgehen in Zwischenetappen<br />
und Rückkoppelungsschleifen, um Ziele und Instrumente des<br />
Wissenstransfers immer wie<strong>der</strong> an die Dynamik <strong>der</strong> Projektentwicklung anpassen<br />
zu können.<br />
� Die Kombination verschiedener Wissensarten: Das Transfermanagement<br />
kombiniert je nach Erfor<strong>der</strong>nis Technologieberatung (Organisation <strong>der</strong> Wissenspartner,<br />
Management <strong>der</strong> Kooperation) mit strategischer Beratung (Managementwissen,<br />
Marktanalysen, Vertriebsberatung) und betrieblicher Weiterbildung<br />
(Weiterbildungskonzepte, Kurse zum Innovationsmanagement):<br />
Alle relevanten Leistungen können so aus einer Hand erfolgen, bzw. werden<br />
vom Management für das Unternehmen organisiert (one face to the customer).<br />
� Die Interdisziplinarität des Transfers: Je nach den Erfor<strong>der</strong>nissen des Projektes<br />
konnten verschiedene wissenschaftliche Disziplinen und verschiedene<br />
Einrichtungen (Hochschulen, FuE-Einrichtungen, wissenschaftliche<br />
Dienstleister) einbezogen werden. D.h. zu den Projektverbünden zählen sowohl<br />
Wissenschaftspartner (verschiedene Disziplinen) als auch Unternehmen<br />
(Geschäftsführer, Ingenieure, Meister) und externe Partner (Technologie-<br />
und Anwendungswissen, Marktkompetenz).<br />
Die individuelle und projektbezogene Ausrichtung <strong>der</strong> Unterstützung kann im<br />
Einzelfall bedeuten, dass Innovationswerkstätten nicht nur einmal, son<strong>der</strong>n<br />
zweimal o<strong>der</strong> mehrere Male durchgeführt werden müssen, um auf verän<strong>der</strong>te An-<br />
for<strong>der</strong>ungen im Innovationsprozess angemessen reagieren zu können. Es liegt in<br />
<strong>der</strong> Kompetenz des Transfermanagers, offene Fragen, Probleme o<strong>der</strong> Asy-<br />
metrien in <strong>der</strong> Zusammenarbeit anzusprechen und konstruktiv auf eine Lösung<br />
hin zu wirken.<br />
31
<strong>Endbericht</strong> <strong>der</strong> wissenschaftlichen Begleitung<br />
Technologiewissen, Managementwissen und methodisches Wissen konnten<br />
durch die Teilnahme verschieden spezialisierter Personen und Einrichtungen si-<br />
cher gestellt werden. So waren in manchen Projekten nicht nur die Wissenschaft-<br />
ler einer Hochschule beteiligt, son<strong>der</strong>n mehrere Wissenschaftler verschiedener<br />
Wissensgebiete aus verschiedenen Hochschulen. Sofern das relevante Wissen<br />
über spezifische technische Lösungen nicht über Hochschulforschung zu akqui-<br />
rieren war, konnte auch auf kommerzielle wissenschaftliche Dienstleister zurück-<br />
gegriffen werden. Betriebswirtschaftliche o<strong>der</strong> strategische Beratungen wurden<br />
z.T. von den Projektträgern selbst o<strong>der</strong> von externen Partner erbracht. Aus <strong>der</strong><br />
Sicht <strong>der</strong> beteiligten Unternehmer konnten auf diese Weise alle relevanten Leis-<br />
tungen aus einer Hand erfolgen.<br />
Die Kombination unterschiedlicher Beratungsarten und Wissensbausteine hat<br />
dazu geführt, dass die Unternehmen das Risiko <strong>der</strong> Innovation fundierter beurtei-<br />
len konnten und in <strong>der</strong> Entscheidung über die Durchführung des Vorhabens si-<br />
cherer wurden. Ein Umstand, <strong>der</strong> nicht unwesentlich zum Erfolg vieler Innovati-<br />
onsvorhaben beigetragen hat. Denn häufig scheitern Innovationsvorhaben schon<br />
im Ideen-Stadium, wenn z.B. nicht geklärt werden kann, welche Verän<strong>der</strong>ungen<br />
eine Innovation für die strategische Ausrichtung <strong>der</strong> Unternehmensziele mit sich<br />
bringt und welche Chancen eine Innovation nicht nur bei einem Kunden, son<strong>der</strong>n<br />
auf einem spezifischen Markt haben kann. Insofern ging es bei dem Wissens-<br />
transfer nicht nur um die Verbreiterung <strong>der</strong> technologischen Leistungsfähigkeit<br />
<strong>der</strong> Unternehmen, son<strong>der</strong>n auch darum, ihre strategische Kompetenz zu verbes-<br />
sern.<br />
In diesem Kontext sind auch die flankierenden Seminare und Weiterbildungsan-<br />
gebote zu sehen, die die Projektträger für Geschäftsführer und Mitarbeiter ange-<br />
boten und durchgeführt haben. Dazu gehören Seminare zum Thema Innovati-<br />
onsmanagement o<strong>der</strong> Seminare, die technische Neuerungen im Arbeitsablauf<br />
den beteiligten Mitarbeitern aus den Unternehmen vermitteln.<br />
Schließlich ist die kontinuierliche und phasenorientierte Begleitung <strong>der</strong> Unter-<br />
nehmen hervorzuheben. Akquisition und Sensibilisierung, Auditierung, Realisie-<br />
rungsplanung und Umsetzung sind ineinan<strong>der</strong> greifende und komplementäre<br />
Schritte des Transferprozesses, die jeweils an die spezifischen externen und in-<br />
ternen Rahmenbedingungen des Unternehmens anzupassen sind. Die ganzheit-<br />
liche und prozessbezogene Vorgehensweise erfor<strong>der</strong>t, dass nicht nur die techni-<br />
sche Lösung und <strong>der</strong> dafür notwendige Wissenstransfer in den Blick genommen<br />
wird, son<strong>der</strong>n das gesamte Unternehmen, seine spezifischen Ressourcen und<br />
Potenziale und seine strategischen Perspektiven zur Vermarktung <strong>der</strong> Innovati-<br />
on.<br />
32
Konsequenzen?<br />
<strong>Endbericht</strong> <strong>der</strong> wissenschaftlichen Begleitung<br />
Bei <strong>der</strong> Gestaltung von Transferprozessen sollte nicht nur die Verbreiterung <strong>der</strong><br />
technologischen Wissensbasis im Unternehmen im Mittelpunkt stehen. Vielmehr<br />
sollte die technologische Kompetenzentwicklung eingebettet sein in Beratungs-<br />
und Weiterbildungsbausteine, die auch die strategische Kompetenz <strong>der</strong> Unter-<br />
nehmen und ihre Fähigkeit zum eigenständigen Management von Innovations-<br />
vorhaben verbessern.<br />
5.5 Personaltransfer<br />
In vielen Fällen waren am Wissenstransfer nicht nur Professoren o<strong>der</strong> Wissen-<br />
schaftliche Mitarbeiter beteiligt, son<strong>der</strong>n auch Studierende, die im Rahmen von<br />
Studien- o<strong>der</strong> Abschlussarbeiten das Thema einer Innovationswerkstatt zum An-<br />
lass für die Entwicklung eigener Analysen und Konzepte nahmen. Das Unter-<br />
nehmen wurde in diesen Fällen für die Studierenden zum Lernfeld vor Ort, in<br />
dem sie – angeleitet von Professoren und wissenschaftlichen Mitarbeitern – Ana-<br />
lysen, Laborversuche und Experimente durchführen und ihre Ideen in die Innova-<br />
tionswerkstatt einbringen konnten.<br />
So wurde z.B. im Fall <strong>der</strong> Firma Ticket.Web ein Kernteam mit 4 Personen aus<br />
dem Unternehmen und <strong>der</strong> TFH Wildau gebildet, das sich im weiteren Arbeits-<br />
prozess regelmäßig etwa ein mal im Monat zu Treffen zusammen fand. Den Wis-<br />
senschaftlern und Mitarbeitern des Unternehmens kam die Aufgabe zu, die fach-<br />
lich-technische Seite zu bearbeiten. Die konkreten Arbeitsschritte dafür wurden in<br />
einem „Lastenheft“ beschrieben, an dem sich auch die zwei Studierenden orien-<br />
tieren konnten, die als Praktikanten im Unternehmen arbeiteten. Einer <strong>der</strong> Absol-<br />
venten konnte auf eine feste Stelle im Unternehmen übernommen werden und<br />
bringt das Innovationsprojekt weiter voran.<br />
In ähnlicher Weise funktionierte <strong>der</strong> Personaltransfer in die Firma Tyroller. Auch<br />
in diesem Fall griff ein Diplomand das Thema <strong>der</strong> Innovationswerkstatt auf und<br />
erarbeitete im Rahmen seiner Abschlussarbeit Entwürfe und das Umsetzungs-<br />
konzept für das Innovationsvorhaben. Dabei wurde er auf regelmäßigen Projekt-<br />
treffen unterstützt, zu denen sich in Abständen von ca. 6 Wochen Projektträger,<br />
Wissenschaftler und Unternehmer zusammen fanden und auf denen <strong>der</strong> Stand<br />
<strong>der</strong> Entwicklungsarbeiten reflektiert sowie Korrekturen und Verbesserungen dis-<br />
kutiert wurden. Nach dem Abschluss seines Studiums wurde <strong>der</strong> Absolvent auf<br />
eine feste Stelle im Unternehmen übernommen. Dort betreut er weiter die Reali-<br />
sierung seines Konzeptes und steht als „Innovationsassistent“ dem Geschäfts-<br />
führer auch in an<strong>der</strong>en Projekten zur Seite, die neben den Routineaufgaben im<br />
Betrieb innovative Lösungen und kreative Arbeit erfor<strong>der</strong>n.<br />
33
<strong>Endbericht</strong> <strong>der</strong> wissenschaftlichen Begleitung<br />
Ob <strong>der</strong> Personaltransfer erfolgreich ist, hängt v.a. von den beteiligten Professo-<br />
ren o<strong>der</strong> Wissenschaftlichen Mitarbeitern aus den Hochschulen ab. Wenn sie die<br />
Themen und die Stärken ihrer Studierenden kennen und sie für die Mitarbeit in<br />
Unternehmen motivieren können, lassen sich Lehranfor<strong>der</strong>ungen und praktische<br />
Unterstützung betrieblicher Innovationsvorhaben leicht aufeinan<strong>der</strong> abstimmen.<br />
Die Qualität des Wissenstransfers hängt deswegen unmittelbar von <strong>der</strong> Kompe-<br />
tenz des wissenschaftlichen Personals ab: Welches Gewicht messen sie anwen-<br />
dungsorientierter Forschung zu? Wie flexibel sind sie bei <strong>der</strong> Abstimmung von<br />
wissenschaftlichen Qualitätsstandards mit den Erfor<strong>der</strong>nissen betrieblicher Inno-<br />
vationsvorhaben?<br />
Sowohl Hochschulen wie Fachhochschulen haben die Potenziale beiden Seiten<br />
gerecht zu werden: Zeiten betrieblicher Praktikas lassen sich für das Studium an-<br />
rechnen und betriebliche Erfahrungen können für wissenschaftliche Qualifikati-<br />
onsarbeiten genutzt werden. Auf diese Weise können die Kontakte zwischen<br />
Wirtschaft und Wissenschaft zu einer stetigen Aktualisierung <strong>der</strong> betriebsnahen<br />
und anwendungsorientierten FuE an Fachhochschulen beitragen. Für die Unter-<br />
nehmen wie<strong>der</strong>um bedeutet <strong>der</strong> Personaltransfer eine Entlastung <strong>der</strong> Geschäfts-<br />
führung von den praktischen Entwicklungsaufgaben im Kontext des Innovations-<br />
vorhabens und eine sinnvolle fachliche Unterstützung bei <strong>der</strong> Suche nach techni-<br />
schen Lösungen.<br />
Konsequenzen?<br />
Der Personaltransfer schafft für beide Seiten im Wissenstransfer Vorteile. Wis-<br />
senschaftler gewinnen daraus Anregungen für die Entwicklung eines industrie-<br />
und anwendungsnahen Ausbildungs- und Forschungsprofils. Unternehmen hilft<br />
er dabei, Ideen in marktfähige Produkte und Verfahren umzusetzen. Zugleich ist<br />
<strong>der</strong> Personaltransfer ein zentrales Instrument sowohl zur Entlastung <strong>der</strong> Ge-<br />
schäftsführung bei <strong>der</strong> Durchführung von Innovationsvorhaben als auch zur Si-<br />
cherung des Fachkräftebedarfs <strong>der</strong> Unternehmen. Dies belegen die vielen Bei-<br />
spiele aus <strong>der</strong> <strong>Kampagne</strong>, in denen Absolventen, die als Praktikanten im Unter-<br />
nehmen gearbeitet haben, nach Abschluss des Projektes in feste Anstellungen<br />
übernommen wurden und dem Unternehmen als Innovationsassistenten weiter<br />
bei <strong>der</strong> Bewältigung von Nicht-Routine-Aufgaben zur Verfügung stehen.<br />
5.6 Fazit<br />
Wissenstransfer ist kein linearer Prozess, so wie dies schematisierte Ablaufpläne<br />
nahelegen, son<strong>der</strong>n in hohem Maße rekursiv und reflexiv. Innovationsziele müs-<br />
sen im Arbeitsprozess überprüft, korrigiert o<strong>der</strong> angepasst werden. Entscheidun-<br />
gen müssen prinzipiell revidierbar sein, wenn sich im Verlauf <strong>der</strong> Zusammenar-<br />
beit herausstellt, dass sinnvolle Alternativen zur Verfügung stehen. Ein erfolgrei-<br />
34
<strong>Endbericht</strong> <strong>der</strong> wissenschaftlichen Begleitung<br />
ches Transfermanagement ist daher v.a. flexibel und anpassungsfähig. Es gibt<br />
keinen „Königsweg“, <strong>der</strong> sicher durch jedes Innovationsvorhaben führt, <strong>der</strong> allen<br />
an<strong>der</strong>en Instrumenten überlegen ist und sie überflüssig macht. Daher ist es auch<br />
nicht sinnvoll in „Best-Practices“ ein übertragbares und formalisiertes Muster für<br />
an<strong>der</strong>e Anwendungskontexte zu sehen. Sie können lediglich als Anregung dazu<br />
dienen, in vergleichbaren Situationen ähnlich vorzugehen.<br />
Zunächst muss festgehalten werden, dass die <strong>Kampagne</strong> v.a. auf das Instrument<br />
<strong>der</strong> Projekt-Kooperation zwischen Wissenschaftlern und Unternehmern gesetzt<br />
hat. Damit ist bereits eine bedeutende Vorauswahl aus dem Spektrum <strong>der</strong> mögli-<br />
chen Instrumente zum Wissenstransfer getroffen worden (vgl. Kapitel. 2.1 Trans-<br />
ferstellen an Hochschulen). Innerhalb <strong>der</strong> Möglichkeiten dieses Instrumentes sind<br />
die Projektträger den weitreichenden Vorgaben zur Projektstrukturierung gefolgt.<br />
Daher sind auch kaum von den Vorgaben abweichende Ergebnisse präsentiert<br />
worden. Zu den wichtigen Ergebnissen <strong>der</strong> <strong>Kampagne</strong> zählt aber die Erkenntnis,<br />
dass die verschiedenen Instrumente von <strong>der</strong> Akquisition bis zur Innovationswerk-<br />
statt als notwendige und einan<strong>der</strong> ergänzende, komplementäre Wege des Trans-<br />
fers zu verstehen sind, die ineinan<strong>der</strong> greifen und jeweils verschiedenen Situati-<br />
onen, Themen und Zielgruppen anzupassen sind. Grundsätzlich macht es jedoch<br />
keinen Unterschied ob Innovations- o<strong>der</strong> Transferwerkstätten und Stakehol<strong>der</strong>-<br />
Dialoge durchgeführt o<strong>der</strong> Innovationsteams gebildet wurden. Der Erfolg eines<br />
Vorhabens hängt vor allem davon ab, ob<br />
� die richtigen Partner vermittelt wurden,<br />
� die Unternehmen von den Projektträgern und Wissenschaftlern dabei unterstützt<br />
wurden, selbst die Ziele des Vorhabens zu definieren und keine „Patentlösungen“<br />
angeboten bekamen<br />
� die Unternehmen durch flankierende Beratungsmodule dabei unterstützt<br />
wurden, das geplante Innovationsvorhaben in seiner strategischen Bedeutung<br />
für die betriebliche Entwicklung einzuschätzen (Marktanalysen, Marktstrategie)<br />
� die Zusammenarbeit für die Beteiligten fachlich plausibel strukturiert und sozial<br />
kompetent mo<strong>der</strong>iert und damit <strong>der</strong> Prozess insgesamt motiviert wurde.<br />
6 . Aus g ew ä h l te Good-Practices<br />
6.1 Auswahlkriterien<br />
Die Auswahl <strong>der</strong> „Good-Practices“ unter den Innovationsvorhaben erfolgte in ei-<br />
nem engen Dialog sowohl mit <strong>der</strong> <strong>LASA</strong> als auch den Projektträgerm. Sie reprä-<br />
sentieren jeweils beson<strong>der</strong>s gute Beispiele dafür, wie<br />
35
<strong>Endbericht</strong> <strong>der</strong> wissenschaftlichen Begleitung<br />
� Organisations- und Handlungsroutinen zur Durchführung von Innovationsvorhaben<br />
vermittelt wurden<br />
� Und die Qualifikation von Geschäftsführung und Mitarbeitern verbessert werden<br />
konnte.<br />
Sie verbreitern das technologische Wissen in den KMU indem<br />
� Neue Qualifikationen vermittelt werden<br />
� O<strong>der</strong> <strong>der</strong> Einstieg in ein neues Technologiefeld gelingt<br />
Sie verbessern im Idealfall jedoch nicht nur die Innovationsfähigkeit von KMU,<br />
son<strong>der</strong>n wirken sich auch auf Fachhochschulen, Hochschulen und Universitäten<br />
aus, indem<br />
� Kooperationsergebnisse in den Lehrbetrieb zurückgekoppelt werden<br />
� Diplom- und an<strong>der</strong>e Studienarbeiten mit unmittelbarem Anwendungsbezug<br />
betreut und erfolgreich abgeschlossen werden<br />
� Und Seminare, Weiterbildungen und Workshops mit Wissenschaftlern und<br />
betrieblichen Mitarbeitern abgehalten werden.<br />
Folgendes Schaubild illustriert die Anfor<strong>der</strong>ungen:<br />
Abb. 9: Anfor<strong>der</strong>ungen an Good-Practices<br />
KMU<br />
Verbesserung <strong>der</strong><br />
Innovationsmanagement-<br />
Kompetenz in KMU<br />
Verbreiterung <strong>der</strong><br />
technologischen<br />
Wissensbasis in KMU<br />
Wissensaustausch<br />
Projektträger<br />
Verbesserung des<br />
regionalen Forschungsund<br />
Ausbildungsprofils<br />
36<br />
FuE<br />
Die Kriterien wurden in einem Workshop den Projektträgern vorgestellt und ab-<br />
gestimmt. Die Projektträger benannten daraufhin jeweils 2 Innovationsvorhaben,<br />
die aus ihrer Sicht den Auswahlkriterien für ein Good-Practice-Projekt entspra-<br />
chen. Diese Beispiel-Projekte wurden von <strong>der</strong> wissenschaftlichen Begleitung be-<br />
son<strong>der</strong>s ausführlich in Fallstudien untersucht:
Fallstudien umfassen:<br />
Methode Ziele<br />
1 Leitfaden-gestütztes Interview mit dem<br />
Projektverantwortlichen des Unternehmens<br />
Auswertung des Innovations-Checks<br />
1 Interview mit dem bzw. den beteiligten<br />
Wissenschaftler/n o<strong>der</strong> externen<br />
Dienstleistern<br />
2 qualitative leitfadengestützte Interviews mit<br />
dem Projektträger<br />
Teilnahme an Projektworkshops u. Transfergesprächen<br />
Auswertung von Protokollen und Dokumenten<br />
zur Durchführung des Transfermanagements<br />
<strong>Endbericht</strong> <strong>der</strong> wissenschaftlichen Begleitung<br />
37<br />
Befunde zu betrieblichen Strukturdaten<br />
erheben<br />
Art <strong>der</strong> Innovation sowie die Innovationsfähigkeit<br />
<strong>der</strong> Unternehmen einschätzen<br />
Bewertung des Verlaufs und <strong>der</strong> Ergebnisse<br />
des Transferprozesses<br />
Rolle <strong>der</strong> Wissenschaftler und an<strong>der</strong>er<br />
externer Dienstleister im Team herausarbeiten<br />
Ihren Input für den Transfer verdeutlichen,<br />
Einschätzungen zur Machbarkeit und Innovativität<br />
des Vorhabens gewinnen<br />
Bewertung des Verlaufs und <strong>der</strong> Ergebnisse<br />
des Transferprozesses<br />
Management-Instrumente und Vorgehen<br />
im Transferprozess deutlich machen<br />
Wirkungszusammenhänge zwischen Instrumenten<br />
und Ergebnissen herausarbeiten<br />
Bewertung des Verlaufs und <strong>der</strong> Ergebnisse<br />
des Transferprozesses<br />
Die an<strong>der</strong>en Vorhaben <strong>der</strong> Projektträger werden im Huckepack-Prinzip mitbear-<br />
beitet. D.h. in den Gesprächen mit den Projektträgern werden nicht nur Informati-<br />
onen zu den Fallstudien-Unternehmen erhoben, son<strong>der</strong>n auch zu den an<strong>der</strong>en<br />
Vorhaben. Stichprobenartig wurden weitere persönliche Gespräche mit Ge-<br />
schäftsführern und Projektverantwortlichen in den beteiligten Unternehmen ge-<br />
führt, um die Vergleichsmaßstäbe für die Good-Practices zu verbessern und ei-<br />
nen umfassenden Überblick zu den Erfolgen und Problemen im Transferprozess<br />
zu bekommen.<br />
Die im Folgenden präsentierten Beispiele sind eine Auswahl von „Good-<br />
Practices“, die jeweils für einen bestimmten Aspekt im Innovationsprozess ste-<br />
hen: Firma Bebra GmbH gelang mit dem Wissenstransfer <strong>der</strong> Einstieg in ein<br />
neues Technologiefeld, Fa. Tyroller GmbH konnte mit Hilfe von Personaltransfer<br />
bei <strong>der</strong> Verbesserung des Innovationsmanagements geholfen werden und <strong>der</strong><br />
Holzverbund ist ein Beispiel dafür, wie die Ergebnisse aus dem Wissenstransfer<br />
dazu verwendet werden können, um Forschung und Lehre mit Anregungen aus<br />
<strong>der</strong> betrieblichen Praxis anwendungsorientierter und betriebsnäher zu gestalten.
6.2 Einstieg in ein neues Technologiefeld<br />
<strong>Endbericht</strong> <strong>der</strong> wissenschaftlichen Begleitung<br />
Das Unternehmen berät Kommunalverwaltungen in Fragen <strong>der</strong> internen Organi-<br />
sation von Arbeit und <strong>der</strong> Optimierung von Arbeitsvorgängen. Schwerpunkte lie-<br />
gen im Bereich des Managements von kommunalen Gebäuden, bei <strong>der</strong> Bewer-<br />
tung von Stellen in <strong>der</strong> Verwaltung und im Bauhofmanagement. Mit <strong>der</strong> Beteili-<br />
gung an <strong>der</strong> Entwicklung technischer Lösungen für Verwaltungsaufgaben betritt<br />
die Firma Neuland. Ihr fehlt das technische Know-how und die Ausstattung für<br />
solche Projekte und das Management von innovativen Aufgaben ist aufgrund<br />
zeitlicher und personeller Probleme für das Unternehmen schwer zu bewältigen.<br />
Das Innovationsvorhaben zielt auf eine technische Lösung zur Verringerung des<br />
Reinigungsaufwandes in öffentlichen Bä<strong>der</strong>n. Dazu wurde mit Hilfe nanotechno-<br />
logischer Verfahren ein Konzept entwickelt, mit dem Glas-, Keramik- und Metall-<br />
oberflächen mit schmutzreduzierenden bzw. abweisenden Nanopartikeln be-<br />
schichtet werden können. Die Beschichtung soll die Reinigung von sanitären Ein-<br />
richtungen wie z.B. öffentlichen Bä<strong>der</strong>n erleichtern und beschleunigen.<br />
Lösungsansatz<br />
Die beson<strong>der</strong>e technologische Herausfor<strong>der</strong>ung für das Projekt bestand in <strong>der</strong><br />
Koordination verschiedener wissenschaftlicher Experten für unterschiedliche O-<br />
berflächen (Keramik, Metall, Glas). Der Projektträger konnte insgesamt vier Wis-<br />
sensträger für das Unternehmen gewinnen.<br />
Zwischen dem Unternehmen und den Wissensträgern fanden bilaterale Treffen<br />
statt, die je nach Komplexität <strong>der</strong> Aufgabenstellung unterschiedlich aufwändig<br />
gestaltet waren. Im Durchschnitt wurden 2 bis 3 Arbeitstreffen pro Wissensträger<br />
veranstaltet, die vom Projektträger angebahnt, begleitet und mo<strong>der</strong>iert wurden.<br />
Die Treffen waren je nach Aufgabe als informeller Erfahrungsaustausch o<strong>der</strong> als<br />
organisierter Workshop geplant. Mit je<strong>der</strong> wissenschaftlichen Einrichtung wurde<br />
jeweils ein Innovationsworkshop durchgeführt, auf dem die Wissensträger ihre<br />
Lösungsansätze zur Be- und Entschichtung verschiedener Oberflächen vorge-<br />
stellt haben und die daraus folgenden unternehmensspezifischen Aufgabenstel-<br />
lungen mit dem Unternehmen diskutiert wurden. Dabei wurde die Machbarkeit<br />
<strong>der</strong> Lösungsansätze überprüft und festgelegt, welche bis dahin noch offenen<br />
Fragen von den Wissensträgern und vom Unternehmen beantwortet werden<br />
müssen.<br />
Außerdem wurde ein Weiterbildungskurzkonzept von einem <strong>der</strong> Wissensträger<br />
vorgestellt, in dem die Lernziele für Projektmitarbeiter aus dem Unternehmen be-<br />
stimmt und Lernschritte und –methoden zur Wissensvermittlung aufgezeigt wer-<br />
den. In regelmäßigen Arbeitstreffen und über telefonische Abstimmung und E-<br />
mailkontakte wurden die Arbeitsfortschritte reflektiert und das weitere Vorgehen<br />
diskutiert.<br />
38
Ergebnisse<br />
<strong>Endbericht</strong> <strong>der</strong> wissenschaftlichen Begleitung<br />
Auf <strong>der</strong> Grundlage verschiedener Expertisen von den unterschiedlichen Wissens-<br />
trägern konnten die Anfor<strong>der</strong>ungen für nanotechnologische Beschichtungs- bzw.<br />
Entschichtungsverfahren geklärt und ein Realisierungskonzept entwickelt wer-<br />
den. Das Realisierungskonzept beschreibt die unternehmensspezifischen Aufga-<br />
benstellungen und den Innovationsansatz, den Arbeitsplan zum Wissenstransfer<br />
und zur Lösung <strong>der</strong> Aufgabenstellung. Es hält die Ergebnisse des durchgeführten<br />
Wissenstransfers fest und entwickelt Empfehlungen für die unternehmensspezifi-<br />
sche Innovation. Einer <strong>der</strong> Studenten, die an Analyse und Realisierung des Kon-<br />
zeptes mitgearbeitet haben, wurde als Innovationsassistent auf einen festen Ar-<br />
beitsplatz in <strong>der</strong> Firma übernommen und entwickelt dort die erprobten Verfahren<br />
weiter.<br />
Bewertung<br />
Für das beratene Unternehmen bedeutete <strong>der</strong> Wissenstransfer den Einstieg in<br />
ein neues Geschäftsfeld und in eine für das Unternehmen bis dahin neue Tech-<br />
nologie. Die beson<strong>der</strong>e Herausfor<strong>der</strong>ung dieses Projektes bestand darin, unge-<br />
wöhnlich viele verschiedene wissenschaftliche Expertisen aufeinan<strong>der</strong> abstim-<br />
men und in ihrem Zusammenwirken zu koordinieren. Mit dem vorgelegten Reali-<br />
sierungskonzept hat das Unternehmen einen Fahrplan bis zur Umsetzung des<br />
Vorhabens erhalten. Die Übernahme eines Innovationsassistenten gewährleistet<br />
die zielorientierte Weiterführung des Vorhabens bis zur Umsetzung des Realisie-<br />
rungskonzeptes.<br />
6.3 Innovationskompetenz durch Personaltransfer<br />
Die Firma konstruiert, fertigt und wartet industrielle Anlagen mit hydraulischem<br />
Antrieben, sie entwickelt Son<strong>der</strong>maschinen für den stationären und mobilen Ein-<br />
satz und sie ergänzt Serienfahrzeuge mit konstruktiven Anlagen, konstruiert und<br />
fertigt den Umbau und die konstruktiven Anpassungen am Serienfahrzeug. Die<br />
Spezialmaschinen sind individuelle Son<strong>der</strong>anfertigungen für Kunden. Auch die<br />
Fahrzeugaufbauten folgen i.d.R. individuellen Kundenwünschen.<br />
Weil jede Son<strong>der</strong>anfertigung einen eigenständigen Forschungs- und Entwick-<br />
lungsaufwand voraussetzt, hat die Firma bereits öfter mit <strong>der</strong> Fachhochschule<br />
zusammen gearbeitet und <strong>der</strong>en Kompetenzen in <strong>der</strong> Konstruktion und Entwick-<br />
lung genutzt. Der Leiter des Fachbereichs für Konstruktionstechnik an <strong>der</strong> FH ist<br />
im Netzwerk <strong>der</strong> Südbrandenburgischen Metall- und Elektroindustrie wegen sei-<br />
nes Engagements für praxisnahe und anwendungsorientierte Forschung sehr gut<br />
bekannt.<br />
39
<strong>Endbericht</strong> <strong>der</strong> wissenschaftlichen Begleitung<br />
Der Impuls für das Projekt zum Wissenstransfer kam von einem Kunden, <strong>der</strong> sich<br />
nach den Möglichkeiten für den Aufbau von Solarenergiefel<strong>der</strong>n bei dem Unter-<br />
nehmen erkundigt hat. Die technische Herausfor<strong>der</strong>ung besteht darin, die Unter-<br />
baukonstruktionen für die Solarfel<strong>der</strong> so in <strong>der</strong> Erde zu verankern, dass die Un-<br />
ebenheiten des Untergrundes exakt ausgeglichen werden. Bislang gelingt dies<br />
nur mit aufwändigen, zeitintensiven und teuren Verfahren. Um solche Unterbau-<br />
konstruktionen schneller und präziser bauen zu können, hat die Firma ein Navi-<br />
gationssystem als auch ein mobiles Konstruktionssystem entwickelt, das Erdver-<br />
ankerungen in genau berechneten Positionen anbringen und montieren kann.<br />
Lösungsansatz<br />
In mehreren persönlichen Arbeitstreffen mit dem Projektträger wurden die Ziele<br />
des Innovationsvorhabens präzisiert. Der Projektträger hat daraufhin den Kontakt<br />
zu einem Wissenschaftler <strong>der</strong> FH Lausitz vermittelt. Im Auftaktgespräch zwischen<br />
Wissenschaftlern und dem Geschäftsführer des Unternehmens, das vom Projekt-<br />
träger angebahnt und mo<strong>der</strong>iert wurde, konnten die Ziele des Innovationsvorha-<br />
bens geklärt und die notwendigen Arbeitschritte und Verantwortlichkeiten abge-<br />
stimmt werden. Dabei wurde verabredet, dass unter <strong>der</strong> Anleitung des Wissen-<br />
schaftlers und in enger Abstimmung mit dem Unternehmen im Rahmen einer<br />
Diplomarbeit die Entwürfe und das Umsetzungskonzept erarbeitet werden.<br />
Der Diplomand hatte einen wesentlichen Anteil an <strong>der</strong> technischen Lösung des<br />
Problems und entwarf sowohl das Konzept für die Realisierung des Navigations-<br />
systems als auch <strong>der</strong> mobilen Montagekonstruktion. Dabei wurde er auf regel-<br />
mäßigen Projekttreffen unterstützt, zu denen sich in Abständen von ca. 6 Wo-<br />
chen Projektträger, Wissenschaftler und Unternehmer zusammen fanden und auf<br />
denen <strong>der</strong> Stand <strong>der</strong> Entwicklungsarbeiten reflektiert sowie Korrekturen und Ver-<br />
besserungen diskutiert wurden.<br />
Nach dem Abschluss seines Studiums wurde <strong>der</strong> Absolvent auf eine feste Stelle<br />
im Unternehmen übernommen. Dort betreut er weiter die Realisierung seines<br />
Konzeptes und steht als „Innovationsassistent“ dem Geschäftsführer auch in an-<br />
<strong>der</strong>en Projekten zur Seite, die neben den Routineaufgaben im Betrieb innovative<br />
Lösungen und kreative Arbeit erfor<strong>der</strong>n.<br />
Ergebnisse<br />
Direkte Folge des INNOPUNKT-Projektes ist ein Realisierungskonzept für die<br />
technische Lösung des mobilen Montagearms und seine Steuerung über ein Na-<br />
vigationssystem. Das Projekt hat außerdem dazu beigetragen, dass eine neue<br />
feste Arbeitstelle für einen Innovationsassistenten geschaffen wurde, <strong>der</strong> im Un-<br />
ternehmen an <strong>der</strong> Umsetzung des Realisierungskonzeptes arbeitet und den Ge-<br />
schäftsführer auch in an<strong>der</strong>en Entwicklungsfragen zur Seite steht.<br />
40
Bewertung<br />
<strong>Endbericht</strong> <strong>der</strong> wissenschaftlichen Begleitung<br />
Die Stärke des Unternehmens liegt in <strong>der</strong> Ideenfindung und in <strong>der</strong> Auswahl ge-<br />
eigneter Projekte. Im Management <strong>der</strong> Realisierung und Umsetzung gibt es je-<br />
doch Engpässe, weil alles über den Geschäftsführer läuft. Das INNOPUNKT-<br />
Projekt hatte daher auch eine wichtige entlastende Funktion. Mit <strong>der</strong> Übernahme<br />
des Absolventen als Innovationsassistent hat <strong>der</strong> Geschäftsführer eine dauerhaf-<br />
te Unterstützung in Entwicklungsfragen bekommen. Auf diese Weise können zu-<br />
sätzliche Ressourcen in die betriebseigene Forschung und Entwicklung investiert<br />
werden, ohne dass dadurch <strong>der</strong> betriebliche Arbeitsalltag allzu sehr einge-<br />
schränkt wird.<br />
6.4 Verbesserung des anwendungsnahen Ausbildungsprofils<br />
Die Logistikkosten in <strong>der</strong> Forst- und Holzwirtschaft sind im Vergleich zu an<strong>der</strong>en<br />
Branchen sehr hoch, weil bei <strong>der</strong> Abholung von Holz im Wald, beim Holztrans-<br />
port, <strong>der</strong> Lieferung und Verarbeitung vielschichtige logistische Probleme auftre-<br />
ten, die den Transport teuer werden lassen. Für logistische Optimierungen gibt<br />
es viele Ansatzpunkte, die gelöst werden können, wenn die Zusammenarbeit im<br />
komplexen System <strong>der</strong> funktionalen Arbeitsteilung zwischen Holztransport-<br />
Unternehmen, Holz-verarbeitenden Unternehmen, Sägewerken und unterstüt-<br />
zenden Einrichtungen bis hin zu den Fachhochschulen verbessert wird. Um den<br />
Erfahrungsaustausch zwischen den interessierten Akteuren anzuregen und Per-<br />
spektiven für die Optimierung <strong>der</strong> Holzlogistik aufzuzeigen, war eine Beratung<br />
und Prozess-Begleitung notwendig.<br />
Lösungsansatz<br />
Dem Projektträger waren die Optimierungsbedarfe in <strong>der</strong> Logistikkette bekannt.<br />
Er suchte den Kontakt zum Fachbereich Wald und Umwelt <strong>der</strong> FH Eberswalde<br />
und ermittelte gemeinsam mit dem Wissenschaftler Unternehmen <strong>der</strong> Holzwirt-<br />
schaft, die für Logistik-Innovationen in Frage kämen. Auf einer Branchenveran-<br />
staltung führte ihn <strong>der</strong> Wissenschaftler in den Kreis <strong>der</strong> potenziellen Partner ein,<br />
ein weiteres Unternehmen wurde vom Projektträger später für das Netzwerk ge-<br />
wonnen. In Einzelgesprächen mit Unternehmen informierte <strong>der</strong> Projektträger über<br />
die <strong>Kampagne</strong>. Im anschließenden Werkstattgespräch mit Wissenschaftlern wur-<br />
de ein gemeinsames Angebotsprofil erarbeitet und in einer Diskussion mit den<br />
Unternehmen bestätigt.<br />
Auf einer weiteren Branchenveranstaltung erfuhren die bis dahin beteiligten Ak-<br />
teure des Netzwerkes davon, dass auch an <strong>der</strong> TFH Wildau über Logistik in <strong>der</strong><br />
Holzwirtschaft geforscht wird. Weil beide Wissenschaftler Bereiche bearbeiten,<br />
die sich ergänzen und für das Netzwerk gleichermaßen wichtig sind, einigte man<br />
41
<strong>Endbericht</strong> <strong>der</strong> wissenschaftlichen Begleitung<br />
sich darauf, das Budget und die Arbeit für den wissenschaftlichen Beitrag zu tei-<br />
len.<br />
An den wissenschaftlichen Recherchen waren Professoren, wissenschaftliche<br />
Mitarbeiter und Studierende bei<strong>der</strong> Fachhochschulen beteiligt. Sie hatten zum<br />
Ziel, Ansatzpunkte zur Optimierung <strong>der</strong> Logistik bei den Unternehmen zu entwi-<br />
ckeln und Schritte zu ihrer Realisierung aufzuzeigen. Sie umfassten detaillierte<br />
Bestandsaufnahmen <strong>der</strong> logistischen Prozesse vor Ort und <strong>der</strong> Schwachstellen<br />
in den betrieblichen Logistikkonzepten. Daraus wurde ein Anfor<strong>der</strong>ungskatalog<br />
für die Anpassung von Informations- und Kommunikationstechnologien für eine<br />
verbesserte Holzlogistik abgeleitet und Perspektiven für weiterführende For-<br />
schungs- und Entwicklungsvorhaben formuliert. Studententeams haben im Rah-<br />
men ihrer Praxissemester die Themen und Fragen <strong>der</strong> beteiligten Unternehmen<br />
bearbeitet und dabei regelmäßig Kontakt mit den Firmen unterhalten. Beide<br />
Fachhochschulen haben die Arbeit <strong>der</strong> Teams i.d.R. vor Ort betreut und die Qua-<br />
lität kontrolliert.<br />
Ergebnisse<br />
Den Unternehmen sind im Rahmen des Projekts die Chancen und Potenziale<br />
bewusst geworden, die ein gemeinsames Vorgehen bringt. In den Werkstattge-<br />
sprächen konnten zahlreiche Berührungspunkte in den Interessen und bei den<br />
Optimierungsbedarfen festgestellt werden. Damit war eine gute Grundlage für<br />
den Erfahrungsaustausch und für die Definition von Zielen und weiteren Arbeits-<br />
schritten für das Netzwerk gelegt. Der Abschlussbericht <strong>der</strong> wissenschaftlichen<br />
Analyse hat Klarheit über die strategische Richtung innovativer Projekte gebracht<br />
und die Unternehmen motiviert, weiter gemeinsame Projekte zu verfolgen. Dazu<br />
haben sie über die TFH Wildau bereits einen Antrag im Rahmen des neuen<br />
BMWi-För<strong>der</strong>programmes ZIM (Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand) ge-<br />
stellt.<br />
Die beteiligten Partner aus den Fachhochschulen konnten aus <strong>der</strong> Zusammenar-<br />
beit weiterführende Perspektiven für anwendungsnahe und auf die Bedarfe <strong>der</strong><br />
regionalen Holzwirtschaft abgestimmte Forschungsprojekte entwickeln.<br />
Bewertung<br />
Der Projektträger hat mit seiner aufsuchenden Beratung die Aufmerksamkeit <strong>der</strong><br />
Unternehmen für die Probleme <strong>der</strong> Holzlogistik geschärft und sie motiviert, sich<br />
zusammen mit den regionalen Fachhochschulen für eine Optimierung <strong>der</strong> Pro-<br />
zesskette zu engagieren. Der entscheidende Einflussfaktor für die erfolgreiche<br />
Mobilisierung <strong>der</strong> Unternehmen war die gute Branchenkenntnis des Projektträ-<br />
gers und seine Kontakte zu Wissenschaftlern, die in diesem Feld Lösungsvor-<br />
schläge für die Betriebe formulieren können. Die geplanten FuE-Projekte, die zu-<br />
42
<strong>Endbericht</strong> <strong>der</strong> wissenschaftlichen Begleitung<br />
sammen mit den Unternehmen durchgeführt werden sollen, werden die Zusam-<br />
menarbeit vertiefen und dazu beitragen, dass die Kompetenz <strong>der</strong> Fachhochschu-<br />
len in <strong>der</strong> angewandten Forschung und <strong>der</strong> betriebsnahen Entwicklung von Lö-<br />
sungen weiter ausgebaut wird.<br />
6.5 Fazit<br />
Die drei ausgewählten Beispiele illustrieren jeweils einen bestimmten Aspekt, <strong>der</strong><br />
für das Prädikat „Good-Practice“ zu erfüllen war. In <strong>der</strong> praktischen Realität die-<br />
ser und auch <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en Projekte, die im Rahmen <strong>der</strong> <strong>Innopunkt</strong>-<strong>Kampagne</strong> ge-<br />
för<strong>der</strong>t und durchgeführt wurden, verschmelzen alle drei Aspekte. In jedem Pro-<br />
jekt geht es darum, die technologische Leistungsfähigkeit <strong>der</strong> KMU zu verbes-<br />
sern, ihre Innovationskompetenz zu stärken und die beteiligten Wissenschaftler<br />
und (Fach-)Hochschulen dazu anzuregen, ihr Forschungs- und Ausbildungsprofil<br />
mit Beispielen aus <strong>der</strong> Praxis noch anwendungsnäher und bedarfsgerechter zu<br />
gestalten. Insofern zielte <strong>der</strong> Wissenstransfer auf einen Austausch zwischen Un-<br />
ternehmen und <strong>der</strong> Wissenschaftler und auf einen Vorteil bei<strong>der</strong> Seiten. Mit den<br />
durchgeführten Projekten darf dies als gelungen bezeichnet werden.<br />
Inwieweit aus den entwickelten Realisierungskonzepten tatsächlich realisierte In-<br />
novationen werden, bleibt weiter zu beobachten und abzuwarten. In vielen Fällen<br />
hängt die Realisierung an <strong>der</strong> Akquirierung weiterführen<strong>der</strong> För<strong>der</strong>mittel. In ande-<br />
ren Fällen wurde das Konzept bereits verwirklicht o<strong>der</strong> <strong>der</strong> im Rahmen <strong>der</strong> Kam-<br />
pagne aus <strong>der</strong> Wissenschaft übernommene Innovationsassistenz führt das Vor-<br />
haben im Unternehmen weiter. Doch auch wenn nicht in allen Fällen aus Ideen<br />
Innovationen werden, bleibt doch die Erfahrung bei den Unternehmen, dass die<br />
Hochschulen <strong>der</strong> Region Lösungsansätze für betriebliche Probleme anbieten und<br />
im Rahmen einer Zusammenarbeit die Möglichkeit besteht, konkrete Innovati-<br />
onsvorhaben auf den Weg zu bringen.<br />
7 . Handlungsempfe h l u n g e n<br />
Auf <strong>der</strong> Grundlage <strong>der</strong> vorgestellten Ergebnisse <strong>der</strong> <strong>Innopunkt</strong>-<strong>Kampagne</strong> kommt<br />
die <strong>Evaluation</strong> zu folgenden Empfehlungen:<br />
Der Wissenstransfer soll weitergeführt werden.<br />
Der spezifische Ansatz <strong>der</strong> <strong>Kampagne</strong>, mit begleiteten und mo<strong>der</strong>ierten Koopera-<br />
tionsprojekten zwischen Wissenschaftlern und Unternehmern Innovationsvorha-<br />
ben auf den Weg zu bringen, war erfolgreich. Der <strong>Kampagne</strong>n-Charakter hatte<br />
eine mobilisierende und beschleunigende Wirkung auf Innovationen in KMU.<br />
Damit konnten nicht nur Betriebe erreicht werden, die bereits sporadisch o<strong>der</strong><br />
kontinuierlich eigene FuE-Projekte durchführen, son<strong>der</strong>n auch KMU, die zum ers-<br />
43
<strong>Endbericht</strong> <strong>der</strong> wissenschaftlichen Begleitung<br />
ten Mal Hochschul-Kooperationen eingegangen sind, um Innovationsvorhaben<br />
zu planen. Die innovativen Potenziale, die damit in Brandenburger KMU er-<br />
schlossen werden können, sollten weiter mobilisiert werden.<br />
Die Ergebnisse <strong>der</strong> <strong>Kampagne</strong> sollen nachhaltig in Transferstrukturen des Landes<br />
integriert werden<br />
Brandenburg verfügt bereits über ein differenziertes System aus Transferstellen<br />
an Hochschulen und in Branchennetzwerken. Die Hochschultransferstellen arbei-<br />
ten aber in erster Linie als Dienstleister für ihre jeweiligen Einrichtungen, die<br />
Branchentransferstellen sind z.T. noch im Aufbau. Zu ihren Aufgaben gehören<br />
Wissenstransfer und Innovationsför<strong>der</strong>ung, sie nehmen aber auch noch an<strong>der</strong>e<br />
Aufgaben im Netzwerkmanagement und im Standortmarketing wahr.<br />
Neben den genannten Transferstellen arbeiten u.a. die an <strong>der</strong> <strong>Kampagne</strong> betei-<br />
ligten Projektträger in unterschiedlichsten Projektzusammenhängen mit an <strong>der</strong><br />
Verbesserung <strong>der</strong> Innovationsfähigkeit von KMU in Brandenburg. Schließlich gibt<br />
es die Strategien zum Wissenstransfer von außeruniversitären FuE-<br />
Einrichtungen wie z.B. diverse Institute <strong>der</strong> Fraunhofer-, <strong>der</strong> Leipniz- o<strong>der</strong> Helm-<br />
holz-Gesellschaft.<br />
Abgesehen von den Akteursstrukturen gibt es eine Reihe von politischen För<strong>der</strong>-<br />
programmen von Bundes- und Landesministerien, die ebenfalls KMU dabei un-<br />
terstützen, Technologien zu adaptieren, Innovationen zu planen, zu finanzieren<br />
und umzusetzen, Netzwerke mit Hochschulen und an<strong>der</strong>en Unternehmen zu<br />
knüpfen und Personal aus Hochschulen in Unternehmen zu transferieren.<br />
Initiativen zur Weiterführung des Wissenstransfers müssen ein spezifisches und<br />
hierzu komplementäres Angebot formulieren, das die Ergebnisse <strong>der</strong> <strong>Kampagne</strong><br />
aufgreift und sich in die vorhandenen Akteurs- und Programmstrukturen einfügt<br />
und sie sinnvoll ergänzt. Weil die För<strong>der</strong>situation im Land von vielen Akteuren,<br />
Programmen und regionsspezifischen Angeboten geprägt ist, ist es notwendig,<br />
dass den KMU, die diese Angebote kaum überblicken können, eine Orientierung<br />
im Wissenstransfer ermöglicht wird. Diese Aufgabe haben während <strong>der</strong> Kampag-<br />
ne die Projektträger übernommen, indem sie für eine passgenaue Vermittlung<br />
<strong>der</strong> Partner gesorgt haben. Auch in Zukunft wird es darauf ankommen, den Un-<br />
ternehmen kompetente Ansprechpartner zur Seite zu stellen, die diese Vermitt-<br />
lungsleistung übernehmen können.<br />
Wirkungen wie sie für die <strong>Kampagne</strong> typisch waren, dürften sich ohne den Pro-<br />
jektbedingten Erfolgsdruck nicht umstandslos wie<strong>der</strong>holen lassen. Vergleichbare<br />
Wirkungen können aber erreicht werden, wenn die mobilisierenden Elemente <strong>der</strong><br />
<strong>Kampagne</strong> bei <strong>der</strong> künftigen För<strong>der</strong>ung aufgegriffen und weiter geführt werden.<br />
Die heutigen Aufgaben <strong>der</strong> o.g. intermediären Akteure konzentrieren sich auf<br />
44
� das Standortmarketing<br />
<strong>Endbericht</strong> <strong>der</strong> wissenschaftlichen Begleitung<br />
� die Vernetzung von KMU zum Aufbau von Wertschöpfungsketten<br />
� die Aufgabe, für die KMU Kooperationsmöglichkeiten zu erschließen und<br />
� den Wissenstransfer.<br />
Dieses Aufgabenprofil sollte ergänzt werden um die für die <strong>Kampagne</strong> typischen<br />
mobilisierenden Merkmale wie die aufsuchende Beratung, das kontinuierliche<br />
und phasenorientierte Coaching und die passgenaue Vermittlung und Kombinati-<br />
on unterschiedlicher Wissensarten und Beratungsinstrumente.<br />
Die Weiterführung des Wissenstransfers mit den Akteuren planen<br />
Die heutigen Träger des Wissenstransfers aus den Branchen- und Technologie-<br />
transferstellen sollten in Überlegungen zur künftigen Gestaltung des Wissens-<br />
transfers einbezogen werden. In Workshops und Arbeitsgesprächen sollte geklärt<br />
werden, welche Bedarfe zur Verbesserung des Wissenstransfers aus <strong>der</strong> Sicht<br />
<strong>der</strong> aktiven Träger bestehen und wie das Land aus <strong>der</strong> Sicht <strong>der</strong> Träger den Wis-<br />
senstransfer bedarfsgerecht unterstützen kann. Insbeson<strong>der</strong>e sollte geklärt wer-<br />
den, wie die Ergebnisse <strong>der</strong> <strong>Kampagne</strong> in die laufende Arbeit integriert werden<br />
können.<br />
Der Branchenfokus soll weiter aufrecht erhalten werden<br />
Eine grundsätzliche Stärke <strong>der</strong> <strong>Kampagne</strong> ist die Ausrichtung des Wissenstrans-<br />
fers an den konkreten Bedarfen <strong>der</strong> Unternehmen eines Branchenkompetenzfel-<br />
des. Ausschlaggebend für den Wissenstransfer sind die Probleme <strong>der</strong> KMU,<br />
nicht die Forschungsergebnisse an Hochschulen. Die Branchen- und Unterneh-<br />
mensperspektive sollte unbedingt weiter aufrecht erhalten werden.<br />
Intensivierung und Ausweitung des Wissenstransfers<br />
Die <strong>Kampagne</strong> war geprägt von wenig aufwändigen Formen des Wissenstrans-<br />
fers wie z.B. die Beschäftigung von Praktikanten, Diplomanden o<strong>der</strong> Doktoran-<br />
den o<strong>der</strong> die Weiterbildung von Geschäftsführern und ihren engsten Mitarbeitern.<br />
I.d.R. zielen die Vorhaben auf technische Lösungen, die ohne weiteren For-<br />
schungsbedarf umzusetzen sind. So sind z.B. keine Projekte entstanden, <strong>der</strong>en<br />
Ziele im Kontext einer aufwändigeren Forschungsför<strong>der</strong>ung zu realisieren sind<br />
(wie z.B. durch eine ProInno II- o<strong>der</strong> Inno Watt För<strong>der</strong>ung). Der Wissenstransfer<br />
sollte daher künftig auch als Möglichkeit betrachtet werden, größere Entwick-<br />
lungsvorhaben vorzubereiten. Realisierungskonzepte sollten auch zur Vorberei-<br />
tung einer Anschlussför<strong>der</strong>ung und zum Aufbau von FuE-intensiven Kompetenz-<br />
netzen entwickelt werden.<br />
45
Verstärkung <strong>der</strong> Akquisitionsbemühungen<br />
<strong>Endbericht</strong> <strong>der</strong> wissenschaftlichen Begleitung<br />
Die Branchennetzwerke bieten hervorragende Branchenzusammenhänge zur<br />
Mobilisierung innovativer Potenziale in den KMU. Je nach Anzahl <strong>der</strong> Akteure<br />
und <strong>der</strong> Intensität ihrer Beziehungen im Netzwerk ergeben sich unterschiedliche<br />
Möglichkeiten zur Mobilisierung innovativer Potenziale:<br />
Im Netzwerk <strong>der</strong> Metall- und Elektroindustrie o<strong>der</strong> im Kunststoffnetzwerk sind die<br />
Partner bekannt, die Anzahl <strong>der</strong> Akteure überschaubar und die Beziehungen<br />
eng. Kooperationen lassen sich unter diesen Umständen leicht anbahnen. Ande-<br />
rerseits stoßen Möglichkeiten zur Anbahnung von Kooperationen durch die über-<br />
schaubare Anzahl <strong>der</strong> Partner im Netzwerk an enge Grenzen.<br />
In Netzwerken mit einem weiten Feld von branchenzugehörigen Unternehmen<br />
und Netzwerken, die sich noch im Aufbau befinden, gibt es weniger persönliche<br />
Bekanntschaften und daher auch weniger gefestigte und eingespielte Geschäfts-<br />
beziehungen. Das erschwert die Anbahnung von Kooperationen, eröffnet aber<br />
ein größeres Feld für potenzielle Partnerschaften.<br />
Für beide „Typen“ von Netzwerken sind verstärkte Akquisitionsbemühungen<br />
sinnvoll. Eng geknüpfte Netzwerke lassen sich durch Akquisition und eine aufsu-<br />
chende und aktivierende Beratung erweitern, locker geknüpfte und offene Netz-<br />
werke können durch Akquisition stärker vom Netzwerk und seinen Leistungen<br />
profitieren. Sinnvoll sind dabei nicht nur „Kaltakquise“ per Anschreiben und tele-<br />
fonischem Nachfassen, son<strong>der</strong>n Veranstaltungen auf Branchenforen und pro-<br />
jektbezogene Informationsveranstaltungen für Unternehmen mit ähnlichen tech-<br />
nologischem Anliegen und Innovationszielen. Die „Vorwerkstätten“ (ICB) können<br />
dabei ebenso nützlich sein, wie Informationsveranstaltungen <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en Pro-<br />
jektträger.<br />
Technologieoffene Weiterführung des Wissenstransfers<br />
Akquisitionsbemühungen sollten technologieoffen aber im Branchenfokus <strong>der</strong><br />
Kompetenzfel<strong>der</strong> Brandenburgs erfolgen. Grundsätzlich wäre zu überlegen, ob<br />
nicht die Zielrichtung des Wissenstransfers auch auf die an<strong>der</strong>en Branchenkom-<br />
petenzfel<strong>der</strong> Brandenburgs ausgeweitet werden kann, um möglichst viele Unter-<br />
nehmen von den Vorteilen des Wissenstransfers profitieren zu lassen.<br />
Integration verschiedener Wissens- und Technologiefel<strong>der</strong> auf <strong>der</strong> Projektebene<br />
Im Unterschied zu Transferstellen an Hochschulen, die jeweils auf die Hoch-<br />
schul-spezifischen Wissengebiete Zugriff haben, sind Hochschul-unabhängige<br />
Institutionen in <strong>der</strong> Lage, Experten aus verschiedenen Hochschulen und Wis-<br />
sensgebieten zu mobilisieren und im konkreten Beratungsprojekt zu integrieren.<br />
Die Integration von Wissensträgern verschiedener Hochschulen und verschiede-<br />
46
<strong>Endbericht</strong> <strong>der</strong> wissenschaftlichen Begleitung<br />
ner institutioneller Organisationsformen (private Dienstleister, öffentliche Einrich-<br />
tungen) erschließt prinzipiell ein weiteres Feld möglicher Wissensträger. Damit<br />
steigen auch die Chancen für eine individualisierte und maßgeschnei<strong>der</strong>te Kom-<br />
bination von Expertisen und damit die Service-Qualität im Wissenstransfer.<br />
Für den Wissenstransfer sind nicht nur Experten verschiedener öffentlicher<br />
Hochschulen zu erschließen, son<strong>der</strong>n auch private Dienstleister.<br />
Intensive Begleitung <strong>der</strong> Innovationsvorhaben<br />
Innovationsvorhaben sind nicht mit einer Aufschluss- und Innovationsberatung<br />
auf den Weg zu bringen. Sowohl unerfahrene als sporadisch sowie kontinuierlich<br />
FuE-treibende KMU sind auf ein externes Management von Innovationsvorhaben<br />
angewiesen, weil ihnen die zeitlichen und personellen Ressourcen für das Ma-<br />
nagement von Nicht-Routineaufgaben fehlen. Neben <strong>der</strong> Beratung sind daher<br />
auch koordinierende und organisierende Funktionen im Management des Wis-<br />
senstransfers zu übernehmen.<br />
� Grundsätzlich muss die Möglichkeit bestehen, den Wissenstransfer phasenorientiert<br />
und das Unternehmen von <strong>der</strong> Aufschlussberatung und dem Innovationsaudit<br />
bis hin zur Fertigstellung eines Realisierungskonzeptes zu begleiten.<br />
� Auch Vermarktungsstrategien sollten, wo sinnvoll und gewünscht, Bestandteil<br />
des Wissenstransfers werden.<br />
� Der Wissenstransfer darf nicht einem festgelegtem Ablaufschema folgen. Erfolgreiches<br />
Transfermanagement ist geprägt von <strong>der</strong> größtmöglichen Flexibilität<br />
in <strong>der</strong> Kombination und Wie<strong>der</strong>holung von Phasen, <strong>der</strong> Organisation von<br />
Partnern und <strong>der</strong> Anwendung von Instrumenten. Die methodische Offenheit<br />
und Flexibilität im Transfer ist weiterhin zu gewährleisten.<br />
47
An h a n g 1<br />
Vorhaben-Steckbrief<br />
<strong>Endbericht</strong> <strong>der</strong> wissenschaftlichen Begleitung<br />
48
Vorhaben-Steckbrief<br />
Name des Vorhabens<br />
Internetadressen <strong>der</strong> Partner Unternehmen<br />
Wissenschaftler<br />
Externe Dienste<br />
Ansprechpartner im Unternehmen<br />
Ansprechpartner Wissenschaft<br />
Weitere Ansprechpartner<br />
Technologiefeld<br />
Branche<br />
1. Zielstellung des Innovationsvorhabens<br />
1.1 Innovationsbezug <strong>der</strong> Projektidee<br />
Innovationsgegenstand Produkt/DL Prozess Organisation Marketing<br />
Neuigkeitsgrad für den Markt<br />
Neuer Markt<br />
Neuigkeitsgrad (Innovationsgehalt) Neuheit f.<br />
Branche<br />
Neuheit in bestehenden<br />
M. keine Neuheit<br />
Neuheit f.<br />
KMU<br />
Inkrement.<br />
Verbess.<br />
1.2 Charakterisierung <strong>der</strong> Projektidee<br />
Relevanz für bestehenden Markt hoch mittel niedrig keine<br />
Relevanz für neue Märkte hoch mittel niedrig keine<br />
Komplexität des Vorhabens hoch mittel niedrig<br />
Bezug zu betriebl. Qualifikationen hoch mittel niedrig<br />
Produktimitation
Notwendigkeit zusätzl. Qualifizierung hoch mittel niedrig<br />
Betriebl. Ressourcen zur Realisierung gegeben horizontale Koop.<br />
nötig<br />
Geplante Organisationsform des<br />
Projektes<br />
innerhalb<br />
bestehen<strong>der</strong><br />
Strukturen<br />
Neue Organisationsform<br />
vertikale Koop.<br />
nötig<br />
Chefsache<br />
2. Projektanbahnung<br />
2.1 Wie kam <strong>der</strong> Kontakt mit dem Unternehmen zustande? Wie wurde <strong>der</strong> Unternehmer sensibilisiert/motiviert?<br />
2.2 Wie wurden die Wissenschaftler für die Zusammenarbeit mit Unternehmen sensibilisiert und motiviert?<br />
2.3 Wie wurde die Idee zum Innovationsvorhaben konkretisiert?<br />
3. Durchführung des Wissenstransfers (Outputs)<br />
3.1 Innovations- o<strong>der</strong> Transferwerkstätten: Treffen, Themen, Ergebnisse<br />
Zielvereinbarungen:<br />
Aufgabenpläne,<br />
Koordination <strong>der</strong> Zusammenarbeit: Austausch, Information, Arbeitsaufträge
3.2 Dialoge, Beratungen, Coaching: Treffen, Themen, Ergebnisse<br />
Zielvereinbarungen:<br />
Aufgabenpläne,<br />
Koordination <strong>der</strong> Zusammenarbeit: Austausch, Information, Arbeitsaufträge<br />
3.3 Personaltransfer: Art und Anzahl, Aufgabengebiete <strong>der</strong> Mitarbeiter<br />
Stellenbeschreibungen<br />
Ort Datum<br />
3.4 Wissensvermittlung an KMU-Mitarbeiter: Seminar, Trainingsveranstaltungen usw.<br />
Trainingsveranstaltungen, Teamsitzungen,<br />
4. Ergebnisse des Wissenstransfers<br />
4.1 Realisierungskonzept ist erstellt<br />
Inhalte<br />
Unterschrift
4.2 Finanzierungskonzept und event. För<strong>der</strong>planung ist erstellt<br />
Inhalte<br />
4.3 KMU verfügt über zeitliche, personelle und finanzielle Ressourcen zur Umsetzung<br />
Einschätzung <strong>der</strong> Ressourcen<br />
4.4 Personaltransfer stärkt die Innovationsfähigkeit des KMU<br />
Stellenbeschreibungen<br />
4.5 Aktuelle Aktivitäten über das För<strong>der</strong>ende hinaus ...<br />
finden ...<br />
Information/Erfahrungsaustausch mit Partnern nicht statt<br />
Beantragung künftiger FuE-Projekte<br />
Planung/Vorbereitung künftiger Investitionsprojekte<br />
Sonstige gemeinsame Aktivitäten<br />
auf<br />
geringem<br />
Niveau statt intensiv statt
An h a n g 2<br />
Indikatorenset<br />
Indikatoren zur Bewertung des Innovationsgrades<br />
Indikatoren Beschreibung <strong>der</strong> Indikatoren<br />
<strong>Endbericht</strong> <strong>der</strong> wissenschaftlichen Begleitung<br />
Beschaffung � Verlangt das Produkt/Verfahren neue Materialien und<br />
Rohstoffe?<br />
� Erfor<strong>der</strong>t seine Entwicklung neue Bezugspartner/quellen?<br />
� Ist eine strengere Qualitätssicherung bei <strong>der</strong> Beschaffung<br />
notwendig?<br />
Technologien, Verfahren,<br />
Mitarbeiter<br />
� Verlangt das Produkt/Verfahren eine neuartige Fertigungstechnik<br />
o<strong>der</strong> neue Produktionsanlagen?<br />
� Muss die Fertigung neu organisiert werden?<br />
� Sind zusätzliche o<strong>der</strong> spezifisch qualifizierte Facharbeiter<br />
notwendig?<br />
� Erfor<strong>der</strong>t die Entwicklung Investitionen in neue und an<strong>der</strong>e<br />
Software?<br />
� Benötigen Sie eine neuartige Messtechnik?<br />
Wirkungen Bewirkt das neue Produkt/Verfahren<br />
� Eine höhere Produktionsgeschwindigkeit bzw. kürzere<br />
Durchlaufzeiten?<br />
� Eine geringere Umweltbelastung?<br />
� Verän<strong>der</strong>te Raumanfor<strong>der</strong>ungen?<br />
� Eine höhere Montage-Flexibilität?<br />
� Eine bessere Kapazitätsauslastung?<br />
� Eine erhebliche Leistungssteigerung?<br />
� Weitere Verän<strong>der</strong>ungen?<br />
Vermarktung Erfor<strong>der</strong>t <strong>der</strong> Absatz des neuen Produktes<br />
� Die Ansprache neuer Kundengruppen?<br />
� Die Wahl neuer Distributionswege?<br />
� Die Auseinan<strong>der</strong>setzung mit neuen Wettbewerbern?<br />
� Eine Neugestaltung <strong>der</strong> Preispolitik?<br />
Ist das Produkt/Verfahren<br />
� Sowohl für den Markt als auch für das Unternehmen neu?<br />
� Neu für das Unternehmen, (eine Erweiterung des Produktprogramms<br />
o<strong>der</strong> bestimmter Produktlinien)?<br />
� Zwar für den Markt eine Neuheit, nicht jedoch für das<br />
Unternehmen (Erweiterung bestehen<strong>der</strong> Gruppen von<br />
Produkten/Verfahren)?<br />
� Eine Verbesserung eines bestehenden Produktes/Verfahrens?<br />
49
<strong>Endbericht</strong> <strong>der</strong> wissenschaftlichen Begleitung<br />
Outputindikatoren zur Analyse und Bewertung des Wissenstransferprozesses<br />
Output Beschreibung <strong>der</strong> Indikatoren<br />
KMU sind rekrutiert und<br />
sensibilisiert<br />
Wissenschaftler und Unternehmer<br />
arbeiten in<br />
Teams zusammen<br />
Projektnetzwerke haben<br />
Kommunikationsstrukturen<br />
etabliert<br />
Der Personaltransfer aus<br />
<strong>der</strong> Wissenschaft in KMU<br />
funktioniert<br />
Die KMU betreiben aktiv<br />
Personalentwicklung<br />
Der externe Erfahrungsaustausch<br />
ist gesichert<br />
� Art des Branchenzugang (Info-Veranstaltungen, persönliche<br />
Gespräche, Foren u.a.)<br />
� Materielle und immaterielle Anreizsysteme<br />
� Akquirierte und ausgewählte Unternehmen<br />
� Kommunikationsformen zur effektiven Integration <strong>der</strong><br />
Mitarbeiter und ihrer spezifischen Kompetenzen<br />
� Projektorientierte Teams aus Mitarbeitern <strong>der</strong> KMU und<br />
FuE-Einrichtungen<br />
� Innovationswerkstätten, Workshops, Projekttreffen,<br />
� Gemeinsame Projektplanung<br />
� Beratungsgespräche<br />
� Coachings<br />
� Branchenspezifische bzw. übergreifende Austausch- und<br />
Kontaktmöglichkeiten<br />
� Virtuelle Diskussionsforen, newsletters u.a.<br />
� Rekrutierung von geeigneten wissenschaftlichen Fachkräften<br />
für die Unternehmen<br />
� Individualisierte Weiterbildungskonzepte<br />
� Rekrutierungs- und Ausbildungsinvestitionen zur Behebung<br />
des Fachkräftebedarfs<br />
� Weiterbildungsmaßnahmen<br />
� Einbindung <strong>der</strong> Belegschaftsvertretung bei <strong>der</strong> Umsetzung<br />
von Innovationen<br />
� Personaltransfer in die Wissenschaft<br />
� Recherche von Anstößen (Vorbil<strong>der</strong>n) für Innovationen<br />
� Aktive Nutzung von Messen, Fachtagungen und Transfer<br />
in Projektnetzwerk<br />
� Gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit<br />
50
Ergebnisindikatoren<br />
Ergebnis Beschreibung <strong>der</strong> Indikatoren<br />
Innovationsvorhaben wurden<br />
konkretisiert und verbindlich<br />
verabredet<br />
Handlungs- und Innovationskompetenz<br />
ist vorhanden<br />
Realisierungskonzepte sind<br />
erstellt<br />
Wirkungsindikatoren<br />
<strong>Endbericht</strong> <strong>der</strong> wissenschaftlichen Begleitung<br />
� Innovationsprojekte sind realistisch, d.h. den zeitlichen,<br />
wirtschaftlichen und technologischen Kompetenzen <strong>der</strong><br />
Partner angepasst.<br />
� Institutionalisierte Formen des Wissenstransfers (Projektgruppen,<br />
Foren, Workshops usw.) sind akzeptiert<br />
und werden genutzt<br />
� Wissenstransfer bzw. Innovationsmanagement schafft<br />
verbindliche Orientierung für die Aktivitäten im Netzwerk<br />
� Verbindliche Arbeitsteilung schafft Klarheit über die Aufgaben<br />
komplementärer Funktionen aus FuE, Konstruktion<br />
und Fertigung<br />
... für z.B. folgende Arten <strong>der</strong> Innovation:<br />
� Inkrementelle Innovationen<br />
� Marktneuheiten<br />
� Neue Produktlinien o<strong>der</strong> –verfahren für das Unternehmen<br />
� Radikale Innovationen<br />
Wirkung Beschreibung <strong>der</strong> Indikatoren<br />
Das Innovationsvorhaben<br />
wird umgesetzt<br />
Die Netzwerke sind nachhaltig<br />
� Die Projektnetzwerke nutzen die etablierten Formen <strong>der</strong><br />
Zusammenarbeit und des Wissenstransfers zur Bearbeitung<br />
des Innovationsvorhabens<br />
� Die Beteiligten pflegen ihre Kommunikationsforen und<br />
Austauschrunden<br />
� Aus <strong>der</strong> Zusammenarbeit werden weitere Impulse für<br />
Innovationen entwickelt<br />
� Aus den Impulsen entstehen weitere Realisierungskonzepte<br />
51