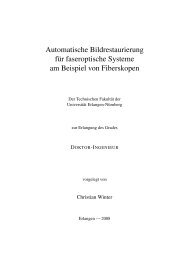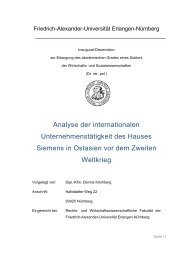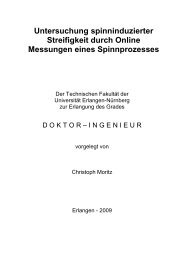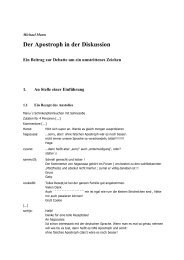Aus der Zahnklinik 1 – Zahnerhaltung und Parodontologie der ...
Aus der Zahnklinik 1 – Zahnerhaltung und Parodontologie der ...
Aus der Zahnklinik 1 – Zahnerhaltung und Parodontologie der ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Aus</strong> <strong>der</strong> <strong>Zahnklinik</strong> 1 <strong>–</strong> <strong>Zahnerhaltung</strong> <strong>und</strong> <strong>Parodontologie</strong><br />
<strong>der</strong> Friedrich-Alexan<strong>der</strong>-Universität Erlangen-Nürnberg<br />
Direktor: Prof. Dr. A. Petschelt<br />
Der Einfluss <strong>der</strong> Wurzelkanalfeuchtigkeit auf die apikale Dichtigkeit adhäsiver<br />
<strong>und</strong> nicht-adhäsiver Sealer<br />
Inaugural-Dissertation<br />
zur Erlangung <strong>der</strong> Doktorwürde<br />
an <strong>der</strong> Medizinischen Fakultät<br />
<strong>der</strong> Friedrich-Alexan<strong>der</strong>-Universität<br />
Erlangen-Nürnberg<br />
Vorgelegt von<br />
Verena Fauth<br />
aus Erlangen
Gedruckt mit <strong>der</strong> Erlaubnis<br />
<strong>der</strong> Medizinischen Fakultät <strong>der</strong> Friedrich-Alexan<strong>der</strong>-Universität<br />
Erlangen-Nürnberg<br />
Dekan: Prof. Dr. Dr. h. c. J. Schüttler<br />
Referent: Prof. Dr. R. Frankenberger<br />
Korreferent: Prof. Dr. A. Petschelt<br />
Tag <strong>der</strong> mündlichen Prüfung: 19.01.2011
Meiner Familie in Liebe <strong>und</strong> Dankbarkeit gewidmet
Inhaltsverzeichnis<br />
1. Zusammenfassung 1<br />
Summary 2<br />
2. Einleitung 3<br />
3. Literaturübersicht 5<br />
3.1 Wurzelkanalaufbereitung 5<br />
3.2 Wurzelkanalspülung 8<br />
3.3 Wurzelkanalfüllung 13<br />
3.4 Dichtigkeitsuntersuchungen 26<br />
4. Ziel <strong>der</strong> Studie 32<br />
5. Material <strong>und</strong> Methode 33<br />
5.1 Vorbereitende Maßnahmen 33<br />
5.2 Maschinelle Aufbereitung 33<br />
5.3 Spülung <strong>der</strong> Wurzelkanäle 34<br />
5.4 Standardisierung von trockenen <strong>und</strong> feuchten Bedingungen 34<br />
5.5 Vorbereitung <strong>der</strong> experimentellen Gruppen 35<br />
5.6 Einteilung <strong>der</strong> Proben 36<br />
5.7 Abfüllen <strong>der</strong> experimentellen Gruppen 36<br />
5.8 Vorbereitung <strong>der</strong> Proben für den Farbstoffpenetrationstest 44<br />
5.9 Messung <strong>der</strong> apikalen Dichtigkeit 48<br />
5.10 Statistische Analyse 49<br />
6. Ergebnisse 50<br />
6.1 Lineare Penetrationstiefe <strong>der</strong> einzelnen Sealer in <strong>der</strong> Übersicht 50<br />
6.2 Ergebnisse <strong>der</strong> statistischen <strong>Aus</strong>wertung 52<br />
7. Diskussion 54<br />
7.1 Diskussion <strong>der</strong> Methode 54<br />
7.2 Diskussion <strong>der</strong> Ergebnisse 59<br />
8. Literaturverzeichnis 64<br />
9. Anhang 93<br />
10. Danksagung 113<br />
11. Eidesstattliche Erklärung 114
ZUSAMMENFASSUNG 1<br />
1. Zusammenfassung<br />
Hintergr<strong>und</strong> <strong>und</strong> Ziele<br />
Das Ziel <strong>der</strong> vorliegenden Studie war die Untersuchung <strong>der</strong> apikalen Dichtig-<br />
keit von Wurzelkanalfüllungen mit adhäsiven <strong>und</strong> nicht-adhäsiven Sealern in<br />
An- o<strong>der</strong> Abwesenheit von Feuchtigkeit.<br />
Material <strong>und</strong> Methode<br />
90 einwurzelige Zähne wurden maschinell bis Größe 60/taper .02 aufbereitet<br />
<strong>und</strong> acht experimentellen Gruppen (jeweils n=10) sowie positiven <strong>und</strong> nega-<br />
tiven Kontrollgruppen zugeordnet (jeweils n=5). Trockene o<strong>der</strong> feuchte Wur-<br />
zelkanäle wurden mit Guttapercha <strong>und</strong> AH Plus Jet, FibreFill, GuttaFlow,<br />
o<strong>der</strong> Resilon-Spitzen <strong>und</strong> Epiphany-Sealer obturiert.<br />
Die Zähne wurden mit 5%iger Methylenblau-Lösung zentrifugiert (30 g, 3 Mi-<br />
nuten) <strong>und</strong> die lineare Farbstoffpenetration unter einem Stereomikroskop<br />
beurteilt.<br />
Ergebnisse<br />
Two-way ANOVA zeigte eine signifikante Abhängigkeit von Undichtigkeit <strong>und</strong><br />
Sealer-Typ (p
2 ZUSAMMENFASSUNG<br />
Summary<br />
Objective<br />
To evaluate apical leakage in the presence or absence of moisture in root<br />
canals obturated with adhesive versus non-adhesive sealers.<br />
Materials and Methods<br />
Ninety single-rooted teeth were instrumented to size 60 /.02 taper and ran-<br />
domly assigned to eight experimental groups (n= 10 each) or designated as<br />
positive/negative controls (n=5 each). Dry and moist root canals were obtu-<br />
rated using gutta-percha and AH Plus Jet, FibreFill or GuttaFlow, or Resilon<br />
cones with Epiphany sealant. Teeth were centrifuged (30 g, 3 minutes) with<br />
5% methylene blue and linear dye penetration was measured un<strong>der</strong> a ste-<br />
reomicroscope.<br />
Results<br />
Two-way ANOVA showed a significant dependence of leakage on sealant<br />
type (p
EINLEITUNG 3<br />
2. Einleitung<br />
Für die langfristige Erhaltbarkeit kariös tiefzerstörter o<strong>der</strong> traumatisierter<br />
Zähne, sind die Verfahren mo<strong>der</strong>ner Endodontie von gr<strong>und</strong>legen<strong>der</strong> Bedeu-<br />
tung.<br />
In den einzelnen Phasen <strong>der</strong> Wurzelkanalbehandlung, angefangen mit <strong>der</strong><br />
Trepanation des Zahnes, <strong>der</strong> chemo-mechanischen Aufbereitung, <strong>der</strong> an-<br />
schließenden Trocknung des Wurzelkanalsystems bis zum bakteriendichten<br />
Verschluss mittels Wurzelfüllmaterialien, gibt es für den Behandler immer<br />
wie<strong>der</strong> Herausfor<strong>der</strong>ungen, die es zu bewältigen gilt.<br />
Eine <strong>der</strong> wichtigsten Voraussetzungen für eine dichte Wurzelfüllung <strong>und</strong> da-<br />
mit <strong>der</strong> Vorbeugung einer bakteriellen Reinfektion des Wurzelkanals ist <strong>der</strong><br />
Trockenheitsgrad <strong>der</strong> Wurzelkanalwände, da die apikale Versiegelung des<br />
Wurzelkanalsystems negativ von Feuchtigkeit <strong>und</strong> an<strong>der</strong>en Flüssigkeiten wie<br />
Blut, beeinflusst werden kann [114, 69, 135]. Obwohl kein Wurzelfüllmaterial<br />
eine hun<strong>der</strong>tprozentige Dichtigkeit erzielen kann, scheint es einen kritischen<br />
Punkt <strong>der</strong> Undichtigkeit zu geben, <strong>der</strong> für die <strong>Aus</strong>heilung periapikaler Läsio-<br />
nen nicht akzeptabel ist <strong>und</strong> daher zu Misserfolgen in <strong>der</strong> Wurzelkanalbe-<br />
handlung führen kann.<br />
Das Belassen von Restfeuchte im Wurzelkanal durch die unvollständige<br />
Trocknung, <strong>der</strong> Wie<strong>der</strong>eintritt von Feuchtigkeit durch das apikale Foramen,<br />
o<strong>der</strong> aber <strong>der</strong> Liquoraustritt aus den eröffneten Dentinkanälchen <strong>und</strong> somit<br />
<strong>der</strong> Wie<strong>der</strong>benetzung <strong>der</strong> Wurzelkanalwände mit Flüssigkeiten, kann die<br />
Dichtigkeit des Sealers- also <strong>der</strong> Kittsubstanz zwischen Kernmaterial <strong>der</strong><br />
Wurzelkanalfüllung <strong>und</strong> Wurzelkanalwand- negativ beeinflussen. [69]<br />
Die Feuchtigkeit innerhalb des Wurzelkanals während des Sealer-<br />
placements kann das Abbindeverhalten des Sealers insoweit verän<strong>der</strong>n, als<br />
es entwe<strong>der</strong> zu beschleunigten o<strong>der</strong> verlängerten Abbindezeiten kommt o<strong>der</strong><br />
<strong>der</strong> Abbindeprozess ganz <strong>und</strong> gar unterb<strong>und</strong>en wird.<br />
Dies resultiert wie<strong>der</strong>um in einer erhöhten Undichtigkeit des betreffenden<br />
Sealers. [135]
4 EINLEITUNG<br />
Für die Dichtigkeit einer Wurzelfüllung ist es wichtig zu wissen, inwieweit sich<br />
das Abbindeverhalten des jeweiligen Wurzelfüllmaterials durch die Anwe-<br />
senheit von Feuchtigkeit modifizieren lässt.<br />
Die vorliegende Studie befasst sich mit <strong>der</strong> Dichtigkeit von konventionellen<br />
<strong>und</strong> adhäsiven Sealern bei An- o<strong>der</strong> Abwesenheit von Feuchtigkeit.
LITERATURÜBERSICHT 5<br />
3. Literaturübersicht<br />
3.1 Wurzelkanalaufbereitung<br />
Die wichtigsten Ziele <strong>der</strong> Wurzelkanalaufbereitung sind neben <strong>der</strong> Form-<br />
gebung <strong>und</strong> effektiven Reinigung des Wurzelkanalsystems, auch die Beibe-<br />
haltung des ursprünglichen Wurzelkanalverlaufes, d.h. die Vermeidung von<br />
Wurzelkanalaberrationen, durch Verlagerung des ursprünglichen Wurzelka-<br />
nals, Bildung eines Ledge o<strong>der</strong> Perforationen [136].<br />
Für die Präparation <strong>der</strong> Wurzelkanäle stehen verschiedene Instrumente zur<br />
Verfügung: Stahlinstrumente, die zuerst aus Kohlenstoffstahl produziert wur-<br />
den <strong>und</strong> seit den 60er Jahren auch aus Cr-Ni-Edelstahl gefertigt werden, so-<br />
wie Nickel-Titan-Instrumente [8].<br />
Für letztere sind zwei Titanlegierungen bekannt, nämlich Titan-Aluminium-<br />
<strong>und</strong> Nickel-Titan-Legierungen. Für das endodontische Instrumentarium hat<br />
sich insbeson<strong>der</strong>e die Nickel-Titanlegierung durchgesetzt [46].<br />
Die Wurzelkanalaufbereitung erfolgte in dieser Studie maschinell mit Hilfe<br />
des FlexMaster-Systems.<br />
Um den Instrumentenkern massiver zu gestalten, verfügen FlexMaster-<br />
Instrumente über einen dreieckig konvexen Querschnitt. Der Hersteller er-<br />
hofft sich so einen erhöhten Torsionswi<strong>der</strong>stand mit reduzierter Bruchgefahr<br />
in geraden Wurzelkanälen.<br />
Ein Set besteht aus einer Introfeile für die koronale Erweiterung, sowie je-<br />
weils drei Feilen mit 6- <strong>und</strong> 4-prozentiger Konizität in den Größen 20, 25, 30<br />
<strong>und</strong> Feilen mit 2-prozentiger Konizität in den Größen 20-35. Weitere Größen<br />
können jedoch nachbestellt werden.<br />
Die Aufbereitung wird in eine Crown-down- <strong>und</strong> eine apikale Sequenz unter-<br />
teilt, d.h.: Feilen mit einer Konizität von 6% <strong>und</strong> 4% werden für die koronale<br />
Aufbereitung benötigt, Feilen mit einer Konizität von 2% werden für die apika-<br />
le Präparation des Wurzelkanals verwendet.
6 LITERATURÜBERSICHT<br />
Je nach Anwendung in weiten, mittleren <strong>und</strong> engen Kanälen, werden alle<br />
Feilen zusätzlich in eine blaue, rote <strong>und</strong> gelbe Sequenz unterteilt.<br />
Um die Bruchgefahr zu minimieren, wird das Instrumentieren im feuchten<br />
Wurzelkanal, das Anlegen einer großen, geraden Zugangskavität, sowie das<br />
konstante Einhalten <strong>der</strong> Drehzahlen von 150 bis maximal 300 rpm empfoh-<br />
len.<br />
Zudem sollten die Instrumente, während <strong>der</strong> Aufbereitung, nicht zu stark<br />
nach apikal forciert werden [7].<br />
In einer Ex-vivo-Studie von Guelzow et al., wurden verschiedene maschinelle<br />
Nickel-Titan-Systeme mit <strong>der</strong> manuellen Instrumentierung mit Stahlinstru-<br />
menten verglichen. Dabei behielten alle Nickel-Titan-Systeme die originale<br />
Wurzelkanalkrümmung mit nur wenigen Instrumentenfrakturen bei, während<br />
die Bearbeitungszeit wesentlich kürzer war als bei <strong>der</strong> manuellen Methode<br />
[62].<br />
Um das Frakturrisiko von FlexMaster-Instrumenten in Bezug auf die Wurzel-<br />
kanalanatomie zu bestimmen, fanden Hübscher et al. heraus, dass dieses<br />
System nur niedrige Drehmomentwerte in Wurzelkanälen erzeugt <strong>und</strong> sehr<br />
wi<strong>der</strong>standfähig gegenüber zyklischer Ermüdung ist [72]. Übereinstimmend<br />
dazu kamen Weiger et al. zu dem Ergebnis, dass FlexMaster-Instrumente für<br />
die Anwendung in gekrümmten Kanälen geeignet sind <strong>und</strong> ähnliche Ergeb-<br />
nisse liefern, wie die damit verglichenen maschinellen LightSpeed-<br />
Instrumente, jedoch mit minimalem Frakturrisiko, aber erhöhtem Risiko für<br />
Wurzelkanalverlagerungen [176].<br />
Schäfer <strong>und</strong> Lohmann verglichen in einer Studie die Reinigungseffizienz von<br />
maschinellen Nickel-Titan-Feilen mit <strong>der</strong> manuellen Aufbereitung mittels K-<br />
Flexofeilen in stark gekrümmten Wurzelkanälen. Dabei zeigte sich, dass kei-<br />
ne <strong>der</strong> beiden Aufbereitungsmethoden komplett saubere Wurzelkanäle er-<br />
zeugte. Jedoch erzielte man mit <strong>der</strong> manuellen Aufbereitung ein besseres<br />
Reinigungsergebnis als mit FlexMaster-Instrumenten. Dagegen wurde <strong>der</strong><br />
originäre Wurzelkanalverlauf durch die Bearbeitung mit FlexMaster-
LITERATURÜBERSICHT 7<br />
Instrumenten signifikant besser beibehalten, was ebenfalls die Studie von<br />
Guelzow et al. gezeigt hat [140, 62]. Auch Schirrmeister et al. untersuchten<br />
die Reinigungsleistung <strong>und</strong> Sicherheit verschiedener maschinell betriebener<br />
Nickel-Titan-Systeme (RaCe, GT Rotary, ProTaper, FlexMaster, ProFile) <strong>und</strong><br />
Handinstrumenten aus Stahl (Hedström-Feilen). Es zeigte sich, dass<br />
FlexMaster-Instrumente einer größeren Bruchgefahr unterliegen als die an-<br />
<strong>der</strong>en Instrumente <strong>und</strong> die Reinigungsleistung mit <strong>der</strong> von GT Rotary,<br />
ProTaper <strong>und</strong> Hedströmfeilen vergleichbar ist. Die saubersten Kanäle er-<br />
reichten RaCe-Instrumente [144]. Dies stimmt mit einer Studie von Shahi et<br />
al. überein: Hierbei wurde <strong>der</strong> Effekt von FlexMaster-, RaCe- <strong>und</strong> ProFile-<br />
Instrumenten auf die Schmierschichtbildung mit Hilfe eines Elektronenmikro-<br />
skops beurteilt. Auch hier hinterließen RaCe- Instrumente die saubersten<br />
Kanalwände, im Sinne von weniger Schmierschicht, als die an<strong>der</strong>en beiden<br />
maschinellen Systeme [150]. In <strong>der</strong> Studie von Hülsmann et al., in <strong>der</strong> die<br />
maschinelle Aufbereitung mittels FlexMaster <strong>und</strong> HERO 642 verglichen wur-<br />
de ergab, dass beide Aufbereitungssysteme sicher sind <strong>und</strong> die originale<br />
Wurzelkanalkrümmung gut beibehalten. Trotzdem verblieben bei beiden Sys-<br />
temen in den meisten Fällen Schmierschicht <strong>und</strong> Debris in den Kanälen [74].<br />
Schäfer <strong>und</strong> Oitzinger verglichen die Schneidleistung verschiedener maschi-<br />
neller Systeme (RaCe, FlexMaster; Mtwo, ProFile, AlphaFile) in künstlichen<br />
Wurzelkanälen. Die beste Schneidleistung fand sich bei Mtwo- <strong>und</strong> RaCe-<br />
Instrumenten [141]. Eine weitere Studie befasste sich mit <strong>der</strong> Formgebung<br />
von simulierten Kanälen mit dem RaCe- <strong>und</strong> dem FlexMaster-System [105].<br />
Bei beiden Systemen war die Bearbeitungszeit ähnlich kurz <strong>und</strong> es wurden<br />
nur wenige Kanalaberrationen produziert.
8 LITERATURÜBERSICHT<br />
3.2 Die Wurzelkanalspülung<br />
Smear layer<br />
Für die chemo-mechanische Reinigung bei <strong>der</strong> Wurzelkanalbehandlung sind<br />
Spüllösungen unerlässlich. Während <strong>der</strong> rein mechanischen Aufbereitung<br />
des Wurzelkanals, entsteht auf <strong>der</strong> Oberfläche <strong>der</strong> Wurzelkanalwand eine<br />
Schicht aus Dentin-Spänen, pulpalen Geweberesten, Blut <strong>und</strong> Bakterien - die<br />
sogenannte Schmierschicht (Smear layer). Diese wirkt als physikalische Bar-<br />
riere <strong>und</strong> verhin<strong>der</strong>t die Penetration von Sealer in die Dentintubuli [89], was<br />
wie<strong>der</strong>um die Dichtigkeit von Wurzelkanalfüllungen beeinflusst [147]. Die<br />
Schmierschicht dringt um ca. 1- 5 Mikrometer in die Dentinkanälchen ein,<br />
verstopft diese <strong>und</strong> setzt die Dentinpermeabilität bis zu 78% herab [122]. Der<br />
Smear layer ist säurelabil <strong>und</strong> wird durch Flüssigkeiten mit einem pH-Wert<br />
von 6,0 bis 6,8 aufgelöst. Einige Bakterien sind in <strong>der</strong> Lage die Schmier-<br />
schicht mittels proteolytischer Enzyme abzubauen, dabei wird aber nur <strong>der</strong><br />
Kollagenanteil eliminiert, nicht <strong>der</strong> Hydroxylapatitanteil [123]. Die Schmier-<br />
schicht als Substrat für das bakterielle Wachstum ist also prädisponierend für<br />
die Bakterienpenetration in die Dentintubuli. Die Entfernung <strong>der</strong> Schmier-<br />
schicht ermöglicht eine bessere Desinfektion des Wurzelkanals <strong>und</strong> verbes-<br />
sert, durch die Sealerpenetration in offene Dentintubuli, den Verschluss <strong>der</strong><br />
Wurzelkanalfüllung bei gleichzeitig reduzierten Mikroleakage-Werten [10,<br />
166].<br />
In <strong>der</strong> Literatur wird die An- o<strong>der</strong> Abwesenheit des Smear layers in Zusam-<br />
menhang mit Mikroleakage kontrovers diskutiert. Auf <strong>der</strong> einen Seite führt die<br />
Entfernung des Smear layers mittels geeigneter Spüllösungen zu einer Pe-<br />
netration des Sealers in die offenen Dentinkanälchen [121] <strong>und</strong> führt zu einer<br />
verbesserten Dichtigkeit <strong>der</strong> Wurzelfüllung [85, 20], auf <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en Seite<br />
zeigen einige Studien, dass es für die apikale Dichtigkeit unerheblich ist, ob<br />
nun die Schmierschicht belassen o<strong>der</strong> entfernt wird [43, 99, 18]. Es kann so-<br />
gar negative Folgen haben, wenn die Schmierschicht entfernt wird [168].<br />
Diese gegensätzlichen Ergebnisse lassen sich durch unterschiedliche Vari-<br />
ablen, wie beispielsweise verschiedene Sealer-Typen, Spüllösungen, Sealer-
LITERATURÜBERSICHT 9<br />
Schichtstärken <strong>und</strong> Wurzelkanalfülltechniken, die in diesen Studien zum Ein-<br />
satz kamen, erklären.<br />
Heutzutage wird jedoch die Entfernung <strong>der</strong> Schmierschicht für eine verbes-<br />
serte Versiegelung des Wurzelkanalsystems [10] <strong>und</strong> damit reduzierte<br />
Mikroleakage-Werte in koronalen <strong>und</strong> apikalen Wurzelkanalabschnitten [23,<br />
149] empfohlen.<br />
Bei <strong>der</strong> <strong>Aus</strong>wahl von Spüllösungen muss darauf geachtet werden, dass die<br />
betreffende Substanz eine möglichst gute antimikrobielle Wirkung besitzt,<br />
zugleich aber möglichst kaum o<strong>der</strong> nicht gewebetoxisch ist.<br />
Ferner sollten Dentin-Späne, die bei <strong>der</strong> Aufbereitung zwangsläufig entste-<br />
hen, wirkungsvoll aus dem Kanal geschwemmt werden, so dass keine Blo-<br />
ckaden entstehen können <strong>und</strong> die Gängigkeit des Wurzelkanals erhalten<br />
bleibt.<br />
Gerade für maschinell betriebene Nickel-Titan-Systeme ist die Gleitwirkung<br />
einer Wurzelkanalspülung von großer Bedeutung, da dadurch Instrumenten-<br />
frakturen effektiv reduziert werden können.<br />
Im Wurzelkanal verbliebene vitale <strong>und</strong> nekrotische Gewebereste, die <strong>der</strong><br />
mechanischen Aufbereitung nicht zugänglich waren, sollten durch die Spüllö-<br />
sung aufgelöst werden.<br />
Natürlich ist auch eine aufhellende, bleichende Wirkung wünschenswert, um<br />
<strong>der</strong> Verfärbung des Zahnes durch Blutbestandteile in den Dentinkanälchen<br />
entgegenzuwirken [9].<br />
Bei <strong>der</strong> großen <strong>Aus</strong>wahl von Spüllösungen werden zwecks Übersichtlichkeit<br />
nur jene näher beschrieben, die auch in dieser Studie verwendet wurden.<br />
Natriumhypochlorit<br />
Von allen Spüllösungen, wird Natriumhypochlorit heutzutage am häufigsten<br />
benutzt [179].<br />
Natriumhypochlorit ist eine farblose bis leicht grüngelbliche Flüssigkeit mit<br />
schwachem Chlorgeruch, die bei Licht- <strong>und</strong> Wärmezutritt sehr instabil ist [9].
10 LITERATURÜBERSICHT<br />
Natriumhypochlorit besitzt ein breites antimikrobielles Wirkspektrum gegen<br />
Bakterien, Bakteriophagen, Sporen, Hefepilze <strong>und</strong> Viren [17].<br />
Es zerstört Zellproteine durch Hydrolyse o<strong>der</strong> oxidative Prozesse <strong>und</strong> ist auf-<br />
gr<strong>und</strong> seiner hypotonen Natur schwach osmotisch wirksam [124].<br />
Mit einem pH-Wert zwischen 11 <strong>und</strong> 12 wirkt es stark alkalisch. Bei Kontakt<br />
mit Gewebeproteinen, werden Peptid-Bindungen gespalten, Proteine also<br />
aufgelöst <strong>und</strong> binnen kurzer Zeit Nitrat, Formaldehyd <strong>und</strong> Acetaldehyd gebil-<br />
det. Während <strong>der</strong> Proteinspaltung kommt es bei den entstandenen Amino-<br />
säuren zu einem <strong>Aus</strong>tausch von OH-Gruppen durch Chlorit-Gruppen - es<br />
entstehen schließlich Chloramine, die letztendlich für die antimikrobielle Wir-<br />
kung verantwortlich sind. <strong>Aus</strong> diesem Gr<strong>und</strong> wirkt Natriumhypochlorit auf vi-<br />
tale Gewebe in hohen, unverdünnten Konzentrationen stark toxisch, während<br />
es bei niedrig konzentrierten Lösungen lediglich zu entzündlichen Reaktionen<br />
kommt [138].<br />
Natriumhypochlorit-Lösungen werden in verschiedenen Konzentrationen von<br />
0,5% bis 6% angeboten. Siqueira et al. [153] fanden keinen signifikanten Un-<br />
terschied in <strong>der</strong> Verwendung von 1%-, 2,5%- <strong>und</strong> 5,2%iger Natriumhypochlo-<br />
rit-Lösung bezüglich des antimikrobiellen Effekts. Demgegenüber führt ein<br />
regelmäßiger Flüssigkeitsaustausch sowie die Verwendung größerer Men-<br />
gen an Natriumhypochlorit-Spüllösung dazu, dass Chlorit-Reserven im Wur-<br />
zelkanal geschaffen werden, so dass Bakterienzellen dadurch wirksam zer-<br />
stört werden.<br />
EDTA (Ethylendiamintetraacetat)<br />
EDTA gehört zu den sogenannten Chelatoren <strong>und</strong> bindet 2-wertige Ionen [9].<br />
An<strong>der</strong>s als Natriumhypochlorit, entfernt EDTA anorganische Bestandteile <strong>und</strong><br />
ist somit in <strong>der</strong> Lage den anorganischen Teil <strong>der</strong> Schmierschicht aufzulösen,<br />
verbolzte Dentintubuli zu öffnen <strong>und</strong> somit eine saubere Wurzelkanal-<br />
oberfläche für eine dichte Wurzelfüllung zu schaffen [102, 56, 57, 27].<br />
Bei <strong>der</strong> maschinellen Aufbereitung von Wurzelkanälen wirkt es als Gleitmittel<br />
<strong>und</strong> vereinfacht somit die Wurzelkanalpräparation.
LITERATURÜBERSICHT 11<br />
Empfehlenswert ist eine Kombination zweier Wurzelkanalspülungen, nämlich<br />
EDTA <strong>und</strong> Natriumhypochlorit. Dadurch lassen sich nicht nur anorganische<br />
Bestandteile entfernen, son<strong>der</strong>n auch organische, mit dem Ergebnis einer<br />
sauberen, schmierschichtfreien Wurzelkanaloberfläche, sogar in den apika-<br />
len Bereichen [194, 148]. Die Kombination von 1%iger NaOCl-Lösung mit<br />
17%iger EDTA-Lösung verbessert sogar die koronale Dichtigkeit von Wur-<br />
zelkanalfüllungen, wie eine Studie von Vivacqua-Gomes et al. zeigen konnte<br />
[174].<br />
Zitronensäure<br />
Ähnlich wie EDTA, ist Zitronensäure ein Chelat-Bildner.<br />
Durch die Anwendung von 50%iger Zitronensäurelösung werden saubere<br />
Wurzelkanaloberflächen mit offenen Dentinkanälchen geschaffen, resultie-<br />
rend in einer verbesserten Sealer-Penetration <strong>und</strong> Wandadaption von Gutta-<br />
percha. Die Gewebezerstörung durch Zitronensäure ist mit <strong>der</strong> von starken<br />
Säuren vergleichbar [96].<br />
Verglichen mit an<strong>der</strong>en Chelatoren, ist selbst eine 10%ige Zitronensäurelö-<br />
sung in ihrer demineralisierenden Wirkung auf das Wurzelkanaldentin min-<br />
destens genauso gut bzw. besser [139, 98].<br />
Dies zeigt auch eine Studie von Yamaguchi et al. [195]: Zitronensäure hat<br />
demnach eine stärkere demineralisierende Wirkung als EDTA <strong>und</strong> sogar an-<br />
tibakterielle Effekte gegen alle 12 Bakterienstämme, die in dieser Studie be-<br />
nutzt wurden.<br />
Zitronensäure zeigt zwar eine gewisse antibakterielle Aktivität, speziell gegen<br />
Kokken, ist aber in <strong>der</strong> Bakterienelimination nicht so effektiv wie Natrium-<br />
hypochlorit [51].<br />
Um nicht nur die anorganische Komponente des Smear layer zu entfernen,<br />
son<strong>der</strong>n sich auch die gewebeauflösende, stark antimikrobiologische Wir-<br />
kung von Natriumhypochlorit zunutze zu machen, empfiehlt sich eine Kombi-<br />
nation aus Zitronensäure <strong>und</strong> Natriumhypochlorit [126].
12 LITERATURÜBERSICHT<br />
Alkohol<br />
Um die chemo-mechanische Reinigung des Wurzelkanalsystems abzu-<br />
schließen, wird als letzte Spüllösung 70- 95%iges Ethanol verwendet.<br />
Ethanol bewirkt zum einen, dass die verbliebene Flüssigkeit im Wurzelkanal-<br />
system schneller verdunstet, also <strong>der</strong> Trocknungsvorgang wesentlich be-<br />
schleunigt wird, zum an<strong>der</strong>en, dass die Oberflächenspannung von Flüssig-<br />
keiten herabgesetzt wird.<br />
Cunningham et al. untersuchten im Jahr 1982 den Effekt von Alkohol auf<br />
Natriumhypochlorit hinsichtlich seiner <strong>Aus</strong>breitungstendenz innerhalb einer<br />
Glaskapillare. Dabei kam man zu dem Ergebnis, dass Alkohol die Oberflä-<br />
chenspannung von Natriumhypochlorit herabsetzt <strong>und</strong> es dadurch zu einer<br />
besseren <strong>Aus</strong>breitung dieser Spülflüssigkeit in vitro kam [26]. Die physikali-<br />
schen Eigenschaften <strong>der</strong> Glaskapillare können hierbei auf offene<br />
Dentinkanälchen in <strong>der</strong> Wurzelkanalwand übertragen werden: Wird nun die<br />
Oberflächenspannung einer Flüssigkeit herabgesetzt, wird sowohl <strong>der</strong><br />
Flüssigkeitsstrom in als auch aus den Dentintubuli hinaus verstärkt.<br />
Im Umkehrschluss kann also Sealer dadurch besser in Dentinkanälchen pe-<br />
netrieren.<br />
Durch das Eindringen von Sealer in die Dentintubuli wird eine dichtere Wur-<br />
zelkanalfüllung geschaffen <strong>und</strong> das Vorkommen von Mikroleakage reduziert<br />
[178, 146].<br />
An<strong>der</strong>e Ergebnisse liefert eine Studie von Wilcox et al. [182]: Demnach führt<br />
eine finale Alkoholspülung des Wurzelkanals zu keiner signifikanten Verbes-<br />
serung <strong>der</strong> Benetzung des Kanallumens mit Sealer.<br />
Trotz alledem darf auf eine vollständige Trocknung durch Papierspitzen nicht<br />
verzichtet werden. Mögliche Interaktionen zwischen Alkohol <strong>und</strong> Sealer kön-<br />
nen nicht ausgeschlossen werden [36, 156, 128].<br />
Neben den verschiedenen Möglichkeiten <strong>der</strong> Wurzelkanaltrocknung zeigt<br />
sich, dass die Verwendung von Papierspitzen in Verbindung mit dem kurzzei-<br />
tigen Einbringen von einer 200°C heißen Sonde, in v itro, zu den trockensten<br />
Wurzelkanalwänden führt [70].
LITERATURÜBERSICHT 13<br />
Dennoch ist dieses Verfahren sehr riskant <strong>und</strong> techniksensitiv, da es bei die-<br />
ser Überhitzung zu einer Schädigung von parodontalem Gewebe <strong>und</strong><br />
Alveolarknochen kommen kann.<br />
3.3 Die Wurzelkanalfüllung<br />
Im Anschluss an die chemo-mechanische Aufbereitung, Reinigung <strong>und</strong><br />
Trocknung <strong>der</strong> Kanäle folgt die Wurzelkanalfüllung.<br />
Für eine erfolgreiche endodontische Behandlung ist es von entscheiden<strong>der</strong><br />
Wichtigkeit, das gesamte Wurzelkanalsystem bakteriendicht mit einem iner-<br />
ten Füllmaterial zu verschließen, dabei eine gute apikale Dichtigkeit zu errei-<br />
chen <strong>und</strong> somit einer Reinfektion vorzubeugen [115].<br />
Anfor<strong>der</strong>ungen an Wurzelkanalfüllmaterialien<br />
Für den endodontischen Therapieerfolg ist die <strong>Aus</strong>wahl eines geeigneten<br />
Füllmaterials entscheidend. Dieses sollte folgenden Anfor<strong>der</strong>ungen gerecht<br />
werden:<br />
Biologische Anfor<strong>der</strong>ungen<br />
• Biokompatibilität, d.h. keine Schädigung <strong>der</strong> Gewebe bzw. des Ge-<br />
samtorganismus<br />
• Bakterizide bzw. bakteriostatische Wirkung<br />
• Füllmaterial sollte nicht resorbierbar sein<br />
Physikalische Anfor<strong>der</strong>ungen<br />
• Wandständigkeit<br />
• Keine Porenbildung<br />
• Keine Abbindeschrumpfung<br />
• Dauerhafte Erhärtung<br />
• Unlösbarkeit in Gewebeflüssigkeiten<br />
• Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
14 LITERATURÜBERSICHT<br />
Praktische Anfor<strong>der</strong>ungen<br />
• Material lässt sich leicht applizieren<br />
• Leichte Entfernung möglich<br />
• Keine Verfärbung <strong>der</strong> Zahnhartsubstanz<br />
• Röntgensichtbarkeit<br />
Klassifikation von Wurzelkanalfüllmaterialien<br />
Die verschiedenen Materialien lassen sich in Sealer <strong>und</strong> Stifte einteilen.<br />
Sealer Stifte<br />
Weichbleibende Pasten Guttapercha-Stifte<br />
Zemente Kunststoffstifte<br />
Zinkoxid-Eugenol Metallstifte<br />
Glasionomer-Zement Silberstifte<br />
Calcium-Salicylat-haltig Goldstifte<br />
Kunstharz/ -stoff Titanstifte<br />
Silikon-Basis<br />
Tabelle 1: Sealer <strong>und</strong> Stifte in <strong>der</strong> Übersicht<br />
Bei alleiniger Anwendung kann keines <strong>der</strong> Wurzelkanalfüllmaterialien die<br />
obengenannten Anfor<strong>der</strong>ungen erfüllen. <strong>Aus</strong> diesem Gr<strong>und</strong> hat sich die<br />
Kombination eines Kernmaterials (Stift) mit einem erhärtenden Zement be-<br />
währt.<br />
Denn die Hauptfunktion eines Wurzelkanal-Sealers ist es, die entstandenen<br />
Räume zwischen dem Guttapercha-Stift <strong>und</strong> <strong>der</strong> Wurzelkanalwand o<strong>der</strong> bei<br />
<strong>der</strong> lateralen Kondensation die Räume zwischen den Guttapercha-Stiften<br />
aufzufüllen <strong>und</strong> Unebenheiten auszugleichen. Demzufolge spielt <strong>der</strong> Sealer<br />
eine entscheidende Rolle um den Wurzelkanal bakteriendicht abzuschließen,<br />
denn ohne die Verwendung eines Sealers sind Wurzelkanalfüllungen <strong>und</strong>icht<br />
[100, 107, 28, 38, 154, 64, 186]. Als Nebeneffekt wirken Sealer als Gleitmittel
LITERATURÜBERSICHT 15<br />
<strong>und</strong> erleichtern die Einbringung des Kernmaterials in den Wurzelkanal [177,<br />
63].<br />
Desweiteren gilt <strong>der</strong> Gr<strong>und</strong>satz: so wenig Sealer wie nötig <strong>und</strong> so viel Kern-<br />
material wie möglich einzubringen, da Sealer einer unterschiedlich starken<br />
Schrumpfung <strong>und</strong> Resorption unterliegen [119, 127, 181, 183].<br />
Einflüsse auf die Dichtigkeit von Sealern<br />
Im Zusammenhang mit <strong>der</strong> Dichtigkeit eines Sealers ist sicherlich <strong>der</strong> Begriff<br />
„Mikroleakage“ von zentraler Bedeutung.<br />
Unter Mikroleakage versteht man eine Spaltbildung im Mikrometerbereich,<br />
die an unterschiedlichen Grenzflächen <strong>der</strong> Wurzelfüllung - den sogenannten<br />
Interfaces - zu unterschiedlichen Zeitpunkten stattfindet.<br />
Dabei kann diese Undichtigkeit während eines längeren Zeitraumes nach<br />
Abfüllen des Wurzelkanals entwe<strong>der</strong> zu- o<strong>der</strong> abnehmen.<br />
Während ein starkes Löslichkeitsverhalten des Sealers o<strong>der</strong> die Anwesenheit<br />
einer Schmierschicht auf <strong>der</strong> Wurzelkanaloberfläche zu einer zunehmenden<br />
Undichtigkeit führt, scheint sich die Dimensionszunahme von Guttapercha<br />
positiv auf die Dichtigkeit auszuwirken [88, 186].<br />
Während <strong>der</strong> Abbindungsreaktion schrumpfen viele Sealer. Durch diese Di-<br />
mensionsän<strong>der</strong>ung entstehen ungewollte Hohlräume <strong>und</strong> es kommt schließ-<br />
lich zu Auflösungserscheinungen des Sealers [181, 142].<br />
Gleichzeitig wird die abdichtende Fähigkeit eines Sealers durch seine physi-<br />
kalischen Eigenschaften, wie Viskosität bzw. Fließfähigkeit, Abbindezeit <strong>und</strong><br />
Filmschichtstärke beeinflusst [88].<br />
Abhängig vom Sealer-Typ wirken sich unterschiedlich dicke Filmschichtstär-<br />
ken, auch in Langzeitversuchen über ein Jahr, unterschiedlich auf die Dich-<br />
tigkeit einer Wurzelfüllung aus [52, 185, 192].<br />
Übereinstimmend konstatierten De-Deus et al. [31] dass dicke Sealer-<br />
Schichtstärken im Allgemeinen zu schlechteren Dichtigkeitswerten führte,<br />
wobei AH Plus hierbei die einzige <strong>Aus</strong>nahme darstellte.
16 LITERATURÜBERSICHT<br />
Nicht nur physikalische Parameter spielen für das Dichtigkeitsverhalten von<br />
Sealern eine Rolle, son<strong>der</strong>n auch ungewollte Ereignisse, die während des<br />
Abfüllens geschehen.<br />
So kommt es gelegentlich vor, dass Wurzelkanäle nur unvollständig getrock-<br />
net werden können <strong>und</strong> sich die verbliebene Restfeuchtigkeit, durch Spüllö-<br />
sungen o<strong>der</strong> körpereigene Gewebeflüssigkeit, negativ auf die Dichtigkeit ei-<br />
ner Wurzelfüllung auswirkt. Allerdings treten diese schädigenden Effekte <strong>der</strong><br />
Feuchtigkeitskontamination wahrscheinlich während des Abfüllens <strong>und</strong> <strong>der</strong><br />
Abbin<strong>der</strong>eaktion auf [114, 69].<br />
Der jeweilige Sealer-Typ spielt auch eine Rolle:<br />
Während einige Sealer wie Apexit (Calcium-Salicylat-Basis), Tubli-Seal<br />
(ZnO-Eugenol-Basis) <strong>und</strong> RoekoSeal (Silikon-Basis) auch in feuchten Wur-<br />
zelkanalverhältnissen gute Dichtigkeitswerte zeigen, scheinen die Werte an-<br />
<strong>der</strong>er Sealer wie AH Plus (Epoxidharz-Basis) o<strong>der</strong> Ketac Endo (Glasionomer-<br />
Basis) davon negativ beeinflusst zu werden [135].<br />
Berutti untersuchte in einer In vitro-Studie, ob Speichelzutritt über offene<br />
Dentinkanälchen im Zahnhalsbereich die Dichtigkeit einer bereits gelegten<br />
Wurzelfüllung beeinflusst [11]. Alle Proben, die mit Speichel in Kontakt ka-<br />
men, wiesen <strong>und</strong>ichte Wurzelfüllungen auf. Das <strong>Aus</strong>maß <strong>der</strong> Farbstoffpene-<br />
tration war dabei abhängig von <strong>der</strong> Zeit <strong>der</strong> Speichelexposition: je länger die<br />
Proben mit Speichel in Berührung kamen, desto stärker war die Farbstoffpe-<br />
netration.<br />
Nachfolgend werden die Sealer näher beschrieben, die in dieser Studie zum<br />
Einsatz kamen:<br />
Zu den bekanntesten Sealern auf Epoxidharzbasis gehören AH 26 <strong>und</strong> AH<br />
Plus.<br />
Nachdem AH26 bei <strong>der</strong> Abbindung durch Polykondensation das allergene<br />
<strong>und</strong> neurotoxische Formaldehyd freisetzt, wurde das Produkt zu dem formal-<br />
dehydfreien AH Plus weiterentwickelt.<br />
An<strong>der</strong>s als bei AH 26 erfolgt die Abbin<strong>der</strong>eaktion von AH Plus durch Polyad-<br />
dition, d.h. es wird kein Reaktionsprodukt abgespalten. Somit wird auch kein<br />
Formaldehyd freigesetzt [92].
LITERATURÜBERSICHT 17<br />
Es hat sich gezeigt, dass die Verwendung von Epoxidharzbasierten Sealern<br />
in einer exzellenten apikalen Dichtigkeit <strong>der</strong> Wurzelfüllung resultiert [1, 61,<br />
94].<br />
AH Plus kann für alle dreidimensionalen verdichtenden Fülltechniken mit<br />
Guttapercha verwendet werden <strong>und</strong> weist bei <strong>der</strong> Abbindung eine sehr ge-<br />
ringe Schrumpfung mit einer langzeitlichen Dimensionsstabilität auf [142,<br />
103].<br />
Die Verb<strong>und</strong>festigkeit von AH Plus mit Dentin ist <strong>der</strong> von an<strong>der</strong>en kunstharz-<br />
basierten Sealern, bei An- <strong>und</strong> Abwesenheit des Smear layers, deutlich über-<br />
legen. Dabei kann die Verb<strong>und</strong>festigkeit von AH Plus noch erhöht werden,<br />
wenn <strong>der</strong> Smear layer vorher entfernt wird [39].<br />
Für eine dichte Wurzelfüllung ist nicht nur <strong>der</strong> Verb<strong>und</strong> Sealer-Dentin, son-<br />
<strong>der</strong>n auch Guttapercha-Sealer ausschlaggebend. Eine Studie von Lee et al.<br />
[91] konnte belegen, dass die Verb<strong>und</strong>festigkeit von AH26 zu Guttapercha<br />
<strong>der</strong> Verb<strong>und</strong>festigkeit von Calcium-Salicylat- <strong>und</strong> Zinkoxid-Eugenol-basierten<br />
Sealern überlegen ist.<br />
In neueren Studien wurde die zytotoxische Wirkung von AH Plus auf Zellkul-<br />
turen nach 24 h <strong>und</strong> 72 h bewertet. Dabei stellte sich heraus, dass die Zyto-<br />
toxizität von AH Plus mit <strong>der</strong> Zeit zunimmt [16, 73, 14].<br />
Die antibakterielle Wirkung, die AH Plus zugeschrieben wird, beruht auf <strong>der</strong><br />
Freisetzung einzelner Komponenten dieses Materials, die letztendlich auch<br />
eine zytotoxische Wirkung hervorrufen können [83].<br />
Weiterhin begünstigt das manuelle Anmischen von AH Plus das Entstehen<br />
von Porositäten <strong>und</strong> die Freisetzung von zytotoxischen Stoffen, die nicht mit-<br />
einan<strong>der</strong> reagiert haben [111].<br />
Gerade wegen seiner guten abdichtenden Eigenschaften <strong>und</strong> seiner ver-<br />
gleichsweise milden Toxizität, ist AH Plus in Kombination mit Guttapercha,<br />
<strong>der</strong> Goldstandard in <strong>der</strong> mo<strong>der</strong>nen Endodontie, an dem sich neu entwickelte<br />
Wurzelfüllmaterialien messen lassen müssen.
18 LITERATURÜBERSICHT<br />
Nachdem sich Sealer auf Epoxidharzbasis nicht mit Adhäsiven auf<br />
Methacrylat-Kunststoffbasis verbinden, wurden Methacrylat-basierte Sealer<br />
mit selbstätzenden Primern entwickelt.<br />
Durch den adhäsiven Verb<strong>und</strong> des Wurzelfüllmaterials mit dem Wurzelka-<br />
naldentin, verbesserte sich auch die apikale Dichtigkeit [54, 151]. Beispiele<br />
für Sealer auf Kunststoffbasis, die zu den sogenannten adhäsiven Wurzel-<br />
füllmaterialien gehören, sind Epiphany <strong>und</strong> FibreFill.<br />
Bei diesen Materialien steht <strong>der</strong> adhäsive Verb<strong>und</strong> von Füllungsmaterial zur<br />
Zahnhartsubstanz im Vor<strong>der</strong>gr<strong>und</strong>.<br />
Das Prinzip des adhäsiven Verb<strong>und</strong>es mit Dentin, im Sinne einer Total-etch-<br />
Technik, wurde erstmals von Nakabayashi et al. [112, 113] beschrieben: eine<br />
feuchte, also hydrophile Dentinoberfläche wird in drei Schritten so vorbehan-<br />
delt, dass das hydrophobe Füllungsmaterial daran haften kann.<br />
Der erste Schritt umfasst die Konditionierung <strong>der</strong> Dentinoberfläche mittels<br />
einer Säure, die den Smear layer entfernt, die oberflächliche Schicht demine-<br />
ralisiert <strong>und</strong> die Kollagenmatrix freilegt. Nach dem Abspülen <strong>der</strong> Säure wird<br />
in einem zweiten Schritt <strong>der</strong> sogenannte Primer auf die feuchte<br />
Dentinoberfläche aufgetragen. Die Primer-Flüssigkeit enthält Monomere in<br />
einer aceton- o<strong>der</strong> alkoholhaltigen Lösung. Diese Flüssigkeit dringt zunächst<br />
in das Kollagengeflecht ein, danach verdunstet die Trägerflüssigkeit Aceton<br />
bzw. Alkohol an <strong>der</strong> Luft <strong>und</strong> schließlich befinden sich nur noch Monomere<br />
zwischen den einzelnen Kollagenfasern. Als letzten Schritt wird nun ein fließ-<br />
fähiger ungefüllter Kunststoff, das sogenannte Adhäsiv, auf das vorbereitete<br />
Dentin gegeben. Die einzelnen Monomere des Adhäsivs verbinden sich in-<br />
nerhalb des Kollagengeflechts mit den Monomeren des Primers <strong>und</strong> schaf-<br />
fen, nach Lichtpolymerisation, eine hydrophobe Oberfläche, an <strong>der</strong> nun das<br />
ebenfalls hydrophobe Füllungsmaterial polymerisieren kann. Diese mit<br />
Kunststoff infiltrierte Kollagenmatrix wird als Hybridschicht bezeichnet <strong>und</strong> ist<br />
ca. 2- 5 Mikrometer dick [113, 42, 25, 173].<br />
An<strong>der</strong>s als bei den meisten an<strong>der</strong>en Sealer-Typen, ist hier die mikromecha-<br />
nische Retention mit <strong>der</strong> Kollagenmatrix des intertubulären Dentins für die
LITERATURÜBERSICHT 19<br />
Haftung <strong>der</strong> Wurzelfüllung an <strong>der</strong> Kanalwand von gr<strong>und</strong>legen<strong>der</strong> Bedeutung.<br />
Die Penetration des Sealers in die Dentintubuli, als makromechanische Haf-<br />
tung spielt dabei eine untergeordnete Rolle [159, 163, 125].<br />
Das Epiphany System (Pentron Clinical Technologies, Wallingford, CT) be-<br />
steht aus einem selbstätzenden Primer, einem Sealer auf Kunststoffbasis<br />
<strong>und</strong> Resilon-Spitzen.<br />
Resilon ist ein thermoplastisches Material, bestehend aus Polycaprolacton -<br />
ein biologisch abbaubares Polyester mit niedrigem Schmelzpunkt.<br />
Methacryloxy-Gruppen, die im Resilon-Kunststoff eingebaut sind, stellen den<br />
Verb<strong>und</strong> mit Epiphany-Sealer sicher. [79]<br />
Als Füllstoffe enthält dieses Material Bariumchlorid sowie verschiedene Glä-<br />
ser.<br />
Der Epiphany Root Canal Sealant ist ein dualhärten<strong>der</strong> Komposit-Kunststoff<br />
mit einem neuen Redox-Katalysator. Dies ermöglicht neben <strong>der</strong> Lichtpolyme-<br />
risation auch eine Autopolymerisation unter sauren Bedingungen [80, 79,<br />
157].<br />
Neben BisGMA (Bisphenol-A Diglycidyldimethacrylat), UDMA<br />
(Urethandimethacrylat) <strong>und</strong> hydrophilen bifunktionellen Methacrylaten, sind<br />
desweiteren silanisierte Barium-Borosilikatgläser, Bariumsulfat, Silikat,<br />
Calciumhydroxid, Bismuth Oxychlorid mit Aminen, Peroxid, Fotoinitiatoren,<br />
Stabilisatoren <strong>und</strong> Farbstoffe enthalten [167].<br />
Der selbstätzende Primer ist eine wässrige Lösung eines sauren Monomers.<br />
Da die Säure zur Konditionierung des Dentins in <strong>der</strong> Primer-Flüssigkeit ent-<br />
halten ist, wird eine separate Ätzung überflüssig.<br />
Im Gegensatz zu einem Adhäsiv-System mit separatem Ätzschritt, werden<br />
hier die gelösten anorganischen Bestandteile nicht abgespült, son<strong>der</strong>n in die<br />
Hybridschicht eingebaut.<br />
Alle drei Komponenten des Epiphany Obturation System sollen so zusam-<br />
men nach <strong>der</strong> Lichtpolymerisation einen soliden Monoblock bilden.
20 LITERATURÜBERSICHT<br />
Obwohl es sich hierbei um ein adhäsives Wurzelkanalfüllmaterial handelt,<br />
sind die Haftwerte einer Epiphany-Resilon-Kombination nicht besser als die<br />
einer Guttapercha-AH Plus-Kombination o<strong>der</strong> an<strong>der</strong>er Sealer mit Guttaper-<br />
cha als Kernmaterial [172, 12].<br />
Selbst Kombinationen von Guttapercha, AH Plus, Resilon <strong>und</strong> Epiphany zei-<br />
gen hinsichtlich <strong>der</strong> Dichtigkeitswerte keine signifikanten Unterschiede [172].<br />
Schwachstellen entstehen bei einer AH Plus/Guttapercha-Kombination am<br />
Sealer-Guttapercha-Interface, während sich bei einer Epiphany-Resilon-<br />
Kombination Mikrospalten vor allem am Sealer-Hybridschicht-Interface bil-<br />
den. Beide Kombinationen können also keine hermetisch dichte Wurzelfül-<br />
lung gewährleisten [164].<br />
Für die Dichtigkeit von Wurzelfüllungen mit dem Epiphany-System scheint<br />
die Fülltechnik, also warme vertikale o<strong>der</strong> kalte laterale Kondensation, uner-<br />
heblich zu sein [41].<br />
Epiphany Primer, Sealer <strong>und</strong> Resilon-Spitzen verursachen schwere zytoto-<br />
xische Schädigungen, wenn sie in direktem Kontakt zu Zellkulturen stehen.<br />
Dabei scheint sich die zytotoxische Wirkung mit <strong>der</strong> Zeit noch zu erhöhen<br />
[14].<br />
Während unpolymerisierte Bausteine wie HEMA - enthalten in Epiphany Pri-<br />
mer - o<strong>der</strong> unpolymerisierte Methacrylate im Sealer diese schweren Schädi-<br />
gungen hervorrufen, wirkt eine mögliche Phasentrennung von UDMA &<br />
Polycaprolacton toxisch [15, 66].<br />
Ein weiterer Gr<strong>und</strong> für die Toxizität von Resilon ist, dass dieses Material an<br />
seinen Ester-Bindungen enzymatisch gespalten werden kann [165].<br />
Genau wie das Epiphany-System gehört auch FibreFill zu den Sealern auf<br />
Methacrylat-Basis.<br />
FibreFill Root Canal Sealant (Pentron, Wallingford) wird in Kombination mit<br />
einem selbsthärtenden Primer eingesetzt (Fibrefill Primer A & B). Als Kern-<br />
material können Guttapercha-Stifte verwendet werden.
LITERATURÜBERSICHT 21<br />
In einer Studie von Gogos et al. [54] verglich man die Haftwerte von FibreFill<br />
(Methacrylat-Basis) mit denen von Sealern auf Epoxidharz-, Glasionomer-<br />
<strong>und</strong> Calcium-Salicylat-Basis.<br />
Die besten Ergebnisse lieferte die FibreFill-Gruppe, wobei <strong>der</strong> Verb<strong>und</strong>ver-<br />
lust hauptsächlich durch adhäsives Versagen entstand.<br />
Verglichen mit den Mikroleakage-Werten eines Calcium-Salicylat-Sealers<br />
schneidet FibreFill auch hier deutlich besser ab. Selbst bei An- o<strong>der</strong> Abwe-<br />
senheit des Smear layers waren Wurzelkanalfüllungen mit FibreFill <strong>und</strong> Gut-<br />
tapercha deutlich dichter als Wurzelfüllungen mit einem Calcium-Salicylat-<br />
Sealer <strong>und</strong> Guttapercha [34].<br />
Vertreter von Sealern auf Silikonbasis sind RSA RoekoSeal Automix <strong>und</strong><br />
GuttaFlow (beides Coltene Whaledent, Langenau).<br />
GuttaFlow ist eine Weiterentwicklung auf Basis von RoekoSeal Automix,<br />
dessen gute Versiegelungseigenschaften in einem Zeitraum von 18 Monaten<br />
unter Beweis gestellt werden konnten [188, 190].<br />
Nach Angaben des Herstellers besteht GuttaFlow aus Guttapercha in pulve-<br />
risierter Form, mit einer Partikelgröße von weniger als 30 Mikrometer <strong>und</strong><br />
Sealer.<br />
Es enthält kein Eugenol <strong>und</strong> ist gut röntgensichtbar.<br />
Auf Gr<strong>und</strong> <strong>der</strong> verbesserten Fließfähigkeit <strong>und</strong> <strong>der</strong> Tatsache, dass GuttaFlow<br />
beim Abbinden leicht expandiert [120], verspricht <strong>der</strong> Hersteller eine bessere<br />
Wandständigkeit <strong>und</strong> einen dadurch verbesserten Verschluss.<br />
In Übereinstimmung dazu, hat eine Studie von Elayouti et al. [37] gezeigt,<br />
dass GuttaFlow über eine gute Wandständigkeit verfügt.<br />
Wegen <strong>der</strong> verbesserten Fließfähigkeit, kann GuttaFlow auch in <strong>der</strong> Single-<br />
cone-Technik angewendet werden <strong>und</strong> gewährleistet eine ebenso gute Dich-<br />
tigkeit wie eine AH Plus/Guttapercha-Füllung in Verbindung mit <strong>der</strong> warmen<br />
vertikalen Kondensationstechnik [13]. Dies wie<strong>der</strong>um wurde durch einen<br />
Bakterienpenetrationstest wi<strong>der</strong>legt, in dem die Dichtigkeit einer GuttaFlow-<br />
Guttapercha-Füllung mit Single-cone-Technik <strong>der</strong> Dichtigkeit einer AH Plus-<br />
Guttapercha-Füllung in Verbindung mit <strong>der</strong> warmen vertikalen Kondensa-<br />
tionstechnik deutlich unterlegen zu sein scheint [109].
22 LITERATURÜBERSICHT<br />
Unter In-vitro-Bedingungen bleiben GuttaFlow-Wurzelkanalfüllungen lange<br />
Zeit stabil, d.h. sie lösen sich nicht auf <strong>und</strong> bleiben in ihrer Beschaffenheit<br />
homogen [142].<br />
GuttaFlow ist im Vergleich zu an<strong>der</strong>en Sealern nur gering zytotoxisch, wobei<br />
auch hier die Toxizität mit <strong>der</strong> Zeit zunimmt. Diese Zunahme kann <strong>der</strong> Frei-<br />
setzung von Nano-Silberpartikeln zugeschrieben werden, die als antibakteri-<br />
eller Zusatz in diesem Sealer enthalten sind [14].<br />
Die milde Zytotoxizität von GuttaFlow konnte auch in einer Studie von<br />
Eldeniz et al. [40] bestätigt werden.<br />
Klassifikation von Wurzelkanalfülltechniken<br />
In <strong>der</strong> mo<strong>der</strong>nen Endodontie unterscheidet man zwischen Kalt- <strong>und</strong> Warm-<br />
fülltechniken, sowie Injektionstechniken.<br />
Kaltfülltechniken Warmfülltechniken Injektionstechniken<br />
Einstift-Technik Vertikale Kondensation Obtura II ®<br />
Kalte Lateralkondensa-<br />
tion<br />
Warme Lateralkonden-<br />
sation<br />
Tabelle 2: Wurzelkanalfülltechniken<br />
Kalte Fülltechniken<br />
Methode nach<br />
Mc Spadden<br />
Thermafil ® , Densfil ®<br />
Ultrafil ®<br />
Die Einstift-Technik, als Vertreter <strong>der</strong> Kaltfülltechniken ist einfach in <strong>der</strong><br />
Anwendung <strong>und</strong> wenig techniksensitiv.<br />
Bei dieser Technik kommt ein Guttapercha-Stift als volumenstabiles Kernma-<br />
terial zur Anwendung <strong>und</strong> Sealer zum Auffüllen <strong>der</strong> Räume zwischen Gutta-<br />
percha <strong>und</strong> <strong>der</strong> Wurzelkanalwand.<br />
Die Wurzelkanalwände werden zunächst mit Hilfe eines Lentulos o<strong>der</strong> einem<br />
an<strong>der</strong>en rotierenden Instrument z.B. EZ-Fill-Spirale, einer Papierspitze, einer
LITERATURÜBERSICHT 23<br />
K-Feile o<strong>der</strong> eines passenden Guttapercha-Stiftes mit Sealer benetzt. Eben-<br />
so kann <strong>der</strong> Sealer per Kanüle eingebracht werden.<br />
Danach wird ein Guttapercha-Stift ebenfalls mit Sealer beschickt, <strong>und</strong> auf<br />
Arbeitslänge in den Kanal eingeschoben. Die Form <strong>und</strong> Größe dieses Gutta-<br />
percha-Stiftes richtet sich nach <strong>der</strong> ISO-Größe des zuletzt verwendeten Auf-<br />
bereitungsinstrumentes.<br />
Die Anwendung dieser Technik ist auf Wurzelkanäle mit kreisr<strong>und</strong>em Quer-<br />
schnitt beschränkt. Hier ist <strong>der</strong> Raum zwischen Guttapercha-Stift <strong>und</strong> Wur-<br />
zelkanalwand am kleinsten, wodurch die Sealer-Schichtstärke sehr dünn ge-<br />
halten werden kann <strong>und</strong> folglich das Risiko <strong>der</strong> Entstehung von Mikrospalten<br />
durch Abbindeschrumpfung minimiert wird.<br />
In puncto Dichtigkeit findet man in <strong>der</strong> Literatur konträre wissenschaftliche<br />
Ergebnisse: einige Studien konnten zeigen, dass die Zentralstifttechnik ande-<br />
ren Techniken unterlegen ist, da das Kernmaterial nicht kondensiert wird [59,<br />
106], während an<strong>der</strong>e Studien gute Dichtigkeitswerte bescheinigten [187, 82,<br />
180].<br />
Das Prinzip bei <strong>der</strong> kalten Lateralkondensation ist es, so viel Kernmaterial<br />
wie möglich <strong>und</strong> so wenig Sealer wie nötig zu verwenden.<br />
Bei dieser Obturationstechnik wird ein Guttapercha-Hauptstift, entsprechend<br />
<strong>der</strong> Größe <strong>der</strong> apikalen Meisterfeile, mit Sealer benetzt <strong>und</strong> in den Wurzelka-<br />
nal eingebracht.<br />
Mit einem geeigneten Fingersprea<strong>der</strong>, <strong>der</strong> bis ca. 1 mm kürzer als Arbeits-<br />
länge eingebracht werden soll, wird nun <strong>der</strong> Hauptstift an die Wurzelkanal-<br />
wand kondensiert. In den so geschaffenen Raum werden wie<strong>der</strong>um dünnere<br />
Guttapercha-Stifte eingeschoben <strong>und</strong> mit dem Fingersprea<strong>der</strong> kondensiert.<br />
Beim Kondensieren muss unbedingt darauf geachtet werden, dass nur mit<br />
leichtem Druck gearbeitet wird.<br />
Ist <strong>der</strong> Kondensationsdruck zu groß, wird <strong>der</strong> Sealer von <strong>der</strong> Wurzelkanal-<br />
wand verdrängt, was sich negativ auf den Verb<strong>und</strong> <strong>der</strong> Wurzelkanalfüllung<br />
mit dem Wurzelkanaldentin auswirkt [75, 45, 186, 187, 94, 47].
24 LITERATURÜBERSICHT<br />
Ein Nachteil <strong>der</strong> Lateralkondensation ist die Entstehung von Mikrorissen in-<br />
nerhalb des Wurzeldentins. Durch den Druck während <strong>der</strong> Lateralkondensa-<br />
tion <strong>und</strong> nachfolgen<strong>der</strong> okklusaler Belastung, entstehen nach längerer Zeit<br />
Mikrorisse durch Rissfortpflanzung <strong>und</strong> daraus resultierend Vertikalfrakturen<br />
<strong>der</strong> Wurzel [67, 68].<br />
Bedingt durch den Einsatz von Fingersprea<strong>der</strong>n können Hohlräume zwi-<br />
schen <strong>der</strong> Wurzelkanalwand <strong>und</strong> <strong>der</strong> Guttapercha-Stifte auftreten, die durch<br />
akzessorische Guttapercha-Stifte nicht mehr ausgeglichen werden können<br />
<strong>und</strong> auch durch den Sealer nicht aufgefüllt werden [32].<br />
Warme Fülltechniken<br />
Durch die thermische Lateralkondensation entstehen durch die Applikation<br />
von Wärme, homogenere Wurzelfüllungen als bei <strong>der</strong> kalten Lateral-<br />
kondensation. Der Gr<strong>und</strong> dafür ist das Zusammenschmelzen <strong>der</strong> einzelnen<br />
Guttapercha-Stifte, wodurch auch die Spalten zwischen den Haupt- <strong>und</strong> Ne-<br />
benstiften eliminiert werden können.<br />
Die Methode nach Mc Spadden zählt ebenfalls zu Warmfülltechniken.<br />
Ein Guttapercha-Stift wird mit Hilfe eines rotierenden Kompaktors innerhalb<br />
des Wurzelkanals erwärmt <strong>und</strong> plastisch verformt.<br />
Der Kompaktor selbst ähnelt einer umgedrehten Hedström-Feile <strong>und</strong> arbeitet<br />
mit 20.000 bis 30.000 Umdrehungen pro Minute. Durch die Reibungswärme<br />
erwärmt sich die Guttapercha <strong>und</strong> passt sich genau <strong>der</strong> Form des Wurzelka-<br />
nals an.<br />
Neben Thermafil ist die Methode nach Mc Spadden genauso effizient [133],<br />
kann aber nur in geraden Wurzelkanälen angewendet werden.<br />
Bei <strong>der</strong> vertikalen Kondensationstechnik wird ein Guttapercha-Stift, in<br />
Verbindung mit einem Sealer, innerhalb des Wurzelkanals zunächst erwärmt,<br />
um danach mit kalten Stopfinstrumenten nach apikal kondensiert zu werden.<br />
Durch das ständige Plastifizieren <strong>und</strong> Kondensieren <strong>der</strong> Guttapercha, dringt
LITERATURÜBERSICHT 25<br />
die Wurzelfüllung auch in feinste Seitenkanälchen ein <strong>und</strong> verschließt sie<br />
[143, 33].<br />
Durch diese dreidimensionale Fülltechnik werden Wurzelfüllungen mit einem<br />
Guttapercha-Gehalt von über 90% erzielt.<br />
Mögliche Komplikationen schließen sowohl die Hitzeschädigung des<br />
Parodonts als auch eine Extrusion des Füllmaterials in das periapikale Ge-<br />
webe ein [152].<br />
Eine weitere Warmfülltechnik, ist das Thermafil- bzw. Densfil-System. Der<br />
Thermafil-Stift besteht aus einem Kunststoffträger, <strong>der</strong> von einer Guttaper-<br />
cha-Schicht ummantelt wird. In einem speziellen Ofen (Thermafil Oven) wird<br />
<strong>der</strong> Stift erhitzt, bis die Guttapercha-Schicht plastisch verformbar ist <strong>und</strong> da-<br />
nach in den mit Sealer beschickten Kanal eingebracht. Schließlich wird <strong>der</strong><br />
überschüssige Stift auf Höhe <strong>der</strong> Kanaleingänge rotierend o<strong>der</strong> mittels eines<br />
heißen Instrumentes abgetrennt.<br />
Die Guttapercha fließt beim Thermafil-Verfahren wesentlich besser in Seiten-<br />
kanäle, hinterlässt weniger Hohlräume innerhalb <strong>der</strong> Wurzelfüllung <strong>und</strong> passt<br />
sich besser <strong>der</strong> Wurzelkanaloberfläche an als Guttapercha-Stifte bei <strong>der</strong> La-<br />
teralkondensation. Trotz allem waren überstopfte Kanäle bei dem Thermafil-<br />
Verfahren häufiger zu beobachten, als bei <strong>der</strong> lateralen Kondensation [22].<br />
In Bezug auf die Dichtigkeit zeigte sich im Farbstoffpenetrationstest, dass<br />
Thermafil-Wurzelfüllungen besser abschneiden als Füllungen mit <strong>der</strong> latera-<br />
len Kondensationstechnik [49].<br />
Verglichen mit <strong>der</strong> kalten Lateralkondensation ergaben sich in einer In vivo-<br />
Studie von Chu et al. [19] keine signifikanten Unterschiede bezüglich des<br />
klinischen Behandlungsergebnisses nach drei Jahren. Dennoch war die Be-<br />
arbeitungszeit mit Thermafil wesentlich kürzer als bei <strong>der</strong> Lateralkondensati-<br />
on. Hinsichtlich des Guttapercha-Sealer-Verhältnisses von Wurzelkanalfül-<br />
lungen schneidet auch hier die Thermafil-Technik besser ab, als die Lateral-<br />
kondensationstechnik [48].
26 LITERATURÜBERSICHT<br />
Injektionstechniken<br />
Schließlich existieren noch Injektionstechniken wie Obtura II <strong>und</strong> Ultrafil,<br />
die vor allem bei Unregelmäßigkeiten innerhalb des Wurzelkanalsystems,<br />
wie starken Verzweigungen o<strong>der</strong> internen Resorptionen, geeignet sind.<br />
Bei diesen Obturationstechniken wird Guttapercha erwärmt <strong>und</strong> mit Hilfe ei-<br />
ner speziellen Applikationspistole in den Wurzelkanal gegeben. Unverzicht-<br />
bar ist die Verwendung von Sealer, da bei <strong>der</strong> Applikation häufig Blasen in<br />
<strong>der</strong> plastifizierten Guttapercha entstehen.<br />
Desweiteren sind diese Techniken für weitlumige Wurzelkanäle empfehlens-<br />
wert, da die Kanäle bis zu einer ISO-Größe von 70 bis 80 aufbereitet werden<br />
müssen.<br />
Sind die Kanallumina kleiner, so kann die Applikationskanüle nicht auf die<br />
vorgesehene Wurzelkanallänge eingeschoben werden.<br />
Vorsicht ist auch beim Einpressdruck geboten: ist <strong>der</strong> Druck, mit dem die<br />
weiche Guttapercha in den Kanal gepresst wird, zu groß, resultiert dies in<br />
apikaler Überstopfung. Ist er jedoch zu klein, werden nicht alle Kanalbereiche<br />
mit Guttapercha ausgefüllt.<br />
Schädigende Einflüsse auf das Parodontium, aufgr<strong>und</strong> <strong>der</strong> starken Erwär-<br />
mung <strong>der</strong> Guttapercha, bestehen bei beiden Systemen nicht [95].<br />
3.4 Dichtigkeitsuntersuchungen<br />
Entscheidend für Erfolg o<strong>der</strong> Misserfolg einer endodontischen Therapie ist<br />
eine möglichst komplette Reinigung sowie <strong>der</strong> darauf folgende hermetisch<br />
dichte Verschluss des Wurzelkanalsystems.<br />
Eine inkomplette, <strong>und</strong>ichte Wurzelfüllung ist meist die Hauptursache eines<br />
Misserfolges <strong>der</strong> nicht-chirurgischen Wurzelkanalbehandlung [76].<br />
Viele unterschiedliche Methoden wurden entwickelt, um die Qualität des api-<br />
kalen Verschlusses hinsichtlich seiner Dichtigkeit beurteilen zu können. Da-<br />
runter finden sich neben Penetrationstests mit Farbstoffen [77] o<strong>der</strong> Radio-<br />
isotopen [55, 175], auch Bakterienpenetrationstests [169], elektrochemische<br />
Verfahren [78] sowie die enzymatische Glucose-Oxidase-Methode [193].
LITERATURÜBERSICHT 27<br />
Farbstoffpenetrationstest<br />
In Dichtigkeitsuntersuchungen unter In vitro-Bedingungen ist <strong>der</strong> Einsatz ver-<br />
schiedener Farbstoffe als Indikatoren weitverbreitet.<br />
Als Farbstoffe kommen verschiedene Substanzen in Frage wie Eosin, Methy-<br />
lenblau, Tusche (Black India Ink) <strong>und</strong> Procion Brilliant Blue [162].<br />
In Zusammenhang mit dem Indikator ist aber auch die Methode ausschlag-<br />
gebend, mit <strong>der</strong> letztendlich <strong>der</strong> Grad <strong>der</strong> Dichtigkeit bzw. Undichtigkeit einer<br />
Wurzelfüllung beurteilt wird.<br />
Für gewöhnlich werden dafür horizontale Schnitte [137, 35, 94], Längsschnit-<br />
te [60, 129, 101, 71, 93, 29, 2] <strong>und</strong> die Clearing Technik [161, 160, 84, 44,<br />
130, 21, 2] eingesetzt.<br />
Jede dieser Techniken hat Vor- <strong>und</strong> Nachteile, vergleicht man aber diese<br />
Methoden untereinan<strong>der</strong>, so zeigt sich ein hoher Grad an Variabilität. Es ist<br />
als wahrscheinlich anzusehen, dass Unterschiede in den experimentellen<br />
Verfahren auch zu einer unterschiedlich starken Variation <strong>der</strong> Ergebnisse<br />
führen [191].<br />
So berichten ähnliche Studien über Diskrepanzen in den Ergebnissen, wenn<br />
unterschiedliche Farbstoffe als Indikatoren benutzt wurden [58, 81, 29].<br />
Selbst bei <strong>der</strong> Verwendung gleicher Materialien <strong>und</strong> Methoden unterscheiden<br />
sich die Ergebnisse voneinan<strong>der</strong> [191].<br />
Wesentlichen Einfluss auf die Ergebnisse nehmen eingeschlossene Luftbla-<br />
sen im Wurzelkanal, die die Farbstoffpenetration verhin<strong>der</strong>n [71, 184]. Um<br />
alle Luftblasen aus dem Kanal zu entfernen, wird <strong>der</strong> Gebrauch einer Zentri-<br />
fuge o<strong>der</strong> eines Vakuums empfohlen [58, 155, 117]. Dennoch wird die Farb-<br />
stoffpenetration in apikalen Dichtigkeitsuntersuchungen nicht signifikant<br />
durch den Einsatz von Vakuum verbessert [134].<br />
An<strong>der</strong>e Faktoren, wie <strong>der</strong> pH-Wert <strong>der</strong> Farbstofflösung, das molekulare Ge-<br />
wicht [2] sowie die sofortige bzw. verspätete Farbstoffimmersion [71, 130]<br />
beeinflussen die Ergebnisse unterschiedlich stark.<br />
Methylenblau wird in unterschiedlichen Konzentrationen am häufigsten in<br />
apikalen Dichtigkeitsuntersuchungen eingesetzt [155].
28 LITERATURÜBERSICHT<br />
Auf Gr<strong>und</strong> seines niedrigeren molekularen Gewichtes ist die Eindringtiefe<br />
von Methylenblau höher als die von Black India Ink [86, 162].<br />
In Verbindung mit <strong>der</strong> Clearing Technik schneidet Black India Ink, auf Gr<strong>und</strong><br />
seiner besseren Sichtbarkeit, jedoch besser ab als Methylenblau [145].<br />
Penetrationstests mit Radioisotopen<br />
Der Gebrauch von radioaktiven Isotopen als Tracer in Penetrationstests galt<br />
im Allgemeinen als vielversprechende Methode. Man vermutete, dass diese<br />
Isotope im Vergleich zu Farbstoffmolekülen über ein besseres Penetrations-<br />
vermögen verfügen <strong>und</strong> schon in geringen Mengen detektiert werden können<br />
[55, 175].<br />
Im Prinzip basiert die Methode auf <strong>der</strong> Emission radioaktiver Strahlen <strong>der</strong><br />
verschiedenen Isotope, die mit Hilfe eines Röntgenfilms sichtbar gemacht<br />
werden können.<br />
Die gebräuchlichsten Radioisotope sind Calcium-45, C 14 markierter Harn-<br />
stoff, <strong>und</strong> I 125 markiertes Albumin.<br />
Calcium-45 wird häufig als wasserlösliches Salz ( 45 CaCl2) verwendet <strong>und</strong><br />
tauscht sich als Ion mit dem inerten Calcium des Apatits <strong>der</strong> Zahnhartsub-<br />
stanz aus.<br />
C 14 markierter Harnstoff ist ebenfalls wasserlöslich <strong>und</strong> wurde schon in eini-<br />
gen an<strong>der</strong>en Studien als Tracer-Substanz verwendet [30, 116]. Es findet hier<br />
jedoch kein <strong>Aus</strong>tausch mit Elementen <strong>der</strong> Zahnhartsubstanz statt.<br />
Iodid 125 markiertes Albumin ist ein großes, wasserlösliches Molekül <strong>und</strong> bin-<br />
det sich an Apatit-Kristalle [65, 110].<br />
Letztendlich ist diese Methode <strong>der</strong> Farbstoffpenetration hinsichtlich <strong>der</strong> Ge-<br />
nauigkeit unterlegen, wie eine Studie von Matloff et al. beweisen konnte. Es<br />
zeigte sich, dass das Penetrationsvermögen <strong>der</strong> Farbstoffmoleküle von Me-<br />
thylenblau besser war als das <strong>der</strong> radioaktiven Isotope [101].
LITERATURÜBERSICHT 29<br />
Bakterienpenetrationstests<br />
Eine weitere Möglichkeit um die Dichtigkeit von Wurzelfüllungen zu bewer-<br />
ten, stellt <strong>der</strong> Bakterienpenetrationstest dar.<br />
Dabei können sowohl Bakterienstämme als auch bakterielle Stoffwechsel-<br />
produkte verwendet werden [170, 87, 171].<br />
Meistens werden jedoch lebende Bakterien verwendet. Beispiele hierfür sind<br />
Staphylococcus epi<strong>der</strong>midis, Enterococcus faecalis o<strong>der</strong> Streptococcus<br />
mutans [4, 151, 5].<br />
Der Versuchsaufbau ist in diesen Studien immer <strong>der</strong>selbe: ein steriler, wur-<br />
zelkanalbehandelter Zahn wird so zwischen zwei Kammer platziert, dass das<br />
koronale Ende des Zahnes in die obere Kammer mit <strong>der</strong> bakterienbeimpften<br />
Nährstofflösung ragt, während das apikale Ende in die untere Kammer mit<br />
einer sterilen, klaren Nährstofflösung eintaucht.<br />
Folglich können die Bakterien aus <strong>der</strong> oberen Kammer nur über den abgefüll-<br />
ten Wurzelkanal in die untere Kammer gelangen.<br />
Nach einem festgelegten Zeitraum o<strong>der</strong> zu festen Zeitpunkten, z.B. täglich,<br />
wird überprüft, ob sich Bakterien in <strong>der</strong> unteren Kammer angesammelt ha-<br />
ben.<br />
Ist die Wurzelkanalfüllung dicht, so bleibt die Nährstofflösung <strong>der</strong> unteren<br />
Kammer klar. Es sind also keine Bakterien nachweisbar.<br />
Bei einer <strong>und</strong>ichten Wurzelkanalfüllung o<strong>der</strong> über die Zeit, trübt sich jedoch<br />
die Nährstofflösung <strong>der</strong> unteren Kammer auf Gr<strong>und</strong> <strong>der</strong> Anwesenheit von<br />
Bakterien.
30 LITERATURÜBERSICHT<br />
Elektrochemische Testverfahren<br />
Das elektrochemische Testverfahren beruht auf <strong>der</strong> Diffusion von Ionen<br />
durch kleinste Undichtigkeiten in <strong>der</strong> Wurzelfüllung.<br />
Es handelt sich hierbei um eine quantitative Bestimmung des Stromes, <strong>der</strong><br />
entlang <strong>der</strong> Wurzelkanalfüllung fließt.<br />
Die daraus gewonnenen Ergebnisse bezüglich <strong>der</strong> Dichtigkeit einer Wurzel-<br />
füllung sind aber nicht mit den Ergebnissen an<strong>der</strong>er Testverfahren, wie z.B.<br />
Farbstoffpenetration o<strong>der</strong> Flüssigkeits-Transport-Modell vergleichbar [132].<br />
Während das Ergebnis des elektrochemischen Testverfahrens letztendlich<br />
auf den Gesetzmäßigkeiten <strong>der</strong> Elektrik basiert, lassen sich die Ergebnisse<br />
an<strong>der</strong>er Testverfahren hauptsächlich durch Diffusion o<strong>der</strong> Filtration erklären.<br />
Es sind also völlig verschiedene Mechanismen <strong>der</strong>en Ergebnisse kaum un-<br />
tereinan<strong>der</strong> korrelieren.<br />
Von Nachteil an diesem Verfahren ist die Korrosion an <strong>der</strong> Anode, welche die<br />
Diffusion <strong>der</strong> Ionen blockiert <strong>und</strong> zu falschen Ergebnissen führen kann [3].<br />
Enzymatische Glucose-Oxidase-Methode<br />
In dieser neuartigen Dichtigkeitsuntersuchung spielt das Glucose-Molekül die<br />
entscheidende Rolle. Da es ein sehr kleines Molekül mit einem relativ nied-<br />
rigem molekularen Gewicht ist, kann die Filtrationsrate von Glucose entlang<br />
<strong>der</strong> Wurzelkanalfüllung bestimmt <strong>und</strong> <strong>der</strong> Grad <strong>der</strong> Undichtigkeit mit Hilfe <strong>der</strong><br />
Spektrofotometrie quantifiziert werden.<br />
Für den Grad <strong>der</strong> Undichtigkeit einer Wurzelfüllung ist folglich die Glucose-<br />
Konzentration im apikalen Reservoir ausschlaggebend.<br />
Um nun den Betrag <strong>der</strong> Glucose-Konzentration genau zu erfassen, reagiert<br />
Glucose, in Anwesenheit von Sauerstoff <strong>und</strong> Wasser, mit Hilfe des Enzyms<br />
Glucoseoxidase, zu Gluconsäure <strong>und</strong> Wasserstoffperoxid.<br />
Die entstandenen Wasserstoffperoxid-Moleküle reagieren wie<strong>der</strong>um mit ei-<br />
nem chromogenen Sauerstoffakzeptor zu einem rotgefärbten Produkt, dem<br />
oxidierten Farbstoff.
LITERATURÜBERSICHT 31<br />
Diese Art <strong>der</strong> Dichtigkeitsuntersuchung erlaubt schließlich eine quantitative<br />
Langzeit-Erfassung von Undichtigkeiten entlang <strong>der</strong> Wurzelfüllung, ohne<br />
dass die Proben, wie bei an<strong>der</strong>en Testverfahren, zerstört werden müssen<br />
[193].<br />
Flüssigkeits-Transport-Modell<br />
Das Flüssigkeits-Transport-Modell, das von Pashley erstmals beschrieben<br />
wurde, ist ein weiteres Instrument zur Dichtigkeitsuntersuchung von Wurzel-<br />
kanalfüllmaterialien [191].<br />
Dabei wird Flüssigkeit durch die Spalträume zwischen Sealer <strong>und</strong> Wurzelka-<br />
nalwand bzw. Sealer <strong>und</strong> Guttapercha mit einem Überdruck von 0,3- 1,2 bar<br />
getrieben.<br />
Der Grad <strong>der</strong> Dichtigkeit wird durch die Bewegung einer Luftblase in einer<br />
Glaskapillare in einer vorgeschriebenen Zeiteinheit bestimmt [108].<br />
Das Prinzip ist die Flüssigkeitsfiltration, die dadurch gewonnenen Ergebnisse<br />
können durch den angelegten Überdruck <strong>und</strong> Variierung <strong>der</strong> Messzeit beein-<br />
flusst werden [131].
32 ZIEL DER STUDIE<br />
4. Ziel <strong>der</strong> Studie<br />
In dieser In vitro-Studie wurde die Qualität <strong>der</strong> apikalen Dichtigkeit von Wur-<br />
zelkanalfüllungen mit vier verschiedenen Sealer-Typen in trockenen o<strong>der</strong><br />
feuchtigkeitskontaminierten Kanälen untersucht.<br />
Dabei wurden Sealer auf Epoxidharz-Basis (AH Plus, DeTrey/Dentsply, Kon-<br />
stanz), auf Methacrylat-Basis in Kombination mit einem Ein-Flaschen-<br />
Adhäsiv <strong>und</strong> einem Polyester-Kernmaterial (Epiphany/Resilon; Pentron,<br />
Wallingford, USA), auf Methacrylat-Basis in Kombination mit einem Zwei-<br />
Flaschen-Adhäsiv <strong>und</strong> einem Guttapercha-Stift (FibreFill, Pentron,<br />
Wallingford, USA) <strong>und</strong> ein auf Polyvinylsiloxan-basierendes, Guttapercha-<br />
enthaltendes, fließfähiges, kaltes Obturationsmaterial (GuttaFlow; Coltène<br />
Whaledent, Langenau) verwendet.<br />
Es wurde die zweifache Null-Hypothese überprüft, dass we<strong>der</strong> <strong>der</strong> verwende-<br />
te Sealer-Typ, noch <strong>der</strong> Wurzelkanalzustand die apikale Dichtigkeit von Wur-<br />
zelkanalfüllungen beeinflussen.
MATERIAL UND METHODE 33<br />
5. Material <strong>und</strong> Methode<br />
5.1 Vorbereitende Maßnahmen<br />
Zu diesem Studienzweck wurden 90 extrahierte, humane Unterkieferfront-<br />
zähne verwendet. Vor Beginn <strong>der</strong> experimentellen Arbeiten wurden die Zäh-<br />
ne für maximal vier Wochen in 0.5%iger Chloramin-T-Lösung bei Raumtem-<br />
peratur gelagert. Vor <strong>der</strong> Trepanation <strong>der</strong> Zähne wurden die Wurzeloberflä-<br />
chen mit Hilfe eines Frontzahn-Scalers (HuFriedy) von anhaftenden Kon-<br />
krementen <strong>und</strong> parodontalem Gewebe vollständig gesäubert.<br />
Die koronale Zugangskavität wurde bis auf Höhe <strong>der</strong> Wurzelkanaleingänge<br />
mittels eines grobkörnigen, zylindrischen Diamanten angelegt.<br />
Die Verwendung von C-Pilot-Feilen <strong>der</strong> ISO-Größe 06 (VDW GmbH) erleich-<br />
terte das Auffinden <strong>der</strong> Wurzelkanäle, während gleichzeitig auch die<br />
Gängigkeit <strong>der</strong> Kanäle überprüft werden konnte.<br />
Um die Arbeitslänge des jeweiligen Wurzelkanals zu bestimmen, wurde eine<br />
Hedström-Feile <strong>der</strong> ISO-Größe 08 eingeschoben, bis <strong>der</strong>en Spitze am Apex<br />
gerade noch zu erkennen war. Der Silikonstopper an <strong>der</strong> Feile wurde auf den<br />
koronalen Referenzpunkt eingestellt, <strong>und</strong> die so ermittelte Länge mit einer<br />
Messbank (VDW GmbH) gemessen.<br />
Die Arbeitslänge ergab sich nun aus <strong>der</strong> Zahnlänge minus 1 mm.<br />
5.2 Maschinelle Aufbereitung<br />
Unter Zuhilfenahme von maschinell betriebenen FlexMaster-Instrumenten<br />
(VDW, Munich, Germany) wurden alle Wurzelkanäle standardisiert aufberei-<br />
tet.<br />
Entsprechend <strong>der</strong> Herstellerangabe wurden die Drehzahlen im Bereich von<br />
150-300 rpm eingehalten. Mit pumpenden Auf- <strong>und</strong> Abwärtsbewegungen,<br />
aber ohne zu starkes Forcieren des Instruments nach apikal, wurden die Ka-<br />
näle bis auf ISO 60 Taper .02 <strong>und</strong> <strong>der</strong> jeweiligen Arbeitslänge erweitert.<br />
Die Aufbereitung erfolgte zunächst mit <strong>der</strong> koronalen Erweiterung, bei <strong>der</strong><br />
Feilen mit einer 6%igen- <strong>und</strong> 4%igen- Konizität verwendet wurden. Für die
34 MATERIAL UND METHODE<br />
Erweiterung des apikalen Wurzelkanaldrittels wurden anschließend Feilen<br />
mit einer 2%igen Konizität verwendet.<br />
Um die apikale Gängigkeit sicherzustellen, wurde nach jedem FlexMaster-<br />
Instrument eine K-Feile <strong>der</strong> ISO-Größe 10 (VDW GmbH) in den Kanal, bis<br />
über den Apex hinaus geschoben <strong>und</strong> Verblockungen innerhalb des Kanals<br />
entfernt.<br />
5.3 Spülung <strong>der</strong> Wurzelkanäle<br />
Zur Vermeidung von Instrumentenfrakturen <strong>und</strong> zur Entfernung von abgetra-<br />
genen Dentin-Spänen <strong>und</strong> Debris wurde zwischenzeitlich mit insgesamt 1 ml<br />
dreiprozentiger NaOCl-Lösung pro Wurzelkanal mit einer Endo-Kanüle<br />
(Transcoject, D-Neumünster) gespült. Um die beim Instrumentieren entstan-<br />
dene Schmierschicht aufzulösen, wurden alle Kanäle mit jeweils 1 ml 40-<br />
prozentiger Zitronensäure gespült.<br />
Die Verwendung <strong>der</strong> NaOCl-Spüllösung <strong>und</strong> <strong>der</strong> Zitronensäurelösung erfolg-<br />
te im Wechsel, so dass die vorletzte Spülung 40-prozentige Zitronensäure<br />
darstellte.<br />
Um verbliebene Reste vorhergehen<strong>der</strong> Spüllösungen zu entfernen, <strong>und</strong> um<br />
die Kanäle schneller trocknen zu können, wurde als Abschlussspülung pro<br />
Kanal jeweils 1 ml 70-prozentige Ethanol-Lösung verwendet.<br />
5.4 Standardisierung von trockenen <strong>und</strong> feuchten Bedingungen<br />
Zehn <strong>der</strong> insgesamt 90 instrumentierten <strong>und</strong> gespülten Zähne, wurden zu-<br />
nächst <strong>der</strong> Länge nach gespalten <strong>und</strong> wie<strong>der</strong> mit Klebewachs zusammenge-<br />
fügt.<br />
Die zehn Zähne wurden in zwei Kontrollgruppen aufgeteilt, nämlich in eine<br />
Gruppe unter trockenen Bedingungen (n=5) <strong>und</strong> in eine Gruppe unter feuch-<br />
ten Bedingungen (n=5)<br />
Die fünf Zähne <strong>der</strong> trockenen Gruppe wurden dabei mit Papierspitzen <strong>der</strong><br />
ISO-Größe 55 getrocknet, so dass an den letzten aufeinan<strong>der</strong> folgenden fünf<br />
Papierspitzen keine Feuchtigkeit mehr zu erkennen war.
MATERIAL UND METHODE 35<br />
Anschließend wurde bei den Kanälen zusätzlich für 10 s Druckluft angewen-<br />
det (KaVo FineAir, Kavo Biberach, Germany). Dieses Vorgehen wurde<br />
mehrmals wie<strong>der</strong>holt. Das Klebewachs wurde von den fünf Proben entfernt<br />
<strong>und</strong> die Fragmente unter dem Lichtmikroskop unter 30-facher Vergrößerung<br />
auf vollständige Trockenheit untersucht. Erst dann, wenn die Wurzelkanal-<br />
oberflächen matt <strong>und</strong> kreidig weiß erschienen, konnte sichergestellt werden,<br />
dass alle Proben eine vollständige <strong>und</strong> reproduzierbare Trocknung aufwie-<br />
sen.<br />
Die Proben <strong>der</strong> Gruppe unter feuchten Bedingungen wurden aufrecht in einer<br />
feuchten Kammer (Memmert B80, Memmert Schwabach) für sieben Tage bei<br />
37°C <strong>und</strong> 100% Luftfeuchtigkeit gelagert.<br />
Der Überschuss an Kondenswasser, <strong>der</strong> sich im apikalen Drittel des Wurzel-<br />
kanals gebildet hatte, wurde mit dünnen Papierspitzen <strong>der</strong> ISO-Größe 25<br />
aufgesaugt, so dass keine Feuchtigkeit mehr an <strong>der</strong> Wurzelspitze sichtbar<br />
war. Diese Zähne wurden ebenfalls auseinan<strong>der</strong> gebrochen <strong>und</strong> unter dem<br />
Lichtmikroskop untersucht.<br />
Dabei wurde beson<strong>der</strong>s darauf geachtet, dass jede Wurzelkanaloberfläche<br />
einen dünnen, homogenen Feuchtigkeitsfilm zeigte.<br />
5.5 Vorbereitung <strong>der</strong> experimentellen Gruppen<br />
Damit eine möglichst vollständige Trocknung aller Kanäle <strong>der</strong> 80 experimen-<br />
tellen Proben erzielt werden konnte, wurden zunächst mehrere Papierspitzen<br />
<strong>der</strong> ISO Größe 55 nacheinan<strong>der</strong> in die Wurzelkanäle auf Arbeitslänge einge-<br />
schoben. Bei allen Kanälen wurden nach <strong>der</strong> ersten trockenen Papierspitze,<br />
die aus dem betreffenden Wurzelkanal entfernt wurde, fünf weitere Papier-<br />
spitzen nachgelegt.<br />
Anschließend wurden in allen Wurzelkanälen für jeweils 10s Druckluft ange-<br />
wendet. Dieses Vorgehen wurde mehrmals wie<strong>der</strong>holt bis alle Proben voll-<br />
ständig getrocknet waren <strong>und</strong> kein Feuchtigkeitsfilm mehr zu erkennen war.
36 MATERIAL UND METHODE<br />
5.6 Einteilung <strong>der</strong> Proben<br />
Je<strong>der</strong> Probenzahn wurde randomisiert einer <strong>der</strong> vier Sealer-Gruppen zuge-<br />
ordnet (n=20). Jede Sealer-Gruppe wurde nochmals in jeweils zwei Unter-<br />
gruppen (n=10) aufgeteilt, wobei diese feuchte <strong>und</strong> trockene Bedingungen<br />
während des Sealer-Placements repräsentierten.<br />
Alle vier Untergruppen mit dem Attribut „feucht“ wurden zur Re-<br />
Kontamination mit Wasserdampf für sieben Tage in einer feuchten Kammer<br />
bei 37°C <strong>und</strong> einer Luftfeuchtigkeit von nahezu 100% gelagert. Dadurch ge-<br />
wann man einen allseitig gleichmäßigen, feinen Feuchtigkeitsfilm auf <strong>der</strong> be-<br />
arbeiteten Wurzelkanaloberfläche, wie bei <strong>der</strong> obengenannten Standardisie-<br />
rung beschrieben.<br />
Zur Verifizierung des Farbstoffpenetrationstests mit Methylenblau-Lösung,<br />
wurden zusätzlich eine positive <strong>und</strong> eine negative Kontrollgruppe untersucht.<br />
Jede Kontrollgruppe bestand aus fünf Zähnen.<br />
In <strong>der</strong> positiven Kontrollgruppe wurden die aufbereiteten Zähne nicht abge-<br />
füllt, in <strong>der</strong> negativen Kontrollgruppe wurden die Wurzelkanäle mit Guttaper-<br />
cha <strong>und</strong> Sealer verschlossen.<br />
5.7 Abfüllen <strong>der</strong> experimentellen Gruppen<br />
Die vier trockenen Untergruppen wurden nach <strong>der</strong> vollständigen Trocknung,<br />
die vier feuchten Untergruppen nach siebentägiger Lagerung in <strong>der</strong> feuchten<br />
Kammer, mit dem zugehörigen Sealer <strong>der</strong> jeweiligen Hauptgruppe obturiert.<br />
Gruppe 1-4<br />
(n=20)<br />
Untergruppen a) / b)<br />
(n=10)<br />
Abfüll-<br />
Technik Darreichungsform<br />
AH Plus feucht trocken SCT Doppelkammerspritze<br />
Epiphany feucht trocken SCT Doppelkammerspritze<br />
FibreFill feucht trocken SCT Doppelkammerspritze<br />
GuttaFlow feucht trocken SCT Einmalkapseln<br />
Tabelle 3: Einteilung <strong>der</strong> experimentellen Gruppen
MATERIAL UND METHODE 37<br />
Das Abfüllen <strong>der</strong> Kanäle erfolgte bei allen 80 Proben in <strong>der</strong> Single-cone-<br />
Technik (SCT). Bei den Sealer-Gruppen AH Plus, GuttaFlow <strong>und</strong> FibreFill<br />
wurde als Kernmaterial jeweils eine Guttapercha-Spitze <strong>der</strong> ISO-Größe 55<br />
verwendet.<br />
<strong>Aus</strong>nahme war nur die Sealer-Gruppe Epiphany. Hier wurde als Kernmaterial<br />
für die Wurzelkanäle <strong>der</strong> 20 Proben jeweils eine Resilon-Spitze ISO-Größe<br />
55 anstelle von Guttapercha benutzt.<br />
Obturation mit AH Plus <strong>und</strong> Guttapercha<br />
AH Plus ist ein Zweipasten-Wurzelkanalfüllmaterial auf Epoxid-Amin-<br />
Polymer-Basis.<br />
Paste A <strong>und</strong> Paste B sind folgen<strong>der</strong>maßen zusammengesetzt:<br />
AH Plus Paste A AH Plus Paste B<br />
Bisphenol-A-Epoxidharz Dibenzyl-Diamin<br />
Bisphenol-F-Epoxidharz Aminoadamantan<br />
Calciumwolframat Tricyclodecan-Diamin<br />
Zirkoniumoxid Calciumwolframat<br />
Hochdisperses Siliciumdioxid Zirkoniumoxid<br />
Eisenoxid Hochdisperses Siliciumdioxid<br />
Tabelle 4: Inhaltsstoffe von AH Plus<br />
Silikonöl<br />
Erhältlich ist es in zwei <strong>Aus</strong>führungen, nämlich in Form von zwei Tuben, wo-<br />
bei das Material manuell im Verhältnis von 1:1 angemischt werden muss <strong>und</strong><br />
in Form von einer AH Plus Jet Doppelkammer-Spritze, bei <strong>der</strong> das direkte<br />
Anmischen <strong>und</strong> Auftragen auf den Papierblock o<strong>der</strong> Glasplatte für die Auf-<br />
nahme mittels Applikationsinstrument möglich ist.
38 MATERIAL UND METHODE<br />
Abbildung 1: AH Plus Jet<br />
In dieser Studie wurde die AH Plus Jet Doppelkammer-Spritze verwendet.<br />
Da das Volumen <strong>der</strong> Pasten A <strong>und</strong> B minimal variieren kann, wurde vor <strong>der</strong><br />
ersten Anwendung <strong>der</strong> Pasten-Überschuss aus <strong>der</strong> Spritze gepresst <strong>und</strong><br />
verworfen (Abb.1.)<br />
Nur so konnte das richtige Mischungsverhältnis <strong>der</strong> beiden Pasten von 1:1<br />
eingehalten werden.<br />
Anschließend wurde eine kleinere Menge des AH Plus-Sealers auf einen<br />
Anmischblock gedrückt <strong>und</strong> mit Hilfe einer Papierspitze <strong>der</strong> ISO-Größe 55 in<br />
das Kanallumen auf Arbeitslänge eingebracht, so dass die gesamte Wurzel-<br />
kanaloberfläche mit AH Plus beschickt wurde. Eine Guttapercha-Spitze wur-<br />
de danach allseitig mit AH Plus benetzt <strong>und</strong> in den Kanal auf die korrekte<br />
Arbeitslänge eingeschoben. Um die vollständige Benetzung des Kanals mit<br />
AH Plus gewährleisten zu können, wurde <strong>der</strong> Guttapercha-Point nochmals<br />
um 360° im Kanallumen rotiert.<br />
Mit dem erhitzten Ende eines Heidemann-Spatels wurde die überstehende<br />
Guttapercha auf Höhe des Kanaleingangs abgetrennt <strong>und</strong> <strong>der</strong> Sealer-<br />
Überschuss mit kleinen Schaumstoffpellets entfernt.
MATERIAL UND METHODE 39<br />
Obturation mit GuttaFlow <strong>und</strong> Guttapercha<br />
Abbildung 2: GuttaFlow-Kapseln mit Dispenser <strong>und</strong> Guttapercha-Primer H<br />
Bei GuttaFlow handelt es sich um ein Zwei-Komponenten-System, beste-<br />
hend aus einer Polydimethylsiloxan-Matrix <strong>und</strong> feinst gemahlener Guttaper-<br />
cha mit einer Korngröße < 30 Mikrometer.<br />
Es wird als Einmalkapsel mit einem Paste-Paste-System angeboten <strong>und</strong> ist<br />
folgen<strong>der</strong>maßen zusammengesetzt:<br />
Guttaperchapulver<br />
Tabelle 5: Inhaltsstoffe von GuttaFlow<br />
Polymethylsiloxan<br />
Silikonöl<br />
Paraffinöl<br />
Platinkatalysator<br />
Zirkondioxid<br />
Nano-Silber<br />
Farbstoff<br />
Als Kaltfüllsystem ist GuttaFlow schon bei Zimmertemperatur fließfähig. Es<br />
wird also keine zusätzliche Wärme benötigt, was wie<strong>der</strong>um zur Folge hat,<br />
dass das Material nicht schrumpft, son<strong>der</strong>n beim Abbinden leicht expandiert.
40 MATERIAL UND METHODE<br />
Die Guttapercha-Stifte wurden zunächst mit Alkohol gereinigt <strong>und</strong> getrocknet.<br />
Mit Hilfe einer Microbrush wurde als nächstes Guttapercha Primer H auf die<br />
Stifte aufgetragen <strong>und</strong> mit dem Luftpuster dünn verblasen. Die GuttaFlow-<br />
Einmalkapseln wurden aktiviert <strong>und</strong> nach Herstellerangaben im Cap Mix-<br />
Gerät für 30s angemischt. Mit <strong>der</strong> montierten Applikationskanüle wurde das<br />
Material in den Kanal eingebracht. Zusätzlich wurde eine kleine Menge<br />
GuttaFlow auf einen Anmischblock gegeben. Die vorbereiteten Guttapercha-<br />
Spitzen wurden dann mit GuttaFlow beschickt <strong>und</strong> auf Arbeitslänge in den<br />
Wurzelkanal eingeschoben. Vor <strong>der</strong> endgültigen Platzierung des<br />
Guttaperchapoints, wurde dieser, zur vollständigen Benetzung <strong>der</strong> Kanal-<br />
wände, um 360° innerhalb des Wurzelkanals rotiert.<br />
Der Sealer-Überschuss wurde mit Schaumstoffpellets entfernt <strong>und</strong> die über-<br />
stehende Guttaperchaspitze am Kanaleingang mit einem heißen Instrument<br />
abgetrennt. Mit einem kalten Kugelstopfer (Hu Friedy) wurde die Wurzelfül-<br />
lung leicht kondensiert.<br />
Obturation mit FibreFill <strong>und</strong> Guttapercha<br />
Abbildung 3: FibreFill-Sealer mit FibreFill-Primerflüssigkeiten A & B
MATERIAL UND METHODE 41<br />
Das FibreFill-System, ein adhäsives Obturationsmaterial, besteht aus<br />
FibreFill Sealer <strong>und</strong> zwei FibreFill Primer-Flüssigkeiten A <strong>und</strong> B (Abb. 3).<br />
Die einzelnen Bestandteile sind, wie folgt zusammengesetzt:<br />
FibreFill-Sealer<br />
Primer-Flüssigkeit A<br />
Primer-Flüssigkeit B<br />
UDMA, PEGDMA, HDDMA, BisGMA<br />
Bariumborosilikat-Gläser,<br />
Bariumsulfat,<br />
Silikat, Calciumhydroxid,<br />
Calciumphosphat, Initiatoren, Stabi-<br />
lisatoren, Pigmente, Benzoylperoxid<br />
Aceton, oberflächenaktives Monomer,<br />
NTG-GMA Magnesium<br />
Aceton, PMGDMA, HEMA, Initiatoren,<br />
Stabilisatoren, Wasser<br />
Tabelle 6: Inhaltsstoffe von FibreFill-Sealer <strong>und</strong> FibreFill-Primer<br />
In einer Mischschale wurden zunächst die FibreFill Primer-Flüssigkeiten A<br />
<strong>und</strong> B im Mischungsverhältnis 1:1 miteinan<strong>der</strong> vermengt. Eine Appli-Brush<br />
wurde danach von allen Seiten mit <strong>der</strong> vermischten Primer-Flüssigkeit be-<br />
feuchtet. Um die Bürste nicht zu übersättigen, wurde <strong>der</strong> Überschuss an Kle-<br />
bemittel leicht abgeschüttelt.<br />
Die Bürste wurde in den Wurzelkanal auf Arbeitslänge eingeführt <strong>und</strong> dabei<br />
gedreht, so dass die gesamte Wurzelkanaloberfläche gleichmäßig mit Primer<br />
benetzt wurde.<br />
Der Klebefilm wurde mittels Druckluft für fünf Sek<strong>und</strong>en leicht angetrocknet<br />
<strong>und</strong> die Primer-Ansammlung an <strong>der</strong> Wurzelspitze mit Papierspitzen ISO-<br />
Größe 45 aufgesaugt.<br />
Da FibreFill-Sealer in einer Doppelkammerspritze erhältlich ist, wurde auch<br />
hier, vor <strong>der</strong> ersten Anwendung, eine kleine Menge Sealer verworfen.<br />
Die Wurzelkanäle wurden analog oben genannter Gruppen, mit Hilfe einer<br />
Papierspitze <strong>und</strong> einem Guttapercha-Point ISO 55 abgefüllt. Die überstehen-<br />
de Guttapercha-Spitze wurde abgetrennt, <strong>der</strong> Sealer-Überschuss entfernt<br />
<strong>und</strong> koronal für 40 Sek<strong>und</strong>en lichtgehärtet.
42 MATERIAL UND METHODE<br />
Obturation mit Epiphany <strong>und</strong> Resilon-Spitzen<br />
Abbildung 4: Epiphany-Sealer mit Resilon-Spitzen <strong>und</strong> Primer-Flüssigkeiten<br />
Das Epiphany-System besteht aus einem selbstätzenden Primer, einem du-<br />
alhärtenden, Methacrylat-basierten, hydrophilen Sealer <strong>und</strong> Resilon-Spitzen<br />
(Abb.4).<br />
Resilon, eine Substanz aus Polyester-Polymeren, besitzt ähnliche Eigen-<br />
schaften wie Guttapercha, ist aber schon bei niedrigeren Temperaturen<br />
thermoplastisch verformbar.<br />
Laut Hersteller haftet <strong>der</strong> hydrophile Kunststoff-Sealer sowohl an Epiphany-<br />
Obturatoren als auch am Wurzelkanaldentin <strong>und</strong> bildet nach dem <strong>Aus</strong>härten<br />
einen Monoblock.<br />
Die einzelnen Bestandteile von Epiphany sind:<br />
Epiphany<br />
Tabelle 7: Inhaltsstoffe von Epiphany-Sealer<br />
BisGMA, UDMA,<br />
hydrophile Methacrylate
MATERIAL UND METHODE 43<br />
Der Epiphany-Sealer wird, ähnlich wie AH Plus Jet, in einer Doppelkammer-<br />
spritze angeboten. Um das richtige Mischungsverhältnis zu wahren, wurde<br />
<strong>der</strong> Pasten-Überschuss vor <strong>der</strong> ersten Anwendung entfernt <strong>und</strong> verworfen.<br />
Ein Tropfen des selbstätzenden Primers wurde zunächst in eine Mischschale<br />
gegeben <strong>und</strong> eine Papierspitze <strong>der</strong> ISO-Größe 55 darin eingetaucht. Danach<br />
wurde die vollgesogene Papierspitze in den Kanal auf Arbeitslänge einge-<br />
bracht <strong>und</strong> <strong>der</strong> Primer, durch mehrmalige Rotationen <strong>und</strong> Auf- <strong>und</strong><br />
Abbewegungen in das Wurzelkanaldentin einmassiert.<br />
Vor dem Einbringen des Sealers, wurde zunächst <strong>der</strong> Primer-Überschuss<br />
mittels Papierspitzen entfernt.<br />
Das Verteilen des Epiphany-Sealers erfolgte, analog zu den restlichen Grup-<br />
pen, mit Papierspitzen.<br />
Schließlich wurde, wie bei allen an<strong>der</strong>en Proben, <strong>der</strong> Sealer-Überschuss am<br />
Pulpakammerboden entfernt <strong>und</strong> die Resilon-Spitze mit einem heißen In-<br />
strument abgetrennt. Durch die sich anschließende Lichthärtung für 40 s er-<br />
reichte man durch die Polymerisation des Sealers einen koronal dichten Ver-<br />
schluss des Wurzelkanals.<br />
Eine weitere <strong>Aus</strong>härtung mit <strong>der</strong> Polymerisationslampe war nicht notwendig,<br />
da das Material dualhärtend <strong>und</strong> laut Herstellerangaben nach 45 Minuten<br />
ausgehärtet ist.
44 MATERIAL UND METHODE<br />
5.8 Vorbereitung <strong>der</strong> Proben für den Farbstoffpenetrationstest<br />
Alle 90 Proben wurden koronal mit Ketac Cem (3M ESPE) verschlossen.<br />
Zur vollständigen <strong>Aus</strong>härtung <strong>der</strong> Sealer, wurden alle Zähne für 7 Tage im<br />
Thermoschrank (Memmert B80) bei 37°C <strong>und</strong> nahezu 100 % Luftfeuchtigkeit<br />
gelagert.<br />
Anschließend wurden die Außenflächen <strong>der</strong> Zähne komplett mit 2 Schichten<br />
Nagellack (Ellen Betrix) überzogen, so dass keine Zahnhartsubstanz mehr<br />
durchschimmerte. (Abb. 5)<br />
Abbildung 5: Lackierte Zähne mit abgetrennten Apices vor dem Zentrifugieren<br />
Um eventuell vorhandene apikale Ramifikationen zu entfernen, wurden als<br />
nächstes die Apices <strong>der</strong> 85 Proben, also <strong>der</strong> vier experimentellen Gruppen<br />
(n=20) <strong>und</strong> <strong>der</strong> positiven Kontrollgruppe (n=5), abgetrennt. Die Apices <strong>der</strong><br />
negativen Kontrollgruppe (n=5) wurden dabei nicht entfernt.<br />
Die Abtrennung <strong>der</strong> Apices erfolgte sukzessiv an einem Gipsmodell-Trimmer,<br />
bis <strong>der</strong> Wurzelfüllungsstift gerade erkennbar war.<br />
Dabei wurden die Wurzelspitzen senkrecht auf das sich rotierende<br />
Trimmerblatt gehalten, bis die Guttapercha- bzw. Resilon-Spitzen an <strong>der</strong><br />
Schnittfläche sichtbar wurden.
MATERIAL UND METHODE 45<br />
Die einzelnen Gruppen wurden zusammen mit 5%iger Methylenblau-<br />
Farbstofflösung in Reagenzgläser gegeben <strong>und</strong> bei 30 g für 3 min zentrifu-<br />
giert (Varifuge K; Heraeus-Christ, Osterode) (Abb. 6).<br />
Abbildung 6: Geöffnete Zentrifuge vor dem Bestücken<br />
Anschließend wurden die Proben unter fließendem Leitungswasser abgewa-<br />
schen <strong>und</strong> getrocknet.<br />
Die Zähne <strong>der</strong> einzelnen Untergruppen wurden danach in Epoxidharz<br />
(Biresin G27, Sika B.V., Utrecht, Nie<strong>der</strong>lande) eingebettet (Abb. 7) <strong>und</strong> nach<br />
dem <strong>Aus</strong>härten des Harzes in jeweils 10 Querschnitte mit einer wasserge-<br />
kühlten Lochsäge (Roditi International Corporation, Hamburg) gesägt.<br />
(Abb.8)
46 MATERIAL UND METHODE<br />
Abbildung 7: In Biresin G27 eingebettete zentrifugierte Probenzähne<br />
Abbildung 8: Zersägen des Epoxidharz-Blockes mit <strong>der</strong> Innenlochsäge
MATERIAL UND METHODE 47<br />
Abbildung 9: Repräsentative horizontale Serienschnitte <strong>der</strong> Schnittebenen 2-5
48 MATERIAL UND METHODE<br />
5.9 Messung <strong>der</strong> apikalen Dichtigkeit<br />
Unter einem Lichtmikroskop mit 40-facher Vergrößerung (Wild Stereomikro-<br />
skop, Leica Geosystems AG, Heerbrugg; Schweiz) wurden die Serienschnit-<br />
te <strong>der</strong> einzelnen Gruppen von drei unabhängigen Betrachtern bewertet.<br />
(Abb.9 &10)<br />
Abbildung 10: <strong>Aus</strong>wertung <strong>der</strong> Serienschnitte unter dem Lichtmikroskop<br />
Um die lineare Farbstoffpenetration zu quantifizieren, wurde je<strong>der</strong> einzelne<br />
Wurzelquerschnitt <strong>der</strong> einzelnen Schnittebenen (1-10) mit „0“ für „keine<br />
Farbstoffpenetration“ o<strong>der</strong> „1“ für „Farbstoffpenetration“ bewertet.
MATERIAL UND METHODE 49<br />
5.10 Statistische Analyse<br />
Die Ergebnisse wurden mit Hilfe von SPSS 14.0 (SPSS, Chicago, IL, USA)<br />
statistisch analysiert.<br />
In <strong>der</strong> statistischen Analyse eingeschlossen waren:<br />
Kolmogorov-Smirnov Test,<br />
one-way ANOVA,<br />
two-way ANOVA,<br />
Duncan´s multiple range-test <strong>und</strong><br />
t-Tests<br />
Desweiteren wurde <strong>der</strong> Signifikanz-Punkt bei 0.05 festgelegt.
50 ERGEBNISSE<br />
6. Ergebnisse<br />
Zur Beurteilung <strong>der</strong> Dichtigkeit von Wurzelkanalfüllungen wurde die lineare<br />
Penetration herangezogen.<br />
Die lineare Penetration wurde anhand von horizontalen Serienschnitten un-<br />
ter mikroskopischer Vergrößerung durch drei Untersucher validiert.<br />
Dabei wurde lediglich untersucht, ob Farbstoff in <strong>der</strong> jeweiligen Schnittebene<br />
sichtbar war o<strong>der</strong> nicht.<br />
Für die Beurteilung <strong>der</strong> linearen Penetrationstiefe war die Menge des Farb-<br />
stoffs zunächst irrelevant, die Entscheidung für die An-o<strong>der</strong> Abwesenheit des<br />
Farbstoffs wurde mit einer reinen Ja-Nein-Entscheidung getroffen.<br />
Das Ergebnis konnte aufgr<strong>und</strong> <strong>der</strong> drei Untersucher immer nur eindeutig po-<br />
sitiv (= Farbstoff vorhanden) o<strong>der</strong> eindeutig negativ (= kein Farbstoff vorhan-<br />
den) sein, da bei zwei möglichen Entscheidungen <strong>und</strong> drei Untersuchern<br />
immer ein mehrheitliches Ergebnis erzielt wird.<br />
6.1 Lineare Penetrationstiefe <strong>der</strong> einzelnen Sealer in <strong>der</strong> Übersicht<br />
Gruppenzugehörigkeit Lineare Penetration in mm<br />
(Standardabweichung)<br />
AH Plus trocken 2,0 (1,2)<br />
AH Plus feucht 2,8 (2,6)<br />
Epiphany trocken 4,3 (3,6)<br />
Epiphany feucht 3,9 (3,1)<br />
FibreFill trocken 7,2 (1,8)<br />
FibreFill feucht 8,4 (0,8)<br />
GuttaFlow trocken 1,5 (0,5)<br />
GuttaFlow feucht 2,4 (2,1)<br />
Tabelle 8: Lineare Penetrationstiefen <strong>und</strong> Standardabweichung<br />
Die Mittelwerte <strong>der</strong> linearen Penetrationstiefen sind in Tabelle 8 aufgelistet.
ERGEBNISSE 51<br />
Die positive Kontrollgruppe zeigte Farbstoffpenetration entlang <strong>der</strong> gesamten<br />
Wurzelkanallänge, während in <strong>der</strong> negativen Kontrollgruppe keine Farbstoff-<br />
penetration erkennbar war.<br />
Der silikonbasierte Sealer GuttaFlow erzielte im trockenen Wurzelkanalzu-<br />
stand im Mittel den besten Wert mit 1,5 mm Penetrationstiefe, während<br />
FibreFill, ein Sealer auf Methacrylat-Basis, in feuchten Wurzelkanälen den<br />
schlechtesten Mittelwert <strong>der</strong> linearen Penetrationstiefe mit 8,4 mm erreichte.<br />
In <strong>der</strong> nachfolgenden Abbildung sind die Mittelwerte <strong>der</strong> linearen Penetrati-<br />
onstiefen für die vier verschiedenen Sealer in Abhängigkeit zum Wurzelka-<br />
nalzustand nochmals veranschaulicht.<br />
Mittelwerte lineare Penetration<br />
10,0<br />
8,0<br />
6,0<br />
4,0<br />
2,0<br />
0,0<br />
AH+Dry<br />
AH+Wet<br />
EpiDry<br />
EpiWet<br />
FibDry<br />
Abbildung 11: Mittelwerte <strong>der</strong> linearen Penetrationstiefen in Abhängigkeit von Wur-<br />
zelkanalzustand <strong>und</strong> Sealer<br />
FibWet<br />
Gruppenzugehörigkeit<br />
GFDry<br />
GFWet<br />
Sealer<br />
AHPlus<br />
Epiphany<br />
FibreFill<br />
GuttaFlow
52 ERGEBNISSE<br />
lineare Penetration<br />
10,0<br />
8,0<br />
6,0<br />
4,0<br />
2,0<br />
0,0<br />
Abbildung 12: Gesamtwerte <strong>der</strong> linearen Penetration in Abhängigkeit von Wurzelka-<br />
nalzustand <strong>und</strong> Sealer<br />
6.2 Ergebnisse <strong>der</strong> statistischen <strong>Aus</strong>wertung<br />
Die statistische <strong>Aus</strong>wertung ergab signifikante Unterschiede für die Gruppen<br />
<strong>der</strong> Parameter „Sealer“ (One-way ANOVA; p0.05).<br />
Weiterhin wurden signifikante Unterschiede bei beiden Sealer-Typen, also<br />
nicht-adhäsive <strong>und</strong> adhäsive Sealer beobachtet (T-test; p
ERGEBNISSE 53<br />
Im Gegensatz dazu waren die Kombinationen AH Plus/Epiphany <strong>und</strong> AH<br />
Plus/GuttaFlow statistisch nicht signifikant (T-Test, p>0.05).<br />
Unter feuchten Wurzelkanalbedingungen erreichte Epiphany/Resilon bessere<br />
Dichtigkeitswerte als unter trockenen Bedingungen, während die abdichten-<br />
den Eigenschaften von AH Plus, FibreFill <strong>und</strong> GuttaFlow durch Feuchtigkeit<br />
negativ beeinflusst wurden. Jedoch waren diese Ergebnisse statistisch nicht<br />
signifikant (T-Tests; p>0.05).<br />
Von allen Sealern hat die FibreFill-Gruppe unter feuchten Wurzelkanalbedin-<br />
gungen, bezüglich <strong>der</strong> apikalen Dichtigkeit am schlechtesten abgeschnitten.<br />
Wurzelkanalzustand<br />
trocken<br />
Wurzelkanalzustand<br />
feucht<br />
GF FF EP AH AH EP FF GF<br />
AH 0,388 AH<br />
0,068 EP 0,793 EP 0,406<br />
0,033* 0,000* FF 0,067 FF 0,000*<br />
0,000* 0,024* 0,229 GF 0,219 GF<br />
GF= GuttaFlow<br />
FF= FibreFill<br />
EP= Epiphany<br />
AH= AH Plus<br />
*= statistisch signifikante Werte<br />
Tabelle 9: T-Test für die Mittelwertgleichheit bei 2-seitiger Signifikanz <strong>und</strong> gleichen<br />
Varianzen
54 DISKUSSION<br />
7. Diskussion<br />
7.1 Diskussion <strong>der</strong> Methode<br />
Zahnauswahl<br />
Um möglichst gleiche <strong>Aus</strong>gangsbedingungen zu schaffen <strong>und</strong> um die Ver-<br />
gleichbarkeit <strong>der</strong> Ergebnisse sicherzustellen, wurden in <strong>der</strong> vorliegenden<br />
Studie humane Unterkiefer-Inzisivi für die Dichtigkeitsuntersuchungen heran-<br />
gezogen.<br />
Variationen bezüglich Zahnform, Zahngröße <strong>und</strong> Wurzelkanalanatomie konn-<br />
ten so auf ein Minimum beschränkt werden. Folglich konnten alle Wurzelka-<br />
näle auf dieselbe Größe aufbereitet werden.<br />
Alle Zähne wurden vor Studienbeginn in Chloramin-T-Lösung gelagert, um<br />
mögliche Wechselwirkungen zwischen Lagermedium <strong>und</strong> Sealer auszu-<br />
schließen.<br />
Aufbereitung <strong>der</strong> Wurzelkanäle<br />
Zum Zweck <strong>der</strong> Standardisierung wurden alle Wurzelkanäle mittels eines<br />
drehmomentkontrollierten Schrittmotors für endodontische Behandlungen<br />
(S.E.T. Endostepper) <strong>und</strong> einem vollrotierenden, maschinellen Nickel-Titan-<br />
System (FlexMaster, VDW) in <strong>der</strong> Crown-down-Technik bis auf ISO-Größe<br />
60/.02 aufbereitet. An<strong>der</strong>s als bei <strong>der</strong> manuellen Aufbereitung erzeugte man<br />
damit einheitlich kreisr<strong>und</strong>e Wurzelkanalquerschnitte, die dann zu einem<br />
späteren Zeitpunkt mittels Single-cone-Technik abgefüllt wurden. Nebenbei<br />
konnte auch <strong>der</strong> originale Wurzelkanalverlauf besser eingehalten werden als<br />
bei manuellen Aufbereitungstechniken [62].<br />
Wurzelkanalspülung<br />
Zur Desinfektion <strong>und</strong> zur Auflösung organischer Gewebereste sowie zur Ent-<br />
fernung <strong>der</strong> Schmierschicht, wurden alle Wurzelkanäle während <strong>der</strong> Aufbe-<br />
reitung im Wechsel mit jeweils 1 ml dreiprozentiger Natriumhypochlorit-<br />
Lösung <strong>und</strong> je 1 ml 40-prozentiger Zitronensäure-Lösung gespült. Nach je-
DISKUSSION 55<br />
dem Instrumentenwechsel wurden so nekrotisches Gewebe <strong>und</strong> Dentin-<br />
Späne aus dem Kanal entfernt <strong>und</strong> somit Verblockungen innerhalb des Wur-<br />
zelkanals vorgebeugt.<br />
Da Natriumhypochlorit ein breites Wirkspektrum gegen Bakterien, Bakterio-<br />
phagen, Sporen, Hefepilze <strong>und</strong> Viren besitzt [17], kam diese Spüllösung in<br />
<strong>der</strong> vorliegenden Studie zum Einsatz. Es wurde darauf geachtet, dass ein<br />
regelmäßiger Flüssigkeitsaustausch zwischen den einzelnen Aufbereitungs-<br />
phasen stattfand, um Chlorit-Reserven innerhalb des Wurzelkanals zu schaf-<br />
fen, die letzten Endes für die antimikrobielle Wirkung verantwortlich sind<br />
[153].<br />
Als weitere Spüllösung wurde 40%ige Zitronensäurelösung verwendet. Nur<br />
so konnten saubere Wurzelkanaloberflächen mit offenen Dentinkanälchen<br />
geschaffen werden, die für die Sealer-Penetration <strong>und</strong> optimale Wand-<br />
ständigkeit <strong>der</strong> späteren Wurzelfüllung nötig sind [96].<br />
Damit nicht nur eine Eigenschaft einer Spüllösung dominieren kann, wurden<br />
beide Spüllösungen bei allen Wurzelkanälen, in jeweils gleichen Volumina<br />
<strong>und</strong> im Wechsel verwendet. Dies entspricht auch einer Empfehlung von<br />
Pérez-Heredia et al. [126].<br />
Um mögliche Interaktionen zwischen NaOCl <strong>und</strong> Sealer zu verhin<strong>der</strong>n, wur-<br />
de bei jedem Wurzelkanal als vorletzte Spülung Zitronensäure <strong>und</strong> als letzte<br />
Spülung 70%iges Ethanol verwendet.<br />
Die Wurzelkanäle wurden auch hier wie<strong>der</strong> mit jeweils 1 ml Ethanol gespült.<br />
Ethanol beschleunigt den Trocknungsvorgang, indem Flüssigkeiten schneller<br />
verdunsten <strong>und</strong> setzt ferner die Oberflächenspannung von Flüssigkeiten her-<br />
ab, so dass es zu einer besseren <strong>Aus</strong>breitung von Flüssigkeiten, bzw. zu<br />
einer besseren Sealer-Penetration in die offenen Dentintubuli kommt [26].
56 DISKUSSION<br />
Trocknung <strong>der</strong> Wurzelkanäle<br />
Um alle Wurzelkanäle möglichst vollständig trocknen zu können, wurden<br />
nach <strong>der</strong> ersten trockenen Papierspitze fünf weitere Papierspitzen nachei-<br />
nan<strong>der</strong> in den Kanal eingeschoben.<br />
Der Vorgang <strong>der</strong> Wurzelkanaltrocknung stellt einen kritischen Punkt in <strong>der</strong><br />
Wurzelkanalbehandlung dar, denn selbst kleine Flüssigkeitsmengen können<br />
die hermetische Abdichtung durch das Wurzelkanalfüllmaterial negativ beein-<br />
flussen [135].Der Gebrauch einer höheren Anzahl von Papierspitzen in Kom-<br />
bination mit zusätzlichen Methoden <strong>der</strong> Wurzelkanaltrocknung, wie warme<br />
Druckluftstöße o<strong>der</strong> das Einbringen einer heißen Sonde in den Wurzelkanal<br />
resultiert in einem höherem Trockenheitsgrad innerhalb <strong>der</strong> Wurzelkanäle<br />
<strong>und</strong> einer besseren Abdichtung durch das Wurzelkanalfüllmaterial [70]. Der<br />
Verschluss von feuchten Wurzelkanälen führt tendenziell zu größeren Un-<br />
dichtigkeiten [90].<br />
Die Feuchtigkeitskontamination <strong>der</strong> Wurzelkanalwände wurde in dieser Stu-<br />
die durch die Lagerung <strong>der</strong> Zähne in einer feuchten Kammer erreicht. Da-<br />
durch konnte eine Flüssigkeitsansammlung innerhalb <strong>der</strong> Wurzelkanäle ver-<br />
mieden <strong>und</strong> ein gleichmäßiger Feuchtigkeitsfilm an <strong>der</strong> Wurzelkanalwand<br />
erzielt werden [135].<br />
Im Gegensatz zur Studie von Horning <strong>und</strong> Kessler, in welcher die Wurzelka-<br />
näle mit 0,05 ml Kochsalz-Lösung pro Kanal wie<strong>der</strong> befeuchtet wurden [69],<br />
gab es in <strong>der</strong> vorliegenden Studie keine signifikanten Unterschiede in <strong>der</strong><br />
Farbstoffpenetration, ob bei feuchten o<strong>der</strong> trockenen Wurzelkanalbedingun-<br />
gen. Bemerkenswert ist jedoch, dass die Wie<strong>der</strong>befeuchtung bei Horning et<br />
al. in nassen Wurzelkanälen resultierte, während in <strong>der</strong> vorliegenden Studie<br />
standardisierte feuchte Wurzelkanäle untersucht wurden. Die verschiedenen<br />
Wie<strong>der</strong>befeuchtungsprozeduren könnten letztendlich <strong>der</strong> Gr<strong>und</strong> für die unter-<br />
schiedlichen Ergebnisse bei<strong>der</strong> Studien sein.
DISKUSSION 57<br />
Wurzelkanalfüllung<br />
Um die Verschlusstechnik als mögliche einflussnehmende Variable aus-<br />
schließen zu können, wurden in dieser Studie alle Proben <strong>der</strong> experimentel-<br />
len Gruppen durch die Einstift-Technik obturiert.<br />
Diese Technik zählt zu den Kaltfülltechniken, ist einfach anwendbar <strong>und</strong> we-<br />
nig techniksensitiv. Desweiteren können alle Wurzelkanäle mit dieser Tech-<br />
nik in einer standardisierten Art <strong>und</strong> Weise abgefüllt werden.<br />
Die Einstift-Technik kommt bei Wurzelkanälen mit kreisr<strong>und</strong>em Querschnitt<br />
zum Einsatz, genau wie in <strong>der</strong> vorliegenden Studie.<br />
Bei allen Wurzelkanälen wurde zunächst eine mit Sealer beschickte Papier-<br />
spitze <strong>der</strong> ISO-Größe 55 in das Kanallumen auf Arbeitslänge eingebracht<br />
<strong>und</strong> um 360° rotiert, so dass die gesamte Wurzelkana lwand mit dem Sealer<br />
in Berührung kam. Nach dem Entfernen <strong>der</strong> Papierspitze wurde ein Gutta-<br />
percha-Stift <strong>der</strong>selben ISO-Größe mit Sealer benetzt <strong>und</strong> in den Wurzelkanal<br />
bis auf Arbeitslänge eingeschoben <strong>und</strong> abermals um 360° gedreht, um eine<br />
vollständige Benetzung <strong>der</strong> Wurzelkanalwand <strong>und</strong> des Guttapercha-Stiftes<br />
sicherzustellen. Schließlich wurde die überstehende Guttapercha auf Höhe<br />
des Kanaleinganges mit Hilfe einer erhitzen Sonde abgetrennt, die Trepana-<br />
tionsöffnung mit einem Schaumstoffpellet versäubert <strong>und</strong> mit Ketac Cem (3M<br />
ESPE) verschlossen.<br />
Es hat sich nämlich auch in früheren Studien gezeigt, dass die Ein-Stift-<br />
Technik in Kombination mit nicht-schrumpfenden Sealern eine effektive Me-<br />
thode ist, um das Wurzelkanalsystem dicht zu versiegeln [13, 189, 180].<br />
Weiterhin berichteten Facer <strong>und</strong> Walton, dass die Sealer-Verteilung bei <strong>der</strong><br />
Lateralkondensation entgegen <strong>der</strong> traditionellen Vorstellung ist [45]. Bei <strong>der</strong><br />
Lateralkondensation bewirkt das Einbringen des Sprea<strong>der</strong>s in den Wurzelka-<br />
nal, dass <strong>der</strong> Sealer heraus gequetscht wird <strong>und</strong> die Guttapercha nun in di-<br />
rektem Kontakt zur Wurzelkanalwand steht. Diese Sealer-freien Wurzelka-<br />
nalabschnitte wurden auch in einigen an<strong>der</strong>en Studien beobachtet [187, 45,<br />
93, 47].
58 DISKUSSION<br />
Basierend auf den Ergebnissen einer früheren Studie Roggendorf et al.<br />
[135], wurde in <strong>der</strong> vorliegenden Studie keine zusätzliche Kontrollgruppe mit<br />
Lateralkondensationstechnik angelegt.<br />
Man kam nämlich zu dem Ergebnis, dass <strong>der</strong> Prozentsatz <strong>der</strong> mit Sealer be-<br />
deckten Wurzelkanal-Oberfläche signifikant höher war, wenn die Kanäle mit<br />
<strong>der</strong> Einstift-Technik abgefüllt wurden [187].<br />
Nebenbei ist die apikale Versiegelung durch einen nicht-schrumpfenden<br />
Sealer in Kombination mit <strong>der</strong> Einstift-Technik ebenso gut, wie bei <strong>der</strong> Late-<br />
ralkondensation o<strong>der</strong> <strong>der</strong> warmen vertikalen Kondensationstechnik [82].<br />
Übereinstimmend dazu kamen Lussi et al. [97] zu dem Ergebnis, dass nicht<br />
die Verschlusstechnik, son<strong>der</strong>n vielmehr <strong>der</strong> Sealer-Typ wesentlich für die<br />
apikale Abdichtung des Wurzelkanalsystems ist.<br />
Farbstoffpenetration<br />
Zur Visualisierung <strong>der</strong> Undichtigkeit von Wurzelfüllungen wurde in dieser<br />
Studie 5%ige Methylenblau-Lösung verwendet. Einige Studien konnten zei-<br />
gen, dass <strong>der</strong> weit verbreitete Farbstoffpenetrationstest ein geeignetes Mittel<br />
darstellt, um die abdichtenden Eigenschaften von Wurzelkanalfüllmaterialien<br />
in vitro zu bestimmen [191, 2, 101].<br />
Methylenblau wird oft als Tracer in Dichtigkeitsuntersuchungen benutzt. Ge-<br />
rade wegen seines geringen molekularen Gewichtes, das vergleichbar klein<br />
ist, wie bakterielle Stoffwechselprodukte, <strong>und</strong> <strong>der</strong> Tatsache, dass die Penet-<br />
rationstiefe von Methylenblau größer ist als die an<strong>der</strong>er Farbstoffe, kam Me-<br />
thylenblau in dieser Studie zum Einsatz [2].<br />
Wesentliche Schwachstelle <strong>der</strong> Farbstoffpenetration sind in <strong>der</strong> Wurzelkanal-<br />
füllung eingeschlossene Luftblasen. Diese verhin<strong>der</strong>n die Penetration des<br />
Farbstoffes <strong>und</strong> können so zu falschen Ergebnissen führen [184].<br />
<strong>Aus</strong> diesem Gr<strong>und</strong> wurde in <strong>der</strong> vorliegenden Studie mit einer Zentrifuge ge-<br />
arbeitet, da Farbstoffpenetrationstests in <strong>der</strong> Literatur unter Unterdruck o<strong>der</strong><br />
Hochdruck empfohlen werden [117, 155].
DISKUSSION 59<br />
Schnittmethoden<br />
Zur Bewertung <strong>der</strong> Farbstoffpenetration wurden die Proben anschließend in<br />
horizontale 1 mm dicke Scheiben geschnitten. An<strong>der</strong>s als bei <strong>der</strong> sogenann-<br />
ten Clearing-Technik, bei <strong>der</strong> die Farbstoffpenetration durch Entkalken des<br />
Zahnes sichtbar gemacht wird, können durch Querschnitt-Technik sowohl die<br />
Farbstoffpenetration innerhalb des Wurzelkanalfüllmaterials detektiert wer-<br />
den, als auch die Verteilung des Sealers, die Penetrationstiefe <strong>und</strong> die Pe-<br />
netrationsfläche dargestellt werden [187]. Im Vergleich zur Clearing-Technik<br />
können also bei <strong>der</strong> Querschnitt-Technik signifikant höhere <strong>und</strong> dadurch ge-<br />
nauere Penetrationswerte gemessen werden [97, 162].<br />
Zudem gestatten die Querschnitte die genaue Visualisierung <strong>der</strong> Penetration<br />
im Bereich <strong>der</strong> Zirkumferenz. Außerdem kann die Farbstoffpenetration nicht<br />
nur lateral <strong>der</strong> Wurzelfüllung sichtbar gemacht werden, wie dies bei <strong>der</strong> Clea-<br />
ring-Technik <strong>der</strong> Fall ist.<br />
7.2 Diskussion <strong>der</strong> Ergebnisse<br />
In <strong>der</strong> vorliegenden In-vitro Studie wurde die Dichtigkeit vier verschiedener<br />
Sealer bei feuchten <strong>und</strong> trockenen Wurzelkanalzuständen untersucht.<br />
Es wurden sowohl adhäsive als auch nicht-adhäsive Sealer auf ihr Dichtig-<br />
keitsverhalten getestet.<br />
Als adhäsive Sealer wurden Epiphany <strong>und</strong> FibreFill verwendet. Beide Sealer<br />
basieren auf Methacrylaten <strong>und</strong> werden zusammen mit selbstätzenden<br />
Primern verwendet.<br />
Weiterhin kamen AH Plus <strong>und</strong> GuttaFlow, als Vertreter <strong>der</strong> nicht-adhäsiven<br />
Sealer, zum Einsatz.<br />
AH Plus ist ein Sealer auf Kunstharz-Basis, während GuttaFlow einen Sili-<br />
kon-basierten Sealer darstellt.<br />
<strong>Aus</strong> <strong>der</strong> statistischen Analyse <strong>der</strong> Ergebnisse geht hervor, dass sich die Art<br />
des Sealers signifikant auf die Dichtigkeit von Wurzelkanalfüllung auswirkt.
60 DISKUSSION<br />
Ein Teil <strong>der</strong> Nullhypothese, nämlich, dass <strong>der</strong> Sealer-Typ keinerlei Einfluss<br />
auf die apikale Dichtigkeit besitzt, muss somit verworfen werden.<br />
Die besten Ergebnisse bezüglich <strong>der</strong> abdichtenden Eigenschaften, sowohl im<br />
trockenen als auch im feuchten Wurzelkanalzustand, lieferte GuttaFlow, ge-<br />
folgt von AH Plus, Epiphany <strong>und</strong> zuletzt FibreFill.<br />
Bei <strong>der</strong> statistischen <strong>Aus</strong>wertung ergaben sich signifikante Unterschiede für<br />
den Parameter „Sealer“, jedoch keine signifikanten Unterschiede für die Pa-<br />
rameter „feucht“ <strong>und</strong> „Sealer*feucht“.<br />
Die Dichtigkeit von Wurzelkanalfüllungen ist also mehr vom jeweiligen<br />
Sealer-Typ abhängig, <strong>und</strong> nicht ausschließlich von feuchten o<strong>der</strong> trockenen<br />
Wurzelkanalzuständen. Auch die Kombination von Sealer-Typ <strong>und</strong> feuchtem<br />
Wurzelkanalzustand scheint für die Dichtigkeit nicht ausschlaggebend zu<br />
sein.<br />
Werden jedoch die nicht-adhäsiven Sealer, also GuttaFlow <strong>und</strong> AH Plus, mit<br />
den adhäsiven Sealern Epiphany <strong>und</strong> FibreFill verglichen, so konnten signifi-<br />
kante Unterschiede beobachtet werden.<br />
Die Kombinationen GuttaFlow/Epiphany, GuttaFlow/FibreFill <strong>und</strong> AH<br />
Plus/FibreFill waren statistisch signifikant.<br />
Aber auch <strong>der</strong> Vergleich adhäsiver Sealer untereinan<strong>der</strong>, nämlich<br />
Epihany/FibreFill war statistisch signifikant.<br />
Vergleich trockener versus feuchter Wurzelkanalzustand<br />
Ein feuchter Wurzelkanalzustand scheint das Abdichtungsvermögen <strong>der</strong><br />
meisten Sealer negativ zu beeinflussen: so erhöhen sich die Penetrationstie-<br />
fen im feuchten Wurzelkanal bei AH Plus, GuttaFlow <strong>und</strong> FibreFill um durch-<br />
schnittlich um 0,96 mm. Die <strong>Aus</strong>nahme stellt dabei Epiphany dar; hier ver-<br />
min<strong>der</strong>t sich die Penetrationstiefe im feuchten Kanal um durchschnittlich 0,4<br />
mm.<br />
Die hohe Oberflächenspannung des Feuchtigkeitsfilms auf <strong>der</strong> Wurzelkanal-<br />
wand könnte ein möglicher Gr<strong>und</strong> für die Erhöhung <strong>der</strong> Penetrationstiefen<br />
sein: Die feinen Wassertropfen verhin<strong>der</strong>n das Anfließen des hydrophoben
DISKUSSION 61<br />
Sealers an die Wurzelkanaloberfläche bzw. in die offenen Dentintubuli, folg-<br />
lich bilden sich Mikrospalten zwischen Wurzelkanalwand <strong>und</strong> Wurzelfüllung.<br />
Ein weiterer Gr<strong>und</strong> könnte aber auch das Löslichkeitsverhalten des Sealers<br />
in Wasser sein [88, 186], so könnte Feuchtigkeit die Abbindung des Sealers,<br />
speziell beim Abfüllen <strong>der</strong> Kanäle, wie in <strong>der</strong> vorliegenden Studie, unterbin-<br />
den bzw. verzögern [114, 69].<br />
Vergleich <strong>der</strong> unterschiedlichen Sealer<br />
GuttaFlow besaß die besten abdichtenden Eigenschaften von allen Sealern,<br />
die in dieser Studie zum Einsatz kamen. Dennoch führte die Feuchtigkeit<br />
auch hier zu einer reduzierten Dichtigkeit <strong>und</strong> zu einer höheren Standardab-<br />
weichung.<br />
Das Vorgängerprodukt von GuttaFlow ist RoekoSeal Automix, das von einem<br />
klassischen Sealer, durch die Zugabe von kleinen Guttapercha-Partikeln, zu<br />
einem Material für die kalte Obturation weiterentwickelt wurde [104].<br />
Unter feuchten Wurzelkanalbedingungen könnten die zusätzlichen Füllstoffe<br />
in GuttaFlow, wie auch bei Roeko Seal Automix zu einer Beeinträchtigung<br />
<strong>der</strong> abdichtenden Eigenschaften geführt haben [135].<br />
AH Plus zeigte in dieser Studie ein vergleichbar gutes Versiegelungsvermö-<br />
gen wie in <strong>der</strong> vorhergehenden Studie von Roggendorf et al. [135].<br />
Desweiteren verfügt AH Plus unter feuchten bzw. trockenen Wurzelkanalbe-<br />
dingungen über ähnlich gute abdichtende Eigenschaften wie GuttaFlow, was<br />
aus dem Vergleich <strong>der</strong> linearen Penetrationstiefen hervorgeht.<br />
Trotzdem ist die Standardabweichung für AH Plus unter feuchten Bedingun-<br />
gen höher als für GuttaFlow.<br />
Epiphany schneidet im Vergleich zu AH Plus <strong>und</strong> GuttaFlow bedeutend<br />
schlechter ab: neben einem schlechteren Versiegelungsvermögen, besitzt<br />
Epiphany die höchste Standardabweichung, die in dieser Studie verzeichnet<br />
werden konnte.
62 DISKUSSION<br />
Jedoch konnten aufgr<strong>und</strong> <strong>der</strong> Wurzelkanallänge keine höheren Penetra-<br />
tionswerte als 9 mm erreicht werden. Zudem kann diese Länge auch als ma-<br />
ximale Penetrationstiefe gewertet werden, da diese die durchschnittliche<br />
Länge vieler Wurzelkanäle von Unterkiefer-Inzisivi repräsentiert. Daher wur-<br />
de hier die maximale Penetrationstiefe auf 9 mm limitiert.<br />
In <strong>der</strong> FibreFill-Gruppe wurden, sowohl unter trockenen, als auch unter<br />
feuchten Bedingungen, die größten Penetrationstiefen erreicht.<br />
In Übereinstimmung mit einer Studie von Roggendorf et al. [135], scheint <strong>der</strong><br />
relevante Faktor für die höheren Werte <strong>der</strong> Standardabweichung bei konven-<br />
tionellen Sealern auch hier wie<strong>der</strong> die Wurzelkanalfeuchtigkeit zu sein.<br />
Betrachtet man dagegen die linearen Penetrationstiefen von adhäsiven<br />
Sealern, scheint es keinen klaren Einfluss des Wurzelkanalzustandes auf die<br />
apikale Undichtigkeit <strong>der</strong> betreffenden Wurzelfüllungen zu geben. Während<br />
bei beiden Epiphany-Gruppen keine Unterschiede festzustellen waren, nahm<br />
das Versiegelungsvermögen von FibreFill unter feuchten Wurzelkanalbedin-<br />
gungen ab. Im Gegensatz zu einer an<strong>der</strong>en Studie [135] werden sowohl ad-<br />
häsive Sealer als auch das neue Silikon-basierte Obturationsmaterial<br />
GuttaFlow negativ durch Feuchtigkeit beeinflusst.<br />
Wahrscheinlich wird dabei die Abbin<strong>der</strong>eaktion von Sealern auf Methacrylat-<br />
Basis durch die Anwesenheit von Feuchtigkeit beeinträchtigt, indem <strong>der</strong><br />
Feuchtigkeitsfilm auf <strong>der</strong> Wurzelkanalwand als Barriere wirkt <strong>und</strong> es so zu<br />
keinem adäquaten Verb<strong>und</strong> <strong>der</strong> Sealers mit dem Wurzelkanaldentin kommt.<br />
Schon in an<strong>der</strong>en Studien hat sich gezeigt, dass die wesentliche Schwach-<br />
stelle bei <strong>der</strong> Epiphany-Resilon-Kombination vor allem das Sealer-<br />
Hybridschicht-Interface darstellt, was wie<strong>der</strong>um zu Mikrospalten <strong>und</strong> somit zu<br />
einer <strong>und</strong>ichten Wurzelkanalfüllung führt [164].<br />
Das Problem hierbei ist, wie bei allen Materialien auf Kunststoffbasis, die<br />
Schrumpfung während <strong>der</strong> Polymerisation.<br />
Durch die Verkettung <strong>der</strong> Monomer-Bausteine während <strong>der</strong> Auto- o<strong>der</strong> Licht-<br />
polymerisation, kommt es zur Schrumpfung eines Kunststoffes, wodurch Mik-<br />
rospalten an <strong>der</strong> Grenzfläche Sealer-Hybridschicht entstehen können.
DISKUSSION 63<br />
Auch <strong>der</strong> hohe C-Faktor, d.h. das Verhältnis von geb<strong>und</strong>ener zu ungeb<strong>und</strong>e-<br />
ner Kunststofffläche bewirkt, dass hohe Belastungen an <strong>der</strong> Grenzfläche ent-<br />
stehen, die schließlich zu einem adhäsiven Versagen führen können [54].<br />
Dagegen scheinen Sealer auf Silikonbasis <strong>und</strong> Epoxidharz-Basis aufgr<strong>und</strong><br />
<strong>der</strong> geringen Farbstoffpenetrationstiefen effektiv abdichtende Wurzelkanal-<br />
füllmaterialien zu sein. Der Gr<strong>und</strong> hierfür könnte eine leichte Expansion die-<br />
ser Sealer während <strong>der</strong> Abbinde-Reaktion sein [120].<br />
Zu ähnlichen Ergebnissen kamen auch einige an<strong>der</strong>e Studien [23, 188, 50,<br />
120].<br />
Wegen ihrer hydrophoben Natur scheinen die Materialeigenschaften von<br />
Epoxidharzen schon unter sehr geringen Feuchtigkeitsmengen zu leiden<br />
[82].<br />
Zu guter Letzt sind adhäsive Sealer noch nicht ausreichend optimiert um<br />
Wurzelkanäle dicht zu verschließen, sowohl unter feuchten wie unter trocke-<br />
nen Bedingungen [53].
64 LITERATURVERZEICHNIS<br />
8. Literaturverzeichnis<br />
1. Abramovich A, Goldberg F:<br />
The relationship of the root canal sealer to the dentine wall. An in vitro<br />
study using the scanning electron microscope.<br />
J Br Endod Soc. 9(2), 81-6 (1976)<br />
2. Ahlberg KM, Assavanop P, Tay WM:<br />
A comparison of the apical dye penetration patterns shown by methy-<br />
lene blue and india ink in root-filled teeth.<br />
Int Endod J. 28(1), 30-4 (1995)<br />
3. Amditis C, Bryant RW, Blackler SM:<br />
The assessment of apical leakage of root-filled teeth by the electro-<br />
chemical technique.<br />
<strong>Aus</strong>t Dent J. 38(1), 22-7 (1993)<br />
4. Barthel CR, Moshonov J, Shuping G, Ørstavik D:<br />
Bacterial leakage versus dye leakage in obturated root canals.<br />
Int Endod J. 32(5), 370-5 (1999)<br />
5. Baumgartner G, Zehn<strong>der</strong> M, Paqué F:<br />
Enterococcus faecalis type strain leakage through root canals filled with<br />
Gutta-Percha/AH plus or Resilon/Epiphany.<br />
J Endod. 33(1), 45-7 (2007)<br />
6. Beer R, Baumann MA, Kielbassa AM:<br />
Taschenatlas <strong>der</strong> Endodontie<br />
Auflage Georg Thieme Verlag, Stuttgart. S.132 (2004)<br />
7. Beer R, Baumann MA, Kielbassa AM:<br />
Taschenatlas <strong>der</strong> Endodontie<br />
Auflage Georg Thieme Verlag, Stuttgart. S.142 (2004)
LITERATURVERZEICHNIS 65<br />
8. Beer R, Baumann MA, Kielbassa AM:<br />
Taschenatlas <strong>der</strong> Endodontie<br />
Auflage Georg Thieme Verlag, Stuttgart. S.110 (2004)<br />
9. Beer R, Baumann MA, Kielbassa AM:<br />
Taschenatlas <strong>der</strong> Endodontie<br />
Auflage Georg Thieme Verlag, Stuttgart S.154 (2004)<br />
10. Behrend GD, Cutler CW, Gutmann JL:<br />
An in-vitro study of smear layer removal and microbial leakage along<br />
root canal fillings.<br />
Int Endod J. 29(2), 99-107 (1996)<br />
11. Berutti E:<br />
Microleakage of human saliva through dentinal tubules exposed at the<br />
cervical level in teeth treated endodontically.<br />
J Endod. 22(11), 579-82 (1996)<br />
12. Biggs SG, Knowles KI, Ibarrola JL, Pashley DH:<br />
An in vitro assessment of the sealing ability of resilon/epiphany using<br />
fluid filtration.<br />
J Endod. 32(8), 759-61 (2006)<br />
13. Brackett MG, Martin R, Sword J, Oxford C, Rueggeberg FA, Tay<br />
FR, Pashley DH:<br />
Comparison of seal after obturation techniques using a polydimethylsi-<br />
loxane-based root canal sealer.<br />
J Endod. 32(12), 1188-90 (2006)<br />
14. Bouillaguet S, Wataha JC, Tay FR, Brackett MG, Lockwood PE:<br />
Initial in vitro biological response to contemporary endodontic sealers.<br />
J Endod. 32(10), 989-92 (2006)
66 LITERATURVERZEICHNIS<br />
15. Bouillaguet S, Wataha JC, Hanks CT, Ciucchi B, Holz J:<br />
In vitro cytotoxicity and dentin permeability of HEMA.<br />
J Endod. 22(5), 244-8 (1996)<br />
16. Bouillaguet S, Wataha JC, Lockwood PE, Galgano C, Golay A,<br />
Krejci I:<br />
Cytotoxicity and sealing properties of four classes of endodontic sealers<br />
evaluated by succinic dehydrogenase activity and confocal laser scan-<br />
ning microscopy.<br />
Eur J Oral Sci. 112(2), 182-7 (2004)<br />
17. Byström A, S<strong>und</strong>qvist G:<br />
Bacteriologic evaluation of the effect of 0.5 percent sodium hypochlorite<br />
in endodontic therapy.<br />
Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 55(3), 307-12 (1983)<br />
18. Chailertvanitkul P, Saun<strong>der</strong>s WP, Mackenzie D:<br />
An assessment of microbial coronal leakage in teeth root filled with gut-<br />
ta-percha and three different sealers.<br />
Int Endod J. 29(6), 387-92 (1996)<br />
19. Chu CH, Lo EC, Cheung GS:<br />
Outcome of root canal treatment using Thermafil and cold lateral con-<br />
densation filling techniques.<br />
Int Endod J. 38(3), 179-85 (2005)<br />
20. Cergneux M, Ciucchi B, Dietschi JM, Holz J:<br />
The influence of the smear layer on the sealing ability of canal obtura-<br />
tion.<br />
Int Endod J. 20(5), 228-32 (1987)
LITERATURVERZEICHNIS 67<br />
21. Clark DS, ElDeeb ME:<br />
Apical sealing ability of metal versus plastic carrier Thermafil obturators.<br />
J Endod. 19(1), 4-9 (1993)<br />
22. Clinton K, Van Himel T:<br />
Comparison of a warm gutta-percha obturation technique and lateral<br />
condensation.<br />
J Endod. 27(11), 692-5 (2001)<br />
23. Cobankara FK, Adanir N, Belli S:<br />
Evaluation of the influence of smear layer on the apical and coronal<br />
sealing ability of two sealers.<br />
J Endod. 30(6), 406-9 (2004)<br />
24. Cobankara FK, Adanir N, Belli S, Pashley DH:<br />
A quantitative evaluation of apical leakage of four root-canal sealers.<br />
Int Endod J. 35(12), 979-84 (2002)<br />
25. Crim GA:<br />
Assessment of microleakage of three dentinal bonding systems.<br />
Quintessence Int. 21(4), 295-7 (1990)<br />
26. Cunningham WT, Cole JS 3rd, Balekjian AY:<br />
Effect of alcohol on the spreading ability of sodium hypochlorite endo-<br />
dontic irrigant.<br />
Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 54(3), 333-5 (1982)<br />
27. Czonstkowsky M, Wilson EG, Holstein FA:<br />
The smear layer in endodontics.<br />
Dent Clin North Am. 34(1), 13-25 (1990)
68 LITERATURVERZEICHNIS<br />
28. Czonstkowsky M, Michanowicz A, Vazquez JA:<br />
Evaluation of an injection of thermoplasticized low-temperature gutta-<br />
percha using radioactive isotopes.<br />
J Endod. 11(2), 71-4 (1985)<br />
29. Dalat DM, Spångberg LS:<br />
Comparison of apical leakage in root canals obturated with various gut-<br />
ta percha techniques using a dye vacuum tracing method.<br />
J Endod. 20(7), 315-9 (1994)<br />
30. Delivanis P, Tabibi A:<br />
A comparative sealability study of different retrofilling materials.<br />
Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 45(2), 273-81 (1978)<br />
31. De-Deus G, Coutinho-Filho T, Reis C, Murad C, Paciornik S:<br />
Polymicrobial leakage of four root canal sealers at two different thick-<br />
nesses.<br />
J Endod. 32(10), 998-1001 (2006)<br />
32. De-Deus G, Gurgel-Filho ED, Magalhães KM, Coutinho-Filho T:<br />
A laboratory analysis of gutta-percha-filled area obtained using Therma-<br />
fil, System B and lateral condensation.<br />
Int Endod J. 39(5), 378-83 (2006)<br />
33. DuLac KA, Nielsen CJ, Tomazic TJ, Ferrillo PJ Jr, HattonJF:<br />
Comparison of the obturation of lateral canals by six techniques.<br />
J Endod. 25(5), 376-80 (1999)<br />
34. Economides N, Kokorikos I, Kolokouris I, Panagiotis B, Gogos C:<br />
Comparative study of apical sealing ability of a new resin-based root<br />
canal sealer.<br />
J Endod. 30(6), 403-5 (2004)
LITERATURVERZEICHNIS 69<br />
35. Eguchi DS, Peters DD, Hollinger JO, Lorton L:<br />
A comparison of the area of the canal space occupied by gutta-percha<br />
following four gutta-percha obturation techniques using Procosol sealer.<br />
J Endod. 11(4), 166-75 (1985)<br />
36. Eick JD, Cobb CM, Chappell RP, Spencer P, Robinson SJ:<br />
The dentinal surface: its influence on dentinal adhesion. Part I.<br />
Quintessence Int. 22(12), 967-77 (1991)<br />
37. Elayouti A, Achleithner C, Löst C, Weiger R:<br />
Homogeneity and adaptation of a new gutta-percha paste to root canal<br />
walls.<br />
J Endod. 31(9), 687-90 (2005)<br />
38. ElDeeb ME:<br />
The sealing ability of injection-molded thermoplasticized gutta-percha.<br />
J Endod. 11(2), 84-6 (1985)<br />
39. Eldeniz AU, Erdemir A, Belli S:<br />
Shear bond strength of three resin based sealers to dentin with and<br />
without the smear layer.<br />
J Endod. 31(4), 293-6 (2005)<br />
40. Eldeniz AU, Mustafa K, Ørstavik D, Dahl JE:<br />
Cytotoxicity of new resin-, calcium hydroxide- and silicone-based root<br />
canal sealers on fibroblasts <strong>der</strong>ived from human gingiva and L929 cell<br />
lines.<br />
Int Endod J. 40(5), 329-37 (2007)<br />
41. Epley SR, Fleischman J, Hartwell G, Cicalese C:<br />
Completeness of root canal obturations: Epiphany techniques versus<br />
gutta-percha techniques.<br />
J Endod. 32(6), 541-4 (2006)
70 LITERATURVERZEICHNIS<br />
42. Erickson RL:<br />
Surface interactions of dentin adhesive materials.<br />
Oper Dent.;Suppl 5, 81-94 (1992)<br />
43. Evans JT, Simons JH:<br />
Evaluation of the apical seal produced by injected thermoplasticized<br />
Gutta-percha in the absence of smear layer and root canal sealer.<br />
J Endod. 12(3), 100-7 (1986)<br />
44. Ewart A, Saun<strong>der</strong>s WP:<br />
Investigation into the apical leakage of root-filled teeth prepared for a<br />
post crown.<br />
Int Endod J. 23(5), 239-44 (1990)<br />
45. Facer SR, Walton RE:<br />
Intracanal distribution patterns of sealers after lateral condensation.<br />
J Endod. 29(12), 832-4 (2003)<br />
46. Gängler P, Hoffmann T, Willershausen B, Schwenzer N, Ehrenfeld<br />
M:<br />
ZahnM<strong>und</strong>Kiefer-Heilk<strong>und</strong>e; Konservierende Zahnheilk<strong>und</strong>e <strong>und</strong><br />
<strong>Parodontologie</strong><br />
2. Auflage Georg Thieme Verlag Stuttgart˙New York, S.222 (2005)<br />
47. Gani O, Visvisian C, de Caso C:<br />
Quality of apical seal in curved canals using three types of sprea<strong>der</strong>s.<br />
J Endod. 26(10), 581-5 (2000)<br />
48. Gençoğlu N:<br />
Comparison of 6 different gutta-percha techniques (part II): Thermafil,<br />
JS Quick-Fill, Soft Core, Microseal, System B, and lateral condensation.<br />
Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 96(1), 91-5 (2003)
LITERATURVERZEICHNIS 71<br />
49. Gençoğlu N, Garip Y, Baş M, Samani S:<br />
Comparison of different gutta-percha root filling techniques: Thermafil,<br />
Quick-fill, System B, and lateral condensation.<br />
Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 93(3), 333-6 (2002)<br />
50. Gençoglu N, Türkmen C, Ahiskali R:<br />
A new silicon-based root canal sealer (Roekoseal-Automix).<br />
J Oral Rehabil. 30(7), 753-7 (2003)<br />
51. Georgopoulou M, Kontakiotis E, Nakou M:<br />
Evaluation of the antimicrobial effectiveness of citric acid and sodium<br />
hypochlorite on the anaerobic flora of the infected root canal.<br />
Int Endod J. 27(3), 139-43 (1994)<br />
52. Georgopoulou MK, Wu MK, Nikolaou A, Wesselink PR:<br />
Effect of thickness on the sealing ability of some root canal sealers.<br />
Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 80(3), 338-44<br />
(1995)<br />
53. Gesi A, Raffaelli O, Goracci C, Pashley DH, Tay FR, Ferrari M:<br />
Interfacial strength of Resilon and gutta-percha to intraradicular dentin.<br />
J Endod. 31(11), 809-13 (2005)<br />
54. Gogos C, Economides N, Stavrianos C, Kolokouris I, Kokorikos I:<br />
Adhesion of a new methacrylate resin-based sealer to human dentin<br />
J Endod. 30(4), 238-40 (2004)<br />
55. Going RE, Massler M, Dute HL:<br />
Marginal penetration of dental restorations by different radioactive iso-<br />
topes.<br />
J Dent Res. 39, 273-84 (1960)
72 LITERATURVERZEICHNIS<br />
56. Goldberg F, Abramovich A:<br />
Analysis of the effect of EDTAC on the dentinal walls of the root canal.<br />
J Endod. 3(3), 101-5 (1977)<br />
57. Goldman LB, Goldman M, Kronman JH, Lin PS:<br />
The efficacy of several irrigating solutions for endodontics: a scanning<br />
electron microscopic study.<br />
Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 52(2), 197-204 (1981)<br />
58. Goldman M, Simmonds S, Rush R:<br />
The usefulness of dye-penetration studies reexamined.<br />
Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 67(3), 327-32 (1989)<br />
59. Goracci G, Cantatore G, Filanti G:<br />
Canal obturation. Analysis of 4 different techniques<br />
Dent Cadmos. 31;59(5), 11 (1991)<br />
60. Grieve AR, Parkholm JD:<br />
The sealing properties of root filling cements. Further studies.<br />
Br Dent J. 2;135(7), 327-31 (1973)<br />
61. Grossman LI:<br />
Physical properties of root canal cements.<br />
J Endod. 2(6), 166-75 (1976)<br />
62. Guelzow A, Stamm O, Martus P, Kielbassa AM:<br />
Comparative study of six rotary nickel-titanium systems and hand in-<br />
strumentation for root canal preparation.<br />
Int Endod J. 38(10), 743-52 (2005)<br />
63. Gutmann JL & Witherspoon DE:<br />
Obturation of the cleaned and shaped root canal system.<br />
Cohen S &Burns RC eds Pathways of the Pulp.7 th ed. St. Louis: Mosby,<br />
258-360 (1998)
LITERATURVERZEICHNIS 73<br />
64. Hata G, Kawazoe S, Toda T, Weine FS:<br />
Sealing ability of Thermafil with and without sealer.<br />
J Endod. 18(7), 322-6 (1992)<br />
65. Hay DI, Moreno EC:<br />
Differential adsorption and chemical affinities of proteins for apatitic sur-<br />
faces.<br />
J Dent Res. 58(Spec Issue B), 930-42 (1979)<br />
66. Hiraishi N, Papacchini F, Loushine RJ, Weller RN, Ferrari M, Pash-<br />
ley DH, Tay FR:<br />
Shear bond strength of Resilon to a methacrylate-based root canal sea-<br />
ler.<br />
Int Endod J. 38(10), 753-63 (2005)<br />
67. Holcomb JQ, Pitts DL, Nicholls JI:<br />
Further investigation of sprea<strong>der</strong> loads required to cause vertical root<br />
fracture during lateral condensation.<br />
J Endod. 13(6), 277-84 (1987)<br />
68. Hong J, Xia WW, Xiong HG:<br />
Analysis of the effect on the stress of root canal wall by vertical and lat-<br />
eral condensation procedures<br />
Shanghai Kou Qiang Yi Xue. 12(5), 359-61 (2003)<br />
69. Horning TG, Kessler JR:<br />
A comparison of three different root canal sealers when used to obtu-<br />
rate a moisture-contaminated root canal system.<br />
J Endod. 21(7), 354-7 (1995)<br />
70. Hosoya N, Nomura M, Yoshikubo A, Arai T, Nakamura J, Cox CF:<br />
Effect of canal drying methods on the apical seal.<br />
J Endod. 26(5), 292-4 (2000)
74 LITERATURVERZEICHNIS<br />
71. Hovland EJ, Dumsha TC:<br />
Leakage evaluation in vitro of the root canal sealer cement Sealapex.<br />
Int Endod J. 18(3), 179-82 (1985)<br />
72. Hübscher W, Barbakow F, Peters OA:<br />
Root canal preparation with Flexmaster: assessment of torque and<br />
force in relation to canal anatomy.<br />
Int Endod J. 36(12), 883-90 (2003)<br />
73. Huang TH, Yang JJ, Li H, Kao CT:<br />
The biocompatibility evaluation of epoxy resin-based root canal sealers<br />
in vitro.<br />
Biomaterials. 23(1), 77-83 (2002)<br />
74. Hülsmann M, Gressmann G, Schäfers F:<br />
A comparative study of root canal preparation using FlexMaster and<br />
HERO 642 rotary Ni-Ti instruments.<br />
Int Endod J. 36(5), 358-66 (2003)<br />
75. Hugh CL, Walton RE, Facer SR:<br />
Evaluation of intracanal sealer distribution with 5 different obturation<br />
techniques.<br />
Quintessence Int. 36(9), 721-9 (2005)<br />
76. Ingle JI, Beveridge EE, Glick DH, Weichman JA, Abou-Rass M:<br />
Mo<strong>der</strong>n endodontic therapy<br />
Ingle JI, Tainter JF,<br />
eds Endodontics. 3rd ed. 1985<br />
77. Ishley DJ, ElDeeb ME:<br />
An in vitro assessment of the quality of apical seal of thermomechani-<br />
cally obturated canals with and without sealer.<br />
J Endod. 9(6), 242-5 (1983)
LITERATURVERZEICHNIS 75<br />
78. Jacobson SM, von Fraunhofer JA:<br />
The investigation of microleakage in root canal therapy. An electro-<br />
chemical technique.<br />
Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 42(6), 817-23 (1976)<br />
79. Jia WT, Alpert B:<br />
Root canal filling material.<br />
United States Patent Application 2003011368<br />
US Patent & Trademark Office, June 19, 2003<br />
80. Jin SH, Jia WT:<br />
Self-curing system for endodontic sealant applications.<br />
United States Patent Application 20030134933<br />
US Patent & Trademark Office, July 17, 2003<br />
81. Karagöz-Küçükay I, Küçükay S, Bayirli G:<br />
Factors affecting apical leakage assessment.<br />
J Endod. 19(7), 362-5 (1993)<br />
82. Kardon BP, Kuttler S, Hardigan P, Dorn SO:<br />
An in vitro evaluation of the sealing ability of a new root-canal-<br />
obturation system.<br />
J Endod. 29(10), 658-61 (2003)<br />
83. Kayaoglu G, Erten H, Alaçam T, Ørstavik D:<br />
Short-term antibacterial activity of root canal sealers towards Entero-<br />
coccus faecalis.<br />
Int Endod J. 38(7), 483-8 (2005)<br />
84. Keane KM, Harrington GW:<br />
The use of a chloroform-softened Gutta-percha master cone and its ef-<br />
fect on the apical seal.<br />
J Endod. 10(2), 57-63 (1984)
76 LITERATURVERZEICHNIS<br />
85. Kennedy WA, Walker WA, Gough RW:<br />
Smear layer removal effects on apical leakage.<br />
J Endod. 12(1), 21-7 (1986)<br />
86. Kersten HW, Moorer WR:<br />
Particles and molecules in endodontic leakage.<br />
Int Endod J. 22(3), 118-24 (1989)<br />
87. Khayat A, Lee SJ, Torabinejad M:<br />
Human saliva penetration of coronally unsealed obturated root canals.<br />
J Endod. 19(9), 458-61 (1993)<br />
88. Kontakiotis EG, Wu MK, Wesselink PR:<br />
Effect of sealer thickness on long-term sealing ability: a 2-year follow-up<br />
study.<br />
Int Endod J. 30(5), 307-12 (1997)<br />
89. Kouvas V, Liolios E, Vassiliadis L, Parissis-Messimeris S, Bout-<br />
sioukis A:<br />
Influence of smear layer on depth of penetration of three endodontic<br />
sealers: an SEM study.<br />
Endod Dent Traumatol. 14(4), 191-5 (1998)<br />
90. Kuhre AN, Kessler JR:<br />
Effect of moisture on the apical seal of laterally condensed gutta-<br />
percha.<br />
J Endod. 19(6), 277-80 (1993)<br />
91. Lee KW, Williams MC, Camps JJ, Pashley DH:<br />
Adhesion of endodontic sealers to dentin and gutta-percha.<br />
J Endod. 28(10), 684-8 (2002)
LITERATURVERZEICHNIS 77<br />
92. Leyhausen G, Heil J, Reifferscheid G, Waldmann P, Geurtsen W:<br />
Genotoxicity and cytotoxicity of the epoxy resin-based root canal sealer<br />
AH plus.<br />
J Endod. 25(2), 109-13 (1999)<br />
93. Limkangwalmongkol S, Abbott PV, Sandler AB:<br />
Apical dye penetration with four root canal sealers and gutta-percha us-<br />
ing longitudinal sectioning.<br />
J Endod. 18(11), 535-9 (1992)<br />
94. Limkangwalmongkol S, Burtscher P, Abbott PV, Sandler AB, Bis-<br />
hop BM:<br />
A comparative study of the apical leakage of four root canal sealers and<br />
laterally condensed gutta-percha.<br />
J Endod. 17(10), 495-9 (1991)<br />
95. Lipski M:<br />
In vitro infrared thermographic assessment of root surface temperatures<br />
generated by high-temperature thermoplasticized injectable gutta-<br />
percha obturation technique.<br />
J Endod. 32(5), 438-41 (2006)<br />
96. Loel DA:<br />
Use of acid cleanser in endodontic therapy.<br />
J Am Dent Assoc. 90(1), 148-51 (1975)<br />
97. Lussi A, Imwinkelried S, Stich H:<br />
Obturation of root canals with different sealers using non-<br />
instrumentation technology.<br />
Int Endod J. 32(1), 17-23 (1999)
78 LITERATURVERZEICHNIS<br />
98. Machado-Silveiro LF, González-López S, González-Rodríguez MP:<br />
Decalcification of root canal dentine by citric acid, EDTA and sodium ci-<br />
trate.<br />
Int Endod J. 37(6), 365-9 (2004)<br />
99. Madison S, Krell KV:<br />
Comparison of ethylenediamine tetraacetic acid and sodium hypochlo-<br />
rite on the apical seal of endodontically treated teeth.<br />
J Endod. 10(10), 499-503 (1984)<br />
100. Marshall FJ, Massler M:<br />
The sealing of pulpless teeth evaluated with radioisotopes.<br />
J Dent Med. 16, 172-84 (1961)<br />
101. Matloff IR, Jensen JR, Singer L, Tabibi A:<br />
A comparison of methods used in root canal sealability studies.<br />
Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 53(2), 203-8 (1982)<br />
102. McComb D, Smith DC:<br />
A preliminary scanning electron microscopic study of root canals after<br />
endodontic procedures.<br />
J Endod. 1(7), 238-42 (1975)<br />
103. McMichen FR, Pearson G, Rahbaran S, Gulabivala K:<br />
A comparative study of selected physical properties of five root-canal<br />
sealers.<br />
Int Endod J. 36(9), 629-35 (2003)<br />
104. Medina N, Valle G, Kuttler S, Namerow K:<br />
Comparison of the sealing ability of a new cold flowable gutta-percha<br />
system and conventional obturation techniques<br />
J Endod. 32, 236 Abstract OR 12 (2006)
LITERATURVERZEICHNIS 79<br />
105. Merret SJ, Bryant ST, Drummer PM:<br />
Comparison of the shaping ability of RaCe and FlexMaster rotary nick-<br />
el-titanium systems in simulated canals.<br />
J Endod. 32(10), 960-2 (2006)<br />
106. Michaïlesco PM, Valcarcel J, Grieve AR, Levallois B, Lerner D:<br />
Bacterial leakage in endodontics: an improved method for quantifica-<br />
tion.<br />
J Endod. 22(10), 535-9 (1996)<br />
107. Michanowicz A, Czonstkowsky M:<br />
Sealing properties of an injection-thermoplasticized low-temperature (70<br />
degrees C) Gutta-percha: a preliminary study.<br />
J Endod. 10(12), 563-6 (1984)<br />
108. Miletić I, Anić I, Pezelj-Ribarić S, Jukić S:<br />
Leakage of five root canal sealers.<br />
Int Endod J. 32(5), 415-8 (1999)<br />
109. Monticelli F, Sadek FT, Schuster GS, Volkmann KR, Looney SW,<br />
Ferrari M, Toledano M, Pashley DH, Tay FR:<br />
Efficacy of two contemporary single-cone filling techniques in prevent-<br />
ing bacterial leakage.<br />
J Endod. 33(3), 310-3 (2007)<br />
110. Moreno EC, Kresak M, Zahradnik RT:<br />
Physicochemical aspects of fluoride-apatite systems relevant to the<br />
study of dental caries.<br />
Caries Res.;11 Suppl 1, 142-71 (1977)<br />
111. Mutal L, Gani O:<br />
Presence of pores and vacuoles in set endodontic sealers.<br />
Int Endod J. 38(10), 690-6 (2005)
80 LITERATURVERZEICHNIS<br />
112. Nakabayashi N:<br />
Bonding mechanism of resins and the tooth<br />
Kokubyo Gakkai Zasshi. 49(2), 410 (1982)<br />
113. Nakabayashi N, Kojima K, Masuhara E:<br />
The promotion of adhesion by the infiltration of monomers into tooth<br />
substrates.<br />
J Biomed Mater Res. 16(3), 265-73 (1982)<br />
114. Negm MM:<br />
The effect of human blood on the sealing ability of root canal sealers:<br />
an in vitro study.<br />
Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 67(4), 449-52 (1989)<br />
115. Nguyen NT:<br />
Obturation oft he root canal system.<br />
Cohen S. Burns RC, eds. Pathways of the Pulp,3 rd edn.<br />
St. Louis:CV MosbyCo, 205-99 (1984)<br />
116. O'Brien WJ, Craig RG, Peyton FA:<br />
Capillary penetration aro<strong>und</strong> a hydrophobic filling material.<br />
J Prosthet Dent. 19(4), 399-405 (1968)<br />
117. Oliver CM, Abbott PV:<br />
Entrapped air and its effects on dye penetration of voids<br />
Endod Dent Traumatol. 7(3), 135-8 (1991)
LITERATURVERZEICHNIS 81<br />
118. Onay EO, Ungor M, Orucoglu H:<br />
An in vitro evaluation of the apical sealing ability of a new resin-based<br />
root canal obturation system.<br />
J Endod. 32(10), 976-8 (2006)<br />
119. Ørstavik D:<br />
Physical properties of root canal sealers: measurement of flow, working<br />
time, and compressive strength.<br />
Int Endod J. 16(3), 99-107 (1983)<br />
120. Ørstavik D, Nordahl I, Tibballs JE:<br />
Dimensional change following setting of root canal sealer materials.<br />
Dent Mater. 17(6), 512-9 (2001)<br />
121. Pallarés A, Faus V, Glickman GN:<br />
The adaption of mechanically softened gutta-percha to the canal walls<br />
in the presence or absence of smear layer: a Scanning electron micro-<br />
scopic study.<br />
Int Endod J. 28(5), 266-9 (1995)<br />
122. Pashley DH:<br />
Smear layer: physiological consi<strong>der</strong>ations.<br />
Oper Dent Suppl. 3, 13-29 (1984)<br />
123. Pashley DH:<br />
Clinical consi<strong>der</strong>ations of microleakage.<br />
J Endod. 16(2), 70-77 (1990)<br />
124. Pashley EL, Birdsong NL, Bowman K, Pashley DH:<br />
Cytotoxic effects of NaOCl on vital tissue.<br />
J Endod. 11(12), 525-8 (1985)
82 LITERATURVERZEICHNIS<br />
125. Pereira PN, Okuda M, Sano H, Yoshikawa T, Burrow MF, Tagami J:<br />
Effect of intrinsic wetness and regional difference on dentin bond<br />
strength.<br />
Dent Mater. 15(1), 46-53 (1999)<br />
126. Pérez-Heredia M, Ferrer-Luque CM, González-Rodríguez MP:<br />
The effectiveness of different acid irrigating solutions in root canal<br />
cleaning after hand and rotary instrumentation.<br />
J Endod. 32(10), 993-7 (2006)<br />
127. Peters D.D:<br />
Two-year in vitro solubility of four gutta-percha sealer obturation tech-<br />
niques<br />
J Endod. 12, 139-145 (1986)<br />
128. Petschelt A:<br />
Drying of root canals<br />
Dtsch Zahnarztl Z. 45(4), 222-6 (1990)<br />
129. Pitt Ford TR:<br />
The leakage of root fillings using glass ionomer cement and other mate-<br />
rials.<br />
Br Dent J. 1;146(9), 273-8 (1979)<br />
130. Pollard BK, Weller RN, Kulild JC:<br />
Standardized technique for linear dye leakage studies: immediate ver-<br />
sus delayed immersion times.<br />
Int Endod J. 23(5), 250-3 (1990)<br />
131. Pommel L, Camps J:<br />
Effects of pressure and measurement time on the fluid filtration method<br />
in endodontics<br />
J Endod. 27(4), 256-8 (2001)
LITERATURVERZEICHNIS 83<br />
132. Pommel L, Jacquot B, Camps J:<br />
Lack of correlation among three methods for evaluation of apical lea-<br />
kage.<br />
J Endod. 27(5), 347-50 (2001)<br />
133. Rapisarda E, Bonaccorso A, Tripi TR:<br />
Evaluation of two root canal preparation and obturation methods: the<br />
Mc Spadden method and the use of ProFile-Thermafil<br />
Minerva Stomatol. 48(1-2), 29-38 (1999)<br />
134. Roda RS, Gutmann JL:<br />
Reliability of reduced air pressure methods used to assess the apical<br />
seal.<br />
Int Endod J. 28(3), 154-62 (1995)<br />
135. Roggendorf MJ, Ebert J, Petschelt A, Frankenberger R:<br />
Influence of moisture on the apical seal of root canal fillings with five dif-<br />
ferent types of sealer.<br />
J Endod. 33(1), 31-3 (2007)<br />
136. Ruddle CJ:<br />
New directions in endodontics. Interview.<br />
Dent Today. 21(2), 74-81 (2002)<br />
137. Russin TP, Zardiackas LD, Rea<strong>der</strong> A, Menke RA:<br />
Apical seals obtained with laterally condensed, chloroform-softened gut-<br />
ta-percha and laterally condensed gutta-percha and Grossman's sealer.<br />
J Endod. 6(8), 678-82 (1980)<br />
138. Rutberg M, Spångberg E, Spångberg L:<br />
Evaluation of enhanced vascular permeability of endodontic medica-<br />
ments in vivo.<br />
J Endod. 3(9), 347-51 (1977)
84 LITERATURVERZEICHNIS<br />
139. Scelza MF, Teixeira AM, Scelza P:<br />
Decalcifying effect of EDTA-T, 10% citric acid, and 17% EDTA on root<br />
canal dentin.<br />
Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 95(2), 234-6 (2003)<br />
140. Schäfer E, Lohmann D:<br />
Efficiency of rotary nickel-titanium FlexMaster instruments compared<br />
with stainless steel hand K-Flexofile-Part 2. Cleaning effectiveness and<br />
instrumentation results in severely curved root canals of extracted teeth.<br />
Int Endod J. 35(6), 514-21 (2002)<br />
141. Schäfer E, Oitzinger M:<br />
Cutting efficiency of five types of rotary nickel-titanium instruments.<br />
J Endod. 34(2), 198-200 (2008)<br />
142. Schäfer E, Zandbiglari T:<br />
Solubility of root-canal sealers in water and artificial saliva.<br />
Int Endod J. 36(10), 660-9 (2003)<br />
143. Schil<strong>der</strong> H:<br />
Filling root canals in three dimensions.<br />
Dent Clin North Am. Nov, 723-44 (1967)<br />
144. Schirrmeister FJ, Strohl C, Altenburger MJ, Wrbas KT, Hellwig E:<br />
Shaping ability and safety of five different rotary nickel-titanium instru-<br />
ments compared with stainless steel hand instrumentation in simulated<br />
curved root canals.<br />
Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 101(6), 807-13<br />
(2006)<br />
145. Scott AC, Vire DE, Swanson R:<br />
An evaluation of the Thermafil endodontic obturation technique.<br />
J Endod. 18(7), 340-3 (1992)
LITERATURVERZEICHNIS 85<br />
146. Sen BH, Pişkin B, Baran N:<br />
The effect of tubular penetration of root canal sealers on dye microlea-<br />
kage.<br />
Int Endod J. 29(1), 23-8 (1996)<br />
147. Sen BH; Wesselink PR, Türkün M:<br />
The smear layer: a phenomenon in root canal therapy.<br />
Int Endod J. 28(3), 141-8 (1995)<br />
148. Serper A, Calt S, Dogan AL, Guc D, Ozçelik B, Kuraner T:<br />
Comparison of the cytotoxic effects and smear layer removing capacity<br />
of oxidative potential water, NaOCl and EDTA.<br />
J Oral Sci. 43(4), 233-8 (2001)<br />
149. Shahravan A, Haghdoost AA, Adl A, Rahimi H, Shadifar F:<br />
Effect of smear layer on sealing ability of canal obturation: a systematic<br />
review and meta-analysis.<br />
J Endod. 33(2), 96-105 (2007)<br />
150. Shahi S, Yavari HR, Rahimi S, Reyhani MF, Kamarroosta Z,<br />
Abdolrahimi M:<br />
A comparative scanning electron microscopic study of the effect of<br />
three different rotary instruments on smear layer formation.<br />
J Oral Sci 51(1), 55-60 (2009)<br />
151. Shipper G, Ørstavik D, Teixeira FB, Trope M:<br />
An evaluation of microbial leakage in roots filled with a thermoplastic<br />
synthetic polymer-based root canal filling material (Resilon).<br />
J Endod. 30(5), 342-7 (2004)<br />
152. Silver GK, Love RM, Purton DG:<br />
Comparison of two vertical condensation obturation techniques: Touch<br />
'n Heat modified and System B<br />
Int Endod J. 32(4), 287-95 (1999)
86 LITERATURVERZEICHNIS<br />
153. Siqueira JF Jr, Rôças IN, Favieri A, Lima KC:<br />
Chemomechanical reduction of the bacterial population in the root canal<br />
after instrumentation and irrigation with 1%, 2.5%, and 5.25% sodium<br />
hypochlorite.<br />
J Endod. 26(6), 331-4 (2000)<br />
154. Skinner RL, Himel VT:<br />
The sealing ability of injection-molded thermoplasticized gutta-percha<br />
with and without the use of sealers.<br />
J Endod. 13(7), 315-7 (1987)<br />
155. Spångberg LS, Acierno TG, Yongbum Cha B:<br />
Influence of entrapped air on the accuracy of leakage studies using dye<br />
penetration methods.<br />
J Endod. 15(11), 548-51 (1989)<br />
156. Stevens RW, Strother JM, McClanahan SB:<br />
Leakage and sealer penetration in smear-free dentin after a final rinse<br />
with 95% ethanol.<br />
J Endod. 32(8), 785-8 (2006)<br />
157. Suh BI, Feng L, Pashley DH, Tay FR:<br />
Factors contributing to the incompatibility between simplified-step adhe-<br />
sives and chemically-cured or dual-cured composites. Part III. Effect of<br />
acidic resin monomers.<br />
J Adhes Dent. ;5(4), 267-82 (2003)<br />
158. Szeremeta-Browar TL, VanCura JE, Zaki AE:<br />
A comparison of the sealing properties of different retrograde tech-<br />
niques: an autoradiographic study.<br />
Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 59(1), 82-7 (1985)
LITERATURVERZEICHNIS 87<br />
159. Tagami J, Tao L, Pashley DH:<br />
Correlation among dentin depth, permeability, and bond strength of ad-<br />
hesive resins.<br />
Dent Mater. 6(1), 45-50 (1990)<br />
160. Tagger M, Tamse A, Katz A, Korzen BH:<br />
Evaluation of the apical seal produced by a hybrid root canal filling me-<br />
thod, combining lateral condensation and thermatic compaction.<br />
J Endod. 10(7), 299-303 (1984)<br />
161. Tagger M, Tamse A, Katz A, Tagger E:<br />
An improved method of three-dimensional study of apical leakage.<br />
Quintessence Int Dent Dig. 14(10), 981-98 (1983)<br />
162. Tamse A, Katz A, Kablan F:<br />
Comparison of apical leakage shown by four different dyes with two<br />
evaluating methods.<br />
Int Endod J. 31(5), 333-7 (1998)<br />
163. Tao L, Pashley DH:<br />
Shear bond strengths to dentin: effects of surface treatments, depth and<br />
position.<br />
Dent Mater. 4(6), 371-8 (1988)<br />
164. Tay FR, Loushine RJ, Weller RN, Kimbrough WF, Pashley DH, Mak<br />
YF, Lai CN, Raina R, Williams MC:<br />
Ultrastructural evaluation of the apical seal in roots filled with a polyca-<br />
prolactone-based root canal filling material.<br />
J Endod. 31(7), 514-9 (2005)
88 LITERATURVERZEICHNIS<br />
165. Tay FR, Pashley DH, Yiu CK, Yau JY, Yiu-fai M, Loushine RJ, Wel-<br />
ler RN, Kimbrough WF, King NM:<br />
Susceptibility of a polycaprolactone-based root canal filling material to<br />
degradation. II. Gravimetric evaluation of enzymatic hydrolysis.<br />
J Endod. 31(10), 737-41 (2005)<br />
166. Taylor JK, Jeansonne BG, Lemon RR:<br />
Coronal leakage: effects of smear layer, obturation technique, and sea-<br />
ler.<br />
J Endod. 23(8), 508-12 (1997)<br />
167. Teixeira FB, Teixeira EC, Thompson JY, Trope M:<br />
Fracture resistance of roots endodontically treated with a new resin fill-<br />
ing material.<br />
J Am Dent Assoc. 135(5), 646-52 (2004)<br />
168. Timpawat S, Vongsavan N, Messer HH:<br />
Effect of removal of the smear layer on apical microleakage<br />
J Endod. 27(5), 351-3 (2001)<br />
169. Thirawat J, Edm<strong>und</strong>s DH:<br />
Sealing ability of materials used as retrograde root fillings in endodontic<br />
surgery.<br />
Int Endod J. 22(6), 295-8 (1989)<br />
170. Torabinejad M, Ung B, Kettering JD:<br />
In vitro bacterial penetration of coronally unsealed endodontically<br />
treated teeth.<br />
J Endod. 16(12), 566-9 (1990)
LITERATURVERZEICHNIS 89<br />
171. Trope M, Chow E, Nissan R:<br />
In vitro endotoxin penetration of coronally unsealed endodontically<br />
treated teeth.<br />
Endod Dent Traumatol. 11(2), 90-4 (1995)<br />
172. Ungor M, Onay EO, Orucoglu H:<br />
Push-out bond strengths: the Epiphany-Resilon endodontic obturation<br />
system compared with different pairings of Epiphany, Resilon, AH Plus<br />
and gutta-percha.<br />
Int Endod J. 39(8), 643-7 (2006)<br />
173. Van Meerbeek B, De Munck J, Yoshida Y, Inoue S, Vargas M, Vijay<br />
P, Van Landuyt K, Lambrechts P, Vanherle G:<br />
Buonocore memorial lecture. Adhesion to enamel and dentin: current<br />
status and future challenges<br />
Oper Dent. 28(3), 215-35 (2003)<br />
174. Vivacqua-Gomes N, Ferraz CC, Gomes BP, Zaia AA, Teixeira FB,<br />
Souza-Filho FJ:<br />
Influence of irrigants on the coronal microleakage of laterally condensed<br />
gutta-percha root fillings.<br />
Int Endod J. 35(9), 791-5 (2002)<br />
175. Wainwright WW:<br />
Enamel penetration by radioactive salts of zinc, calcium, silver, pluto-<br />
nium, palladium and copper.<br />
J Am Dent Assoc. 43(6), 664-84 (1951)<br />
176. Weiger R, Brückner M, ElAyouti A, Löst C:<br />
Preparation of curved root canals with rotary FlexMaster instruments<br />
compared to Lightspeed instruments and NiTi hand files.<br />
Int Endod J 36(7), 483-90 (2003)
90 LITERATURVERZEICHNIS<br />
177. Weine FS:<br />
Endodontic Therapy 3rd ed St.Louis:CV Mosby, 176, 2-19<br />
178. White RR, Goldman M, Lin PS:<br />
The influence of the smeared layer upon dentinal tubule penetration by<br />
plastic filling materials.<br />
J Endod. 10(12), 558-62 (1984)<br />
179. Whitten BH, Gardiner DL, Jeansonne BG, Lemon RR:<br />
Current trends in endodontic treatment: report of a national survey.<br />
J Am Dent Assoc. 127(9), 1333-41 (1996)<br />
180. Whitworth JM, Baco L:<br />
Coronal leakage of sealer-only backfill: an in vitro evaluation.<br />
J Endod. 31(4), 280-2 (2005)<br />
181. Wiener B.H., Schil<strong>der</strong> H:<br />
A comparative study of important physical properties of various root ca-<br />
nal sealers. Part II. Evaluation of dimensional changes<br />
Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 32, 928-937 (1971)<br />
182. Wilcox LR, Wiemann AH:<br />
Effect of a final alcohol rinse on sealer coverage of obturated root can-<br />
als<br />
J Endod. 21(5), 256-8 (1995)<br />
183. Wilson A.D., Batchelor F:<br />
Zinc oxide-eugenol cements. Part II. Study of erosion and<br />
disintegration<br />
J Dent Res. 49, 593-598 (1970).<br />
184. Wu MK, De Gee AJ, Wesselink PR:<br />
Fluid transport and dye penetration along root canal fillings.<br />
Int Endod J. 27(5), 233-8 (1994)
LITERATURVERZEICHNIS 91<br />
185. Wu MK, De Gee AJ, Wesselink PR:<br />
Leakage of four root canal sealers at different thickness.<br />
Int Endod J. 27(6), 304-8 (1994)<br />
186. Wu MK, Fan B, Wesselink PR:<br />
Diminished leakage along root canals filled with gutta-percha without<br />
sealer over time: a laboratory study.<br />
Int Endod J. 33(2), 121-5 (2000)<br />
187. Wu MK, Özok AR, Wesselink PR:<br />
Sealer distribution in root canals obturated by three techniques.<br />
Int Endod J. 33(4), 340-5 (2000)<br />
188. Wu MK, Tigos E, Wesselink PR:<br />
An 18-month longitudinal study on a new silicon-based sealer, RSA<br />
RoekoSeal: a leakage study in vitro.<br />
Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 94(4), 499-502<br />
(2002)<br />
189. Wu MK, van <strong>der</strong> Sluis LW, Ardila CN, Wesselink PR:<br />
Fluid movement along the coronal two-thirds of root fillings placed by<br />
three different gutta-percha techniques.<br />
Int Endod J. Aug;36(8):533-40.(2003)<br />
190. Wu MK, van <strong>der</strong> Sluis LW, Wesselink PR:<br />
A 1-year follow-up study on leakage of single-cone fillings with Roe-<br />
koRSA sealer.<br />
Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 101(5), 662-7<br />
(2006)<br />
191. Wu MK, Wesselink PR:<br />
Endodontic leakage studies reconsi<strong>der</strong>ed. Part I. Methodology, applica-<br />
tion and relevance.<br />
Int Endod J. 26(1), 37-43 (1993)
92 LITERATURVERZEICHNIS<br />
192. Wu MK, Wesselink PR, Boersma J:<br />
A 1-year follow-up study on leakage of four root canal sealers at differ-<br />
ent thicknesses.<br />
Int Endod J. 28(4), 185-9 (1995)<br />
193. Xu Q, Fan MW, Fan B, Cheung GS, Hu HL:<br />
A new quantitative method using glucose for analysis of endodontic<br />
leakage.<br />
Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 99(1), 107-11<br />
(2005)<br />
194. Yamada RS, Armas A, Goldman M, Lin PS:<br />
A scanning electron microscopic comparison of a high volume final<br />
flush with several irrigating solutions: Part 3.<br />
J Endod. 9(4), 137-42 (1983)<br />
195. Yamaguchi M, Yoshida K, Suzuki R, Nakamura H:<br />
Root canal irrigation with citric acid solution.<br />
J Endod. 22(1), 27-9 (1996)
ANHANG 93<br />
9. Anhang<br />
Geräte <strong>und</strong> Materialien<br />
AH Plus Jet ® Dentsply DeTrey<br />
LOT 0506002950<br />
Anmischblock Pentron Clinical Technologies<br />
Anmischspatel Hu-Friedy<br />
AppliBrush ® Pentron Clinical Technologies<br />
Aqua dest. Wissenschaftliches Labor <strong>der</strong> <strong>Zahnklinik</strong> 1,<br />
Universitätsklinikum Erlangen, Deutschland<br />
Choramin-T-Lösung 0,5% Apotheke des Universitätsklinikums<br />
Erlangen, Deutschland<br />
C-Pilot files VDW GmbH, München<br />
Diamantenschleifer Hager & Meisinger GmbH<br />
Neuss, Deutschland<br />
Druckluft KaVo FineAir, Kavo Biberach, Germany<br />
Endo-Kanüle Transcoject, Neumünster, Deutschland<br />
Endo-Stepper S.E.T., Olching, Deutschland
94 ANHANG<br />
Epiphany ® root canal sealer Pentron Clinical Technologies<br />
LOT 141917<br />
Epiphany ® Primer Pentron Clinical Technologies<br />
LOT 136300<br />
Epoxidharz Biresin ® G27, Sika BV, Utrecht, NL<br />
Ethanol-Lösung 70% Apotheke des Universitätsklinikums<br />
Erlangen, Deutschland<br />
Feuchte Kammer Memmert GmbH<br />
Memmert B 80 Schwabach, Deutschland<br />
FibreFill ® R.C.S. Pentron Clinical Technologies LLC<br />
LOT140228<br />
FibreFill ® Primer A Pentron Clinical Technologies LLC<br />
LOT 111772<br />
FibreFill ® Primer B Pentron Clinical Technologies LLC<br />
LOT 137232A<br />
FlexMaster ® VDW Dental,<br />
Frontzahnscaler Hu-Friedy<br />
München, Deutschland<br />
Leimen, Deutschland<br />
Glasplatten VDW GmbH
ANHANG 95<br />
GuttaFlow ® Coltène Whaledent<br />
LOT 114146<br />
Guttapercha Primer H LOT S 17848-104<br />
Guttapercha Top Color Coltène Whaledent<br />
ISO 55 LOT 080346<br />
Hedström-Feilen ISO 08 VDW GmbH<br />
Heidemann-Spatel Hu-Friedy<br />
Leimen, Deutschland<br />
Innenlochsäge Roditi International<br />
Ketac Cem Maxicap 3M ESPE<br />
Hamburg, Deutschland<br />
LOT 206037<br />
Kugelstopfer Hu-Friedy<br />
Leimen, Deutschland<br />
K-Räumer ISO 10 VDW GmbH<br />
Messbank VDW GmbH<br />
Methylenblau-Lösung 5% Wissenschaftliches Labor <strong>der</strong> <strong>Zahnklinik</strong> 1,<br />
Nagellack Ellen Betrix ®<br />
Universitätsklinikum Erlangen, Deutschland
96 ANHANG<br />
Natriumhypochlorit-Lsg. 6% Apotheke des Univesitätsklinikums<br />
Erlangen, Deutschland<br />
Papierspitzen Top Color Coltène Whaledent, Langenau<br />
ISO 55 LOT 94284<br />
Polymerisationslampe KaVo GmbH<br />
Polylux II Biberbach, Deutschland<br />
Resilon-Spitzen ISO 55 Pentron Clinical Technologies<br />
Schaumstoffpellets Demedis<br />
München, Deutschland<br />
Spritzen 2 ml BD Discardit II, Fraga, Spanien<br />
Statistik-&Analyse-Software SPSS Inc., Chicago, IL, USA<br />
SPSS ® for Windows, Version 14.0<br />
Stereo-Lichtmikroskop Wild stereomicroscope, Leica Geosystems<br />
AG, Heerbrugg; Switzerland<br />
Trimmer Wassermann, Deutschland<br />
Winkelstück grün KaVo GmbH<br />
Biberach, Deutschland<br />
Winkelstück rot KaVo GmbH<br />
Biberach, Deutschland<br />
Zentrifuge Heraeus Christ GmbH, Osterode, Deutschland
ANHANG 97<br />
Varifuge ® K Osterode, Deutschland<br />
VivaPad ® Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein<br />
Zitronensäure-Lösung 40% Apotheke des Universitätsklinikums<br />
Erlangen, Deutschland
98 ANHANG<br />
Statistik<br />
Gruppenzugehörigkeit = AH+Dry<br />
Kolmogorov-Smirnov-Anpassungstest(c)<br />
N<br />
Parameter <strong>der</strong><br />
lineare<br />
Penetration<br />
10<br />
Normalverteilung(a,b)<br />
Mittelwert 2,000<br />
Standardabweichung<br />
1,1547<br />
Extremste Differenzen<br />
Absolut<br />
,307<br />
Positiv ,307<br />
Negativ -,207<br />
Kolmogorov-Smirnov-Z ,970<br />
Asymptotische Signifikanz (2-seitig)<br />
,303<br />
a Die zu testende Verteilung ist eine Normalverteilung.<br />
b <strong>Aus</strong> den Daten berechnet.<br />
c Gruppenzugehörigkeit = AH+Dry<br />
Gruppenzugehörigkeit = AH+Wet<br />
Kolmogorov-Smirnov-Anpassungstest(c)<br />
lineare<br />
Penetration<br />
N 10<br />
Parameter <strong>der</strong> Mittelwert<br />
Normalvertei-<br />
2,800<br />
lung(a,b)<br />
Standardabweichung<br />
2,6162<br />
Extremste Differenzen<br />
Absolut<br />
,420<br />
Positiv ,420<br />
Negativ -,246<br />
Kolmogorov-Smirnov-Z<br />
1,329<br />
Asymptotische Signifikanz (2-seitig)<br />
a Die zu testende Verteilung ist eine Normalverteilung.<br />
b <strong>Aus</strong> den Daten berechnet.<br />
c Gruppenzugehörigkeit = AH+Wet<br />
,059
ANHANG 99<br />
Gruppenzugehörigkeit = EpiDry<br />
Kolmogorov-Smirnov-Anpassungstest(c)<br />
lineare<br />
Penetration<br />
N 10<br />
Parameter <strong>der</strong> Mittelwert<br />
Normalvertei-<br />
4,300<br />
lung(a,b)<br />
Standardabweichung<br />
3,5606<br />
Extremste Differenzen<br />
Absolut<br />
,242<br />
Positiv ,242<br />
Negativ -,207<br />
Kolmogorov-Smirnov-Z ,767<br />
Asymptotische Signifikanz (2-seitig)<br />
,599<br />
a Die zu testende Verteilung ist eine Normalverteilung.<br />
b <strong>Aus</strong> den Daten berechnet.<br />
c Gruppenzugehörigkeit = EpiDry<br />
Gruppenzugehörigkeit = EpiWet<br />
Kolmogorov-Smirnov-Anpassungstest(c)<br />
lineare<br />
Penetration<br />
N 10<br />
Parameter <strong>der</strong> Mittelwert<br />
Normalvertei-<br />
3,900<br />
lung(a,b)<br />
Standardabweichung<br />
3,1429<br />
Extremste Differenzen<br />
Absolut<br />
,222<br />
Positiv ,222<br />
Negativ -,178<br />
Kolmogorov-Smirnov-Z ,702<br />
Asymptotische Signifikanz (2-seitig)<br />
,708<br />
a Die zu testende Verteilung ist eine Normalverteilung.<br />
b <strong>Aus</strong> den Daten berechnet.<br />
c Gruppenzugehörigkeit = EpiWet
100 ANHANG<br />
Gruppenzugehörigkeit = FibDry<br />
Kolmogorov-Smirnov-Anpassungstest(c)<br />
lineare<br />
Penetration<br />
N 10<br />
Parameter <strong>der</strong> Mittelwert<br />
Normalvertei-<br />
7,200<br />
lung(a,b)<br />
Standardabweichung<br />
1,7512<br />
Extremste Differenzen<br />
Absolut<br />
,176<br />
Positiv ,152<br />
Negativ -,176<br />
Kolmogorov-Smirnov-Z ,557<br />
Asymptotische Signifikanz (2-seitig)<br />
,916<br />
a Die zu testende Verteilung ist eine Normalverteilung.<br />
b <strong>Aus</strong> den Daten berechnet.<br />
c Gruppenzugehörigkeit = FibDry<br />
Gruppenzugehörigkeit = FibWet<br />
Kolmogorov-Smirnov-Anpassungstest(c)<br />
lineare<br />
Penetration<br />
N 10<br />
Parameter <strong>der</strong> Mittelwert<br />
Normalvertei-<br />
8,400<br />
lung(a,b)<br />
Standardabweichung<br />
,8433<br />
Extremste Differenzen<br />
Absolut<br />
,362<br />
Positiv ,238<br />
Negativ -,362<br />
Kolmogorov-Smirnov-Z 1,144<br />
Asymptotische Signifikanz (2-seitig)<br />
,146<br />
a Die zu testende Verteilung ist eine Normalverteilung.<br />
b <strong>Aus</strong> den Daten berechnet.<br />
c Gruppenzugehörigkeit = FibWet
ANHANG 101<br />
Gruppenzugehörigkeit = GFDry<br />
Kolmogorov-Smirnov-Anpassungstest(c)<br />
lineare<br />
Penetration<br />
N 10<br />
Parameter <strong>der</strong> Mittelwert<br />
Normalvertei-<br />
1,500<br />
lung(a,b)<br />
Standardabweichung<br />
,5270<br />
Extremste Differenzen<br />
Absolut<br />
,329<br />
Positiv ,329<br />
Negativ -,329<br />
Kolmogorov-Smirnov-Z 1,039<br />
Asymptotische Signifikanz (2-seitig)<br />
,230<br />
a Die zu testende Verteilung ist eine Normalverteilung.<br />
b <strong>Aus</strong> den Daten berechnet.<br />
c Gruppenzugehörigkeit = GFDry<br />
Gruppenzugehörigkeit = GFWet<br />
Kolmogorov-Smirnov-Anpassungstest(c)<br />
lineare<br />
Penetration<br />
N 10<br />
Parameter <strong>der</strong> Mittelwert<br />
Normalvertei-<br />
2,400<br />
lung(a,b)<br />
Standardabweichung<br />
2,1705<br />
Extremste Differenzen<br />
Absolut<br />
,341<br />
Positiv ,341<br />
Negativ -,259<br />
Kolmogorov-Smirnov-Z 1,077<br />
Asymptotische Signifikanz (2-seitig)<br />
,196<br />
a Die zu testende Verteilung ist eine Normalverteilung.<br />
b <strong>Aus</strong> den Daten berechnet.<br />
c Gruppenzugehörigkeit = GFWet
102 ANHANG<br />
Nichtparametrische Tests<br />
Sealer = AHPlus<br />
Kolmogorov-Smirnov-Anpassungstest(c)<br />
lineare<br />
Penetration<br />
N 20<br />
Parameter <strong>der</strong> Mittelwert<br />
Normalvertei-<br />
2,400<br />
lung(a,b)<br />
Standardabweichung<br />
2,0105<br />
Extremste Differenzen<br />
Absolut<br />
,279<br />
Positiv ,279<br />
Negativ -,243<br />
Kolmogorov-Smirnov-Z 1,247<br />
Asymptotische Signifikanz (2-seitig)<br />
,089<br />
a Die zu testende Verteilung ist eine Normalverteilung.<br />
b <strong>Aus</strong> den Daten berechnet.<br />
c Sealer = AHPlus<br />
Sealer = Epiphany<br />
Kolmogorov-Smirnov-Anpassungstest(c)<br />
lineare<br />
Penetration<br />
N 20<br />
Parameter <strong>der</strong> Mittelwert<br />
Normalvertei-<br />
4,100<br />
lung(a,b)<br />
Standardabweichung<br />
3,2751<br />
Extremste Differenzen<br />
Absolut<br />
,189<br />
Positiv ,189<br />
Negativ -,183<br />
Kolmogorov-Smirnov-Z ,847<br />
Asymptotische Signifikanz (2-seitig)<br />
,471<br />
a Die zu testende Verteilung ist eine Normalverteilung.<br />
b <strong>Aus</strong> den Daten berechnet.<br />
c Sealer = Epiphany
ANHANG 103<br />
Sealer = FibreFill<br />
Kolmogorov-Smirnov-Anpassungstest(c)<br />
lineare<br />
Penetration<br />
N 20<br />
Parameter <strong>der</strong> Mittelwert<br />
Normalvertei-<br />
7,800<br />
lung(a,b)<br />
Standardabweichung<br />
1,4726<br />
Extremste Differenzen<br />
Absolut<br />
,242<br />
Positiv ,208<br />
Negativ -,242<br />
Kolmogorov-Smirnov-Z 1,084<br />
Asymptotische Signifikanz (2-seitig)<br />
,190<br />
a Die zu testende Verteilung ist eine Normalverteilung.<br />
b <strong>Aus</strong> den Daten berechnet.<br />
c Sealer = FibreFill<br />
Sealer = GuttaFlow<br />
Kolmogorov-Smirnov-Anpassungstest(c)<br />
lineare<br />
Penetration<br />
N 20<br />
Parameter <strong>der</strong> Mittelwert<br />
Normalvertei-<br />
1,950<br />
lung(a,b)<br />
Standardabweichung<br />
1,6051<br />
Extremste Differenzen<br />
Absolut<br />
,338<br />
Positiv ,338<br />
Negativ -,277<br />
Kolmogorov-Smirnov-Z 1,510<br />
Asymptotische Signifikanz (2-seitig)<br />
,021<br />
a Die zu testende Verteilung ist eine Normalverteilung.<br />
b <strong>Aus</strong> den Daten berechnet.<br />
c Sealer = GuttaFlow
104 ANHANG<br />
Univariate Varianzanalyse<br />
Zwischensubjektfaktoren<br />
Wertelabel N<br />
Sealer 1 AHPlus 20<br />
2 Epiphany 20<br />
3 FibreFill 20<br />
4 GuttaFlow 20<br />
WKTrockng 1 dry 40<br />
2 wet 40<br />
Tests <strong>der</strong> Zwischensubjekteffekte<br />
Abhängige Variable: lineare Penetration<br />
Quadratsumme Mittel <strong>der</strong><br />
Quelle<br />
vom Typ III df Quadrate F Signifikanz<br />
Korrigiertes Modell<br />
439,188(a) 7 62,741 12,707 ,000<br />
Konstanter<br />
Term<br />
1320,313 1 1320,313 267,405 ,000<br />
sealer 423,938 3 141,313 28,620 ,000<br />
feucht 7,813 1 7,813 1,582 ,212<br />
sealer * feucht 7,438 3 2,479 ,502 ,682<br />
Fehler 355,500 72 4,938<br />
Gesamt 2115,000 80<br />
Korrigierte Gesamtvariation<br />
794,688 79<br />
a R-Quadrat = ,553 (korrigiertes R-Quadrat = ,509)
ANHANG 105<br />
T-Test<br />
Gruppenstatistiken<br />
lineare Penetration<br />
lineare<br />
Penetration<br />
Gruppenzugehörigkeit N Mittelwert Standardabweichung<br />
Standardfehler<br />
des Mittelwertes<br />
AH+Dry<br />
10 2,000 1,1547 ,3651<br />
AH+Wet 10 2,800 2,6162 ,8273<br />
Test bei unabhängigen Stichproben<br />
Gruppenstatistiken<br />
Gruppenzugehörigkeit N Mittelwert Standardabweichung<br />
Standardfehler des<br />
Mittelwertes<br />
lineare Penetration EpiDry 10 4,300 3,5606 1,1260<br />
lineare<br />
Penetration<br />
Varianzen<br />
sind<br />
gleich<br />
Varianzen<br />
sind nicht<br />
gleich<br />
Varianzen<br />
sind<br />
gleich<br />
Varianzen<br />
sind nicht<br />
gleich<br />
Test bei unabhängigen Stichproben<br />
Levene-Test <strong>der</strong><br />
Varianzgleichheit T-Test für die Mittelwertgleichheit<br />
Sig.<br />
Standard-<br />
95%<br />
Signifi(2-<br />
Mittlere fehler <strong>der</strong> Konfidenzintervall<br />
F kanz T df seitig) Differenz Differenz <strong>der</strong> Differenz<br />
EpiWet 10 3,900 3,1429 ,9939<br />
Levene-Test<br />
<strong>der</strong> Varianzgleichheit<br />
T-Test für die Mittelwertgleichheit<br />
F<br />
Signifikanz<br />
T df<br />
Sig.<br />
(2seitig)<br />
Mittlere<br />
Differenz <br />
Standardfehler<br />
<strong>der</strong><br />
Differenz<br />
Untere Obere<br />
2,467 ,134 -,885 18 ,388 -,8000 ,9043 -2,6999 1,0999<br />
-,885 12,378 ,393 -,8000 ,9043 -2,7637 1,1637<br />
95%<br />
Konfidenzintervall<br />
<strong>der</strong> Differenz<br />
Untere Obere<br />
,965 ,339 ,266 18 ,793 ,4000 1,5019 -2,7553 3,5553<br />
,266 17,727 ,793 ,4000 1,5019 -2,7588 3,5588
106 ANHANG<br />
Gruppenstatistiken<br />
Gruppenzugehörigkeit N Mittelwert Standardabweichung<br />
Standardfehler des<br />
Mittelwertes<br />
lineare Penetration FibDry 10 7,200 1,7512 ,5538<br />
lineare<br />
Penetration<br />
Varianzen<br />
sind<br />
gleich<br />
Varianzen<br />
sind nicht<br />
gleich<br />
Test bei unabhängigen Stichproben<br />
Gruppenstatistiken<br />
FibWet 10 8,400 ,8433 ,2667<br />
Levene-Test <strong>der</strong><br />
Varianzgleichheit T-Test für die Mittelwertgleichheit<br />
Sig.<br />
(2- Mittlere Standard-<br />
95%<br />
SignifiseiDiffefehler<br />
<strong>der</strong> Konfidenzintervall<br />
F kanz T df tig)renz Differenz <strong>der</strong> Differenz<br />
Untere Obere<br />
4,516 ,048 -1,952 18 ,067 -1,2000 ,6146 -2,4913 ,0913<br />
-1,952 12,961 ,073 -1,2000 ,6146 -2,5282 ,1282<br />
Gruppenzugehörigkeit N Mittelwert Standardabweichung<br />
Standardfehler<br />
des Mittelwertes<br />
lineare Penetration GFDry 10 1,500 ,5270 ,1667<br />
lineare<br />
Penetration <br />
Varianzen<br />
sind<br />
gleich<br />
Varianzen<br />
sind<br />
nicht<br />
gleich<br />
Test bei unabhängigen Stichproben<br />
GFWet 10 2,400 2,1705 ,6864<br />
Levene-Test <strong>der</strong><br />
Varianzgleichheit T-Test für die Mittelwertgleichheit<br />
Sig.<br />
StandardfehSignifi(2-<br />
Mittlere ler <strong>der</strong> Diffe-<br />
F kanz T df seitig) Differenz renz<br />
95%<br />
Konfidenzintervall<br />
<strong>der</strong> Differenz<br />
Untere Obere<br />
12,507 ,002 -1,274 18 ,219 -,9000 ,7063 -2,3839 ,5839<br />
-1,274 10,058 ,231 -,9000 ,7063 -2,4726 ,6726
ANHANG 107<br />
Gruppenstatistiken<br />
Gruppenzugehörigkeit N Mittelwert Standardabweichung<br />
Standardfehler<br />
des Mittelwertes<br />
lineare Penetration AH+Dry 10 2,000 1,1547 ,3651<br />
lineare<br />
Penetration <br />
Varianzen<br />
sind<br />
gleich<br />
Varianzen<br />
sind<br />
nicht<br />
gleich<br />
Test bei unabhängigen Stichproben<br />
Gruppenstatistiken<br />
EpiDry 10 4,300 3,5606 1,1260<br />
Levene-Test <strong>der</strong><br />
Varianzgleichheit T-Test für die Mittelwertgleichheit<br />
Sig.<br />
StandardfehSignifi(2-<br />
Mittlere ler <strong>der</strong> Diffe-<br />
F kanz T df seitig) Differenz renz<br />
95%<br />
Konfidenzintervall<br />
<strong>der</strong> Differenz<br />
Untere Obere<br />
25,850 ,000 -1,943 18 ,068 -2,3000 1,1837 -4,7868 ,1868<br />
-1,943 10,872 ,078 -2,3000 1,1837 -4,9090 ,3090<br />
Gruppenzugehörigkeit N Mittelwert Standardabweichung<br />
Standardfehler<br />
des Mittelwertes<br />
lineare Penetration AH+Dry 10 2,000 1,1547 ,3651<br />
lineare<br />
Penetration<br />
Varianzen<br />
sind<br />
gleich<br />
Varianzen<br />
sind nicht<br />
gleich<br />
Test bei unabhängigen Stichproben<br />
FibDry 10 7,200 1,7512 ,5538<br />
Levene-Test<br />
<strong>der</strong> Varianzgleichheit<br />
T-Test für die Mittelwertgleichheit<br />
F<br />
Signifikanz<br />
T df<br />
Sig.<br />
(2seitig)<br />
Mittlere<br />
Differenz <br />
Standardfehler<br />
<strong>der</strong><br />
Differenz<br />
95%<br />
Konfidenzintervall<br />
<strong>der</strong> Differenz<br />
Untere Obere<br />
1,440 ,246 -7,839 18 ,000 -5,2000 ,6633 -6,5936 -3,8064<br />
-7,839 15,582 ,000 -5,2000 ,6633 -6,6093 -3,7907
108 ANHANG<br />
Gruppenstatistiken<br />
Gruppenzugehörigkeit N Mittelwert Standardabweichung<br />
Standardfehler<br />
des Mittelwertes<br />
lineare Penetration AH+Dry 10 2,000 1,1547 ,3651<br />
lineare<br />
Penetration<br />
Varianzen<br />
sind<br />
gleich<br />
Varianzen<br />
sind nicht<br />
gleich<br />
Test bei unabhängigen Stichproben<br />
Gruppenstatistiken<br />
GFDry 10 1,500 ,5270 ,1667<br />
Levene-Test <strong>der</strong><br />
Varianzgleichheit T-Test für die Mittelwertgleichheit<br />
Sig.<br />
(2- Mittlere Standardfehler<br />
F Signifikanz T df seitig) Differenz <strong>der</strong> Differenz<br />
95%<br />
Konfidenzintervall<br />
<strong>der</strong> Differenz<br />
Untere Obere<br />
11,250 ,004 1,246 18 ,229 ,5000 ,4014 -,3433 1,3433<br />
1,246 12,594 ,236 ,5000 ,4014 -,3700 1,3700<br />
Gruppenzugehörigkeit N Mittelwert Standardabweichung<br />
Standardfehler des<br />
Mittelwertes<br />
lineare Penetration EpiDry 10 4,300 3,5606 1,1260<br />
lineare<br />
Penetration<br />
Varianzen<br />
sind<br />
gleich<br />
Varianzen<br />
sind nicht<br />
gleich<br />
Test bei unabhängigen Stichproben<br />
FibDry 10 7,200 1,7512 ,5538<br />
Levene-Test <strong>der</strong><br />
Varianzgleichheit T-Test für die Mittelwertgleichheit<br />
Sig.<br />
StandardfehSignifi(2-<br />
Mittlere ler <strong>der</strong> Diffe-<br />
F kanz T df seitig) Differenz renz<br />
95%<br />
Konfidenzintervall<br />
<strong>der</strong> Differenz<br />
Untere Obere<br />
12,533 ,002 -2,311 18 ,033 -2,9000 1,2548 -5,5362 -,2638<br />
-2,311 13,113 ,038 -2,9000 1,2548 -5,6084 -,1916
ANHANG 109<br />
Gruppenstatistiken<br />
Gruppenzugehörigkeit N Mittelwert Standardabweichung<br />
Standardfehler<br />
des Mittelwertes<br />
lineare Penetration EpiDry 10 4,300 3,5606 1,1260<br />
lineare<br />
Penetration<br />
Varianzen<br />
sind<br />
gleich<br />
Varianzen<br />
sind nicht<br />
gleich<br />
Test bei unabhängigen Stichproben<br />
Gruppenstatistiken<br />
lineare<br />
Penetration<br />
lineare<br />
Penetration<br />
Varianzen<br />
sind<br />
gleich<br />
Varianzen<br />
sind nicht<br />
gleich<br />
Test bei unabhängigen Stichproben<br />
GFDry 10 1,500 ,5270 ,1667<br />
Levene-Test <strong>der</strong><br />
Varianzgleichheit T-Test für die Mittelwertgleichheit<br />
Sig.<br />
95%<br />
(2- Mittlere Standardfehler Konfidenzintervall<br />
F Signifikanz T df seitig) Differenz <strong>der</strong> Differenz <strong>der</strong> Differenz<br />
Untere Obere<br />
44,707 ,000 2,460 18 ,024 2,8000 1,1382 ,4087 5,1913<br />
2,460 9,394 ,035 2,8000 1,1382 ,2415 5,3585<br />
Gruppenzugehörigkeit N Mittelwert Standardabweichung<br />
Standardfehler<br />
des Mittelwertes<br />
FibDry<br />
10 7,200 1,7512 ,5538<br />
GFDry 10 1,500 ,5270 ,1667<br />
Levene-Test <strong>der</strong><br />
Varianzgleichheit T-Test für die Mittelwertgleichheit<br />
Sig.<br />
(2- Mittlere Standardfehler<br />
F Signifikanz T df seitig) Differenz <strong>der</strong> Differenz<br />
95%<br />
Konfidenzintervall<br />
<strong>der</strong> Differenz<br />
Untere Obere<br />
9,113 ,007 9,856 18 ,000 5,7000 ,5783 4,4850 6,9150<br />
9,856 10,617 ,000 5,7000 ,5783 4,4215 6,9785
110 ANHANG<br />
Gruppenstatistiken<br />
Gruppenzugehörigkeit N Mittelwert Standardabweichung<br />
Standardfehler<br />
des Mittelwertes<br />
lineare Penetration AH+Wet 10 2,800 2,6162 ,8273<br />
lineare<br />
Penetration<br />
Varianzen<br />
sind<br />
gleich<br />
Varianzen<br />
sind nicht<br />
gleich<br />
Test bei unabhängigen Stichproben<br />
Gruppenstatistiken<br />
EpiWet 10 3,900 3,1429 ,9939<br />
Levene-Test<br />
<strong>der</strong> Varianzgleichheit<br />
T-Test für die Mittelwertgleichheit<br />
F<br />
Signifikanz<br />
T df<br />
Sig.<br />
(2seitig)<br />
Mittlere<br />
Differenz<br />
Standardfehler<br />
<strong>der</strong><br />
Differenz<br />
95% Konfidenzintervall<br />
<strong>der</strong> Differenz<br />
Untere Obere<br />
,657 ,428 -,851 18 ,406 -1,1000 1,2931 -3,8168 1,6168<br />
-,851 17,427 ,407 -1,1000 1,2931 -3,8232 1,6232<br />
Gruppenzugehörigkeit N Mittelwert Standardabweichung<br />
Standardfehler<br />
des Mittelwertes<br />
lineare Penetration AH+Wet 10 2,800 2,6162 ,8273<br />
lineare<br />
Penetration<br />
Varianzen<br />
sind<br />
gleich<br />
FibWet<br />
Varianzen<br />
sind<br />
nicht<br />
gleich<br />
Test bei unabhängigen Stichproben<br />
10 8,400 ,8433 ,2667<br />
Levene-Test<br />
<strong>der</strong> Varianzgleichheit<br />
T-Test für die Mittelwertgleichheit<br />
F<br />
Signifikanz<br />
T df<br />
Sig.<br />
(2seitig)<br />
Mittlere<br />
Differenz<br />
Standardfehler<br />
<strong>der</strong><br />
Differenz<br />
95%<br />
Konfidenzintervall<br />
<strong>der</strong> Differenz<br />
Untere Obere<br />
4,408 ,050 -6,443 18 ,000 -5,6000 ,8692 -7,4262 -3,7738<br />
-6,443 10,850 ,000 -5,6000 ,8692 -7,5164 -3,6836
ANHANG 111<br />
Abkürzungen<br />
Abb. Abbildung<br />
ANOVA analysis of variance<br />
AH AHPlus<br />
BisGMA Bisphenyl-A-Glycidyl-Methacrylat<br />
Cr-Ni-Edelstahl Chrom-Nickel-Edelstahl<br />
°C Grad Celcius<br />
d.h. das heißt<br />
EDTA Ethylendiamintetraacetat<br />
EP Epiphany<br />
et al (lat.) et alii /et aliae/ et alia<br />
FF Fibrefil ®<br />
g Gramm<br />
GF GuttaFlow ®<br />
GT Rotary Greater Taper Rotary<br />
h St<strong>und</strong>e(n)<br />
HDDMA Hexandioldimethacrylat<br />
HEMA Hydroxyethylmethacrylat<br />
ISO International Organization for Standardization<br />
Japanese-NiTi Japanese-Nickel-Titanium<br />
ml Milliliter<br />
x m% x Massenprozent<br />
mm Millimeter<br />
n Anzahl<br />
NaOCl Natriumhypochlorit<br />
NTG-GMA N-2-acetic acid-N-3-(2-hydroxy-1methacryloxy)propyl-4-<br />
methylaniline
112 ANHANG<br />
OH Hydroxylgruppe<br />
pH potentia hydrogenii<br />
PEGDMA Polyethylenglycoldimethacrylat<br />
PMGDMA Pyromelltitic Glycerol-Dimethacrylat<br />
p-value Signifikanzwert, Kennzahl zur <strong>Aus</strong>wertung statistischer<br />
Tests<br />
RaCe Reamers with alternating cutting edges<br />
rpm ro<strong>und</strong>s per minute<br />
s Sek<strong>und</strong>e<br />
SCT single-cone-technique<br />
UDMA Urethandimethacrylat
DANKSAGUNG 113<br />
10. Danksagung<br />
Für die Unterstützung bei <strong>der</strong> Anfertigung meiner Dissertation geht mein be-<br />
son<strong>der</strong>er Dank an:<br />
Prof. Dr. Anselm Petschelt, Prof. Dr. Roland Frankenberger, Oberarzt Dr.<br />
Matthias J. Roggendorf, Oberarzt Dr. Johannes Ebert, Dr. Walter Dasch, PD<br />
Dr. Ulrich Lohbauer, Herrn Herbert Brönner, Herrn Rainer Herold<br />
Desweiteren möchte ich mich an dieser Stelle herzlich bei meinen Eltern,<br />
meinem Bru<strong>der</strong> Stefan <strong>und</strong> bei Thomas, sowie bei all meinen Fre<strong>und</strong>en be-<br />
danken.
114 EIDESSTATTLICHE ERKLÄRUNG<br />
11. Eidesstattliche Erklärung<br />
Ich erkläre hiermit eidesstattlich, dass mir über die Betreuung <strong>der</strong> Disserta-<br />
tion mit dem Titel:<br />
Der Einfluss <strong>der</strong> Wurzelkanalfeuchtigkeit auf die apikale Dichtigkeit ad-<br />
häsiver <strong>und</strong> nicht-adhäsiver Sealer<br />
hinaus keine weitere Hilfe zuteil geworden ist, <strong>und</strong> ich bei <strong>der</strong> Erstellung <strong>der</strong><br />
Arbeit keine an<strong>der</strong>en als die in <strong>der</strong> Dissertation angeführten Hilfsmittel ver-<br />
wendet habe.<br />
Ich versichere, die Dissertation nicht vorher o<strong>der</strong> gleichzeitig an einer ande-<br />
ren Fakultät eingereicht zu haben.<br />
Ich habe bis dato an keiner an<strong>der</strong>en medizinischen Fakultät ein Gesuch um<br />
Zulassung zur Promotion eingelassen.<br />
Erlangen, den 19.05.2010<br />
Verena Fauth