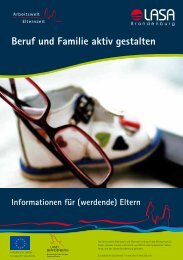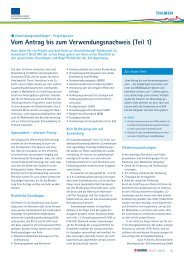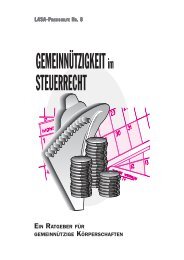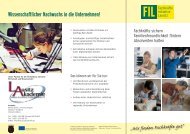Kompetenzermittlung bei Führungskräften - LASA Brandenburg GmbH
Kompetenzermittlung bei Führungskräften - LASA Brandenburg GmbH
Kompetenzermittlung bei Führungskräften - LASA Brandenburg GmbH
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Praxishilfe Nr. 14<br />
<strong>Kompetenzermittlung</strong> <strong>bei</strong><br />
<strong>Führungskräften</strong><br />
Eine praktische Anleitung zur Messung der<br />
beruflichen Handlungskompetenz<br />
PR14 Um.indd 1 16.01.2006 12:55:38
<strong>LASA</strong>-Praxishilfe Nr. 14<br />
Titel<br />
Herausgeber<br />
Copyright<br />
Autoren<br />
Fotos<br />
Gestaltung/Druck<br />
Titelblattgestaltung<br />
Grafisches Konzept<br />
Bestellung<br />
Impressum<br />
Praxishilfe Nr. 14<br />
<strong>Kompetenzermittlung</strong> <strong>bei</strong> <strong>Führungskräften</strong><br />
Eine praktische Anleitung zur Messung der beruflichen<br />
Handlungskompetenz<br />
Landesagentur für Struktur und Ar<strong>bei</strong>t<br />
<strong>Brandenburg</strong> <strong>GmbH</strong><br />
Dezember 2005<br />
Landesagentur für Struktur und Ar<strong>bei</strong>t<br />
<strong>Brandenburg</strong> <strong>GmbH</strong><br />
Alle Rechte vorbehalten<br />
Matthias Richter, Britta Oertel (Institut für Zukunftsstudien<br />
und Technologiebewertung g<strong>GmbH</strong>, IZT),<br />
Thomas Feil, (dwif--Consulting <strong>GmbH</strong>)<br />
IZT/Matthias Richter, Hotel am Alten Rhin,<br />
Landhotel Märkische Höfe, Störitzland Betriebsgesellschaft,<br />
HausRheinsberg<br />
Druckerei Feller, Teltow<br />
Sylvia Krell, <strong>LASA</strong><br />
PraxisInstitut, Bremen<br />
Landesagentur für Struktur und Ar<strong>bei</strong>t<br />
<strong>Brandenburg</strong> <strong>GmbH</strong><br />
Postfach 900 354<br />
14439 Potsdam<br />
Telefon: (03 31) 60 02-2 00<br />
Telefax: (03 31) 60 02-4 00<br />
Internet: www.lasa-brandenburg.de<br />
E-Mail: office@lasa-brandenburg.de<br />
Die Praxishilfe ist kostenlos.<br />
PR14 Um.indd 2 16.01.2006 12:55:38
1<br />
1.1<br />
1.2<br />
1.3<br />
1.4<br />
1.5<br />
1.6<br />
1.7<br />
2<br />
2.1<br />
2.2<br />
2.3<br />
2.4<br />
2.5<br />
2.6<br />
3<br />
3.1<br />
3.2<br />
4<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
<strong>LASA</strong>-Praxishilfe Nr. 14<br />
Vorwort 3<br />
Geleitwort 5<br />
Kompetenzmessung im Überblick 7<br />
Der Paradigmenwechsel von der Qualifikation hin<br />
zur Kompetenz 7<br />
Kompetenzentwicklung ist mehr als Aus- und<br />
Weiterbildung 8<br />
Die Komponenten der beruflichen Handlungskompetenz 9<br />
Ziele von Kompetenzmessungen 10<br />
Verfahren, Ansätze und Indikatoren der Kompetenz-<br />
messung 11<br />
Strategien zur erfolgreichen Einführung von<br />
Kompetenzmessung 13<br />
Fazit: Für wen sind Kompetenzmessverfahren<br />
interessant? 14<br />
„Kompetenzmessung in der <strong>Brandenburg</strong>er<br />
Tourismusbranche“ – ein Praxis<strong>bei</strong>spiel 17<br />
Das Reiseland <strong>Brandenburg</strong> 17<br />
Die Qualifizierungsoffensive im Tourismus im<br />
Land <strong>Brandenburg</strong> 23<br />
Das Instrument der Kompetenzmessung in der<br />
<strong>Brandenburg</strong>er Tourismuswirtschaft im Überblick 27<br />
Ziele von Kompetenzmessungen 32<br />
Der Kompetenzstern als Basis des Businesschecks<br />
und zur Visualisierung der Ergebnisse 34<br />
Fazit: Kompetenzmessung als Instrument der<br />
Strategieentwicklung 40<br />
Leseempfehlungen 41<br />
„Kompetenzmessung und Kompetenzentwicklung“ 41<br />
Leseempfehlungen „Unternehmens- und<br />
Personalmanagement“ 44<br />
Fußnotenverzeichnis 47<br />
<strong>LASA</strong>-Schriftenverzeichnis 49<br />
PR14.indd 1 16.01.2006 12:53:49<br />
1
2<br />
<strong>LASA</strong>-PRAXISHILFE Nr. 14<br />
PR14.indd 2 16.01.2006 12:53:50
Vorwort<br />
Liebe Leserinnen, liebe Leser,<br />
<strong>LASA</strong>-Praxishilfe Nr. 14<br />
vor dem Hintergrund des Wandels zur modernen Informations- und<br />
Wissensgesellschaft im 21. Jahrhundert wird Bildung für den Einzelnen<br />
das wichtigste Gut und Voraussetzung für ein erfolgreiches<br />
und erfülltes Ar<strong>bei</strong>tsleben. Nur so kann man mit dem ständigen<br />
Prozess der Veränderung in der auf Wettbewerb orientierten Gesellschaft<br />
Schritt halten.<br />
Die Landesagentur für Struktur Ar<strong>bei</strong>t <strong>Brandenburg</strong> <strong>GmbH</strong> (<strong>LASA</strong>)<br />
widmet sich mit diesem Handlungsleitfaden einem sehr spezifischen<br />
Aspekt dieser Thematik, verbunden mit dem Versuch,<br />
Handlungsempfehlungen für die praktische Tätigkeit von Führungspersonen<br />
kleiner und mittlerer Unternehmen zu erar<strong>bei</strong>ten. Im<br />
Auftrag des brandenburgischen Ministeriums für Ar<strong>bei</strong>t, Soziales,<br />
Gesundheit und Familie (MASGF) setzt die <strong>LASA</strong> seit Jahren<br />
Förderprogramme um, die u. a. die passgenaue Qualifizierung und<br />
Kompetenzentwicklung von Mitar<strong>bei</strong>tern und <strong>Führungskräften</strong> in<br />
KMU zum Ziel haben.<br />
Den Anstoß für diese Publikation gab die INNOPUNKT-Kampagne<br />
6, die zum Ziel hatte, die Idee einer Qualifizierungsoffensive in<br />
der brandenburgischen Tourismuswirtschaft zu befördern. Unter<br />
anderem ging es darum, die Entwicklung individueller beruflicher<br />
Handlungskompetenz von <strong>Führungskräften</strong> in Unternehmen der<br />
Tourismusbranche im Rahmen der 2-jährigen Projektlaufzeit zu<br />
messen. Ein wahrlich innovatives und ambitioniertes Anliegen.<br />
Die Ergebnisse waren so viel versprechend, dass die <strong>LASA</strong> sich<br />
entschlossen hat, in der Reihe der <strong>LASA</strong>-Publikation „Praxishilfe“,<br />
insbesondere den Geschäftsführern und Personalverantwortlichen<br />
in <strong>Brandenburg</strong>er Unternehmen einen praktischen Handlungsleitfaden<br />
an die Hand zu geben, der sie in die Lage versetzt, die berufliche<br />
Handlungskompetenz ihrer Führungskräfte, aber natürlich<br />
auch jeder einzelnen Mitar<strong>bei</strong>terin und jedes einzelnen Mitar<strong>bei</strong>ters<br />
zu überprüfen und zu entwickeln.<br />
Jeder verantwortungsvolle Leiter weiß, dass die Wettbewerbsfähigkeit<br />
seines Unternehmens in erster Linie von der individuellen<br />
beruflichen Handlungskompetenz der Belegschaft seines Unternehmens<br />
abhängt.<br />
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, liebe Leserinnen und Leser,<br />
diese Praxishilfe als eines von weiteren Werkzeugen Ihrer Personalführung<br />
zu verstehen und, so hoffen wir, auch in der Praxis<br />
anzuwenden.<br />
Prof. Dr. Wolfgang Kubiczek<br />
Geschäftsführer der <strong>LASA</strong> <strong>Brandenburg</strong> <strong>GmbH</strong><br />
PR14.indd 3 16.01.2006 12:53:50<br />
3
4<br />
<strong>LASA</strong>-PRAXISHILFE Nr. 14<br />
PR14.indd 4 16.01.2006 12:53:50
Geleitwort<br />
<strong>LASA</strong>-Praxishilfe Nr. 14<br />
Möglichkeiten und Grenzen der Kompetenzmessung in der Praxis<br />
Im November 2005 wurden vier ehemalige Teilnehmer der INNO-<br />
PUNKT-Kampagne 6 – aufgrund von Besonderheiten in den verschiedenen<br />
Kompetenzbereichen und mit dem Ziel, ein möglichst<br />
breites Spektrum von Betriebstypen abzudecken – aufgesucht. Sie<br />
sollten eigens für diese Praxishilfe ihre Meinung – stellvertretend<br />
für viele andere Betriebe – zur Methodik Kompetenzmessung und<br />
den Anspruch an das Instrument äußern. Die Struktur der kleinen<br />
und mittleren Unternehmen ist sehr unterschiedlich in der strategischen<br />
Ausrichtung, im Personalbesatz, <strong>bei</strong>m Marketing sowie <strong>bei</strong><br />
den eigenen Anforderungen gegenüber den Gästen. Die Betriebe<br />
werden deshalb in ihren Besonderheiten kurz vorgestellt. Vieles<br />
ist da<strong>bei</strong> stellvertretend für andere Betriebe in <strong>Brandenburg</strong>. Deshalb<br />
sollen nicht nur Unternehmen in der Gastronomie und im Beherbergungsgewerbe<br />
angesprochen werden. Sie sollen auch von<br />
den Erfahrungen und Konsequenzen lernen, welche die Betriebe<br />
aus den Ergebnissen der Messung der beruflichen Handlungskompetenz,<br />
aufgrund von Coachingmaßnahmen oder allgemein wegen<br />
der Marktsituation gezogen haben.<br />
Rückblick<br />
Ziel des Projektes „Kompetenzmessung der individuellen beruflichen<br />
Handlungskompetenz von <strong>Führungskräften</strong> von kleinen und<br />
mittleren Unternehmen (KMU) in der Tourismusbranche“ 1 war die<br />
Entwicklung und Erprobung eines praxisnahen Instrumentariums<br />
zur Messung von Aspekten beruflicher Handlungskompetenz. Am<br />
Beispiel von 50 an einer Schulungs- und Coachingmaßnahme teilnehmenden<br />
Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern sollten<br />
Kompetenzsteigerungen aufgezeigt werden. Hierzu wurden die<br />
Anforderungen an Fach- und Führungskräfte aus dem Tourismus-<br />
Sektor ermittelt und durch deren betriebliche Anforderungsprofile<br />
ergänzt. Die Berücksichtigung externer Einflussfaktoren, zu denen<br />
neben den wirtschaftlichen und unternehmerischen Indikatoren<br />
auch das persönliche Umfeld der Befragten zählen, ist da<strong>bei</strong> ein<br />
wesentlicher Vorteil. Besonderes Merkmal für das Instrument ist<br />
die Möglichkeit der Ausrichtung auf die individuellen Bedürfnisse<br />
des Unternehmens sowie die laufende Anpassung der Messkriterien<br />
an die Erfordernisse unternehmensinterner und externer<br />
marktbezogener Faktoren.<br />
PR14.indd 5 16.01.2006 12:53:50<br />
5
6<br />
<strong>LASA</strong>-PRAXISHILFE Nr. 14<br />
PR14.indd 6 16.01.2006 12:53:50
1<br />
1.1<br />
Kompetenzbegriff<br />
Qualifikationsbegriff<br />
Kompetenzmessung im Überblick<br />
<strong>LASA</strong>-Praxishilfe Nr. 14<br />
Der Paradigmenwechsel von der Qualifikation hin zur Kompetenz<br />
Der Begriff „Kompetenz“ umfasst alle Fähigkeiten, Wissensbestände<br />
und Herangehensweisen, die ein Mensch erworben hat<br />
und anwendet. Kompetenz bezeichnet also die situationsunabhängige<br />
Handlungs- und Problemlösungsfähigkeit von Individuen 2 .<br />
Wissenschaftler beschreiben Kompetenzen als Verhaltensweisen<br />
(Dispositionen), die den Menschen dazu befähigen, seine Umwelt<br />
selbst zu gestalten. Kompetenz befähigt dazu, sich Ziele zu setzen<br />
sowie Strategien und Herangehensweisen zu entwickeln, um diese<br />
Ziele zu realisieren 3 .<br />
Somit unterscheidet sich der Kompetenzbegriff grundlegend vom<br />
Qualifikationsbegriff 4 : Qualifikationen werden als Kenntnisse,<br />
Fähigkeiten und Fertigkeiten, die für die Ausübung eines Berufes<br />
wichtig sind, bezeichnet. Sie stellen einen „Grundbestand<br />
an Wissen und Können dar“ 5 und setzen einen Bildungs- bzw.<br />
Ausbildungsgang voraus. Auch der Kompetenzbegriff umfasst das<br />
für einen Handlungskontext erforderliche Wissen: Fachwissen,<br />
Methodenwissen, Wissen um soziale Verhältnisse, Strukturen<br />
und Beziehungen innerhalb und außerhalb des Unternehmens.<br />
Allerdings ist für Kompetenz in der Ar<strong>bei</strong>tswelt ausschlaggebend,<br />
wie Kenntnisse, Fertigkeiten, Erfahrungen und Verhaltensweisen<br />
kombiniert werden. Qualifikation bildet somit eine Basis für Kompetenz<br />
und steht nicht im Gegensatz hierzu. 6<br />
Mit dem Wechsel von der Qualifikation hin zur Kompetenz erweitern<br />
sich die Herausforderungen der modernen Ar<strong>bei</strong>tswelt.<br />
Obwohl das Wissen im engeren Sinn eine maßgebliche Größe für<br />
den beruflichen Erfolg bleibt, wird die Beschäftigungsfähigkeit<br />
von Erwerbstätigen bzw. der Erfolg von Unternehmerinnen und<br />
Unternehmern mit weiteren Faktoren verbunden, die die Handlungsfähigkeit<br />
und den beruflichen bzw. unternehmerischen Erfolg<br />
bestimmen.<br />
Der Wechsel der Betrachtungsebene von der Qualifikation hin zur<br />
Kompetenz birgt jedoch auch die Möglichkeit, neben den einzelnen<br />
Erwerbstätigen auch Unternehmen, Organisationen, Netzwerke,<br />
Branchen oder Regionen zu betrachten. Auf der kollektiven<br />
Ebene stehen da<strong>bei</strong> <strong>bei</strong>spielsweise die Handlungsfähigkeit oder<br />
die Wettbewerbsfähigkeit im Blickpunkt.<br />
Petra Tesch definiert „Kompetenz“ „als die Fähigkeit, in einer<br />
spezifischen Handlungssituation die persönlichen Ressourcen<br />
wie Wissen, persönliche Werte, Kenntnis, gesellschaftliche<br />
Normen, Willen/Aktivität, Fähigkeiten und Fertigkeiten und die<br />
Ressourcen des Umfeldes (wie Werkzeuge, Netzwerke, tradiertes<br />
Wissen) so einzusetzen und miteinander zu kombinieren,<br />
dass da<strong>bei</strong> die Anforderungen, die sich ergeben aus der Situation<br />
selbst, den Ressourcen der anderen Interagierenden sowie<br />
gesellschaftliche Normen, mit dem Ziel von hoher Performanz<br />
optimal berücksichtigt werden.“ Diese Definition berücksich-<br />
PR14.indd 7 16.01.2006 12:53:50<br />
7
8<br />
<strong>LASA</strong>-PRAXISHILFE Nr. 14<br />
1.2<br />
Kompetenzentwicklung<br />
in Ar<strong>bei</strong>ts- und<br />
Lebenswelt<br />
tigt zum einen den Menschen und seine berufliche wie private<br />
Herkunft, zum anderen auch das Umfeld, in dem die Kompetenzen<br />
zur Anwendung kommen und ermöglicht somit auch die<br />
Messung der individuellen Kompetenz hinsichtlich des jeweiligen<br />
Effektivitätsbereiches bzw. Wirkungskreises.<br />
Quelle: Tesch, P. (2003), S. 8 mwN.<br />
Kompetenzentwicklung ist mehr als Aus- und Weiterbildung<br />
Nach Frieling et al. 7 ist Kompetenzentwicklung das „Ergebnis spezifischer<br />
und unspezifischer Wechselwirkungen zwischen Person,<br />
Betrieb, Ar<strong>bei</strong>tsorganisation und Gesellschaft, die geplant, gesteuert,<br />
angeregt, unterstützt und gefördert werden können“ 8 . Lebensbegleitend<br />
erfolgt die Herausbildung von Kompetenzen durch<br />
individuelle Lern- und Entwicklungsprozesse und unterschiedliche<br />
Formen des Lernens in der Ar<strong>bei</strong>ts- und in der Lebenswelt.<br />
Auch hier wird der Unterschied zur traditionellen Aus- und Weiterbildung<br />
deutlich, in der vor allem Wissen und Fähigkeiten zielgerichtet<br />
weiterentwickelt wurden, die für Berufsausübung im engeren<br />
Sinne relevant sind. Für die Kompetenzentwicklung dagegen<br />
gilt, dass Ar<strong>bei</strong>tsprozesse insgesamt so gestaltet werden sollten,<br />
dass sie die Kompetenzen wecken und fördern sowie selbst<br />
organisierte bzw. selbst gesteuerte Lernprozesse kontinuierlich<br />
unterstützen. Des Weiteren sollte das Ar<strong>bei</strong>tsumfeld so gestaltet<br />
werden, dass vorhandene Kompetenzen im Sinne von Erwerbstätigen<br />
und Unternehmen ausgeschöpft werden. Auch hier bilden die<br />
traditionellen Bausteine der Aus- und Weiterbildung einen wesentlichen<br />
Bestandteil der Kompetenzentwicklung. Vor dem Hintergrund<br />
des strukturellen Wandels können Kompetenzen nicht nur<br />
berufsbegleitend eher zufällig erworben werden: Auch hier muss<br />
Fachwissen berufsbegleitend gelehrt und gelernt werden, um<br />
sowohl die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen als auch die<br />
Beschäftigungsfähigkeit von Erwerbstätigen mittel- und langfristig<br />
zu erhalten. Da<strong>bei</strong> sollten jedoch verstärkt individuelle Erfahrungen<br />
und Interessen Berücksichtigung finden, um das Anknüpfen<br />
an bereits erworbenen Kompetenzen zu ermöglichen.<br />
Doch ein „lernendes Unternehmen“ ist durch weitere Merkmale<br />
gekennzeichnet: Es gilt, die Kompetenzen der Mitar<strong>bei</strong>terinnen<br />
und Mitar<strong>bei</strong>ter für Produkt-, Dienstleistungs- und Prozess-Innovationen<br />
zu nutzen und so Wettbewerbspotenziale zu realisieren.<br />
Damit Unternehmen aber eben diese Wettbewerbsvorteile nutzen<br />
können, müssen sie über Handlungs- und Problemlösefähigkeiten<br />
verfügen 9 , einen guten Umgang mit Informationen und Wissen<br />
sowie die Bereitschaft zu Veränderungen aufweisen 10 .<br />
PR14.indd 8 16.01.2006 12:53:50
1.3<br />
<strong>LASA</strong>-Praxishilfe Nr. 14<br />
Die Komponenten der beruflichen Handlungskompetenz<br />
Was macht kompetentes berufliches Handeln aus? Diese Frage<br />
ist schwer zu beantworten und bedarf stets einer Konkretisierung<br />
im Rahmen eines spezifischen Kontextes. Übergreifend wählen<br />
die meisten Expertinnen und Experten ganzheitliche Herangehensweisen<br />
zur Definition des Begriffs „Handlungskompetenz“: Bereits<br />
1994 verwies Bunk darauf, dass berufliche Handlungskompetenz<br />
neben den erforderlichen Kenntnissen, Fertigkeiten und Fähigkeiten<br />
eines Berufs auch Fähigkeiten, Ar<strong>bei</strong>tsaufgaben selbstständig<br />
und flexibel lösen zu können und die Bereitschaft, dispositiv im<br />
Berufsumfeld und innerhalb der Ar<strong>bei</strong>tsorganisation mitzuwirken,<br />
umfasst. 11<br />
Nach Bunk <strong>bei</strong>nhaltet Handlungskompetenz die Integration von<br />
vier Teilkompetenzen:<br />
• „Fachkompetenz besitzt derjenige, der zuständig und sachverständig<br />
über Aufgaben und Inhalte seines Ar<strong>bei</strong>tsbereichs<br />
verfügt und die dafür notwendigen Kenntnisse und Fertigkeiten<br />
beherrscht.<br />
• Methodenkompetenz besitzt derjenige, der <strong>bei</strong> gestellten<br />
Ar<strong>bei</strong>tsaufgaben und auftretenden Abweichungen verfahrensmäßig<br />
angemessen reagieren kann, selbstständig Lösungswege<br />
findet sowie gemachte Erfahrungen sinnvoll auf andere Ar<strong>bei</strong>tsprobleme<br />
überträgt.<br />
• Sozialkompetenz besitzt derjenige, der mit anderen Menschen<br />
kommunikativ und kooperativ zusammenar<strong>bei</strong>ten kann, gruppenorientiertes<br />
Verhalten und zwischenmenschliches Verständnis<br />
zeigt.<br />
• Mitwirkungs- oder Personale Kompetenz besitzt derjenige, der<br />
seinen Ar<strong>bei</strong>tsplatz und darüber hinaus seine Ar<strong>bei</strong>tsumgebung<br />
konstruktiv mitgestalten kann, dispositiv zu organisieren und<br />
entscheiden vermag und zur Verantwortungsübernahme bereit<br />
ist.“ 12<br />
Eine weitere, weit verbreitete Definition der Grundtypen der<br />
Kompetenz ist in Abbildung 1 wiedergegeben und vertieft bzw.<br />
veranschaulicht die Teilkompetenzen. In dieser Darstellung sind<br />
Fach- und Methodenkompetenz integriert. Der übergreifenden<br />
Handlungskompetenz entspricht hier die aktivitätsbezogene Kompetenz:<br />
Personale<br />
Kompetenzen<br />
Die Dispositionen einer Person, reflexiv<br />
selbst organisiert zu handeln, d. h.<br />
sich selbst einzuschätzen, produktive<br />
Einstellungen, Werthaltungen, Motive<br />
und Selbstbilder zu entwickeln, eigene<br />
Begabungen, Motivationen, Leistungsvorschläge<br />
zu entfalten und sich im Rahmen<br />
der Ar<strong>bei</strong>t und außerhalb kreativ zu entwickeln<br />
und zu lernen.<br />
PR14.indd 9 16.01.2006 12:53:50<br />
9
10<br />
<strong>LASA</strong>-PRAXISHILFE Nr. 14<br />
Die vier Grundtypen<br />
der Kompetenz nach<br />
Erpenbeck. Heyse<br />
1999 bzw. Erpenbeck,<br />
Rosenstiel 2003.<br />
1.4<br />
Kompetenzen und<br />
Ar<strong>bei</strong>tswelt<br />
Fachlich-methodische<br />
Kompetenzen<br />
Sozialkommunikative<br />
Kompetenzen<br />
Aktivitätsbezogene<br />
Kompetenz<br />
Ziele von Kompetenzmessungen<br />
Die Disposition einer Person, <strong>bei</strong> der<br />
Lösung von sachlich-gegenständlichen<br />
Problemen geistig und physisch selbst<br />
organisiert zu handeln, d. h. mit fachlich<br />
und instrumentellen Kenntnissen, Fertigkeiten<br />
und Fähigkeiten kreativ Probleme<br />
zu lösen, Wissen sinnorientiert einzuordnen<br />
und zu bewerten; das schließt<br />
Dispositionen ein, Tätigkeiten, Aufgaben<br />
und Lösungen methodisch selbst organisiert<br />
zu gestalten, sowie die Methoden<br />
selbst kreativ weiterzuentwickeln.<br />
Die Dispositionen, kommunikativ und kooperativ<br />
selbst organisiert zu handeln, d.<br />
h. sich mit anderen kreativ auseinander-<br />
und zusammenzusetzen, sich gruppen-<br />
und beziehungsorientiert zu verhalten,<br />
und neue Pläne, Aufgaben und Ziele zu<br />
entwickeln.<br />
Die Dispositionen einer Person, aktiv und<br />
gesamtheitlich selbst organisiert zu handeln<br />
und dieses Handeln auf die Umsetzung<br />
von Absichten, Vorhaben und Plänen<br />
zu richten – entweder für sich selbst oder<br />
auch für andere und mit anderen, im<br />
Team, im Unternehmen, in der Organisation.<br />
Diese Dispositionen umfassen damit<br />
das Vermögen, die eigenen Emotionen,<br />
Motivationen, Fähigkeiten und Erfahrungen<br />
und alle anderen Kompetenzen<br />
– personale, fachlich-methodische und<br />
sozial-kommunikative – in die eigenen<br />
Willensantriebe zu integrieren und Handlungen<br />
erfolgreich zu realisieren.<br />
Kompetenzen sind der Schlüssel, um sich in der modernen<br />
Ar<strong>bei</strong>tswelt zu behaupten – diese These wird heute von Akteuren<br />
aus Wirtschaft und Wissenschaft kaum bestritten. Der Begriff<br />
„Kompetenz“ spiegelt die Komplexität von Wirtschaft und Gesellschaft<br />
wider. Er integriert die Bedarfe und Interessen von Erwerbstätigen<br />
und Unternehmen und verdeutlicht die Herausforderung,<br />
sich kontinuierlich an diese Entwicklungslinien anzupassen.<br />
Aufgrund dieser Komplexität ist Kompetenz schwer zu entwickeln<br />
oder zu bewerten. Dies gilt sowohl für die individuelle als auch für<br />
die unternehmerische Ebene. Doch gleichzeitig kann nur die Messung<br />
und Bewertung von Kompetenzen dringend erforderliches<br />
Orientierungswissen schaffen, um im heutigen Wettbewerb zu<br />
bestehen. Konkrete Verfahren, Kompetenzen zu messen, sollen<br />
diesen Orientierungsrahmen schaffen.<br />
PR14.indd 10 16.01.2006 12:53:51
1.5<br />
Verfahren zur<br />
Kompetenzmessung<br />
<strong>LASA</strong>-Praxishilfe Nr. 14<br />
Verfahren, Ansätze und Indikatoren der Kompetenzmessung<br />
Ein genormtes Verfahren als Standard für die Bewertung zur Messung<br />
der Handlungskompetenz gibt es nicht. Grundsätzlich sind<br />
fast alle wissenschaftlich fundierten Herangehensweisen bzw.<br />
quantitative und qualitative Methoden zur Kompetenzmessung<br />
geeignet. Gerade in der noch vergleichsweise jungen „Disziplin“<br />
vermag eine breite Herangehensweise sogar zielführende Potenziale<br />
erschließen.<br />
Zu den typischen methodischen Herangehensweisen zählen <strong>bei</strong>spielsweise:<br />
• Interview: Das Interview ist – besonders <strong>bei</strong> der Bewertung und<br />
Messung der Handlungskompetenzen – eine der am häufigsten<br />
angewendeten Verfahren. Entsprechend der Bewertungskriterien<br />
und dem gewählten Vorgehen (offenes bzw. geschlossenes<br />
Interview, Selbst- und/oder Fremdeinschätzung usw.) können<br />
Fragen auch situativ angepasst und durch Nachfragen auch konkretisiert<br />
werden. Die Interviewform ist nicht unbedingt objektiv,<br />
da seitens des Interviewleiters auch Sympathiebewertungen<br />
eine Rolle spielen.<br />
• Fragebogen: Fragebögen sind eine sehr sichere Methode zur<br />
Abfrage insbesondere von einfachen, nachvollziehbaren Daten<br />
und Werten (z. B. Beruf, Alter, Unternehmensgröße usw.). Ein<br />
Fragebogen kann auch eingesetzt werden, um bestimmte Charaktereigenschaften<br />
und Verhaltensweisen abzufragen, allerdings<br />
können die Antworten recht einfach manipuliert werden.<br />
Die Fragebögen können elektronisch und/oder in gedruckter<br />
Form vorgelegt werden. Wichtig ist, darauf zu achten, dass die<br />
Fragen klar und einfach zu verstehen und auch zu beantworten<br />
sind.<br />
• Beobachtung durch unabhängige Beobachter: Die Beobachtung<br />
einer zu bewertenden Person erscheint insbesondere dann als<br />
sinnvoll, wenn Verhaltensweisen und Charaktereigenschaften in<br />
der gewohnten Atmosphäre bewertet werden sollen.<br />
• Selbsteinschätzung oder Fremdeinschätzung durch Mitar<strong>bei</strong>ter,<br />
Kollegen usw.: Die Bewertung bzw. Beobachtung durch Mitar<strong>bei</strong>ter,<br />
Kollegen usw. ist vor allem für ein umfassendes Bild der<br />
zu bewertenden Person wichtig. Durch die verschiedenen, eher<br />
subjektiv geprägten Aussagen entsteht ein breites und vor allem<br />
genaueres Bild insbesondere über die weichen Kompetenzen<br />
der zu bewertenden Person.<br />
Die Auswahl der eingesetzten methodischen Herangehensweisen<br />
ist da<strong>bei</strong> abhängig von den mit der Kompetenzmessung bzw. Kompetenzbewertung<br />
verfolgten Zielen, den Kennzahlen des Unternehmens<br />
sowie den Tätigkeitsprofilen der Erwerbstätigen.<br />
PR14.indd 11 16.01.2006 12:53:51<br />
11
12<br />
<strong>LASA</strong>-PRAXISHILFE Nr. 14<br />
Hauptfelder der Fach-,<br />
Methoden-, Sozial- und<br />
Personalkompetenz<br />
Grundsätzlich können anwendungsorientierte Ansätze von individualorientierten<br />
Ansätzen unterschieden werden:<br />
• In der Wirtschaft werden in der Regel anwendungsorientierte<br />
Ansätze der Kompetenzmessung genutzt, um die Kompetenzen<br />
für zukünftige Herausforderungen abzuschätzen. Sie messen<br />
hierzu schwerpunktmäßig das Potenzial von Erwerbstätigen oder<br />
Unternehmen. Die Auswahl der Indikatoren orientiert sich an<br />
den Herausforderungen und Erfordernissen für Unternehmen.<br />
Ziele sind <strong>bei</strong>spielsweise die Auswahl von Mitar<strong>bei</strong>terinnen und<br />
Mitar<strong>bei</strong>tern oder die Ermittlung von Aus- und Weiterbildungsbedarfen.<br />
• Dagegen fokussieren individualorientierte Ansätze typischerweise<br />
ein breites Spektrum an Kompetenzen, die in Ar<strong>bei</strong>ts- und<br />
Lebenswelt erworben wurden. Ziel ist es, die Steigerung der<br />
Kompetenzen zur individuellen Entwicklung nicht nur für die Ar<strong>bei</strong>tswelt<br />
zu erzielen. Als Ergebnis sollen Erkenntnisse über die<br />
individuelle Leistungsfähigkeit gewonnen und für den weiteren<br />
Lebensweg nutzbar gemacht werden.<br />
Bereits diese Beispiele verdeutlichen, dass standardisierte<br />
Verfahren nur für einzelne Anwendungsgebiete entwickelt werden<br />
können und zudem der ständigen Aktualisierung bedürfen.<br />
Die Indikatoren der Kompetenzmessung sind genauso breit<br />
gestreut wie die Anforderungen in der modernen Ar<strong>bei</strong>tswelt.<br />
Unter dynamischen Bedingungen müssen sie kontinuierlich an<br />
die Erfordernisse der Unternehmen und ihres Umfeldes bzw.<br />
die Bedarfe der Erwerbstätigen und die Herausforderungen an<br />
ihre Beschäftigungsfähigkeit angepasst werden. Heute können<br />
<strong>bei</strong>spielsweise die folgenden Kriterien den vier Teilkompetenzen<br />
nach Bunk zugeordnet werden und einen Eindruck über mögliche<br />
Indikatoren vermitteln.<br />
Fachkompetenz:<br />
- Betriebswirtschaftliche<br />
Kenntnisse<br />
- Kaufmännisches Wissen<br />
- EDV-Wissen<br />
- Branchenkenntnisse<br />
- Unternehmerisches Denken<br />
und Handeln<br />
- Sprachkenntnisse<br />
Methodenkompetenz:<br />
- Analytisches Denken<br />
- Konzeptionelle Fähigkeiten<br />
- Kreativität und Innovations-<br />
fähigkeit<br />
- Gefühl für künftige Entwicklungen<br />
- Führungsmethoden, Umgang mit<br />
Mitar<strong>bei</strong>tern<br />
- Problemlösungsfähigkeit<br />
Personale Kompetenz:<br />
- Risikobereitschaft<br />
- Flexibilität<br />
- Kritische Selbstwahrneh-<br />
mung<br />
- Offenheit<br />
- Belastbarkeit<br />
Soziale Kompetenz:<br />
- Teamfähigkeit<br />
- Kommunikationsfähigkeit<br />
- Konfliktlösungsbereitschaft<br />
- Verantwortungsbewusstsein<br />
gegenüber Kollegen<br />
- Überzeugungskraft<br />
PR14.indd 12 16.01.2006 12:53:51
1.6<br />
<strong>LASA</strong>-Praxishilfe Nr. 14<br />
Die hier gewählten Beispiele bedürfen insbesondere im Bereich<br />
der Fachkompetenz der gezielten Auswahl u. a. nach Branche oder<br />
Tätigkeitsfeld. Auch die anderen Indikatoren müssen zielgruppenspezifisch<br />
definiert bzw. verfeinert werden. Da<strong>bei</strong> stehen im noch<br />
jungen Aufgabenfeld der Kompetenzmessung bereits für die so<br />
genannten weichen Handlungskompetenzen – die soziale, personale<br />
und methodische Kompetenz – eine Reihe von <strong>bei</strong>spielhaften<br />
Kriterienkatalogen als Ausgangspunkt zur Verfügung.<br />
Strategien zur erfolgreichen Einführung von Kompetenzmessung<br />
Verfahren zur Kompetenzmessung werden nur dann aussagefähige<br />
Ergebnisse bringen, wenn einige grundlegende Regeln – die übrigens<br />
auch für andere Einführungsprozesse gelten – beachtet werden:<br />
Eine fundierte Strategie ist für die erfolgreiche Verankerung neuer<br />
Verfahren von besonderer Bedeutung. Sie gilt als Faktor, der in<br />
erheblichem Maße zum Erfolg der Kompetenzmessung und somit<br />
zur Kompetenzsteigerung und Unternehmenserfolg <strong>bei</strong>trägt. In<br />
einer Kompetenz-Strategie sollte festgelegt sein, wie sich die<br />
Kompetenzen der Erwerbstätigen und des Unternehmens insgesamt<br />
entwickeln sollen. Diese Zielsetzung sollte in Schriftform<br />
niedergelegt werden, allen Beteiligten bekannt gemacht und je<br />
nach Bedarf breit diskutiert bzw. angepasst werden.<br />
Die Kompetenz-Strategie konkretisiert …<br />
� … die zu erreichenden Ziele,<br />
� … den Zeithorizont der Maßnahme,<br />
� … die eingesetzten Verfahren,<br />
� … die zu erhebenden Indikatoren,<br />
� … die durchführende „Instanz“,<br />
� … die erforderlichen zeitlichen und finanziellen Ressourcen.<br />
Kompetenzmessung sollte stets in einem engen Bezug zur Kompetenzentwicklung<br />
gesehen werden – unabhängig davon, ob Führungskräfte<br />
oder Mitar<strong>bei</strong>terinnen und Mitar<strong>bei</strong>ter im Mittelpunkt<br />
der Kompetenzmessung stehen: Die frühzeitige Einbeziehung<br />
aller Akteure und die Einhaltung einiger „Grundregeln“ sichert die<br />
Unterstützung aller Beteiligter.<br />
PR14.indd 13 16.01.2006 12:53:51<br />
13
14<br />
<strong>LASA</strong>-PRAXISHILFE Nr. 14<br />
In Anlehnung an:<br />
http://www.bibb.<br />
de/dokumente/pdf/<br />
a45_fachtagung_<br />
informelles-lernen_06_<br />
gillen.pdf<br />
1.7<br />
Anwendung der<br />
Kompetenzmessung<br />
Bausteine für den Erfolg der Kompetenzmessung sind:<br />
� Partizipation durch die Einbeziehung aller Beteiligten<br />
� Glaubwürdigkeit durch Einbeziehung in die Gesamtstrategie<br />
� Transparenz durch breite Information und Offenlegung der<br />
Ziele und Zwecke und der Ergebnisverwertung<br />
� Verlässlichkeit durch Einhaltung der Qualitätskriterien in der<br />
Durchführung<br />
� Legitimität durch den Ausschluss des Gebrauchs zur Selektion<br />
� Professionalität durch angemessene Vorbereitung, Durchführung<br />
und Nachbereitung der Kompetenzmessung<br />
� Nachhaltigkeit durch die Kombination von Kompetenzmessung<br />
und Kompetenzsteigerung<br />
Fazit: Für wen sind Kompetenzmessverfahren interessant?<br />
Das Instrument der Kompetenzmessung erfährt zunehmend auch<br />
in kleinen und mittleren Betrieben und Einrichtungen größere Beachtung.<br />
Steigende Anforderungen an die Sozial-, Methoden- oder<br />
Personalkompetenz der Beschäftigten führen zu einem wachsenden<br />
Interesse an quantifizierbaren Mess- und Bewertungsverfahren.<br />
13 Entscheidend für den Erfolg von Kompetenzmessungen<br />
ist die genaue Definition des jeweiligen Zielkorridors, der sich<br />
an den individuellen Bedarfen der ausgewählten Erwerbstätigen<br />
einerseits, aber auch an den Anforderungen im Rahmen veränderter<br />
Wettbewerbsbedingungen im jeweiligen Wirtschaftssektor<br />
andererseits orientiert.<br />
Ausgangspunkt für anwendungsorientierte Kompetenzmessungen<br />
können verschiedene unternehmensinterne Ar<strong>bei</strong>tsbereiche und<br />
Prozesse sein. Im Bereich des klassischen Personalmanagements<br />
sind Bezugs- wie Ausgangspunkte der Kompetenzmessung<br />
typischerweise das Einstellungsverfahren und Kompetenzentwicklungsstrategien<br />
für Mitar<strong>bei</strong>terinnen und Mitar<strong>bei</strong>ter. Zwischen<br />
dem Personalmanagement und der Organisationsentwicklung im<br />
weitesten Sinne kommt der Aspekt der Fort- und Weiterbildung in<br />
Betracht. Als weitere Anwendungsfelder können auch der organisatorische<br />
Aufbau und die Aufstellung des Unternehmens selbst<br />
Ausgangspunkt einer Kompetenzmessung werden. Da<strong>bei</strong> muss<br />
berücksichtigt werden, dass Veränderungen und Veränderungsprozesse,<br />
die durch die Kompetenzmessung angeschoben werden, zu<br />
den mittel- und langfristigen Aufgaben gehören.<br />
PR14.indd 14 16.01.2006 12:53:51
<strong>LASA</strong>-Praxishilfe Nr. 14<br />
Hinter den jeweiligen Aspekten stehen unterschiedliche Zwecke.<br />
Beispiele hierfür sind:<br />
• Mitar<strong>bei</strong>terauswahl in Einstellungsverfahren: Um Stellen und<br />
Positionen in Betrieben und Unternehmen besetzen zu können,<br />
werden Stellenbeschreibungen und Stellenprofile erstellt.<br />
Wesentliche Bestandteile der Stellenprofile sind die Jobprofil-<br />
und die Anforderungsprofilbeschreibungen, für die geeignete<br />
Bewerber gefunden werden müssen. Die Auswahl von geeig-<br />
neten Bewerbern für die jeweils zu besetzende Stelle kann im<br />
Rahmen einer Kompetenzmessung erfolgen.<br />
• Unterstützung der Karriereplanung: Mithilfe der Kompetenzmessung<br />
werden Stärken und Schwächen sowie die Ziele erfasst<br />
– zudem ist es möglich, Wünsche und Zielvorstellungen in die<br />
Kompetenzbewertung mit aufzunehmen. Basierend auf den jeweiligen<br />
Ergebnissen der Kompetenzmessung können Maßnahmen<br />
und Strategien zur Mitar<strong>bei</strong>terförderung vorgeschlagen und<br />
durchgeführt, sowie im Rückblick auch auf ihre Wirksamkeit hin<br />
überprüft werden.<br />
• Fort- und Weiterbildung: Im Rahmen von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen<br />
kommen zwei Aspekte für die Kompetenzmessung<br />
in Betracht: einerseits die Erfolgsmessung und<br />
Überprüfung des Bildungsangebotes, andererseits die Messung<br />
der Kompetenzsteigerung <strong>bei</strong> den an den Bildungsangeboten<br />
teilnehmenden Beschäftigten.<br />
• Strategische und organisationale Ausrichtung des Unternehmens:<br />
Die Ermittlung der Kompetenzen der Beschäftigten<br />
ermöglicht dem Unternehmen eine genaue Einschätzung seiner<br />
personellen Fähig- und Fertigkeiten. Somit kann das Unternehmen<br />
genau erkennen, für welche Aufgaben und Tätigkeiten die<br />
Mitar<strong>bei</strong>ter eingesetzt werden können. Basierend auf diesen<br />
Ergebnissen kann das Unternehmen auch strategisch darüber<br />
entscheiden, welche Kompetenzen künftig notwendig und erforderlich<br />
sind, um im Wettbewerb zu bestehen. Auf Grundlage<br />
der Kompetenzmessung können dann einerseits Weiterbildungsmaßnahmen<br />
ausgewählt und für die Mitar<strong>bei</strong>ter angeboten werden.<br />
Andererseits können – basierend auf den Ergebnissen der<br />
Kompetenzmessung – strategische Entscheidungen hinsichtlich<br />
des Unternehmensaufbaus und der Unternehmensorganisation<br />
getroffen werden.<br />
Grundsätzlich ist jedoch die Kompetenzsteigerung der Erwerbstätigen<br />
und die Wettbewerbsorientierung des Unternehmens ein<br />
zentrales Aufgabenfeld für Unternehmen aller Größenklassen. Im<br />
Sinne der Umsetzung des Leitbildes eines „lernenden Unternehmens“<br />
erschließt sich die Bedeutung der Kompetenzmessung<br />
und darauf aufbauender Kompetenzentwicklungen im besonderen<br />
Maße.<br />
PR14.indd 15 16.01.2006 12:53:51<br />
15
16<br />
<strong>LASA</strong>-PRAXISHILFE Nr. 14<br />
PR14.indd 16 16.01.2006 12:53:51
2<br />
2.1<br />
Tourismus-<br />
Eckpfeiler<br />
der Wirtschaft<br />
Herausforderungen<br />
für die <strong>Brandenburg</strong>er<br />
Tourismuswirtschaft<br />
(Quelle: dwif 2003)<br />
Verlängerungsdynamik<br />
im<br />
Tourismussektor<br />
<strong>LASA</strong>-Praxishilfe Nr. 14<br />
„Kompetenzmessung in der <strong>Brandenburg</strong>er<br />
Tourismusbranche“ – ein Praxis<strong>bei</strong>spiel<br />
Das Reiseland <strong>Brandenburg</strong><br />
Mit einer Vielzahl von Maßnahmen und Aktivitäten ist es <strong>Brandenburg</strong><br />
in den vergangenen Jahren gelungen, die Tourismuswirtschaft<br />
zu einem bedeutenden Eckpfeiler der brandenburgischen<br />
Wirtschaft zu entwickeln. Der touristische Gesamtumsatz beläuft<br />
sich heute auf ca. 2,63 Mrd. EUR und der touristische Einkommens<strong>bei</strong>trag<br />
in Höhe von 1,46 Mrd. EUR entspricht mehr als<br />
60.000 Vollbeschäftigtenäquivalenten. 14 Mussten in der Anfangszeit<br />
vor allem noch touristische Strukturen aufgebaut werden,<br />
steht heute die Entwicklung zielgruppengerechter und marktfähiger<br />
Produkte für die aussichtsreichsten Tourismusarten im Fokus landesweiter<br />
Programme. Hierzu zählen insbesondere der Rad-, Reit-,<br />
Wasser- und Sporttourismus, der Städte- und Kulturtourismus,<br />
der Campingtourismus sowie der Gesundheits- und Wellnesstourismus.<br />
Begleitend hierzu werden Kooperationen touristischer und<br />
überregional relevanter Organisationen und Verbände bzw. Vereine<br />
in <strong>Brandenburg</strong> unterstützt, um eine noch größere Kundennähe zu<br />
gewährleisten.<br />
Seit einiger Zeit unterliegt der Tourismussektor regional wie<br />
auch international einer besonders ausgeprägten Veränderungsdynamik.<br />
Rasant sich ändernde Verbraucherpräferenzen, steigender<br />
Wettbewerbsdruck – auch im globalen Maßstab – und<br />
die zunehmende Bedeutung von Informations- und Kommunikationstechnologien<br />
sind nur einige Beispiele für Treiber des<br />
hohen Veränderungstempos (vgl. Abbildung oben). Besonders <strong>bei</strong><br />
kleinen und mittleren Unternehmen im Tourismussektor führen<br />
die wettbewerblichen Veränderungsprozesse und daraus folgende,<br />
oft komplizierte Wechselwirkungen zu einem erhöhten Bedarf an<br />
Beratungs- und weiterführenden Unterstützungsleistungen. Vor<br />
dem Hintergrund der bereits eingetretenen Konsolidierungsphase<br />
der Tourismusentwicklung in <strong>Brandenburg</strong> wie auch den übrigen<br />
ostdeutschen Bundesländern, d. h. sich abschwächender Wachstumsraten<br />
einerseits und einem sich verschärfenden Wettbewerb<br />
um die anspruchsvoller werdenden Kunden andererseits<br />
17<br />
15 , erhält<br />
das Qualitätsmanagement zunehmende strategische Bedeutung.<br />
PR14.indd 17 16.01.2006 12:53:52
18<br />
<strong>LASA</strong>-PRAXISHILFE Nr. 14<br />
Fall<strong>bei</strong>spiel: Hotel und Restaurant „Am Alten Rhin“<br />
Bert Krsynowski vom Hotel und Restaurant „Am Alten Rhin“<br />
weist darauf hin, dass gerade deshalb die Weiterbildungsangebote<br />
für kleine und mittlere Unternehmen künftig noch passgenauer<br />
gestaltet werden müssen. Das Hotel und Restaurant<br />
„Am Alten Rhin“ wird den kommenden Herausforderungen vor<br />
allem durch Schärfung der bisherigen Alleinstellungsmerkmale<br />
– kleines Familienhotel mit hohem und individuellem Serviceangebot<br />
– begegnen. Hierfür sind, so Bert Krsynowski, vor allem<br />
aber auch Fähigkeiten und Kompetenzen in den Bereichen<br />
Akquisition, Verkauf, Marketing und Produktentwicklung notwendig.<br />
Dass die Kompetenzen auch für ihn persönlich wichtig sind,<br />
zeigen die Ergebnisse vor allem im Bereich der Fachkompetenz.<br />
Zu erkennen sind hohe Spezialisierungsgrade im Bereich<br />
Betriebswirtschaft, Unternehmensführung und Organisation.<br />
Führungserfahrung sammelte er in mittelgroßen Gastronomie-<br />
und Beherbergungsbetrieben in seiner vorherigen beruflichen<br />
Tätigkeit sowie durch den Besuch von Seminaren. Nach eigenen<br />
Angaben ist Führungserfahrung besonders in dem strategischen<br />
Bereich Marketing und Kommunikation sehr wichtig. Ergebnisse<br />
der Kompetenzmessung unterstützen die Geschäftsführung vom<br />
Hotel und Restaurant „Am Alten Rhin“, indem präzise Angaben<br />
über Weiterbildungsbedarfe und Kompetenzdefizite gemacht und<br />
künftige Bedarfe aufgezeigt werden. Dadurch kann der Betrieb<br />
weiter optimiert und die Wettbewerbsfähigkeit gesichert werden.<br />
Der Betrieb: Hotel und Restaurant Am Alten Rhin<br />
(Typ: 3*** Sup. Hotel)<br />
Hotel und Restaurant<br />
„Am Alten Rhin“<br />
Friedrich-Engels-Straße 12<br />
16827 Alt Ruppin<br />
Telefon: (0 33 91) 765-0<br />
Fax: (0 33 91) 765-15<br />
Internet:<br />
www.hotel-am-alten-rhin.de<br />
E-Mail:<br />
Hotel.AmAltenRhin@t-online.de<br />
Geschäftsführung/Inhaberin: Britta Krsynowski<br />
Kurzbeschreibung Einrichtung:<br />
Familiengeführtes Hotel im ländlichen Stil in Alt Ruppin. Kapazitäten:<br />
33 Zimmer, 33 Kneipenplätze, ein Restaurant mit 60 Plätzen.<br />
PR14.indd 18 16.01.2006 12:53:52
„Opa‘s jemütliche<br />
Kneipe“ im Hotel<br />
und Restaurant<br />
Am Alten Rhin<br />
Teichanlage<br />
vor dem Hotel<br />
Familienbetrieb<br />
Krsynowski<br />
<strong>LASA</strong>-Praxishilfe Nr. 14<br />
Hinzu kommt der Rhinsaal & Rhinsalon (120 Plätze) und eine<br />
Hofterrasse. Das Hotel umgibt ein naturnah gestalteter Garten mit<br />
Kinderspielplatz, direkt am Flüsschen Alter Rhin.<br />
Seit September 2002 gibt es einen kleinen Wellnessbereich im<br />
Haus.<br />
Vorstellung Interviewpartner: Bert Krsynowski<br />
Herr Krsynowski ist ausgebildeter Koch und staatlich geprüfter<br />
Betriebswirt für das Gaststätten- und Hotelwesen. Als Küchenchef<br />
und als Leiter in mittleren Hotel- und Restaurantbetrieben<br />
sammelte er umfangreiche Erfahrungen. Er ist Ausbildungsträger<br />
in gastronomischen Berufen. Im Rahmen von Mitgliedschaften/<br />
Vorsitz im Tourismusausschuss des DIHK, der IHK Potsdam, Präsidium<br />
HOGA <strong>Brandenburg</strong> engagiert sich Herr Krsynowski für die<br />
touristische Entwicklung <strong>Brandenburg</strong>s.<br />
PR14.indd 19 16.01.2006 12:53:54<br />
19
20<br />
<strong>LASA</strong>-PRAXISHILFE Nr. 14<br />
Team Hotel und<br />
Restaurant<br />
Am Alten Rhin<br />
Darüber hinaus unterstützt Herr Krsynowski vor allem junge,<br />
touristische Unternehmen u. a. <strong>bei</strong> Betriebsgründungen, Projektentwicklungen<br />
sowie Zertifizierungen im Hotel- und Restaurantbereich.<br />
Die hohe Ar<strong>bei</strong>tsbelastung mit über 80 Stunden Einsatz pro Woche<br />
dokumentieren sein vielseitiges Tätigkeitsspektrum inner-<br />
und außerhalb des Betriebes. Dies sind im Übrigen die Zeitangaben<br />
vieler Kollegen in vergleichbaren Beherbergungs- und Gastronomiebetrieben.<br />
Bei der Messung der Fachkompetenz sind u. a. wegen der Ausbildung<br />
hohe Spezialisierungsgrade im Bereich Betriebswirtschaft,<br />
Unternehmensführung und Organisation zu verzeichnen.<br />
Führungserfahrung sammelte Herr Krsynowski in mittelgroßen<br />
Gastronomie- und Beherbergungsbetrieben in seiner vorherigen<br />
beruflichen Tätigkeit sowie durch den Besuch von Seminaren.<br />
Nach eigenen Angaben ist Führungserfahrung besonders in dem<br />
strategischen Bereich Marketing und Kommunikation sehr wichtig.<br />
Sein Credo:<br />
Eine gezielte permanente Aus- und Weiterbildung macht Sinn,<br />
auch wenn latent die Gefahr einer Know-how-Abwanderung besteht.<br />
Die betriebliche Situation:<br />
Mit 11 Festangestellten und 10 Auszubildenden bildet das Hotel<br />
und Restaurant Am Alten Rhin für die örtlichen Verhältnisse eine<br />
mittelgroße Einheit. Vor 10 Jahren haben Herr Krysnowski und<br />
seine Frau die Leitung des Betriebs übernommen.<br />
Zur Sicherung der Qualität ist der Betrieb nach DIN 9001 zertifiziert.<br />
Darüber hinaus werden – im Gegensatz zu vielen anderen<br />
Betrieben – Erfolgskontrollen wie die Berechnung des Gewinns je<br />
Vollbeschäftigten, je Betriebsstunde sowie die Betriebsergebnisse<br />
I und II angesetzt.<br />
„… Schulungen sind sehr sinnvoll, solange sie unmittelbaren Nutzen<br />
für die Mitar<strong>bei</strong>ter/den Betrieb haben. Die Mitar<strong>bei</strong>ter werden<br />
regelmäßig geschult …“ Umso wichtiger ist es, dass Weiterbil-<br />
dungsangebote für Kleinunternehmen in den nächsten Jahren<br />
passender gestaltet werden. Dafür gilt es, die Bedarfe der<br />
Betriebe genau zu kennen.<br />
PR14.indd 20 16.01.2006 12:53:54
Charakterisierung<br />
Kompetenzen<br />
„Profi-Gruppe“<br />
<strong>LASA</strong>-Praxishilfe Nr. 14<br />
Sowohl betriebliche Kooperationen (z. B. Neuruppiner Hotel AG)<br />
als auch die Vernetzung mit übergeordneten Tourismusorganisationen<br />
– insbesondere der örtlichen – werden gepflegt.<br />
Die Perspektiven werden durchwachsen eingeschätzt. Das Niveau<br />
kann nur gehalten werden, wenn weiterhin auf hohem Niveau<br />
Aktivitäten für Marketing, Kommunikation und Vernetzung getätigt<br />
werden und keine weiteren Verschärfungen der Konkurrenzsituation<br />
entstehen. Als virulentes mittelfristiges Problem – nicht nur für<br />
die Personalrekrutierung – wird die Überalterung der Bevölkerung<br />
<strong>bei</strong> gleich bleibend niedrigen Geburtenraten eingeschätzt.<br />
Seine Vision:<br />
Klein, aber fein mit hohem individuellen Servicelevel.<br />
Nutzen/Ansprüche an die Kompetenzmessung:<br />
Das Instrument Kompetenzmessung hilft, diese Erfassungslücke<br />
zu schließen, um präzise die Bedarfe für Weiterbildungen/Kompetenzsteigerungen<br />
(Ergänzungen) zu erschließen bzw. genau zu orten,<br />
wo Defizite in der Fachkompetenz auszugleichen sind. Ziel ist<br />
immer, da<strong>bei</strong> die Wettbewerbsfähigkeit des Betriebes zu sichern.<br />
Herr Krsynowski begrüßt die Aktivitäten um die Kompetenzmessung.<br />
Er kann mit dem Instrument insbesondere seine eigenen<br />
Stärken auf einen Blick einschätzen, um weiter nach Optimierungen<br />
zu suchen. Kompetenzsteigerungen sind seiner Meinung<br />
nach immer notwendig im Bereich Akquisition, Verkauf, Marketing,<br />
Produktentwicklung und Kooperationen.<br />
PR14.indd 21 16.01.2006 12:53:56<br />
21
22<br />
<strong>LASA</strong>-PRAXISHILFE Nr. 14<br />
Führungskräfte in Unternehmen wie das Hotel Am Alten Rhin<br />
haben in etwa vergleichbare Ausprägungen der Kompetenzspinnen<br />
wie die oben dargestellte von Herrn Krsynowski. Diese verfügen<br />
über sehr hohe Werte <strong>bei</strong> den Handlungskompetenzen. Aufgrund<br />
der fachlichen Ausbildung können sie auch <strong>bei</strong> den Fachkompetenzen<br />
punkten. Im Rating variiert diese Gruppe überwiegend in<br />
einem Bereich von 2,0 bis 2,5. Neben der sehr hohen sozialen,<br />
methodischen und personalen Kompetenz verfügen die Teilnehmer<br />
über weitere nahezu identische Eigenschaften:<br />
• Der Aspekt „Management“ ist in den meisten Fällen ausgeprägt.<br />
Besondere Stärken sind hier die Bereiche „Betriebsstruktur<br />
und -abläufe“ sowie „Messung Kundenerwartung“. Wird korrespondierend<br />
hierzu die Bewertung der weichen Kompetenzen<br />
– hier die soziale und die methodische Kompetenz – betrachtet,<br />
erklärt sich das Ergebnis: In nahezu allen Fällen verfügen die<br />
Teilnehmer dieser Gruppe über eine ausgeprägt hohe Gästeorientierung<br />
wie auch Team- und Kooperationsfähigkeit. Die<br />
sozialen wie auch die methodischen Kompetenzen, besonders<br />
die Führungsmethoden und die ausgeprägten konzeptionellen<br />
Fähigkeiten, gewährleisten eine gute Betriebsstruktur wie auch<br />
-abläufe. Das ist ausschlaggebend für die in vielen Fällen gut<br />
bewertete Unternehmensführung.<br />
• Das Marketing ist ebenfalls ausgeprägt – allerdings nicht ganz<br />
so stark wie das Management. Wichtig ist die Beziehung zwischen<br />
der Fachkompetenz – hier der Betriebsführung und den<br />
touristischen Kenntnissen – zu den Bereichen Marketing und<br />
Preispolitik. Hier sind noch Entwicklungspotenziale festzustellen.<br />
• Demgegenüber sind die Ziele etwas schwächer bewertet worden,<br />
als das Marketing. In der Kompetenzspinne setzen sich die<br />
Unternehmensziele aus den Partnern, der Unternehmenszukunft<br />
und den Innovationspotenzialen zusammen. Hier bietet sich ein<br />
sehr indifferentes Bild, was sicherlich auch darauf zurückzuführen<br />
ist, dass von vielen Teilnehmern die gesamtwirtschaftliche<br />
Situation mit Auswirkung auf die Unternehmenssituation als<br />
nicht beeinflussbarer Faktor bestimmt wird. Die Innovationspotenziale<br />
werden dagegen mehrheitlich als durchschnittlich<br />
bewertet.<br />
Charakterisiert werden kann die oben beschriebene Gruppe als<br />
„Profi-Gruppe“. Die Teilnehmer haben sich bereits seit längerem<br />
mit der Branche wie mit dem Unternehmen intensiv beschäftigt.<br />
Die Tätigkeiten wurden von der „Pike“ auf gelernt in Hotelfachschulen,<br />
Ausbildungsbetrieben, Hochschulen etc. Da<strong>bei</strong> ist es<br />
unerheblich, ob es sich um einen Familienbetrieb, Betriebsgesellschaften,<br />
Ketten, Kooperationen oder andere Betriebsformen<br />
handelt.<br />
PR14.indd 22 16.01.2006 12:53:56
2.2<br />
Qualität im Tourismus<br />
<strong>LASA</strong>-Praxishilfe Nr. 14<br />
Die Qualifizierungsoffensive im Tourismus im Land <strong>Brandenburg</strong><br />
Das Land <strong>Brandenburg</strong> stellt sich den Herausforderungen für die<br />
<strong>Brandenburg</strong>er Tourismuswirtschaft mit einer Qualitäts- und mit<br />
einer Qualifizierungsoffensive. Innerhalb der Qualitätsoffensive<br />
sind eine Reihe von Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität<br />
des Reiselandes <strong>Brandenburg</strong> initiiert worden: Etablierung der<br />
Tourismus-Akademie <strong>Brandenburg</strong>, Einführung des „Qualitäts-Gütesiegels<br />
für den brandenburgischen Tourismus“, Ausbildung von<br />
Qualitätscoachs nach Schweizer Vorbild und weitere Maßnahmen<br />
zur Qualitätssicherung (Klassifizierung von Beherbergungsbetrieben<br />
und „Anerkannten Tourist-Informationsstellen“ etc.).<br />
Im Rahmen einer innovativen ar<strong>bei</strong>tsmarktpolitischen Schwerpunktförderung<br />
– kurz INNOPUNKT – unter dem Titel „Qualifizierungsoffensive<br />
im Tourismus im Land <strong>Brandenburg</strong>“ wurden<br />
darüber hinaus individuelle Coaching- und Schulungseinheiten<br />
angeboten. Die vom Land hier<strong>bei</strong> ausgewählten Maßnahmen<br />
fokussieren Beschäftigte und deren unmittelbares Ar<strong>bei</strong>ts- und<br />
Betätigungsfeld zur Sicherstellung der mittel- und langfristigen<br />
Wettbewerbsfähigkeit. Die angebotenen netzwerkorientierten<br />
Schulungen und individuellen Coachingangebote sollen vor allem<br />
die Handlungskompetenz der Schulungsteilnehmer fördern und so<br />
den Wissenshorizont erweitern und die Handlungsfähigkeit steigern.<br />
Die INNOPUNKT-Kampagne wurde landesweit durchgeführt<br />
und verfolgte das Ziel, möglichst viele Unternehmen und Teilnehmer<br />
zu erreichen. Innerhalb des hier vorgestellten Projektes<br />
wurden so in den vergangenen 24 Monaten Führungskräfte aus<br />
über 240 Unternehmen modulartig qualifiziert sowie individuell<br />
beraten und gecoacht.<br />
Um vor allem auch die Wirksamkeit der Maßnahmen zu dokumentieren,<br />
hat das Land parallel zu den laufenden Schulungen eine<br />
wissenschaftliche Begleitung des Projektes veranlasst. Das Ziel<br />
des die Qualifizierungsoffensive begleitenden und nachfolgend<br />
vorgestellten Vorhabens „Kompetenzmessung“ 16 ist die Messung<br />
des Zuwachses der individuellen beruflichen Handlungskompetenz<br />
von Fach- und <strong>Führungskräften</strong> von kleinen und mittleren<br />
Unternehmen der Tourismusbranche mittels einer teils neu-, teils<br />
weiterentwickelten Messmethodik. Wichtig für den Auftraggeber<br />
waren die Ausstrahlungseffekte der Schulungen auf das Ar<strong>bei</strong>ts-<br />
und Betätigungsfeld aller Teilnehmer. Denn vor allem über die<br />
Menschen soll die Qualität im Tourismus weiter verbessert und<br />
das Reiseland <strong>Brandenburg</strong> attraktiver gestaltet werden.<br />
PR14.indd 23 16.01.2006 12:53:56<br />
23
24<br />
<strong>LASA</strong>-PRAXISHILFE Nr. 14<br />
Landhotel<br />
Märkische Höfe<br />
Fall<strong>bei</strong>spiel: „Landhotel Märkische Höfe“<br />
Die Innopunkt-Kampagne richtete sich jedoch nicht nur an<br />
etablierte touristische Einrichtungen, sondern auch an Unternehmensgründungen.<br />
Das Landhotel „Märkische Höfe“ ar<strong>bei</strong>tete<br />
zum Projektzeitstart erst seit etwa anderthalb Jahren. Frau<br />
Tandetzki-Untersteiner, die bis dahin als Erzieherin gear<strong>bei</strong>tet<br />
hatte, legt so auch besonderen Wert auf Gästeorientierung und<br />
klaren Alleinstellungsmerkmalen. Anhand der Kompetenzspinne<br />
sind deutlich die Entwicklungspotenziale im Bereich der Fachkompetenzen<br />
zu erkennen. Zudem fällt auf, dass die soziale<br />
Kompetenz mit dem Marketing korrespondiert. Insbesondere die<br />
Bewertung der Gästeorientierung im Bereich der sozialen Kompetenz<br />
wie im Marketing-Bereich zeigen, dass die Teilnehmer in<br />
dieser Gruppe hohes Interesse am Umgang mit den Gästen haben<br />
– und, wird das Ergebnis aus der personalen Kompetenz mit<br />
hinzugezogen, sich für die Gäste auch stark engagieren (Aspekt<br />
Belastbarkeit). Mithilfe der Ergebnisse aus der Kompetenzmessung<br />
können darauf basierend künftige Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen<br />
individuell bedarfsorientiert geplant und präzise<br />
ausgewählt werden.<br />
Betrieb: Landhotel Märkische Höfe (Typ: Hotel)<br />
Landhotel Märkische Höfe<br />
Dorfstr. 11<br />
16818 Netzeband<br />
Telefon: (03 39 24) 89 80<br />
Mobil: (01 73) 624 69 96<br />
Telefax: (03 39 24) 898 60<br />
Internet: www.maerkischehoefe.com<br />
E-Mail: info@maerkischehoefe.com<br />
Geschäftsführung/Inhaber: Martina Tandetzki-Untersteiner<br />
und Johann Untersteiner<br />
Kurzbeschreibung Einrichtung:<br />
Ruhige Lage, ländlich individuelles Ambiente, familienfreundlich,<br />
gute Küche, vielfältiges Angebot, viel Platz – Unterbringung großer<br />
Gesellschaften möglich. Sie bieten ein Kulturprogramm im Dorf.<br />
PR14.indd 24 16.01.2006 12:53:57
<strong>LASA</strong>-Praxishilfe Nr. 14<br />
Ein Landhotel mit Konferenz- und Tagungsräumen, Reitstall und<br />
Pferdehotel. Darüber hinaus Spielplatz und Streichelzoo, Sauna<br />
und Solarium. Im Restaurant wird mediterrane und märkische<br />
Küche angeboten.<br />
Vorstellung Interviewpartner: Martina Tandetzki-Untersteiner<br />
Frau Tandetzki-Untersteiner und ihr Mann haben den Betrieb 2002<br />
übernommen. Mit vier Festangestellten und sieben geringfügig<br />
Beschäftigten und Auszubildenden handelt es sich bezogen auf<br />
den Personalbestand um eine kleinere Einheit. Mit einem 14h Ar<strong>bei</strong>tstag/<br />
7 Tage die Woche treibt Frau Tandetzki-Untersteiner den<br />
Auf- und Ausbau des Betriebes voran. Es bleibt wenig Zeit für Freizeit<br />
und Erholung. Als gelernte Erzieherin ist Frau Tandetzki-Untersteiner<br />
eine Quereinsteigerin. Keine Seltenheit in vielen anderen<br />
Beherbergungs- und Gastronomiebetrieben <strong>Brandenburg</strong>s.<br />
Ihr Credo:<br />
„Die Vernetzung mit der Region und ein Höchstmaß an Gastfreundschaft<br />
ist wichtig für den langfristigen Unternehmenserfolg“.<br />
Die betriebliche Situation:<br />
Die Vernetzung mit Partnerbetrieben, touristischen Vereinen und<br />
Verbänden – keine Selbstverständlichkeit wie die Erhebungen zur<br />
Kompetenzmessung gezeigt haben – ist ausgeprägt <strong>bei</strong> den Märkischen<br />
Höfen. Die Kooperationen werden auch in Zukunft gepflegt,<br />
um die Konkurrenzfähigkeit des Betriebs zu erhalten.<br />
Die Perspektiven für das Unternehmen werden sehr positiv<br />
eingeschätzt. Hilfreich ist hierfür eine gewisse Alleinstellung im<br />
Produktangebot, die Spezialisierung auf anspruchsvolle Klientel<br />
(Reiter/Jäger) sowie der Anspruch, die Ursprünglichkeit des<br />
Gebäudekomplexes durch angepasste aufwändige Renovierungen/Restaurierungen<br />
zu erhalten. Ein Beitrag zur Individualität des<br />
Angebotes.<br />
Bei der Organisation des Betriebs wird viel mit Intuition gear<strong>bei</strong>tet.<br />
Es gibt keine spezifischen Ablaufpläne. Der höhere Abstimmungsbedarf<br />
bindet jedoch zusätzlich Kapazitäten der Geschäftsführung.<br />
Strategisch wichtige Informationen für das Unternehmen (Gästedaten,<br />
Marktdaten) können häufig nur neben<strong>bei</strong> gepflegt werden<br />
(stellv. für viele andere Betriebe).<br />
Ein umfassendes Controlling (Kapazitätsauslastung, Berechnung<br />
Gewinn pro Betriebsstunde) wurde anfangs nicht durchgeführt.<br />
Abhilfe wurde geschaffen, indem 2003/2004 im Rahmen von<br />
PR14.indd 25 16.01.2006 12:53:57<br />
25
26<br />
<strong>LASA</strong>-PRAXISHILFE Nr. 14<br />
Charakterisierung<br />
Kompetenzbereiche:<br />
„Konsolidierer“<br />
INNOPUNKT sechs Seminare im Rahmen der Winterakademie<br />
besucht wurden, um die ökonomischen Aufwendungen/Betriebskosten<br />
zu spezifizieren.<br />
Anm. d. Verfasser:<br />
In Familienbetrieben fokussieren sich die Entscheidungen häufig<br />
auf die Inhaberinnen/Inhaber, sodass die Steuerung von Teilprozessen<br />
nur selten über die Mitar<strong>bei</strong>ter befördert wird. Die<br />
Delegation von Aufgaben ist in Familienbetrieben deshalb nicht<br />
immer optimal. Die (zu) hohe Ar<strong>bei</strong>tsbelastung der Leitung ist<br />
dann häufig die Konsequenz. So wird die u. a. für strategische<br />
Überlegungen, neue Marketingkonzepte, Weiterbildung notwendige<br />
Zeit zu stark eingegrenzt. Frühzeitiges Reagieren auf Unternehmensentwicklungen<br />
im positiven/wie negativen Sinn wird so in<br />
Teilen gefährdet. Viele Geschäftsführer/Inhaber sind sich dieser<br />
Situation bewusst, können aber nicht viel daran ändern, da sie<br />
immer wieder von der Last des täglichen Geschäftsbetriebes<br />
eingeholt werden. Abhilfe kann hier die entsprechende Aufbauar<strong>bei</strong>t<br />
<strong>bei</strong>m Personal schaffen. Teile der Mitar<strong>bei</strong>ter sollen z. B. die<br />
Verantwortung für Beschaffung, Kapazitätenplanung übernehmen.<br />
In auslastungsschwächeren Zeiten sollten diese Dinge aktiver<br />
angegangen werden.<br />
Vision:<br />
Ausweitung des Zielgruppenmixes. Frau Tandetzki-Untersteiner<br />
möchte künftig auch auf Familien fokussieren.<br />
Nutzen/Ansprüche an die Kompetenzmessung:<br />
Nach eigenen Angaben von Frau Tandetzki-Untersteiner: Hohe<br />
Identifikation mit Kompetenzspinne, erkennt „ihre“ Kompetenzspinne.<br />
Frau Tandetzki-Untersteiner repräsentiert mit ihrem Betrieb die<br />
Untergruppe mit ausgeprägter personaler und sozialer Kompetenz.<br />
Das Rating weist hier eine Spanne von etwa 2,0 bis 3,1 auf.<br />
Signifikante Merkmale dieser Gruppe sind eine hohe Bereitschaft<br />
zur Selbstentwicklung, eine hohe Belastbarkeit wie auch eine<br />
hohe Flexibilität. Gleichzeitig gemein ist dieser Gruppe eine opti-<br />
PR14.indd 26 16.01.2006 12:53:58
2.3<br />
Instrumente der<br />
Kompetenzmessung<br />
<strong>LASA</strong>-Praxishilfe Nr. 14<br />
mierbare Fachkompetenz und dort spezielle tourismusfachliche<br />
Kenntnisse. In dieser Gruppe finden sich mehrheitlich Quereinsteiger,<br />
die besonders ihre fehlenden Fachkompetenzen – insbesondere<br />
in den Bereichen Marketing, Betriebsführung, Organisation<br />
– durch eine hohe Bereitschaft zur Selbst- und Weiterentwicklung<br />
ausgleichen wollen und können.<br />
Bei der Betrachtung der Spinne ist auffällig, dass die soziale<br />
Kompetenz mit dem Marketing korrespondiert. Insbesondere die<br />
Bewertung der Gästeorientierung im Bereich der sozialen Kompetenz<br />
wie im Marketing-Bereich zeigen, dass die Teilnehmer in<br />
dieser Gruppe hohes Interesse am Umgang mit den Gästen haben<br />
– und, wird das Ergebnis aus der personalen Kompetenz mit<br />
hinzugezogen, sich für die Gäste auch stark engagieren (Aspekt<br />
Belastbarkeit).<br />
Diese Gruppe kann als erfolgreiche Konsolidierer zusammengefasst<br />
werden, da sie fachspezifische Lücken durch einen überdurchschnittlichen<br />
Ar<strong>bei</strong>tseinsatz, insbesondere <strong>bei</strong>m Erfüllen der<br />
Wünsche für die Gäste, ausgleichen.<br />
Den Teilnehmern dieser Gruppe ist bewusst geworden, dass sie<br />
viele unternehmensbezogene Aspekte laufend oder neu anfassen<br />
und organisieren müssen. Sie sehen viele Handlungsbedarfe und<br />
möchten Lösungen kennen lernen. Ihre Aufgabenerfüllung gleicht<br />
einer Passion. Um Zeit und Kraft für strategische Überlegungen<br />
und Erholung zu sammeln, müssen hier jedoch Bereiche künftig<br />
besser delegiert werden können.<br />
Das Instrument der Kompetenzmessung in der <strong>Brandenburg</strong>er<br />
Tourismuswirtschaft im Überblick<br />
Zur Kompetenzmessung in der brandenburgischen Tourismuswirtschaft<br />
wurde gemeinsam durch die Forschungspartner IZT – Institut<br />
für Zukunftsstudien und Technologiebewertung und dwif consulting<br />
ein fünfstufiges Verfahren entwickelt und erprobt. Es dient<br />
dazu, Entwicklungsfortschritte durch Schulungs- und Coachingmaßnahmen<br />
zu bewerten. Das Verfahren gliedert sich grob in zwei<br />
Phasen (vgl. folgende Abbildung). In der ersten Phase – Entwicklungs-<br />
und Planungsphase – wird durch einen Methodenmix aus<br />
Fragebogen und Interviews eine erste Messung durchgeführt. In<br />
der Bewertungsphase erfolgt eine Überprüfung des Veränderungsprozesses.<br />
Des Weiteren werden Handlungskompetenzen in einer<br />
Vergleichsgruppe erhoben. Diese Ergebnisse unterstützen die<br />
Interpretation der zweiphasigen Kompetenzmessung.<br />
In der Entwicklungs- und Planungsphase – diese setzt sich aus<br />
der Analyse der Unternehmenssituation (erster Schritt) und dem<br />
Intensivgespräch vor Ort (zweiter Schritt) zusammen – wird die<br />
IST-Kompetenz analysiert. Wesentliche Indikatoren sind der Unternehmensaufbau<br />
und die Unternehmensstrategie, die Kernkompetenzen<br />
der Organisation (primäre Aufgaben und Funktionen) und<br />
die sich daraus ergebenden Anforderungen an Erwerbstätige – im<br />
hier gewählten Beispiel Führungskräfte von kleinen und mittleren<br />
touristischen Unternehmen in <strong>Brandenburg</strong>.<br />
PR14.indd 27 16.01.2006 12:53:58<br />
27
28<br />
<strong>LASA</strong>-PRAXISHILFE Nr. 14<br />
Phasenmodell<br />
des Projektes<br />
„Kompetenzmessung“<br />
Inhalt der Interviews sind einerseits die privaten, persönlichen<br />
und beruflichen Ziele und Zielstellungen, andererseits auch die<br />
Erwartungshaltung hinsichtlich von Coaching- bzw. Schulungsangeboten.<br />
Vor allem aber werden im Rahmen der Interviews die individuellen<br />
Handlungskompetenzen besprochen. Anhand von Indikatoren<br />
zu Teilaspekten der Handlungskompetenz werden Ar<strong>bei</strong>ts- und<br />
Verhaltensweisen mittels eines Fragebogens und eines Interviews<br />
erhoben. Die Einschätzungen erfolgen da<strong>bei</strong> einmal durch den<br />
Interviewten selbst (Selbsteinschätzung) und zum anderen durch<br />
den Interviewer (Fremdeinschätzung).<br />
Diese Ergebnisse werden in der zweiten Phase überprüft. Die<br />
Ergebnisse aus der ersten Kompetenzbewertung bilden in der<br />
Bewertungsphase die Vergleichswerte für die eigentliche Kompetenzmessung.<br />
Die Interviewpartner werden erneut gebeten, eine<br />
Selbsteinschätzung ihrer neu erworbenen Kompetenzen vorzunehmen.<br />
Dieses Interview wird erneut durch eine Fremdeinschätzung<br />
begleitet. Gemeinsam wird die Kompetenzsteigerung diskutiert,<br />
wo<strong>bei</strong> insbesondere die „weichen“ Bausteine der Handlungskompetenz<br />
– soziale, personale und methodische Themenstellungen<br />
– im Mittelpunkt stehen.<br />
Alle Ergebnisse werden sowohl für die individuellen Teilnehmerinnen<br />
und Teilnehmer als auch übergeordnet ausgewertet und<br />
diskutiert.<br />
PR14.indd 28 16.01.2006 12:54:00
Kinder – die<br />
Hauptzielgruppe<br />
im „Störitzland“<br />
<strong>LASA</strong>-Praxishilfe Nr. 14<br />
Fall<strong>bei</strong>spiel: „Kinder- und Jugendpark Störitzland“<br />
Das Instrument der Kompetenzmessung ist branchen- und betriebsgrößenunabhängig<br />
einzusetzen und kann in öffentlichen<br />
Betrieben als auch in privatwirtschaftlichen Unternehmen zur<br />
Anwendung kommen. Der Kinder- und Jugendpark „Störitzland“<br />
wurde vormals von einem eingetragenen Verein in eine <strong>GmbH</strong><br />
umgewandelt und beschäftigt heute etwa 15 Mitar<strong>bei</strong>ter. Der<br />
Geschäftsführer Herr Kohnke betont die große Bedeutung der<br />
Kundenorientierung und weist zudem darauf hin, dass das<br />
Gespräch wie der Kontakt zu den Mitar<strong>bei</strong>tern genauso wichtig<br />
ist, denn darüber wird auch das Ar<strong>bei</strong>tsklima bestimmt. Der<br />
enge direkte Kontakt zu den Mitar<strong>bei</strong>tern wie auch zu den Gästen<br />
verschafft Herrn Kohnke zusätzlich einen guten Überblick<br />
über die aktuelle Unternehmenssituation. Zusätzlich Kompetenzmessungen<br />
durchzuführen, ist aus seiner Sicht <strong>bei</strong> der<br />
noch überschaubaren Zahl der Mitar<strong>bei</strong>ter zu aufwändig. Als<br />
Unterstützungsinstrument und Beratungshilfe, insbesondere<br />
<strong>bei</strong> der Auswahl von Schulungen und Trainings, ist die Kompetenzmessung<br />
jedoch ein effektives und effizientes Instrument.<br />
Der Betrieb: Kinder- und Jugendpark „Störitzland“ (Typ: KIEZ)<br />
Geschäftsführung/Inhaber: Peter Kohnke<br />
Kurzbeschreibung Einrichtung:<br />
Störitzland Betriebsgesellschaft mbH<br />
Am Störitzsee<br />
15537 Grünheide OT Störitz<br />
Telefon: (0 33 62) 61 85<br />
Telefax: (0 33 62) 61 67<br />
Mobil: (01 70) 86 53 341<br />
Internet: www.stoeritzland.de<br />
E-Mail: info@stoeritzland.de<br />
Im Grünheider Wald- und Seengebiet liegt der internationale Kinder-<br />
und Jugendpark „Störitzland“. Die Naturanlage mit eigenem<br />
Badesee bietet auf einer 18 Hektar großen Fläche Platz für ca.<br />
500 Kinder und Jugendliche. Sie bilden die Hauptzielgruppe der<br />
Einrichtung.<br />
PR14.indd 29 16.01.2006 12:54:02<br />
29
30<br />
<strong>LASA</strong>-PRAXISHILFE Nr. 14<br />
Gebucht werden hier u. a. Klassenfahrten, Ferienaufenthalte,<br />
Wandertage, Projektwochen, Familienurlaub, Seminare und Schulungsveranstaltungen.<br />
Vorstellung Interviewpartner: Peter Kohnke<br />
Herr Kohnke ist Geschäftsführer der Störitzland Betriebsgesellschaft<br />
mbH und kommt aus der Region. Seine Berufserfahrung<br />
konnte er unter anderem als Mitar<strong>bei</strong>ter/Leiter in Jugendherbergen<br />
sammeln. Im Hinblick auf seine zukünftige Ausrichtung<br />
möchte er weiterhin die Auf- und Ausbauar<strong>bei</strong>t des KIEZ vorantreiben.<br />
Die Messungen ergaben ein hohes Maß an Sozialkompetenz<br />
sowie eine ausgeprägte Zukunftsorientierung.<br />
Herr Kohnke plant und ar<strong>bei</strong>tet langfristig. Durch intensive Werbemaßnahmen<br />
liegen für 2007 <strong>bei</strong>spielsweise schon Aufträge vor,<br />
sodass die Auslastung zu 1/3 gesichert ist.<br />
Auch als Geschäftsführer sieht er sich als Teil des Teams – dennoch<br />
natürlich Chef <strong>bei</strong> allen Entscheidungen – und er bekommt<br />
Anerkennung nicht nur im Team. Er spendiert auch mal ein Eis,<br />
wenn einem Kind eines herunterfällt „… aber nicht weitersagen<br />
…“. Auch fördert er einige gemeinnützige Vereine, die regelmäßig<br />
als Gäste Störitzland besuchen.<br />
Die betriebliche Situation:<br />
Aufgrund der wirtschaftlichen Situation und des ausgesprochen<br />
saisonal bedingten Geschäfts können nicht alle Mitar<strong>bei</strong>ter im<br />
KIEZ Störitzland ganzjährig beschäftigt werden. Mitunter entscheidend<br />
für den Unternehmenserfolg von Störitzland sind:<br />
• die Umwandlung des Geschäftsbetriebes von einem e. V. in eine<br />
<strong>GmbH</strong><br />
• das Gespräch mit den Mitar<strong>bei</strong>tern/„… das Ar<strong>bei</strong>tsklima ist das<br />
Wesentliche!“<br />
• relativ hohe Ausgaben für Werbung<br />
• laufende Modernisierungsar<strong>bei</strong>ten/Reinvestition von Einnahmeüberschüssen<br />
• Investitionssicherung – Zusammenar<strong>bei</strong>t mit Fördereinrichtungen<br />
(z. B. ILB)<br />
Das Angebot muss immer und immer wieder überar<strong>bei</strong>tet werden<br />
– „… dem Gast muss jedes Jahr etwas Neues geboten werden,<br />
einmal an Ausstattungsdetails auf dem Gelände, aber auch an<br />
Sport- und Freizeitangeboten“.<br />
PR14.indd 30 16.01.2006 12:54:03
Beachvolleyballplatz<br />
„Störitzland“<br />
Luftaufnahme Kiez<br />
Störitzsee<br />
<strong>LASA</strong>-Praxishilfe Nr. 14<br />
Entsprechend wurde/wird u. a.<br />
investiert:<br />
• Fußballplatz<br />
• Beachvolleyballplatz<br />
• Kleiner Fuhrpark Jugendmotor-<br />
räder<br />
• Gastgeschenke (Tassen,<br />
T-Shirts mit Logo, Postkarten)<br />
• Internetseitenpflege<br />
• Energiesparmaßnahmen<br />
(Wasserfilter)<br />
Gleichzeitig müssen neue Einnahmemöglichkeiten entwickelt<br />
werden. Durch die Nähe zum See hat sich hier fast automatisch<br />
die Möglichkeit geboten, während der Wochenenden im Sommer<br />
ein Strandbad zu eröffnen. An dem Badestrand entsteht so die<br />
Chance, dass sich auch Eltern einfinden, die künftig ihre Kinder in<br />
den KIEZ Störitzsee schicken. Darüber hinaus plant Herr Kohnke<br />
den Aufbau einer gastronomischen Einrichtung, um weitere Möglichkeiten<br />
für Essen/Café für Besucher und Betreuer zu schaffen.<br />
In auslastungsschwachen Zeiten werden z. B. Silvesterfeiern für<br />
ca. 200 Gäste ausgerichtet.<br />
Ein professionell eingerichteter Rezeptionsbereich gewährleistet,<br />
dass vor<strong>bei</strong>kommende Wanderer eine ausführliche Beratung erhalten.<br />
Oft wird eine Betriebsführung zur Gewinnung der potenziellen<br />
Gäste (Kinder der Wanderer) von Herrn Kohnke angeschlossen.<br />
Hauptgeschäft bleiben die Kinder und Jugendreisen. „… Wichtig<br />
ist das Schaffen von eindeutigen Alleinstellungsmerkmalen.<br />
Darüber hinaus wird die Stammkundschaft gezielt umworben. So<br />
erhalten Eltern, deren Kinder mehrmals das Kinderferienlager im<br />
Störitzland besuchen, Rabatte.<br />
Besonders nach der Abreise von (Kinder- oder Jugend-)Gruppen<br />
werden Teamsitzungen durchgeführt, um zu diskutieren, was gut<br />
und was weniger gut lief. Die Auswertung der Meckerzettel ist<br />
da<strong>bei</strong> besonders wichtig. Überstunden werden im Team vorausgesetzt.<br />
Das Team entscheidet <strong>bei</strong> neuen Bewerbern mit, ob diese<br />
ins Team passen.<br />
PR14.indd 31 16.01.2006 12:54:06<br />
31
32<br />
<strong>LASA</strong>-PRAXISHILFE Nr. 14<br />
Motorradfahren<br />
für Kinder<br />
2.4<br />
Kompetenzentwicklung<br />
– ein Prozess des<br />
Lebenslangen Lernens<br />
Herr Kohnke betreibt aktives Beschwerdemanagement: „Mit allem<br />
zufrieden, das kann nicht sein … so helfen sie uns nicht …“ Herr<br />
Kohnke fordert <strong>bei</strong> seinen Gästen Kritik heraus. Kleinere Mängel<br />
(z. B. Spiegel im Betreuerraum) werden dann – häufig noch in<br />
Anwesenheit der Gäste – sofort behoben.<br />
Vision<br />
Das Kiez muss sich immer verändern und immer besser werden.<br />
Das KIEZ muss höchsten Qualitätsanforderungen genügen, um<br />
weiterhin bestehen zu können. Deshalb muss nicht nur der Service<br />
stetig verbessert werden. Langfristig soll Störitzland in den<br />
vorderen Plätzen der Kieze in <strong>Brandenburg</strong> rangieren.<br />
Nutzen/Ansprüche an die Kompetenzmessung:<br />
Als Unterstützungsinstrument und Beratungshilfe ist das Instrument<br />
aus Sicht von Herrn Kohnke geeignet. Er verwendet<br />
es jedoch nicht als Managementinstrument, da es für die Zahl<br />
der Mitar<strong>bei</strong>ter (unter 15) zu aufwendig hält. Er hat den Nutzen<br />
gezogen: „…was muss ich weiter beachten, um als Unternehmer<br />
erfolgreich zu bleiben; in welchen Bereichen benötige ich noch<br />
Weiterbildung.<br />
Ziele von Kompetenzmessungen<br />
Lebenslanges Lernen durchbricht den Ablauf strikt aufeinander<br />
folgender Abschnitte eines Bildungsweges, der oft mit dem<br />
Schul- oder dem Hochschulabschluss beendet ist. Häufig wird<br />
„Lebenslanges Lernen“ nur verstanden als die Anpassung von<br />
Qualifikationen an neue Erfordernisse, die im Berufsleben aus<br />
dem technischen Fortschritt erwachsen. Lebenslanges Lernen<br />
bedeutet aber darüber hinaus:<br />
• den Wiedereinstieg in Bildungswege zu ermöglichen;<br />
• die im Beruf erworbenen, aber nicht formal bescheinigten Kompetenzen<br />
auszubauen bzw. zu erhalten.<br />
Lebenslanges Lernen schließt auch mit ein, Bildung als Weg zu<br />
mehr Eigenverantwortlichkeit im Leben anzubieten. Es umfasst<br />
also die Gesamtheit allen formalen, nicht-formalen und informellen<br />
Lernens ein Leben lang.<br />
PR14.indd 32 16.01.2006 12:54:08
Eigene Stärken<br />
entwickeln<br />
<strong>LASA</strong>-Praxishilfe Nr. 14<br />
Zu wenig werden im Laufe eines Erwerbslebens die privaten, persönlichen<br />
und beruflichen Ziele und Zielstellungen überprüft und<br />
hinterfragt. Der Erfolg hängt jedoch von einem ständigen Lernen,<br />
einer ständige Zielanpassung ab. Dies zu erreichen erfordert<br />
u. a. gezielte Coaching- bzw. Schulungsmaßnahmen. Ein Teil der<br />
Kompetenzmessung ist die Messung der individuellen Erwartungshaltungen<br />
hinsichtlich des Coaching- und Schulungsangebotes.<br />
Anhand von Indikatoren zu Teilaspekten der Handlungskompetenz<br />
werden Ar<strong>bei</strong>ts- und Verhaltensweisen erörtert und bewertet.<br />
Der Kompetenzstern (vgl. Gliederungspunkt 2.6) visualisiert da<strong>bei</strong><br />
Kompetenzen und ihre Abhängigkeiten. Er misst acht Basisbereiche.<br />
Der Kompetenzstern ist ein Werkzeug zur Navigation der<br />
individuellen Kompetenzen unter Berücksichtigung von Umfeldfaktoren.<br />
Eine Besonderheit ist da<strong>bei</strong> die Berücksichtigung externer<br />
Einflussfaktoren, zu denen neben den wirtschaftlichen und<br />
unternehmerischen Indikatoren auch das persönliche Umfeld der<br />
Befragten gehört.<br />
Je nach Gewichtung der in der Kompetenzspinne aufgeführten<br />
Kategorien können mithilfe einer ersten Kompetenzeingangsmessung<br />
mögliche Handlungsbedarfe aufgezeigt werden. Die<br />
Dokumentation des jeweiligen individuellen Kompetenzzuwachses<br />
wird sichergestellt. Überdies werden die Beziehungen zwischen<br />
Kompetenz und Unternehmenssituation visualisiert.<br />
Eine wesentliche Stärke der Kompetenzmessung im vergleichenden<br />
Modus ist die Dokumentation der eigenen Stärken, die für<br />
den jeweiligen Bewerteten durchaus auch motivierende Aspekte<br />
haben kann. Damit ist nicht nur ein Mess-, sondern auch ein Planungsinstrument<br />
entwickelt worden.<br />
Das Instrument der Kompetenzmessung wird auch in kleinen und<br />
mittleren touristischen Betrieben und Einrichtungen immer wichtiger,<br />
zumal die Anforderungen an die Beschäftigten besonders<br />
in den Bereichen der Sozial-, Methoden- oder Personalkompetenz<br />
weiter steigen.<br />
Damit das Instrument zielgerichtet eingesetzt werden kann, werden<br />
die Anforderungsprofile der beteiligten Fach- und Führungskräfte<br />
spezifiziert und die bereits bestehenden Ar<strong>bei</strong>tsplatz- und<br />
Qualifikationsprofile der Tourismusbranche mit in die Bewertung<br />
einbezogen.<br />
Durch die Kompetenzmessung wird sichergestellt, dass die für<br />
das Unternehmen und für die strategische Entwicklung des Unternehmens<br />
wichtigen Kompetenzen aufgebaut werden. Im Einzelnen<br />
werden:<br />
• diejenigen Kompetenzen identifiziert, die bereits vorhanden<br />
sind, aber noch nicht mit in die Unternehmensplanung mit einbezogen<br />
worden sind.<br />
• Mitar<strong>bei</strong>ter mit relevanten, für den Geschäftserfolg entscheidenden<br />
Schlüsselqualifikationen – die so genannten Leistungsträger<br />
– ermittelt. Dadurch können vor allem vorhandene<br />
PR14.indd 33 16.01.2006 12:54:08<br />
33
34<br />
<strong>LASA</strong>-PRAXISHILFE Nr. 14<br />
2.5<br />
Kompetenzsternabbildung<br />
der<br />
Schwächen und<br />
Stärken<br />
Kompetenzstern für<br />
Geschäftsführer von<br />
kleinen und mittleren<br />
Unternehmen in <strong>Brandenburg</strong><br />
(Beispiel) 18<br />
Mitar<strong>bei</strong>ter gezielt gefördert und dadurch auch im Unternehmen<br />
gehalten werden. Neueinstellungen könnten nach dem gleichen<br />
Muster erfolgen.<br />
• Qualifizierungsmaßnahmen gezielt ausgewählt und durchgeführt.<br />
Anhand des Qualifikations- und Kompetenzprofils können<br />
darüber hinaus die Maßnahmen nahezu individuell und leistungsgerecht<br />
angepasst werden. Dadurch lässt sich gleichzeitig<br />
die Effektivität und Effizienz der Maßnahmen deutlich erhöhen.<br />
• Durch die regelmäßigen Gespräche und Interviews im Rahmen<br />
einer Kompetenzmessung können durchgeführte Schulungen<br />
und Qualifizierungsmaßnahmen auf ihre mittel- und langfristigen<br />
Effekte hin überprüft werden.<br />
Der Kompetenzstern als Basis des Businesschecks und zur<br />
Visualisierung der Ergebnisse<br />
Eine Grundlage für die Visualisierung der Ergebnisse bildet der<br />
Kompetenzstern. Er ist als Werkzeug für die Visualisierung,<br />
Beurteilung und Profilierung der Kompetenzen und der davon<br />
abhängenden Faktoren entwickelt worden. 17 Der Kompetenzstern<br />
zeigt in seinem Inneren eine ringförmige Bewertungsskala mit den<br />
subjektiven Werten von -- (sehr schlecht) bis ++ (sehr gut). Auf<br />
dieser Skala sind sternförmig acht Grundkompetenzen aufgeführt.<br />
Sie sind für Unternehmen, Produkte oder Projekte im Wesentlichen<br />
gleich (vgl. Abbildung).<br />
Quelle: dwif/IZT 2005 in Anlehnung an den Stein<strong>bei</strong>s-Business-Check (SBC)<br />
Auf der linken Seite sind die unternehmensinternen Daten aufgeführt,<br />
auf der rechten Seite die Handlungskompetenz.<br />
Zunächst bewerten die Interviewpartner ihre Kompetenzen. Sie<br />
werden da<strong>bei</strong> durch den Interviewer unterstützt. Die Fragen sind<br />
weitestgehend auf kleine und mittlere Unternehmen in der Tourismusbranche<br />
ausgerichtet und enthalten über 160 Einzelindikatoren,<br />
mit denen die Handlungskompetenz erfasst wird.<br />
PR14.indd 34 16.01.2006 12:54:09
<strong>LASA</strong>-Praxishilfe Nr. 14<br />
Der Kompetenzstern ist letztendlich ein Werkzeug zur Visualisierung<br />
der Kompetenzen und ihrer Abhängigkeiten. Folgende<br />
Ausprägungen sind relevant für kleine und mittlere Unternehmen<br />
in <strong>Brandenburg</strong>:<br />
• Verwendung für unterschiedliche Unternehmen und deren Produkte,<br />
• Messung von acht Basisbereichen,<br />
• Detaillierung und Individualisierung auf die INNOPUNKT-6-Teilnehmer,<br />
• Visualisierung von Kompetenzbewertungen in einem Sterndiagramm,<br />
• Erfassung und Aufbereitung komplexer Zusammenhänge,<br />
• Ermöglichung eines Vergleichs unter den kleinen und mittleren<br />
Unternehmen,<br />
• Nutzung des Kompetenzsterns als ein Werkzeug zur Navigation<br />
der individuellen Kompetenzen unter Berücksichtigung von Umfeldfaktoren.<br />
Nach der statistischen Auswertung der im Interview erhobenen<br />
Daten wurden diese auf wesentliche Merkmale der Handlungskompetenz<br />
aggregiert. Die jeweiligen Aspekte wurden in eine<br />
Sternabbildung übertragen und miteinander verbunden. Der so<br />
entstehende Stern – bzw. die Spinne – gibt die individuelle Kompetenzcharakteristik<br />
wider. Gleichzeitig bietet diese Darstellung<br />
auch die Möglichkeit, Kompetenzcharakteristiken miteinander zu<br />
vergleichen, indem <strong>bei</strong>de in die Kompetenzspinne eingetragen<br />
werden und so eine Visualisierung der Unterschiede bieten.<br />
Fall<strong>bei</strong>spiel: „HausRheinsberg“<br />
Aus Sicht von Herrn Schmidt vom HausRheinsberg ist die Visualisierung<br />
von Unternehmenserfolg und beruflicher Handlungskompetenz<br />
besonders hilfreich <strong>bei</strong> der gemeinsamen Planung<br />
von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen. Das HausRheinsberg<br />
hat etwa 50 Mitar<strong>bei</strong>ter und bietet körperbehinderten<br />
Menschen einen mit 4-Sterne-Hotels vergleichbaren Service.<br />
Damit verfügt das Haus über klare Alleinstellungsmerkmale<br />
im Segment der Rehabilitation körperbehinderter Menschen.<br />
Die Mitar<strong>bei</strong>terfluktuation ist ausgesprochen niedrig. Ein Grund<br />
hierfür sind regelmäßige Teammeetings, eine klare Regelung<br />
der Verantwortungsbereiche und regelmäßige Schulungen.<br />
Entsprechend positiv fallen die Ergebnisse <strong>bei</strong> der Messung<br />
der Teammotivation aus. Mindestens einmal im Monat trifft<br />
sich das Team, um Wünsche, Probleme und Anregungen zu<br />
äußern. Um die Anforderungen der Zielgruppe zu erfüllen,<br />
sind die Mitar<strong>bei</strong>ter sowohl aus der pflegerischen als auch<br />
aus der touristischen Perspektive in gewisser Hinsicht doppelt<br />
gefordert. Im Ergebnis der Kompetenzmessung konnte hier<br />
festgestellt werden, dass eine sehr hohe ausgeprägte personale<br />
Kompetenz mit den Bereichen des Managements und des<br />
PR14.indd 35 16.01.2006 12:54:09<br />
35
36<br />
<strong>LASA</strong>-PRAXISHILFE Nr. 14<br />
Impressionen<br />
Hotel am See<br />
HausRheinsberg<br />
Marketings korrespondieren. Daher sei eine Fortführung bzw.<br />
Weiterentwicklung des Kompetenzmessinstruments zu einem<br />
Management- und Personalentwicklungsinstrument durchaus<br />
denkbar.<br />
Der Betrieb: Hotel am See HausRheinsberg (Typ: Hotel)<br />
Vertretungsberechtigte<br />
Geschäftsführerin: Corinna Abele<br />
HausRheinsberg g<strong>GmbH</strong><br />
Hotel am See<br />
Donnersmarckweg 1<br />
16831 Rheinsberg<br />
Tel.: (03 39 31) 3 44-0<br />
Fax: (03 39 31) 3 44-5 55<br />
Internet: www.hausrheinsberg.de<br />
E-Mail: post@hausrheinsberg.de<br />
Kurzbeschreibung Einrichtung:<br />
Auf einem Areal von 14.000 m2 ist eine gegliederte Hotelanlage<br />
mit drei Gästehäusern (108 Gästezimmer)<br />
und einem Zentralgebäude<br />
durch die Fürst Donnersmarck-Stiftung<br />
zu Berlin errichtet<br />
worden. Im Zentralgebäude<br />
befinden sich Gemeinschaftsräume<br />
wie Restaurant, Hotelbar, Seminarräume, Schwimmbad,<br />
Fitnesscenter, Kegelbahn sowie eine große Mehrzweckhalle, die<br />
„Seehalle“.<br />
PR14.indd 36 16.01.2006 12:54:15
Sport im Hotel am See<br />
HausRheinsberg<br />
<strong>LASA</strong>-Praxishilfe Nr. 14<br />
Die betriebliche Situation:<br />
Barrierefreier Tourismus für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen<br />
ist das Ziel der Anlage. Der schwellenlose Zugang zu<br />
Zimmern und Balkonen ist selbstverständlich. Die Bäder sind bis<br />
ins Detail rollstuhlgerecht ausgestattet, viele haben höhenverstellbare<br />
Waschtische. Die Freizeitbereiche wie Sauna, Schwimmbad<br />
mit Rutsche und Lifter, Kegelbahn und Fitnessräume sind rollstuhlgerecht.<br />
Seit 2001 hat das Hotel den Betrieb aufgenommen.<br />
Mit rund 50 Angestellten und 25 Auszubildenden ist der Betrieb<br />
ein bedeutender Ar<strong>bei</strong>tgeber für Rheinsberg und die regionale<br />
Wirtschaft (Zulieferer). Mit einer Zimmerauslastung um die 60 %<br />
liegt der Betrieb weit über dem Landesdurchschnitt.<br />
Auf der Internationalen Tourismusmesse in Berlin verlieh das<br />
Ministerium für Wirtschaft des Landes <strong>Brandenburg</strong> den Tourismuspreis<br />
2002. HausRheinsberg – Hotel am See erhielt den 2.<br />
Platz für innovative Dienstleistungen und Marketing. Eigene Seminarbesuche<br />
und die der Mitar<strong>bei</strong>ter sollen die Qualität sichern und<br />
dazu dienen, die Vorreiterfunktion des Hauses zu erhalten und<br />
auszubauen.<br />
Am 29. August 2003 wurde das HausRheinsberg<br />
Hotel am See mit dem Qualitäts-Gütesiegel<br />
für den brandenburgischen Tourismus<br />
Stufe 1 ausgezeichnet.<br />
Das Hotel ist mit allen relevanten Vertretern der Tourismuswirtschaft<br />
auf örtlicher, regionaler und landesweiter Ebene vernetzt.<br />
Im Segment barrierefreier Tourismus für Menschen mit Mobilitätseinschränkung<br />
hat dieser außergewöhnliche Betrieb eine<br />
Alleinstellung nicht nur in <strong>Brandenburg</strong>. Entsprechend gut werden<br />
die Perspektiven für das Unternehmen von der Hotelleitung eingeschätzt.<br />
PR14.indd 37 16.01.2006 12:54:17<br />
37
38<br />
<strong>LASA</strong>-PRAXISHILFE Nr. 14<br />
Vorstellung Interviewpartner:<br />
Corinna Abele und Siegfried Schmidt<br />
Frau Corinna Abele leitet als verantwortliche<br />
Hoteldirektorin das HausRheinsberg.<br />
Sie koordiniert die Aufgaben der Abteilungen<br />
im Hotel und ist für eine Tochtergesellschaft<br />
der Fürst Donnersmarck-Stiftung<br />
als Geschäftsführerin verantwortlich.<br />
Herr Siegfried Schmidt präsentiert das Hotel<br />
<strong>bei</strong> Verbänden, Institutionen, Gruppen<br />
und Organisationen. Der Besuch und die<br />
Teilnahme an allen Fachmessen ergänzt<br />
das Aufgabengebiet.<br />
Das Hotel wird von der gelernten Hotelfachfrau Corinna Abele seit<br />
vier Jahren geleitet. Ihre Führungserfahrung hat Sie sich insbesondere<br />
in der Praxis angeeignet. Seminare haben dazu <strong>bei</strong>getragen,<br />
die Führungskompetenzen auszubauen.<br />
Diplomatie, Einfühlungsvermögen und Fingerspitzengefühl bedeuten<br />
da<strong>bei</strong>, Mitar<strong>bei</strong>ter einzubeziehen und sie nach ihrer Meinung<br />
zu fragen. Auf diese Weise kann das Gefühl der Bevormundung<br />
vermieden werden.<br />
Entsprechend positiv fallen die Ergebnisse <strong>bei</strong> der Messung<br />
der Teammotivation aus. Die Mitar<strong>bei</strong>terfluktuation ist gering.<br />
Wöchentlich trifft sich das Abteilungsleiter-Team, um Wünsche,<br />
Probleme und Anregungen zu äußern. Um auch die Betriebsergebnisse<br />
zu erzielen, wird von der Geschäftsführung an einem<br />
Businessplan gear<strong>bei</strong>tet. Die Zuständigkeitsbereiche sind klar<br />
festgelegt. Um die Anforderungen der Zielgruppe zu erfüllen, sind<br />
die Mitar<strong>bei</strong>ter sowohl aus der pflegerischen als auch aus der<br />
touristischen Erholungsperspektive in gewisser Hinsicht doppelt<br />
gefordert. Die dafür geforderte Motivation setzt auch entsprechend<br />
hohe Führungsansprüche an die Leiter der jeweiligen<br />
Abteilungen. Für einen reibungslosen Ablauf ar<strong>bei</strong>tet der Betrieb<br />
mit Checklisten.<br />
Frau Abele und Herr Schmidt zeigen hohes Engagement in der<br />
Marktforschung 19 : aktives Beschaffen von Marktdaten; Berücksichtigung<br />
der Marktinformationen vom Verband; Teilnahme auf<br />
Tagungen; Beteiligung Gästebefragungen Region; hausinterne<br />
Befragungen; aktives Beschwerdemanagement; eigene Leute für<br />
Beschaffung/Interpretation Marktdaten/Marktinformationen. Daraufhin<br />
wird entsprechend das Angebot/die Produkte angepasst,<br />
PR14.indd 38 16.01.2006 12:54:17
<strong>LASA</strong>-Praxishilfe Nr. 14<br />
erneuert, modifiziert. Außerdem werden gezielte Mailingaktionen<br />
durchgeführt.<br />
Credo:<br />
Höchste Produktqualität, um die Ansprüche zu 100 % zu erfüllen.<br />
Vision:<br />
Ein langfristig angelegter Zielgruppenmix ist Garant für eine weiterhin<br />
gute und verbesserte Auslastung.<br />
Nutzen/Ansprüche an die Kompetenzspinne:<br />
Hohe Identifikation mit der Kompetenzspinne; Unternehmenserfolg<br />
und berufliche Handlungskompetenz auf einen Blick; Fortführung<br />
als Management- und Personalentwicklungsinstrument<br />
denkbar.<br />
Zusammenfassung<br />
Die Kompetenzspinne bietet die Möglichkeit, Beziehungen<br />
zwischen Kompetenz und Unternehmenssituation darzustellen.<br />
Je nach Gewichtung der in der Kompetenzspinne aufgeführten<br />
Kategorien können die Ergebnisse mögliche Handlungsbedarfe<br />
aufzeigen. Ein wesentlicher Vorteil der Kompetenzspinne im vergleichenden<br />
Modus ist die Dokumentation der eigenen Stärken,<br />
die für den jeweiligen Bewerteten durchaus auch motivierende<br />
Aspekte haben kann, wie auch die Analysefähigkeit anhand der<br />
Ausprägungen der Kompetenzspinne. Beziehungen und Zusammenhänge<br />
zwischen einzelnen Teilbereichen lassen sich aufzeigen<br />
und – soweit möglich und notwendig – gegebenenfalls durch<br />
gezielte Schulungsangebote und spezielle Coachings optimieren.<br />
Ferner können <strong>bei</strong>spielsweise in größeren analysierten Gruppen<br />
anhand von bestimmten Merkmalen Unter- bzw. Teilgruppen<br />
gebildet werden und für diese dann spezielle Bildungsangebote<br />
entwickelt werden.<br />
Sowohl für die hier <strong>bei</strong>spielhaft dargestellten „Konsolidierer“ als<br />
auch für die „Profi-Gruppe“ gilt, dass sie genügend Hinweise gegeben<br />
haben, wie man Betriebe auch <strong>bei</strong> angespannter allgemeiner<br />
Wirtschaftslage – auch wenn die Prozessabläufe nicht immer<br />
100-prozentig gesteuert werden – erfolgreich führen kann. Dies<br />
soll als Anregung und Motivation, nicht als Belehrung, verstanden<br />
werden.<br />
PR14.indd 39 16.01.2006 12:54:18<br />
39
40<br />
<strong>LASA</strong>-PRAXISHILFE Nr. 14<br />
2.6<br />
Strategieentwicklung<br />
mittels<br />
Kompetenzmessung<br />
Stärkung der<br />
Wettbewerbssituation<br />
Fazit: Kompetenzmessung als Instrument der<br />
Strategieentwicklung<br />
Vor dem Hintergrund des strukturellen Wandels und hohem<br />
Wettbewerbsdruck haben Unternehmen aller Größenklassen einen<br />
höheren Bedarf auch an mittel- und langfristigem Orientierungswissen.<br />
Nur so können zukunftsweisende Produkte und Dienstleistungen<br />
entwickelt und auf sich wandelnden Märkten positioniert<br />
werden. Dass diese Herausforderungen nur in einem engen<br />
Miteinander von Führungsebenen und kompetenten Mitar<strong>bei</strong>terinnen<br />
und Mitar<strong>bei</strong>tern bewältigt werden kann, darf bereits als<br />
„Binsenweisheit“ gelten. Ebenso hat sich die Erkenntnis durchgesetzt,<br />
dass das für wirtschaftliche Zukunft von Unternehmen<br />
erforderliche Wissen nicht nur punktuell durch Aus- und Weiterbildung<br />
erworben werden kann und dass Sozial-, Methoden- oder<br />
Personalkompetenz da<strong>bei</strong> auch weiter an Bedeutung gewinnen<br />
werden. Kompetenzsteigerung ist ein kontinuierlicher Prozess, der<br />
von effektiven und effizienten Maßnahmen profitiert. Die Chancen,<br />
die die Kompetenzmessung für Innovation und Beschäftigung<br />
bietet, liegen folglich in der individuellen und kollektiven Effizienzsteigerung.<br />
Das im Rahmen der INNOPUNKT-Kampagne entwickelte Verfahren<br />
zur Kompetenzmessung und die Visualisierung als „Kompetenzspinne“<br />
bieten die Möglichkeit, Verflechtungen zwischen<br />
den Kompetenzen von Erwerbstätigen und der jeweiligen Unternehmenssituation<br />
darzustellen. Je nach Gewichtung der in der<br />
Kompetenzspinne aufgeführten Kategorien zeigen die Ergebnisse<br />
Handlungsbedarfe auf. Ein wesentlicher Vorteil der Kompetenzspinne<br />
im vergleichenden Modus ist die Dokumentation der<br />
jeweils eigenen Stärken: Hier werden Potenziale zur Motivierung<br />
genutzt. Beziehungen und Zusammenhänge zwischen einzelnen<br />
Teilbereichen werden aufgezeigt und können darauf aufbauend<br />
durch gezielte Schulungsangebote und spezielle Coachingmaßnahmen<br />
optimiert werden. Der unternehmensübergreifende<br />
Ansatz ermöglicht darüber hinaus Erkenntnisse, die im Sinne der<br />
Wirtschafts- und Regionalentwicklung nicht nur den Unternehmen,<br />
sondern auch Ar<strong>bei</strong>tgeber- und Ar<strong>bei</strong>tnehmerverbänden sowie<br />
Verwaltung und Politik befruchten sollen.<br />
Beispielswiese werden durch die Einführung der neuen Baseler<br />
Eigenkapitalvereinbarungen (kurz Basel II) und die damit verbundenen<br />
Ratings umfangreiche Informationen zusammengestellt,<br />
die einen Eindruck über das Unternehmen verschaffen sollen. In<br />
diesem Rahmen werden nicht nur die Kreditwürdigkeit, sondern<br />
auch strategische und organisatorische Aspekte (Unternehmensnachfolge,<br />
Wissensmanagement, Wertschöpfungsketten, Leistungsträger<br />
usw.) beleuchtet. Auch hier kann die Kompetenzmessung<br />
als vorbereitendes, unterstützendes Instrument vor allem im<br />
Bereich des Personalmanagements (Weiterbildung, Förderung der<br />
Leistungsträger usw.) zur Anwendung kommen.<br />
PR14.indd 40 16.01.2006 12:54:18
3<br />
3.1<br />
Leseempfehlungen<br />
<strong>LASA</strong>-Praxishilfe Nr. 14<br />
„Kompetenzmessung und Kompetenzentwicklung“<br />
Ar<strong>bei</strong>tsstab Forum Bildung in der Geschäftsstelle der Bund-Länder-<br />
Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung<br />
(2001):<br />
Kompetenzen als Ziele von Bildung und Qualifikation. Bericht<br />
der Expertengruppe des Forums. Der Bericht wendet sich<br />
primär an das Forum Bildung. Er dient als Grundlage für die<br />
Erar<strong>bei</strong>tung von Empfehlungen durch das Forum Bildung. Der<br />
Bericht wendet sich darüber hinaus an eine breite Öffentlichkeit,<br />
um die öffentliche Debatte von Empfehlungsentwürfen<br />
des Forum Bildung zum Themenschwerpunkt „Bildungs- und<br />
Qualifikationsziele von morgen“ zu unterstützen.<br />
Baitsch, C. (1996): Kompetenz von Individuen, Gruppen und Organisationen.<br />
Psychologische Überlegungen zu einem Analyse-<br />
und Bewertungskonzept, in: Denisow, K./Fricke, W./Stieler-Lorenz,<br />
B.: Partizipation und Produktivität. Zu einigen kulturellen<br />
Aspekten der Ökonomie. Bonn.<br />
Bunk, G. P. (1994): Kompetenzvermittlung in der beruflichen Aus-<br />
und Weiterbildung in Deutschland. In: Europäische Zeitschrift<br />
für Berufsbildung 1/94. Gerhard P. Bunk ist Professor an der<br />
Universität Gießen. Seit langen Jahren ist er im REFA-Verband<br />
für Ar<strong>bei</strong>tsstudien und Betriebsorganisation tätig und leitete<br />
den Grundsatzausschuss Betriebspädagogik und Personalentwicklung.<br />
Erpenbeck, J. (1996): Kompetenz und kein Ende? In: QUEM-Bulletin,<br />
Heft 1/96. Berlin.<br />
Erpenbeck, J./Heyse, V. (1999): Die Kompetenzbiographie: Strategien<br />
der Kompetenzentwicklung durch selbstorganisiertes<br />
Lernen und multimediale Kommunikation. Ar<strong>bei</strong>tsgemeinschaft<br />
Qualifikations-Entwicklungs-Management (QUEM) (Hrsg.), Edition<br />
QUEM, Bd. 10. Münster.<br />
Mit der Kompetenzbiographie wird eine neu entwickelte Erfassungs-<br />
und Darstellungsmethode vorgestellt. Sie fokussiert<br />
auf diejenigen biographischen Ereignisse, die für die berufliche<br />
Kompetenzentwicklung retrospektiv wichtig, gegenwärtig nutzbar<br />
oder prospektiv zu fördern sind.<br />
Erpenbeck, J./von Rosenstiel, L. (Hrsg.) (2003): Handbuch<br />
Kompetenzmessung. Erkennen, verstehen und bewerten von<br />
Kompetenzen in der betrieblichen, pädagogischen und psychologischen<br />
Praxis. Stuttgart.<br />
Wie kann man Kompetenzen erkennen, charakterisieren und<br />
messen? In diesem Handbuch wird – erstmalig nach europäischem<br />
Maßstab – das gesamte Spektrum von Verfahren der<br />
Kompetenzmessung und -charakterisierung anhand zahlreicher<br />
Beispiele präsentiert. Die Autoren beschreiben zahlreiche<br />
Verfahren, die in der betrieblichen und pädagogischen Praxis<br />
eingesetzt werden. In einem vergleichenden Ausblick wird der<br />
Bezug zu Methoden hergestellt, wie sie in modernen psycholo-<br />
PR14.indd 41 16.01.2006 12:54:18<br />
41
42<br />
<strong>LASA</strong>-PRAXISHILFE Nr. 14<br />
gischen Diagnostik-, Personalauswahl- und Ar<strong>bei</strong>tsanalyseverfahren<br />
angewandt werden.<br />
Frieling, E.; Kauffeld, S.; Grote, S.; Bernard, H. (2000): Flexibilität<br />
und Kompetenz: Schaffen flexible Unternehmen kompetente<br />
und flexible Mitar<strong>bei</strong>ter? Berlin.<br />
Mit dem Kasseler-Kompetenz-Raster (KKR) können erstmals<br />
Kompetenzen anhand objektiver Verhaltensdaten untersucht<br />
und unternehmensübergreifend verglichen werden: Bestimmt<br />
wurde die Unternehmensflexibilität von 140 Unternehmen,<br />
zudem wurden die Kompetenz und Flexibilität von insgesamt<br />
400 Mitar<strong>bei</strong>tern und Mitar<strong>bei</strong>terinnen aus den Produktions-<br />
und Planungsbereichen von 20 Unternehmen am Standort<br />
Deutschland erhoben. Da<strong>bei</strong> zeigt sich nicht nur, dass die<br />
Sozialkompetenz zur Bewältigung von Optimierungsaufgaben<br />
weit überschätzt wird, sondern auch, dass eigene Entscheidungsspielräume<br />
nicht genutzt und konkrete Maßnahmen zur<br />
Problemlösung oft nicht ergriffen werden.<br />
Gillen, J. (2003): Kompetenzanalyse und Kompetenzerhebung –<br />
eine Bestandsaufnahme aus ar<strong>bei</strong>tnehmerorientierter Perspektive,<br />
Hamburg 2003. Das Entwicklungs- und Forschungsprojekt<br />
KomNetz (Kompetenzentwicklung in vernetzten Lernstrukturen<br />
– Gestaltungsaufgabe für betriebliche und regionale Sozialpart-<br />
ner) hat zum Ziel, die Kompetenzentwicklung von Beschäftigten<br />
und Interessenvertretungen zu untersuchen, zu gestalten<br />
und auszubauen. Es richtet sich an Beschäftigte, Betriebs- und<br />
Personalräte und regionale Kooperationspartner. Im Web unter:<br />
http://www2.hsu-hh.de/PWEB/paebap/forsch/komnetz/<br />
downloads/Kompetenzanalyse_und _Kompetenzerhebung.pdf.<br />
Lichtenberger, Y. (1999): Von der Qualifikation zur Kompetenz. Die<br />
neuen Herausforderungen der Ar<strong>bei</strong>tsorganisation in Frankreich.<br />
In: Kompetenzentwicklung 99. Aspekte einer neuen<br />
Lernkultur: Argumente, Erfahrungen, Konsequenzen. Münster,<br />
S. 257-305: 00/01 QIQ3678-4<br />
Staudt, E. (1998): Kompetenz zur Innovation – Defizite der<br />
Forschungs-, Bildungs-, Wirtschafts- und Ar<strong>bei</strong>tsmarktpolitik,<br />
in: Klemmer, P.; Becker-Soest, D.; Wink, R. (Hrsg.): Liberale<br />
Grundrisse einer zukunftsfähigen Gesellschaft, Baden-Baden<br />
1998.<br />
Staudt, E. & Kriegesmann, B. (2001): Kompetenzentwicklung und<br />
Innovation. Quem-Bulletin. Nach einem theoretischen Einführungskapitel<br />
begründen Staudt & Kriegesmann in dem Kapitel<br />
„Weiterbildung: Ein Mythos zerbricht (nicht so leicht)!“ den<br />
Paradigmenwechsel von der traditionellen Weiterbildung zur<br />
Kompetenzentwicklung. Die Autoren gehen da<strong>bei</strong> auch auf die<br />
Kritik ein, die ihre früheren teilweise provozierenden Aussagen<br />
von dem geringen Nutzen von Weiterbildung hervorgerufen<br />
haben.<br />
PR14.indd 42 16.01.2006 12:54:18
<strong>LASA</strong>-Praxishilfe Nr. 14<br />
Tesch, P. (2003): KOBRA-Handbuch, Berlin 2003. In der Ar<strong>bei</strong>t<br />
werden Fragen für die GenderNet-Partnerprojekte genauer<br />
beleuchtet. KOBRA beschäftigt sich seit seiner Gründung mit<br />
dem Zusammenwirken von Ar<strong>bei</strong>t – Bildung und Beruf unter<br />
dem Aspekt der Chancengleichheit und berät Frauen, die diese<br />
drei Lebensräume miteinander in Einklang bringen wollen. KO-<br />
BRA ar<strong>bei</strong>tet seit Jahren mit einem biografiebezogenen Ansatz<br />
in Beratung und Weiterbildung, der die unterschiedlichsten<br />
Lebenssituationen, Kontinua und Brüche als Lernfelder einbezieht.<br />
Materialien im Internet<br />
Erpenbeck, J., (1997): Wert, Bedeutung, Sinn – Was vermittelt<br />
Weiterbildung, in: Nuissl, E.; Schiersmann, C. und Siebert,<br />
H. (Hrsg.): Pluralisierung des Lehrens und Lernens. Im Web<br />
unter: http://www.die-frankfurt.de/esprid/dokumente/doc-<br />
1997/nuissl97-01-pdf.<br />
Gebert, H. (2001): Kompetenz-Management – Bewirtschaftung<br />
von implizitem Wissen in Unternehmen, im Web unter: http://<br />
verdi.unisg.ch/org/iwi/iwi_pub.nsf/wwwPublRecentEng/<br />
14CBE590F8A36F65C1256DF900395EF1/$file/WI_Paper_<br />
kurz_09_HGE.pdf.<br />
Hübner, W. (1999). Zur Messung von Kompetenz und Kompetenzentwicklung,<br />
in: QUEM-BULLETIN, Jg. 1999, Heft 4. Die<br />
Ar<strong>bei</strong>tsgemeinschaft Betriebliche Weiterbildungsforschung<br />
(ABWF) e. V. ist eine Vereinigung von Wissenschaftlern. Zweck<br />
des Vereins ist, die Forschung im Bereich der Kompetenzentwicklung<br />
zu pflegen und zu intensivieren. Das umfasst insbesondere<br />
Fragen der betrieblichen Weiterbildung, der Personal-<br />
und Organisationsentwicklung und des Lernens im Prozess der<br />
Ar<strong>bei</strong>t. In Anbetracht wachsender Bedeutung kontinuierlichen,<br />
selbstorganisierten Lernens wird es immer notwendiger,<br />
Kompetenzen zu messen, zu bewerten und anzuerkennen. Im<br />
Web unter: http://www.abwf.de/content/main/publik/bulletin/1999/Quem4-99.pdf.<br />
Sauer, J. M. (1997): Neue Chancen der Kompetenzentwicklung,<br />
in: Nuissl, E., Schiersmann, C. und Siebert, H. (Hrsg.) (1997):<br />
Pluralisierung des Lehrens und Lernens. Frankfurt. In: http://<br />
www.die-frankfurt.de/esprid/dokumente/doc-1997/nuissl97-<br />
01-pdf.<br />
PR14.indd 43 16.01.2006 12:54:18<br />
43
44<br />
<strong>LASA</strong>-PRAXISHILFE Nr. 14<br />
3.2<br />
Leseempfehlungen „Unternehmens- und Personalmanagement“<br />
Bleicher, K. (1994): Leitbilder. Orientierungsrahmen für eine integrative<br />
Managementphilosophie. Stuttgart/Zürich.<br />
Der Band greift die Rolle und Gestaltungsprobleme von Leitbildern<br />
auf. Viele derzeit in der Praxis entwickelte Leitbilder<br />
werden aus unterschiedlichen Gründen den Ansprüchen eines<br />
integrierten Managements nicht gerecht. Mit dem hier vorgestellten<br />
St. Galler Management-Konzept werden die Beteiligten<br />
gezwungen, sich im Spannungsfeld von extremen Verhaltensmöglichkeiten<br />
eindeutig zu positionieren.<br />
Dieterle, W. K.; Winckler, E. (Hrsg.) (1990): Unternehmensgründung.<br />
Handbuch des Gründungsmanagements. München.<br />
Der Band enthält Beiträge von 46 Experten zu den Themen<br />
Personal, Planung und Organisation, Markt, Finanzierung,<br />
Recht, Sicherheit und Institutionelle Aspekte. In Kapitel III.<br />
Planung und Organisation wird ein Konzept der strategischen<br />
Planung für Unternehmensgründungen vorgestellt (S. 93 ff.).<br />
Fink, D. (Hrsg.) (2000): Management Consulting Fieldbook. Die<br />
Ansätze der großen Unternehmensberater. München.<br />
Das Buch gibt einen Überblick über Managementkonzepte, die<br />
in den letzten Jahren von Beratungsgesellschaften entwickelt<br />
wurden. Lesenswert hier das Kapitel B.9 „Geschäftsprozessintegriertes<br />
Kompetenzmanagement“, in dem der Ansatz von<br />
Cap Gemini Consulting vorgestellt wird.<br />
Heucher, M.; Ilar, D.; Kubr, T.; Marchesi, H. (1999): Planen,<br />
Wachsen, Gründen. Mit dem professionellen Businessplan<br />
zum Erfolg. Zürich.<br />
Der Band zählt mit zu den Empfehlungen der StartUp-Initiative.<br />
Das Handbuch ist von den Autoren als Ar<strong>bei</strong>tsinstrument und<br />
Nachschlagewerk konzipiert und behandelt den grundlegenden<br />
Aufbau eines Businessplanes. Exemplarisch wird ein Businessplan<br />
vorgestellt. Darüber hinaus enthält der Band weiterführende<br />
Literaturhinweise und Internetadressen zum Thema.<br />
Müller-Stewens, G.; Lechner, C. (2001): Strategisches Management.<br />
Wie strategische Initiativen zum Wandel führen.<br />
Stuttgart.<br />
Vision, Mission und Leitbild sind Instrumente zur Gestaltung<br />
der Unternehmenspolitik, über die man den Geschäftsfeldern<br />
Orientierung geben möchte und dadurch gewissermaßen ihre<br />
Entwicklung „kanalisiert“. Vgl. hierzu Kap. 3 Positionierung,<br />
insb. 3.3.1 Vision, Mission, Leitbild, S. 174-182.<br />
PR14.indd 44 16.01.2006 12:54:18
Lesetipps:<br />
<strong>LASA</strong>-Praxishilfe Nr. 14<br />
von Oettinger, Bolko; von Ghyczy, Tiha; Bassford, C. (Hrsg.) (2001):<br />
Clausewitz. Strategie Denken. Wien.<br />
In diesem Band finden sich ausgewählte Texte von Clausewitz<br />
– zum Teil auch mit Erläuterung.<br />
Sunzi: Die Kunst des Krieges. München.<br />
Sunzi lebte ca. 500 v. Chr. und war Philosoph, bevor Helu, der<br />
König der Wu, ihn zum obersten General ernannte. Der Denker<br />
hatte mit seinem Werk „Die Kunst des Krieges“, der ersten<br />
bekannten Abhandlung in schriftlicher Form, die Aufmerksamkeit<br />
des Herrschers erlangt.<br />
Morrell, M.; Capparell, S. (2003): Shackletons Führungskunst.<br />
Reinbeck.<br />
Der Antarktis-Forscher Ernest Shackleton war ein Gentleman,<br />
Abenteurer und Dichter; sein Charisma war berühmt. Solche<br />
Persönlichkeiten faszinieren die Nachwelt. Wenn derjenige<br />
dann noch wie Shackleton fast ein Wunder vollbracht hat, natürlich<br />
erst recht. Er schaffte es auf seiner Expedition mit der<br />
Endurance, die Mannschaft nach dem Schiffbruch und einem<br />
zweijährigen Überlebenskampf im Eis vollzählig zurückzubringen.<br />
Da<strong>bei</strong> bewies er eine Führungskunst und ein Krisenmanagement,<br />
die ihn als geborenen Anführer auswiesen. Obwohl<br />
seine Expeditionen um die Zeit des ersten Weltkriegs herum<br />
stattfanden, sind seine Führungsprinzipien wie gemacht für<br />
heutige Unternehmenskulturen. Damals war ein eher hierarchischer<br />
Stil wie der des Forschers Robert F. Scott üblich: Er<br />
galt als mürrisch, herrschsüchtig und steif; in militärischer<br />
Tradition stellte er das Ziel über Menschenleben. Shackleton<br />
dagegen führte unautoritär und demokratisch, er galt als herzlich,<br />
humorvoll und gerecht. Besonders sein unerschütterlicher<br />
Optimismus und sein Einfühlungsvermögen für seine Männer<br />
halfen ihm in der Antarktis. Seine Crew dankte es ihm mit<br />
großer Loyalität.<br />
PR14.indd 45 16.01.2006 12:54:18<br />
45
46<br />
<strong>LASA</strong>-PRAXISHILFE Nr. 14<br />
PR14.indd 46 16.01.2006 12:54:19
4<br />
Fußnotenverzeichnis<br />
<strong>LASA</strong>-Praxishilfe Nr. 14<br />
1 Im Auftrag der Landesagentur für Struktur und Ar<strong>bei</strong>t (<strong>LASA</strong>)<br />
<strong>Brandenburg</strong> <strong>GmbH</strong>. Informationen zum Projekt sind auf der<br />
Seite der <strong>LASA</strong> unter http://www.lasa-brandenburg.de/index.<br />
php?id=105 erhältlich. Der Abschlussbericht zum Projekt kann<br />
unter http://www.lasa-brandenburg.de/fileadmin/user_<br />
upload/IP-dateien/kampagnen/IZT_komp_tourism.pdf gedownloadet<br />
werden.<br />
2 Vgl. Baitsch, C. (1996), S. 102-112, sowie Erpenbeck, J.<br />
(1996), S. 9-13.<br />
3 Vgl. Erpenbeck, J./Heyse, V. (1999) sowie Erpenbeck, J./<br />
von Rosenstiel, L. (Hrsg.) (2003), S. X f.<br />
4 Vgl. Lichtenberger, Y. (1999), S. 257-305.<br />
5 Ebd., S. 292.<br />
6 Vgl. Lichtenberger, Y. (1999), S. 257-305.<br />
7 Vgl. Frieling, E. et al. (2000): Flexibilität und Kompetenz:<br />
Schaffen flexible Unternehmen kompetente und flexible<br />
Mitar<strong>bei</strong>ter? Berlin, Waxmann 2000.<br />
8 Ebd., S. 13.<br />
9 Vgl. Probst, G.J.B. et al. (2000), S. 13.<br />
10 Ebd., S. 13.<br />
11 Vgl. Bunk, G. P. (1994), S. 9-15.<br />
12 Vgl. Bunk, G. P. (1994), S. 9-15.<br />
13 Vgl. Hübner, W. (1999), S. 7.<br />
14 Berechnungen in Anlehnungen an: Tagesreisen der Deutschen,<br />
Schriftenreihe des dwif, Nr. 50/2005. dwif: Deutsches Wirtschaftswissenschaftliches<br />
Institut für Fremdenverkehr e. V.<br />
an der Universität München sowie seine 100 % Tochter, die<br />
dwif-Consulting <strong>GmbH</strong>.<br />
15 Siehe auch Ostdeutscher Sparkassen- und Giroverband<br />
(Hrsg.): Sparkassen-Tourismusbarometer – Jahresbericht,<br />
Ausgabe 2002 bis 2005, Berlin.<br />
16 Der genaue Projekttitel lautet „Kompetenzmessung der individuellen<br />
beruflichen Handlungskompetenz von <strong>Führungskräften</strong><br />
von kleinen und mittleren Unternehmen in der Tourismusbranche“.<br />
17 Vgl. http://www.stein<strong>bei</strong>s-business-check.de/kompetenzen.<br />
html<br />
PR14.indd 47 16.01.2006 12:54:19<br />
47
48<br />
<strong>LASA</strong>-PRAXISHILFE Nr. 14<br />
18 Die Darstellung basiert auf einer Software von Stein<strong>bei</strong>s Transfer<br />
Zentrum 2003. Die Inhalte der Sichtfenster wurden vollständig<br />
überar<strong>bei</strong>tet und den Verhältnissen der touristischen<br />
kleinen und mittleren Unternehmen in <strong>Brandenburg</strong> angepasst.<br />
19 Nicht nur für diesen Vorzeigebetrieb mit wenig Aufwand umsetzbar.<br />
PR14.indd 48 16.01.2006 12:54:19
Bestellung<br />
Telefon<br />
Fax<br />
E-Mail<br />
Internet<br />
� Studien<br />
� Dokumentationen<br />
� Praxishilfen<br />
Stand: Dezember 2005<br />
<strong>LASA</strong> <strong>Brandenburg</strong> <strong>GmbH</strong><br />
Postfach 900 354<br />
14439 Potsdam<br />
Wetzlarer Straße 54<br />
14482 Potsdam<br />
(03 31) 60 02-2 00<br />
(03 31) 60 02-4 00<br />
office@lasa-brandenburg.de<br />
www.lasa-brandenburg.de<br />
<strong>LASA</strong>-Praxishilfe Nr. 14<br />
PR14.indd 49 16.01.2006 12:54:20<br />
49
50<br />
<strong>LASA</strong>-PRAXISHILFE Nr. 14<br />
Nr. 43<br />
Nr. 42<br />
Nr. 41<br />
Nr. 40<br />
Nr. 39<br />
Nr. 38<br />
Nr. 37<br />
Nr. 36<br />
Nr. 35<br />
Studien<br />
Alt wie ein Baum? Altersstrukturen <strong>Brandenburg</strong>er Unternehmen<br />
vor dem Hintergrund demografischer Entwicklungen.<br />
Udo Papies (SÖSTRA <strong>GmbH</strong> Berlin): Dezember 2005; 94 Seiten;<br />
Euro 10,00; ISBN 3-929756-55-2<br />
Infrastruktur in der Region entwickeln - Fall<strong>bei</strong>spiele erfolgreicher<br />
Verknüpfung von Ar<strong>bei</strong>tsmarktpolitik und Infrastrukturentwicklung<br />
in Ost- und Westdeutschland.<br />
Uwe Kühnert, Berti Wahl: Nov. 2004; 93 Seiten; Euro 10,00; ISBN 3-929756-53-6<br />
Zwischen Flexibilität und drohender Abwanderung aus den Regionen.<br />
Pendlerverhalten und Hauptpendlerströme im Land <strong>Brandenburg</strong>.<br />
Wilma Frank, Karsten Schuldt, Claudia Temps (PIW): Juni 2004; 119 Seiten;<br />
Euro 10,00; ISBN 3-929756-52-8<br />
Erfolgsgarant Netzwerke? Status quo und Entwicklungstendenzen<br />
von Qualifizierungsnetzwerken im Land <strong>Brandenburg</strong>.<br />
Wilma Frank, Karsten Schuldt, Claudia Temps (PIW); Martin Grundmann (schiffgmbh);<br />
Dr. Gerhard Richter (IMU-Institut): Mai 2003; 52 Seiten; Euro 7,50;<br />
ISBN 3-929756-45-5<br />
Kompass zur Qualifizierung. Orientierungsleitfaden zur frühzeitigen<br />
Qualifikationsbedarfsermittlung in kleinen und mittleren Unternehmen<br />
im Land <strong>Brandenburg</strong>.<br />
Vanessa Franz, Hanne Johé-Kellberg, Franz Seibert, Martin Zwick, isoplan-Institut<br />
Saarbrücken-Berlin-Brüssel, Juni 2002, 96 Seiten, EURO 9,00; ISBN 3-929756-43-9<br />
Ar<strong>bei</strong>tsmarktpolitik - Quadratur des Kreises? Die bundesdeutsche<br />
Ar<strong>bei</strong>tsförderung als Spiegelbild breit gefächerter Zielstellungen<br />
und Erwartungen. Eine Literaturstudie.<br />
Alexander Kühl, Frank Schiemann (SÖSTRA <strong>GmbH</strong> Berlin):<br />
April 2002; 147 Seiten; Euro 10,00; ISBN 3-929756-42-0<br />
Ar<strong>bei</strong>tsförder-Monitoring - Regulierung zwischen „top down“ und<br />
„bottom up“. Machbarkeitsstudie zum Aufbau eines Monitoringsystems<br />
als Begleitinstrument regionalisierter Landesar<strong>bei</strong>tsförderung.<br />
Thorsten Armstroff, Axel Weise (Compass <strong>GmbH</strong>); Martin Grundmann, Jörg Nickel<br />
(IMU Institut <strong>GmbH</strong>); Karsten Schuldt (PIW): Dezember 2000; 70 Seiten; Euro 7,50;<br />
ISBN 3-929756-38-2<br />
Qualitätsmanagement und Qualitätskriterien für die Bildungs- und<br />
Weiterbildungsberatung.<br />
Regina Beuck (Weiterbildung Hamburg e. V.); Dietrich Harke; Susanne Voß (<strong>LASA</strong>):<br />
Dezember 2000; 74 Seiten; Euro 7,50; ISBN 3-929756-37-4<br />
Mobilitätszuwachs ohne Ende? Pendlerbewegungen und regionale<br />
Ar<strong>bei</strong>tsmärkte in <strong>Brandenburg</strong>.<br />
Karsten Schuldt (PIW): Mai 2000; 82 Seiten; Euro 7,50;<br />
ISBN 3-929756-36-6<br />
PR14.indd 50 16.01.2006 12:54:20
Nr. 34<br />
Nr. 33<br />
Nr. 32<br />
Nr. 31<br />
Nr. 20<br />
Nr. 19<br />
Nr. 18<br />
Nr. 17<br />
Nr. 16<br />
<strong>LASA</strong>-Praxishilfe Nr. 14<br />
Vernachlässigte Märkte? Eine Analyse der Angebotsprofile <strong>Brandenburg</strong>er<br />
Bildungsträger zur Entwicklung kleiner und mittlerer<br />
Unternehmen.<br />
Karsten Schuldt (PIW): Mai 1999; 63 Seiten; Euro 7,50;<br />
ISBN 3-929756-33-1 (vergriffen)<br />
Bleibt alles anders? ABS-Gesellschaften zwischen „Regiegeschäft“<br />
und Diversifizierung. Ergebnisse einer Erhebung Ende Juni 1998.<br />
Uwe Kühnert: April 1999; 54 Seiten; Euro 6,00;<br />
ISBN 3-929756-32-3<br />
Ar<strong>bei</strong>tsplatzeffekte und Ar<strong>bei</strong>tsförderung in der Tourismuswirtschaft.<br />
Eine empirische Untersuchung in ausgewählten Landkreisen<br />
<strong>Brandenburg</strong>s.<br />
Udo Papies, Peter Schreiber (SÖSTRA): Juli 1998; 102 Seiten; Euro 9,50;<br />
ISBN 3-929756-29-3<br />
Betroffen - nicht zuständig - aber gefordert! Kommunale Ar<strong>bei</strong>tsförderung<br />
in ausgewählten Regionen des Landes <strong>Brandenburg</strong>.<br />
Karsten Schuldt (PIW): Juni 1998; 48 Seiten; Euro 6,00;<br />
ISBN3-929756-28-5<br />
<strong>LASA</strong>-Dokumentationen<br />
Ländlich in die Zukunft. Rahmenbedingungen für ländliche Entwicklung<br />
an der Schwelle zur neuen EU-Strukturfondsperiode.<br />
Uwe Kühnert: Oktober 2005; 60 Seiten; Euro 8,00; ISBN 3-929756-54-4<br />
Chance oder Illusion? Vereinbarkeit von Familie und<br />
Erwerbstätigkeit.<br />
Sigrid Huschke, Uta Jacobs: März 2004; 61 Seiten; Euro 8,00; ISBN 3-929756-51-X<br />
Diskussionen auf dem Weg ins Zentrum. Dokumentation der Fachtagung<br />
„Chancengleichheit von Männern und Frauen? Impulse und<br />
Erfahrungen aus Schweden, Österreich, Polen und der Bundesrepublik<br />
Deutschland“ am 27. und 28. Oktober 2003 in Potsdam.<br />
Uwe Kühnert: Februar 2004; 82 Seiten; Euro 8,00; ISBN 3-929756-50-1<br />
Umwelt und Ar<strong>bei</strong>t für Regionen. Praxiserfahrungen <strong>bei</strong> der<br />
Umsetzung investiver Ar<strong>bei</strong>tsförderung im Bereich regenerativer<br />
Energien.<br />
Matthias Vogel, Achim Hartisch: Dezember 2003; 40 Seiten; Euro 6,00;<br />
ISBN 3-929756-49-8<br />
Ar<strong>bei</strong>tsförderung in der Denkmalpflege. Ein Vorteil für <strong>bei</strong>de<br />
Seiten.<br />
Heike Hofmann, Uta Jacobs: Oktober 2003; 90 Seiten; Euro 8,00;<br />
ISBN 3-929756-48-X<br />
PR14.indd 51 16.01.2006 12:54:20<br />
51
52<br />
<strong>LASA</strong>-PRAXISHILFE Nr. 14<br />
Nr. 15<br />
Nr. 14<br />
Nr. 13<br />
Nr. 12<br />
Nr. 11<br />
Nr. 10<br />
Nr. 9<br />
Nr. 8<br />
Nr. 7<br />
Nr. 6<br />
Den Qualitätsstandard halten. Zum Stellenwert fachlicher Anleitung<br />
<strong>bei</strong> ABM durch das Landesprogramm „Qualifizierung und<br />
Ar<strong>bei</strong>t für <strong>Brandenburg</strong>“.<br />
Dr. Harald Michel, Dr. Volker Schulz (IFAD): Juni 2003; 33 Seiten; Euro 6,00;<br />
ISBN 3-929756-47-1<br />
Verzahnung von Ar<strong>bei</strong>tsförderung und Strukturförderung. So funktioniert<br />
es: Beispiele aus der Praxis.<br />
Stephan Broniecki, Achim Hartisch, Heike Hofmann, Uta Jacobs, Prof. Dr. Wolfgang<br />
Kubiczek, Marion Piek, Martina Pohle, Renate Simons, Dr. Matthias Vogel, Berti<br />
Wahl, Christian Wend: Mai 2003; 32 Seiten; Euro 6,00; ISBN 3-929756-46-3<br />
Kommunale Strategien zur Förderung von Beschäftigung. Zwei Beispiele<br />
aus dem Land <strong>Brandenburg</strong>.<br />
Sigrid Huschke, Dr. Matthias Vogel: Dezember 2002; 52 Seiten; Euro 7,00;<br />
ISBN 3-929756-44-7<br />
Neues Lernen made in <strong>Brandenburg</strong>. Dokumentation der deutschschwedischen<br />
INNOPUNKT-Konferenz „Modelle neuer Lernformen<br />
der beruflichen Bildung“ am 1./2. Oktober 2001 in Potsdam.<br />
Uwe Kühnert: Dezember 2001; 101 Seiten; Euro 8,00;<br />
ISBN 3-929756-41-2<br />
Landesinitiative zur Verbesserung der Umwelt in landwirtschaftlichen<br />
Unternehmen. Entwicklungen und Ergebnisse eines Kooperationsmodells<br />
zum Einsatz der Ar<strong>bei</strong>tsförderung (1995 bis 2000).<br />
Uta Jacobs: Mai 2001; 39 Seiten; Euro 6,00; ISBN 3-929756-40-4<br />
Programm zur Beseitigung oder landschaftsgerechten Einpassung<br />
kommunaler Altablagerungen - Erste Ergebnisse und Erfahrungen<br />
unter Einbindung der Ar<strong>bei</strong>tsförderung im Zeitraum 1998 bis<br />
2000.<br />
Dr. Matthias Vogel: April 2001; 78 Seiten; Euro 7,50;<br />
ISBN 3-929756-39-0<br />
Ökologisches Bauen und Ar<strong>bei</strong>tsförderung.<br />
Chancen - Beispiele - Erfahrungen.<br />
Dr. Renate Gruhle/Dr. Matthias Vogel: Dezember 1999;<br />
68 Seiten; Euro 7,50; ISBN 3-929756-35-8<br />
Erfahrungen und Probleme <strong>bei</strong> der regionalen Steuerung von Ar<strong>bei</strong>tsförderung<br />
- Dokumentation eines <strong>LASA</strong>-Kolloquiums am<br />
28. Oktober 1999 in Bad Liebenwerda.<br />
Uwe Kühnert: Dezember 1999; 64 Seiten; Euro 7,50;<br />
ISBN 3-929756-34-X<br />
Das Hochwassersonderprogramm der Ar<strong>bei</strong>tsförderung 1997/98<br />
im Land <strong>Brandenburg</strong>. Ergebnisse - Erfahrungen - Empfehlungen<br />
aus der Umsetzung.<br />
Dr. Matthias Vogel: Februar 1999; 117 Seiten; Euro 9,00; ISBN 3-929756-31-5<br />
Tausch- und Barterringe - eine neue Perspektive für die Ar<strong>bei</strong>tsförderung?<br />
Uta Jacobs: Dezember 1998; 102 Seiten; Euro 9,00;<br />
ISBN 3-929756-30-7<br />
PR14.indd 52 16.01.2006 12:54:20
Nr. 5<br />
Nr. 13<br />
Nr. 12<br />
Nr. 11<br />
Nr. 10<br />
Nr. 9<br />
Nr. 8<br />
Nr. 7<br />
Nr. 6<br />
Ar<strong>bei</strong>tsplätze schaffen mit umweltschützenden<br />
Biotechnologien.<br />
<strong>LASA</strong>-Praxishilfe Nr. 14<br />
Matthias Vogel: Februar 1998; 48 Seiten; Euro 7,50; ISBN 3-929756-27-7<br />
<strong>LASA</strong>-Praxishilfen<br />
Selbstevaluation. Der Weg zu mehr Nachhaltigkeit.<br />
Dezember 2004; 92 Seiten; kostenlos<br />
Beschäftigung schaffende Infrastrukturförderung.<br />
Juli 2002; 56 Seiten; kostenlos<br />
Notausgang Insolvenz - Das Verfahren.<br />
Oktober 2001; 60 Seiten; kostenlos<br />
Brückenschlag. Tourismus für Menschen mit<br />
Behinderungen.<br />
Oktober 2001; 70 Seiten; kostenlos<br />
Bin ich eine UnternehmensgründerIn? Testen Sie sich doch<br />
einfach mal! - Lust auf einen Beruf voller Abenteuer und<br />
Herausforderungen?<br />
Januar 2001; 60 Seiten; kostenlos<br />
Gemeinnützigkeit im Steuerrecht.<br />
Ein Ratgeber für gemeinnützige Körperschaften.<br />
Mai 2000; 60 Seiten; kostenlos<br />
Vergabe ABM: Damit behalten Sie die Fäden in der Hand.<br />
2. überar<strong>bei</strong>tete Auflage; Dezember 1999; 72 Seiten; kostenlos (vergriffen)<br />
Verknüpfung von Mitteln aus der Gemeinschaftsaufgabe mit der<br />
Ar<strong>bei</strong>tsförderung. Ein Ratgeber für kommunale Projekte.<br />
2. überar<strong>bei</strong>tete Auflage; Dezember 1998; 40 Seiten; kostenlos<br />
Ar<strong>bei</strong>tsmarktpolitischer Informationsservice<br />
BRANDaktuell.<br />
Hrsg.: <strong>LASA</strong> <strong>Brandenburg</strong> <strong>GmbH</strong>; erscheint zweimonatlich; kostenlos<br />
Newsletter-BRANDaktuell.<br />
erscheint 14-täglich; kostenlos;<br />
Internet: www.lasa-brandenburg.de/brandakt/bestellung.htm<br />
BRANDaktuell im PDF-Format<br />
erscheint eine Woche vor dem Druckexemplar BRANDaktuell; kostenlos;<br />
Internet: www.lasa-brandenburg.de/brandakt/bestellung.htm<br />
PR14.indd 53 16.01.2006 12:54:20<br />
53
54<br />
<strong>LASA</strong>-PRAXISHILFE Nr. 14<br />
PR14.indd 54 16.01.2006 12:54:20
<strong>LASA</strong>-Praxishilfe Nr. 14<br />
55
56<br />
<strong>LASA</strong>-PRAXISHILFE Nr. 14<br />
PR14.indd 56 16.01.2006 12:54:20
<strong>LASA</strong>-Praxishilfe Nr. 14<br />
Wissen nennen<br />
wir den kleinen Teil der<br />
Unwissenheit, den wir geordnet<br />
haben.<br />
Ambrose Bierce, Schriftsteller<br />
PR14 Um.indd 3 16.01.2006 12:55:38
PR14 Um.indd 4 16.01.2006 12:55:38