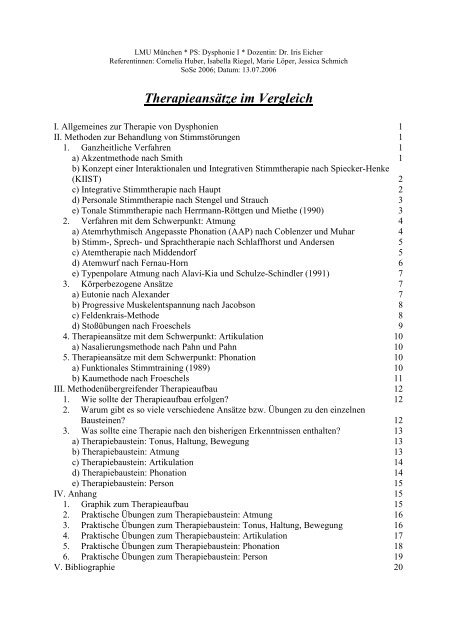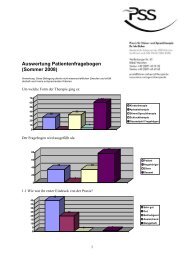Therapieansätze im Vergleich - Lehrpraxis Dr. Eicher
Therapieansätze im Vergleich - Lehrpraxis Dr. Eicher
Therapieansätze im Vergleich - Lehrpraxis Dr. Eicher
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
LMU München * PS: Dysphonie I * Dozentin: <strong>Dr</strong>. Iris <strong>Eicher</strong><br />
Referentinnen: Cornelia Huber, Isabella Riegel, Marie Löper, Jessica Schmich<br />
SoSe 2006; Datum: 13.07.2006<br />
<strong>Therapieansätze</strong> <strong>im</strong> <strong>Vergleich</strong><br />
I. Allgemeines zur Therapie von Dysphonien 1<br />
II. Methoden zur Behandlung von St<strong>im</strong>mstörungen 1<br />
1. Ganzheitliche Verfahren 1<br />
a) Akzentmethode nach Smith 1<br />
b) Konzept einer Interaktionalen und Integrativen St<strong>im</strong>mtherapie nach Spiecker-Henke<br />
(KIIST) 2<br />
c) Integrative St<strong>im</strong>mtherapie nach Haupt 2<br />
d) Personale St<strong>im</strong>mtherapie nach Stengel und Strauch 3<br />
e) Tonale St<strong>im</strong>mtherapie nach Herrmann-Röttgen und Miethe (1990) 3<br />
2. Verfahren mit dem Schwerpunkt: Atmung 4<br />
a) Atemrhythmisch Angepasste Phonation (AAP) nach Coblenzer und Muhar 4<br />
b) St<strong>im</strong>m-, Sprech- und Sprachtherapie nach Schlaffhorst und Andersen 5<br />
c) Atemtherapie nach Middendorf 5<br />
d) Atemwurf nach Fernau-Horn 6<br />
e) Typenpolare Atmung nach Alavi-Kia und Schulze-Schindler (1991) 7<br />
3. Körperbezogene Ansätze 7<br />
a) Eutonie nach Alexander 7<br />
b) Progressive Muskelentspannung nach Jacobson 8<br />
c) Feldenkrais-Methode 8<br />
d) Stoßübungen nach Froeschels 9<br />
4. <strong>Therapieansätze</strong> mit dem Schwerpunkt: Artikulation 10<br />
a) Nasalierungsmethode nach Pahn und Pahn 10<br />
5. <strong>Therapieansätze</strong> mit dem Schwerpunkt: Phonation 10<br />
a) Funktionales St<strong>im</strong>mtraining (1989) 10<br />
b) Kaumethode nach Froeschels 11<br />
III. Methodenübergreifender Therapieaufbau 12<br />
1. Wie sollte der Therapieaufbau erfolgen? 12<br />
2. Warum gibt es so viele verschiedene Ansätze bzw. Übungen zu den einzelnen<br />
Bausteinen? 12<br />
3. Was sollte eine Therapie nach den bisherigen Erkenntnissen enthalten? 13<br />
a) Therapiebaustein: Tonus, Haltung, Bewegung 13<br />
b) Therapiebaustein: Atmung 13<br />
c) Therapiebaustein: Artikulation 14<br />
d) Therapiebaustein: Phonation 14<br />
e) Therapiebaustein: Person 15<br />
IV. Anhang 15<br />
1. Graphik zum Therapieaufbau 15<br />
2. Praktische Übungen zum Therapiebaustein: Atmung 16<br />
3. Praktische Übungen zum Therapiebaustein: Tonus, Haltung, Bewegung 16<br />
4. Praktische Übungen zum Therapiebaustein: Artikulation 17<br />
5. Praktische Übungen zum Therapiebaustein: Phonation 18<br />
6. Praktische Übungen zum Therapiebaustein: Person 19<br />
V. Bibliographie 20
I. Allgemeines zur Therapie von Dysphonien<br />
St<strong>im</strong>mtherapie als interdisziplinärer Prozess:<br />
- neben medizinisch-naturwissenschaftlichen Kenntnissen auch Einbezug psychologischer,<br />
soziologischer, phonetischer, pädagogischer und kommunikationswissenschaftlicher<br />
Kenntnisse<br />
- außerdem Beachtung anthropologischer und philosophischer Reflexionen sowie Elemente<br />
aus der Körper- und Musiktherapie<br />
Übergeordnetes Ziel der St<strong>im</strong>mtherapie:<br />
- Ökonomisierung der St<strong>im</strong>mfunktion, d.h. die Entfaltung der individuellen<br />
Leistungsfähigkeit der St<strong>im</strong>me und das Wiederherstellen ihrer Alltagstauglichkeit durch<br />
den Abbau ungünstiger und schädigender St<strong>im</strong>mgewohnheiten<br />
- Rückgewinn des erschütterten Grundvertrauens in die Verlässlichkeit der eigenen St<strong>im</strong>me<br />
Die St<strong>im</strong>mtherapie ist ein „Arbeitsvertrag“, d.h. die Verantwortung für die gemeinsame Arbeit<br />
und den Erfolg wird zwischen Therapeut und Patient geteilt.<br />
II. Methoden zur Behandlung von St<strong>im</strong>mstörungen<br />
1. Ganzheitliche Verfahren<br />
a) Akzentmethode nach Smith<br />
Theoretische Grundlage<br />
- ganzheitlich auf die Funktion bezogen: Atmung, Phonation, Artikulation, Körperbewegung<br />
und Prosodie<br />
- Aufbau „normaler“ Muster der St<strong>im</strong>mproduktion<br />
- indirekter Lernprozess: Orientierung am St<strong>im</strong>mvorbild des Therapeuten; indirekte<br />
Behandlung der Defizite<br />
- individuelle Abst<strong>im</strong>mung der Behandlung auf den Patienten und auf die Diagnose<br />
- physiologische Aspekte: kinästhetisches Feedback wichtig für die Kontrolle/Koordination<br />
von Atmung, Phonation und Artikulationsmuster<br />
Inhaltliche Schwerpunkte<br />
- Verbinden von weichen, großen, schwingende Bewegungen mit der Arbeit an der St<strong>im</strong>me<br />
- Einüben der Abdominal-/Zwerchfellatmung<br />
- Durchführung der Übungen in drei verschiedenen Tempi mit der Intention eines flüssigen<br />
Gesamtablaufs<br />
- nach Automatisierung Übergang zum freien Sprechen<br />
Ziele<br />
- Ersetzen pathologischer Symptome durch physiologische<br />
Anwendbarkeit<br />
- alle Formen funktioneller und organischer St<strong>im</strong>mstörungen sowie Stottern<br />
Kritik<br />
- genaue Angaben bezüglich der Vorgehensweise, dadurch aber geringe Variabilität<br />
- Störung der eigenen St<strong>im</strong>mentfaltung durch Orientierung am St<strong>im</strong>mbild des Therapeuten<br />
- geringes Eingehen auf die Begleitung <strong>im</strong> Transfer<br />
1
) Konzept einer Interaktionalen und Integrativen St<strong>im</strong>mtherapie nach<br />
Spiecker-Henke (KIIST)<br />
Theoretische Grundlage<br />
- Mittelpunkt des therapeutischen Prozesses: der Mensch mit seiner individuell erlebten<br />
St<strong>im</strong>merkrankung<br />
- multid<strong>im</strong>ensionales Vorgehen: verschiedene Therapieelemente wirken zusammen<br />
(Bewegung, Rhythmus und Dynamik, Atmung, St<strong>im</strong>me und Emotion)<br />
- alle Faktoren, die <strong>im</strong> Zusammenhang mit der St<strong>im</strong>merkrankung stehen, müssen<br />
berücksichtigt werden<br />
Inhaltliche Schwerpunkte<br />
- „Sensibel werden“ für emotionale Vorgänge und psychischer Prozesse<br />
- Analyse der Kommunikations- und Interaktionsstrukturen des Patienten<br />
- wahrnehmungszentrierte Maßnahmen<br />
- körperzentrierte Maßnahmen (Tonusregulierung, Zusammenspiel Körperhaltung, Atmung,<br />
Phonation und Bewegung)<br />
- emotions- und erlebniszentrierte Maßnahmen (Verbindung von Sprechabsicht, Bewegung,<br />
Atmung und Phonation)<br />
- st<strong>im</strong>mfunktionszentrierte Maßnahmen (Resonanz, Leistungsfähigkeit)<br />
- sprechzentrierte Maßnahmen (Rhetorik, Texte)<br />
- interaktionszentrierte Maßnahmen (üben spezieller Kommunikationssituationen)<br />
- flankierende Maßnahmen (St<strong>im</strong>mhygiene, interdisziplinäres Arbeiten etc.)<br />
Ziele<br />
- angepasste und physiologische Funktions- und Verhaltensmuster<br />
Anwendbarkeit<br />
- bei St<strong>im</strong>mstörungen aller Art<br />
Kritik<br />
- Grenzen der st<strong>im</strong>mtherapeutischen Arbeit unklar<br />
c) Integrative St<strong>im</strong>mtherapie nach Haupt<br />
Theoretische Grundlage<br />
- St<strong>im</strong>mfunktion = Ausdruck der ganzen Persönlichkeit<br />
- Basis: der St<strong>im</strong>mfunktionskreis<br />
- verschiedene <strong>Therapieansätze</strong> werden aufgegriffen und in effizienter, patientenbezogener<br />
Weise zugeordnet<br />
- drei Grundgedanken:<br />
Zusammenwirken aller Teilbereiche zu einem vernetzten Ganzen<br />
ressourcenorientiertes Arbeiten<br />
Erkennen der Signalgebung der Störung<br />
- Einteilung in 3 Therapiephasen, mit Schwerpunkt auf jeweils 2 Bereichen<br />
Inhaltliche Schwerpunkte<br />
- „Was drückt die St<strong>im</strong>me aus?“ –Klärung der Frage<br />
- Körperarbeit (z.B. Eutonie, PME, Qi-Gong)<br />
- manuelle Vibration zur Atemtherapie in Anlehnung an Schlaffhorst/Andersen<br />
2
- Artikulationsübungen<br />
- Kombination mit psychologischer, pädagogischer oder künstlerischer Arbeit möglich<br />
Ziele<br />
- der mündige Patient: Übernahme der Eigenverantwortung für Gesundheit und St<strong>im</strong>me<br />
Anwendbarkeit<br />
- alle Formen von St<strong>im</strong>mstörungen - je nach Diagnose unterschiedliche Schwerpunktsetzung<br />
Kritik<br />
- Grenzen der St<strong>im</strong>mtherapie nicht eindeutig<br />
- intuitive Behandlung des Aspektes Person<br />
d) Personale St<strong>im</strong>mtherapie nach Stengel und Strauch<br />
Theoretische Grundlage<br />
- Personenzentrierter Ansatz: Arbeit der St<strong>im</strong>me = bewusste Arbeit an der ganzen Person<br />
- Arbeit auf funktionaler und personaler Ebene<br />
Inhaltliche Schwerpunkte<br />
- konzentrative Körperarbeit (z.B. Feldenkrais, Eutonie)<br />
- Exper<strong>im</strong>entieren mit der St<strong>im</strong>me<br />
- Imagination - z.B. Körperwahrnehmung bewusst durch Vorstellung/ Bilder ergänzen<br />
- personale und funktionale Ebene bei jeder Übung<br />
- Reflexion der Übungen<br />
- Unterstützen des Transfers<br />
Ziele<br />
- möglichst opt<strong>im</strong>aler Funktionsablauf<br />
Anwendbarkeit<br />
- funktionale sowie organische St<strong>im</strong>mstörungen<br />
Kritik<br />
- Grenzen zur Psychotherapie undeutlich<br />
e) Tonale St<strong>im</strong>mtherapie nach Herrmann-Röttgen und Miethe (1990)<br />
Theoretische Grundlage<br />
- holistisches Menschenbild: St<strong>im</strong>me = Phänomen eines gesamtkörperlichen und zugleich<br />
seelischen Geschehens<br />
- st<strong>im</strong>mpädagogischer Ansatz, eingebunden in eine ganzheitliche Konzeption<br />
- konstante Durchführung eines st<strong>im</strong>mtherapeutischen Übungsprogramms, basierend auf den<br />
physiologischen Bedingungen der St<strong>im</strong>mfunktion<br />
- Ersetzung bisheriger Regelkreise durch das Einschleifen neuer, ökonomischer Muster<br />
Inhaltliche Schwerpunkte<br />
- 10 konstante Basisübungen zum Training der wichtigen Grundfunktionen der St<strong>im</strong>me: 1)<br />
Zwerchfelltiefstellung, 2) Hörkontrolle, 3) Rhythmisierung, 4) Ökonomisierung,<br />
- 5) Modulation, 6) St<strong>im</strong>mbandschluss, 7) Indifferenzlage, 8) St<strong>im</strong>mumfang,<br />
- 9) Resonanz und 10) Lautstärke<br />
3
- Integration der Übungen in die verschiedenen Therapiephasen: Entspannungstherapie,<br />
Atemtherapie, Körperarbeit, Hilfen <strong>im</strong> psychischen Bereich und Situationstraining<br />
Ziele<br />
- Veränderungen <strong>im</strong> kognitiven, <strong>im</strong> sensitiven, <strong>im</strong> akustischen und <strong>im</strong> visuellen Bereich<br />
Anwendbarkeit<br />
- alle Formen von St<strong>im</strong>merkrankungen<br />
Kritik<br />
- Möglichkeit einer effizienten, mehrd<strong>im</strong>ensionalen Arbeit, einer Strukturierung und<br />
patientengerechten Modifikation einzelner Übungen, aber wenig kreative Variabilität<br />
2. Verfahren mit dem Schwerpunkt: Atmung<br />
a) Atemrhythmisch Angepasste Phonation (AAP) nach Coblenzer und<br />
Muhar<br />
Theoretische Grundlage<br />
- Menschenbild: Patient als Interaktionspartner, Sprechakt geleitet von Intentionen<br />
- st<strong>im</strong>mpädagogischer, sprecherzieherischer, übender Ansatz<br />
- St<strong>im</strong>me als Spezialfunktion der Atmung, unphysiologische Atmung als Ursache von<br />
Dysphonien<br />
Inhaltliche Schwerpunkte<br />
- Erleichterung der Koordination von Bewegung, Atmung, St<strong>im</strong>me und Artikulation durch<br />
Körpermotorik, Rhythmus und Intention<br />
- Erlernen von Techniken, um ökonomische Atem- und St<strong>im</strong>mführung zu erreichen<br />
Wahrnehmungsübungen in den Bereichen Atmung, Tonus und St<strong>im</strong>me<br />
Haltungsverbesserung und muskuläres Training für St<strong>im</strong>matmung<br />
Rhythmisierung von Bewegung, Atmung und Ton<br />
plastisches Artikulieren, St<strong>im</strong>meinsatzübungen, Finden der Indifferenzlage<br />
Verlängerung der Ausatmung, Erarbeitung eines dreiphasigen Atemrhythmus<br />
intentionale Übungen zur Ökonomisierung von Bewegung, Atmung und St<strong>im</strong>me<br />
Erarbeiten des Abspannens und der AAP, St<strong>im</strong>manpassung an räumliche<br />
Gegebenheiten<br />
Einsetzen von atemokönomisch gegliederten Sprechphasen durch Pausensetzung<br />
Ziele<br />
- durch reflektorische Atemergänzung: Vermeiden von Schnappatmung und hörbarer<br />
Inspiration sowie Entlastung der St<strong>im</strong>me am Phonationsende<br />
- Erreichen von st<strong>im</strong>mlichem Durchhaltevermögen auch unter schwierigen<br />
Phonationsbedingungen durch opt<strong>im</strong>ale Koordination von Amtung und Sprechen<br />
Anwendbarkeit<br />
- für alle St<strong>im</strong>mstörungen geeignet<br />
- gut als Einstieg geeignet und gut in größeres Therapiekonzept integrierbar<br />
Kritik<br />
- keine Anleitung zum Transfer in die Spontansprache, Künstlichkeit des erlernten Sprechens<br />
- wenig Beachtung von Individualität und Geschichte der Patienten<br />
4
- Spezifizierung auf einen Bereich mit gleichzeitigem Anspruch auf ganzheitliche<br />
Wirkungsweise<br />
b) St<strong>im</strong>m-, Sprech- und Sprachtherapie nach Schlaffhorst und Andersen<br />
Theoretische Grundlage<br />
- atempädagogischer Ansatz bei dem man davon ausgeht, dass alle Körperbewegungen<br />
atemkonform geschehen müssen.<br />
Inhaltliche Schwerpunkte<br />
- Erspüren des dreiteiligen Atemrhythmus<br />
- willkürliche Regelung der Ausatmung mittels Lautfunktionen<br />
- Erarbeiten der fünf Regenerationswege: Kreisen, Schwingen, Rhythmus, Atem und Tönen<br />
mit dem Ziel ganzkörperliche Eutonisierung<br />
- Einsatz von Körperbewegungen, Gestik<br />
- Methoden: Rollenspiel, Vorstellungshilfen, künstlerisches Gestalten (Textgestaltung),<br />
Atemschriftzeichen<br />
Ziele<br />
- Erarbeitung einer eutonen Spannung (St<strong>im</strong>migkeit zwischen Sprechen, Situation und<br />
Aussage; durch die Harmonisierung von Atmung, Bewegung und St<strong>im</strong>me<br />
Körperbewusstsein und Empfindungsvermögen für funktionelle Zusammenhänge schaffen)<br />
Anwendbarkeit<br />
- alle St<strong>im</strong>mstörungen<br />
Kritik<br />
- Methode weniger für die St<strong>im</strong>mtherapie als für den pädagogisch-künstlerischen Bereich<br />
entwickelt<br />
- ganzheitliches Verfahren, das dem Transfer und der Ursachenforschung nur wenig<br />
Beachtung schenkt<br />
c) Atemtherapie nach Middendorf<br />
Theoretische Grundlage<br />
- Menschenbild: Atem als zentrales, verbindendes Element zwischen Körper und Seele<br />
- Psychosomatisches, übendes Verfahren aus dem Bereich der Pneopädie<br />
- Atem hat mechanischen, kreislaufdynamischen, chemischen, nervös-reflektorischen und<br />
nervös-vegetativen Einfluss auf den gesamten Körper<br />
- Heilkraft des Atems durch seine enge Vernetzung mit physischen und psychischen<br />
Vorgängen<br />
Inhaltliche Schwerpunkte<br />
- Verbesserung der Körperwahrnehmung durch Atemübungen<br />
Dehnungen unterschiedlicher Körperbereiche und Atem geschehen lassen<br />
Einsatz von <strong>Dr</strong>uckpunkten (Lenken von Atem<strong>im</strong>pulsen)<br />
Vokal-Atemraumarbeit und schweigendes Tönen (Mobilisieren verschiedener<br />
Atemräume durch dazugehörige Vokale); Atemarbeit mit Konsonanten<br />
Erfahrung von Atemräumen und Atemrichtung<br />
Bewegung aus dem Atem heraus, Atemtanz<br />
5
Atembehandlung <strong>im</strong> Liegen (kreisende lösende Bewegungen, Händeauflegen)<br />
- Wechselspiel der Kernelemente Sammeln (geistige Präsenz bei unbewussten Prozessen),<br />
Empfinden (Wahrnehmung von Innen- und Außenraum) und Atmen (Geschehenlassen <strong>im</strong><br />
dreiphasigen Rhythmus)<br />
Ziele<br />
- Förderung von Selbstheilungsprozessen, Kreativität und Ich-Kraft<br />
- Auswirkung dieser Prozesse auf Kraft, Klang, Resonanz und Elastizität der St<strong>im</strong>me<br />
Anwendbarkeit<br />
- geeignet für alle Dysphonien<br />
Kritik<br />
- kein Ersatz für St<strong>im</strong>mtherapie<br />
- Auftreten von heftigen vegetativen und psychischen Reaktionen (z.B. Hyperventilation)<br />
d) Atemwurf nach Fernau-Horn<br />
Theoretische Grundlage<br />
- Atemwurf und Artikulation: Erzeugen einer Tiefstellung und Entspannung des Kehlkopfes<br />
durch die Aktivierung der Bauchmuskulatur und die Weitung des Kehlraumes<br />
Inhaltliche Schwerpunkte<br />
- Atemwurf: Übung der aktiven Einziehung des Bauchdecke bei der Ausatmung,<br />
Kombination mit der Artikulation von plosiven „Lob“<br />
- Flankenstütze: Trainieren der Ausatmung ohne Absenkung des Brustkorbes<br />
- mechanische Weitung des Kehl- und Rachenraumes durch Gähn-, Pleuel- und<br />
Schlürfübungen<br />
- Erarbeiten der Kehlfederung mittels Artikulation und Atemwurf zur Beeinflussung von<br />
pathologischen Verspannungen der Nacken- und Halsmuskulatur<br />
- Übung unterschiedlicher St<strong>im</strong>meinsätze<br />
- Übung von Vokalformen<br />
- „Höflichkeitsgähnen“ zur Lösung von Verspannungen <strong>im</strong> Phonationstrakt<br />
Ziele<br />
- Tiefstellung und Entspannung des Kehlkopfes, Verlagerung des Sprechablaufs in den<br />
vorderen Artikulationsbereich<br />
Anwendbarkeit<br />
- bei St<strong>im</strong>mlippenlähmungen und bei funktionellen Dysphonien nur das st<strong>im</strong>mhafte Gähnen<br />
mit geöffnetem Mund und das Schlürfen<br />
Kritik<br />
- Gefahr, dass das aktive Einziehen der Bauchdecke, das Artikulieren von gehaltenen<br />
Plosiven und die gestützte Flankenatmung die muskuläre Spannung erhöhen und damit zu<br />
einer Überbelastung des St<strong>im</strong>morgans führen<br />
6
e) Typenpolare Atmung nach Alavi-Kia und Schulze-Schindler (1991)<br />
Theoretische Grundlage<br />
- Menschenbild: Versuch einer Individualisierung; jedoch Gruppierung in zwei Klassen<br />
- prägender Einfluss von Mond und Sonne auf die Atmung durch den ständigen Wechsel<br />
ihres Standes; entscheidend: Standort zum Zeitpunkt der Geburt<br />
- die zwei Phasen des Atemvorgangs: Einatmung als Ausdehnungsphase (Zusammenhang<br />
mit dem expansiven Einfluss des Mondes) und Ausatmung als Verengungsphase<br />
(Zusammenhang mit dem kontraktiven Einfluss der Sonne)<br />
- analoge Existenz zweier unterschiedlicher Atemtypen:<br />
Einatmer oder lunare Typen (=vom Mond ausgehend) weiten während der<br />
Einatmung den gesamten Brustkorb, Passivität bei der Ausatmung<br />
Ausatmer oder solare Typen (= von der Sonne ausgehend) atmen mittels Kontraktion<br />
der Ausatmungsmuskulatur aktiv aus, Passivität bei der Einatmung<br />
Inhaltliche Schwerpunkte<br />
- Best<strong>im</strong>mung des Atemtypus durch Ein- und Ausatemübungen sowie lunarer und solarer<br />
Phonation, entscheidend: Reaktionen des Patienten auf die jeweiligen Übungen<br />
- typentsprechende Auswahl aller Atem-, Körper- und St<strong>im</strong>mübungen:<br />
Verstärkung der inspiratorischen Kräfte be<strong>im</strong> Einatmer durch Bewegung und Dehnung<br />
Verstärkung der exspiratorischen Kräfte be<strong>im</strong> Ausatmer durch Ruhe und Entspannung<br />
Ziele<br />
- Behandlung nach individuellen Voraussetzungen anstatt ausschließlich nach<br />
physiologischen Gesichtpunkten<br />
Anwendbarkeit<br />
- alle Formen von St<strong>im</strong>mstörungen<br />
Kritik<br />
- Zusammenhang zwischen den Atemtypen und dem Sonnen- bzw. Mondstand zum<br />
Zeitpunkt der Geburt umstritten; Vernachlässigung anderer Therapiebausteine<br />
3. Körperbezogene Ansätze<br />
a) Eutonie nach Alexander<br />
Theoretische Grundlage<br />
- Menschenbild: Mensch als Wesen mit ineinander greifenden psychischen und physischen<br />
Prozessen<br />
- körperzentrierter Übungsweg mit Grundlagen aus Rhythmik und Bewegungserziehung<br />
- innere und äußere Einflüsse auf Körpertonus<br />
- ganzheitlicher Lernprozess statt Symptombehandlung, um in Einklang mit sich und seiner<br />
Umwelt zu gelangen<br />
Inhaltliche Schwerpunkte<br />
- differenzierteres Körperbewusstsein durch Konzentrations- und Bewusstseinsübungen<br />
Konzentratives Sehen und Hören, Präsentsein, gerichtete bewusste Wahrnehmung<br />
Erarbeiten von Bewusstsein für Hautkontakt, Innenräume, Knochen, Durchströmung<br />
- Lockerung und Regeneration des Körpers durch Streck- und Dehnübungen<br />
7
passive und aktive Streckung, Verlängern in den Raum, Strecken durch Widerstand<br />
- Haltungsaufbau <strong>im</strong> Sitzen, Stehen und Gehen<br />
- funktionsbezogene Übungen z.B. für Atmung<br />
Ziele<br />
- Erarbeiten von individueller, kontextangemessener Tonusflexibilität<br />
- Auswirkung der bewussten, kinästhetischen Aufmerksamkeit für Spannungszustände auf<br />
Atmung, Phonation und Gebrauch des Selbst<br />
Anwendbarkeit<br />
- gut in größere Therapiegefüge integrierbar<br />
Kritik<br />
- reicht zur St<strong>im</strong>mtherapie alleine nicht aus<br />
- Schwierigkeit, mit psychischen Reaktionen des Patienten umzugehen<br />
b) Progressive Muskelentspannung nach Jacobson<br />
Theoretische Grundlagen<br />
- Menschenbild: zu viel Anspannung als Ursache der meisten Erkrankungen des Menschen<br />
- Ganzkörperliches, systematisches Entspannungsverfahren zur Senkung des Körpertonus<br />
- Entspannung = Aussetzen von Muskelkontraktion<br />
- Abbau körperlicher und seelischer Beschwerden durch den Abbau von Körpertonus<br />
Inhaltliche Schwerpunkte<br />
- max<strong>im</strong>ale Anspannung und anschließend abruptes max<strong>im</strong>ales Lösen der Spannung<br />
einzelner Muskelgruppen nacheinander, Wahrnehmung der sich vertiefenden Entspannung<br />
- Voraussetzung für Arbeit an St<strong>im</strong>mfunktion<br />
Ziele<br />
- Erreichen einer tiefen Entspannung und Wiederherstellung einer vegetativen Balance<br />
- Senken des Tonus unter ursprüngliches Ausgangsniveau<br />
Anwendbarkeit<br />
- Entspannungsmethode bei Patienten mit allgemeinem oder spezifischem Hypertonus<br />
- Verdeutlichung der Gegensätze Anspannung – Entspannung bei Patienten, die ungleiche<br />
Spannungen nicht differenzieren können<br />
Kritik<br />
- reicht allein als St<strong>im</strong>mtherapie nicht aus<br />
- Gefahr der Erhöhung des Grundtonus wenn Lösungsphase nicht gelingt<br />
c) Feldenkrais-Methode<br />
Theoretische Grundlage<br />
- Menschenbild<br />
Mensch als lernendes Wesen: Prinzip des lebenslangen Lernens<br />
Einheit von Körper und Geist als untrennbares Ganzes<br />
- Grundlagen aus fernöstlicher Kampfkunst, Physik, Mechanik, Anatomie und<br />
Verhaltenspsychologie<br />
8
- Lernen durch Bewegung, Lenken des Lernens durch bewusstes Ausführen von<br />
Bewegungsabläufen<br />
Inhaltliche Schwerpunkte<br />
- Bewusstsein für Bewegungen als Voraussetzung für Veränderungen der Bewegungen<br />
- funktionale Integration: Arbeit mit dem Einzelnen (Patient weitgehend passiv)<br />
Erfassung des Bewegungskonzepts des Patienten und Entdeckung effizienterer<br />
Bewegungsmuster<br />
Schulung der Wahrnehmung durch <strong>Dr</strong>uckreize und Dehntechnik<br />
- Bewusstheit durch Bewegung: Arbeit in der Gruppe (Patient aktiv)<br />
Exper<strong>im</strong>entieren mit neuen Bewegungen unter verbaler Anleitung<br />
Spüren von Körperkontakten, Bewegung und Dehnung<br />
Ziele<br />
- langsame Neustrukturierung des Nervensystems durch Abbau erlernter und automatisierter<br />
‚falscher’ Bewegungsabläufe und Aufbau von Verkabelungen für neue, zweckmäßigere<br />
Bewegungsmuster<br />
- Schulung körperlicher und geistiger Bewusstheit durch gezielte Körperwahrnehmung<br />
Anwendbarkeit<br />
- für St<strong>im</strong>mstörungen, die aufgrund von ineffizienter Bewegungsabläufe entstehen<br />
Kritik<br />
- intensiver Körperkontakt Umgang mit Emotionen des Patienten<br />
d) Stoßübungen nach Froeschels<br />
Theoretische Grundlage<br />
- funktioneller Ansatz<br />
- Übertragen der Kraft einer Muskelgruppe auf eine andere<br />
Inhaltliche Schwerpunkte<br />
- Stoßübungen mit Phonation von Plosiv-Vokalverbindungen: die geballten Hände an den<br />
Thorax legen, während man „pa,pe,pi,po,pu“ spricht, werden sie vom Thorax bis an die<br />
Oberschenkel kräftig nach unten gedrückt<br />
Ziele<br />
- Übertragung der Muskelspannung auf andere Muskelgruppen mit so viel und so wenig<br />
Kraft wie nötig<br />
Anwendbarkeit<br />
- Kelhkopflähmungen und hypofunktionelle Dysphonien<br />
Kritik<br />
- oft standardmäßig angewandt in Verbindung mit Reizstrombehandlung bei<br />
St<strong>im</strong>mlippenlähmungen > häufige Entstehung einer hyperfunktionellen Dysphonie bis hin<br />
zur Taschenfaltenst<strong>im</strong>me<br />
9
4. <strong>Therapieansätze</strong> mit dem Schwerpunkt: Artikulation<br />
a) Nasalierungsmethode nach Pahn und Pahn<br />
Theoretische Grundlage<br />
- funktionsorientierter Ansatz<br />
- durch Vergrößerung des Ansatzrohrs: Inaktivierung des Gaumensegels während des<br />
Sprechens und Tiefstellung des Kehlkopfs (bei leicht geöffnetem Mund und angedrückten<br />
Nasenflügeln phonieren)<br />
Inhaltliche Schwerpunkte<br />
- Erarbeiten der kostoabdominalen Sprechatmung durch aktive Kontraktion der Bauchdecke<br />
- Phonation nasalierter Vokale mit Kontrolle der Nasalität durch Andrücken der Nasenflügel<br />
- Zwischenschaltung von Nasalen und Ausdehnung des nasalierten St<strong>im</strong>mklanges <strong>im</strong><br />
gesamten Bereich des Brustregisters<br />
- Kauübungen nach Froeschels<br />
- Lippenvibrationsübungen (Lippenflattern), Kieferschütteln, Trink- und Stauübungen<br />
- Artikulationsübungen: Wortketten mit nasalierten St<strong>im</strong>meinsätzen, Übungen <strong>im</strong> Bereich<br />
der Singst<strong>im</strong>me: Atemstütze, durch Nasalierung Glättung des Registerwechsels,<br />
Glissandoübungen, Intervallsprünge<br />
Ziele<br />
- mehr Resonanz erzeugen<br />
Anwendbarkeit<br />
- bei allen Störungsbildern anwendbar zur Erweiterung der Resonanz<br />
Kritik<br />
- ein dauerhaft geöffnetes Gaumensegel entspricht nicht der physiologischen Artikulation<br />
- eher St<strong>im</strong>mtechnik als Therapiemethode; keine Berücksichtigung der Ursachen und<br />
aufrechterhaltenden Faktoren der St<strong>im</strong>merkrankung<br />
5. <strong>Therapieansätze</strong> mit dem Schwerpunkt: Phonation<br />
a) Funktionales St<strong>im</strong>mtraining (1989)<br />
Theoretische Grundlage<br />
- Menschenbild: Konzentration auf die (St<strong>im</strong>m-) Funktion, psychische/ personale Aspekte<br />
weniger berücksichtigt<br />
- ursprünglich Konzept zur Gesangsausbildung<br />
- Arbeit an der St<strong>im</strong>me in Verbindung mit Bewegung (v.a. der Extremitäten), basierend auf<br />
dem Zusammenwirken des gesamten muskulären Systems<br />
- Doppelventilfunktion des Kehlkopfes als Basis für die Ableitung des Einflusses von<br />
Körperbewegungen auf die Kehlkopffunktion:<br />
Zusammenarbeit der Muskulatur mit dem Überdruck- oder Auslassventil<br />
(Taschenfalten) bei der Ausatmung<br />
Aktivierung des Unterdruck- oder Einlassventils (St<strong>im</strong>mlippen) durch die Tätigkeit<br />
der Einatmungsmuskulatur<br />
10
Inhaltliche Schwerpunkte<br />
- u. a. Schwerpunkt E. Rabine: Ganzkörperliche Bewegungsübungen zur Aktivierung der<br />
Einatmungsmuskulatur, St<strong>im</strong>mübungen zur Organisation psychischer, dynamischer und<br />
kommunikativer St<strong>im</strong>maspekte, funktionales Hören<br />
- u. a. Schwerpunkt G. Rohmert: Selbstregulation der St<strong>im</strong>mfunktion über das<br />
audiophonatorische Kontrollsystem, Ausbildung von Vibrato und Brillanz<br />
Ziele<br />
- Entfaltung des individuellen St<strong>im</strong>mpotenzials, Verbesserung des Glottisschlusses, Abbau<br />
unerwünschter supraglottischer Kompensation bei der Phonation, Tonisierung der Mm.<br />
Vocales, St<strong>im</strong>mkräftigung<br />
Anwendbarkeit<br />
- alle Formen funktioneller und organischer St<strong>im</strong>mstörungen<br />
Kritik<br />
- hoher Grad an Effizienz durch physiologische Thesen, aber durch die Konzentration auf die<br />
Singst<strong>im</strong>me eventuelle Probleme be<strong>im</strong> Transfer in die Sprechst<strong>im</strong>me<br />
b) Kaumethode nach Froeschels<br />
Theoretische Grundlage<br />
- funktioneller Ansatz, der davon ausgeht, dass durch die phylogenetisch ältere Funktion<br />
(Kauen) die jüngere (Sprechen) zur Regeneration überlagert wird<br />
- durch das Kauen lassen sich Enge und unphysiologische Verspannungen <strong>im</strong> Ansatzrohr bis<br />
auf Glottisebene beseitigen<br />
Inhaltliche Schwerpunkte<br />
- Kieferschütteln, St<strong>im</strong>m- und Stummkauen mit Kaugut, Vokalkauen, Kauen mit Wort- und<br />
Satzeinschüben, Lesen und Freisprechen mit umrahmender Kauphonation und<br />
Kauerinnerungshilfen<br />
Ziele<br />
- Spannungszustände beheben und einen resonanzreichen St<strong>im</strong>mklang entwickeln<br />
Anwendbarkeit<br />
- postmutationelle und hyperkinethische Dysphonien, aber generell gut geeignet für<br />
Resonanzübungen<br />
Kritik<br />
- generell gut und ohne lange Vorarbeit in die Therapie integrierbar, doch sie allein heilt<br />
keine Dysphonie<br />
Wie könnte man die <strong>Therapieansätze</strong> noch einteilen?<br />
11
III. Methodenübergreifender Therapieaufbau<br />
1. Wie sollte der Therapieaufbau erfolgen?<br />
Gliederung der St<strong>im</strong>mtherapie in fünf Grundbausteine:<br />
- Tonus, Haltung, Bewegung<br />
- Atmung Wahrnehmung als Basis für alle<br />
- Phonation Therapiebausteine<br />
- Person<br />
(weitere Ausführung in Punkt 3, siehe auch Anhang: 1. Graphik zum Therapieaufbau)<br />
Im Allgemeinen:<br />
- individualisierter und flexibler Therapieaufbau<br />
- Transparenz des Therapieaufbaus und Methodenvielfalt<br />
- St<strong>im</strong>me <strong>im</strong> Zentrum der Therapie: Herstellen eines direkten Bezugs zur St<strong>im</strong>mfunktion bei<br />
jeder Übung<br />
- Einbezug der übenden/ funktionellen wie auch der beratenden/ personalen Ebene<br />
- Ursachenforschung und Eruierung st<strong>im</strong>mbeeinflussender Faktoren während des gesamten<br />
Therapieverlaufs, Begleitung von Transferleistungen von Beginn der Therapie an<br />
2. Warum gibt es so viele verschiedene Ansätze bzw. Übungen zu<br />
den einzelnen Bausteinen?<br />
- unterschiedliches Ansprechen auf Therapien/ Übungen je nach Menschenbild des<br />
Therapeuten bzw. des Patienten<br />
- Heterogenität und Komplexität der St<strong>im</strong>mstörungen, daher Notwendigkeit einer Vielzahl<br />
unterschiedlicher Methoden und Ansätze<br />
- die vielschichtigen Zusammenhänge erfordern ein therapeutisches Arbeiten auf mehreren<br />
Ebenen gleichzeitig<br />
- das Zusammenwirken verschiedener Ansätze in seiner Gesamtwirkung ist mehr als die<br />
Summe der Einzelwirkungen<br />
- Ansätze auf teilweise völlig verschiedene Theorien/ Hintergründe zurückzuführen<br />
„Daraus ergibt sich, dass es zur Behandlung einer St<strong>im</strong>merkrankung kein Standardprogramm<br />
geben kann, das nach einem festgelegten oder chronologischen Schema erfolgt. In jedem Fall<br />
wird von den individuellen pathophysiologischen Gegebenheiten auszugehen sein, der<br />
Persönlichkeit des Patienten, seiner situativen Befindlichkeit, seinen Bedürfnissen, seinen<br />
Fähigkeiten und Ressourcen. So erübrigt sich auch die Frage nach der effektivsten Methode.<br />
Im Therapieprozess haben viele Methoden ihren Platz, aber keine von ihnen ist <strong>im</strong>mer und bei<br />
jedem Patienten in gleicher Weise wirksam.“ (Spiecker-Henke, Neuschaefer-Rube 2003: 305)<br />
12
3. Was sollte eine Therapie nach den bisherigen Erkenntnissen<br />
enthalten?<br />
a) Therapiebaustein: Tonus, Haltung, Bewegung<br />
„Eine unbewegte Glocke tönt niemals“ (chinesisches Sprichwort)<br />
- Körperwahrnehmung und Körperbewusstsein<br />
Auflageflächen, Körperräume, Atmung, Unterschiede zwischen den Körperhälften,<br />
Unterschiede vor und nach der Behandlung, Körperspannung, Körperhaltung<br />
- Tonusregulation<br />
Abbau von gesamtkörperlichem Hypertonus, z.B. mit entspannenden Körpertherapien<br />
gezielte Lockerung spezieller, besonders wichtiger Muskelgruppen<br />
Aufbau von Eutonus<br />
- Haltungsarbeit (auf Grundlage der Eutonisierung)<br />
Erarbeiten einer dauerhaften physiologischen Haltung <strong>im</strong> Sitzen und Stehen als<br />
günstige Voraussetzung für Atmung und St<strong>im</strong>mgebung<br />
Wichtig: Patient muss sich wohl fühlen, sonst Problem des mangelnden Transfers der<br />
physiologischen Haltung in den Alltag Anbieten von Haltungsalternativen<br />
- Bewegung<br />
Aktivierung und Entspannung der Muskulatur, Anregen des Kreislaufs<br />
Verbesserung der körperlichen Beweglichkeit und Koordinationsfähigkeit<br />
Erhöhung und Intensivierung des Körperbewusstseins<br />
Einbettung in St<strong>im</strong>mübungen<br />
b) Therapiebaustein: Atmung<br />
„Selbst die stärksten St<strong>im</strong>mbänder verkraften nicht auf Dauer falsche Atemtechnik.“<br />
(Coblenzer 1987)<br />
- Kombination von direkter und indirekter Einflussnahme auf das Atemgeschehen:<br />
bewusstes Thematisieren der Atmung be<strong>im</strong> direkten Vorgehen<br />
absichtliches Nicht-Thematisieren, Einsatz von Intention und Bewegung be<strong>im</strong><br />
indirekten Vorgehen<br />
- Förderung der Nasenatmung:<br />
Nasenatmung als Voraussetzung für die Zwerchfellaktivität und damit für die<br />
Tiefatmung<br />
- Hinführung zur Tiefatmung:<br />
Voraussetzung für die Bauch-Zwerchfell-Flankenatmung: Wahrnehmung des<br />
Ausatemstroms und der Atemräume, Entspannung, Dehnung und Lockerung sowie<br />
Tonuswahrnehmung und Tonusregulation <strong>im</strong> unteren Bauch-Becken-Bereich<br />
- Entwicklung des physiologischen Atemrhythmus:<br />
Erzielen eines physiologischen Atemrhythmus und einer reflektorischen<br />
Atemergänzung durch indirekte Behandlung und Entspannung<br />
- Übungen zum Abspannen:<br />
Lösen der Spannung der Bauchmuskulatur am Ende einer Sprechphase und<br />
Rückfederung des Zwerchfells nach kurzer Entspannung in die Ausgangsstellung<br />
Durch Abspannen und Federung opt<strong>im</strong>ales Zusammenspiel von Atemdruck und<br />
St<strong>im</strong>mlippenspannung<br />
Hauptziel: Umstellen der Hochatmung auf die Zwerchfell-Flanken-Atmung<br />
13
c) Therapiebaustein: Artikulation<br />
„Nachlässiges Artikulieren strapaziert den gutwilligsten Hörer“ (Coblenzer 1987)<br />
- Präzise Artikulation bedeutet: Bewegliche Lippen, lockerer Unterkiefer, elastische Zunge<br />
und entspannte Halsmuskulatur<br />
- Einzelziele: Steigerung des kinästhetischen Bewusstseins bezüglich Lage und Spannung<br />
der Artikulationsorgane und –muskulatur, Verlagerung der kehligen Vokalphonation nach<br />
vorn, Lockerung der Sprechmuskulatur, präzise Bildung der Plosivlaute<br />
Hauptziel der Artikulationstherapie: Aberziehung best<strong>im</strong>mter Fehlleistungen mit<br />
gleichzeitiger Anerziehung der natürlichen Sprechfunktionen<br />
d) Therapiebaustein: Phonation<br />
„Das Verständlichste an der Sprache ist nicht das Wort selber, sondern der Ton, Stärke,<br />
Modulation, Tempo, mit denen eine Reihe von Worten gesprochen wird- kurz, die Musik hinter<br />
den Worten, die Leidenschaft hinter dieser Musik, die Person hinter dieser Leidenschaft: alles<br />
das also, was nicht geschrieben werden kann.“ (Nietzsche in Zehetmeier 1986)<br />
- Basis:<br />
Bewusstmachen der St<strong>im</strong>mwahrnehmung: Klang, Vibration und andere taktile<br />
Empfindungen <strong>im</strong> Kehlkopfbereich (Akzeptieren des Ist-Zustandes der St<strong>im</strong>me, da<br />
deren Veränderung ohne Schulung unphysiologische Muster hervorrufen würde)<br />
- St<strong>im</strong>mwahrnehmung:<br />
Differenzierung der durch den Klang empfundenen Hörwahrnehmung und des<br />
Körperempfindens<br />
- Finden der Indifferenzlage:<br />
physiologisches Nutzen der St<strong>im</strong>me nur in der Indifferenzlage möglich, Erzielen des<br />
bestmöglichen St<strong>im</strong>mergebnisses mit dem geringsten Kraftaufwand<br />
- Resonanzaufbau:<br />
Übungen, die eine Entspannung und Eutonisierung des Körpers bewirken,<br />
Erschließen von Resonanzräumen des Körpers und Kopfes<br />
- Vorverlagerung des St<strong>im</strong>msitzes:<br />
Erlangen eines vorderen St<strong>im</strong>msitzes durch Vollschwingung der St<strong>im</strong>mlippen,<br />
zwerchfellgesteuerten Atemdruck und präzise Lautausformung<br />
- Stabilisieren der St<strong>im</strong>mführung:<br />
Stabilisierung der St<strong>im</strong>mführung meist durch die allgemeine Tonusregulierung<br />
(Voraussetzungen der Tonusregulierung: konstanter Anblasedruck und<br />
Ausbalancieren der Kräfte von Zwerchfell und Kehlkopf)<br />
- Erweiterung des St<strong>im</strong>mumfangs:<br />
ermöglicht durch die Modalationsfähigkeit der St<strong>im</strong>me, Unterstützung der<br />
Ausdehnung des St<strong>im</strong>mumfangs durch die Vorstellung von Leichtigkeit und Schwung<br />
- Kräftigung des St<strong>im</strong>mvolumens:<br />
Ziel: voluminöse und voll tönende St<strong>im</strong>me, ohne mehr Kraft aufzuwenden<br />
(Resonanzreichtum)<br />
- Verlängerung der Phonationsdauer:<br />
Verlängerung der Phonationsdauer durch die Ökonomisierung der St<strong>im</strong>mfunktion<br />
- Verbesserung der Modulationsfähigkeit und der prosodischen Elemente:<br />
Modulation der Sprache mittels Variationen von Tonhöhe, Lautstärke und<br />
Sprechtempo<br />
- St<strong>im</strong>meinsätze:<br />
Verbinden des Übens von Vokaleinätzen mit der Vorstellung von Lösen/ Fallenlassen<br />
und Passivität<br />
- Mentales St<strong>im</strong>mtraining:<br />
mentales Durchführen von St<strong>im</strong>mübungen > <strong>im</strong> Beisein anderer Personen möglich<br />
14
e) Therapiebaustein: Person<br />
„St<strong>im</strong>me, die der Spiegel der Seele ist“ (Erasmus)<br />
- Eigene St<strong>im</strong>me kennen lernen und akzeptieren<br />
Übungen zur Selbstwahrnehmung<br />
Tonband- und Videoaufnahmen: durch stetige Konfrontation mit der eigenen St<strong>im</strong>me<br />
und Fähigkeit zu einer wertfreien Beschreibung der St<strong>im</strong>me entwickeln<br />
- eigenes St<strong>im</strong>mverhalten kennen lernen<br />
Beobachtungsaufgaben zum St<strong>im</strong>mklang und Kommunikationsverhalten in der<br />
Therapie- und Alltagssituation<br />
- Reflexion der Übungen<br />
- Ursachen und aufrechterhaltende Faktoren<br />
durch Selbstbeobachtung Erkenntnisse über mögliche Ursachen und Einflussfaktoren<br />
der St<strong>im</strong>mstörung<br />
allgemeine Prinzipien der St<strong>im</strong>mfunktion als ergänzende Information zu den eigenen<br />
Erfahrungen<br />
- Sprechabsicht und St<strong>im</strong>mgebrauch<br />
eindeutige Sprechabsicht um Phonationsabläufe zu opt<strong>im</strong>ieren: St<strong>im</strong>mübungen mit<br />
einer klaren Sprechabsicht und Ausrichtung auf den Zuhörer<br />
- Erarbeiten eines „gesunden“ St<strong>im</strong>mverhaltens:<br />
Ausschalten St<strong>im</strong>mverschlechternde Bedingungen<br />
Verstärken St<strong>im</strong>mbegünstigender Bedingungen<br />
Strategien um in st<strong>im</strong>mbelastenden Situationen die St<strong>im</strong>me zu entlasten<br />
- Bewältigung von Angst auslösenden Sprechsituationen<br />
IV. Anhang<br />
1. Graphik zum Therapieaufbau<br />
1.<br />
WAHRNEHMUNG<br />
Wahrnehmung<br />
der<br />
Wechselwirkung<br />
von Haltung,<br />
St<strong>im</strong>me und<br />
St<strong>im</strong>mung<br />
Wahrnehmung<br />
von Eigen- und<br />
Fremdgeräuschen<br />
Wahrnehmung<br />
der<br />
Körperhaltung<br />
2.<br />
TONUSREGULATION<br />
Tonusregulation in<br />
der Bewegung<br />
Aufrichtung des<br />
Körpers<br />
Lockerung bzw.<br />
Kräftigung der für<br />
Atmung, St<strong>im</strong>me u.<br />
Sprechen notw.<br />
Muskulatur<br />
15<br />
3. ATMUNG<br />
Sicherheit des<br />
physiologisch<br />
richtigen Atmens<br />
<strong>im</strong> Alltag<br />
Fähigkeit des<br />
Abspannens bei<br />
Ruhe- und<br />
Phonationsatmung<br />
Physiolog.<br />
Atemrhythmus in<br />
Ruhe und<br />
Bewegung<br />
4.<br />
STIMMGEBUNG<br />
Sicherheit des<br />
Gebrauchs der<br />
St<strong>im</strong>me <strong>im</strong><br />
Alltag<br />
Ökonomisches<br />
Sprechen<br />
Physiologische<br />
Lautbildung
Wahrnehmung<br />
des Körpertonus<br />
Wahrnehmung<br />
der Emotionen<br />
Wahrnehmung<br />
der Körperräume<br />
Wahrnehmung<br />
des<br />
Körperkontaktes<br />
(Quelle: www.intervoice.de)<br />
Fähigkeit <strong>im</strong><br />
Umgang mit<br />
psychischen<br />
Spannungszuständen<br />
Fähigkeit zur<br />
Regulation<br />
körperlicher<br />
Spannungszustände<br />
16<br />
Bauch-<br />
Zwerchfell-<br />
Flankenatmung<br />
Nasenatmung<br />
Voll<br />
entwickelte<br />
Resonanz und<br />
Tragfähigkeit<br />
Physiologischer<br />
St<strong>im</strong>mein- und<br />
absatz<br />
3. 3. X<br />
2. Reihenfolge 2. erledigt X<br />
1.<br />
1.<br />
X<br />
1,2,3 = Schwierigkeitsgrad<br />
X, X, X= bereits entwickelte Kompetenzen in einem Bereich<br />
2. Praktische Übungen zum Therapiebaustein: Atmung<br />
Förderung der Nasenatmung:<br />
- Aktivierung der Nasenatmung durch verschiedene Riech- und Schnüffelübungen<br />
Hinführung zur Tiefatmung:<br />
- Übungen <strong>im</strong> Liegen mit verlängerter Ausatmung zum Erlangen der Bauchatmung;<br />
Übungen zur Ermöglichung der Flankenatmung, Atemübungen <strong>im</strong> Sitzen, Stehen und in<br />
Bewegung<br />
Entwicklung des physiologischen Atemrhythmus:<br />
- Förderung der Atempause durch entsprechende Entspannungsübungen<br />
Übungen zum Abspannen:<br />
- Abspannübungen beispielsweise nach verlängerter Ausatmung, nach kurzer, kräftiger<br />
Ausatmung, nach Plosiv-Endlauten und Abspannübungen mit Hilfsmitteln, wie Gummizug,<br />
Ballwurf, „Händehaken", Hand oder Fußdruck<br />
3. Praktische Übungen zum Therapiebaustein: Tonus, Haltung,<br />
Bewegung<br />
Körperwahrnehmung<br />
- Beschreiben der eigenen Körperhaltung und Körperauflage <strong>im</strong> Sitzen und Stehen<br />
- Abstreichen des Körpers, Massagen des Körpers<br />
Tonusregulierung
- Abbau von gesamtkörperlichem Hypertonus<br />
Entspannungsübungen wie z.B. Autogenes Training oder Progressive Muskelrelaxation<br />
passives Bewegen bei der Funktionalen Integration nach Feldenkrais<br />
Fantasiereisen<br />
Massage/ Ausstreichen von Muskulatur, Dehnungsübungen<br />
- Gezielte Lockerung von Hals/ Nacken/ Schultergürtel<br />
Massagen, z.B. mit Igelball<br />
Wärmebehandlung<br />
lockernde Bewegungsübungen für Hals und Schultern (Schulterblätter<br />
zusammenschieben, Kopfkreisen, Nackendehnen, über die Schulter schauen, Kopf<br />
sinken lassen)<br />
- Gesamtkörperliche Eutonisierung<br />
schwingende und kreisende Bewegungen um den Körperschwerpunkt<br />
Klopf- und Vibrationsmassagen<br />
gymnastische Übungen, Ausschütteln der Extremitäten, Balancieren, Kontaktübungen<br />
Haltungsaufbau<br />
- Erarbeiten einer eutonen Sitzhaltung<br />
Sitzhöcker erspüren, Vorstellung einer Verbindung vom Scheitelpunkt zur Decke<br />
Beckenkippen durch das Abrollen der Sitzhöcker<br />
Balancieren eines Buches auf dem Kopf<br />
Sitzen auf einem Gymnastikball<br />
- Erarbeiten eines eutonen Standes<br />
Einpendeln auf den Körperschwerpunkt durch Schwingen und Kreisen<br />
Balancieren eines Buches auf dem Kopf<br />
Herstellung von Bodenkontakt durch Abrollen der Füße auf einem Igelball<br />
Sensibilisierung der Fußsohlen durch unterschiedliche taktile Reize<br />
Aufrichtung der Wirbelsäule aus dem Hocksitz, Farnblattübung<br />
Ausgleich des Hohlkreuzes durch Rückenkontakt zur Wand, Runden des Lendegebiets<br />
und Beckenschaukel<br />
Vorstellungshilfen: z.B. Wurzeln <strong>im</strong> Boden, Faden vom Kopf in den H<strong>im</strong>mel)<br />
Bewegungsarbeit<br />
- gymnastische Übungen<br />
- Räkeln, Strecken, Dehnen<br />
- Gehen, Seilspringen, Hüpfen, Tanzen, Balancieren<br />
- Kreisen, Schwingen, Schaukeln<br />
- Beckenkreisen, Beckenkippen<br />
- Bewegungsabläufe aus Tai-Chi, Qui-Gong, Yoga und Feldenkrais<br />
4. Praktische Übungen zum Therapiebaustein: Artikulation<br />
- offenes und geschlossenes Gähnen zur Weitung des Rachenraums<br />
- artikulomotorische Übungen zur Lockerung von Lippen, Zunge und Kiefer:<br />
- Lippen: Lippenflattern ohne/ mit st<strong>im</strong>me, Kutscher-brrr, Pfropfenknallübung: Lippen<br />
einziehen und sprengen<br />
- Zunge: Zungenrolle, Mundraumtasten, Zungenschnalzen<br />
- Kiefer: Kiefer-/ Kopfschütteln, lockeres Zähneklappern, Gesichtausstreichen abwärts/<br />
seitwärts, Korkensprechen<br />
- Mundmotorikübungen mit Vokalwechsel, Silbenwechsel und komplizierten<br />
Silbenverbindungen (ka-ku-ki-ko-kak)<br />
- Artikulationsübungen mit Zungenbrechern zur Auflockerung, zur Beeinflussung des<br />
Sprechtempos und zur Verbesserung von Lippen- und Zungenbeweglichkeit<br />
17
- Übungen mit lyrischen Texten mit unterschiedlichen Zielsetzungen wie Atemeinteilung,<br />
Pausengestaltung, Deutlichkeit und Sprechtempo<br />
5. Praktische Übungen zum Therapiebaustein: Phonation<br />
St<strong>im</strong>mwahrnehmung:<br />
- ist der Klang laut/leise/hoch/tief/stabil/brüchig/...<br />
- Vibrationsempfinden durch Auflegen der Hände am Brustkorb, Bauch, Gesicht<br />
- St<strong>im</strong>mveränderungen in Abhängigkeit der Kopfhaltung/Haltung/Veränderungen <strong>im</strong><br />
Ansatzrohr<br />
Finden der Indifferenzlage<br />
- Kausummen<br />
- Abspannen auf st<strong>im</strong>mhafte Laute<br />
- Phonation nach und während Entspannungsübungen<br />
Resonanzaufbau<br />
- Abrollen der Sitzhöcker<br />
- Beckenkreisen <strong>im</strong> Sitzen und Stehen (evtl. auf einem Gymnastikball)<br />
- <strong>im</strong> Liegen die Wirbelsäule und das Kreuzbein in verschiedenen Richtungen abrollen<br />
- siehe Baustein Atemübungen und Dehnungsübungen (für den Bereich Atemräume)<br />
- Kausummen, getöntes Gähnen<br />
- Einatmen auf Vokalform, bei Phonation beibehalten der entstandenen Weite <strong>im</strong> Ansatzrohr<br />
- Auflegen der Hände bei der Phonation auf die Flanken, den Bauch , Rücken, Brustkorb,<br />
Gesicht<br />
- Abklopfen des Brustkorbes, Gesichts, Kopf<br />
- Massagen, Abrollen des Körpers mit Bällen<br />
- Summen, dabei die Vibration <strong>im</strong> Gesicht erfühlen<br />
- während der Phonation von Nasalen die Nase, Stirn, Wangen und Lippen massieren<br />
- st<strong>im</strong>mhaftes Lippenflattern<br />
Vorverlagerung des St<strong>im</strong>msitzes<br />
- Übungen zur Unterstützung der zwerchfellgesteuerten Phonation<br />
- Übungen aus dem Therapiebaustein Artikulation<br />
- Klang „aus der Nase ziehen“/nach vorne ziehen<br />
- „Rutschbahn“ (St<strong>im</strong>mgleiten nach vorne/unten)<br />
- Blickkontakt zum Gesprächspartner, <strong>im</strong>aginäres Publikum<br />
Stabilisieren der St<strong>im</strong>mführung<br />
- gerade, gleichmäßige Klänge mit genauer Hörkontrolle<br />
- Klänge nach vorn ziehen/führen<br />
- Phonation in Verbindung mit eutonisierenden Körperübungen (balancieren u.ä.)<br />
Erweiterung des St<strong>im</strong>mumfangs<br />
- Singen von Tonleitern, Intervallen, Gleittönen (evtl. mit ausgedehnter<br />
Schwingungsbewegung der Arme oder Beine)<br />
- geführte Bewegung der Arme nach oben (ggf. mit fixiertem Zielpunkt)<br />
- Ausschütteln der Extremitäten und des Körpers (die Schüttelbewegung dehnt sich auf den<br />
Kehlkopf aus, Unterkiefer und Zunge können gelockert werden)<br />
- Seufzen<br />
Kräftigung des St<strong>im</strong>mvolumens<br />
- entsprechen weitgehend den Übungen zur Resonanz<br />
Verlängerung der Phonationsdauer<br />
- Ausatmen aus ffff, sssss, sch<br />
- allgemein Übungen zur Tonusregulation und Resonanz<br />
Verbesserung der Modulationsfähigkeit und der prosodischen Elemente<br />
- allgemein mit Vorstellung von Gleiten/Schwingen/Bewegung verbunden<br />
18
- Modulation mit Lippenflattern und auf st<strong>im</strong>mhafte Frikative<br />
- Vorstellungshilfe: Sirene, Auto fährt vorbei, Fliege summt <strong>im</strong> Z<strong>im</strong>mer herum (mit<br />
unterstützender Bewegung)<br />
- kurze Gedichte unartikuliert (auf Lippenflattern) inhaltsentsprechend modulieren<br />
- Betonungszeichen setzen, dies durch Arm-/Handbewegung unterstützen<br />
St<strong>im</strong>meinsätze<br />
- Thiel schlägt Übungen von Vokaleinsätzen mit der Vorstellung des Loslassens vor, z.B.<br />
einen Tropfen der sich löst, oder einen Ball fallen lassen, zusätzlich rhythmische<br />
Bewegungen<br />
- Vokaleinsätze durch Voranstellen von /h/ z.B. hup – huuu – uuu- unter, hop – hooo -ooo-<br />
Ober, hap – haaa – aaa – Ampel, hep – heee -eee – Eber, hip -hiii – iiii Igel<br />
6. Praktische Übungen zum Therapiebaustein: Person<br />
Übungen zur St<strong>im</strong>mwahrnehmung<br />
- Anhören von Aufnahmen verschiedener St<strong>im</strong>men und deren Beurteilung Erarbeitung von<br />
Beschreibungskategorien<br />
- Abhören eigener St<strong>im</strong>me des Patienten und Beschreibungsmerkmale einsetzen<br />
- eventuell auch Videoaufnahmen<br />
Eigenes St<strong>im</strong>mverhalten kennen lernen<br />
- St<strong>im</strong>mtagebuch<br />
- vereinbarte Gesprächssituation (z.B. Einkaufen) nach ausgewählten Aspekten beobachten,<br />
z.B.:<br />
laute/leise St<strong>im</strong>me<br />
Blickkontakt<br />
Gestikeinsatz<br />
Körperhaltung be<strong>im</strong> Sprechen<br />
Laufen, stehen oder sitzen be<strong>im</strong> Sprechen lieber<br />
- Rollenspiele<br />
Übungen zur Verbindung von Intention und St<strong>im</strong>me<br />
- Abspannübungen verbunden mit Bewegung z.B. Wespen verjagen: „Weg da!“ oder kurze<br />
Ausrufe: „Komm, her!“, „Geh weg!“<br />
- Prellen mit einem Ball begleitend zu Äußerungen<br />
- Einhalten des Blickkontaktes be<strong>im</strong> Lesen und freien Sprechen<br />
- Einsatz von Gesten in der Therapiesituation<br />
Transfer in den Alltag (wenn neu erarbeitete St<strong>im</strong>mmuster sich nicht spontan in den<br />
Alltag übertragen gezielte Begleitung des Transfers)<br />
- Transfer in den Übungssituationen: Bildbeschreibungen, Nacherzählungen, Erlebnisse<br />
schildern,<br />
- Rollenspiele: Vorbereiten konkreter Alltagssituationen<br />
19
V. Bibliographie<br />
- Alexander, G. (2006): Eutonie: http://www.eutonie.de, Zugriff am 24.06.06.<br />
- Bergauer, U. (1998): Praxis der St<strong>im</strong>mtherapie. Heidelberg: Springer.<br />
- Böhme, G. (1997): Sprach-, Sprech-, St<strong>im</strong>m- und Schluckstörungen. Band 1: Klinik.<br />
Stuttgart: Fischer Verlag.<br />
- Brügge, W. Mohs, K. (1994): Therapie funktioneller St<strong>im</strong>mstörungen. München: Reinhard.<br />
- Degenkolb-Weyers, S. und I. Visser (2006): Seminar-Skript des Seminars: Funktionales<br />
St<strong>im</strong>mtraining – Erlanger Modell.<br />
- Feldenkrais-Gilde Deutschland e.V. (2006): Die Feldenkrais Methode. Lernen in<br />
Bewegung: http://www.feldenkrais.de, Zugriff am 24.06.06.<br />
- Jacobson, Edmund (1976): Entspannung als Therapie. Progressive Relaxation in Theorie<br />
und Praxis. München: Pfeiffer Verlag.<br />
- Kjellrup, Mariann (1993): Bewusst mit dem Körper leben. Spannungsausgleich durch<br />
Eutonie. München: Ehrenwirth Verlag.<br />
- Gundermann H. (1991). Die Krankheit der St<strong>im</strong>me – die St<strong>im</strong>me der Krankheit, Stuttgart:<br />
Gustav Fischer Verlag, S. 201-204.<br />
- Haupt, E. (2003): St<strong>im</strong>mt´s? Idstein: Schulz-Kirchner.<br />
- Hermann-Röttgen, M. (1997): Das integrative Prinzip der tonalen St<strong>im</strong>mtherapie. In:<br />
Lotzmann G. (Hrsg.): Die Sprechst<strong>im</strong>me. Ulm: Fischer, S. 193 – 200.<br />
- Kruse, E. (2005): Gestörte St<strong>im</strong>me. Konservative Verfahren. In: Laryngo-Rhino-Otologie<br />
84, Stuttgart: Thieme, S. 192-200.<br />
- Middendorf, Ilse (2006): Der Erfahrbare Atem: http://www.erfahrbarer-atem.de/dererfahrbare-atem.htm.,<br />
Zugriff am 24.06.06.<br />
- Miethe, E. (1997): Tonale St<strong>im</strong>mtherapie. In: Lotzmann G. (Hrsg.): Die Sprechst<strong>im</strong>me.<br />
Ulm: Fischer, S. 186 – 192.<br />
- Nienkerke-Springer, A. (1996): Betrachtungen zu einem körperbezogenen Ansatz in der<br />
Sprach-, Sprech- und St<strong>im</strong>mtherapie. In: Die Sprachheilarbeit 41, Dortmund: Modernes<br />
Lernen, S. 89-117.<br />
- Rohmert, G. (1997): Die Lichtenberger Methode nach Gisela Rohmert. In: Lotzmann G.<br />
(Hrsg.): Die Sprechst<strong>im</strong>me. Ulm: Fischer, S. 16 – 27.<br />
- Shiromoto, O. (2003): Management of non-organic voice disorders: physiological bases of<br />
Accent Method for non-organic voice disorders. In: International Congres Series 1240, S.<br />
1269-1276.<br />
20
- Spiecker-Henke, M. (1997): Leitlinien der St<strong>im</strong>mtherapie. Stuttgart: Thieme.<br />
- Spiecker-Henke, M. und C. Neuschaefer-Rube (2003): Therapie funktioneller und<br />
organischer St<strong>im</strong>mstörungen. In: Grohnfeldt M. (Hrsg.): Lehrbuch der<br />
Sprachheilpädagogik und Logopädie, Band 4, Beratung, Therapie und Rehabilitation.<br />
Stuttgart: Kohlhammer, S. 303 – 320.<br />
- Stemple, J. (2005): A Holistic Approach to Voice Therapy. In: Seminars in Speech and<br />
Language Vol.26, S. 131-137.<br />
- Stengel, I. und Strauch, T. (1997): St<strong>im</strong>me und Person. Stuttgart: Klett-Cotta.<br />
- Thiel, M.M. (2003): St<strong>im</strong>mtherapie mit Erwachsenen, Springer Verlag.<br />
- Thyme-Frøkjær, K. und Frøkjær-Jensen, B. (2003): Die Akzentmethode. Idstein: Schulz-<br />
Kirchner.<br />
- Tuschy-Nitsch, D. (1999): Hilfe meine St<strong>im</strong>me bleibt weg! NLP in der St<strong>im</strong>m- und<br />
Persönlickeitsentwicklung. In: Multi Mind 3/99, S. 6-9.<br />
21