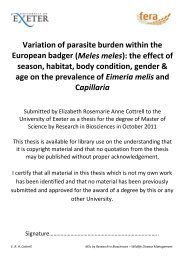Rhythmus und Instrumentation im Theater Einar Schleefs233
Rhythmus und Instrumentation im Theater Einar Schleefs233
Rhythmus und Instrumentation im Theater Einar Schleefs233
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
provokative Jokus, wenn z.B. auf dunkler Bühne Mozarts Im Arsch ist<br />
finster gesungen wird.<br />
Schleef vereindeutigt durch seine Musikalisierung. Wo bei Jelinek viele<br />
mögliche Tonfälle mitschwingen, entscheidet er sich meist für einen. Am<br />
vieldeutigsten bleiben, musikalisch gesehen, die Monologe, die zwar vorwiegend<br />
mit großem Gestus gesprochen werden, aber von vielen individuellen<br />
Nuancierungen geprägt sind. Elisabeth Augustins Monolog als „Andi“<br />
z.B. ist, unterstützt von der schwachen Beleuchtung der Szene, ein<br />
komplexes kleines Hördrama, in dem sie unzählige Sprachregister zieht.<br />
Auch bei Elisabeth Rath fällt die hohe Sprechkultur auf: Trotz des oft deklamatorischen<br />
Gestus‘ differenziert sie stets sehr genau in Dynamik <strong>und</strong><br />
Klangfarbe. Das Sprechtempo hingegen variiert weniger, rhythmische<br />
Variation entsteht bei ihr eher durch Pausen, Phrasierung <strong>und</strong> extreme<br />
Artikulation.<br />
Die dritte Äußerungsform, von der ich weiter oben gesprochen habe,<br />
betrifft vorwiegend die Chorsequenzen <strong>und</strong> einige wenige solistische Partien,<br />
wie etwa die Auftritte von Julia von Sell <strong>im</strong> ersten Teil der Inszenierung:<br />
Sie sind best<strong>im</strong>mt von einer stark musikalisierten, stilisierten Sprache.<br />
Die Chorsequenzen <strong>im</strong> Besonderen verdienen genauere<br />
Aufmerksamkeit. Sie sind durchgehend musikalisiert, meist einheitlich<br />
unisono, trotzdem lassen sich stets individuelle Sprechweisen heraushören.<br />
Es besteht eine Ambivalenz zwischen dem objektivierten, weil vervielfältigten<br />
Ausdruck <strong>und</strong> den subjektiven Abweichungen. Während diese Musikalisierung,<br />
also die genaue stilisierende Festlegung von Pausen, Staccati,<br />
gedehnten Tönen, Sprachmelodieverlauf <strong>und</strong> rhythmischen Akzenten<br />
etc., eine einheitliche Interpretation (<strong>im</strong> musikalischen Sinn) vorgibt, bleibt<br />
der Höreindruck durch die unvermeidliche <strong>und</strong> gewünschte Individualität<br />
des Ausdrucks vielschichtig. Sebastian Nübling beschreibt in einem anderen<br />
Zusammenhang diese Dichotomie als „Vielst<strong>im</strong>migkeit in der Einheit<br />
der Gruppe“ (Nübling 1998b: 63).<br />
Überdies wird die Inszenierung insgesamt entgegen dem ersten Eindruck<br />
des ‚Einst<strong>im</strong>migen‘ <strong>und</strong> Monothematischen von Gegensätzlichkeit(en)<br />
best<strong>im</strong>mt. So prägt z.B. ein Dualismus zwischen Fragmentarität<br />
<strong>und</strong> Geschlossenheit die Inszenierung. Das Baukasten-Prinzip <strong>und</strong> die<br />
Serialität der Makrostruktur stehen einer Reihe von Formelementen gegenüber,<br />
die neben semantischer Geschlossenheit durch die alles umklammernde<br />
Sport-Metapher für musikalische Geschlossenheit sorgen. Dies<br />
sind vor allem wiederkehrende optische <strong>und</strong> akustische Signale, die teilweise<br />
wie musikalische Motive auftreten. So kehren best<strong>im</strong>mte Lichteinstellungen,<br />
wie das streifige Licht auf der Hauptbühne, best<strong>im</strong>mte Kostümelemente<br />
<strong>und</strong> Klänge wieder. Die Trillerpfeife (benutzt von Schleef, Rath,<br />
Zeller, Brambach, Morak), dient sowohl als pr<strong>im</strong>är segmentierendes Zei-<br />
192