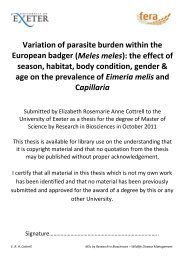Rhythmus und Instrumentation im Theater Einar Schleefs233
Rhythmus und Instrumentation im Theater Einar Schleefs233
Rhythmus und Instrumentation im Theater Einar Schleefs233
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
laut bis sehr laut, wenige leise Stellen bilden die Ausnahme, Lautstärkewechsel<br />
sind fast <strong>im</strong>mer abrupt. Die Instrumentierung ist geprägt von vielen<br />
schnellen Wechseln zwischen unterschiedlichen Gruppen einerseits <strong>und</strong><br />
der Verwendung extremer Klangfarben innerhalb der Gruppierungen andererseits.<br />
So lassen sich folgende ‚St<strong>im</strong>men‘ unterscheiden: ‚Tutti‘, ‚alle<br />
Männer‘, ‚alle Frauen‘, ‚Männer singend‘, ‚Frauen piepsig‘, ‚kleine Männergruppen‘<br />
(eine <strong>im</strong> Bühnenvordergr<strong>und</strong>, eine <strong>im</strong> Bühnenhintergr<strong>und</strong>),<br />
‚ein Mann solo‘, ‚zwei Männer‘, ‚wenige Frauen‘; viele davon allein in der<br />
Sieben/Acht-Passage. Die Vielzahl von Instrumentierungswechseln scheint<br />
mir pr<strong>im</strong>är klangliche Gründe zu haben <strong>und</strong> nicht auf der Zuordnung best<strong>im</strong>mter<br />
Texte zu einem Geschlecht zu beruhen. Ich vermute das, weil<br />
Schleef <strong>im</strong> Wiederholungsteil des Sieben/Acht-Chores Männer- <strong>und</strong> Frauengruppen<br />
dem Text genau umgekehrt zuordnet. Dadurch erscheint der<br />
Text zwar auch semantisch in einem anderen Licht, vor allem aber ‚klingt‘<br />
er anders, <strong>und</strong> die Vertauschung überrascht musikalisch <strong>und</strong> ermöglicht ein<br />
erneutes, frisches Zuhören.<br />
Im Gegensatz zur klanglich verhältnismäßig differenzierten Ausgestaltung<br />
ist der Chor melodisch nichtssagend. Die Sprachmelodie ist, besonders<br />
<strong>im</strong> Gegensatz zu manchen Monologen der Inszenierung, aber auch zu<br />
den freieren Chorpassagen <strong>im</strong> ersten Teil monoton <strong>und</strong> bewegungsarm. 254<br />
Nur zur Akzentuierung der Zählzeiten heben sich die St<strong>im</strong>men individuell<br />
an. Einzige Ausnahme bildet eine kurze Passage der Männer, in der sie auf<br />
Töne sprechen <strong>und</strong> dabei den typischen Gestus militärischen Sprechgesangs<br />
zitieren. Während es also anhand der Rednersequenz in Marthalers<br />
St<strong>und</strong>e Null musikalisch ergiebig erschien, der ausgefeilten Sprachmelodik<br />
Bedeutung beizumessen, treten für Schleefs Sprechchor andere Parameter<br />
in den Vordergr<strong>und</strong>. Das unterstreicht noch einmal die Notwendigkeit<br />
einer individuellen Gewichtung der musikalischen Analyse, die sich den<br />
Anforderungen des gegebenen Beispiels stellt. Ein allgemeingültiges Modell<br />
musikalischer Analyse kann daher nicht Ziel der vorliegenden Arbeit<br />
sein.<br />
Der Anfang<br />
Die Konsequenz, mit der Schleef oft sämtliche theatrale Vorgänge dem<br />
Sprechen unterordnet, zeigt, wie zentral Sprache für seine Sportstück-<br />
Inszenierung ist. Gleichzeitig möchte ich – in vielleicht nur scheinbarem<br />
Widerspruch dazu – auf der Bedeutung des Musikalischen für seine Inszenierung<br />
bestehen. Es liegt also nahe, eine detaillierte Untersuchung mit<br />
besonderer Aufmerksamkeit auf das Verhältnis von Text <strong>und</strong> Musik vor-<br />
254 In der Notation ist das versinnbildlicht durch die Schreibweise der Sprechrhythmen auf<br />
jeweils einem Ton (Männer <strong>und</strong> Frauen <strong>im</strong> Oktavabstand).<br />
196