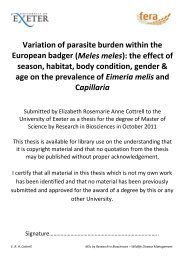Rhythmus und Instrumentation im Theater Einar Schleefs233
Rhythmus und Instrumentation im Theater Einar Schleefs233
Rhythmus und Instrumentation im Theater Einar Schleefs233
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
zwingt <strong>und</strong> zum Wahrnehmen des Körpers <strong>im</strong> musikalisierten Sprechen<br />
der Darsteller.<br />
Schleefs Präsenz in beiden hier untersuchten Inszenierungen öffnet<br />
meine Überlegungen zur Sprachbehandlung noch einmal für die Frage<br />
nach dem Verhältnis von Text <strong>und</strong> Musikalisierung. Dieses Verhältnis ist<br />
unter zwei Aspekten zu hinterfragen: Der erste berührt die formelhafte<br />
Forderung Monteverdis, die musikgeschichtlich zur Geburtsst<strong>und</strong>e der<br />
Oper führte, „pr<strong>im</strong>a le parole, poi la musica“ 287 . Auch bei Schleef muss die<br />
Vorherrschaft des Textes oder der Musik geklärt werden. Der zweite Aspekt<br />
formuliert sich in Ergänzung als die auch in vielen Kritiken latent<br />
mitschwingende Vermutung, ob Schleef nicht pr<strong>im</strong>är sein eigenes Sprechen,<br />
seine der Sprachbehinderung abgetrotzte Diktion, durch Vervielfachung,<br />
Vergrößerung <strong>und</strong> Stilisierung dem Chor aufoktroyiere.<br />
Weiter oben habe ich bereits darauf hingewiesen, dass Schleef sich<br />
selbst eindeutig positioniert, was seine Arbeit am Text betrifft. Sein Anspruch,<br />
„die jeweilige Sprachmelodie des Autors aufzuspüren <strong>und</strong> diese<br />
dann bei den unterschiedlichen Sprechern herauszuarbeiten“ (Schleef<br />
1998/1997: 92) bekräftigt er auch <strong>im</strong> Gespräch nachdrücklich. 288 Also:<br />
pr<strong>im</strong>a le parole? Anhand der Sportstück-Inszenierung ist man sich andererseits,<br />
wie ich am Beispiel des Sieben/Acht-Chores zu zeigen versucht habe,<br />
schnell gewahr, dass es Schleef kaum nur um die vermeintlich innewohnende<br />
Musikalität des Textes, die Sprachmelodie Jelineks zu tun gewesen<br />
sein kann. Während bei Schleefs monologischer Nietzsche-Lesart der Text<br />
weitgehend unangetastet blieb <strong>und</strong> durchaus Bezüge zwischen seiner musikalischen<br />
Interpretation <strong>und</strong> den entsprechenden Angeboten des Textes<br />
herzustellen waren, hatte es <strong>im</strong> Sieben/Acht-Chor vielmehr den Anschein,<br />
als ob nicht die Materialität der Sprache zu einer best<strong>im</strong>mten musikalischen<br />
Gestaltung herausfordere, sondern eine musikalische Form (oder ein<br />
musikalisches Klischee) der Sprache übergestülpt werde. Starke Eingriffe<br />
in die Textgestalt machten ihn vereinbar mit dem trotz aller musikalischer<br />
Differenzierung vorherrschenden Duktus von fußballerischen oder militärischen<br />
Sprechchören, der die lange Chorpartie deutlich dominiert. Doris<br />
287 Etwa: Zuerst die Worte, dann die Musik. Mit dieser ‚seconda prattica‘ lehnten sich<br />
Monteverdi <strong>und</strong> die Florentiner Camerata gegen die verbreitete Vorherrschaft der Musik<br />
auf. Die schon in Monteverdis Madrigalbüchern angelegte Betonung der ‚oratione‘<br />
mündete in der Narratisierung vokalmusikalischer Formen hin zur Oper, zuerst voll ausgeprägt<br />
in seinem Orfeo (1607).<br />
288 Darauf angesprochen, warum er vielfach sinnfremd betonen ließe antwortete Schleef:<br />
„Das können nur Leute behaupten, die sind völlig bekloppt.“ Gerade die Interpunktion<br />
von Texten lese er „wie eine musikalische Notation“. Die Autoren schrieben eindeutig<br />
vor, wie zu betonen sei, <strong>und</strong> „dass sich <strong>im</strong> <strong>Theater</strong> dann so eine Betonung rausgestellt<br />
hat auf die Verben oder später auf die Substantive – ja das ist quasi der Sprachtrott <strong>im</strong><br />
<strong>Theater</strong>“ (Schleef, <strong>Einar</strong> 1999: Ein Gespräch mit Birgit Hüning <strong>und</strong> David Roesner, am<br />
17. November 1999 in Hannover, unveröffentlicht).<br />
220