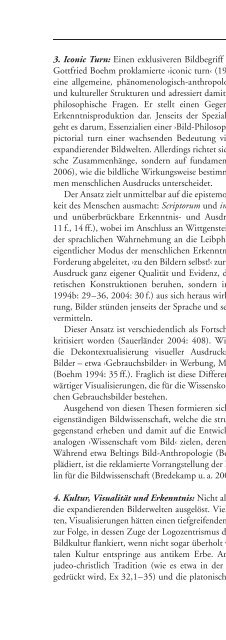Handbuch Wissenssoziologie und Wissensforschung
Handbuch Wissenssoziologie und Wissensforschung
Handbuch Wissenssoziologie und Wissensforschung
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Bernt Schnettler <strong>und</strong> Frederik S. Pötzsch<br />
3. Iconic Turn: Einen exklusiveren Bildbegriff vertritt der von dem deutschen Kunsthistoriker<br />
Gottfried Boehm proklamierte ›iconic turn‹ (1994b: 13). Der iconic turn fokussiert primär auf<br />
eine allgemeine, phänomenologisch-anthropologische Bestimmung des Bilds jenseits sozialer<br />
<strong>und</strong> kultureller Strukturen <strong>und</strong> adressiert damit in erster Linie erkenntnistheoretische <strong>und</strong> bildphilosophische<br />
Fragen. Er stellt einen Gegenentwurf zur Hegemonie der Sprache in der<br />
Erkenntnisproduktion dar. Jenseits der Spezialprobleme kunstwissenschaftlicher Bildanalysen<br />
geht es darum, Essenzialien einer ›Bild-Philosophie‹ zu klären. Der Ansatz teilt die Diagnose des<br />
pictorial turn einer wachsenden Bedeutung visueller Formen für die Gegenwartskultur <strong>und</strong><br />
expandierender Bildwelten. Allerdings richtet sich sein vornehmliches Interesse nicht auf historische<br />
Zusammenhänge, sondern auf f<strong>und</strong>amentale Fragen wie der, was ein Bild ist (Boehm<br />
2006), wie die bildliche Wirkungsweise bestimmt werden kann <strong>und</strong> was diese von anderen Formen<br />
menschlichen Ausdrucks unterscheidet.<br />
Der Ansatz zielt unmittelbar auf die epistemologische Frage danach, was die Erkenntnisfähigkeit<br />
des Menschen ausmacht: Scriptorum <strong>und</strong> imago werden dabei als voneinander unabhängige<br />
<strong>und</strong> unüberbrückbare Erkenntnis- <strong>und</strong> Ausdrucksmöglichkeiten angesehen (Boehm 1994b.<br />
11 f., 14 ff.), wobei im Anschluss an Wittgensteins These einer Vorgängigkeit der bildlichen vor<br />
der sprachlichen Wahrnehmung an die Leibphänomenologie Merleau-Pontys der bildliche als<br />
eigentlicher Modus der menschlichen Erkenntnis angesetzt wird. Daraus wird die emphatische<br />
Forderung abgeleitet, ›zu den Bildern selbst!‹ zurückzukehren (vgl. Schulz 2005: 64). Bilder seien<br />
Ausdruck ganz eigener Qualität <strong>und</strong> Evidenz, die nicht auf sprachlicher Erkenntnis oder theoretischen<br />
Konstruktionen beruhen, sondern im Sinne einer ›ikonischen Differenz‹ (Boehm<br />
1994b: 29–36, 2004: 30 f.) aus sich heraus wirksam seien. Verb<strong>und</strong>en wird dies mit der Folgerung,<br />
Bilder stünden jenseits der Sprache <strong>und</strong> seien – quasi ahistorisch – in der Lage, Wissen zu<br />
vermitteln.<br />
Dieser Ansatz ist verschiedentlich als Fortschreibung der Auratisierungsidee des Kunstwerks<br />
kritisiert worden (Sauerländer 2004: 408). Wissenssoziologisch problematischer ist allerdings<br />
die Dekontextualisierung visueller Ausdrucksformen sowie die Ausgrenzung ›schwacher‹<br />
Bilder – etwa ›Gebrauchsbilder‹ in Werbung, Medien oder Wissenschaft – von ›starken Bildern‹<br />
(Boehm 1994: 35 ff.). Fraglich ist diese Differenzierung vor allem, weil gerade das Gros gegenwärtiger<br />
Visualisierungen, die für die Wissenskonstitution <strong>und</strong> -verbreitung zentral sind, aus solchen<br />
Gebrauchsbilder bestehen.<br />
Ausgehend von diesen Thesen formieren sich in den Geisteswissenschaften Ansätze zu einer<br />
eigenständigen Bildwissenschaft, welche die strukturierende Wirkung von Bildern zum Hauptgegenstand<br />
erheben <strong>und</strong> damit auf die Entwicklung einer der allgemeinen Sprachwissenschaft<br />
analogen ›Wissenschaft vom Bild‹ zielen, deren Etablierung aber noch nicht abgeschlossen ist.<br />
Während etwa Beltings Bild-Anthropologie (Belting 2001) für einen interdisziplinären Ansatz<br />
plädiert, ist die reklamierte Vorrangstellung der Kunstgeschichte als paradigmatischer Leitdisziplin<br />
für die Bildwissenschaft (Bredekamp u. a. 2003) heftig umstritten.<br />
4. Kultur, Visualität <strong>und</strong> Erkenntnis: Nicht allein ein nachhaltiger Kulturwandel werde durch<br />
die expandierenden Bilderwelten ausgelöst. Vielfach wird die weitergehende Auffassung vertreten,<br />
Visualisierungen hätten einen tiefgreifenden Wandel in der Form der Erkenntnisproduktion<br />
zur Folge, in dessen Zuge der Logozentrismus der okzidentalen Schriftkulturen längst von einer<br />
Bildkultur flankiert, wenn nicht sogar überholt worden sei. Dieser Logozentrismus der okzidentalen<br />
Kultur entspringe aus antikem Erbe. Angeführt werden das religiöse Bilderverbot der<br />
judeo-christlich Tradition (wie es etwa in der Parabel vom Tanz um das Goldene Kalb ausgedrückt<br />
wird, Ex 32,1–35) <strong>und</strong> die platonischen Kritik an den sinnestäuschenden Bildern im<br />
475