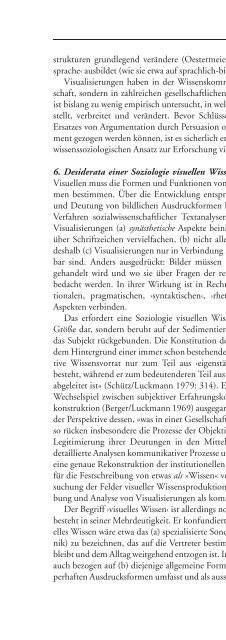Handbuch Wissenssoziologie und Wissensforschung
Handbuch Wissenssoziologie und Wissensforschung
Handbuch Wissenssoziologie und Wissensforschung
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Bernt Schnettler <strong>und</strong> Frederik S. Pötzsch<br />
strukturen gr<strong>und</strong>legend verändere (Oestermeier/Hesse 2000), die mitunter eine eigene ›Bildsprache‹<br />
ausbildet (wie sie etwa auf sprachlich-bildlichen ›Homepages‹ auftritt (Fackler 2001)).<br />
Visualisierungen haben in der Wissenskommunikation zweifellos nicht nur in der Wissenschaft,<br />
sondern in zahlreichen gesellschaftlichen Feldern eine wachsende Bedeutung. Allerdings<br />
ist bislang zu wenig empirisch untersucht, in welcher Form visuelle Kommunikation Wissen herstellt,<br />
verbreitet <strong>und</strong> verändert. Bevor Schlüsse über die Veränderung der Denkformen, des<br />
Ersatzes von Argumentation durch Persuasion oder seriöser Wissensvermittlung durch Edutainment<br />
gezogen werden können, ist es sicherlich erforderlich, die weitere Entfaltung eines dezidiert<br />
wissenssoziologischen Ansatz zur Erforschung visuellen Wissens voranzutreiben.<br />
6. Desiderata einer Soziologie visuellen Wissens: Eine wissenssoziologische Erforschung des<br />
Visuellen muss die Formen <strong>und</strong> Funktionen von visuellen Ausdrucks- <strong>und</strong> Kommunikationsformen<br />
bestimmen. Über die Entwicklung entsprechender Verfahren der Analyse, Interpretation<br />
<strong>und</strong> Deutung von bildlichen Ausdruckformen hinaus, die sich nur bedingt auf den etablierten<br />
Verfahren sozialwissenschaftlicher Textanalysen stützen können, ist dabei zu beachten, dass<br />
Visualisierungen (a) synästhetische Aspekte beinhalten, welche ihr Ausdeutungspotential gegenüber<br />
Schriftzeichen vervielfachen, (b) nicht alle Visualisierungen Zeichencharakter haben <strong>und</strong><br />
deshalb (c) Visualisierungen nur in Verbindung mit dem Kontext, in dem sie stehen, interpretierbar<br />
sind. Anders ausgedrückt: Bilder müssen dort analysiert werden, wo an <strong>und</strong> mit ihnen<br />
gehandelt wird <strong>und</strong> wo sie über Fragen der reinen Ästhetik hinaus mit Sinn <strong>und</strong> Bedeutung<br />
bedacht werden. In ihrer Wirkung ist in Rechnung zu stellen, dass sich ästhetische mit funktionalen,<br />
pragmatischen, ›syntaktischen‹, ›rhetorischen‹ <strong>und</strong> wahrnehmungspsychologischen<br />
Aspekten verbinden.<br />
Das erfordert eine Soziologie visuellen Wissens. Wissen stellt nicht eine material fassbare<br />
Größe dar, sondern beruht auf der Sedimentierung von Erfahrung <strong>und</strong> ist damit prinzipiell an<br />
das Subjekt rückgeb<strong>und</strong>en. Die Konstitution des subjektiven Wissensvorrates vollzieht sich vor<br />
dem Hintergr<strong>und</strong> einer immer schon bestehenden soziokulturellen Ordnung, so dass »der subjektive<br />
Wissensvorrat nur zum Teil aus ›eigenständigen‹ Erfahrungs- <strong>und</strong> Auslegungsresultaten<br />
besteht, während er zum bedeutenderen Teil aus Elementen des gesellschaftlichen Wissensvorrats<br />
abgeleitet ist« (Schütz/Luckmann 1979: 314). Es muss dementsprechend von einem komplexen<br />
Wechselspiel zwischen subjektiver Erfahrungskonstitution <strong>und</strong> gesellschaftlicher Wirklichkeitskonstruktion<br />
(Berger/Luckmann 1969) ausgegangen werden. Betrachtet man »Wissen« also unter<br />
der Perspektive dessen, »was in einer Gesellschaft als ›Wissen‹ gilt« (Berger/Luckmann 1969: 16),<br />
so rücken insbesondere die Prozesse der Objektivierung subjektiver Sinnentäußerungen <strong>und</strong> der<br />
Legitimierung ihrer Deutungen in den Mittelpunkt. Ersteres muss notwendigerweise durch<br />
detaillierte Analysen kommunikativer Prozesse <strong>und</strong> Symbolisierungen erfolgen, letzteres erfordert<br />
eine genaue Rekonstruktion der institutionellen Verfestigungen <strong>und</strong> der sozialen Strukturen, die<br />
für die Festschreibung von etwas als »Wissen« verantwortlich sind. Neben einer genauen Untersuchung<br />
der Felder visueller Wissensproduktion <strong>und</strong> -verteilung ist deshalb die exakte Beschreibung<br />
<strong>und</strong> Analyse von Visualisierungen als kommunikativen Formen notwendig.<br />
Der Begriff ›visuelles Wissen‹ ist allerdings noch unzureichend bestimmt. Das Hauptproblem<br />
besteht in seiner Mehrdeutigkeit. Er konf<strong>und</strong>iert verschiedene Phänomene miteinander. Als visuelles<br />
Wissen wäre etwa das (a) spezialisierte Sonderwissen über Visuelles (z. B. Ästhetik oder Ikonik)<br />
zu bezeichnen, das auf die Vertreter bestimmter Sonderwissenswissensbestände beschränkt<br />
bleibt <strong>und</strong> dem Alltag weitgehend entzogen ist. In einem sehr viel breiteren Sinne ist der Ausdruck<br />
auch bezogen auf (b) diejenige allgemeine Form von Wissen, welche die nichtsprachlichen, körperhaften<br />
Ausdrucksformen umfasst <strong>und</strong> als ausschließlich visuell vermitteltes Wissen auftritt (wie<br />
479