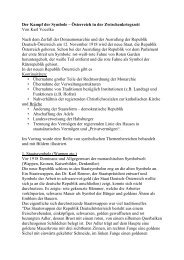pálffy géza: gemeinsam gegen die osmanen ausbau und funktionen ...
pálffy géza: gemeinsam gegen die osmanen ausbau und funktionen ...
pálffy géza: gemeinsam gegen die osmanen ausbau und funktionen ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
PÁLFFY GÉZA: GEMEINSAM GEGEN DIE OSMANEN<br />
AUSBAU UND FUNKTIONEN DER GRENZFESTUNGEN IN<br />
UNGARN IM 16. UND 17. JAHRHUNDERT<br />
1Katalog<br />
der Ausstellung im Österreichischen Staatsarchiv<br />
14. März – 31. Mai 2001<br />
Veranstaltet von dem Österreichischen Staatsarchiv <strong>und</strong><br />
dem Collegium Hungaricum<br />
Auswahl <strong>und</strong> Anordnung der Dokumente:<br />
Peter Broucek<br />
István Fazekas<br />
József Kelenik<br />
Géza Pálffy<br />
Robert Rill<br />
Elisabeth Springer<br />
Ausstellungsgestalter<br />
András Nagy<br />
Wissenschaftliche Assistentinnen<br />
Andrea Kreuzer<br />
Emese Szoleczky<br />
Text:<br />
Géza Pálffy<br />
Budapest – Wien, 2001<br />
Leihgeber<br />
Heeresgeschichtliches Museum, Wien [HGM]<br />
Hadtörténeti Múzeum [Heeresgeschichtliches Museum], Budapest [HTM] Österreichische Akademie der<br />
Wissenschaften, Wien [ÖAW], Forschungsstelle für<br />
Geschichte des Mittelalters, Arbeitsgruppe Inschriften<br />
Magyar Országos Levéltár [Ungarisches Staatsarchiv], Budapest [MOL]<br />
Niederösterreichisches Landesarchiv, Sankt Polten [NÖLA]<br />
Titelbild: Kat. IV-13a<br />
Inhalt<br />
Zum Geleit 4<br />
Ad spectatorem! 4<br />
Einleitung: siehe den Aufsatz von Géza Pálffy im Katalog der Ausstellung KAISER UND KÖNIG:<br />
EINE HISTORISCHE REISE. ÖSTERREICH UND UNGARN 1526-1918 (9. März- 1. Mai 2001,<br />
Osterreichische Nationalbibliothek, Prunksaal) mit Titel Die Entstehung <strong>und</strong> Entwicklung der<br />
Türkenabwehr in Ungarn 1526-1699, Seite 37-46.<br />
Katalog 5<br />
I. Defensionskonzeption <strong>und</strong> Organisation 5<br />
II. Verwaltung <strong>und</strong> Finanzierung 9<br />
III. Armeekommandanten <strong>und</strong> Grenzobersten 14<br />
IV. Versorgung <strong>und</strong> Festungsbau 17<br />
V. Bilder aus dem Leben an der Grenze 24<br />
a. Im „Langen Türkenkrieg” (1593-1606) 24<br />
b. Kriegsartikel <strong>und</strong> Kriegsreglement 24<br />
c. Militärgerichtsbarkeit 26<br />
d. Festungsaufgabe 27<br />
e. Spionage <strong>und</strong> Nachrichten<strong>die</strong>nst 27
f. Gefangenenhandel <strong>und</strong> Gefangenenhaltung 28<br />
g. Remuneration des Kriegs<strong>die</strong>nstes 30<br />
h. Kleinkrieg in den „Friedensjahren” 31<br />
i. Kreudfeuer- <strong>und</strong> Kreudschußsystem 31<br />
j. Religionsfreiheit in den Festungen 32<br />
VI. Ungarische Soldaten in den kaiserlichen Armeen 33<br />
VII. Waffen 34<br />
VIII. Quellen <strong>und</strong> Literatur 35<br />
a. Archivalische Quellen 35<br />
b. Gedruckte Quellen 36<br />
c. Literatur 36<br />
Einleitung: siehe den Aufsatz von Géza Pálffy im Katalog der Ausstellung Kaiser <strong>und</strong> König: Eine<br />
historische Reise. Österreich <strong>und</strong> Ungarn 1526-1918 (9. März – 1. Mai 2001, Österreichische<br />
Nationalbibliothek, Prunksaal) mit Titel Die Entstehung <strong>und</strong> Entwicklung der Türkenabwehr in Ungarn<br />
1526-1699, Seite 37-46.
4Zum Geleit<br />
Vor nunmehr 83 Jahren kam eine Beziehung zu Ende, <strong>die</strong> beinahe vierh<strong>und</strong>ert Jahre angedauert hatte:<br />
Österreich <strong>und</strong> Ungarn waren in einer Schicksalsgemeinschaft verb<strong>und</strong>en, <strong>die</strong> entscheidend für <strong>die</strong><br />
Entwicklung nicht nur der Osteuropas war.<br />
Es ist daher notwendig <strong>die</strong>se Verbindung in Ausstellungen nachzuzeichnen, gibt es doch immer neue<br />
Generationen, denen viele Themen in der beiderseitigen Geschichte unbekannt sind, <strong>die</strong> von einer<br />
<strong>gemeinsam</strong>en Vergangenheit so gut wie nicht wissen.<br />
Der Bogen der Betrachtung muß sich dabei von den „<strong>gemeinsam</strong>en“ Herrscherpersönlichkeiten, über <strong>die</strong><br />
Verwaltungsorganisation auf ziviler <strong>und</strong> militärischer Ebene, zur Wirtschaft, Kultur <strong>und</strong> Wissenschaft<br />
spannen. Die auf uns überkommenen <strong>und</strong> erhaltenen Erinnerungen sind vielfältig <strong>und</strong> werden durch <strong>die</strong>se<br />
Ausstellungen sicherlich vielen Interessierten präsent gemacht.<br />
Das Österreichische Staatsarchiv in dem seit 1923 ständig drei Archivdelegierte aus Budapest tätig sind <strong>und</strong><br />
das damit österreichischerseits gleichsam der letzte Ort <strong>die</strong>ser seinerzeitigen engen Verbindung genannt<br />
werden kann, begrüßt <strong>die</strong> Idee <strong>die</strong>ses Aufzeigens der „verschiedensten Aspekte einer vielseitigen Beziehung“<br />
<strong>und</strong> trägt auch durch zahlreiche Leihgaben zur weiteren Vertiefung des Zusammenlebens in einem zu<br />
erweiternden Europa bei.<br />
Hon.-Prof. Dr. Lorenz Mikoletzky<br />
Generaldirektor des Österreichischen Staatsarchivs<br />
Ad spectatorem<br />
Österreich <strong>und</strong> Ungarn bzw. das Habsburgerreich <strong>und</strong> das Königreich Ungarn bildeten von 1526 bis 1918 –<br />
dank ihrer <strong>gemeinsam</strong>en Herrscher – eine Personalunion. Eine für <strong>die</strong> Entwicklung beider Länder<br />
entscheidende Periode <strong>die</strong>ses langen Zusammenlebens bildeten <strong>die</strong> fast zwei Jahrh<strong>und</strong>erte von der Schlacht<br />
bei Mohács (29. August 1526) bis zum Frieden von Karlowitz (26. Januar 1699). Das Königreich Ungarn<br />
galt in <strong>die</strong>ser Zeit für <strong>die</strong> österreichischen Erbländer durch das Grenzverteidigungssystem auf seinem<br />
Territorium als Schutzschild <strong>gegen</strong> <strong>die</strong> osmanische Expansion. Mitteleuropa war also im Interesse seiner<br />
eigenen Sicherheit gr<strong>und</strong>sätzlich auf Ungarn angewiesen. Das Königreich Ungarn konnte jedoch <strong>die</strong> Rolle<br />
der „Schutzbastei des Christentums“ (lat. propugnaculum Christianitatis) nur anhand der mit jährlicher<br />
Regelmäßigkeit bereitgestellten finanziellen <strong>und</strong> militärischen Unterstützung aus den österreichischen<br />
Erbländern erfüllen <strong>und</strong> seinen eigenen Fortbestand gewährleisten. Österreich <strong>und</strong> Ungarn kämpften deshalb<br />
im 16. <strong>und</strong> 17. Jahrh<strong>und</strong>ert aufeinander angewiesen <strong>gegen</strong> <strong>die</strong> Osmanen.<br />
Als Ergebnis <strong>die</strong>ses <strong>gegen</strong>seitigen Aufeinanderangewiesenseins entstand bis zur zweiten Hälfte des 16.<br />
Jahrh<strong>und</strong>erts in Ungarn ein Verteidigungssystem, das aus etwa 120 Grenzfestungen bestand <strong>und</strong> sich 150<br />
Jahre lang <strong>gegen</strong> <strong>die</strong> Eroberer wehren konnten. Die Ausstellung im Österreichischen Staatsarchiv präsentiert<br />
auf österreichischem Territorium das erste Mal <strong>die</strong> Herausbildung der Verteidigungskonzeption <strong>gegen</strong> <strong>die</strong><br />
Osmanen <strong>und</strong> den Prozeß des Ausbaus des Grenzschutzes bzw. <strong>die</strong> Organisation des Festungsnetzes.<br />
Zahlreiche bisher völlig unbekannte Dokumente, Festungsgr<strong>und</strong>risse <strong>und</strong> Karten – als Ergebnisse jüngster<br />
Forschungen in Wien <strong>und</strong> Budapest – veranschaulichen <strong>die</strong> militärpolitischen, finanziellen <strong>und</strong><br />
administrativen Schwierigkeiten bzw. Ergebnisse der Funktion <strong>und</strong> der Versorgung des<br />
Grenzfestungssystems. Die von ungarischen Historikern <strong>und</strong> Archivaren zusammengestellte Ausstellung<br />
zeigt darüber hinaus das Alltagsleben der Soldaten der Grenzfestungen in Momentaufnahmen <strong>und</strong> anhand<br />
von schriftlichen Quellen <strong>und</strong> bildlichen Darstellungen.<br />
Dr. Géza Pálffy<br />
wissenschaftlicher Mitarbeiter des Instituts für Geschichte<br />
der Ungarischen Akademie der Wissenschaften
Katalog<br />
5I. Defensionskonzeption <strong>und</strong> Organisation<br />
I-1<br />
Landkarte Ungarn von Oberingenieur Martin Stier mit Darstellung der<br />
Grenzoberhauptmannschaften <strong>gegen</strong> <strong>die</strong> Osmanen, 1684, Nürnberg<br />
OriginalDruck von Martin Endter, 101 x 153 cm, 12 Bl., deut.<br />
Wien, KA Kartensammlung B IX a 487-1.<br />
Die Organisation des ungarischen Grenzverteidigungssystems, in erster Linie das System der<br />
Grenzoberhauptmannschaften oder Grenzgeneralate (supremus capitaneatus confiniorum), stellten im 16.<br />
<strong>und</strong> 17. Jahrh<strong>und</strong>ert am anschaulichsten <strong>die</strong> Landkarten des deutschen Ingenieurs Martin Stier (1620-16.<br />
Febr. 1669) dar. Stier erstellte im Jahre 1661 für Kaiser Leopold I. <strong>und</strong> den Wiener Hofkriegsrat auf der<br />
Gr<strong>und</strong>lage mehrerer Grenzvisitationen <strong>und</strong> nach langen Vorarbeiten eine aus 12 Blättern bestehende<br />
Landkarte Ungarns, deren Originalexemplar in der Handschriftensammlung der Österreichischen<br />
Nationalbibliothek aufbewahrt wird (Sign.: Cod. 8332). Auf Gr<strong>und</strong> <strong>die</strong>ser wurde sie das erste Mal 1664 von<br />
Mauritius Lang in Wien zur Hilfe bei der Orientierung im Türkenkrieg geDruckt – wie <strong>die</strong>s Stier selbst<br />
bereits vom Kaiser in seinem Ersuchen erbeten hatte: „solche Karte bey erfolgendem Türkhenkrieg dem<br />
gemeinen Wesßen in etwaß zu nuczen khomen möchte“. Ein Beweis für <strong>die</strong> Brauchbarkeit der Landkarte war,<br />
daß sie zur Zeit des nächsten großen Türkenkrieges (1683-1699) zunächst 1684, dann wiederholt 1687 von<br />
Martin Endtner in Nürnberg herausgegeben wurde. Die Landkarte des früheren Quartiermeisterleutnants<br />
(1650), dann Hauptmanns <strong>und</strong> schließlich Oberingenieurs Stier gilt zugleich als eine der genausten<br />
Darstellungen Ungarns im 17. Jahrh<strong>und</strong>ert.<br />
Literatur: Zur Tätigkeit <strong>und</strong> den Karten Stiers Nischer, 1924, S. 24-25; Descriptio Austriae, S. 125; Österreich <strong>und</strong> <strong>die</strong><br />
Osmanen, S. 96; Krompotic, 1997, S. 304-337 <strong>und</strong> neuerdings Pálffy, 2000/1, S. 60-76.<br />
I-2<br />
Entwurf von Sforza Pallavicini Oberstfeldmarschall in Ungarn über <strong>die</strong> besetzenden ungarischen<br />
Grenzfestungen von der Theiß bis zur Drau, 6. Februar 1553, Raab<br />
Original, Papier, 31 x 22 cm, lat.<br />
Wien, HHStA Hungarica AA Fasc. 69, Konv. B, fol. 18-25, Beilage zum Brief von Pallavicini an König Ferdinand I.<br />
Druck: Pálffy, 1999/2, S. 83 (in Tabellenform).<br />
Die Osmanen besetzten im Jahre 1552 in Ungarn große Gebiete sowohl in der Nachbarschaft Siebenbürgens<br />
(Banat), als auch in Transdanubien (<strong>die</strong> Festung Veszprém <strong>und</strong> Palota) <strong>und</strong> nördlich von Ofen, heute Buda<br />
(<strong>die</strong> Grenzburgen im Komitat Nógrád). Die Beschleunigung des Ausbaus der Grenzverteidigung im<br />
Vorgelände Wiens war daher auf jeden Fall von Nöten. Der zu <strong>die</strong>ser Zeit mit der Verteidigung <strong>die</strong>ses<br />
Grenzgebiets betraute Oberstfeldmarschall Sforza Pallavicini Markgraf zu Cortemaggiore erstellte deshalb<br />
im Februar des Jahres 1553 einen Entwurf für Ferdinand I., in dem festgelegt wurde, wie viele Reiter <strong>und</strong><br />
Fußknechte in den einzelnen Festungen des Grenzfestungsnetzes <strong>die</strong>nen sollten, das sich von der Burg Erlau<br />
(Eger) in Oberungarn langsam bis zur Drau erstreckte. Von den insgesamt 8560 Soldaten hielt er für <strong>die</strong>ses<br />
kleinere Grenzgebiet, unter dem Aspekt der Verteidigung Wiens für <strong>die</strong> bedeutenderen Festungen in<br />
Transdanubien (vor allem Raab, Pápa, Totis [Tata], Szigetvár usw.) 3760 Soldaten für notwendig. Die spätere<br />
Raaber Grenze (vgl. I-8) hatte ihre Gr<strong>und</strong>lage zum Teil in <strong>die</strong>sem Entwurf.<br />
Literatur: Takáts, 1908, S. 266-267, <strong>und</strong> zum Lebenslauf Pallavicinis Setton, 1984, passim; Köhbach, 1994, S. 214-215:<br />
Anm 78; Pálffy, 1999/2, S. 254-255 <strong>und</strong> Wien, KA Kriegswissenschaftlichen Memoires 28/1334/11 pp. 195-227.<br />
I-3<br />
Verzeichnis der Städte <strong>und</strong> Festungen in Ungarn für <strong>die</strong> Stände des Heiligen Römischen Reiches, <strong>die</strong><br />
zur Zeit eines neuen Feldzuges Sultan Süleymans I. <strong>gegen</strong> Wien mit der bestimmten Anzahl Soldaten<br />
besetzt werden sollen, Ende 1542, Wien<br />
Originalband, Papier, 33 x 24 cm, deut.<br />
Wien, HHStA MEA RTA Fasc. 8, Konv. 4, fol. 22-24 (Nürnberger Reichstag, 1543).<br />
Druck: Pálffy, 1999/2, S. 56-57 (in Tabellenform).<br />
Daß Ofen, <strong>die</strong> Hauptstadt des mittelalterlichen Königreichs Ungarn, in <strong>die</strong> Hände der Osmanen gelangt war<br />
(29. August 1541), erweckte sowohl in Wien als auch im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation große<br />
Besorgnis. Die Expansion der Osmanen stellte zu jener Zeit bereits auch für <strong>die</strong> österreichischen Erbländer
eine ernstzunehmende Gefahr dar. Ende September des Jahres 1542 machte sich daher unter der Leitung von<br />
Joachim Markgraf zu Brandenburg ein Heer von 55,000 Mann (mit Reichstruppen, österreichischen,<br />
italienischen <strong>und</strong> ungarischen Einheiten) zur Rückeroberung Ofens auf, sie konnten jedoch nicht einmal das<br />
am linken Ufer der Donau gelegene, viel weniger bedeutende Pest einnehmen. Da nach der peinlichen<br />
Niederlage noch weitere Nachrichten aus Konstantinopel darüber eintrafen, daß Sultan Süleyman der<br />
Prächtige im folgenden Jahr erneut persönlich gen Wien zu ziehen beabsichtige, begannen nach dem Feldzug<br />
in der österreichischen Hauptstadt Verhandlungen über <strong>die</strong> Verteidigungsmöglichkeiten. Zu <strong>die</strong>ser Zeit ist<br />
vermutlich der vorliegende Entwurf zur Information der Stände des Heiligen Römischen Reichs deutscher<br />
Nation entstanden, laut dem insgesamt 49,150 Mann zur effektiven Verteidigung der ungarischen Gebiete im<br />
Vorgelände Wiens in Transdanubien für notwendig waren. (Davon hielt man für Wien selbst 2000 Reiter <strong>und</strong><br />
8000 Fußknechte für ausreichend.) 6Obgleich Sultan Süleyman 1543 erneut persönlich nach Ungarn kam,<br />
gelangte er nicht bis vor Wien. Mit der Eroberung Grans (Esztergom), Stuhlweißenburgs (Székesfehérvár)<br />
<strong>und</strong> Fünfkirchens (Pécs) stärkte er jedoch sowohl <strong>die</strong> Verteidigung Ofens als auch <strong>die</strong> Lage der von ihm<br />
eingenommenen ungarischen Festungen.<br />
Literatur: Meyer, 1879, S. 480-538; Károlyi, 1880; Traut, 1892; Schulze, 1978 <strong>und</strong> neuerdings Liepold, 1998, S. 237-<br />
252.<br />
I-4<br />
Ratschlag von Lazarus Freiherr von Schwendi, wie man <strong>die</strong> Grenzverteidigung in Ungarn <strong>gegen</strong> <strong>die</strong><br />
Osmanen organisieren sollte, 1566<br />
Original, Papier, 33 x 22 cm, deut.<br />
Wien, KA AFA 1566/13/1.<br />
Druck: Frauenholz, 1939, S. 92-106: Nr. 5.<br />
Lazarus Freiherr von Schwendi (1522-1582), einer der bedeutendsten Kriegswissenschaftler des 16.<br />
Jahrh<strong>und</strong>erts, stand von 1565 bis 1568 im Sold Kaiser Maximilians II. (1564-1576) <strong>und</strong> leistete als<br />
Feldoberst in Oberungarn Dienst. In <strong>die</strong>sem Amt kam ihm bei der Rückeroberung der wichtigen Festung von<br />
Szatmár vom Fürst von Siebenbürgen, Johann Sigm<strong>und</strong> (1565), später bei der Gründung der Zipser Kammer<br />
(1567) <strong>und</strong> bei der Ausarbeitung des Artikelbriefes (Kriegsartikels) der ungarischen Soldaten (s. V-2) eine<br />
gr<strong>und</strong>legende Rolle zu. Darüber hinaus legte er in seinem vorliegenden Vorschlag, den er im Jahre 1566<br />
beim Hofkriegsrat eingereicht hatte <strong>und</strong> dem 1568 <strong>und</strong> 1569 weitere Entwürfe folgten, ausführlich seine<br />
Meinung zu nahezu allen Problemen des ungarischen Kriegswesens dar: Organisation der<br />
Grenzverteidigung, Versorgung der Festungen sowie Kriegsmethoden <strong>gegen</strong> <strong>die</strong> Osmanen. Ein bedeutender<br />
Teil seiner Vorschläge wurde ab Ende der 1560er Jahre stufenweise in <strong>die</strong> Praxis umgesetzt. Die von<br />
Schwendi formulierten Reformen trugen daher gr<strong>und</strong>legend zu der Ausarbeitung der Defensionskonzeption<br />
<strong>und</strong> zum Vollzug der Türkenabwehr in Ungarn bei.<br />
Literatur: Eiermann, 1904; König, 1934; Schnur, 1987, S. 27-46; Niklas, 1995 <strong>und</strong> besonders Janko, 1871.<br />
I-4a<br />
Verzeichnis der Grenzsoldaten in den Burgen <strong>gegen</strong> Siebenbürgen, 19. Januar 1563, Kaschau<br />
Original, Papier, 31 x 22 cm, deut.<br />
Wien, KA AFA 1563/1/ad 12, Beilage zum Brief der königlichen Kommissare, Mustermeister in Ungarn Andreas<br />
Kielman <strong>und</strong> Christoph Gannabiczer an Erzherzog Karl, 19. Januar 1563, Kaschau (ebenda 1563/1/12).<br />
Die Wiener Kriegsführung legte in der zweiten Hälfte der 1550er Jahre besonders großen Akzent darauf, daß<br />
<strong>die</strong> Truppen von Ferdinand I. von dem siebenbürgischen Fürsten Johann Sigm<strong>und</strong>, dem Sohn von König<br />
Johann Szapolyai (1526-1540), im nordöstlichen Teil Ungarns möglichst große Gebiete zurückerobern. Dies<br />
war in erster Linie aus jenem Gr<strong>und</strong> notwendig, da mit der Entstehung des Fürstentums Siebenbürgen der<br />
neue, obschon christliche Staat zum Feind des Habsburgerreiches geworden war, denn er war ein<br />
Vasallenstaat der Pforte. Dies bedeutete, daß <strong>die</strong> Fürsten von Siebenbürgen den Thron nur mit der<br />
Bestätigung des Sultans besteigen durften, daß ihnen <strong>die</strong>ser eine jährliche Steuerpflicht auferlegte <strong>und</strong> sie nur<br />
mit osmanischer Genehmigung eine eigenständige Außenpolitik führen konnten. Der Hofkriegsrat sah sich<br />
aus <strong>die</strong>sem Gr<strong>und</strong> ab den 1560er Jahren gezwungen, <strong>gegen</strong>über dem Fürstentum in Oberungarn eine<br />
gesonderte Grenzfestungszone zu entwickeln. Das vorliegende Verzeichnis, das von Januar 1563 datiert,<br />
listete – aufgr<strong>und</strong> des Berichtes des Mustermeisters Andreas Kielmann (vgl. II-5b) <strong>und</strong> seines Schreibers<br />
Christoph Gannabiczer (vgl. II-5) – <strong>die</strong> aktuellen bzw. <strong>die</strong> in Zukunft notwendigen Soldatenzahlen- <strong>und</strong><br />
Soldangaben <strong>die</strong>ser Burgen. Die sogenannte Grenzhauptmannschaft jenseits der Theiß, <strong>die</strong> Siebenbürgen<br />
<strong>gegen</strong>überstand, entwickelte sich letztendlich nach der 1565 erfolgten Rückeroberung der Festung Szatmár
von Johann Sigm<strong>und</strong> (vgl. noch dazu den Aufsatz von Géza Pálffy).<br />
Literatur: Pálffy, 1996.<br />
I-5<br />
Protokoll der Wiener Hauptgrenzberatschlagung, August-September, 1577<br />
Originalband vom Hand des Hofkriegsratsekretärs Bernhard Reisacher, Papier, 30,5 x 21,5 cm, deut.<br />
Wien, KA AFA 1577/13/2 fol. 1-369, andere zeitgenössische Abschriften: Budapest, MOL P 108 Esterházy cs. lt., Rep.<br />
77, Fasc. N; Wien, ÖNB Cod. 8678, ebenda Cod. 8345, ebenda Cod. 12 660; Nürnberg, Archiv GNM WF<br />
Österreich ZR 7670.<br />
Druck: Geõcze, 1894, fehlerhafte, abgekürzte ungarische Edition (eine Ausgabe von József Kelenik <strong>und</strong> Géza Pálffy in<br />
Vorbereitung).<br />
Zur Diskussion der schwachen Punkte des Grenzverteidigungssystems, <strong>die</strong> sich in den 70er Jahren des 16.<br />
Jahrh<strong>und</strong>erts bemerkbar gemacht hatten, berief der Hofkriegsrat im August des Jahres 1577 eine<br />
Hauptgrenzberatschlagung in Wien ein. Das im Original erhalten gebliebene Protokoll der Beratschlagung ist<br />
eine der wichtigsten, bis zum heutigen Tag noch nicht publizierten Quellen in der Geschichte der<br />
Türkenabwehr in Ungarn. Die Teilnehmer der Kriegskonferenz diskutierten <strong>die</strong> Möglichkeiten der<br />
Gestaltung der Defensionskonzeption mit großer Sorgfalt <strong>und</strong> beschlossen gr<strong>und</strong>legende Reformen <strong>und</strong><br />
Maßnahmen, <strong>die</strong> zur Modernisierung <strong>und</strong> wirkungsvolleren Nutzung des Grenzfestungssystems führten. Das<br />
Protokoll ist zugleich ein ausgezeichneter Beweis dessen, daß <strong>die</strong> sogenannte Militärische Revolution auch<br />
auf dem Gebiet des Königreichs Ungarn in bedeutendem Maße zum Tragen gekommen ist (vgl. Einleitung<br />
von Géza Pálffy).<br />
Literatur: Schulze, 1973, S. 65-69; Wessely, 1976, S. 38-49; Kruhek, 1995/2, S. 273-277; Kelenik, 1997, S. 30-37 <strong>und</strong><br />
Pálffy, 1999/2, S. 167-176.<br />
7I-6<br />
Kriegsdiskurs von Lazarus Freiherr von Schwendi, 1593, Frankfurt am Main<br />
Wien, Bibliothek des Österreichischen Staatsarchivs, Ac 221.<br />
NeuDruck: Frauenholz, 1939, S. 192-287: Nr. 9.<br />
Lazarus Freiherr von Schwendi war einer der bedeutendsten politischen <strong>und</strong> militärischen Denker im Europa<br />
des 16. Jahrh<strong>und</strong>erts. Zunächst stand er im Dienst Kaiser Karls V. zuerst 1546 als Kriegskommissar im<br />
schmalkaldischen Krieg <strong>und</strong> später in verschiedenen militärischen <strong>und</strong> diplomatischen Ämtern (1552: Oberst<br />
eines deutschen Regiments in den Niederlanden, 1556: Eroberung von St. Quentin, 1557: Schlacht bei<br />
Grävelingen). Ab 1564 stand er im Sold Maximilians II. <strong>und</strong> spielte in den folgenden Jahren (1565-1568)<br />
sowohl als Feldherr als auch als Militärreformer beim Ausbau des ungarischen Verteidigungssystems <strong>und</strong> der<br />
Organisation der Versorgung der Grenzfestungen (s. I-4 <strong>und</strong> I-5) eine gr<strong>und</strong>legende Rolle. Neben der<br />
Ausarbeitung des Artikelbriefes der deutschen Fußknechte <strong>und</strong> der Reuterbestallung auf dem Reichstag zu<br />
Speyer 1570 zählt er in erster Linie aufgr<strong>und</strong> seines berühmten Werkes mit dem Titel Kriegsdiskurs zu den<br />
Klassikern der Kriegswissenschaften. Schwendi faßte in <strong>die</strong>sem Werk – dessen Originalmanuskript (1578) er<br />
Erzherzog Matthias, dem Gubernator von Niederlanden widmete – <strong>die</strong> Erfahrungen seines mehr als<br />
dreißigjährigen Militär<strong>die</strong>nstes zusammen: er legte seine Gedanken nahezu zum gesamten Bereich des<br />
Kriegwesens ausführlich dar, vor allem zu den Themen Heeresorganisation, Aufgaben der verschiedenen<br />
Amtsträger, Feld-, Lager- <strong>und</strong> Schlachtordnung, Problemen der Lebensmittelversorgung, Kämpfe <strong>gegen</strong> <strong>die</strong><br />
Osmanen, Belagerungsmethoden der Festungen usw. Der ErstDruck seines Werkes erschien jedoch erst nach<br />
seinem Tode, im Jahre 1593 in Frankfurt am Main.<br />
Literatur: Jähns, 1889, Bd. I, S. 907-909; Janko, 1871; Eiermann, 1904; König, 1934; Schnur, 1987, S. 27-46 <strong>und</strong><br />
Niklas, 1995.<br />
I-6a<br />
Lazarus Freiherr von Schwendi (1522-1583)<br />
Papier, Kupferstich aus dem Kriegsdiskurs von Schwendi 1593 (I-6).<br />
I-7<br />
Handschriftliche Kartenskizze von Johann Choron über <strong>die</strong> Raaber Grenze, <strong>und</strong>atiert [1563]<br />
Original, Papier, 44,5 x 32,5 cm, lat.<br />
Wien, KA AFA 1564/2/ad 11 c.
Druck: Pálffy, 2000/1, Beilage I.<br />
Hinsichtlich der Verteidigung der Kaiserstadt Wien galt im 16. <strong>und</strong> 17. Jahrh<strong>und</strong>ert <strong>die</strong> Grenzfestungszone<br />
zwischen dem Plattensee (Balaton) <strong>und</strong> der Donau, <strong>die</strong> bis etwa 1560 entstandene Raaber Grenze, als das<br />
wichtigste Gebiet (s. I-8). In der Organisation der Raaber Grenzoberhauptmannschaft spielten in den 40er<br />
<strong>und</strong> 50er Jahren des 16. Jahrh<strong>und</strong>erts neben Niklas Graf zu Salm d.J. (†1550, Erlau) auch Ehrenreich von<br />
Königsberg, der erste Präsident des Wiener Hofkriegsrates (1556-1560), Sforza Pallavicini (vgl. I-2) <strong>und</strong><br />
Adam Gall zu Loßdorf eine entscheidende Rolle. Da jedoch nicht jedes Mitglied des Hofkriegsrates <strong>die</strong><br />
topografischen Besonderheiten der Verteidigungszone ausreichend kannte, holten sie sich im Interesse der<br />
richtigen militärischen Entscheidungen meist von den ungarischen Großgr<strong>und</strong>besitzern des Gebietes <strong>die</strong><br />
notwendigen Informationen ein. Die handschriftliche Grenzfestungslinienkarte von Johann Choron von<br />
Devecser entstand irgendwann um 1563 vermutlich ebenfalls zu <strong>die</strong>sem Zweck. Obwohl <strong>die</strong> Landkarte nur<br />
skizzenhaft war, gab sie in Meilen gerechnet <strong>die</strong> Entfernung zwischen den königlichen <strong>und</strong> den osmanischen<br />
Festungen an. Damit ist sie einzigartig, denn verfügen wir aus dem 16. Jahrh<strong>und</strong>ert über keine anderen<br />
Angaben mit ähnlichen Entfernungsmarkierungen auf Landkarten von Ungarn. Trotz <strong>die</strong>ser äußerst<br />
einfachen Darstellung lieferte <strong>die</strong> Karte dem Hofkriegsrat auf perfekte Weise genügend Daten. Die<br />
Kartenskizze – in deren Mittelpunkt der Gr<strong>und</strong>riß von Devecser, der Residenz von Choron zu sehen ist – ist<br />
aus dem Gesichtspunkt der Militär- <strong>und</strong> Kartographiegeschichte auch deshalb besonders interessant, weil sie<br />
<strong>die</strong> bisher frühste bekannte Darstellung eines Teiles des ungarischen Grenzverteidigungssystems ist, das im<br />
16. Jahrh<strong>und</strong>ert <strong>gegen</strong> <strong>die</strong> Osmanen neu ausgebaut worden war.<br />
Literatur: Pálffy, 2000/1, S. 36-39.<br />
I-8<br />
Karte der Raaber Grenze im 16. Jahrh<strong>und</strong>ert<br />
Entwurf von Géza Pálffy.<br />
Die Karte der Raaber Grenze zur Verteidigung Wiens <strong>und</strong> Niederösterreichs veranschaulicht <strong>die</strong> mehrfache<br />
Untergliederung der Grenzverteidigung ausgezeichnet. Die erste Burglinie bildeten <strong>die</strong> Festungen nördlich<br />
vom Plattensee (Palota, Veszprém, Tihany, Szigliget, Keszthely, Csobánc) bzw. Totis (Tata) südlich von<br />
Komorn. Zu der zweiten Front gehörte neben Csesznek, Szentmárton <strong>und</strong> Pápa auch <strong>die</strong> Festungsstadt Raab<br />
selbst. Raab war im 16. <strong>und</strong> 17. Jahrh<strong>und</strong>ert <strong>die</strong> wichtigste Vorbastei der Kaiserstadt Wien. Ihren Schutz<br />
sicherte außer ihrer Befestigung durch <strong>die</strong> modernen italienischen Burgbaumethoden (vgl. IV-11) <strong>und</strong> der<br />
ungefähr 1500 Mann starken deutschen <strong>und</strong> ungarischen Besatzungstruppe auch eine ganze Reihe von in der<br />
Nachbarschaft gelegenen kleinen Wachthäusern, <strong>die</strong> auf der Karte gut zu erkennen sind. Diese bildeten einen<br />
Ring um <strong>die</strong> Festung, indem sie sich vor allem auf <strong>die</strong> Linien der Flüsse Raab <strong>und</strong> Rabnitz (Rábca) stützten.<br />
Ihre Hauptaufgabe war <strong>die</strong> Beobachtung der Türkeneinfälle <strong>und</strong> <strong>die</strong> Alarmierung der Soldaten in der Festung<br />
Raab (vgl. V-14-15b).<br />
Literatur: Pálffy, 1999/2.<br />
8I-9<br />
Karte des italienischen Festungsbaumeisters Giovanni Jacobo Gasparini über das<br />
Grenzverteidigungssystem <strong>gegen</strong> <strong>die</strong> Osmanen von der Burg Erlau bis zur Drau, <strong>und</strong>atiert [Anfang,<br />
1594]<br />
Original, Papier, 43 x 57 cm, ital.<br />
Wien, HHStA Kartensammlung U/II/4/8.<br />
Druck: Pálffy, 2000/1, Faksimile.<br />
Das bis zu den 1580er Jahren neuorganisierte Verteidigungssystem (vgl. I-5) wird auf der<br />
Grenzfestungslinienkarte von Gasparini, einer der schönsten <strong>und</strong> interessantesten Darstellungen der<br />
Türkenabwehr in Ungarn, ausgezeichnet dargestellt. Gasparini dürfte <strong>die</strong> Landkarte sehr wahrscheinlich zu<br />
Beginn des Jahres 1594 erstellt haben, d. h. bereits zur Zeit des „Langen Türkenkrieges“ (1593-1606), denn<br />
er hat <strong>die</strong> Ende 1593 durch den bergstädtischen Grenzobersten Nikolaus Pálffy (s. III-5) zurückeroberten<br />
Festungen im Komitat Nógrád mit roten Ringen markiert. Die Karte stellt das Grenzburgensystem in Ungarn<br />
nördlich <strong>und</strong> nordöstlich der Drau dar. Die Ausführung ist in vielen Elementen ziemlich einfach, manchmal<br />
sogar oberflächlich, <strong>die</strong> Informationen sind aber in manchen Fällen erstaunlich genau. Gasparini nahm in<br />
seine Karte auch solche Festungen <strong>und</strong> kleine Wachthäuser auf, <strong>die</strong> in den vorangehenden Jahren gebaut,<br />
bald darauf aber vernichtet worden waren. Die ungefähr im Maßstab 1:720,000 dimensionierte Karte wurde<br />
natürlich nach den persönlichen Erfahrungen auf dem Kriegsschauplatz <strong>und</strong> bei den Grenzvisitationen<br />
gezeichnet. Die Karte ist außerdem noch in einem besonderen Punkt für <strong>die</strong> ungarisch-österreichische
Militärkartographie bzw. für <strong>die</strong> europäische Kartographiegeschichte wichtig <strong>und</strong> interessant. Der<br />
italienische Festungsbaumeister stellte nämlich das Grenzverteidigungssystem <strong>gegen</strong> <strong>die</strong> Osmanen<br />
abweichend von den geDruckten <strong>und</strong> den Manuskript gebliebenen Karten über das zeitgenössische Ungarn<br />
nicht in nördlicher, sondern in östlicher Richtung, d. h. also von Wien aus betrachtet, dar. Gasparini<br />
verfertigte 1594 für den Hofkriegsrat eine solche Karte, mit deren Hilfe <strong>die</strong> Ratsherren – sozusagen <strong>die</strong>se auf<br />
den Tisch legend – über <strong>die</strong> österreichische Erbländer schützende ungarische Grenzverteidigung zuverlässige<br />
Informationen bekommen konnten. Diese Karte zeigte nämlich aus dem Gesichtspunkt Europas <strong>und</strong> durch<br />
<strong>die</strong> Brille der Wiener Kriegsführung das ungarische Defensionssystem, das zwei Jahrh<strong>und</strong>erte lang <strong>die</strong> Rolle<br />
der „Schutzbastei des Christentums“ (lat. propugnaculum Christianitatis) spielte.<br />
Literatur: Pálffy, 2000/1, S. 77-88.<br />
I-9a<br />
Karte von Franz Batthyány über <strong>die</strong> Burgen entlang den Flüssen Zala <strong>und</strong> Raab, <strong>die</strong> <strong>gegen</strong> türkische<br />
Festung Kanizsa geordnet werden sollten, Dezember 1600<br />
Original, Papier, 32 x 20,5 cm, lat. <strong>und</strong> ung.<br />
Wien, KA HKR Akten Exp. 1601 März Nr. 187, fol. 34.<br />
Druck: Pálffy, 2000/1, Beilage IV.<br />
Infolge des Verlustes von Kanizsa am 20. Oktober 1600 gelangte das frühere Grenzgebiet, <strong>die</strong><br />
Kanischerische (Kanisische) Grenzoberhauptmannschaft, nahezu vollständig in <strong>die</strong> Hand der Osmanen. Die<br />
Wiener Kriegsführung sah sich daher gezwungen, den Türken <strong>gegen</strong>über eine neue Verteidigungszone<br />
auszubauen. Angesichts der mächtigen Gefahr begannen aus <strong>die</strong>sem Gr<strong>und</strong> bereits am Ende 1600<br />
Beratungen in Wien <strong>und</strong> Graz, <strong>die</strong> anschließend zunächst in Schottwien, <strong>und</strong> in den folgenden Jahren in der<br />
österreichischen, steirischen sowie der ungarischen Hauptstadt, in Preßburg fortgeführt wurden. Als Folge<br />
<strong>die</strong>ser Verhandlungen entstand nach der Organisationstätigkeit von 1610-1620er Jahren <strong>die</strong> <strong>gegen</strong>über von<br />
Kanizsa liegende Grenzoberhauptmannschaft. Jene Landkarte, <strong>die</strong> als gr<strong>und</strong>legendes Hilfsmittel zum Ausbau<br />
der späteren Oberhauptmannschaft <strong>die</strong>nte, hatte der ungarische Großgr<strong>und</strong>besitzer der benachbarten Gebiete,<br />
Franz Batthyány, noch im Dezember 1600 für eine der ersten Verhandlungen erstellt. Die Landkarte führte<br />
alle Burgen entlang der Flüsse Zala <strong>und</strong> Raab genau an, <strong>die</strong> bei der Verteidigung in Frage kamen. Der<br />
Landkarte legte der Großgr<strong>und</strong>besitzer sogar noch einen Entwurf über <strong>die</strong> in einzelnen Festungen<br />
stationierenden Besatzungstruppen bei.<br />
Literatur: Antonitsch, 1975, S. 268-273; Simon, 1997, S. 70-83. <strong>und</strong> Pálffy, 2000/1, S. 56-59.<br />
I-10<br />
Entwurf der Ausgaben für <strong>die</strong> Bezahlung der Soldaten in den Grenzfestungen in Ungarn (von Szatmár<br />
bis zur Drau), Februar 1607<br />
Original, Papier, 37,5 x 43,5 cm, deut.<br />
Wien, KA AFA 1607/13/1 ad 1 f.<br />
Druck: Benda, 1983, S. 50-54.<br />
Nachdem der Friede von Zsitvatorok am 11. November 1606 zwischen den Gesandten Kaiser Rudolfs II.<br />
(1576-1612) <strong>und</strong> Sultan Ahmeds I. (1603-1617) geschlossen worden war, setzte in der Geschichte der<br />
Türkenabwehr in Ungarn eine neue Epoche ein. Ganz bis zum Türkenkrieg zwischen 1660 <strong>und</strong> 1664 kehrte<br />
auf dem ungarischen Kriegsschauplatz relative „Ruhe“ ein. Dementsprechend erstellte der Hofkriegsrat<br />
bereits zu Beginn 1607 in Bezug auf jede einzelne Grenzoberhauptmannschaft einen Entwurf über <strong>die</strong><br />
künftig als notwendig erachteten Besatzungstruppen <strong>und</strong> deren Sold. Diese Vorschläge richteten sich nach<br />
den gr<strong>und</strong>legenden Veränderungen, <strong>die</strong> zur Zeit des „Langen Türkenkrieges“ eingetreten waren (1592: Fall<br />
von Wihitsch, 1596: Verlust von Erlau, 1600: Eroberung Kanizsas von den Türken), sowie nach der<br />
ausstehenden längeren Friedenszeit. Die vorliegende zusammenfassende Tabelle wurde aufgr<strong>und</strong> der<br />
einzelnen Teilentwürfe angefertigt. In <strong>die</strong>ser sah man für den Sold der von den siebenbürgischen Grenzen bis<br />
zum Fluss Drau vorgeschriebenen 18,692 Soldaten – inklusive der Wiener Garnison mit 500 Mann – jährlich<br />
etwa 1,520,000 rheinische Gulden als notwendig vor. Für <strong>die</strong> sonstigen Kriegsausgaben (Kosten des<br />
Hofkriegsrates, Proviantverpflegung, 9Kriegsmaterialversorgung, Burgbefestigungen usw.) veranschlagte<br />
man noch weitere etwa 355,000 rheinische Gulden. Der Entwurf wurde nie in seiner Gesamtheit<br />
verwirklicht, zumal zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges (1618-1648) <strong>die</strong> Zahl der Grenzsoldaten <strong>und</strong> auch<br />
<strong>die</strong> Kriegsausgaben der Türkenabwehr – in erster Linie aus finanziellen Gründen – wiederholt maßgeblich<br />
gesenkt wurden.
Literatur: Benda, 1983, S. 50-54.<br />
I-11<br />
Entwurf von Hilarius Feichtinger Oberstmustermeister in Ungarn an den Wiener Hofkriegsrat über<br />
<strong>die</strong> Zahlreduktion der ungarischen Grenzsoldaten, 3. April 1671, Wien<br />
Zeitgenössische Abschrift, Papier, 31 x 21 cm, deut.<br />
Wien, FHKA HKA HFU rote Nr. 237, 1672 März fol. 615-619.<br />
Ganz zu Beginn der 1670er Jahre unternahm der Hofkriegsrat den Versuch, <strong>die</strong> Soldatenmasse der<br />
ungarischen Grenzfestungen dem System des stehenden Heeres entsprechend, das sich allmählich schon<br />
zustande gekommen war, umzustrukturieren. Um <strong>die</strong>s zu erreichen, wurden verschiedene Entwürfe<br />
ausgearbeitet, <strong>die</strong> im Wesentlichen darauf abzielten, <strong>die</strong> Grenzsoldaten in Kompanien zu organisieren <strong>und</strong> sie<br />
ähnlich der regulären Regimenter erscheinen zu lassen. All <strong>die</strong>s wäre – in erster Linie aus finanziellen<br />
Gründen – mit der bedeutenden Senkung der Zahl der Grenzsoldaten einhergegangen. Diese Vorstellungen<br />
belegt der Entwurf von Hilarius Feichtinger, Obermustermeister in Ungarn (1657-1678) ausgezeichnet, der<br />
<strong>die</strong> Zahl der ungefähr 11,400 ungarischen Husaren <strong>und</strong> Haiducken, <strong>die</strong> von den siebenbürgischen Grenzen<br />
bis zur Drau <strong>die</strong>nten, auf insgesamt 4000 Mann senken wollte. Die Reformbestrebung scheiterte jedoch an<br />
dem Widerstand der ungarischen Stände <strong>und</strong> der Grenzsoldaten. Der Hofkriegsrat war daher gezwungen, den<br />
Entwurf zurückzuziehen <strong>und</strong> <strong>die</strong> Zahl der Soldaten in den Grenzfestungen bis etwa 1677 größtenteils<br />
wiederherzustellen. Obgleich <strong>die</strong> folgenden Jahrzehnte <strong>die</strong> Notwendigkeit der Reformpläne belegten,<br />
konnten <strong>die</strong> Grenzsoldaten, <strong>die</strong> ein zur Hälfte militärisches <strong>und</strong> zur anderen Hälfte bürgerliches Leben<br />
führten, nicht mehr in <strong>die</strong> Struktur des stehenden Heeres eingegliedert werden.<br />
Literatur: Takáts, 1908, S. 300-304 <strong>und</strong> Czigány, 1996.<br />
II. Verwaltung <strong>und</strong> Finanzierung<br />
II-1<br />
Instruktion König Ferdinands I. für den Wiener Hofkriegsrat, 17. November 1556, Wien<br />
Zeitgenössische Abschrift, Papier, 32,5 x 21 cm, deut.<br />
Wien, KA Bestallungen Nr. 28, andere zeitgenössische Abschriften: Wien, KA AFA 1556/13/2; Wien, FHKA HKA Instr.<br />
Nr. 127; Wien, HHStA Schloßarchiv Grafenegg, Archiv Breuner, Militaria, Schachtel 152, Fasc. Nr. 4, 17. Nov.<br />
1556.<br />
Druck: Firnhaber, 1864, 129-132: Nr. IX <strong>und</strong> Fellner-Kretschmayr, 1907/Bd. 2, 276-280: Nr. 16.<br />
Die Gründung des Wiener Hofkriegsrates 1556 war ein Meilenstein in der Geschichte des österreichischen<br />
<strong>und</strong> des ungarischen Kriegswesens der frühen Neuzeit. Obwohl König Ferdinand bereits seit 1529 Kriegsräte<br />
für <strong>die</strong> militärischen Angelegenheiten ernannt hatte, nahmen <strong>die</strong>se ihre Aufgaben nur ad hoc wahr, hatten<br />
nicht in jedem Fall einen festen Sitz, <strong>und</strong> waren also keine Ämter. Mitte der 50er Jahre des 16. Jahrh<strong>und</strong>erts<br />
war es unmöglich geworden, das Verteidigungssystem in Ungarn sowie das sich rasch entwickelnde<br />
Kriegswesen auf <strong>die</strong> althergebrachte Weise zu verwalten. Aus <strong>die</strong>sem Gr<strong>und</strong>e rief Ferdinand I. am 17.<br />
November 1556 in Wien den Hofkriegsrat ins Leben, der schon einen festen Sitz hatte, seine Sitzungen in<br />
Form eines Ratskollegiums (ursprünglich mit 5 Ratsherren) abhielt <strong>und</strong> somit eine für seine Zeit moderne<br />
Fachbehörde war. Als Vorgänger des späteren Kriegsministeriums war der Hofkriegsrat im allgemeinen für<br />
<strong>die</strong> Leitung des Militärwesens zuständig, vor allem aber für <strong>die</strong> damals wichtigste Frage, nämlich für <strong>die</strong><br />
Ausarbeitung einer Defensionskonzeption zur Türkenabwehr, darüber hinaus für <strong>die</strong> Grenzfestungsbauten,<br />
<strong>die</strong> Kriegsmaterial- <strong>und</strong> Lebensmittelversorgung sowie in Zusammenarbeit mit der Hofkammer für <strong>die</strong><br />
Besoldung der Grenzsoldaten. Die Führung der Ostpolitik gehörte laut der Instruktion für den Hofkriegsrat<br />
nicht in seinen Kompetenzbereich, dennoch wurde sie wegen seiner engen Verbindung mit der<br />
Grenzverteidigung in Ungarn doch zu einer wichtigen Aufgabe.<br />
Literatur: Firnhaber, 1864; Regele, 1949 <strong>und</strong> Broucek, 1988.<br />
II-2<br />
Protokoll des Wiener Hofkriegsrates aus dem Jahre 1574<br />
Originalband, Papier, 34 x 23,5 cm, deut.<br />
Wien, KA HKR Prot. Bd. 158, Exp. 1574.
Die schriftlichen Aufgaben, <strong>die</strong> sich im Zusammenhang mit der vielfältigen Arbeit des Hofkriegsrates<br />
ergaben, wurden seit 1556 von einem eigenen Organ, der Hofkriegskanzlei wahrgenommen. Ihr Personal<br />
bestand ursprünglich aus zwei Sekretären, einem Registrator, einem Expeditor, mehreren Konzipisten <strong>und</strong><br />
Schreibern, sowie einigen Dienern <strong>und</strong> Dolmetschern. Die bei <strong>die</strong>sem Regierungsorgan eingehenden <strong>und</strong><br />
ausgefertigten Schriftstücke wurden hier fast regelmäßig registriert, indem eigene Bände für <strong>die</strong> eingehenden<br />
<strong>und</strong> für <strong>die</strong> ausgefertigten Schriftstücke geführt wurden. Ent<strong>gegen</strong> ihrer Bezeichnung enthielten <strong>die</strong> Expedit-<br />
Protokolle kurze inhaltliche Auszüge der eingehenden Schriftstücke <strong>und</strong> <strong>die</strong> Registratur-Protokolle <strong>die</strong><br />
Extrakte der ausgefertigten. Die Protokolle stellen demnach keine Zusammenfassungen der<br />
Hofkriegsratssitzungen 10dar, sondern sind zeitgenössische Registraturbücher der Hofkriegskanzlei. Anfangs<br />
wurden des öfteren <strong>die</strong> Schriftstücke mehrerer Jahre in einem Band zusammengefasst, wobei <strong>die</strong> Benutzung<br />
durch ein Personenregister erleichtert wurde. Bis 1573 stehen <strong>die</strong> Einträge in chronologischer Reihenfolge,<br />
danach wurden sie jedoch nach den wichtigsten Personen <strong>und</strong> Themen geordnet, wie z.B. Kaiser,<br />
Hofkammer, Raaber, Bergstädtische usw. Grenzoberhauptmannschaften, Festungsbau-, Zeug- <strong>und</strong><br />
Schiffbrückenwesen, Wien Stadtguardia usw. Dieses System lief um 1640 allmählich aus. Bereits seit 1656<br />
ging man wieder zur chronologischen Ordnung über, gleichzeitig wurden jedoch von nun an nicht mehr nur<br />
<strong>die</strong> Personennamen, sondern auch <strong>die</strong> wichtigsten Themenbereiche in <strong>die</strong> Register aufgenommen.<br />
Literatur: Firnhaber, 1864; Regele, 1949 <strong>und</strong> Egger, 1993, S. 76-77.<br />
II-3<br />
Instruktion Erzherzog Maximilians für Emericus Thelekessy Feldoberst in Oberungarn <strong>und</strong><br />
Oberhauptmann zu Kaschau, 8. Mai 1559, Wien<br />
Original, Papier, 31,5 x 22 cm, lat.<br />
Budapest, MOL E 136 MKA Div. Instr. Nr. 173, fol. 323-330.<br />
Die Oberungarische Grenzoberhauptmannschaft entstand allmählich nach der Rückeroberung der Stadt<br />
Kaschau (1552) <strong>und</strong> der umliegenden Gebiete in Nord- <strong>und</strong> Ostungarn (1557-1568), <strong>die</strong> früher im Besitz von<br />
dem Fürsten von Siebenbürgen, Johann Sigm<strong>und</strong> waren. Ihr erster Oberhauptmann war der Emericus<br />
Thelekessy (1497-1560). Seiner Instruktion zufolge war er gleichzeitig Oberhauptmann der Stadt Kaschau.<br />
Die Urk<strong>und</strong>e unterzeichneten neben Erzherzog Maximilian auch der Präsident des Hofkriegsrates Ehrenreich<br />
von Königsberg (im Original: „Eenreich von Khünigsperg“) <strong>und</strong> dessen Sekretär Hans Fieringer. Die<br />
wichtigste Aufgabe des Oberhauptmanns bestand in der Verwaltung der etwa ein Dutzend Grenzburgen<br />
<strong>die</strong>ses Landesteils. Thelekessy gehörte zu den hervorragendsten ungarischen Offizier seiner Zeit, da er sein<br />
ganzes Leben dem Kampf <strong>gegen</strong> <strong>die</strong> Türken gewidmet hatte. Bereits in jungen Jahren nahm er an der<br />
Schlacht bei Mohács (1526) teil <strong>und</strong> <strong>die</strong>nte dann als Rittmeister unter dem Befehl von Hans Katzianer, später<br />
in den Burgen von Pápa, Veszprém <strong>und</strong> Raab. Zwischen 1554 <strong>und</strong> 1556 war er Hauptmann der Grenzburg<br />
Lewenz (Léva), <strong>und</strong> nahm 1556 unter der Führung von Erzherzog Ferdinand von Tirol am Kriegszug in<br />
Südtransdanubien teil. Auf dem Höhepunkt seiner militärischen Laufbahn erhielt er <strong>die</strong><br />
Grenzoberhauptmannschaft in Oberungarn, konnte <strong>die</strong>ses Amt jedoch wegen seines Todes am 30. Mai 1560<br />
nur für kurze Zeit bekleiden.<br />
Literatur: Pálffy, 1998, S. 162-164 <strong>und</strong> ders., 2000/2,S. 47.<br />
II-4<br />
Instruktion Kaiser Maximilians II. für Georg Zrínyi (kroat. Zrinski) Kreisoberst jenseits der Donau,<br />
15. August 1574, Wien<br />
Original, Papier, 31 x 20,5 cm, lat.<br />
Wien, KA HKR KlA IX c 1.<br />
Georg Zrínyi (1549-1603), Sohn des Helden von Szigetvár, Nikolaus Zrínyi (III-4), wurde am 15. August<br />
1574 von Kaiser Maximilian II. zum Kreisobersten jenseits der Donau (supremus capitaneus partium regni<br />
Hungariae Transdanubianarum) ernannt. Im Sinne seiner Instruktion, <strong>die</strong> der Kaiser für ihn vom<br />
Hofkriegsrat hatte ausstellen lassen, war Zrínyi für <strong>die</strong> Kriegsangelegenheiten der neun ungarischen<br />
Komitaten Transdanubiens, für <strong>die</strong> Führung der zu <strong>die</strong>ser Zeit bereits veralteten adeligen Insurrektion sowie<br />
für <strong>die</strong> Organisation der Robotarbeiten (gratuitus labor) bei Festungsbauten zuständig, wobei jedoch <strong>die</strong><br />
Grenzfestungen <strong>die</strong>ses Gebietes nicht in seine Kompetenz fielen, sondern in <strong>die</strong> des Raaber <strong>und</strong> des<br />
Kanischerischen (Kanisischen) Grenzobersten. Da Zrínyi aber von 1574 an ein Jahr lang auch an der Spitze<br />
der Grenzoberhauptmannschaft von Kanizsa stand, war er für <strong>die</strong>se kurze Zeit mit der Leitung der<br />
Verteidigung in ganz Südtransdanubien beauftragt. Später, von 1582-1598, hatte Zrínyi noch einmal den<br />
Posten des Kreisobersten jenseits der Donau inne. Darüber hinaus spielte er vor allem durch seine
Großgr<strong>und</strong>herrschaft in der Murinsel auch bei der Verteidigung der Steiermark eine führende Rolle.<br />
Literatur: Pálffy, 2000/2, S. 46: Anm. 92. <strong>und</strong> Roth, 1969-1970.<br />
II-4a<br />
Bestallung Kaiser Ferdinands I. für Karl Haiden von Guntramsdorf Mustermeister in Ungarn, 1.<br />
Februar 1561, Wien<br />
Zeitgenössische Abschrift, Papier, 31 x 20,5 cm, deut.<br />
Wien, KA Bestallungen Nr. 89.<br />
Eine der schwierigsten Aufgaben bei der Versorgung der Grenzsoldaten bestand darin, ihren Sold<br />
aufzubringen <strong>und</strong> auszuzahlen. Dem ging in den einzelnen Burgen immer <strong>die</strong> Musterung voran, bei der unter<br />
der Leitung eines Mustermeisters <strong>die</strong> Ausrüstung der Soldaten überprüft wurde. Der Gehilfe des<br />
Mustermeisters, der sogenannte Musterschreiber, stellte dabei das Musterregister mit den Namen der<br />
Soldaten <strong>und</strong> der Art ihrer Ausrüstung zusammen. Unter den verschiedenen Mustermeistern hatte der<br />
Oberstmustermeister in Ungarn eine besondere Stellung. Diesen Posten hatten seit den 1540er Jahren in der<br />
Regel zwei Personen inne. Die Aufgaben des Oberstmustermeisters waren in einer eigenen Bestallung<br />
zusammengefasst. Das früheste bisher gef<strong>und</strong>ene Exemplar einer solchen Bestallung wurde für Karl Haiden<br />
von Guntramsdorf († 2. April 1582) ausgestellt. Haiden entstammte einer niederösterreichischen Familie, <strong>die</strong><br />
zum Ritterstand gehörte, <strong>und</strong> <strong>die</strong>nte bereits Mitte der 1530er Jahre als Soldat in Ungarn. Ab 1533 bekleidete<br />
er auch das Erbunterschenkenamt 11in Österreich unter der Enns <strong>und</strong> war Anfang der 40er Jahre<br />
Musterkommissar im Heer Kaiser Karls V. Seine hier erworbenen Erfahrungen halfen ihm, den Posten des<br />
Oberstmustermeister in Ungarn zu erhalten. Diesen hatte er bis zu seinem Tode im Jahre 1582 inne, was auch<br />
seine Ernennung zum kaiserlichen Rat im Jahre 1574 bestätigte. Sein Grabstein findet sich in der Pfarrkirche<br />
zu Achau (Niederösterreich).<br />
Literatur: Perger, 1970, S. 121-123.<br />
II-5<br />
Instruktion Kaiser Ferdinands I. für Christoph Gannabiczer Kriegszahlmeister in Ungarn, 1. Januar<br />
1564, Wien<br />
Konzept, Papier, 31,5 x 21,5 cm, deut.<br />
Wien, FHKA HKA Instr. Nr. 158, eine zeitgenössische Abschrift: ebenda Nr. 175.<br />
Nach den Musterungen zahlten <strong>die</strong> Kriegszahlmeister den Grenzsoldaten ihren Sold aus. Das größte Ansehen<br />
hatte der Kriegszahlmeister in Ungarn, dessen Amt um 1545 entstand. Der erste Amtsträger jedoch, der auch<br />
eine Instruktion erhielt, war erst Christoph Gannabiczer († 31. Oktober 1576), der seinen Dienst zwar der<br />
Hofkammer untergeordnet, aber in enger Zusammenarbeit mit dem Hofkriegsrat am 1. Januar 1564 aufnahm.<br />
Bis dahin war er Musterschreiber in Ungarn, was ihm eine gute Gr<strong>und</strong>lage für seine spätere Arbeit sicherte.<br />
Das Kriegszahlmeisteramt hatte er drei Jahre lang, bis Ende 1566 inne, dann wurde er von Andreas<br />
Schnätterl abgelöst (vgl. II-9). Gannabiczer ließ sich 1576 im Wiener Stephansdom beisetzen, wo sein<br />
Grabdenkmal bis heute erhalten geblieben ist.<br />
Literatur: Pálffy-Perger, 1998, S. 222-233.<br />
II-5a<br />
Instruktion Kaiser Maximilians II. für Christoph Teufel Oberstproviantmeister des ungarischen<br />
Kriegswesens, 29. Dezember 1565, Linz<br />
Zeitgenössische Abschrift, Papier, 31 x 21 cm, deut.<br />
Wien, KA HKR KlA I 1, eine zeitgenössische Abschrift: Wien, FHKA HKA Instr. Nr. 164.<br />
Im Anschluß an <strong>die</strong> Gründung des Hofkriegsrates wurde wahrscheinlich Anfang 1557 der bereits ständige<br />
Posten des Oberstproviantmeisters in Ungarn zur Leitung der Lebensmittelversorgung der Grenzsoldaten<br />
eingerichtet. Seine Aufgabe bestand in der Versorgung der für <strong>die</strong> Verteidigung Wiens wichtigsten<br />
Grenzfestungen (Raab, Komorn, Totis, später auch Kanizsa) mit Brot, Wein, Fleisch, Salz <strong>und</strong> Schmalz. Er<br />
wurde in seiner Arbeit von ihm untergeordneten Proviantmeistern unterstützt, <strong>die</strong> in den größeren<br />
Grenzfestungen für <strong>die</strong> Lebensmittelverteilung zuständig waren, darüber hinaus regelmäßig<br />
Bestandsaufnahmen über <strong>die</strong> Vorräte machten <strong>und</strong> <strong>die</strong> Mängel meldeten. Der recht vielfältige<br />
Aufgabenbereich des Oberstproviantmeisters, der der Hofkammer unterstellt war, wurde in langen<br />
Instruktionen wie in der für Christoph Teufel vom Ende des Jahres 1565 beschrieben. Im 16. Jahrh<strong>und</strong>ert<br />
hatten meist niederösterreichische Adelige das Amt des Oberstproviantmeisters inne, weil <strong>die</strong>se Gebiete<br />
Hilfslieferungen in <strong>die</strong> genannten Grenzfestungen veranlaßten. Teufel kannte <strong>die</strong>se Burgen gut, da er selbst
1546 an der Spitze von sieben Reitern in Raab ge<strong>die</strong>nt hatte. Einer seiner Brüder, Andreas, war dabei zur<br />
gleichen Zeit zweimal (1575-1577 <strong>und</strong> 1577-1582) Raaber Grenzoberst, während sein anderer Bruder,<br />
Georg, Präsident des Hofkriegsrates (1566-1578) war. Die niederösterreichische Familie spielte also in der<br />
zweiten Hälfte des 16. Jahrh<strong>und</strong>erts eine gr<strong>und</strong>legende Rolle bei der Leitung <strong>und</strong> Versorgung der<br />
Grenzfestungen in Ungarn.<br />
Literatur: Widter, 1886, S. 104-114; Wissgrill, 1886, S. 131-136; Glatzl, 1950, passim; Adel im Wandel, 1991, S. 273<br />
<strong>und</strong> Pálffy, 1999/2, S. 196-200 <strong>und</strong> 260-261.<br />
II-5b<br />
Instruktion Kaiser Rudolfs II. für Andreas Kielman von Kielmansegg Oberstzeugmeister der<br />
ungarischen Grenzfestungen, 1. Januar 1584, Wien<br />
Konzept, Papier, 32 x 21 cm, deut.<br />
Wien, KA HKR KlA V 3.<br />
Für <strong>die</strong> Kriegsmaterialversorgung der Grenzfestungen war der dem Hofkriegsrat unterstellte<br />
Oberstzeugmeister (später Oberst-Land- <strong>und</strong> Hauszeugmeister) zuständig. Dieses Amt richtete Kaiser<br />
Maximilian I. (1493-1519) im Jahre 1503 in Innsbruck ein <strong>und</strong> legte als Aufgabe für den Oberstzeugmeister<br />
<strong>die</strong> Überwachung der in den österreichischen Gebieten entstandenen Zeughäuser fest. Unter König<br />
Ferdinand I. zog mit dem Hof auch der Amtsträger nach Wien um, genauer gesagt <strong>die</strong>nte seit den 1550er<br />
Jahren sowohl in Tirol als auch in den niederösterreichischen Ländern je ein eigener Oberstzeugmeister.<br />
Nachdem im Sinne des Testaments von Ferdinand I. Innerösterreich eine weitgehende Eigenständigkeit<br />
erlangt hatte, wurde im Jahre 1564 auch in Graz ein eigenes Amt eingerichtet. Während der Träger <strong>die</strong>ses<br />
Amtes von nun an für <strong>die</strong> Versorgung der Grenzfestungen in Kroatien <strong>und</strong> Slawonien zuständig war, leitete<br />
der Oberstzeugmeister in Wien <strong>die</strong> Versorgung des Grenzfestungsnetzes von der Drau bis zur Grenze<br />
Siebenbürgens, wie auch aus der Instruktion für Andreas Kielman von Kielmansegg (1524-1590) aus dem<br />
Jahre 1584 ausführlich hervorgeht. Er versorgte <strong>die</strong> einzelnen Festungen aus dem Wiener Hauptzeughaus, in<br />
das auf seine Bestellungen hin regelmäßig Kanonen, Handfeuerwaffen <strong>und</strong> verschiedenes Kriegsmaterial in<br />
großen Mengen vor allem aus den Reichsstädten sowie aus Tirol <strong>und</strong> Prag befördert wurden. Kielman selbst<br />
war einer der besten Kenner der ungarischen Grenzverteidigung. Nachdem er von 1556 bis1559 als<br />
Hauptmann eine Landknechtstruppe in Ungarn geführt hatte, war er zusammen mit Karl 12Haiden (II-4a)<br />
Mustermeister in Ungarn (1561-1566). Ab 1566 <strong>die</strong>nte er als Oberst zu Komorn, dann zwischen 1577 <strong>und</strong><br />
1580 als Grenzoberhauptmann zu Kanizsa, schließlich stand er von 1580 bis zu seiner Ernennung zum<br />
Oberstzeugmeister wieder der Festung zu Komorn vor.<br />
Literatur: Kielmansegg, 1910, S. 4-21 <strong>und</strong> Pálffy, 1996/2, S. 170-174.<br />
II-6<br />
Vorgeschriebene Soldkosten der Grenzfestungssoldaten in Ungarn <strong>und</strong> Kroatien im 16. Jahrh<strong>und</strong>ert<br />
Entwurf von Géza Pálffy.<br />
Prozentualer Anteil der vorgeschriebenen Soldkosten der Grenzsoldaten an den jährlichen Einnahmen bzw. an den<br />
Kriegsausgaben des Königreichs Ungarn in der zweiten Hälfte des 16. Jahrh<strong>und</strong>erts<br />
Jahr jährliche Soldausgaben<br />
für <strong>die</strong> Grenzsoldaten<br />
in rheinischen Gulden<br />
Prozentualer Anteil der<br />
Soldkosten an den<br />
jährlichen Einnahmen<br />
Prozentualer Anteil der Soldkosten an den<br />
max. 1 * eingeschätzten Kriegsausgaben<br />
1554 761 766 100 50<br />
1556 945 475 81 40,5<br />
1572 1 385 965 55 27,5<br />
1576 1 658 736 46 23<br />
1578 1 461 900 52 26<br />
1582 1 418 292 54 27<br />
1593 1 572 533 49 24,5<br />
Genaue Angaben über <strong>die</strong> jährlichen Einnahmen des verkleinerten Königreichs Ungarn stehen uns nur für<br />
<strong>die</strong> Mitte der 70er Jahre des 16. Jahrh<strong>und</strong>erts zur Verfügung. Zu <strong>die</strong>ser Zeit betrugen <strong>die</strong> verschiedenen<br />
Einkünften (Dreißigst, Bergbaueinkünfte, Kriegssteuer, Einnahmen der Gr<strong>und</strong>herrschaften, Steuerabgaben<br />
1max. = um 50 Prozent
der königlichen Städte usw.), <strong>die</strong> <strong>die</strong> drei in Ungarn zuständigen Kammern (Ungarische, Zipser <strong>und</strong><br />
Niederösterreichische) verwalteten, insgesamt 765,000 rheinische Gulden. Für militärische Zwecke wurden<br />
etwa 50 Prozent <strong>die</strong>ser Summe eingesetzt.<br />
Literatur: Oberleitner, 1860, S. 1-231; Acsády, 1888; Merényi, 1893, S. 543-545; Loebl, 1899, S. 19-29; Takáts, 1908,<br />
passim; Loserth, 1938, S. 205-208: Nr. 12; Benda, 1983 <strong>und</strong> Pálffy, 1995/4, S. 61-86.<br />
II-7<br />
Musterregister der zwei deutschen Landsknechttruppen unter der Leitung Hans von Panobiz <strong>und</strong><br />
Jakob von Raming mit den Angaben der Abstammungsorte der Soldaten, 19. März 1562, Tyrnau<br />
Original, Papier, 32 x 22 cm, deut.<br />
Wien, KA AFA 1562/3/ad 2 a.<br />
Gegen <strong>die</strong> Türken in Ungarn zu kämpfen, bedeutete nicht nur für Ungarn eine Aufstiegsmöglichkeit. Der<br />
Hofkriegsrat stationierte nämlich in den wichtigsten Grenzfestungen in der Regel mehrere Tausend Mann<br />
starke Truppen, deren Mitglieder vor allem aus österreichischen, böhmischen, mährischen, aber auch aus<br />
weit entfernten Gebieten des Heiligen Römischen Reiches angeworben wurden. Dies läßt sich sehr gut<br />
anhand des Musterregisters der zwei deutschen Landsknechttruppen illustrieren, <strong>die</strong> unter dem Befehl der<br />
Hauptleute Hans von Panobiz <strong>und</strong> Jakob von Raming im Frühjahr 1562 ihren Dienst in Ungarn aufnahmen.<br />
Da das Register auch <strong>die</strong> Abstammungsorte der Soldaten angibt (wie z.B. Stuttgart, Regensburg, Augsburg,<br />
Nürnberg, München, Breslau, Ingolstadt, Salzburg, Graz, Wien, Linz, Laibach usw.), ist es für <strong>die</strong> Forschung<br />
besonders wertvoll, da andere ähnliche Quellen kaum zur Verfügung stehen. Die beiden Landsknechttruppen<br />
wurden dann nach Oberungarn abkomman<strong>die</strong>rt <strong>und</strong> auf <strong>die</strong> dortigen Festungen (vor allem in Szatmár <strong>und</strong><br />
Szendrõ) verteilt. Auch Jakob von Ramings Karriere in Ungarn begann zu <strong>die</strong>ser Zeit. Später wurde er<br />
Grenzoberst zu Szatmár (1565-1568), dann Hofkriegsrat, <strong>und</strong> schließlich ab 1574 Oberstzeugmeister in Wien<br />
(vgl. II-5b). Währenddessen stieg auch Hans von Panobiz, ebenfalls Hauptmann, auf: von 1568 bis zu<br />
seinem Tode im Jahre 1586 war er Grenzburghauptmann zu Ivanics, einer wichtigen Festung an der<br />
Slawonischen Grenze.<br />
II-7a<br />
Musterregister der in den Grenzfestungen Raab, Szentmárton, Pápa <strong>und</strong> Veszprém <strong>die</strong>nenden<br />
Grenzsoldaten, <strong>die</strong> von den niederösterreichischen Ständen bezahlt wurden, 30. März 1546, Raab<br />
Original, Papier, 31 x 22 cm, deut.<br />
Wien, FHKA HKA HFU rote Nr. 2, 1546, fol. 48 a/1-18.<br />
Druck: Pálffy, 1999/2, S. 61 (in Tabellenform).<br />
Vom März 1546 an stationierten <strong>die</strong> niederösterreichischen Stände mehr als anderthalb Jahrh<strong>und</strong>erte lang<br />
ständige Besatzungen von beträchtlicher Stärke an der Raaber Grenze, d.h. in den Festungen (vor allem in<br />
Raab, Pápa <strong>und</strong> Veszprém), 13<strong>die</strong> Wien verteidigten. Das Musterregister der 1126 namentlich genannten<br />
Soldaten (110 deutsche gerüstete Reiter, 796 Husaren <strong>und</strong> 220 Haiducken), <strong>die</strong> im Frühjahr 1546 in <strong>die</strong>sen<br />
Burgen <strong>die</strong>nten, stellt <strong>die</strong> eine der ältesten Quellen ihrer Art über <strong>die</strong> Türkenabwehr in Ungarn dar. Die<br />
Musterung wurde in Gegenwart von Erasmus Teufel, Kriegsrat <strong>und</strong> Verwalter des Feldoberstleutnantenamtes<br />
in Ungarn (Vater der erwähnten Brüder Teufel, s. II-5a), <strong>und</strong> des späteren Raaber Grenzoberhauptmanns<br />
(1556-1560) Adam Gall zu Loßdorf sowie von Sigm<strong>und</strong> Graf zu Tierstein <strong>und</strong> Ebersdorf durchgeführt.<br />
Anschließend kam es zur Auszahlung des Solds für den Monat März. Mehr als <strong>die</strong> Hälfte der Soldaten <strong>die</strong>nte<br />
in Raab <strong>und</strong> einige von ihnen, wie z.B. Ludwig von Puchheim, Karl Schwetkovitsch oder Georg <strong>und</strong><br />
Christoph Teufel waren junge niederösterreichische Adelige, <strong>die</strong> bei der Reiterei mit schweren Rüstungen<br />
<strong>gegen</strong> <strong>die</strong> Türken kämpften. Der Sold der 1126 Grenzsoldaten betrug für ein Jahr gerechnet ungefähr 70,000<br />
rheinische Gulden, <strong>und</strong> machte 10 Prozent der jährlichen Einnahmen Ungarns aus. In <strong>die</strong>sem Sinne war <strong>die</strong><br />
Hilfe aus Niederösterreich für <strong>die</strong> Aufrechterhaltung des ungarischen Grenzverteidigungssystems<br />
unerlässlich.<br />
Literatur: Pertl, 1939; Möller, 1976, S. 21-31 <strong>und</strong> Pálffy, 1999/2, S. 60-62.<br />
II-8<br />
Tuchmuster zur Bezahlung der Soldaten an der Raaber Grenze, 1680<br />
Original, Papier bzw. Tuch, deut.<br />
Sankt Pölten, NÖLA SA Ständische Akten A-II-10, Karton 42, unter dem Datum 6. Mai 1681.<br />
Da es im 16. <strong>und</strong> 17. Jahrh<strong>und</strong>ert einerseits schwierig, ja sogar gefährlich war, mit größeren Mengen Bargeld<br />
zu bezahlen, es aber andererseits auch oft an Bargeld mangelte, wurde der Sold der Soldaten zur Hälfte in
Tuch beglichen. (Darüber hinaus wurde manchmal der Sold für <strong>die</strong> Grenzsoldaten in Naturalien oder Waffen<br />
ausgezahlt.) Die Auszahlung in Tuch war auch deshalb vorteilhaft, weil man es in größeren Posten kaufte,<br />
jedoch in kleineren Mengen wieder verteilte, so daß sich wegen des Preisunterschiedes beträchtliche Beträge,<br />
bei einer Grenzbezahlung mehrere Tausend Gulden, einsparen ließen. Außerdem führten <strong>die</strong> Tuchlieferer<br />
Tuch, das in Farbe, Zusammensetzung <strong>und</strong> Qualität sehr unterschiedlich war, wie auch aus <strong>die</strong>sem<br />
Tuchmuster zur Bezahlung der Soldaten an der Raaber Grenze aus dem Jahre 1680 ersichtlich ist. Und da <strong>die</strong><br />
Soldaten <strong>die</strong> einzelnen Tuchsorten <strong>und</strong> deren Preise nicht genau kannten, eröffnete sich hier eine weitere<br />
Manipulationsmöglichkeit. Darüber hinaus stammten in der zweiten Hälfte des 17. Jahrh<strong>und</strong>erts der<br />
sogenannte Unterkriegszahlmeister der niederösterreichischen Stände <strong>und</strong> der Tuchlieferer aus ein <strong>und</strong><br />
derselben Familie, nämlich aus der der Wäggeles. Daher verw<strong>und</strong>ert es nicht, daß der Aufstieg der Familie<br />
gerade in <strong>die</strong>ser Zeit vor sich ging.<br />
Literatur: Valentinitsch, 1975, S. 141-165.<br />
II-9<br />
Rechnungsbuch des Kriegszahlmeisters in Ungarn Andreas Schnätterl zu Tornau aus dem Jahre 1570<br />
Originalband, Papier, 40 x 29 cm, deut., angekauft im Jahre 1991 von der Familie Ellridshausen (Wels in<br />
Niederösterreich).<br />
Wien, KA Armee-Schemata Bd. 9 a, fol. 1-388, fol. I r -II r Einnahmenrubriken, fol. II v -IX r Personenindex zu den<br />
Einnahmen, fol. X leer, fol. 1 r -120 r Einnahmen, fol. 121 leer, fol. 122 v -388 r Ausgaben.<br />
Die Kriegszahlmeister mußten den Kammern, <strong>die</strong> ihre Arbeit kontrollierten, jährlich über <strong>die</strong> von ihnen<br />
verwalteten Geldsummen Rechenschaft ablegen. Dabei hatten sie einerseits <strong>die</strong> Einnahmen, andererseits –<br />
durch Quittungen über <strong>die</strong> ausgezahlten Beträge belegt – <strong>die</strong> Ausgaben ausführlich aufzulisten. So wurden<br />
aus den Rechnungsbüchern für ein Jahr dicke Bände. Da sie nach der Vertreibung der Türken aus Ungarn<br />
ihre Bedeutung verloren hatten, wurden sie weggeworfen, <strong>und</strong> nur einige von ihnen sind aus dem 16. <strong>und</strong> 17.<br />
Jahrh<strong>und</strong>ert erhalten geblieben. Die wichtigste Rolle unter den Kriegszahlmeistern spielte der<br />
Kriegszahlmeister in Ungarn (später Hofkriegszahlmeister, vgl. II-5), der über den größten<br />
Zuständigkeitsbereich verfügte <strong>und</strong> demnach <strong>die</strong> höchsten Geldbeträge verwaltete. Bislang konnte aus dem<br />
16. Jahrh<strong>und</strong>ert nur ein einziges Rechnungsbuch eines Kriegszahlmeisters in Ungarn gef<strong>und</strong>en werden,<br />
nämlich das von Andreas Schnätterl, der sein Amt zwischen 1567 <strong>und</strong> 1578 ausübte. Es enthält <strong>die</strong><br />
Einnahmen <strong>und</strong> Ausgaben des Jahres 1570, <strong>und</strong> wurde am 23. Dezember 1572 der Hofkammer zur Kontrolle<br />
vorgelegt. Schnätterls Einnahmen, etwa 300,000 rheinische Gulden, stammten aus Einkünften in Ungarn,<br />
Nieder- <strong>und</strong> Oberösterreich, Böhmen, Mähren <strong>und</strong> Schlesien, aus der Türkenhilfe des Heiligen Römischen<br />
Reiches <strong>und</strong> aus Krediten, <strong>die</strong> er vor allem von Augsburger, Wiener, Breslauer <strong>und</strong> anderen Händlern sowie<br />
von Hochadeligen aufgenommen hatte. Die Ausgaben betrafen fast jeden Bereich des Kriegswesens, vor<br />
allem aber wurden sie für den Sold der Grenzsoldaten <strong>und</strong> der Wiener Garnison, für <strong>die</strong><br />
Lebensmittelversorgung <strong>und</strong> <strong>die</strong> Kosten der Militärverwaltung getätigt.<br />
II-9a<br />
Rechnungsbuch des Hofkriegszahlmeisters Peter Sutter aus dem Jahre 1623<br />
Originalband, Papier, 42 x 30 cm, deut.<br />
Wien, FHKA HKA KZAB Nr. 263, fol. 1 r -2 r Einnahmenrubriken, fol. 2 v -9 r Personenindex zu den Einnahmen, fol. 1<br />
leer, fol. 2 r -173 r Einnahmen, fol. 174 leer, fol. 175 v -644 r . Ausgaben, fol. 645 r -646 v Ausgabenrubriken, fol. 647r-<br />
668 v Personalindex zu den Ausgaben, fol. 669 leer.<br />
Aus dem 17. Jahrh<strong>und</strong>ert ist uns bislang nur ein einziges komplettes Rechnungsbuch eines<br />
Hofkriegszahlmeisters bekannt. Es wurde von Peter Sutter, der das Amt in den 20er Jahren des 17.<br />
Jahrh<strong>und</strong>erts innehatte, zusammengestellt <strong>und</strong> gibt Auskunft über seine Einnahmen <strong>und</strong> Ausgaben im Jahre<br />
1623. Sutter hatte gründliche Kenntnisse im Bereich der Kriegs- <strong>und</strong> Grenzfinanzierung, weil er bereits 1604<br />
unter Kriegszahlmeister Michael Zeller ge<strong>die</strong>nt hatte <strong>und</strong> 1610 Kontrolleur 14des Nachfolgers Zellers,<br />
Joseph Niessers, war. Auch seine Einnahmen stammten aus Einkünften in Ungarn, Niederösterreich,<br />
Böhmen, Mähren <strong>und</strong> Schlesien, sowie aus päpstlicher Hilfe, machten jedoch mit 9,657,000 rheinischen<br />
Gulden eine viel beträchtlichere Summe aus als <strong>die</strong> seines Amtsvorgängers im 16. Jahrh<strong>und</strong>ert. Die<br />
Ausgaben wurden nicht nur für <strong>die</strong> Besoldung der Grenzsoldaten <strong>und</strong> ihre Versorgung mit Lebensmitteln <strong>und</strong><br />
Kriegsmaterial aufgewendet, sondern auch für <strong>die</strong> Tilgung früherer Kredite, für verschiedene Gnadengelder<br />
<strong>und</strong> Geschenke <strong>und</strong> für <strong>die</strong> Bezahlung der deutschen, ungarischen <strong>und</strong> kroatischen Truppen, <strong>die</strong> zur<br />
Verteidigung Wiens <strong>gegen</strong> den Fürsten von Siebenbürgen, Gábor Bethlen (1613-1629) angeworben worden
waren.<br />
Literatur: Sapper, 1982, S. 413-414, vgl. noch Oberleitner, 1857, S. 3-48.<br />
II-10<br />
Verzeichnis der ungarischen bzw. kroatisch-slawonischen Grenzfestungen <strong>und</strong> der Soldsummen der<br />
Grenzsoldaten an <strong>die</strong> Stände des Heiligen Römischen Reiches, 1576<br />
Originalband, Papier, 31 x 22 cm, deut.<br />
Wien, HHStA Hungarica AA Fasc. 123, Konv. A, fol. 190-213, andere zeitgenössische Abschriften: Wien, HHStA<br />
RHKl RTA Fasc. 54 a, Konv. A, fol. 107-127; HHStA MEA RTA Fasc. 72, Konv. B, fol. 185-206, ebenda Fasc. 73,<br />
Nr. 10, ebenda Fasc. 73, Nr. 125; Budapest, OSzK Kt. Fol. Germ. 1195, fol. 2-29; Nürnberg, Archiv GNM, WF<br />
Österreich ZR 7670. fol. 1-29 <strong>und</strong> ebenda fol. 356-376.<br />
Druck: Pálffy, 1995/1, 114-185.<br />
Bei der Finanzierung der Türkenabwehr in Ungarn spielte neben den österreichischen Erbländern <strong>und</strong> den<br />
Ländern der Böhmischen Krone auch das im 16. <strong>und</strong> 17. Jahrh<strong>und</strong>ert von den Kaisern aus der Familie<br />
Habsburg regierte Heilige Römische Reich eine gr<strong>und</strong>legende Rolle. Auf den Reichstagen bewilligten <strong>die</strong><br />
Reichsstände für <strong>die</strong> kaiserlichen Propositionen <strong>die</strong> sogenannte Türkenhilfe, eine Art Steuer, <strong>die</strong> nach ihrer<br />
Bemessung entsprechend eingetrieben wurde <strong>und</strong> in Abhängigkeit vom Ausmaß der Türkengefahr mehrere<br />
Millionen Gulden betrug. Ihre Maßeinheit war der Römermonat, was mit der früheren Krönung der Kaiser in<br />
Rom zusammenhing. Sie belief sich auf insgesamt 128,000 rheinische Gulden, <strong>die</strong> gleiche Summe wie der<br />
Monatssold der Soldaten, <strong>die</strong> den Kaiser nach Rom begleiteten. Zur Bewilligung der Türkensteuer mußten<br />
<strong>die</strong> Reichsstände genau über Organisation <strong>und</strong> Zustand des ungarischen Grenzfestungssystems sowie über<br />
<strong>die</strong> Soldkosten der Soldaten informiert werden. Aus <strong>die</strong>sem Gr<strong>und</strong>e stellte der Hofkriegsrat für fast jeden<br />
Reichstag Verzeichnisse über <strong>die</strong> Zusammensetzung der Soldaten in den einzelnen Grenzburgen <strong>und</strong> <strong>die</strong><br />
notwendigen Soldsummen zusammen. Das untenstehende Verzeichnis wurde für den Regensburger<br />
Reichstag von 1576 erstellt <strong>und</strong> weist Struktur <strong>und</strong> Kosten des Grenzburgnetzes für jede<br />
Grenzoberhauptmannschaft aus. In den 123 Festungen des Verteidigungssystems von der Grenze<br />
Siebenbürgens bis zur Küste der Adria <strong>die</strong>nten zu <strong>die</strong>ser Zeit – zusammen mit den Feldtruppen, <strong>die</strong> wegen<br />
der Wahl von Stephan Báthory zum polnischen König im Jahre 1576 nach Oberungarn komman<strong>die</strong>rt wurden<br />
– etwa 27,000 Soldaten, <strong>die</strong> jährlich insgesamt etwa 1,675,000 rheinische Gulden Sold bezogen. Die<br />
Türkenhilfe war also sehr vonnöten, so daß <strong>die</strong> Stände in Regensburg 60 Römermonate bewilligten.<br />
Höchster Verwalter der eingegangenen Steuern war der Reichspfennigmeister.<br />
Literatur: Müller, 1900, S. 251-304; ders., 1938; Loserth, 1938; Steglich, 1972, S. 7-55; Wessely, 1976, S. 31-55;<br />
Schulze, 1978; Pausch, 1986 <strong>und</strong> Pálffy, 1995/1.<br />
III. Armeekommandanten <strong>und</strong> Grenzobersten<br />
III-1<br />
Grabdenkmal von Leonhard Freiherr von Vels (1497-1545) im Wiener Stephansdom<br />
Fotoaufnahme aus der Sammlung der „Inschriften Kommission“ der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in<br />
Wien.<br />
Der einer Tiroler Familie entstammende Leonhard Freiherr von Vels (1497-10. November 1545) spielte in<br />
den 30er <strong>und</strong> 40er Jahren des 16. Jahrh<strong>und</strong>erts sowohl bei der Vergrößerung der ungarischen Gebiete König<br />
Ferdinands als auch bei der Organisation der Gr<strong>und</strong>lagen des Grenzverteidigungssystems eine sehr große<br />
Rolle. Nachdem er vor 1526 im Sold Kaiser Karls V. in Italien gestanden hatte, hält er sich nun fast ständig<br />
an dem ungarischen Kriegsschauplatz auf, wobei er seit 1531 zugleich dem Landeshauptmannsamt in Tirol<br />
vorstand. Zwischen 1527 <strong>und</strong> 1529 war er Oberst über das deutsche Fußvolk in Ungarn, dann in der ersten<br />
Hälfte der 30er Jahre Feldmarschall der österreichischen Truppen <strong>und</strong> schließlich mehrmals (1537-1538,<br />
1540, 1544-1545) Oberstfeldhauptmann König Ferdinands in Ungarn. Als solcher arbeitete er vorrangig an<br />
der ersten Befestigung <strong>und</strong> der Versorgung der Grenzburgen an der Donau (Gran, Komorn <strong>und</strong> Raab). 1529<br />
führte er zugleich sieben Fähnlein niederösterreichischer Fußknechte bei der Türkenbelagerung Wiens <strong>und</strong><br />
wurde mehrmals um Rat bei den Wiener Befestigungsarbeiten gebeten. Zu <strong>die</strong>ser Zeit gehörte er zu den<br />
einflußreichsten Persönlichkeiten des Wiener Hofes, da er von 1537 bis zu seinem Tode auch das Amt des<br />
Obersthofmeisters bekleidete. Sein Grabdenkmal befand sich bis 1951 am Pfeiler zwischen dem südlichen<br />
<strong>und</strong> dem mittleren Tor des Wiener Stephansdoms, ist jedoch heute in der Halle des Nordturms zu<br />
besichtigen.
Literatur: Orgler, 1859, S. 3-31; Hye-Kerkdal, 1966, S. 13-21 <strong>und</strong> Pálffy-Perger, 1998, S. 249-251.<br />
15III-2<br />
Thomas Nádasdy (1498-1562), Palatin von Ungarn<br />
Ölgemälde von Benjamin Block aus dem Ende des 16. Jahrh<strong>und</strong>ert, Fotoaufnahme.<br />
Budapest, MNM Történeti Képcsarnok.<br />
Der Politiker, Magnat, Soldat <strong>und</strong> Mäzen Thomas Nádasdy war eine der größten ungarischen<br />
Persönlichkeiten des 16. Jahrh<strong>und</strong>erts. Aus einer Familie des niederen Adels stieg er durch sein Talent, sein<br />
ausgezeichnetes diplomatisches Geschick <strong>und</strong> seine Frau, Ursula Kanizsai, in <strong>die</strong> höchste ungarische<br />
ständische Würde auf. Seinen Dienst begann er noch als Sekretär König Ludwigs (Jagello) II. (1516-1526)<br />
<strong>und</strong> erschien als dessen Gesandter im Juli 1526 auf dem Reichstag in Speyer, wo er Hilfeleistungen <strong>gegen</strong><br />
<strong>die</strong> Türken erbat. Nach der Schlacht bei Mohács war er ein treuer Anhänger König Ferdinands <strong>und</strong><br />
gleichzeitig auch dessen Burggraf zu Ofen (1527-1529), bis Sultan Süleyman I. <strong>die</strong> Burg zur Zeit seines<br />
Feldzuges <strong>gegen</strong> Wien Johann Szapolyai übergab. Von da an <strong>die</strong>nte er bis 1535 Szapolyai, wechselte dann<br />
jedoch wieder zu König Ferdinand, dem er bis zu seinem Tode im Jahre 1562 <strong>die</strong>nte. Als Banus in Kroatien<br />
<strong>und</strong> Slawonien (1537-1542) spielte er in der Verteidigung der kroatischen Gebiete eine wichtige Rolle <strong>und</strong><br />
war später mehrmals Landeshauptmann in Transdanubien (1542-1546 <strong>und</strong> 1548-1552), schließlich ab 1554<br />
Palatin des Königreichs Ungarn. In seinen beiden letztgenannten Funktionen machte er sich um <strong>die</strong><br />
Grenzverteidigung in Transdanubien <strong>und</strong> dabei in erster Linie um den Aufbau der Festungskette um<br />
Szigetvár ver<strong>die</strong>nt. Als Palatin tat er viel dafür, daß den ungarischen Ständen selbst nach Gründung des<br />
Hofkriegsrates (1556, vgl. II-1) möglichst viele ihrer militärischen Kompetenzen erhalten blieben. Sein<br />
Schloss in Sárvár (in Transdanubien) war ein Zentrum der Künste <strong>und</strong> der Kultur.<br />
Literatur: Söptei, 1998 (mit weiterer Literatur).<br />
III-3<br />
Nikolaus Zrínyi (1508-1566), der Held von Szigetvár<br />
Hans Sibmacher († 1611), 1602.<br />
Papier, Kupferstich, 15 x 11,5 cm.<br />
Budapest, HTM 5335 Kp.<br />
Der aus Kroatien stammende Nikolaus Zrínyi (kroat. Zrinski) war bis an sein Lebensende ein treuer<br />
Anhänger <strong>und</strong> einer der erfahrensten Grenzhauptleute König Ferdinands I. Bereits 1529 nahm er an der<br />
Verteidigung Wiens teil <strong>und</strong> organisierte dann <strong>die</strong> Defension der Grenze als Banus zwischen 1542 <strong>und</strong> 1556<br />
in Kroatien sowie zwischen 1561 <strong>und</strong> 1566 als Oberhauptmann von Szigetvár in Südtransdanubien. Er hatte<br />
viel Erfahrung in der Kriegsführung mit Reiterei leichterer Rüstungen, <strong>und</strong> wurde deshalb mehrfach mit der<br />
Anwerbung von Husarentruppen beauftragt. Während des siebten Feldzuges Sultan Süleymans in Ungarn im<br />
Spätsommer 1566 verteidigte er noch mit seinem letzten Tropfen Blut <strong>die</strong> ihm anvertraute Festung. Nachdem<br />
alle Lebensmittel <strong>und</strong> das gesamte Kriegsmaterial aufgebraucht waren, wagte er am 8. September 1566 mit<br />
seinen verbliebenen Soldaten einen heldenhaften Ausfall <strong>gegen</strong> <strong>die</strong> Türken, <strong>die</strong> in mehrfacher Überzahl<br />
waren. Sein Gegner, der alte Sultan, erlebte Zrínyis Heldentod jedoch nicht mehr, da er einige Tage zuvor im<br />
Belagerungslager (wahrscheinlich an der Ruhr) gestorben war.<br />
Literatur: Barabás, 1898-1899.<br />
III-4<br />
Adolf Graf zu Schwarzenberg (1551-1600)<br />
Hans Sibmacher († 1611).<br />
Papier, Kupferstich, 15 x 11,5 cm.<br />
Budapest, HTM 1542 Kp..<br />
Einer der erfolgreichsten kaiserlichen Feldherrn des „Langen Türkenkriegs“ (1593-1606) war Adolf Graf zu<br />
Schwarzenberg. Nachdem er 1572 in den Niederlanden im Sold des spanischen Königs Philipp II. unter dem<br />
Befehl von Gubernator Herzog Alba seine ersten militärischen Erfahrungen gemacht hatte, <strong>die</strong>nte er längere<br />
Zeit am Hof Herzog Ernst von Bayerns als Hofmarschall, später als Hofmeister <strong>und</strong> Hauptmann, ab 1585<br />
sogar als Generaloberst der herzoglichen Truppen. Seine Kriegserfahrungen aus den Niederlanden konnte er<br />
ab 1595 im großen Krieg <strong>gegen</strong> <strong>die</strong> Türken in Ungarn nutzen. Bei mehreren Feldzügen (1596, 1598 <strong>und</strong><br />
1599) hatte er den Posten des Oberstfeldmarschalls inne. Zwischen 1597 <strong>und</strong> 1599 war er zugleich<br />
Stadtguardia-Oberst in Wien, <strong>und</strong> sogar Hofkriegsrat. Sein Name wurde jedoch erst durch <strong>die</strong> zusammen mit
Nikolaus Pálffy (III-5) durchgeführte Zurückeroberung der Festung Raab am 29. März 1598 europaweit<br />
berühmt. Dank <strong>die</strong>ser bravourösen militärischen Aktion konnte <strong>die</strong> Kaiserstadt, <strong>die</strong> sich jahrelang in einer<br />
recht gefährlichen Lage befand, endlich aufatmen. Aus <strong>die</strong>sem Gr<strong>und</strong>e schlug Kaiser Rudolf II.<br />
Schwarzenberg am 5. Juni 1599 zum Ritter <strong>und</strong> nahm ihn in den Reichsgrafenstand auf. Lange konnte<br />
Schwarzenberg <strong>die</strong> große Anerkennung jedoch nicht genießen, da er beim Ausbruch der rebellierenden<br />
wallonischen Söldner unter der Festung von Pápa am 29. Juli 1600 einen tödlichen Kopfschuss erlitt.<br />
Literatur: Schwarzenberg, 1963, S. 104-107.<br />
16III-5<br />
Nikolaus Pálffy von Erdõd (1552-1600)<br />
Dominicus Custos (1612†).<br />
Papier, Ra<strong>die</strong>rung <strong>und</strong> Kupferstich, 20,2 x 15,5 cm.<br />
Budapest, HTM 84.44.1.<br />
Einer der größten Politiker <strong>und</strong> Feldherrn im Ungarn des ausgehenden 16. Jahrh<strong>und</strong>erts war Nikolaus Pálffy.<br />
Seine Anerkennung rührte daher, daß er am Hof der Kaiser Maximilian II. <strong>und</strong> Rudolf II. erzogen worden<br />
war <strong>und</strong> daß seine Frau Maria Fugger aus einer der bedeutendsten Bankiersfamilien Europas stammte. Als<br />
Sohn einer Familie des niederen Adels im Komitat Preßburg stieg er mit beispielloser Geschwindigkeit zu<br />
den Freiherrn <strong>und</strong> den einflußreichsten <strong>und</strong> wohlhabendsten Obersten Würdenträgern Ungarns auf. Er war<br />
Oberstkämmerer des Königreichs Ungarn (1581-1600), dann Oberst zu Komorn (1584-1589), Grenzoberst<br />
zu Neuhäusel (1589-1600) <strong>und</strong> schließlich Oberhauptmann zu Gran (1595-1600). Die Rückeroberung der<br />
türkischen Festungen im Komitat Nógrád im Winter 1593/94 unter seiner Führung war eine der<br />
erfolgreichsten militärischen Aktionen im „Langen Türkenkrieg“. Einen Ruf in Europa verschaffte er sich<br />
mit der Rückeroberung Raabs am 29. März 1598. Diesen bravourösen nächtlichen Überfall führte er<br />
<strong>gemeinsam</strong> mit Adolf Graf von Schwarzenberg (III-4) durch. Als einzigem ungarischen Aristokraten des 16.<br />
<strong>und</strong> 17. Jahrh<strong>und</strong>erts verliehen ihm auch <strong>die</strong> niederösterreichischen <strong>und</strong> böhmischen Stände ihre<br />
„Staatsbürgerschaft“ (indigenatus).<br />
Literatur: Jedlicska, 1897; ders., 1910, S. 489-492 <strong>und</strong> Galavics, 1986, S. 56-59.<br />
III-6<br />
Giorgio Basta (1544-1607)<br />
Papier, Kupferstich.<br />
Druck: Veress, 1909, Titelblatt.<br />
In einer Familie albanischer Herkunft in Italien geboren, wurde Giorgio Basta zu einem der bedeutendsten<br />
kaiserlichen Feldherren um <strong>die</strong> Wende des 16. <strong>und</strong> 17. Jahrh<strong>und</strong>erts. In den Niederlanden begann er im Sold<br />
des spanischen Königs Philipp II. neben seinem Vater <strong>und</strong> später seinem älteren Bruder den Soldatenberuf zu<br />
erlernen. Hier <strong>die</strong>nte er in immer höheren Positionen bis 1597, als er auf Empfehlung des Gubernators in den<br />
Niederlanden, Erzherzog Albrecht, an den ungarischen Kriegsschauplatz komman<strong>die</strong>rt wurde. Im Feldzug<br />
von 1597 war er bereits Oberstfeldmarschallleutnant <strong>und</strong> ein Jahr später General über <strong>die</strong> geringe Reiterei<br />
<strong>und</strong> Generalfeldzeugmeister. Eine besonders große Rolle übernahm er in den Feldzügen in Oberungarn <strong>und</strong><br />
in Siebenbürgen. Dank seiner Erfolge ernannte ihn Kaiser Rudolf II. zum Feldobersten in Oberungarn (1599-<br />
1601), dann zum Gubernator in Siebenbürgen (1602-1604). Die Vereinigung des Königreichs Ungarn <strong>und</strong><br />
Siebenbürgens konnte er jedoch vor allem aus finanziellen Gründen nur für kurze Zeit sichern. Angesichts<br />
seiner militärischen Ver<strong>die</strong>nste wurde er 1605 sowohl in den Herrenstand als auch in den Reichsgrafenstand<br />
aufgenommen. Über seine Tätigkeit als Feldherr hinaus hat er auch auf dem Gebiet der Kriegswissenschaften<br />
Wertvolles geleistet. In seinen in italienischer Sprache erschienenen Werken (Il maestro di campo generale<br />
1606 <strong>und</strong> Governo della cavalleria leggiera 1612) fasste er seine praktischen Erfahrungen von den<br />
ungarischen Kriegsschauplatzen zusammen.<br />
Literatur: Veress, 1909-1913 <strong>und</strong> Jähns, 1890, S. 927-930.<br />
III-7<br />
Raim<strong>und</strong>o Montecuccoli (1609-1680)<br />
Papier, Kupferstich.<br />
Commentarii bellici Raym<strong>und</strong>i Principis Montecuccoli. Wien, 1718.<br />
Raim<strong>und</strong>o Montecuccoli gehörte zu den Feldherren <strong>und</strong> Kriegswissenschaftlern der zweiten Hälfte des 17.<br />
Jahrh<strong>und</strong>erts, <strong>die</strong> eine europäische Bedeutung erlangten. Nach langen Dienstjahren (seit 1635 Oberst, 1642-
1644 Generalfeldwachtmeister, 1644-1658 Feldmarschallleutnant, seit 1645 Hofkriegsrat, 1645-1646<br />
Kommandant in Schlesien, seit 1648 General über <strong>die</strong> Kavallerie, seit 1658 Feldmarschall, seit 1659<br />
Geheimrat) stieg er vom einfachen Musketier zum Präsidenten des Wiener Hofkriegsrates auf. In Ungarn war<br />
er von 1660 bis zu seinem Tode Raaber Grenzoberst, wobei er 1661 <strong>und</strong> 1662 als Armeekommandant in<br />
Oberungarn <strong>die</strong>nte <strong>und</strong> in der Schlacht bei Szentgotthárd-Mogersdorf am 1. August 1664 war er<br />
Oberbefehlshaber der ganzen kaiserlichen Armee in Ungarn. Seine überwiegend italienischsprachigen Werke<br />
über <strong>die</strong> wichtigsten Probleme des damaligen Kriegswesens (wie z.B. stehendes Heer, Festungsarchitektur,<br />
Versorgung der Armee usw.) sichern ihm einen vornehmen Platz unter den Klassikern der<br />
Kriegswissenschaften.<br />
Literatur: Montecuccoli, 1980 (mit weiterer vielen Literatur).<br />
III-8<br />
Nikolaus Zrínyi (1620-1664)<br />
Lucas Schmitzer.<br />
Papier, Kupferstich, 20,5 x 11,5 cm.<br />
Budapest HTM 6604 Kp.<br />
Nikolaus Zrínyi war der bedeutendste ungarische Feldherr im 17. Jahrh<strong>und</strong>ert. Sein gleichnamiger<br />
Urgroßvater starb 1566 bei Szigetvár den Heldentod (III-3). Nach seinen Stu<strong>die</strong>n in Graz, Wien, Tyrnau <strong>und</strong><br />
Italien übernahm er im Kampf 17<strong>gegen</strong> <strong>die</strong> Türken an der Grenze eine Rolle. Von 1640 bis zu seinem Tode<br />
war er Oberhauptmann der Murinsel <strong>und</strong> seit 1647 zugleich Banus in Kroatien. Mit ungarischen <strong>und</strong><br />
kroatischen Husaren nahm er auch mehrmals an den Manövern des Dreißigjährigen Krieges (1618-1648)<br />
teil. In Anerkennung seiner Dienste ernannte ihn Ferdinand III. in den 40er Jahren des 17. Jahrh<strong>und</strong>erts zum<br />
Geheimrat <strong>und</strong> Generalfeldwachtmeister. Sein Name wurde durch den Türkenkrieg zwischen 1660 <strong>und</strong> 1664<br />
europaweit berühmt, da er 1661 am linken Murufer <strong>die</strong> Festung Zrínyi-Újvár (Serinwar) auf, was bei den<br />
Osmanen große Empörung hervorrief <strong>und</strong> setzte 1664 <strong>die</strong> Schiffsbrücke von Esseg (Eszék) in Brand, <strong>die</strong> <strong>die</strong><br />
Nachschublinie der Türken sichern sollte. Auch als Kriegswissenschaftler <strong>und</strong> Poet gehörte er zu den<br />
hervorragendsten ungarischen Persönlichkeiten. Er schrieb mehrere kriegswissenschaftliche Abhandlungen,<br />
<strong>und</strong> seine Obsidio Sigetiana (1647-1648), <strong>die</strong> vom Heldentod seines Urgroßvaters berichtet, stellt eines der<br />
ältesten <strong>und</strong> schönsten Epen der ungarischen Literatur dar.<br />
Literatur: Széchy, 1896-1902; Klaniczay, 1964; Perjés, 1965; ders., 1989 <strong>und</strong> Zrínyi Miklós hadtudományi munkái,<br />
1976.<br />
IV. Versorgung <strong>und</strong> Festungsbau<br />
IV-1<br />
Bericht des Festungsbaumeisters Urban Süeß an den Wiener Hofkriegsrat über <strong>die</strong> Befestigungen der<br />
Grenzburgen zwischen der Donau <strong>und</strong> der Drau, 1. Februar 1572, Raab<br />
Original, Papier, 32 x 21 cm, deut.<br />
Wien, KA HKR Akten Exp. 1572 Mai Nr. 77, fol. 1-11.<br />
Der stufenweise Ausbau <strong>und</strong> <strong>die</strong> spätere Modernisierung des Defensionssystems machten zu jeder Zeit<br />
genaue Informationen über Zustand <strong>und</strong> Probleme der einzelnen Festungen notwendig, so daß man über<br />
Nachrichten von Grenzobersten <strong>und</strong> Burghauptleuten hinaus auch Grenzfestungsvisitationen durchführen<br />
mußte. Die vom Hofkriegsrat entsandten Kommissare (in der Regel Offiziere, Festungsbaumeister <strong>und</strong><br />
andere Experten) überprüften dabei den Zustand der Burgbefestigungen, untersuchten <strong>die</strong> Schwierigkeiten<br />
bei der Versorgung der Soldaten <strong>und</strong> machten Vorschläge für <strong>die</strong> Beseitigung von Mängeln. Auf ähnliche<br />
Weise wurden aufgr<strong>und</strong> solcher Grenzbereitungen Berichte über <strong>die</strong> Bedeutung der einzelnen<br />
Grenzoberhauptmannschaften geschrieben oder Karten über <strong>die</strong> Grenzgebiete selbst gezeichnet (s. z.B. I-7,<br />
I-9 <strong>und</strong> I-9a). Die Teilnehmer der Grenzvisitationen mußten vor allem auch Inventare über Kriegsmaterial-<br />
<strong>und</strong> Lebensmittelvorräte aufstellen, weiterhin <strong>die</strong> Festungen vermessen, ja sogar zeichnen, sowie <strong>die</strong><br />
notwendigen Modernisierungspläne <strong>und</strong> deren Budget aufstellen. Eine solche wichtige Untersuchung der<br />
Festungen zwischen Donau <strong>und</strong> Drau fand von Ende 1571 bis Anfang 1572 statt. Dabei suchte eine<br />
vielköpfige Kommission unter Leitung des Raaber Grenzoberhauptmanns (1560-1574) Eck Graf zu Salm<br />
<strong>und</strong> Neuburg in Begleitung von 100 Reitern von Raab aus alle königlichen <strong>und</strong> privat-gr<strong>und</strong>herrschaftlichen<br />
Burgen am Nordufer des Plattensees <strong>und</strong> in der Gegend des Flusses Zala auf. Aufgr<strong>und</strong> <strong>die</strong>ser Untersuchung<br />
sollte in Wien entschieden werden, welche Festungen auch in der Zukunft befestigt oder mit einer
Besatzungsmannschaft versehen werden mußten. Unter den Kommissaren befand sich auch der italienische<br />
Festungsbaumeister Giulio Turco, der Gr<strong>und</strong>risse <strong>und</strong> Profilzeichnungen bzw. Befestigungspläne für <strong>die</strong><br />
einzelnen Burgen anzufertigen hatte. Von <strong>die</strong>sen sind bis heute etwa zwei Dutzend in der Kartensammlung<br />
des Kriegsarchivs in Wien erhalten geblieben (s. vier Beispiele: IV-1a, b, c <strong>und</strong> IV-12).<br />
Literatur: Pálffy, 1999/2, S. 202-203 (mit weiterer Literatur ebenda Anm. 11.).<br />
IV-1a<br />
Plan <strong>und</strong> Profilzeichnung der Grenzburg Szentmárton (Sankt Martin, heute Pannonhalma), 1572<br />
Original, Papier, 31 x 21 cm, ital.<br />
Wien, KA Kartensammlung G VII 187.<br />
IV-1b<br />
Plan <strong>und</strong> Profilzeichnung der Grenzburg Csesznek, 1572<br />
Original, Papier, 29,5 x 21 cm, ital.<br />
Wien, KA Kartensammlung G VII 17-430.<br />
IV-1c<br />
Plan <strong>und</strong> Profilzeichnung der Burg des Bischofs von Veszprém, Sümeg, 1572<br />
Original, Papier, 30,5 x 21 cm, ital.<br />
Wien, KA Kartensammlung G VII 1205.<br />
IV-2<br />
Hauptrelation der Kommissare an Kaiser Leopold I. über <strong>die</strong> Visitation der kroatischen <strong>und</strong><br />
slawonischen Grenzfestungen, 1. März 1658, Graz<br />
18Konzept, Papier, 32 x 21 cm, deut.<br />
Wien, IHKR Akten Vindica 1658 März Nr. 22, fol. 1-30, andere wichtige, noch une<strong>die</strong>rte Akten über <strong>die</strong><br />
Grenzbesichtigung: ebenda 1657 Juni Nr. 18, fol. 1-6, bzw. 1658 März Nr. 26, fol. 1-18, KA HKR Akten Exp. 1657<br />
Febr. Nr. 152, unfoliert (24. Januar 1657, Graz), bzw. das e<strong>die</strong>rte Quellenmaterial: Krompotic, 1997, S. 1-72. <strong>und</strong><br />
304-337.<br />
Im Januar 1657 suchte eine vielköpfige Kommission unter Leitung des Präsidenten des Innerösterreichischen<br />
Hofkriegsrates (1650-1661) Wilhelm Leopold Graf zu Reinstein <strong>und</strong> Tattenbach <strong>und</strong> des späteren<br />
Vizepräsidenten der Innerösterreischen Kammer (1661-1688) Johann Andreas Freiherr von Zehentner <strong>die</strong><br />
Kroatische <strong>und</strong> <strong>die</strong> Slawonische (Windische) Grenze sowie <strong>die</strong> Festungen <strong>und</strong> Städte entlang der steirischen<br />
Grenze (Graz, Hardberg, Fürstenfeld, Feldbach, Radkersburg <strong>und</strong> Pettau) auf. Über <strong>die</strong> Inventur der<br />
Kriegsmaterialvorräte hinaus wurde auch der Zustand der Befestigungen gründlich untersucht. Dabei<br />
unterstützte sie Oberingenieur Martin Stier (s. I-1), der <strong>die</strong> Gr<strong>und</strong>risse der einzelnen Burgen sowie <strong>die</strong><br />
notwendigen Modernisierungspläne erstellte <strong>und</strong> auch je einige Karten über das System der kroatischen bzw.<br />
der slawonischen Grenzfestungen <strong>und</strong> der zwischen ihnen liegenden Wachthäuser zeichnete. Durch <strong>die</strong><br />
Burgvisitation sollte also <strong>die</strong> Funktionsweise des Grenzschutzes, der während der langen Friedensperiode<br />
verfallen war, effektiviert werden. Die <strong>die</strong>sbezüglichen Vorschläge der Kommission wurden sowohl in Wien<br />
als auch in Graz monatelang diskutiert, bis <strong>die</strong> Hauptrelation im März 1658 Kaiser Leopold I. eingereicht<br />
wurde.<br />
Literatur: Laszowski, 1908; Krompotic, 1997, passim <strong>und</strong> Pálffy, 2000/1, S. 60-76.<br />
IV-3<br />
Verzeichnis der verschiedenen Kanonen, <strong>die</strong> aus dem Wiener kaiserlichen Hauptzeughaus in <strong>die</strong><br />
ungarischen Grenzfestungen geliefert wurden, 1593-1594<br />
Original, Papier, 33 x 22 cm, deut.<br />
Wien, FHKA HKA NÖHA rote Nr. 300/2, fol. 1062-1065.<br />
Bei der Versorgung der Grenzfestungen in Ungarn mit Kriegsmaterial spielte das kaiserliche Hauptzeughaus<br />
in Wien <strong>die</strong> wichtigste Rolle, während das Landeszeughaus in Graz für den Nachschub an <strong>die</strong> Kroatische <strong>und</strong><br />
<strong>die</strong> Slawonische Grenze sorgte. Da der überwiegende Teil der Feuerwaffen sowie ein bedeutender Teil des<br />
Kriegsmaterials für <strong>die</strong> ungarische Grenzverteidigung aus dem Heiligen Römischen Reich, Tirol <strong>und</strong><br />
Böhmen gesichert werden mußte, wurde <strong>die</strong> vom Oberstzeugmeister (II-5b) von <strong>die</strong>sen Gebieten bestellte<br />
Kriegsausrüstung zuerst dorthin geliefert <strong>und</strong> von dort aus auf <strong>die</strong> einzelnen Grenzfestungen verteilt. Diese<br />
Nachschubpraxis wird durch das untenstehende Verzeichnis bezüglich der Anfangsperiode des „Langen<br />
Türkenkriegs“ sehr gut illustriert. Aus der Liste geht hervor, dass <strong>die</strong> Mehrheit der Kanonen aus den
österreichischen Ländern (aus Innsbruck <strong>und</strong> Salzburg) <strong>und</strong> aus dem Reich (vor allem aus Nürnberg,<br />
Augsburg <strong>und</strong> Ulm) kam, während ein Großteil des Schießpulvers aus Wiener Neustadt, Innsbruck,<br />
Augsburg, Nürnberg, Regensburg, Passau bzw. aus Württemberg, Prag, Iglau, Olmütz, Brünn <strong>und</strong> Breslau<br />
angeschafft <strong>und</strong> dann in <strong>die</strong> Grenzfestungen bzw. das kaiserliche Lager weiter befördert wurden. Weitere<br />
bedeutende Lieferungen führte auch der namhafte Reichspfennigmeister Zacharias Geizkofler aus <strong>und</strong> ein<br />
großer Schießpulvertransport kam sogar aus der Lausitz an.<br />
Literatur: Pichler-Meran, 1880; Szendrei, 1888; Iványi, 1926-1928; Müller, 1900, S. 251-304; ders., 1938; Egg, 1961;<br />
Krenn, 1974; ders., o. J.; Valentinitsch, 1977; ders., o. J. <strong>und</strong> Pálffy, 1995/2.<br />
IV-4<br />
Kaliber-Druchmesser zu den Kanonen, <strong>die</strong> von Wien aus nach Szigetvár geliefert werden sollten,<br />
Januar 1558<br />
Original, Papier, 32 x 20 cm, deut.<br />
Wien, KA AFA 1558/1/ad 2.<br />
Bevor <strong>die</strong> Artillerie im 18. Jahrh<strong>und</strong>ert eine eigene Waffengattung wurde, war das Kaliber der verschiedenen<br />
Geschütze nicht streng geregelt. Dies bedeutete, daß das Kaliber nicht in den zeitgenössischen Längenmaßen<br />
angegeben wurde, sondern aufgr<strong>und</strong> des Gewichts der unterschiedlichen (eisernen, bleiernern oder<br />
steinernen) Kugeln, <strong>die</strong> von einer Kanone abgefeuert werden konnten. Da das Kaliber jedoch auch auf <strong>die</strong>se<br />
Weise von der Qualität des Eisens, des Bleis oder des Steins abhing, stellte <strong>die</strong>s auch keine sichere Methode<br />
dar. So kam es oft vor, daß <strong>die</strong> Kugel, <strong>die</strong> zu einer bestimmten Kanone gehörte, gezeichnet wurde <strong>und</strong> der<br />
Nachschub aufgr<strong>und</strong> <strong>die</strong>ser Zeichnung bestellt wurde. Auf <strong>die</strong>se Weise bestellten <strong>die</strong> königlichen<br />
Kommissare, <strong>die</strong> <strong>die</strong> Mängel der Festung von Szigetvár im Jahre 1558 in Südtransdanubien untersuchten,<br />
verschiedene Kugeln von dem Wiener Zeugwart Hans von Diskau.<br />
Literatur: Iványi, 1926-1928; Schmidtchen, 1977 <strong>und</strong> Timár, 1989.<br />
IV-5<br />
Inventar des Kriegsmaterials der windischen Grenzfestungen, Weitschawar (Bajcsavár), 24. August<br />
1581, Graz<br />
Original, Papier, 31 x 21 cm, deut.<br />
Wien, KA, IHKR Akten, Vindica 1581 Aug. Nr. 17, fol. 31-64, Weitschawar: fol. 50 r -53 v .<br />
Als Zentrum einer eigenen Grenzhauptmannschaft gehörte <strong>die</strong> auf Kosten der steirischen Stände 1578<br />
südlich von Kanizsa erbaute Festung Weitschawar zur Windischen Grenze. Da für ihre Versorgung der 1578<br />
aufgestellte Innerösterreichische Hofkriegsrat zuständig war, wurde <strong>die</strong> Kriegsmaterialversorgung der<br />
Festung nicht aus dem Wiener Hauptzeughaus, 19sondern aus dem Grazer Landeszeughaus gesichert. Das<br />
untenstehende Inventar wurde im August 1581 bei der Visitation der ganzen Slawonischen-<br />
Weitschawarischen Grenzoberhauptmannschaft aufgestellt, wobei Kriegsmaterialvorräte <strong>und</strong> Mängel aller<br />
Festungen registriert wurden.<br />
Literatur: Pichler-Meran, 1880; Roth, 1970; Krenn, 1974 <strong>und</strong> Valentinitsch, o. J.<br />
IV-5a<br />
Italienisches Trinkglas aus der Grenzfestung Weitschawar, 1578-1600<br />
Original, Achat, H: 20 cm, Fotoaufnahme.<br />
Bajcsa - Vár, archäologische Ausgrabungen 2000.<br />
Literatur: Roth, 1970; Vándor, 1997. S. 27-30 <strong>und</strong> ders., 1998, S. 101-109.<br />
IV-5b<br />
Österreichischer Krug aus der Grenzfestung Weitschawar mit einer Medaillonschmückung, 1578-1600<br />
Original, Ton, H: 26,5 cm, Fotoaufnahme.<br />
Bajcsa - Vár, archäologische Ausgrabungen 1999.<br />
IV-5c<br />
Besteck mit einem Trinkglas aus Österreich oder Italien bzw. mit einem steirischen Messer aus der<br />
Grenzfestung Weitschawar, 1578-1600<br />
Original, Teller Ø: 16,5 cm, Krug H: 18 cm, Trinkglas H: 12,5 cm <strong>und</strong> Messer L: 21 cm, Fotoaufnahme.
Bajcsa - Vár, archäologische Ausgrabungen 1999-2000.<br />
IV-6<br />
Profilzeichnung <strong>und</strong> Gr<strong>und</strong>risse des Neubaus des Zeughauses zu Szatmár, 1667, Ingenieur <strong>und</strong><br />
Festungsbaumeister Lucas Georg Ssicha<br />
Original, Papier, 31 x 20,5 cm; Profilzeichnung: 17,5 x 16 cm, Gr<strong>und</strong>riß des Erdgeschosses: 15,5 x 12,5 cm, Gr<strong>und</strong>riß<br />
des ersten Geschosses: 15,3 x 12,8 cm, lat.<br />
Budapest, MOL E 211 MKA Lymbus Series II, Tétel XL, fol. 249-252. Vgl. andere Gr<strong>und</strong>risse aus dem Jahre 1662:<br />
Wien, FHKA HKA Kartensammlung R a 294/1-2 (Original, Papier, Gr<strong>und</strong>riß des Erdgeschosses: 40,5 x 30,2 cm,<br />
Gr<strong>und</strong>riß des ersten Geschosses: 40 x 31 cm, deut.), Beilage zum Bericht des oberungarischen Proviantdirektors<br />
Matthias Senkviczy an <strong>die</strong> kaiserlichen Räte am Preßburger Landtag., 2. August 1662, Szatmár (Wien, FHKA HKA<br />
HFU rote Nr. 213, 1662 Aug. fol. 171-172 <strong>und</strong> 179-180, zeitgenössische Abschrift).<br />
Die wichtigeren Festungen, in erster Linie <strong>die</strong> Zentren der Grenzoberhauptmannschaften (wie z.B. Kaschau,<br />
Neuhäusel, Komorn <strong>und</strong> Szatmár) <strong>die</strong>nten auch als kleinere Produktions- <strong>und</strong> Lagerstätten von<br />
Kriegsmaterial. In ihren Zeughäusern wurden <strong>die</strong> Geschütze <strong>und</strong> <strong>die</strong> Munition aus dem Wiener<br />
Hauptzeughaus gelagert <strong>und</strong> in <strong>die</strong> kleineren Festungen geliefert. Außerdem wurden hier beschädigte Waffen<br />
repariert sowie Schießpulver <strong>und</strong> verschiedene Feuerwerke hergestellt. In dem Zeughaus zu Kaschau wurden<br />
darüber hinaus auch Kanonen in großer Zahl gegossen <strong>und</strong> sogar Schiffe für den Fluß Theiß gebaut. In den<br />
60er Jahren des 17. Jahrh<strong>und</strong>erts wurde ein Großteil der Zeughäuser in Ungarn im Einklang mit der<br />
militärischen Entwicklung der Zeit modernisiert. So kam es auch zum Entwurf des Um- <strong>und</strong><br />
Neugestaltungsplans des Zeughauses zu Szatmár, eine anschauliche Arbeit eines der bekanntesten Ingenieure<br />
in Ungarn, Lukas Georg Ssicha.<br />
Literatur: Szendrei, 1896, S. 315-317: Nr. 2621 (ähnliche Profilzeichnung des Zeughauses zu Kaschau von Ingenieur<br />
Ssicha); Pichler-Meran, 1880; Krenn, 1974; Schmidtchen, 1977, S. 169-196; Neumann, 1992 <strong>und</strong> Pálffy, 1995/2.<br />
IV-7<br />
Plan eines neuerdachten Kriegsinstruments, vor Februar 1644, Jakob Stumb Bürger <strong>und</strong> Tischler zu<br />
Schemnitz <strong>und</strong> Jakob Schmitzl Hofschloßer von Palatin Nikolaus Esterházy<br />
Original, Papier, 32 x 20 cm, deut.<br />
Wien, KA HKR Akten Exp. 1644 Febr. Nr. 185, fol. 2.<br />
Der ständige Kampf <strong>gegen</strong> <strong>die</strong> Türken trug zur Entwicklung der Kriegsmaterialherstellung <strong>und</strong> zur<br />
Entstehung verschiedener technischer Neuerungen bei. Ein solches neues Kriegsinstrument, einen speziellen,<br />
mit 32 Gewehren ausgerüsteten Kriegswagen, der zum Transport von Lebensmitteln <strong>und</strong> Munition geeignet<br />
war, entwarf Jakob Stumb, Bürger zu Schemnitz, zusammen mit dem Hofschlosser von Palatin Ungarns<br />
(1525-1645) Nikolaus Esterházy, Jakob Schmitzl. Darüber jedoch, ob <strong>die</strong> an den Hofkriegsrat eingereichte<br />
Neuerung auch tatsächlich verwirklicht wurde, stehen uns keine Informationen zur Verfügung.<br />
20IV-8<br />
Plan der Festung <strong>und</strong> Proviantmühle in Totis (Tata), 1586<br />
Original, Aquarell, Papier, 59 x 85,5 cm, deut.<br />
Wien, FHKA HKA Kartensammlung O 267, Beilage zu den Akten in ebenda HKA HFU rote Nr. 51, 1586 März fol. 8-<br />
26.<br />
Das Mehl, das <strong>die</strong> Soldaten zum Backen ihres Brotes benötigten, wurde in den Mühlen unweit der Burgen<br />
gemahlen. Im Falle einiger größeren Burgen bauten <strong>die</strong> Soldaten entweder selber Mühlen, oder sie brachten<br />
<strong>die</strong>se – teils legal, teils illegal – unter ihren Einfluß. Die neben der südlich von Komorn gelegenen Festung<br />
Totis stehende <strong>und</strong> von den Türken in Brand gesteckte Mühle wurde von Burghauptmann Georg Christoph<br />
Rosenberg (1574-1586) mit kaiserlicher Genehmigung im Jahre 1579 neuerrichtet. Sie <strong>die</strong>nte in erster Linie<br />
der Verproviantierung der Burgsoldaten. Nach dem Tod von Rosenberg wollte Rudolf II. den Erben <strong>die</strong><br />
Mühle um 250 Gulden ablösen. Sie willigten aber nicht ein. Der neue Oberhauptmann Georg Paksy (1586-<br />
1594) regte bei Erzherzog Ernst am 1. Februar 1587 <strong>die</strong> Erbauung einer neuen Mühle in der Burg an. Die<br />
Hofkammerräte in Wien <strong>und</strong> <strong>die</strong> Niederösterreichische Kammer unterstützten den Plan, dem am 4. März<br />
auch der Kaiser seine Zustimmung gab.<br />
Literatur: Takáts, 1915, Bd. 2, S. 440; Bíró, 1966, S. 311-324 <strong>und</strong> Schallaburg, 1982, S. 375.<br />
IV-8a<br />
Plan eines Provianthauses in Oberungarn, August 1662<br />
Original, Papier, 30,5 x 41 cm, deut.
Wien, FHKA HKA Kartensammlung R a 293, Beilage zum Bericht des oberungarischen Proviantdirektors Matthias<br />
Senkviczy an <strong>die</strong> kaiserlichen Räte am Preßburger Landtag., 2. August 1662, Szatmár (Wien, FHKA HKA HFU rote<br />
Nr. 213, 1662 Aug. fol. 171-172 <strong>und</strong> 179-180, zeitgenössische Abschrift).<br />
In den größeren Grenzfestungen wurden zum Lagern der Lebensmittel (Getreide, Mehl, Fleisch, Wein, Salz<br />
usw.) bereits Mitte des 16. Jahrh<strong>und</strong>erts Provianthäuser eingerichtet, <strong>die</strong> der Aufsicht der Proviantmeister<br />
unterstanden (vgl. II-5a). Diese Gebäude hatten meistens einen Stein- oder Holzboden, oft auch mehrere<br />
Stockwerke <strong>und</strong> einen Keller. Laut Instruktionen für <strong>die</strong> Burghauptmänner waren Lebensmittelreserven für<br />
mindestens sechs Monate vorgeschrieben, <strong>die</strong>s wurde jedoch selten eingehalten. An einigen Orten wurden in<br />
den Provianthäusern oder in deren unmittelbarer Nähe Backhäuser eingerichtet. Die Bäcker gehörten dem<br />
Personal der Proviantmeister (Müller, Metzger, Kellermeister usw.) an. In den 60er Jahren des 17.<br />
Jahrh<strong>und</strong>erts wurden – ähnlich der Zeughäuser (vgl. IV-6) – an zahlreichen Orten des Landes neue, in der<br />
Epoche bereits als modern geltende Gebäude errichtet. Ein Plan eines solchen Provianthauses<br />
(wahrscheinlich für <strong>die</strong> Festung Szatmár), der vom Sommer des Jahres 1662 datiert, ist uns erhalten<br />
geblieben. Das Provianthaus sollte <strong>die</strong> Versorgung der hinbestellten deutschen Truppeneinheiten<br />
sicherstellen.<br />
IV-8b<br />
Proviantordnung für <strong>die</strong> oberungarischen Grenzfestungen, 1570, Niklas Graf zu Salm <strong>und</strong> Neuburg<br />
<strong>und</strong> Franz von Poppendorf<br />
Original, Papier, 31 x 20 cm, lat.<br />
Wien, FHKA HKA VUG rote Nr. 35, fol. 1196-1197.<br />
Dem Hofkriegsrat bereitete bei der Lebensmittelversorgung der Grenzsoldaten in erster Linie <strong>die</strong> Versorgung<br />
der deutschen Söldner große Schwierigkeiten. Die ungarischen Soldaten nutzten <strong>die</strong> günstigen<br />
landwirtschaftlichen Gegebenheiten aus <strong>und</strong> kamen bald in Besitz von Landgütern in der Nachbarschaft ihrer<br />
Burg, dadurch konnten sie sich auch zu schlechten Zeiten versorgen. Fremden Soldaten bot sich <strong>die</strong>se<br />
Möglichkeit nicht. Die wichtigste Aufgabe der in den Grenzfestungen angestellten Proviantmeister war daher<br />
<strong>die</strong> Versorgung Letzterer mit Brot, Fleisch, Wein <strong>und</strong> Salz – teils aus der Grenzburgherrschaft selbst, teils<br />
durch Anschaffung. Um zu vermeiden, daß <strong>die</strong> Bevölkerung <strong>die</strong> Preise in <strong>die</strong> Höhe treibt, wurden von den<br />
vom Hofkriegsrat entsandten Kommissaren oder von den Grenzobersten Proviantordnungen erlassen, in<br />
denen <strong>die</strong> Höchstpreise festgelegt wurden. Dies geschah auch 1570, als in der Person von Niklas Graf zu<br />
Salm <strong>und</strong> Neubug (†1580) <strong>und</strong> Franz von Poppendorf zwei Kommissare Kaiser Maximilians II. in<br />
Oberungarn <strong>die</strong> Preisgrenze festlegten.<br />
Literatur: Steinwenter, 1913, S. 51-84.<br />
IV-9<br />
Instruktion von Erzherzog Ernst für Erasmus Braun Oberstbaukommissar der Grenzfestungen in<br />
Ungarn, 15. Januar 1587, Wien<br />
Konzept, Papier, 32,5 x 21 cm, deut.<br />
Wien, KA HKR KlA VI 7.<br />
Ab den 50er Jahren des 16. Jahrh<strong>und</strong>erts wurde der Festungsbau in den einzelnen<br />
Grenzoberhauptmannschaften, wie auch in Wien, von professionellen Bausuperintendenten geleitet: Sie<br />
koordinierten <strong>die</strong> Arbeit der italienischen Festungsbaumeister <strong>und</strong> Meister (Palliers, Steinmetzen, Ziegler<br />
usw.) an den Burgen. Nach unseren bisherigen Kenntnissen wurde im Jahre 1569 in Wien zur Aufsicht<br />
sämtlicher Festungsbautätigkeit in Ungarn bzw. zur Führung der damit in Verbindung stehenden Geschäfte<br />
das Amt des Oberstbaukommissaren eingeführt. Im 16. <strong>und</strong> 17. Jahrh<strong>und</strong>ert bekleideten vor allem deutsche<br />
<strong>und</strong> italienische Oberoffiziere <strong>und</strong> Baumeister <strong>die</strong>sen wichtigen Posten, <strong>die</strong> ihrem Auftrag im Sinne der<br />
Anordnung (s.u.) nachkamen. Erasmus Braun († 1594) war Oberoffizier, der zuvor als Oberhauptmann zu<br />
Ungarisch 21Altenburg (Magyaróvár) (1574-1583), dann als Grenzoberst zu Kanizsa (1581-1582) ge<strong>die</strong>nt<br />
hatte <strong>und</strong> ab 1583 wirklicher Hofkriegsrat war.<br />
Literatur: Pataki, 1931 <strong>und</strong> Koppány, 1997, S. 153-177.<br />
IV-10<br />
Architectura von Vestungen von Daniel Speckle, 1589, Straßburg<br />
Wien, Bibliothek des Österreichischen Staatsarchivs Fb 23.<br />
Der in Straßburg geborene Daniel Speckle (oder Specklin, †1589) war einer der herausragendsten<br />
europäischen Experten des Festungsbauwesens, das im Laufe des 16. Jahrh<strong>und</strong>erts eine intensive
Entwicklung erlebte. 1576 wurde er zum Baumeister seiner Geburtsstadt, im Laufe seines Lebens lernte er<br />
jedoch nahezu das ganze Reich kennen: er arbeitete an den Festungen in Düsseldorf, Regensburg <strong>und</strong> Wien.<br />
Nach den neuesten Forschungen soll er sogar in Ungarn, beim Bau der Burg von Komorn mitgewirkt haben.<br />
In erster Linie läßt es sich damit erklären, daß in seinem Buch (Architectura von Vestungen), das im Jahre<br />
seines Todes 1589 erschienen war, der Gr<strong>und</strong>riß von Komorn zu finden ist. Hinsichtlich seiner Konzeptionen<br />
des Festungsbaus war Speckle seiner Zeit weit voraus. Sein Werk wurde in mehrere Sprachen übersetzt <strong>und</strong><br />
öfters herausgegeben (Straßburg 1608 <strong>und</strong> Dresden 1746) <strong>und</strong> übte im 17. Jahrh<strong>und</strong>ert bedeutenden Einfluß<br />
aus.<br />
Literatur: Jähns, 1889, Bd. I, S. 822-831; Neumann, 1988 <strong>und</strong> Pollak, 1991, besonders S. 94-96.<br />
IV-11<br />
Plan der Grenzfestung Raab, 1561<br />
Original, Papier, 42 x 57 cm, deut.<br />
Wien, FHKA HKA Kartensammlung M 23/1.<br />
Raab (Gyõr) wurde ab den 40er Jahren des 16. Jahrh<strong>und</strong>erts zu einem der wichtigsten Schlüssel des<br />
ungarischen Türkenabwehrsystems <strong>und</strong> gleichzeitig zur Vorbastei von Wien. Daher wurde <strong>die</strong> Ausstattung<br />
der Burg mit einer starken Besatzung (etwa 1500 Mann) <strong>und</strong> ihr Ausbau zu einer modernen Festung<br />
unbedingt <strong>und</strong> ohne Versäumnis nötig. Der Bau wurde durch eine Burgbesichtigung Anfang September 1555<br />
möglich: Laut Plan wurde <strong>die</strong> Burg des Bischofs von Raab mit dem darunter gelegenen Kapitel-<br />
Marktflecken zu einem einheitlichen Abwehrsystem zusammengezogen, das Straßennetz so umstrukturiert,<br />
daß es gut kontrollierbar wurde, d.h. <strong>die</strong> Burg <strong>und</strong> <strong>die</strong> Stadt wurde zu einer einzigen Festung, genauer gesagt<br />
zu einer Festungsstadt ausgebaut – wie <strong>die</strong>s teils schon auf dem Gr<strong>und</strong>riß aus dem Jahre 1561 gut ersichtlich<br />
ist. Sowohl bei der Planung, als auch bei der Umsetzung kam den italienischen Festungsbaumeistern<br />
Francesco Benigno <strong>und</strong> Pietro Ferabosco eine bedeutende Rolle zu, <strong>die</strong> <strong>die</strong> Entwürfe gemäß den modernen<br />
italienischen Baumethoden der Epoche, aber den örtlichen Gegebenheiten angepasst ausarbeiteten. Ihre<br />
Arbeit übernahm in den 70er-80er Jahren des 16. Jahrh<strong>und</strong>erts Bausuperintendent Urban Süeß. Zwischen<br />
1565 <strong>und</strong> 1580 stimmten allein <strong>die</strong> niederösterreichischen Stände dem Festungsbau von Raab eine Förderung<br />
in der Höhe von 198,500 rheinische Gulden zu.<br />
Literatur: Villányi, 1882; Pfannl, 1930, S. 217-242; Banfi-Maggiorotti, 1932; Borbíró-Valló, 1956 <strong>und</strong> Gecsényi, 1993.<br />
IV-11a<br />
Belagerung von Raab, 1594<br />
Hans Sibmacher (1611†).<br />
Papier, Kupferstich, 18 x 28 cm.<br />
Budapest, HTM 3337 Kp.<br />
IV-12<br />
Plan des italienischen Festungsbaumeisters Giulio Turco über <strong>die</strong> Modernisierung der Grenzfestung<br />
Komorn, Januar 1572<br />
Original, Papier, 30,5 x 41 cm.<br />
Wien, KA Kartensammlung G I h 318-07.<br />
Druck: Domokos, 1997, S. 72: Bild Nr. 3.<br />
Die Grenzfestung Komorn am Zusammenfluß der Donau <strong>und</strong> der Waag erlangte ab den 30er Jahren des 16.<br />
Jahrh<strong>und</strong>erts große Bedeutung im Kampf <strong>gegen</strong> <strong>die</strong> Türken: zum einen kontrollierte sie <strong>die</strong> Donau <strong>und</strong> <strong>die</strong><br />
nahegelegene Kriegsroute, zum anderen konnte auf dem Fluß sogar eine Flotte anlegen. Um <strong>die</strong>se Aufgabe<br />
entsprechend bewältigen zu können, durfte <strong>die</strong> Modernisierung der Festung nicht mehr länger<br />
hinausgezögert werden. Der Um- bzw. Neubau begann in den 1540er Jahren <strong>und</strong> erreichte in den 50er-70er<br />
Jahren des Jahrh<strong>und</strong>erts seinen Höhepunkt. In der Planphase wirkten mehrere italienische Baumeister wie<br />
z.B. Nicolo Angielini <strong>und</strong> Giulio Turco mit. Der während der Besichtigung Anfang 1572 erstellte Plan von<br />
Turco (s. IV-1) zeigt eindeutig, wie sehr <strong>die</strong> geographischen Gegebenheiten <strong>die</strong> Anwendung der modernen<br />
Festungsbaumethoden einschränkten bzw. beeinflußten. Ein Beleg für <strong>die</strong> Bedeutung der Festung von<br />
Komorn ist, daß der Gr<strong>und</strong>riß der Burg sogar im Werk Achitectura von Vestungen von Daniel Speckle, einem<br />
der herausragendsten Fachbüchern der Epoche über das Festungsbauwesen vorkommt (s. IV-10).<br />
Literatur: Domokos, 1997, S. 67-92.
22IV-12a<br />
Grenzfestung Komorn, 1626<br />
Papier, Kupferstich, 12,5 x 18 cm.<br />
Budapest, HTM 3362 Kp.<br />
IV-13<br />
Plan des italienischen Festungsbaumeisters Ottavio Baldigara über <strong>die</strong> Modernisierung der<br />
Grenzfestung Erlau, 31. März 1572<br />
Original, Papier, 31 x 42,5 cm, deut.<br />
Wien, KA Kartensammlung G I h 158, fol. 17.<br />
Druck: Domokos, 2000, Bild Nr. 5.<br />
Die von den Türken im Jahre 1552 erfolglos erstürmte Festung Erlau (Eger) galt – neben Szatmár <strong>und</strong><br />
Kaschau – als Schlüssel zu Oberungarn. Festungsbaumeister <strong>und</strong> königliche Kommissare, <strong>die</strong> sich vom<br />
Zustand der Bauten während ihrer Besichtigungen auch persönlich überzeugten, arbeiteten zur<br />
Modernisierung der Burgen Anfang der 70er Jahre des 16. Jahrh<strong>und</strong>erts zahlreiche Pläne aus. Einer der<br />
wichtigsten <strong>die</strong>ser Pläne wird dem italienischen Festungsbaumeister Ottavio Baldigara († 15. Januar 1588)<br />
zugeschrieben: sein Plan entstand im März 1572 <strong>und</strong> wurde nach der Begutachtung im Juli in Wien<br />
angenommen. Dies zeigt, daß der Meister <strong>die</strong> örtlichen Gegebenheiten bei der Planung mitberücksichtigt<br />
hatte <strong>und</strong> <strong>die</strong> modernen bzw. alten Befestigungsmethoden <strong>die</strong>sen angepasst hatte.<br />
Literatur: Domokos, 2000, S. 42-49.<br />
IV-13a<br />
Grenzfestung Erlau, 16. Jahrh<strong>und</strong>ert<br />
Papier, Kupferstich, 32 x 45,2 cm.<br />
Druck: Braun-Hogenberg, 1617, p. 32.<br />
IV-14<br />
Gr<strong>und</strong>riß des italienischen Festungsbaumeisters Ottavio Baldigara über <strong>die</strong> neu aufgebauten<br />
Grenzfestung Neuhäusel bzw. <strong>die</strong> alten Burg Oláhújvár, 1583<br />
Original, Papier, 57,5 x 43 cm, ital.<br />
Wien, KA HKR Akten Exp. 1583 Sept. Nr. 82.<br />
Druck: Domokos, 2000, Bild Nr. 10.<br />
Die modernste Festung zur Zeit der Türkenabwehr im 16 Jahrh<strong>und</strong>ert war – neben Karlstadt (s. lV-16) – das<br />
in den 80er Jahren des 16. Jahrh<strong>und</strong>erts erbaute Neuhäusel (Érsekújvár). Nach dem Fall von Gran im Jahre<br />
1543 begann Paul Várday, Erzbischof von Gran (1526-1549), um den Türkeneinfällen Einhalt zu gebieten,<br />
am linken sumpfigen Ufer der Neutra (Nyitra) den Bau einer Palisadenburg mit einem quadrangulären<br />
Gr<strong>und</strong>riß. Die neue Festung ist schließlich dem Mitwirken seines Nachfolgers (1553-1568) Nikolaus Oláh zu<br />
verdanken, daher der Name Oláhújvár. Im Laufe der 1570er Jahre entsprach <strong>die</strong> Festung aufgr<strong>und</strong> der<br />
Tatsache, daß der Sumpf <strong>die</strong> Mauern nahezu verschluckte <strong>und</strong> weil <strong>die</strong> Gr<strong>und</strong>fläche der Festung einfach zu<br />
gering war, nicht mehr den von der Zeit diktierten militärischen Anforderungen. Der Hofkriegsrat ließ aus<br />
<strong>die</strong>sem Gr<strong>und</strong> nach den Plänen des italienischen Festungsbaumeisters Ottavio Baldigara († 15. Januar 1588)<br />
aus dem Jahre 1583 eine neue Festung errichten, <strong>die</strong> auch <strong>die</strong> alte Burg sehr gut erkennen ließ. Die neue<br />
Festung stand am rechten Ufer der Neutra, auf weniger sumpfigem, ebenen Boden <strong>und</strong> wurde zu einer<br />
hexagonalen Festungsstadt, deren Bauarbeiten sich über mehrere Jahre hinwegzogen – mit bedeutender<br />
finanziellen Förderung der mährischen <strong>und</strong> böhmischen Stände.<br />
Literatur: Domokos, 2000, S. 49-52.<br />
IV-15<br />
Plan des italienischen Festungsbaumeisters Ottavio Baldigara über <strong>die</strong> Grenzburg Kálló in<br />
Oberungarn, 1573<br />
Original, Papier, 43,5 x 32 cm, ital.<br />
Wien, KA HKR Akten Exp. 1573. Okt. Nr. 43, fol. 4-5.<br />
Druck: Domokos, 2000, Bild Nr. 12.<br />
Nach dem Fall von Gyula im Jahre 1566 wurde der Landteil östlich der Theiß nahezu zur Beute der<br />
türkischen Spahis. Im Komitat Szabolcs lag zwischen den Festungen Tokaj <strong>und</strong> Ecsed auf einer Strecke von<br />
100 Km keine einzige Festung, <strong>die</strong> <strong>die</strong> türkischen Beutezüge hätten einschränken können. Angesichts <strong>die</strong>ser
Umstände entschied der Hofkriegsrat, auf den Rat von Hans Ruebers, Grenzoberst in Oberungarn (1568-<br />
1584) über den Bau einer neuen Burg neben Kálló (heute Nagykálló). Trotz der ständigen Proteste der<br />
Türken begann der Bau der neuen Festung nach den Plänen des italienischen Baumeisters Ottavio Baldigara<br />
(† 15. Januar 1588). Bald erfüllte <strong>die</strong> Burg <strong>die</strong> Hoffnungen des Hofkriegsrates, zumal sie <strong>die</strong> Einfällen <strong>und</strong><br />
<strong>die</strong> Steuereintreibung der Türken von Szolnok <strong>und</strong> Gyula auf den königlichen Gebieten weitgehend<br />
erschwerte.<br />
Literatur: Domokos, 2000, S. 58-60.<br />
23IV-15a<br />
Grenzburg Kálló, 17. Jahrh<strong>und</strong>ert<br />
Papier, Kupferstich, 33 x 41 cm.<br />
Budapest, HTM 3352/2.<br />
IV-16<br />
Plan der Grenzfestung Karlstadt, Anfang des 18. Jahrh<strong>und</strong>erts<br />
Original, Papier, 46 x 69 cm, deut.<br />
Wien, KA Kartensammlung Inl. C VII 12.<br />
An der Kroatischen Grenze beim Zusammenfluß der Korana <strong>und</strong> der Kulp begann im Sommer 1579 der Bau<br />
der Festung Karlstadt (heute Karlovac). Diese neue Burg war – ähnlich Neuhäusel (lV-14) – eine moderne<br />
hexagonale Festungsstadt, <strong>die</strong> <strong>die</strong> Funktion hatte, <strong>die</strong> am Una-Ufer gelegene Festung Wihitsch, <strong>die</strong> immer<br />
ausgelieferter wurde, zu entlasten. Der Name der Festung stammt von Erzherzog Karl von Innerösterreich<br />
(1540-1590), der seit 1564 über den als Innerösterreich bekannten Ländern (Steiermark, Krain, Kärnten,<br />
Görz, Istrien <strong>und</strong> Friaul) regierte. Darüber hinaus kam Erzherzog Karl eine wichtige Rolle dabei zu, daß nach<br />
den Verhandlungen der Wiener Hauptgrenzberatschlagung von 1577 (I-5) zur Führung der kroatischen <strong>und</strong><br />
slawonischen Grenzfestungen in Graz 1578 ein eigenständiges Regierungsorgan, der Innerösterreichische<br />
Hofkriegsrat eingerichtet wurde.<br />
Literatur: Karlovac, 1979, S. 81-104; Kruhek, 1995/1 <strong>und</strong> Zmegaè, 2000, S. 62-70, vgl. noch Schulze, 1973.<br />
IV-17<br />
Gr<strong>und</strong>riß der nach dem Fall von Neuhäusel neuerrichteten Grenzfestung Leopoldstadt entlag der<br />
Waag, April 1673, Ingenieur Friedrich Ungar<br />
Original, Papier, 44 x 59 cm, deut.<br />
Wien, KA Kartensammlung G I h 393-900., Beilage zum Brief von Johann Michael Ridt Kommandant zu Leopoldstadt<br />
an den Wiener Hofkriegsrat, 14. April 1673, Leopoldstadt (Wien, KA HKR Akten Exp. 1673 Apr. Nr. 89.).<br />
Zentrum der nach 1665 erbauten <strong>gegen</strong>über von Neuhäusel liegenden Grenzoberhauptmannschaft wurde <strong>die</strong><br />
völlig neuerrichtete Grenzfestung Leopoldstadt am Ufer der Waag (vgl. Aufsatz von Géza Pálffy). Der Bau<br />
der modernen hexagonalen Festung wurde – dank der Unterstützung der mährischen, österreichischen <strong>und</strong><br />
ungarischen Stände – nach äußerst kurzer Zeit, bereits 1673 nahezu fertiggestellt. Der Gr<strong>und</strong>riß von<br />
Ingenieur Friedrich Ungar zeigt den Zustand vor dem Abschluß der Bauarbeiten im Frühjahr 1673.<br />
Literatur: Sedlák, 1963, S. 151-153 <strong>und</strong> ŠimonÈiæ, 1971, S. 72-73.<br />
IV-17a<br />
Zeichnung des Festungstores Leopoldstadt mit dem kaiserlichen Wappen <strong>und</strong> mit einer<br />
Gedenkinschrift, vor 13. Juni 1673<br />
Original, Papier, 40,5 x 58 cm, lat.<br />
Wien, KA Kartensammlung G VII 54-350.<br />
Leopoldstadt bekam seinen Namen nach Kaiser Leopold l. (1657-1705), der den Bau in Auftrag gegeben<br />
hatte. Von den verzierten Toren der Festung fertigte der Ingenieur Friedrich Ungar für den Hofkriegsrat eine<br />
Zeichnung an, <strong>die</strong> <strong>die</strong> Burg mit dem kaiserlichen Wappen <strong>und</strong> den Aufschriften, <strong>die</strong> <strong>die</strong> Errichtung der<br />
Festung dokumentieren, sehr minuziös veranschaulicht. Folgender Text war in der Inschrift, voller<br />
Abkürzungen, zu lesen: „L[eopoldvs] P[rimvs] D[ei] G[ratia] R[omanorvm] I[mperator] S[emper]<br />
A[vgvstvs] H[vngariae] B[oemiae]q[ue] R[ex] A[rchidvx] A[vstriae] H[oc] F[ortalitvm] E[xstrvi] C[vravit]<br />
A[nn]o M.DC.LXV.”, d.h.<br />
„Seine Majestät Leopold I., Kaiser des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation von Gottes Gnaden,<br />
König von Ungarn <strong>und</strong> Böhmen, Erzherzog zu Österreich ließ <strong>die</strong>se Festung im Jahre 1665 erbauen.“
IV-18<br />
Handschrift von Raim<strong>und</strong>o Montecuccoli über <strong>die</strong> Türkenkriege in Ungarn, um 1670<br />
Originalband, Papier, ital.<br />
Wien, KA Kriegswissenschaftliche Memoires Nr. B. 492/d/1/7:2,<br />
Raim<strong>und</strong>o Montecuccoli (1609-1680) war einer der berühmtesten Feldherren <strong>und</strong> Kriegswissenschaftler der<br />
zweiten Hälfte des 17. Jahrh<strong>und</strong>erts, <strong>die</strong> eine europäische Bedeutung erlangten. Nach langem Dienst stieg er<br />
vom einfachen Musketier zum Präsidenten des Wiener Hofkriegsrates im Jahre 1668 auf. In Ungarn war er<br />
von 1660 bis zu seinem Tode Raaber Grenzoberst, wobei er 1661 <strong>und</strong> 1662 als Armeekommandant in<br />
Oberungarn <strong>die</strong>nte <strong>und</strong> war im Sommer 1664 Oberbefehlshaber der ganzen kaiserlichen Armee in der<br />
siegreichen Schlacht bei Szentgotthárd-Mogersdorf (1. August 1664). Über <strong>die</strong> Probleme des<br />
zeitgenössischen Kriegswesens (stehendes Heer, Festungsbauwesen <strong>und</strong> Heerproviantierung usw.)<br />
erschienen mehrere Schriften aus seiner Feder, vor allem in italienischer Sprache. Er hinterließ einen<br />
überwältigenden Nachlaß von Manuskripten, der heute im Wiener Kriegsarchiv aufbewahrt wird. Das<br />
ausgestellte Manuskript über <strong>die</strong> Türkenkriege in Ungarn in den 1660er Jahren ist ebenfalls ein wertvolles<br />
Exemplar <strong>die</strong>ses „Erbes“.<br />
24Literatur: Montecuccoli, 1980 (mit weiterer Literatur), vgl. Wagner, 1964.<br />
IV-19<br />
Kriegswissenschaftliche Handschrift von Adam Batthyány d.J., Ende des 17. Jahrh<strong>und</strong>erts<br />
Original, Papier, 29 x 20 cm, ung.<br />
Budapest, MOL P 1313 Batthyány cs. lt. Memorabilia Nr. 1341, fol. 1-24.<br />
Neben Nikolaus Zrínyi (1620-1664, s. III-8), dem herausragendsten Repräsentanten der<br />
Kriegswissenschaftler im 16. <strong>und</strong> 17. Jahrh<strong>und</strong>ert, <strong>die</strong> auf Ungarisch schrieben, befaßten sich relativ wenige<br />
mit der Kriegswissenschaft. Zu ihnen gehörte Adam Batthyány d.J. (1662-1703), der ähnlich seinem Vater<br />
<strong>und</strong> Großvater (Christoph <strong>und</strong> Adam Batthyány d.Ä.) ab 1685 bis zu seinem Tode Grenzoberst der<br />
<strong>gegen</strong>über von Kanizsa liegenden Festungen bzw. Kreisoberst in Transdanubien war. Kaiser Leopold I.<br />
ernannte ihn zuerst zum Feldmarschallleutnant im Jahre 1690, zwei Jahre darauf dann zum Banus von<br />
Kroatien <strong>und</strong> Slawonien. Batthyány nahm sehr aktiv an dem Türkenkrieg zur Befreiung Ungarns (1683-<br />
1699) teil, vor allem an der Belagerung von Stuhlweißenburg <strong>und</strong> Kanizsa. Ihn interessierte nicht nur <strong>die</strong><br />
Praxis der Kriegsführung, sondern auch deren theoretischer Hintergr<strong>und</strong>. Davon zeugen seine in ungarischer<br />
Sprache abgefaßten, vor allem nach den Aufsätzen der früheren Feldherren <strong>und</strong> Kriegswissenschaftler<br />
zusammengestellten, noch unaufgearbeiteten Schriften.<br />
V. Bilder aus dem Leben an der Grenze<br />
a. Im „Langen Türkenkrieg“ (1593-1606)<br />
V-1<br />
Schlachtordnung der kaiserlichen <strong>und</strong> der türkischen Armee vor Kanizsa-Sormás, 7. Oktober 1600,<br />
Hans Leonhard von Yell Oberstquartiermeister<br />
Original, Tuschzeichnung, Papier, 38 x 51 cm, deut.<br />
Wien, KA AFA 1600/13/3, fol. 532-533.<br />
Druck: Ivanics, 1992, 51: Nr. 4 (eine Faksimileausgabe von Mária Ivanics in Vorbereitung).<br />
Anfang September 1600 nahm Großwesir Ibrahim <strong>die</strong> wichtigste Festung des südlichen Teils von<br />
Transdanubien, nämlich <strong>die</strong> Festung Kanizsa unter Beschuß. Die kaiserliche Kriegsführung Entschied<br />
daraufhin, daß <strong>die</strong> sich unter Raab gerade versammelnden Truppen zur Befreiung der Grenzfestung einen<br />
Feldzug unternehmen sollten. Die Truppen hatten sich neben Raab bis zum 16. September unter der Führung<br />
des französischen Feldherrn Philippe-Emmanuel duc de Mercoeur versammelt <strong>und</strong> zogen los. Das Heer<br />
gelangte über Pápa <strong>und</strong> Zalaszentiván nach Zalaegerszeg, war jedoch wegen Problemen bei der<br />
Lebensmittelversorgung zu einem langen Umweg in Richtung Süden gezwungen, bis es dann mit weiteren<br />
Truppeneinheiten ergänzt über Letenye nach Kanizsa gelangte. Unweit des heutigen Dorfes Sormás reihten<br />
sich <strong>die</strong> Truppen auf, während <strong>die</strong> Türken <strong>die</strong> Festung auch weiterhin erstürmten. Die künstlerische<br />
Darstellung von Oberstquartiermeister Hans Leonharn von Yell zeigt <strong>die</strong> ganze Schlachtordnung vom 7.
Oktober. Er liefert nicht nur zum Zusammenstoß wertvolle Daten, der mit einer Niederlage für <strong>die</strong> Ungarn<br />
ausging, sondern hinterließ der Nachwelt 19 aus kriegshistorischer Sicht einzigartige, äußerst gründlich<br />
gefertigte Tuschzeichnungen über <strong>die</strong> wichtigsten Stationen des Feldzuges, der zur Befreiung von Kanizsa<br />
unternommen wurde bzw. über <strong>die</strong> belagerte Festung. Nach der Niederlage der kaiserlichen Heertruppen<br />
ging Kanizsa am 20. Oktober 1600 an <strong>die</strong> Osmanen über.<br />
Literatur: Ivanics, 1992, S. 44-53; vgl. Cerwinka, 1968, S. 409-511; Niederkorn, 1991 <strong>und</strong> Tóth, 2000.<br />
b. Kriegsartikel <strong>und</strong> Kriegsreglement<br />
V-2<br />
Artikelbrief für <strong>die</strong> deutschen Fußknechten in Wien bzw. später für <strong>die</strong> deutschen Grenzsoldaten in<br />
der Burg Pápa, 16. Dezember 1586/15. Mai 1593<br />
Original, bzw. Konzept, Papier, 32 x 20,5 cm, deut.<br />
Wien, KA HKR KlA VIII b 3.<br />
Die Soldatendisziplin der von Kaiser Maximilian I. (1493-1519) aufgestellten Landsknechttruppen <strong>und</strong> der<br />
späteren deutschen Fußknechtregimenter bzw. <strong>die</strong> Feldordnung sowie <strong>die</strong> Militärgerichtsbarkeit wurden ab<br />
Anfang des 16. Jahrh<strong>und</strong>erts mittels sogenannten Artikelbriefen reguliert. Die Benennung ist darauf<br />
zurückzuführen, daß das Kriegsreglement <strong>die</strong> wichtigsten <strong>und</strong> vorschriftsmäßig einzuhaltenden<br />
Verhaltensregeln eines Soldaten wie auch <strong>die</strong> Sanktionen für <strong>die</strong> verschiedenen Verstöße <strong>gegen</strong> <strong>die</strong> Vorschrift<br />
bzw. <strong>die</strong> Praxis der Militärjustiz <strong>gegen</strong> <strong>die</strong> Zuwiderhandelnden in Punkte (Artikel) geordnet, detailliert<br />
festlegte. Die Fußknechte leisteten nach ihrer Rekrutierung <strong>und</strong> Musterung (vgl. II-4a, II-7 <strong>und</strong> II-7a) den<br />
Eid auf <strong>die</strong> Artikelbriefe. Auf den von Maximilian I. im Jahre 1508 erlassenen Artikelbrief folgten ab den<br />
20er Jahren des 16. Jahrh<strong>und</strong>erts weitere (1527, 1532, 1566), <strong>die</strong> eine wichtige Rolle dabei spielten, daß auf<br />
dem Reichstag von Speyer im Jahre 1570 ein für <strong>die</strong> ganze deutsche Infanterie gültiges Kriegsreglement (74<br />
Artikel) ausgearbeitet werden konnte. Lazarus Freiherr von Schwendi (I-4 <strong>und</strong> I-6) hatte sich bei <strong>die</strong>ser<br />
Arbeit ewig geltende Ver<strong>die</strong>nste erworben. Der Articul auf <strong>die</strong> teutschte Fußknechte aus dem Jahre 1570<br />
wurde von den Reichsständen in einem Gesetzartikel bekräftigt, der zur Gr<strong>und</strong>lage für <strong>die</strong> verschiedenen<br />
Kriegsreglemente der deutschen Fußsoldaten für nahezu 100 Jahre wurde. Der Artikelbrief aus dem Jahre<br />
1570 wurde auch bei der Ausarbeitung des hier ausgestellten Artikelbriefes für <strong>die</strong> Wiener Stadtgardia aus<br />
dem Jahre 1586 herangezogen. 25Interessant ist, daß während des „Langen Türkenkrieges“ <strong>die</strong> nach Pápa<br />
bestellten deutschen Fußknechte 1593 unter dem Kommando von Christoph Priam nach der Anwerbung<br />
ihren Eid auch auf denselben Text leisteten.<br />
Literatur: Erben, 1901, S. 473-529.; ders., 1902, S. 1-200; Möller, 1976, S. 31-40 <strong>und</strong> Pálffy, 1995/3, S. 23-33, 45-52.<br />
V-2a<br />
Kriegsartikel für <strong>die</strong> ungarischen Husaren entweder im Feld<strong>die</strong>nst oder in den Grenzfestungen,<br />
<strong>und</strong>atiert, Oberungarn<br />
Abschrift, wahrscheinlich aus dem Anfang des 17. Jahrh<strong>und</strong>erts, Papier mit Siegel von Gabriel Perényi, ung.<br />
Budapest, HL TGy 1588/41, [vor 1926 in Wien, KA AFA 1588/12/15].<br />
Druck: Gömöry, 1891, S. 148-152 <strong>und</strong> Szemelvények, 1955, S. 187-191; vgl. noch <strong>die</strong> Editionen der lateinischen<br />
Version: Lopašiæ, 1884, S. 65-67: Nr. XXXVII <strong>und</strong> neuerdings Pálffy, 1995/3, S. 184-186.<br />
Neben der Infanterie hatte der Reichstag von Speyer 1570 auch für <strong>die</strong> Reiterei (Kavallerie) Artikelbriefe<br />
gutgeheißen, <strong>die</strong> damals Reiterbestellung bzw. Reiterrecht genannt wurden. Bei der Aufsetzung <strong>die</strong>ser<br />
Artikelbriefe kam Lazarus Freiherr von Schwendi (I-4 <strong>und</strong> I-6) ebenfalls eine bedeutende Rolle zu. Dieses<br />
Reglement war allerdings nicht das erste, das Schwendi für <strong>die</strong> Reiterei formuliert hatte. Im Jahre 1566,<br />
während seines Feldzugs in Oberungarn ließ er <strong>die</strong> ungarischen Burghauptmänner für <strong>die</strong> ungarischen<br />
Husaren eigenständige Kriegsartikel in ungarischer <strong>und</strong> lateinischer Sprache ausarbeiten. Das<br />
Ausstellungsstück ist eines der frühsten im Original erhalten gebliebenen Artikel in ungarischer Sprache, das<br />
aus dem frühen 17. Jahrh<strong>und</strong>ert datiert. Schwendi setzte neben der Reiterei auch für <strong>die</strong> ungarische<br />
Fußknechte Kriegsartikel auf. Der ungarische Landtag bekräftigte <strong>die</strong>se Artikel im Gegensatz zu den<br />
Reichsständen niemals, somit sind sie nie in Druckform erschienen. Dies erklärt ihre schwache Wirkung im<br />
Vergleich zu den Kriegsreglementen des Reichstags von Speyer 1570. Dennoch galten <strong>die</strong> für <strong>die</strong> Husaren<br />
<strong>und</strong> Haiducken ausgearbeiteten Artikelbriefe als <strong>die</strong> frühsten allgemeinen <strong>und</strong> für <strong>die</strong> ganze ungarische<br />
Armee generell gültigen Kriegsreglemente.
Literatur: Pálffy, 1995/3, S. 71-81.<br />
V-2b<br />
Kriegsartikel für <strong>die</strong> kroatischen Fußknechte der kroatischen <strong>und</strong> windischen Grenzfestungen, 10.<br />
Juni 1579, Graz<br />
Original, Papier, 31,5 x 20,5 cm, kroat.<br />
Wien, KA HKR KlA VIII b 2.<br />
Druck: Lopašiæ, 1884, S. 67-71: Nr. XXXVIII.<br />
Ein klarer Beweis dafür, wie bedeutend <strong>und</strong> nützlich <strong>die</strong> 1566 ausgearbeiteten Kriegsartikel für ungarische<br />
Husaren <strong>und</strong> Haiducken (V-2a) waren ist, daß sie bald ins kroatische übersetzt wurden. Lazarus Freiherr von<br />
Schwendi legte auf der Wiener Hauptgrenzberatschlagung im Jahre 1577 (s. I-5) <strong>die</strong> Kriegsartikel vor <strong>und</strong><br />
sprach sich für ihre Verbreitung aus. Daraufhin besagten <strong>die</strong> Vertreter der steirischen, Kärntner, Krainer <strong>und</strong><br />
Görzer Stände im Januar 1578 auf einer Beratung bei Bruck an der Mur, daß „dem Kriegsvolck an der<br />
Gränizen, es sey Hungarisch, Windisch, Croatisch <strong>und</strong> kein Nation ausgeschlossen, soll der Articulbrief<br />
inhalt der Wiennerischen Beratschlagung fürgehalten, <strong>und</strong> sie, <strong>die</strong> Kriegsleuth darauf zu beschwören<br />
schuldig seye.” Für <strong>die</strong> in den kroatischen <strong>und</strong> slawonischen Grenzfestungen <strong>die</strong>nenden kroatischen Reiter<br />
<strong>und</strong> Fußsoldaten wurde rasch <strong>die</strong> Übersetzung in Auftrag gegeben, <strong>die</strong> Erzherzog Karl von Innerösterreich<br />
erstmals am 1. März 1578 herausgab. Im November desselben Jahres fand sie – laut Überlieferungen –<br />
bereits Anwendung, da <strong>die</strong> kroatischen Soldaten der ersten Besatzung in der neuerrichteten Festung<br />
Weitschawar (IV-5) ihren Eid auf <strong>die</strong> Artikel geleistet hatten. Im Juni 1579 gab Erzherzog Karl <strong>die</strong><br />
Kriegsartikel erneut heraus, davon zeugt das im Kriegsarchiv erhalten gebliebene Ausstellungsstück. Wie<br />
nützlich <strong>die</strong> Artikelbriefe auf Kroatisch waren zeigt, daß sie Kaiser Leopold I. noch 1672 in ungeänderter<br />
Form verkündete.<br />
Literatur: Pálffy, 1995/3, S. 71-81 <strong>und</strong> Roth, 1970, S. 200-201.<br />
V-3<br />
Kriegsreglement des Grenzobersten Adam Forgách von Ghymes für <strong>die</strong> Soldaten der bergstädtischen<br />
Grenzfestungen, 21. Juni 1648, Szécsény<br />
Original, Papier, 32 x 20 cm, ung. bzw. lat.<br />
Budapest, MOL E 136 Div. Instr. Tétel 35, fol. 643-647.<br />
Druck: Illésy, 1892, S. 569-576.<br />
Die Disziplin der ungarischen Grenzsoldaten regelten im 17. Jahrh<strong>und</strong>ert außer dem 1566 ausgearbeiteten<br />
allgemeinen Kriegsartikel (V-2a) noch zahlreiche weitere spezielle Kriegsreglemente. Ihre Veröffentlichung<br />
war wegen der Besonderheiten des Dienstes in den Grenzfestungen <strong>und</strong> der Eigenart der Kriegsführung<br />
<strong>gegen</strong> <strong>die</strong> Türken an der Grenze nötig. Eines <strong>die</strong>ser äußerst detaillierten Kriegsreglemente hatte Adam<br />
Forgách, bergstädtischer Grenzoberst (1645-1663) den in den Festungen seiner Grenzoberhauptmannschaft<br />
<strong>die</strong>nenden ungarischen Soldaten verkündet. Dieses Reglement widmete der Disziplin der Grenzsoldaten 42<br />
Artikel <strong>und</strong> ging dabei auf den Wach<strong>die</strong>nst, den Feuerschutz <strong>und</strong> auf <strong>die</strong> in türkische Gebiete geführten<br />
Einfällen ein, wobei es Fluchen, Trunkenheit (vor allem vor Messen) <strong>und</strong> nicht zuletzt das Halten von<br />
unsittlichen Weibern niederer Moral verbot.<br />
Literatur: Pálffy, 1995/3, S. 80-81.<br />
26c. Militärgerichtsbarkeit<br />
V-4<br />
Bericht der königlichen Kommissare an König Ferdinand I. über <strong>die</strong> Verurteilung eines spanischen<br />
meuternden Soldaten in Gran mit Hilfe des „Rechtes der langen Spieße”, 21. Mai 1531, Gran<br />
Original, Papier, 31,5 x 22 cm, deut.<br />
Wien, HHStA Hungarica AA Fasc. 17, Konv. 5, 1531 Mai fol. 99-101.<br />
Druck: Pálffy, 1995/3, 196: Nr. 12 (teilweise).<br />
In der Gerichtsbarkeit der deutschen Fußknechte entwickelte sich neben dem bewährten Justizorgan, dem<br />
Schultheißengericht eine andere spezielle Art der Rechtsprechung – „Kriegsrecht mit den langen Spießen”<br />
genannt. In den Regimentern, wo <strong>die</strong> Fußknechte nach ihrer Musterung <strong>die</strong>se Form der Gerichtsbarkeit<br />
annahmen, brauchte man keinen Kriegsrichter, d. h. Schultheißen. Bei <strong>die</strong>ser Form der Rechtsprechung
wurde das Urteil (Freispruch oder Verurteilung) anhand des Artikelbriefes von den Soldaten <strong>gemeinsam</strong><br />
gefällt. Verurteilung bedeutete immer Todesstrafe. Die Soldaten bildeten zwei einander <strong>gegen</strong>überstehende<br />
Reihen <strong>und</strong> der Verurteilte mußte zwischen ihnen, in der „Gasse” laufen, während <strong>die</strong> Soldaten ihn mit<br />
Lanzenstößen töteten: „wir den 18 Tag diss Monets [1531], so wir hie [d. h. zu Gran], von der Hanndlung<br />
von Plinttenpurg khomen, den Spanyer widerumben guettlich fragen lassen, welher aber, auf seiner voriger<br />
Mainung beliben, haben wir ine den volgennden Tag fürgestellt, <strong>und</strong> durch <strong>die</strong> Spieß lauffen lassen; daselbst<br />
er gestorben <strong>und</strong> sein Schuldt bezallt” – berichteten <strong>die</strong> königlichen Kommissare an Ferdinand I. aus Gran<br />
über <strong>die</strong>se Art der Rechtsprechung. Das „Recht der langen Spieße“ wurde wegen ihrer Unmenschlichkeit bis<br />
zum Ende des 16. Jahrh<strong>und</strong>erts abgeschafft. In der Zeit des Dreißigjährigen Krieges (1618-1648) tauchte sie<br />
aber in Form einer Bestrafung, des Spießrutenlaufes wieder auf.<br />
Literatur: Bonin, 1904, S. 148-158; Beck, 1908, S. 28-38; Möller, 1976, S. 234-259; Fiedler, 1985, S. 79-83 <strong>und</strong> Pálffy,<br />
1995/3, S. 39-41, 63.<br />
V-4a<br />
Zeichnung des „Rechtes der langen Spieße” aus dem Buch von Leonhart Fronsperger Von<br />
Kayserlichem Kriegssrechten, 1565<br />
Papier, Kupferstich von Jost Amman.<br />
NeuDruck: Fronsperger, 1970, Buch I, fol. XXIII.<br />
System <strong>und</strong> Praxis der Militärgerichtsbarkeit der deutschen Soldaten stellte als erster Leonhart Fronsperger<br />
(1520-1575), Bürger von Ulm <strong>und</strong> kaiserlicher Soldat, in seinem 1565 in Frankfurt am Main erschienen<br />
Werk Von Kayserlichem Kriegssrechten dar, in dem auch das „Recht der langen Spieße“ vorkam, das dem<br />
Autor wohl bekannt war. Fronsperger hatte an zahlreichen Feldzügen Kaiser Karls V. <strong>und</strong> Ferdinands I. – als<br />
Schultheiß eines Fußknechtregiments – persönlich teilgenommen. 1542 <strong>und</strong> 1566 gelangte er von Amts<br />
wegen sogar auf den ungarischen Kriegsschauplatz.<br />
Literatur: Bonin, 1904, S. 148-158; Beck, 1908, S. 28-38; Möller, 1976, S. 234-259; Fiedler, 1985, S. 79-83 <strong>und</strong> Pálffy,<br />
1995/3, S. 39-41, 63.<br />
V-5<br />
Urteil des Militärgerichtes der Grenzfestung Veszprém, nach der Appellation des Grenzobersten zu<br />
Raab, über den Streit zwischen dem Oberhauptmann zu Veszprém <strong>und</strong> den Grenzsoldaten zu Tihany,<br />
22. Dezember 1654, Veszprém, dann 30. Januar 1655, Raab<br />
Original, Papier, 32 x 21 cm, ung. <strong>und</strong> lat.<br />
Budapest, MOL P 71 Csáky cs. lt. Fasc. 273, Köteg I, fol. 27-31.<br />
In den 50er <strong>und</strong> 60er Jahren des 16. Jahrh<strong>und</strong>erts erlangten <strong>die</strong> ungarischen Grenzsoldaten – ähnlich den<br />
deutschen Söldnern – allmählich das Privileg der selbständigen Kriegsgerichtsbarkeit. Das System der<br />
ungarischen Soldatenrechtsprechung entwickelte sich jedoch im 16. <strong>und</strong> 17. Jahrh<strong>und</strong>ert in einer ganz<br />
speziellen Form. Die Militärjustiz passte sich der Struktur der Türkenabwehr, dem System der<br />
Grenzoberhauptmannschaften an. Dies bedeutete folgendes: <strong>die</strong> Gerichtshöfe der Hauptmänner der kleineren<br />
Grenzfestungen durften bei criminalis causa (Straffälle wie Diebstahl, Mord usw.) nur mit dem Vorwissen<br />
des Grenzoberhauptmannes oder seines Vertreters Strafen verhängen; andererseits wurde denjenigen, <strong>die</strong> mit<br />
dem Urteil des Gerichtshofes des Burghauptmannes nicht zufrieden waren, <strong>die</strong> Möglichkeit eingeräumt,<br />
beim Gerichtshof des Grenzoberhauptmannes Berufung einzulegen. Die Aufgabe <strong>die</strong>ses Gerichtes zweiter<br />
Instanz war es, in den Prozessen, <strong>die</strong> <strong>die</strong> Mitglieder der Besatzung oder <strong>die</strong> Offiziere der Grenzfestungen<br />
<strong>gegen</strong>einander führten, in höchster Instanz zu verhandeln. Ein anschauliches Beispiel dafür liefert der Prozeß<br />
der Grenzsoldaten zu Tihany am Plattensee <strong>und</strong> Franz Csáky, Burghauptmann zu Veszprém (1654-1656) im<br />
Dezember des Jahres 1654 im Gebiet der Raaber Grenze, der wegen dem Verkauf eines verletzten türkischen<br />
Gefangenen angehängt wurde. Den Streit versuchte der Burghauptmann widerrechtlich erst bei seinem<br />
eigenen Gericht zu lösen, wobei das Urteil eindeutig für ihn vorteilig ausfiel. Die Soldaten zu Tihany legten<br />
jedoch beim Gerichtshof von Philipp Graf von Mansfeld Grenzoberhauptmann zu Raab (1643-1657)<br />
Appellation ein, der den früheren Spruch im Januar 1655 vernichtete <strong>und</strong> den Burghauptmann zu Veszprém<br />
darauf hinwies, das System der Rechtsprechung zu respektieren.<br />
Literatur: Pálffy, 1995/3, S. 115-147.
27d. Festungsaufgabe<br />
V-6<br />
Militärgerichtsurteil über <strong>die</strong> Festung Raab den Türken aufgegebenen Grenzobersten Ferdinand Graf<br />
zu Hardegg, 2. März 1595, Wien<br />
Original, Papier, 44 x 33 cm, deut.<br />
Wien, KA AFA 1595/3/ad 1 a, andere wichtige, aber une<strong>die</strong>rte Akten über den Prozeß von Hardegg: Wien, KA<br />
1595/3/1, 1595/3/ad 1 a, 1595/6/2 <strong>und</strong> Wien, ÖNB Cod. 7554.<br />
Für <strong>die</strong> Rechtsprechung über <strong>die</strong> Grenzoberste <strong>und</strong> Burghauptmänner, <strong>die</strong> im Laufe des 16. <strong>und</strong> 17.<br />
Jahrh<strong>und</strong>erts den Türken Grenzfestungen überlassen hatten, waren in Abhängigkeit deren Nationalität<br />
unterschiedliche Organe zuständig. Während über <strong>die</strong> deutschen Offiziere ein vom Hofkriegsrat ernanntes<br />
kaiserliches unparteiisches Kriegsgericht das Urteil fällte, richtete über <strong>die</strong> ungarischen Offiziere das<br />
Spezialgericht des ungarischen Landtages (vgl. V-6b). Häufig war das vom Hofkriegsrat delegierte<br />
Militärgericht im Gegensatz zu seinem Namen jedoch bei weitem nicht unparteiisch. Ein Beleg dafür ist der<br />
Prozeß von Ferdinand Graf zu Hardegg, Grenzoberst zu Raab (1592-1594), der sich mehrere Monate<br />
hinwegzog <strong>und</strong> der am 2. März 1595 schließlich mit dem Todesurteil ein Ende nahm. Hardegg hatte am 29.<br />
September 1594 nach tapferem, nahezu zwei Monate währendem Widerstand <strong>die</strong> Festung Raab aufgegeben<br />
<strong>und</strong> den in der Überzahl kämpfenden Osmanen überlassen. Nach der peinlichen Flucht der Hilfstruppen<br />
Erzherzog Matthias‘ (9-10. September) schien sein Widerstand völlig aussichtslos, dennoch hielt er noch<br />
nahezu drei Wochen lang Stand <strong>und</strong> schlug <strong>die</strong> Attacken der Türken zurück. Das zum Urteilsspruch<br />
versammelte Gericht hatte kein anderer, als Erzherzog Matthias zusammenstellen lassen. Hardegg hatte<br />
wegen den militärischen Fehlleistungen des Erzherzogs <strong>und</strong> wegen seines Glaubens (er war Protestant)<br />
sterben müssen. Die Anführer der niederösterreichischen Gegenreformation hatten den Anlaß sehr geschickt<br />
dazu genützt, aus Hardegg einen Sündenbock zu machen. Sein Todesurteil wurde am 16. Juni 1595 in Wien<br />
am Platz am Hof vollzogen (V-6a). Ähnlich erging es dem Protestanten Georg Paradeiser Grenzoberst zu<br />
Kanizsa (1598-1600), der <strong>die</strong> Festung am 20. Oktober 1600 aufgegeben <strong>und</strong> den Türken überlassen hatte. Er<br />
wurde im Jahre 1601 auch am Platz am Hof hingerichtet.<br />
Literatur: Hausmann, 1983, S. 194-200; Mohl, 1913, S. 31-37 <strong>und</strong> Cerwinka, 1968, S. 409-511.<br />
V-6a<br />
Hinrichtung von Ferdinand Graf zu Hardegg in Wien (Platz am Hof), 16. Juni 1595<br />
Hans Sibmacher (1601†).<br />
Papier, Kupferstich, 15,5 x 26 cm, deut.<br />
Budapest, HTM 964 Kp.<br />
V-6b<br />
Urteil des Spezialgerichtes des ungarischen Landtages über <strong>die</strong> Festung Babócsa (bei Kanizsa) den<br />
Türken aufgegebenen Gregor Pethõ, 2. April 1601, Preßburg<br />
Original, Papier, 32 x 21,5 cm, lat.<br />
Wien, KA HKR Akten Reg. 1601 Sept. Nr. 26, fol. 27-36.<br />
Über <strong>die</strong> ungarischen Burghauptmänner, <strong>die</strong> <strong>die</strong> Grenzfestungen den Türken überlassen hatten, sprach nicht<br />
das vom Hofkriegsrat delegierte Kriegsgericht, sondern das Spezialgericht des ungarischen Landtages Urteil<br />
aus. Dies ist damit zu erklären, daß <strong>die</strong>ses Gericht bereits vor 1526 in Sachen Grenzfestungsaufgabe<br />
zuständig gewesen war. Dieses Privileg der Rechtsprechung wollten <strong>die</strong> ungarischen Stände beibehalten. Der<br />
Hofkriegsrat erkannte Mitte des 16. Jahrh<strong>und</strong>erts, daß es sich nicht lohnt, sich in Angelegenheiten der<br />
weniger gewichtigen Kompetenzbereiche mit den ungarischen Ständen in heikle politische Konflikte zu<br />
verwickeln. Somit blieb das Recht der Urteilfällung in Sachen Grenzfestungsaufgabe beim Spezialgericht<br />
des ungarischen Landtages. Ein sehr plastisches Beispiel gibt das Urteil über Gregor Pethõ von Gerse, der<br />
sich Anfang September 1600 gezwungen sah, <strong>die</strong> Burg Babócsa (bei Kanizsa) den Türken zu überlassen. Das<br />
Spezialgericht fällte zwar das Urteil, er müsse sein Vermögen verloren <strong>und</strong> enthauptet werden, kurz darauf<br />
jedoch suchten <strong>die</strong> Mitglieder desselben Gerichtes um Gnade bei Kaiser Rudolph II. an. Pethõ wurde <strong>die</strong><br />
Gnade gewährt, letztlich wurde auch <strong>die</strong> ihm auferlegte harte Strafe gemindert: er mußte lediglich einige<br />
Jahre lang auf eigene Kosten Dienst an der Grenze leisten.<br />
Literatur: Pálffy, 1997/2, S. 197-221.
e. Spionage <strong>und</strong> Nachrichten<strong>die</strong>nst<br />
V-7<br />
Bericht des ehemaligen Botschafters in Konstantinopel Anton Verancsics an Erzherzog Karl über den<br />
Aufbau eines Spionagesystems am Hof des Sultans bzw. an der ungarischen Grenze, 28. September<br />
1570, Oláhújvár<br />
Original, Papier, 31 x 22 cm, lat.<br />
Wien; HHStA Hungarica AA Fasc. 96, Konv. B, fol. 72-79, (une<strong>die</strong>rt in Verancsics Antal, 1857-1875).<br />
28Es lag gr<strong>und</strong>sätzlich im Interesse <strong>und</strong> war unversäumbare Aufgabe des Wiener Hofkriegsrates einen<br />
Nachrichten<strong>die</strong>nst aufzustellen, der im Kampf mit den Osmanen <strong>die</strong> Pläne des Feindes herausbekommen<br />
sollte. Von ebenso wichtiger Bedeutung war es, zur Informationsendung <strong>und</strong> Kontaktpflege mit den<br />
Grenzoberhauptmannschaften <strong>die</strong> Nachrichtenübermittlung auszubauen. Der siegreiche Kampf <strong>gegen</strong> <strong>die</strong><br />
Türken, <strong>die</strong> erfolgreichen Verhandlungen in der Ostdiplomatie sowie <strong>die</strong> Lenkung der Grenzverteidigung<br />
hingen nämlich größtenteils genau davon ab, ob <strong>die</strong> militärischen Entscheidungen in Wien <strong>und</strong> in den<br />
wichtigsten Grenzfestungen aufgr<strong>und</strong> zuverlässiger Informationen <strong>und</strong> zur rechten Zeit getroffen werden<br />
konnten. Der großangelegte Plan von Anton Verancsics, einst Botschafter in Konstantinopel (1553-1557 <strong>und</strong><br />
1567-1568) zur Neustrukturierung des Nachrichten<strong>die</strong>nstes (s.u.), den Erzherzog Karl von Innerösterreich in<br />
Auftrag gegeben hatte <strong>und</strong> der Ende September 1570 vorgelegt wurde, ver<strong>die</strong>nt daher besondere<br />
Aufmerksamkeit. Verancsics stellt darin dar, auf welche Personen sich <strong>die</strong> Habsburgerdiplomatie in der<br />
Spionagetätigkeit in Konstantinopel verlassen konnte:<br />
– <strong>die</strong> Beamten <strong>und</strong> Diener des Sultans in Serai (Leibwächter, Truchsesse usw.), <strong>die</strong><br />
meistens Renegaten waren (serbischer, bosnischer, ungarischer, deutscher, italienischer<br />
Abstammung),<br />
– <strong>die</strong> sehr einflußreiche Dolmetscher, <strong>die</strong> waren aber oft Doppelagenten,<br />
– <strong>die</strong> jüdischen Ärzte des Sultans,<br />
– <strong>die</strong> türkischen <strong>und</strong> renegaten Diener der türkischen Oberstwürdenträger in der<br />
Residenz in Konstantinopel,<br />
– Botschafter von anderen christlichen Staaten (darunter auch <strong>die</strong> von Siebenbürgen),<br />
– <strong>die</strong> Spionen <strong>und</strong> <strong>die</strong> Diplomaten der Feinde der Osmanen, vor allem <strong>die</strong> der Persier,<br />
– <strong>und</strong> letztens auch <strong>die</strong> Geheimagenten, <strong>die</strong> von Wien ihren ständigen Lohn bekamen,<br />
<strong>und</strong> <strong>die</strong> im allgemeinen auch vor den Botschaftern in Konstantinopel unbekannt blieben.<br />
Die Möglichkeiten der Spionage an den Grenzen in Ungarn waren auch nach der Mitte des 16. Jahrh<strong>und</strong>erts<br />
sehr günstig. Da das türkische Grenzfestungssystem auf dem Gebiet des ehemaligen mittelalterlichen<br />
ungarischen Königreiches ausgebaut wurde, konnten für <strong>die</strong> Grenzhauptmänner folgende Gruppen mit<br />
Informationen <strong>die</strong>nen:<br />
– eingebaute Personen in den Diwan der benachbarten Paschas <strong>und</strong> Begs, besonders<br />
<strong>die</strong> ungarischen Schreiber,<br />
– gelegentliche, bezahlte Spionen, <strong>die</strong> in <strong>die</strong> feindlichen Grenzfestungen oder während<br />
eines Kriegszuges ins Türkenlager beordnet wurden,<br />
– ungarische Richter <strong>und</strong> Bauer der eroberten oder gehuldigten Dörfer, <strong>die</strong> unter dem<br />
Vorwand der Steuereinzahlung freien Eingang in <strong>die</strong> türkischen Festungen hatten,<br />
– Kaufleute <strong>und</strong> Reisende im Osmanenreich,<br />
– christliche Gefangene in osmanischen Burgen (ihre Briefe wurden nämlich durch <strong>die</strong><br />
Türken nicht unter Zensur gezogen, sie wurden aber wegen Zusammensammlung ihres<br />
Lösegeldes freigelassen, vgl. V-9-12),<br />
– Renegaten, <strong>die</strong> zu den Türken zogen, oder sich auf ihre Religion bekehrten,<br />
– letztens <strong>die</strong> gefangengenommenen Soldaten <strong>und</strong> feindliche Untertanen, d. h. <strong>die</strong><br />
sogenannten „Zungen”.<br />
Literatur: Takáts, 1915, Bd. 2, S. 133-212; Žontar, 1971, S. 167-222; ders., 1973; Lesure, 1983, S. 127-154 <strong>und</strong> Pálffy,<br />
1999/1, S. 40-54.
V-8<br />
Karte der ungarischen <strong>und</strong> türkischen Grenzfestungen in der Umgebung von Kanizsa, 1580<br />
Original, Papier, 42 x 59, ital.<br />
Wien, HHStA Turcica Karton 43, Konv. 2, fol. 50, Beilage zum Brief des Botschafters in Konstantinopel Joachim von<br />
Sinzendorf an Kaiser Rudolf II, 18. Januar 1581, ebenda fol. 37-45 <strong>und</strong> fol. 62-71.<br />
Druck: Pálffy, 2000/1, Beilage III.<br />
Die Karten über <strong>die</strong> Grenzfestungsgebiete waren von dermaßen großer Bedeutung, daß <strong>die</strong> Spione sie zu<br />
erwerben trachteten. Eine solche Karte gelangte im Jahre 1580 auf diplomatischem Wege an den Wiener<br />
Hofkriegsrat. Die osmanische Kriegsführung in Ungarn, nämlich der Pascha von Ofen, ließ in <strong>die</strong>sem Jahr<br />
eine Karte über <strong>die</strong> Grenzfestungen um Kanizsa anfertigen, <strong>und</strong> er schickte ein Exemplar an den Hof des<br />
Sultans nach Istanbul. Hier ließ Joachim von Sinzendorf, der ständige Botschafter (1578-1581) Kaiser<br />
Rudolfs II. <strong>die</strong> von Ofen gekommene türkische Karte von einem im Dienst der Osmanen stehenden<br />
Dolmetscher (wahrscheinlich italienischer Abstammung) – natürlich <strong>gegen</strong> entsprechende finanzielle<br />
Belohnung – kopieren. Die Kopie schickte er zur Kenntnisnahme nach Wien. Die mit italienischen<br />
Aufschriften verfertigte Kartenkopie ist ein guter Beweis dafür, daß <strong>die</strong> Osmanen das Festungssystem des<br />
Gegners ziemlich genau kannten.<br />
Literatur: Pálffy, 2000/1, S. 46-49.<br />
f. Gefangenenhandel <strong>und</strong> Gefangenenhaltung<br />
V-9<br />
Ansuchen der vormaligen Grenzsoldaten zu Erlau, später Galeerensklaven im türkischen Dienste am<br />
Mittelmeer an <strong>die</strong> Ungarische Kammer zu Preßburg, vor 18. April 1575, o. O.<br />
Original, Papier, 32 x 21,5 cm, lat.<br />
Budapest, MOL E 41 Litterae ad cameram exaratae 1575 Nr. 101.<br />
Druck: Maksay, 1978, S. 78-79.<br />
Im Gegensatz zur öffentlichen Annahme versklavten <strong>die</strong> Osmanen von Ungarn aus niemals große Massen<br />
von mehreren Zehntausend Menschen, denn bot sich dazu mangels Lebensmitteln niemals <strong>die</strong> Gelegenheit.<br />
Dies bedeutete jedoch bei weitem nicht, daß <strong>die</strong> entlang der Grenze in Gefangenschaft geratenen, meist<br />
ärmeren Gefangenen zuweilen nicht auf 29den Sklavenmarkt von Belgrad oder Konstantinopel <strong>und</strong> von dort<br />
in weitgelegene Gebiete des Osmanischen Reiches, oder gar auf Galeeren gekommen wären. Im Frühjahr<br />
1575 wandten sich zwei aus Gefangenschaft entlassene ehemalige ungarische Grenzsoldaten von Erlau an<br />
<strong>die</strong> Ungarische Kammer zu Preßburg um Hilfe, <strong>die</strong> in ihrer Bitte ihre bitteren Erlebnisse ausführlich<br />
erzählten. Sie gelangten vom ungarischen Kriegsschauplatz um 1560 auf <strong>die</strong> Insel Rodos, wo sie zu<br />
Friedenszeiten Fron<strong>die</strong>nst leisteten, zu Kriegszeiten jedoch auf Galeeren zu rudern hatten. Sie nahmen im<br />
Jahre 1565 an der Belagerung von Malta teil, <strong>die</strong> ohne Erfolg blieb, zogen im siegreichen osmanischen<br />
Feldzug <strong>gegen</strong> Zypern (1570-1571) mit <strong>und</strong> kämpften sogar in der Schlacht bei Lepanto (7. Oktober 1571).<br />
Während der Belagerung von Tunis im Jahre 1574 <strong>die</strong>nten sie immer noch als Galeerensträfling, bis sie<br />
einmal während dem Holzhacken entkommen konnten. Aus der Ferne kehrten sie dann glücklich in ihre<br />
Heimat Ungarn zurück.<br />
Literatur: Szakály, 1998, S. 133-151.<br />
V-10<br />
Franz Wathay in seiner Türkengefangenschaft in Temesvár, 1603<br />
Original, Aquarell von Wathay aus seinem Gesangsbuch, Fotoaufnahme.<br />
Budapest, MTA Kt. K 62, fol. 31 v .<br />
Faksimileausgabe: Wathay Ferenc énekes könyve, 1976, Bd. I, fol. 31 v .<br />
Über <strong>die</strong> Umstände der türkischen Gefangenschaft sind sehr wenig bildliche Darstellungen erhalten<br />
geblieben. Das Aquarell über seine Gefangenschaft in Temesvár 1603 von Franz Wathay (1568-1610), der<br />
beim Fall von Stuhlweißenburg Ende August 1602 gefangen genommen wurde, gilt als Seltenheit. Ab Mitte<br />
der 80er Jahre des 16. Jahrh<strong>und</strong>erts <strong>die</strong>nte Wathay erst in Raab, nach dessen Fall im Jahre 1594 in Ungarisch<br />
Altenburg (Magyaróvár) (1595-1597), anschließend in Sárvár (1597) <strong>und</strong> letztendlich in Pápa (1597-1598).<br />
Zwischen 1598 <strong>und</strong> 1600 <strong>die</strong>nte er als Vizeburghauptmann von Veszprém, 1602 bekleidete er das gleiche<br />
Amt in Stuhlweißenburg, das 1601 von den Türken zurückerobert wurde. Von hier geriet er am 29. August
1602 nach dem Fall der Burg in Gefangenschaft <strong>und</strong> wurde erst in Ofen, dann später in Belgrad gefangen<br />
gehalten. Obwohl es ihm gelungen war, von Belgrad zu fliehen, hat man ihn wieder gefangen <strong>und</strong> nach<br />
Temesvár geschleppt. Das ausgestellte Bild über seine Gefangenschaft entstand später in Konstantinopel, da<br />
er nach einem weiteren Fluchtversuch erneut gefangen wurde, aber <strong>die</strong>smal brachte man ihn in <strong>die</strong><br />
osmanische Hauptstadt. 1605 geriet er zurück nach Ofen, denn der Umstand, daß er einem Adelsgeschlecht<br />
abstammte, ermöglichte den Gefangenentausch. Anfang 1606 erlangte er <strong>gegen</strong> den Beg von Szekszárd, der<br />
in christlicher Gefangenschaft gehalten wurde, seine Freiheit. Wathay gab seinen ursprünglichen Beruf auch<br />
später nicht auf. Erst <strong>die</strong>nte er als Rittmeister in Raab (1607-1609), dann bis zu seinem Tode als Hauptmann<br />
der kleinen Burg Csesznek (IV-1b). Das ausgestellte Bild blieb in seinem in Konstantinopel gefertigten<br />
Gesangsbuch erhalten, das aufgr<strong>und</strong> der darin befindlichen Gedichte als eines der wertvollsten Werke der<br />
ungarischen Gemeindedichtkunst des 16. Jahrh<strong>und</strong>erts anzusehen ist.<br />
Literatur: Wathay Ferenc énekes könyv, 1976 <strong>und</strong> Pálffy, 1998, S. 169-173 (mit weiterer Literatur).<br />
V-11<br />
Gefangenenbuch von Adam Batthyány über <strong>die</strong> türkischen <strong>und</strong> serbischen Gefangene, Mitte des 17.<br />
Jahrh<strong>und</strong>erts<br />
Original, Papier, 31 x 21 cm, ung.<br />
Budapest, MOL P 1313 Batthyány cs. lt., Török iratok Nr. 49.<br />
Im 16. Jahrh<strong>und</strong>ert entwickelte sich entlang der ungarisch-türkischen Grenze in Ungarn eine spezielle Form<br />
des Gefangenenhandels, nämlich der Gefangenenhandel für Lösegeld. Dies war keine einmalige Erscheinung<br />
in Europa: entlang aller Frontlinien (z.B. an der polnisch-tatarischen Grenze oder am Mittelmeer), wo <strong>die</strong><br />
Osmanen über längere Zeit Kriege <strong>gegen</strong> ihre Feinde führten, wurde es zur Praxis, so bereits im 15.<br />
Jahrh<strong>und</strong>ert auf der Balkanhalbinsel. Man ging bei <strong>die</strong>ser Form des Handels so vor, daß man <strong>die</strong> Gefangenen<br />
anläßlich des Beuteverkaufs ähnlich einer Versteigerung (lat. auctio, ung. kótyavetye) unter den Soldaten, <strong>die</strong><br />
am Beutezug teilgenommen hatten, aufteilte <strong>und</strong> <strong>die</strong>se <strong>die</strong> Gefangenen dann versteigerten. Anschließend<br />
handelten <strong>die</strong> Gefangenen mit ihren Haltern ein Lösegeld aus, das sie nach ihrer Entlassung in Form von<br />
Schatzungen (Abgaben) einsammeln mußten. Für ihre Rückkehr übernahmen <strong>die</strong> zurückgebliebenen<br />
Gefangenen Bürgschaft (mit weiteren Geldsummen, mit ihrer Nase oder einem Ohr usw.). Die<br />
Gefangennahme eines wohlhabenden türkischen Offiziers konnte einem eine Vermögen herbeischaffen. Der<br />
Gefangenenhandel bot dem einen oder anderen Grenzhauptmann oder Großgr<strong>und</strong>besitzer entlang der Grenze<br />
somit <strong>die</strong> Möglichkeit des guten Geschäfts. Im südwestlichen Teil Transdanubiens führten vor allem <strong>die</strong><br />
Mitglieder der Familie Batthyány einen regen Handel mit Gefangenen. Ein Beleg dafür liefert das<br />
Gefangenenbuch von Adam Batthyány Grenzoberst der <strong>gegen</strong>über von Kanizsa liegenden Festungen (1633-<br />
1659) über <strong>die</strong> türkischen <strong>und</strong> serbischen Gefangenen aus der Mitte des 17. Jahrh<strong>und</strong>erts. In der<br />
Bestandaufnahme führte er Namen <strong>und</strong> Summe des Lösegeldes bzw. <strong>die</strong> Tilgungsart auf. Die exakte<br />
Inventarisierung war nicht umsonst: von den Lösegeldern hatte <strong>die</strong> Familie in besseren Jahren mehrere<br />
10,000 ungarische Gulden Einnahmen. Natürlich erwies sich der Gefangenenhandel auch für <strong>die</strong> Türken als<br />
lukrativ, denn belief sich das Lösegeld der 178 aus den Grenzfestungen <strong>gegen</strong>über von Kanizsa<br />
verschleppten ungarischen Soldaten zwischen 1644 <strong>und</strong> 1647 auf nahezu 65,000 Gulden.<br />
Literatur: Takáts, 1915, Bd. 1, S. 160-303; Vilfan, 1971, S. 177-199; Izsépy. 1974, S. 159-169; Die Steiermark: Brücke<br />
<strong>und</strong> Bollwerk, 1986, S. 309-312; Varga J., 1995, S. 145-162 <strong>und</strong> Pálffy, 1997/2, S. 5-78 (mit weiterer Literatur).<br />
30V-12<br />
Siegel der Gefangenengemeinde in dem sogenannten „gestutzten Turm“ (Csonkatorony) in Ofen, 1651-<br />
1681<br />
Nr. 1: Budapest, MOL P 1314 Batthyány cs. lt. Missiles Nr. 50 743 (15 Februar 1651), Nr. 2: ebenda Nr. 31 527 (4<br />
September 1651), Nr. 3: ebenda passim (<strong>und</strong>atierte Briefe), Nr. 4: ebenda Nr. 15 615 (<strong>und</strong>atiert, in den 1650er<br />
Jahren), Nr. 5: ebenda passim (Briefe aus den Jahren 1657-1661 <strong>und</strong> Nr. 6: Budapest, MOL P 1865 Sibrik cs. lt.<br />
Fasc. 4, Káldy cs. lt. Aláírás nélküli levelek fol. 46.<br />
Druck: Pálffy, 1997/2., S. 62: Nr. 1-6.<br />
Die im 16. <strong>und</strong> 17. Jahrh<strong>und</strong>ert in türkischen Gefängnissen in Ungarn eingekerkerten Grenzsoldaten<br />
versuchten ihre in den Friedensverträgen verankerten Rechte geltend zu machen <strong>und</strong> <strong>gegen</strong> das blutige<br />
Foltern aufzutreten. Damit läßt sich erklären, daß sich im 17. Jahrh<strong>und</strong>ert Gefangenengemeinden in den<br />
türkischen Gefängnissen zur „Selbstverwaltung“ herausbildeten. Zur Vertretung ihrer Interessen wählten <strong>die</strong><br />
Gefangenen einen erfahrenen Kameraden zum Wirt; dem im sogenannten „gestutzten Turm“ (ung.<br />
Csonkatorony) in Ofen, dem größten Gefängnis des osmanischen Eroberungsgebietes in Ungarn sowohl ein
Schreiber als auch ein Priester behilflich waren ihre verschiedene Aufgaben (Kontaktaufnahme zu den<br />
Gefangenhaltern, Wahl von Bürgen, Organisation der Verpflegung, <strong>die</strong> Prozeßführung der Gefangenen usw.)<br />
zu lösen. Der Priester übernahm <strong>die</strong> Seelsorge, während der Schreiber <strong>die</strong> Urk<strong>und</strong>en der Gefangenen (z.B.<br />
Supplikationen <strong>und</strong> Bürgschaftsbriefe usw.) anfertigte. Zur Beurk<strong>und</strong>ung bzw. Beglaubigung <strong>die</strong>ser<br />
Dokumente ließen <strong>die</strong> Gefangenen Siegel hauen. Aus dem 17. Jahrh<strong>und</strong>ert sind uns sechs solche Siegel der<br />
Gefangenengemeinde des „gestutzten Turmes“ von Ofen bekannt.<br />
Literatur: Nagy, 1868, S. 661-663 <strong>und</strong> Pálffy, 1997/2., S. 52-59.<br />
g. Remuneration des Kriegs<strong>die</strong>nstes<br />
V-13a<br />
Adelsbekräftigung <strong>und</strong> Wappenerweiterung für Georg Ghyczy, Burghauptmann des Graner<br />
Erzbischofs Nikolaus Oláh in Oláhújvár, 4. Dezember 1564, Wien, Kaiser Maximilians II.<br />
Original, Pergament, 60 x 75 cm, lat.<br />
Budapest, MOL P 293 Ghyczy cs. lt., Tétel 1, 4. Dezember 1564, Wien<br />
Druck: Áldásy, 1904, S. 47-49: Nr. LXXX.<br />
Im 16. <strong>und</strong> 17. Jahrh<strong>und</strong>ert stellte der Soldaten<strong>die</strong>nst in den Grenzfestungen für <strong>die</strong> Bauern eine der<br />
bedeutendsten Aufstiegsmöglichkeiten dar. Für den langen <strong>und</strong> erfolgreichen Dienst wurden sie von den<br />
Herrschern mit der Verleihung des Adelstitels <strong>und</strong> einem Wappen bzw. mit Landgütern von unterschiedlicher<br />
Größe belohnt. Kaiser Maximilian II. bestätigte beispielsweise am 4. Dezember 1564 den Adelstitel des<br />
Burghauptmanns der Grenzfestung Oláhújvár Georg Ghyczy <strong>und</strong> seiner Brüder (Wolfgang <strong>und</strong> Johann) <strong>und</strong><br />
erweiterte ihres Wappen. Ghyczy hatte <strong>die</strong> Anerkennung ver<strong>die</strong>nt, da er sein Leben von Jugend an an der<br />
Grenze verbracht hatte. Anfang der 50er Jahre des 16. Jahrh<strong>und</strong>erts <strong>die</strong>nte er unter den Soldaten von Palatin<br />
Thomas Nádasdy (1554-1562, vgl. III-2) zuerst in Szigetvár, dann in Kanizsa, <strong>und</strong> anschließend an der Seite<br />
von Andreas Báthory, wo er sich hohe Achtung verschuf. Später wurde er zum Burghauptmann der Soldaten<br />
von Nikolaus Oláh Erzbischof von Gran (1553-1568) in der Burg von Oláhújvár.<br />
Wappen: vorne aus einer mehrzinnigen Festungsmauer mit gewölbtem offenem Tor wachsend ein gekrönter<br />
grauer Löwe, mit der erhobenen Rechten eine Bärentatze zum eignen Rachen führend; hinten aus gekröntem<br />
grünem Dreiberge sich erhebend ein roter bekleideter, gebogener Arm, in der Faust ein Schwert mit grauer<br />
Parierstange senkrecht emporehaltend, dessen Spitze durch den Hals, eines vom Rumpfe getrennten,<br />
schnurrbärtigen Türkenschädels gestoßen erscheint. Kleino<strong>die</strong>n: zwischen offenem Fluge der Arm mit<br />
Schwert, aber ohne Türkenkopf.<br />
Literatur: Siebmacher, Bd. IV, 15, Taf. 157 <strong>und</strong> S. 197; Nyulászi-Starub, 1999, S. 270 <strong>und</strong> 379: Nr. 113, vgl. noch<br />
Benczédi, 1966, S. 821-827.<br />
V-13b<br />
Adelsbekräftigung <strong>und</strong> Wappenerweiterung für Alexander Bakács von Szentgyörgyvölgy, 15. August<br />
1622, Wien, Kaiser Ferdinand II.<br />
Original, Pergament, Buchformat, 30 x 25 cm, lat.<br />
Budapest, MOL R 64 Tétel 1, 15. August 1622, Adelsbekräftigung für Alexander Bakács.<br />
Druck: Áldásy, 1904, 123-125: Nr. CCVI.<br />
Der Familie Bakács von Szentgyörgyvölgy verlieh noch König Johann Szapolyai (1526-1540) am 11. Juni<br />
1532 den Adelstitel, weil Alexander Bakács d.Ä. in der Schlacht bei Mohács (1526) das Leben von Johann<br />
Bánffy, dem späteren Palatin (1530-1534) gerettet hatte, indem er ihm sein Pferd überließ. Die Mitglieder der<br />
Familie, <strong>die</strong> ihre Besitztümer im westlichen Teil Transdanubiens hatten, ergriffen später <strong>die</strong> Partei von König<br />
Ferdinand I. (1526-1564), dessen Nachfolgern sie ebenfalls treu <strong>und</strong> untertänig <strong>die</strong>nten. Alexander Bakács<br />
d.J., Enkel des Helden von Mohács nahm 1593 – laut seiner Adelsbekräftigung (s.u.) – an der Schlacht bei<br />
Pákozd neben Stuhlweißenburg teil <strong>und</strong> fiel dabei in türkische Gefangenschaft. Nach seiner Freilassung für<br />
das immense Lösegeld in der Höhe von 10,000 Gulden (vgl. V-9-11), blieb er weiterhin Soldat. Erst war er<br />
Rittmeister in Pápa (1600), dann bis zu seinem Tode im Jahre 1626 Oberhauptmann in der 31Grenzfestung<br />
Keszthely am Plattensee. Für <strong>die</strong>se Dienste bestätigte Ferdinand II. am 15. August 1622 den Adelsbrief von<br />
Bakács <strong>und</strong> erweiterte seines Wappen.<br />
Wappen: Im Schild vor einem auf grünem Boden liegenden gezäumten <strong>und</strong> gesattelten weißen Roß zwei<br />
Ritter mit Brustharnisch, Kettenpanzerhemd, umgürteten Krummsäbeln, hohen Sporenstiefeln <strong>und</strong>
Eisenhelmen mit Federschmuck. Der Eine scheint ein laufendes zweites Roß zu besteigen <strong>und</strong> dabei von<br />
dem Anderen unterstützt zu werden (vgl. <strong>die</strong> Heldentat von Alexander Bakács d.Ä. in der Schlacht bei<br />
Mohács 1526). Kleino<strong>die</strong>n: zwischen offenem, je mit einem sechsstrahligen Sterne belegten Fluge ein mit<br />
Kettenpanzer, Brustharnisch, Eisenhandschuhen <strong>und</strong> Stahlhelm bekleideter Mann, in der erhobenen Rechten<br />
ein Schwert mit Parierstange, <strong>die</strong> Linke in <strong>die</strong> Hüfte gestützt. Ringsherum sind das kaiserlichen, das<br />
ungarische, das böhmische, das kroatische, das dalmatinische sowie das slawonische Wappen zu sehen. Die<br />
Adelsbriefbestätigung bekräftigten außer dem Herrscher noch ungarischer Großkanzler Peter Pázmány<br />
(1616-1637) <strong>und</strong> Lorenz Ferenczffy, Hofsekretär (1610-1640) mit ihrer Unterschrift.<br />
Literatur: Siebmacher, Bd. IV, 15, Taf. 20 <strong>und</strong> S. 26., bzw. IV, 15, Suppl., Taf. 6 <strong>und</strong> S. 10; Nyulászi-Starub, 1999, S. 83<br />
<strong>und</strong> 183: Nr. LVII, bzw. S. 292 <strong>und</strong> 406: Nr. 380.<br />
h. Kleinkrieg in den „Friedensjahren“<br />
V-14a<br />
Verzeichnis der Türkenschaden in Ungarn, 1591-1593<br />
Zeitgenössische Abschrift, Papier, 33 x 21,5 cm, deut.<br />
Wien, KA HKR Akten Reg. 1591 Dez. Nr. 54., fol. 1-41, andere wichtige, aber noch une<strong>die</strong>rte Türkenschadenregister:<br />
ebenda Exp. 1589 Aug. Nr. 88, fol. 1-26; Wien, HHStA Turcica Karton 43, Konv. 1, fol. 25-32 <strong>und</strong> ebenda Karton<br />
81, Konv. 1, fol. 238-241.<br />
Zu längeren Friedenszeiten, <strong>die</strong> zwischen den bedeutenderen Türkenkriegen vergingen (1568-1593 <strong>und</strong><br />
1606-1660), konnte <strong>die</strong> Bevölkerung entlang der Grenze den Frieden doch nicht genießen. Die türkischen<br />
Spahis <strong>und</strong> Martalosen fielen nämlich Tag für Tag in das Königreich Ungarn <strong>und</strong> in Kroatien ein <strong>und</strong> wagten<br />
sich sogar bis in das Gebiet der österreichischen Erbländer. Ziel <strong>die</strong>ser Anschläge war es, ihre<br />
Steuereintreibungskompetenz auf den feindlichen Gebieten noch weiter auszudehnen, den Gegner ständig zu<br />
beunruhigen bzw. dessen Festungen <strong>und</strong> Kräfte besser einschätzen zu können (vgl. V-8). Obwohl <strong>die</strong><br />
Friedensabkommen von 1568 <strong>und</strong> 1606 solcherlei Aktionen streng verboten, wurden <strong>die</strong> Vorschriften in<br />
Wirklichkeit nicht eingehalten. Zudem nahmen <strong>die</strong> Türken hin <strong>und</strong> wieder eine kleine Burg ein, wie es z.B.<br />
an der Bergstädtischen Grenze im Falle von Divény <strong>und</strong> Blaustein im Jahre 1575 geschah. Ähnlich erging es<br />
1577-1578 den kleineren Burgen zwischen Wihitsch <strong>und</strong> Sisek an der Kroatischen Grenze. Über <strong>die</strong><br />
Schäden, <strong>die</strong> <strong>die</strong> Türken während <strong>die</strong>ser Beutezüge anrichteten, mußten <strong>die</strong> Burghauptmänner von Zeit zu<br />
Zeit ein Verzeichnis mit Bilanz aufstellen, <strong>die</strong> in Wien summiert <strong>und</strong> dann den in Konstantinopel<br />
stationierten Botschaftern gesandt wurde. Diese legten aufgr<strong>und</strong> der Verzeichnisse am Hof des Sultans<br />
wegen Friedensbruch Klage ein.<br />
Literatur: Ráth, 1860, S. 92-123; Gömöry, 1885, S. 155-178; Simoniti, 1977, S. 491-505; ders., 1980, S. 87-99; ders.,<br />
1981, S. 109-119 <strong>und</strong> ders., 1990.<br />
V-14b<br />
Verzeichnis der Grenzsoldatenschaden in den türkischen Gebieten Ungarns, 1625<br />
Original, Papier, 41 x 30 cm, ung.<br />
Wien, HHStA Turcica Karton 10, Kov. 2, fol. 130-136.<br />
Zu Friedenszeiten führten <strong>die</strong> Grenzsoldaten – ähnlich der Türken – ebenfalls tagtäglich Beutezüge in <strong>die</strong><br />
eroberten ungarischen Gebiete mit völlig identischer Absicht: <strong>die</strong> Grenzsoldaten trieben in den Gebieten des<br />
Feindes Steuern ein, sicherten ihre Lebensmittelversorgung von dort, <strong>und</strong> versuchten dabei <strong>die</strong> schwachen<br />
Punkte der türkischen Festungen auszuk<strong>und</strong>schaften. Ähnlich der Grenzhauptmänner ließen daher auch <strong>die</strong><br />
Paschas in Ungarn häufig <strong>die</strong> von den Grenzsoldaten angerichteten Schäden registrieren. Die Listen wurden<br />
summiert <strong>und</strong> nach Konstantinopel gesandt, wo meist der Großwesir das Schadenverzeichnis – unter<br />
eifrigem Protestieren – den kaiserlichen Botschaftern übergab. Diese hatten das Verzeichnis auf schnellstem<br />
Wege nach Wien weiterzuleiten. Der Hofkriegsrat erfuhr 1625 mittels eines solchen Verzeichnisses über <strong>die</strong><br />
Beutezüge der Grenzsoldaten <strong>und</strong> der dabei angerichteten Schäden in der Gegend von Szeged, Szolnok <strong>und</strong><br />
Gran.<br />
Literatur: Fekete, 1926, S. 22-24: Nr. 12 <strong>und</strong> ders., 1932, passim.
i. Kreudfeuer- <strong>und</strong> Kreudschußsystem<br />
V-15a<br />
Kreudfeuer- <strong>und</strong> Kreudschußpatent Kaiser Maximilians II., 13. August 1575, Wien<br />
OriginalDruck, Papier, 43 x 59 cm, deut.<br />
Wien, KA AFA 1575/8/2.<br />
Druck: Codicis Austriaci, 1704, S. 652-653.<br />
32Obwohl <strong>die</strong> Türkeneinfälle <strong>die</strong> Krainer <strong>und</strong> steirischen Gebiete bereits Ende des 14. Jahrh<strong>und</strong>erts<br />
beeinträchtigt hatten, bedeuteten sie erst mit der Eroberung Bosniens im Jahre 1464 bzw. noch mehr nach<br />
dem Zusammenbruch des Königreichs Ungarn 1526 eine wahre Gefahr. Im Anschluß daran beunruhigten <strong>die</strong><br />
türkischen Spahis <strong>und</strong> Martalosen <strong>die</strong> Einwohner der kroatischen, ungarischen <strong>und</strong> österreichischen Gebiete<br />
jeden Tag mit Einfällen. Aus <strong>die</strong>sem Gr<strong>und</strong> wurde Anfang des 16. Jahrh<strong>und</strong>erts eine besondere Art des<br />
Alarms, das Kreudfeuer- <strong>und</strong> Kreudschhußsystem entwickelt. (Das alte deutsche Wort Krei/Kreu mit der<br />
Bedeutung Geschrei ist in der heutigen Sprache nicht mehr erhalten). Das System funktionierte<br />
folgendermaßen: auf den höher gelegenen Stellen wurden Holzhaufen aufgestapelt, <strong>die</strong> man für Feuerzeichen<br />
anzündete; in den Burgen <strong>und</strong> Burgschlössern wurden mit der Entwicklung der Feuerwaffen Kreudmörser<br />
(lat. mortarium pro dando signo seu rumore, slav. glasnik) angewandt, um <strong>die</strong> Bewohner der Gegend von<br />
den Beutezügen der Türken zu verständigen <strong>und</strong> <strong>die</strong> Festungsbesatzungen beizeiten zu mobilisieren. Durch<br />
<strong>die</strong> festgelegte Zahl der Kanonenschüsse wurde <strong>die</strong> Anwendung eines einfachen Kodesystems möglich. Die<br />
alarmierte Bevölkerung floh in <strong>die</strong> Wälder <strong>und</strong> Sümpfe bzw. <strong>die</strong> sogenannten Fluchtörter der Umgebung,<br />
während sich <strong>die</strong> Soldaten der einzelnen Festungen zur Verfolgung der türkischen Truppen rüsteten. König<br />
Ferdinand I. gab erstmals 1537 sein Patent für das Kreudfeuer- <strong>und</strong> Kreudschußsystem aus, das später von<br />
ihm wie auch seinen Nachfolgern wiederholt (z.B. 1542, 1556, 1575 <strong>und</strong> 1594) nachgeDruckt wurde. Ein<br />
sehr gut ausgearbeitetes System war in der Gegend von Wien <strong>und</strong> Graz bzw. in den steirischen <strong>und</strong> Krainer<br />
Gebieten in Gebrauch.<br />
Literatur: Newald, 1883, S. 259-270; Zahn, 1894, S. 84-113; Otruba, 1955-1956, S. 15-43; ders., 1956, S. 100-105; Die<br />
Steiermark: Brücke <strong>und</strong> Bollwerk, 1986, S. 219-222 <strong>und</strong> Simoniti, 1991, S. 169-179.<br />
V-15b<br />
Kreudschußordnung des Oberhauptmanns der <strong>gegen</strong>über von Kanizsa liegenden Grenzfestungen<br />
Adam Batthyány, 17. Januar 1644, o. O.<br />
Original, Papier, 31 x 20 cm, ung.<br />
Budapest, MOL P 1313 Batthyány cs. lt., Katonai iratok, Csomó 252. fol. 626.<br />
Das Kreudfeuer- <strong>und</strong> Kreudschußsystem war nicht nur in den österreichischen Gebieten, sondern auch an der<br />
ungarischen Grenze in Gebrauch. In den 60er Jahren des 16. Jahrh<strong>und</strong>erts wurde <strong>die</strong> Anwendung des<br />
Alarmsystems in der Bergstädtischen Grenzoberhauptmannschaft getrennt reguliert, im Jahre 1644 erließ<br />
Adam Batthyány, Oberhauptmann der <strong>gegen</strong>über von Kanizsa liegenden Grenzfestungen (1633-1659) eine<br />
Ordnung für <strong>die</strong> Burgen entlang des Flusses Zala. Interessant an <strong>die</strong>ser Ordnung war, daß je nach Richtung<br />
der türkischen Attacke festgelegt wurde, wie viel Schüsse <strong>die</strong> einzelnen Burgen abzugeben hatten, von<br />
welchen Festungen <strong>und</strong> wohin <strong>die</strong>se weiterzugeben waren bzw. wo sich <strong>die</strong> Soldaten der Festungen zur<br />
Aufhaltung <strong>und</strong> Verfolgung des Feindes zu versammeln hatten. Das Kreudschußsystem funktionierte in<br />
<strong>die</strong>sem Fall, was <strong>die</strong> Gr<strong>und</strong>züge anbelangt – natürlich in sehr vereinfachter Form <strong>und</strong> unter einfachsten<br />
Umständen – ähnlich der späteren „Telegraphie“.<br />
Literatur: Varga J., 1981, S. 96.<br />
j. Religionsfreiheit in den Festungen<br />
V-17<br />
Klageschrift der evangelischen Grenzsoldaten zu Vázsony (Transdanubien) an den Oberstleutnant der<br />
Raaber Grenze, Johann Esterházy über ihre Religionsfreiheit, 5. Februar 1675, Nagyvázsony<br />
Original, Papier, 31 x 20 cm, ung. bzw. lat.<br />
Budapest, MOL P 707 Zichy cs. lt. Fasc. 39 et F, Nr. 11, fol. 27-28.<br />
Zu den Privilegien der ungarischen Grenzsoldaten zählte – neben der Steuerfreiheit <strong>und</strong> der selbständigen<br />
Militärgerichtsbarkeit – auch <strong>die</strong> Religionsfreiheit. Diese erlangten sie in der zweiten Hälfte des 16.<br />
Jahrh<strong>und</strong>erts, indem sie <strong>die</strong> Entwicklung ausnutzten, deren zufolge 85-90% der Bevölkerung des
Königreichs Ungarn zum Anhänger einer Richtung des Protestantismus wurde. Auf dem Landtag von<br />
Preßburg von 1608 wurde <strong>die</strong>ses Privilegium gesetzlich bestätigt. Trotzdem verhinderten ab Mitte des 17.<br />
Jahrh<strong>und</strong>erts <strong>die</strong> kampflustigen Vertreter der Gegenreformation <strong>die</strong> Grenzsoldaten dabei, ihren evangelischen<br />
oder reformierten Glauben auszuüben, indem sie ihre Kirchen belagerten oder ihre Prediger vertrieben.<br />
Ähnliches geschah im Jahre 1675 in einer kleineren Burg an der Raaber Grenze: in Vázsony (heute<br />
Nagyvázsony) wurde der Stellvertreter der Burghauptmannschaft, der den evangelischen Prediger beschützt<br />
hatte, ins Gefängnis geworfen. Die evangelischen Burgsoldaten wandten sich in einer Klageschrift an den<br />
Raaber Grenzoberstleutnant (1655-1691) Johann Esterházy <strong>und</strong> baten ihn darin um <strong>die</strong> Freilassung ihres<br />
Predigers <strong>und</strong> um ihr Recht auf Religionsfreiheit.<br />
Literatur: Szabó, 1933, S. 457-470; ders., 1958-1959 <strong>und</strong> Benczédi, 1966, S. 821-827.<br />
33VI. Ungarische Soldaten in den kaiserlichen Armeen<br />
VI-1<br />
Supplikation von Josef Luka von Fünfkirchen an Kaiser Karl V., 21. Dezember 1547<br />
Original, Papier, 32 x 21 cm, lat.<br />
Wien, HHStA Hungarica Misc. Fasc. 425, Konv. B, fol. 6-7 (Nr. 52).<br />
Während auf dem ungarischen Kriegsschauplatz ständig deutsche Reiter <strong>und</strong> Fußsoldaten gebraucht waren,<br />
so war <strong>die</strong> Wiener Kriegsführung im 16. <strong>und</strong> 17. Jahrh<strong>und</strong>ert bei ihren Kriegen auf dem Gebiet des Heiligen<br />
Römischen Reiches stets auf <strong>die</strong> ungarischen Husaren angewiesen. Die ungarischen leichten Reiter eigneten<br />
sich dank ihrer geschickten Wendigkeit sehr gut dazu, <strong>die</strong> Nachschubsroute des Feindes zu durchschneiden<br />
<strong>und</strong> dessen Aufmarschieren zu erschwären. Kaiser Karl V. hatte bereits im schmalkadischen Krieg (1546-<br />
1547) zahlreiche ungarische Husaren rekrutiert, mitunter solche, <strong>die</strong> später zu Grenzobersten aufgestiegen<br />
sind, wie beispielsweise Johann Krusics, Johann Pethõ oder Franz Zay. Zu den weniger bekannten<br />
ungarischen Soldaten zählt Josef Luka aus Fünfkirchen (heute Pécs in Südungarn), der nichtsdestoweniger<br />
eine sehr tapfere Heldentat vollbrachte: im April 1547 nahm er an der Gefangennahme von Johannn<br />
Friedrich von Sachsen (1503-1554), dem großen Rivalen des Kaisers, persönlich teil.<br />
Literatur: Károlyi, 1877, S. 642-654 <strong>und</strong> 841-854.<br />
VI-1a<br />
Bestallung für Adam Batthyány zur Anwerbung von 2000 Husaren für <strong>die</strong> kaiserliche Armee im<br />
Dreißigjährigen Krieg, 16. September 1644, Ebersdorf<br />
Original, Papier, 37 x 49,5 cm, lat.<br />
Wien, KA, Bestallungen Nr. 1405.<br />
In der ersten Hälfte des 17. Jahrh<strong>und</strong>erts stellte der Hofkriegsrat erstmals im kurzen Krieg <strong>gegen</strong> Venedig<br />
(1616-1617), <strong>und</strong> dann während des Dreißigjährigen Krieges (1618-1648) ungarische Soldaten, d.h. sowohl<br />
Husaren als auch Haiducken ein. Ein Teil <strong>die</strong>ser Söldner <strong>die</strong>nte als Soldat aus den Grenzfestungen, den<br />
anderen Teil machten Personen aus, <strong>die</strong> – <strong>und</strong> davon gab es im Land genügend – von Waffen bzw.<br />
Waffenführung etwas verstanden. Ab 1618 beauftragte der Hofkriegsrat nahezu jährlich immer weitere<br />
Burghauptmänner an der Grenze <strong>und</strong> ungarische Großgr<strong>und</strong>besitzer (z.B. Paul Esterházy, Nikolaus Forgách,<br />
Stephan Pálffy, Matthias Somogyi usw.) mit der Anwerbung von Reitern <strong>und</strong> Fußsoldaten. Im September<br />
1644 bekam Adam Batthyány Grenzoberst der <strong>gegen</strong>über von Kanizsa liegenden Festungen <strong>und</strong> Kreisoberst<br />
in Transdanubien (1633-1659) folgende Bestellung von 2000 Husaren. Obwohl <strong>die</strong> ungarischen Regimenter<br />
später aufgelöst wurden, ist ihre Rolle bei den Kriegen nicht zu leugnen. Sie sind ein konkreter Beweis dafür,<br />
daß <strong>die</strong> ungarische <strong>und</strong> österreichische Kriegsführung eine <strong>gemeinsam</strong>e Angelegenheit war.<br />
Literatur: Gömöry, 1888, S. 537.<br />
VI-2<br />
Verzeichnis der ungarischen Husaren <strong>und</strong> Fußknechte unter dem Kommando des neuernannten<br />
Generals der ungarischen Feldmiliz, Graf Ladislaus Csáky, 1686<br />
Zeitgenössische Abschrift, Papier, 32 x 20 cm, lat.<br />
Budapest, MOL P 71 Csáky cs. lt. Fasc. 198, Nr. 1.<br />
Während dem großen Türkenkrieg am Ende des 17. Jahrh<strong>und</strong>erts nahm <strong>die</strong> Wiener Kriegsführung immer
mehr ungarische Kompagnien <strong>und</strong> Regimenter in das kaiserlich Heer auf. Diese spielten bei der<br />
Durchschneidung der Nachschubroute des Feindes sowie bei der Blockade der größeren türkischen<br />
Festungen in Ungarn (z.B. Kanizsa, Stuhlweißenburg, Erlau oder Großwardein) bzw. bei den Feldzügen in<br />
Slawonien, Serbien <strong>und</strong> Bosnien eine wichtige Rolle. Eine der von der Zahl her stärksten ungarischen<br />
Armeen (mit 4000 Mann) hatte noch Graf Ladislaus Csáky (1670-1708) im Jahre 1686 angeworben, davon<br />
zeugt <strong>die</strong> Aufstellung seiner Truppen in lateinischer Sprache. Csáky war bis 1689 General <strong>die</strong>ser <strong>und</strong> anderer<br />
ungarischen Truppen, u.a. der ungarischen Feldmiliz im Theiß-Gebiet. Anschließend war er bis zum Ende<br />
des Türkenkrieges Oberst eines ungarischen Husarenregiments. Für seine Ver<strong>die</strong>nste bekam er 1689 den<br />
Generalfeldwachtmeistertitel.<br />
Literatur: Czigány, 1987, S. 285-290; Szakály, 1987 <strong>und</strong> Mészáros, 1995, S. 375-378.<br />
VI-3<br />
Anwerbungspatent für Graf Nikolaus Pálffy, 1. September 1688<br />
Konzept, Papier, 31 x 20 cm, lat.<br />
Wien, KA AFA Türkenkrieg 1688/9/2 fol. 490-495.<br />
Mit der Befreiung Ungarns verloren <strong>die</strong> früheren Grenzsoldaten ab Mitte der 80er Jahre des 17. Jahrh<strong>und</strong>erts<br />
allmählich ihre Stellung. Das kaiserliche Heer brauchte <strong>die</strong> ungarischen Soldaten jedoch auch weiterhin: zum<br />
einen zur Zurückeroberung der südlichen Gebiete des Landes <strong>und</strong> zum anderen auf der ab 1688<br />
neueröffneten französischen Front. Ab etwa 1685 wurden immer weitere neue ungarische Regimenter<br />
gegründet, bei deren Rekrutierung man versuchte, so viele frühere Grenzsoldaten aufzunehmen, wie nur<br />
möglich. Graf Nikolaus Pálffy (1657-1732), aus dem namhaften ungarischen 34Adelsgeschlecht, später<br />
Palatin von Ungarn (1714-1732) bekam 1688 vom Hofkriegsrat <strong>die</strong> Anordnung, ein Regiment mit 3000<br />
ungarischen Fußsoldaten anzuwerben.<br />
Literatur: Jedlicska, 1910, S. 508-511.<br />
VI-3a<br />
Anwerbungspatent für Graf Stefan Zichy, 3. April 1691, Wien<br />
Konzept, Papier, 31 x 20 cm, lat.<br />
Wien, KA Bestallungen Nr. 2656.<br />
Anfang April 1691 wurde Graf Stefan Zichy (um 1650-1700) an der Raaber Grenze damit beauftragt, so<br />
viele ehemalige Grenzsoldaten in den Sold von Kaiser Leopold I. anzuwerben, wie möglich. Für Zichy war<br />
<strong>die</strong>s keine schwierige Aufgabe, zumal er zu den erfahrensten ungarischen Oberoffizieren des ausgehenden<br />
17. Jahrh<strong>und</strong>erts zählte. 1669-1670 ging er in Deutschland, Niederlanden <strong>und</strong> Frankreich auf Stu<strong>die</strong>nreisen,<br />
wo er sogar Fortifikationswesen stu<strong>die</strong>rte. Nach seiner Heimkehr <strong>die</strong>nte er erst in Raab, dann nahm er ab<br />
1683 an nahezu allen Feldzügen des großen Türkenkrieges teil. Ab 1688 hatte er bis zu seinem Tode (4. Mai<br />
1700) das Amt des Grenzoberstleutnants an der Raaber Grenze inne.<br />
Literatur: Czigány, 1987, S. 285-290 <strong>und</strong> Szakály, 1987.<br />
VI-4<br />
Belagerung von Ofen (Buda), 1686<br />
Michael Wenning.<br />
Papier, Kupferstich, gestochenes Blatt, 30 x 57 cm, ital.<br />
Wien, KA Kartensammlung H III c 98-3.<br />
VI-5<br />
Schlacht bei Zenta, 1697<br />
Jan van Huchtenburg (1647-1733), 1725.<br />
Papier, Kupferstich, 60 x 80 cm, deut.<br />
Budapest, HTM 3893 Kp.<br />
VI-6<br />
Entwurf des Wiener Hofkriegsrates über <strong>die</strong> Demolierung der Grenzfestungen in den inneren<br />
Gebieten Ungarns, Februar 1702<br />
Zeitgenössische Abschrift, Papier, 34 x 21,5 cm, lat.<br />
Budapest, MOL A 14 Insinuata Consilii Bellici 1702: ad Nr. 4, eine andere zeitgenössische Abschrift: Budapest, MOL P<br />
125 Esterházy cs. lt. Nr. 9933.<br />
Druck: Baranyai, 1975, S. 193-195.
Nach der Befreiung Ungarns (1699) wurde der Großteil der Festungen im Landesinneren aus militärischer<br />
Sicht fast überflüssig. Daher fertigte der Hofkriegsrat Anfang 1702 folgenden Plan über <strong>die</strong> Sprengung der<br />
wichtigeren Festungen an. Die endgültige Anordnung über <strong>die</strong> Durchführung erfolgte am 24. Februar durch<br />
Kaiser Leopold I. Die Festungen wurden sechs Gruppen zugeordnet, wobei bei jeder einzelnen Gruppe<br />
deutsche <strong>und</strong> französische Kriegsingenieure <strong>die</strong> Arbeit der Minenexperten, Steinbrecher, Schmiede sowie der<br />
durch <strong>die</strong> Komitate zur Verfügung gestellten Bauern überwachten. Wegen der hohen Kosten <strong>und</strong> der<br />
Schwierigkeiten des Vollzugs wurde <strong>die</strong> Anordnung doch nicht vollständig ausgeführt. Somit wurde in Erlau<br />
nur <strong>die</strong> äußere Burg gesprengt. Zum Sprengen der mehreren Dutzend Minen brauchte man aber auch so etwa<br />
35 Tonnen Schießpulver bzw. mehrere 100 Wagen <strong>und</strong> Zugtiere.<br />
Literatur: Baranyai, 1975, S. 193-195 <strong>und</strong> Molnár, 1987, S. 148-152.<br />
VII. Waffen<br />
VII-1<br />
Österreichische Muskete mit Kombinationsschloß (Lunten- <strong>und</strong> Radschloß), Ende des 17.<br />
Jahrh<strong>und</strong>erts<br />
L: 147 cm, B: 19 cm, T: 11 cm.<br />
Wien, HGM NI 39 151.<br />
35VII-2<br />
Muskete mit Luntenschloß, um 1620<br />
L: 131 cm, B: 17 cm, T: 8 cm.<br />
Wien, HGM NI 39 141.<br />
VII-3<br />
Österreichischer Radschloßkarabiner (Arkebuse), zweite Hälfte des 17. Jahrh<strong>und</strong>erts<br />
L: 98 cm, B: 16 cm, T: 9 cm.<br />
Wien, HGM NI 39 578.<br />
VII-4<br />
Österreichischer Küraß für Reiter, 17. Jahrh<strong>und</strong>ert<br />
H: 32 cm, B: 37 cm, T: 19 cm.<br />
Wien, HGM NI 1652.<br />
VII-5<br />
Zischägge, frühes 18. Jahrh<strong>und</strong>ert<br />
H (mit Ständer) 33 cm, B: 24 cm.<br />
Wien, HGM ohne Nr.<br />
VII-6<br />
Küraß für Offizier, frühes 18. Jahrh<strong>und</strong>ert<br />
H: 37 cm, B: 37 cm, T: 19 cm.<br />
Wien, HGM NI 39 655.<br />
VII-7<br />
Türkischer Streitaxt<br />
L: 157 cm, B: 20 cm.<br />
Wien, HGM NI 40 259.<br />
VII-8<br />
Türkischer Streitkolben<br />
L: 65 cm, Ø 9 cm.<br />
Wien, HGM r 1159.<br />
VII-9<br />
Türkischer Streitkolben<br />
L: 61 cm, Ø 12 cm.<br />
Wien, HGM r 1161.
VII-10<br />
Türkischer Pfeil<br />
L: 71 cm.<br />
Wien, HGM ohne Nr.<br />
VII-11<br />
Türkischer R<strong>und</strong>schild<br />
H: 20 cm, Ø 60 cm.<br />
Wien, HGM 1267.<br />
a. Archivalische Quellen<br />
AA Allgemeine Akten<br />
AFA KA, Alte Feldakten<br />
VIII. Quellen <strong>und</strong> Literatur<br />
Archiv GNM Nürnberg Archiv des Germanischen Nationalmuseums, Nürnberg<br />
A 14 MOL, Magyar Kancelláriai Levéltár [Archiv der Ungarischen Kanzlei], Insinuata<br />
Consilii Bellici<br />
Bestallungen KA, Sonderreihe des Wiener Hofkriegsrates, Bestallungen<br />
Exp. Expedit<br />
E 41 MOL, Litterae ad cameram exaratae<br />
E 136 MOL, MKA Diversae instructiones<br />
E 211 MOL MKA Lymbus<br />
FHKA ÖStA, Finanz- <strong>und</strong> Hofkammerarchiv, Wien<br />
HGM Heeresgeschichtliches Museum, Wien<br />
HFU FHKA, HKA, Hoffinanz Ungarn<br />
HHStA ÖStA, Haus-, Hof- <strong>und</strong> Staatsarchiv, Wien<br />
HKA Hofkammerarchiv<br />
HKR Akten KA, Akten des Wiener Hofkriegsrates<br />
HKR KlA KA, Sonderreihe des Wiener Hofkriegsrates, Hofkriegsrätliches Kanzleiarchiv<br />
HKR Prot. KA, Protokolle des Wiener Hofkriegsrates<br />
HTM Hadtörténeti Múzeum [Heeresgeschichtliches Museum], Budapest<br />
Hungarica HHStA, Ungarische Akten (Hungarica)<br />
IHKR Akten KA, Akten des Innerösterreichischen Hofkriegsrates<br />
Instr. Instruktionen<br />
KA ÖStA, Kriegsarchiv, Wien<br />
Káldy cs. lt. MOL, Familienarchiv Káldy<br />
Katonai iratok Militärakten<br />
KZAB FHKA, HKA, Kameralzahlamtsbücher<br />
MEA HHStA, Mainzer Erzkanzlerarchiv<br />
Misc. Miscellanea<br />
MKA MOL, Magyar Kamara Archívuma [Archiv der Ungarischen Kammer]<br />
MNM Magyar Nemzeti Múzeum [Ungarisches Nationalmuseum], Budapest<br />
MOL Magyar Országos Levéltár [Ungarisches Staatsarchiv), Budapest<br />
MTA Kt. Magyar Tudományos Akadémia, Kézirattár [Bibliothek der Ungarischen Akademie<br />
der Wissenschaften, Handschriftensammlung]
NÖHA FHKA, HKA, Niederösterreichische Herrschaftsakten<br />
NÖLA Niederösterreichisches Landesarchiv, Sankt Pölten<br />
OSzK Kt. Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, Kézirattár [Ungarische Nationalbibliothek,<br />
Handschriftensammlung]<br />
36ÖNB Österreichische Nationalbibliothek, Wien<br />
ÖStA Österreichisches Staatsarchiv, Wien<br />
P 71 Csáky cs. lt. MOL, Csáky család levéltára, Központi levéltár [Familienarchiv Csáky,<br />
Hauptarchiv]<br />
P 108 Esterházy cs. lt. MOL, Esterházy család hercegi ágának levéltára [Familienarchiv Esterházy,<br />
fürstlicher Zweig], Repositorium<br />
P 125 Esterházy cs. lt. MOL, Esterházy család hercegi ágának levéltára, Eszteházy Pál nádor<br />
[Familienarchiv Esterházy, fürstlicher Zweig, Palatin Paul Esterházy]<br />
P 293 Ghyczy cs. lt MOL, Ghyczy család levéltára [Familienarchiv Ghyczy]<br />
P 707 Zichy cs. lt. MOL, Zichy család levéltára [Familienarchiv Zichy]<br />
P 1313 Batthyány cs. lt. MOL, Batthyány család levéltára, A Batthyány család törzslevéltára [Familienarchiv<br />
Batthyány, Hauptarchiv]<br />
P 1314 Batthyány cs. lt. MOL, Batthyány család levéltára [Familienarchiv Batthyány], Missiles<br />
P 1865 Sibrik cs. lt. MOL, Sibrik család levéltára [Familienarchiv Sibrik]<br />
Reg. Registratur<br />
RHKl HHStA, Reichshofkanzlei<br />
RTA Reichstagsakten<br />
R 64 MOL, MKA Mohács utáni gyûjtemény, Hazai címeres és nemesi iratok<br />
[Aktensammlung nach der Schlacht bei Mohács 1526, Einheimische Wappen- <strong>und</strong><br />
Adelsakten]<br />
SA Ständisches Archiv<br />
Török iratok Türkische Akten<br />
Történeti Képcsarnok MNM, Historisches Bildarchiv<br />
Turcica HHStA, Türkei (Turcica)<br />
VUG FHKA, HKA, Vermischte ungarische Gegenstände<br />
WF Weltliche Fürsten<br />
b. Gedruckte Quellen<br />
Áldásy Antal: A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának czímereslevelei 1200-1868 [Adelsbriefe der<br />
Bibliothek des Ungarischen Nationalmuseums 1200-1868], Budapest, 1904. (=A Magyar Nemzeti Múzeum<br />
könyvtárának czímjegyzéke Bd. II.)<br />
Barabás Samu: Zrínyi Miklós a szigetvári hõs életére vonatkozó levelek és okiratok [Briefe <strong>und</strong><br />
Urk<strong>und</strong>en zum Leben des Helden von Szigetvár, Nikolaus Zrínyi], Bd. I-II, Budapest, 1898-1899.<br />
(=Monumenta Hungariae Historica I: Diplomataria Bd. XXIX-XXX)<br />
Braun, Georg-Hogenberg, Franz: Civitates orbis terrarum, Bd. VI, Köln, 1617.<br />
Codicis Austriaci ordine alphabetico compilati pars prima, Wien, 1704.<br />
Descriptio Austriae: Österreich <strong>und</strong> seine Nachbarn im Kartenbild von der Spätantike bis ins 19.<br />
Jahrh<strong>und</strong>ert, Hrsg.: Johannes Dörflinger-Robert Wagner-Franz Wawrik. Wien, 1977.<br />
Fekete Ludwig: Türkische Schriften aus dem Archive des Palatins Nikolaus Esterházy 1606-1645,<br />
Budapest, 1932. (=Schriften des Palatins Nikolaus Esterházy)<br />
Fellner, Thomas-Kretschmayr, Heinrich: Die österreichische Zentralverwaltung, Abt. I. Von Maximilian<br />
I. bis zur Vereinigung der österreichischen <strong>und</strong> böhmischen Hofkanzlei (1749), Bd. 2, Aktenstücke 1491-<br />
1681, Wien, 1907. (=Veröffentlichungen der Kommission für neuere Geschichte Österreichs 6)<br />
Frauenholz, Eugen von: Lazarus von Schwendi: der erste deutsche Verkünder der allgemeinen
Wehrpflicht, Hamburg, 1939.<br />
Fronsperger, Leonhart: Von Kayserlichem Kriegssrechten, Faksimileausgabe, Graz, 1970.<br />
Geõcze István: Hadi tanácskozások az 1577-ik évben [Kriegsberatschlagungen im Jahre 1577], In:<br />
Hadtörténelmi Közlemények [Militärgeschichtliche Mitteilungen] 7 (1894), S. 502-537 <strong>und</strong> 647-673.<br />
Illésy János: Gr. Forgách Ádám bányavárosi fõkapitány katonai rendtartása [Kriegsreglement des<br />
bergstädtischen Grenzobersten Graf Adam Forgách], In: Hadtörténelmi Közlemények [Militärgeschichtliche<br />
Mitteilungen] 5 (1892), S. 569-576.<br />
Krompotic, Louis: Relationen über Fortifikation der Südgrenze des Habsburgerreiches von 16. bis 18.<br />
Jahrh<strong>und</strong>ert, Hannover, 1997.<br />
Laszowski, E[mil]: Važan rukopis Martina Stiera [Eine wichtige Handschrift von Martin Stier], In:<br />
Vjesnik Zemaljskog Arkiva [Zeitschrift des Landesarchiv Kroatiens] 10 (1908), S. 197-202.<br />
Lopašiæ, Radoslav: Spomenici hrvatske krajine: Acta historiam confinii militaris Croatici illustrancia,<br />
Bd. I, Od godine 1479 do 1610, Zagreb, 1884. (=Monumenta spectantia historiam Slavorum Meridionalium<br />
XV)<br />
Merényi Lajos: A véghelyek 1577. évi kivonatos költségvetése [Kriegsbudgetextrakt der Grenzfestungen<br />
aus dem Jahre 1577], In: Hadtörténelmi Közlemények [Militärgeschichtliche Mitteilungen] 6 (1893), S. 543-<br />
545.<br />
Pálffy Géza: A magyarországi és délvidéki végvárrendszer 1576. és 1582. évi jegyzékei [Verzeichnisse<br />
der ungarischen <strong>und</strong> kroatisch-slawonischen Grenzfestungen aus dem Reichstagsjahre 1576 <strong>und</strong> 1582], In:<br />
Hadtörténelmi Közlemények [Militärgeschichtliche Mitteilungen] 108 (1995), Heft 1, S. 114-185. [=Pálffy,<br />
1995/1]<br />
Ráth Károly: Gyõr vármegyének 1642. évben összeírt sérelmi jegyzõkönyve a török ellen [Verzeichnis<br />
der Beschwerden <strong>gegen</strong> <strong>die</strong> Türken des Komitats Raab aus dem Jahre 1642], In: Magyar Történelmi Tár<br />
[Ungarische Historische Sammlung] 7 (1860), S. 92-123.<br />
Szemelvények a magyar hadtörténelem tanulmányozásához [Urk<strong>und</strong>enauswahl zur Untersuchung der<br />
ungarischen Militärgeschichte], Hrsg.: Gábor Rohonyi-László Nagy-Gyula Tóth, Bd. I, Budapest, 1955.<br />
Timár György: Királyi Sziget: Szigetvár várgazdaságának iratai 1546-1565 [Königliche Festung<br />
Szigetvár: Akten der Burgherrschaft von Szigetvár 1546-1565], Pécs, 1989. (=Baranya török kori forrásai I)<br />
Verancsics Antal m. kir. helytartó, esztergomi érsek összes munkái [Sämtliche Werke des ungarischen<br />
königlichen Statthalters <strong>und</strong> Graner Bischofs Anton Verancsics], Hrsg.: László Szalay-Gusztáv Wenzel, Bd.<br />
I-XII, Pest, 1857-1875. (=Monumenta Hungariae Historica II: Scriptores Bd. II-VI, IX-X, XIX-XX, XXV-<br />
XXVI <strong>und</strong> XXXII)<br />
Veress Endre: Basta György hadvezér levelezése és iratai (1597-1607) [Korrespondenz <strong>und</strong> Akten von<br />
Feldherr Giorgio Basta (1597-1607)], Bd. I-II, Budapest, 1909-1913. (=Monumenta Hungariae Historica I:<br />
Diplomataria Bd. XXXIV <strong>und</strong> XXXVII)<br />
Wathay Ferenc énekes könyve (Hasonmás kiadás) [Gesangsbuch von Franz Wathay (Faksimileausgabe)]<br />
Hrsg.: Lajos Nagy, Bd. I-II, Budapest, 1976.<br />
Zrínyi Miklós hadtudományi munkái [Kriegswissenschaftliche Werke von Nikolaus Zrínyi], Budapest,<br />
1976.<br />
c. Literatur<br />
Acsády Ignác: Végváraink és költségeik a XVI. és XVII. században [Unsere Grenzfestungen <strong>und</strong> ihre<br />
Kosten im 16. <strong>und</strong> 17. Jahrh<strong>und</strong>ert], In: Hadtörténelmi Közlemények [Militärgeschichtliche Mitteilungen] 1<br />
(1888), S. 64-85 <strong>und</strong> 246-267.<br />
37Adel im Wandel: Politik-Kultur-Konfession 1500-1700, Rosenburg, 1990.<br />
Antonitsch, Evelyne: Die Wehrmaßnahmen der innerösterreichischen Länder im dreizehnjährigen<br />
Türkenkrieg 1593-1606 (unter besonderer Berücksichtigung Steiermark), Graz, 1975. (= Ungedr. phil. Diss.)<br />
Banfi, F[lorio]-Maggiorotti, L[eone] A[ndrea]: La fortezza di Giavarino in Ungheria ed i suoi architetti<br />
militari italiani, specialmente Pietro Ferabosco, Roma, 1932.<br />
Beck, Wilhelm: Eine Spießrechtsordnung aus dem Jahre 1542, In: Archiv für Kulturgeschichte 6 (1908),<br />
S. 28-38.
Benczédi László: Katonarétegek helyzete a török elleni várháborúkban [Lage der Soldatenschichten in<br />
den Türkenkriegen], In: Hadtörténelmi Közlemények [Militärgeschichtliche Mitteilungen] 13 (1966), Heft 4,<br />
S. 821-827.<br />
Bonin, Burkhard von: Gr<strong>und</strong>züge der Rechtsverfassung in den deutschen Heeren zu Beginn der Neuzeit,<br />
Weimar, 1904.<br />
Borbíró Virgil-Valló István: Gyõr város építéstörténete [Baugeschichte der Stadt Raab], Budapest, 1956.<br />
Bíró Endre: Malomépítés tatán 1587-ben [Mühlenbau in Totis in 1587], In: A Komárom Megyei<br />
Múzeumok Közleményei [Mitteilungen der Museen im Komitat Komorn] 1 (1966), S. 311-324.<br />
Broucek, Peter (Hrsg. unter Mitarb. v. Georg Zivkovic <strong>und</strong> Herbert Klima): Der Allerhöchste<br />
Oberbefehl. Die Garden. Nach Manuskriptfragmenten von Obstlt. Alphons Freiherr von Wrede, Wien, 1988.<br />
(=Militaria Austriaca – Geschichte der k. u. k. Wehrmacht Bd. 6)<br />
Cenner-Wilhelmb Gizella: A Zrínyi család ikonográfiája [Die Ikonographie der Familie Zrínyi],<br />
Budapest, 1997.<br />
Cerwinka, Günther: Die Eroberung der Festung Kanizsa durch <strong>die</strong> Türken im Jahre 1600, In:<br />
Innerösterreich 1564-1619. Hrsg.: Alexander Novotny-Berthold Sutter, Graz, 1968, S. 409-511. (=Joannea:<br />
Publikationen des Steiermärkischen Landesmuseums <strong>und</strong> der Steiermärkischen Landesbibliothek Bd. III)<br />
Czigány István: Ungarisches Militär in den Armeen der Verbündeten, In: Acta Academiae Scientiarum<br />
Hungaricae 33 (1987), Heft 2-4, S. 285-290.<br />
Czigány István: A királyi Magyarország hadügyi fejlõdésének sajátosságai és európai összefüggései<br />
1600-1700 [Eigentümlichkeiten <strong>und</strong> europäische Zusammenhänge der militärischen Entwicklung des<br />
ungarischen Königreiches], Budapest, 1996. (=Kandidátusi értekezés)<br />
Domokos György: Adatok a komáromi vár 16. századi építéstörténetéhez [Angaben zur Baugeschichte<br />
der Festung Komorn im 16. Jahrh<strong>und</strong>ert], In: Limes: Komárom-Esztergom Megyei Tudományos Szemle<br />
[Limes: Wissenschaftliche R<strong>und</strong>schau des Komitats Komorn-Gran] 9 (1997), Heft 4, S. 67-92.<br />
Domokos György: Ottavio Baldigara: Egy itáliai várf<strong>und</strong>áló mester Magyarországon: [Ottavio<br />
Baldigara: ein italienischer Festungsbaumeister in Ungarn], Budapest, 2000. (=A Hadtörténeti Intézet és<br />
Múzeum Millenniumi Könyvtára 2)<br />
Egg, Erich: Der Tiroler Geschützguß 1400-1600, Innsbruck, 1961. (=Tiroler Wirtschaftsstu<strong>die</strong>n 9)<br />
Egger, Rainer: Hofkriegsrat <strong>und</strong> Kriegsministerium als zentrale Verwaltungsbehörden der Militärgrenze,<br />
In: Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs 43 (1993), S. 74-93.<br />
Eiermann, Adolf: Lazarus von Schwendi, Freiherr von Hohenlandsberg, ein deutscher Feldoberst <strong>und</strong><br />
Staatsmann des XVI. Jahrh<strong>und</strong>erts, Freiburg, 1904.<br />
Erben, Wilhelm: Ursprung <strong>und</strong> Entwicklung der deutschen Kriegsartikel, In: Mitteilungen des Instituts<br />
der Österreichischen Geschichtsforschung Erg.-Bd. 6 (1901), S. 473-529.<br />
Erben, Wilhelm: Kriegsartikel <strong>und</strong> Reglements als Quellen zur Geschichte der k. u. k. Armee, In:<br />
Mitteilungen des kaiserlichen <strong>und</strong> königlichen Heeresmuseums im Artilleriearsenal in Wien 1 (1902), S. 1-<br />
200.<br />
Fekete Lajos: Bevezetés a hódoltság török diplomatikájába [Einführung in <strong>die</strong> türkische Diplomatik in<br />
Ungarn], Budapest, 1926. (= A Magyar Országos Levéltár kiadványai)<br />
Fiedler, Siegfried: Kriegswesen <strong>und</strong> Kriegführung im Zeitalter der Landsknechte, Koblenz, 1985.<br />
(=Heerwesen der Neuzeit Abt. I, Bd. 2)<br />
Firnhaber, Friedrich: Zur Geschichte des österreichischen Militärwesens: Skizze der Entstehung des<br />
Hofkriegsrathes, In: Archiv für K<strong>und</strong>e österreichischer Geschichtsquellen 30 (1864), S. 91-178.<br />
Galavics Géza: Kössünk kardot az pogány ellen: Török háborúk és képzõmûvészet [„Lasset uns<br />
umgürten mit dem Schwert <strong>gegen</strong> <strong>die</strong> Heiden“: Türkenkriege <strong>und</strong> bildende Kunst], Budapest, 1986.<br />
Gecsényi Lajos: Ungarische Städte im Vorfeld der Türkenabwehr Österreichs: Zur Problematik der<br />
ungarischen Städteentwicklung, In: Elisabeth Springer-Leopold Kammerhofer (Hrsg.), Archiv <strong>und</strong><br />
Forschung: Das Haus-, Hof- <strong>und</strong> Staatsarchiv in seiner Bedeutung für <strong>die</strong> Geschichte Österreichs <strong>und</strong><br />
Europas, Wien-München, 1993, S. 57-77. (=Wiener Beiträge zur Geschichte der Neuzeit Bd. 20)<br />
Glatzl, Matthias: Die Freiherrn von Teufel in ihrer staats- <strong>und</strong> kirchenpolitischen Stellung zur Zeit der<br />
Reformation <strong>und</strong> Restauration, Wien, 1950. (ungeDruckte phil. Diss.)
Gömöry, Gustav von: Türkennoth <strong>und</strong> das Grenzwesen in Ungarn <strong>und</strong> Croatien während sieben<br />
„Friedensjahren” von 1575 bis 1582, In: Mitteilungen des k. k. Kriegs-Archivs 1885, S. 155-178.<br />
Hausmann, Friedrich: Ferdinand Graf zu Hardegg <strong>und</strong> der Verlust der Festung Raab, In: Walter<br />
Höflechner - Helmut J. Mezler-Andelberg - Othmar Pickl (Hrsg.), Domus Austriae: eine Festgabe Hermann<br />
Wiesflecker zum 70. Geburtstag, Graz, 1983, S. 184-209.<br />
Heischmann, Eugen: Die Anfänge des stehenden Heeres in Österreich, Wien, 1925. (=Deutsche Kultur.<br />
Historische Reihe Bd. III)<br />
Hye-Kerkdal, Heinz: Leonhard Freiherr von Völs der Jüngere, In: Südostdeutsche Museumsblätter 16<br />
(1966), S. 13-21.<br />
Ivanics Mária: A császári felmentõ sereg útja Kanizsára egykorú ábrázolások tükrében (1600.<br />
szeptember 16-október 13.) [Der Weg der kaiserlichen Befreiungstruppen nach Kanizsa im Spiegel der<br />
zeitgenössischen Darstellungen (16. September-13. Oktober 1600)], In: Zalai Múzeum [Zalaer Museum] 4<br />
(1992), S. 45-53.<br />
Iványi Béla: A tüzérség története Magyarországon kezdetétõl 1711-ig [Geschichte der Artillerie in<br />
Ungarn von den Anfängen bis 1711], In: Hadtörténelmi Közlemények [Militärgeschichtliche Mitteilungen]<br />
27-29 (1926-1928), 12 Teile<br />
Izsépy Edit: Az egri törökök fogságába esett magyar rabok kiváltásának és szállításának problémái [Die<br />
Problemen der Auslösung <strong>und</strong> Transportierung der in <strong>die</strong> Hände der Türken zu Erlau gefallenen ungarischen<br />
Gefangenen], In: Agria: Annales Musei Agriensis 11-12 (1974), S. 159-169.<br />
Janko, Wilhelm: Lazarus Freiherr von Schwendi oberster Feldhauptmann <strong>und</strong> Rath Kaiser Maximilian’s<br />
II, Wien, 1871.<br />
Jähns, Max: Geschichte der Kriegswissenschaften vornehmlich in Deutschland, Abt. I-III, München-<br />
Leipzig, 1889-1891.<br />
Jedlicska Pál: Adatok erdõdi báró Pálffy Miklós a gyõri hõsnek életrajza és korához 1552-1600<br />
[Angaben zur Biographie <strong>und</strong> zur Zeit von Nikolaus Pálffy Freiherr von Erdõd, dem Helden zu Raab 1552-<br />
1600], Eger, 1897.<br />
Jedlicska Pál: Eredeti részletek Gróf Pálffy-család okmánytárához 1401-1653 s Gróf Pálffyak életrajzi<br />
vázlatai [Originale Details zur Quellensammlung der gräflichen Familie Pálffy 1401-1653 <strong>und</strong> <strong>die</strong><br />
Lebenslaufskizzen der Mitglieder der gräflichen Familie Pálffy], Budapest, 1910.<br />
Karlovac 1579-1979 [Karlstadt 1579-1979], Karlovac, 1979.<br />
Károlyi Árpád: Magyar huszárok a schmalkaldi háborúban [Ungarische Husaren im schmalkaldischen<br />
Krieg], In: Századok [Jahrh<strong>und</strong>erte] 11 (1877), S. 642-654 <strong>und</strong> 841-854.<br />
Károlyi Árpád: A német birodalom nagy hadi vállalata 1542-ben: Új adalék külviszonyaink történetéhez<br />
[Die große Expedition des Heiligen Römischen Reiches im Jahre 1542: Neue Beiträge zur Geschichte der<br />
auswärtigen Angelegenheiten], Budapest, 1880.<br />
38Kelenik József: A hadügyi forradalom és jelenségei Európában és a magyar királyságban a XVI.<br />
század második felében [Die Militärische Revolution <strong>und</strong> ihre Erscheinungen in Europa <strong>und</strong> im Königreich<br />
Ungarn in der zweiten Hälfte des 16. Jahrh<strong>und</strong>erts], In: Tivadar Petercsák (Hrsg.), Hagyomány és<br />
korszerûség a XVI-XVII. században [Tradition <strong>und</strong> Modernisierung im 16. <strong>und</strong> 17. Jahrh<strong>und</strong>ert], Eger, 1997,<br />
S. 27-41. (Studia Agriensia 17)<br />
Kielmansegg, Erich Graf von: Familien-Chronik der Herren, Freiherren <strong>und</strong> Grafen von Kielmansegg, 2.<br />
erg. <strong>und</strong> verbess. Auflage, Wien, 1910.<br />
Klaniczay Tibor: Zrínyi Miklós [Nikolaus Zrínyi], 2. überarb. Auflage, Budapest, 1964.<br />
Koppány Tibor: A magyarországi végvárak építési szervezete a XVI-XVII. században [Organisation des<br />
Grenzfestungsbauapparates in Ungarn im 16. <strong>und</strong> 17. Jahrh<strong>und</strong>ert], In: Tivadar Petercsák (Hrsg.),<br />
Hagyomány és korszerûség a XVI-XVII. században [Tradition <strong>und</strong> Modernisierung im 16. <strong>und</strong> 17.<br />
Jahrh<strong>und</strong>ert], Eger, 1997, S. 153-177. (=Studia Agriensia 17)<br />
Köhbach, Markus: Die Eroberung von Fülek durch <strong>die</strong> Osmanen 1554: Eine historisch-quellenkritische<br />
Stu<strong>die</strong> zur osmanischen Expansion im östlichen Mitteleuropa, Wien-Köln-Weimar, 1994. (=Zur K<strong>und</strong>e<br />
Südosteuropas II/18)<br />
König, Johann: Lazarus von Schwendi Röm. Kaiserl. Majestät Rat <strong>und</strong> Feldoberst 1522-1583: Beitrag<br />
zur Geschichte der Gegenreformation, Schwendi,1934.
Krenn, Peter: Das Steiermärkische Landeszeughaus in Graz: Eine Übersicht über seine Geschichte <strong>und</strong><br />
seine Waffen, Graz, 1974. (=Veröffentlichungen des Landeszeughauses Graz 2)<br />
Krenn, Peter: Die Nürnberger Waffenlieferungen von 1578/79 an das steiermärkische Landeszeughaus in<br />
Graz, In: Trommel <strong>und</strong> Pfeifen–Militärzelte–Anderthalbhänder–Nürnberger Waffen–Waffenhandel <strong>und</strong><br />
Gewehrerzeugung in der Steiermark. Graz, o. J., S. 82-96. (=Veröffentlichungen des Landeszeughauses Graz<br />
6)<br />
Kruhek, Milan: Karlovac: utvrde, granice i ljudi [Karlstadt: Befestigungen, Grenzen <strong>und</strong> Leute],<br />
Karlovac, 1995. [=Kruhek, 1995/1]<br />
Kruhek, Milan: Krajiške utvrde i obrana hrvatskog kraljevstva tijekom 16. stoljeæa [Die Grenzfestungen<br />
<strong>und</strong> <strong>die</strong> Verteidigung Königreich Kroatiens im 16. Jahrh<strong>und</strong>ert], Zagreb, 1995. (=Biblioteka Hrvatska<br />
povjesnica, Monografije i studije 1) [=Kruhek, 1995/2]<br />
Lesure, Michel: Michel Èernoviæ 'explorator secretus' a Constantinople (1556-1563), In: Turcica 15<br />
(1983), S. 127-154.<br />
Liepold, Antonio: Wider den Erbfeind christlichen Glaubens: Die Rolle des niederen Adels in den<br />
Türkenkriegen des 16. Jahrh<strong>und</strong>erts, Frankfurt am Main-Berlin-Bern-New York-Paris-Wien, 1998.<br />
(=Europäische Hochschulschriften, Reihe 3: Geschichte <strong>und</strong> ihre Hilfswissenschaften Bd. 767)<br />
Loebl, Alfred H.: Zur Geschichte des Türkenkrieges von 1593-1606, Bd. I. Vorgeschichte, Prag, 1899.<br />
(=Prager Stu<strong>die</strong>n aus dem Gebiete der Geschichtswissenschaft Heft VI)<br />
Loserth, Johann: Innerösterreich <strong>und</strong> <strong>die</strong> militärischen Maßnahmen <strong>gegen</strong> <strong>die</strong> Türken im 16.<br />
Jahrh<strong>und</strong>ert: Stu<strong>die</strong>n zur Geschichte der Landesdefension <strong>und</strong> der Reichshilfe, Graz, 1934. (=Forschungen<br />
zur Verfassungs- <strong>und</strong> Verwaltungsgeschichte der Steiermark Bd. XI, Heft 1)<br />
Matunák Mihály: Érsek-Újvár alapítási éve [Gründungsjahr von Neuhäusel], In: Századok<br />
[Jahrh<strong>und</strong>erte] 30 (1896), S. 338-341.<br />
Mészáros Kálmán: Két Csáky László halála (1698, 1708) [Der Tod von zwei Ladislaus Csáky (1698,<br />
1708], In: Fons: Forráskutatás és Történeti Segédtudományok [Fons: Quellenforschung <strong>und</strong> historische<br />
Hilfswissenschaften] 2 (1995), Heft 3, S. 375-378.<br />
Meyer, Christian: Die Feldhauptmannschaft Joachims II. im Türkenkriege von 1542, In: Zeitschrift für<br />
Preußische Geschichte <strong>und</strong> Landesk<strong>und</strong>e 16 (1879), S. 480-538.<br />
Mohl Antal: Gyõr eleste és visszavétele 1594-1598 [Fall <strong>und</strong> Zurückeroberung von Raab 1594-1598],<br />
Gyõr, 1913.<br />
Molnár László, V.: Kanizsa vára [Festung Kanizsa], Budapest, 1987.<br />
Raim<strong>und</strong> Montecuccoli: historische Gedächtnisausstellung. Hafnerbach, 8. September bis 31. Oktober<br />
1980., Hafnerbach, 1980.<br />
Möller, Hans-Michael: Das Regiment der Landsknechte: Untersuchungen zu Verfassung, Recht <strong>und</strong><br />
Selbstverständnis in deutschen Söldnerheeren des 16. Jahrh<strong>und</strong>erts, Wiesbaden, 1976. (=Frankfurter<br />
historische Abhandlungen 12)<br />
Müller, Johannes: Die Ver<strong>die</strong>nste Zacharias Geizkoflers um <strong>die</strong> Beschaffung der Geldmittel für den<br />
Türkenkrieg Kaiser Rudolfs II., In: Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 21<br />
(1900), S. 251-304.<br />
Müller, Johannes: Zacharias Geizkofler 1560-1617, des Heiligen Römischen Reiches Pfennigmeister <strong>und</strong><br />
oberster Proviantmeister im Königreich Ungarn, Baden bei Wien, 1938. (=Veröffentlichungen des Wien<br />
Hofkammerarchivs III)<br />
Nagy Imre: A budai Csonkatorony pecséte [Siegel des sogenannten „gestutzten Turmes“ (ung.<br />
Csonkatorony) in Ofen], In: Századok [Jahrh<strong>und</strong>erte] 2 (1868), S. 661-663.<br />
Neumann, Hartwig: Festungsbaukunst <strong>und</strong> Festungsbautechnik: Deutsche Wehrbauarchitektur vom XV.<br />
bis XX. Jahrh<strong>und</strong>ert, Koblenz, 1988. (=Architectura militaris Bd. 1)<br />
Neumann, Hartwig: Das Zeughaus: Die Entwicklung eines Bautyps von spätmittelalterlichen<br />
Rüstkammer zum Arsenal in deutschsprachigen Bereich vom XV. bis XIX. Jahrh<strong>und</strong>ert., Teil I, Textband,<br />
Bonn, 1992. (=Architectura militaris Bd. 3)<br />
Newald, Joh[ann]: Die Fluchtörter <strong>und</strong> Kreudenfeuer in Niederösterreich, zur Zeit der drohenden<br />
Türken-Invasion, In: Blätter des Vereines für Landesk<strong>und</strong>e von Niederösterreich NF 17 (1883), S. 259-270.
Niederkorn, Jan Paul: Die europäischen Mächte <strong>und</strong> der „Lange Türkenkrieg” Kaiser Rudolfs II. (1593-<br />
1606), Wien, 1993. (=Archiv für österreichische Geschichte Bd. 135)<br />
Niklas, Thomas: Um Macht <strong>und</strong> Einheit des Reiches: Konzeption <strong>und</strong> Wirklichkeit der Politik bei<br />
Lazarus von Schwendi (1522-1583), Husum, 1995. (=Historische Stu<strong>die</strong>n 442)<br />
Nischer, Ernst: Österreichische Kartographen: Ihr Leben, Lehren <strong>und</strong> Wirken, Wien, 1924. (=Die<br />
Landkarte, Fachbücherei für jedermann in Länderaufnahme <strong>und</strong> Kartenwesen 1)<br />
Nyulászi-Starub, Éva: Wappen aus fünf Jahrh<strong>und</strong>erten auf Wappenbriefen im Ungarischen Staatsarchiv,<br />
Szekszárd, 1999.<br />
Oberleitner, Karl: Beiträge zur Geschichte des Dreißigjährigen Krieges mit besonderer Berücksichtigung<br />
des österreichischen Finanz- <strong>und</strong> Kriegswesens, nach den Quellen des k. k. Finanz-Ministerial-Archivs, vom<br />
Jahre 1618-1634, In: Archiv für K<strong>und</strong>e österreichischer Geschichtsquellen 19 (1857), S. 3-48.<br />
Oberleitner, Karl: Österreichs Finanzen <strong>und</strong> Kriegswesen unter Ferdinand I. vom Jahre 1522 bis 1564,<br />
In: Archiv für K<strong>und</strong>e österreichischer Geschichtsquellen 22 (1860), S. 1-231.<br />
Orgler, Flavian: Leonhard Colonna Freiherr von Völs, Landeshauptmann an der Etsch <strong>und</strong> Burggraf von<br />
Tirol, In: Programm des k. k. Gymnasiums zu Bozen 9 (1859), S. 3-31.<br />
Otruba, Gustav: Zur Geschichte des Fernmeldewesens in Österreich, In: Technologisches<br />
Gewerbemuseum, Jahresbericht 1955/56, S. 15-43.<br />
Otruba, Gustav: Die Kreudenfeuersicherung der Stadt Wien im 16. <strong>und</strong> 17. Jhdt., In: Unsere Heimat 27<br />
(1956), S. 100-105.<br />
Pálffy Géza: A fõkapitányi hadiipari mûhely kiépülése Kassán és nyersanyagellátó forrásai [Der Ausbau<br />
des königlichen Zeughauses zu Kaschau <strong>und</strong> <strong>die</strong> Quellen zu seiner Rohmaterialversorgung]. In: Tivadar<br />
Petercsák-Ernõ Petõ (Hrsg.), Végvár és környezet [Grenzfestung <strong>und</strong> Umgebung], Eger, 1995, S. 183-221.<br />
(=Studia Agriensia 15) [=Pálffy, 1995/2]<br />
Pálffy Géza: Katonai igazságszolgáltatás a királyi Magyarországon a XVI-XVII. században<br />
[Militärgerichtsbarkeit im Königreich Ungarn im 16. <strong>und</strong> 17. Jahrh<strong>und</strong>ert], Gyõr, 1995. [=Pálffy, 1995/3]<br />
Pálffy Géza: A magyarországi török és királyi végvárrendszer fenntartásának kérdéséhez [Unterhaltung<br />
der türkischen <strong>und</strong> königlichen Grenzfestungen in Ungarn im 16. Jahrh<strong>und</strong>ert]. In: Keletkutatás<br />
[Ostforschung] Frühjahr 1995, S. 61-86. [=Pálffy, 1995/4]<br />
Pálffy Géza: Védelmi övezetek a Tiszától keletre a 16. században [Verteidigungszonen östlich von der<br />
Theiß im 16. Jahrh<strong>und</strong>ert], 39In: István Lengvári (Hrsg.), In memoriam Barta Gábor: Tanulmányok Barta<br />
Gábor emlékére [Stu<strong>die</strong>n in memoriam Gábor Barta], Pécs, 1996, S. 209-228. [=Pálffy, 1996/1]<br />
Pálffy Géza: Egy Zala megyei település nevének keletkezéstörténete és eddig ismeretlen XVI. századi<br />
névadója. (Kilimán falu és Andreas Kielman von Kielmansegg) [Entstehungsgeschichte des Ortsnamens<br />
einer Dorfgemeinde im Komitat Zala <strong>und</strong> ihrer unbekannter Namengeber aus dem 16. Jahrh<strong>und</strong>ert: Dorf<br />
Kilimán <strong>und</strong> Andreas Kielman von Kielmansegg] In: Magyar Nyelv [Ungarische Sprache] 92 (1996), Heft 2,<br />
S. 163-174. [=Pálffy, 1996/2]<br />
Pálffy Géza: A rabkereskedelem és rabtartás gyakorlata és szokásai a XVI-XVII. századi török-magyar<br />
határ mentén. (Az oszmán-magyar végvári szokásjog történetéhez) [Gefangenenhandel <strong>und</strong><br />
Gefangenenhaltung in Ungarn im 16. <strong>und</strong> 17. Jahrh<strong>und</strong>ert: Zur Geschichte des osmanisch-ungarischen<br />
Grenzbrauches], In: Fons: Forráskutatás és Történeti Segédtudományok [Fons: Quellenforschung <strong>und</strong><br />
historische Hilfswissenschaften] 4 (1997), Heft 1, S. 5-78. [=Pálffy, 1997/1]<br />
Pálffy Géza: Várfeladók feletti ítélkezés a 16-17. századi Magyarországon: A magyar rendek hadügyi<br />
jogkörének kérdéséhez [Urteilsfällung über Festungsaufgeber im 16. <strong>und</strong> 17. Jahrh<strong>und</strong>ert in Ungarn: Zur<br />
Frage des militärischen Rechtsbereiches der ungarischen Stände], Levéltári Közlemények [Archivalische<br />
Mitteilungen] 68 (1997), Heft 1-2, S. 199-221. [=Pálffy, 1997/2]<br />
Pálffy Géza: A veszprémi végvár fõ- és vicekapitányainak életrajzi adattára (16-17. század) [Datenbank<br />
zum Lebenslauf der Ober- <strong>und</strong> Vizehauptmänner der Grenzfestung Veszprém, 16-17. Jahrh<strong>und</strong>ert], In:<br />
Veszprém a török korban: Felolvasóülés Veszprém török kori emlékeirõl [Veszprém zur Türkenzeit: Vorträge<br />
der Tagung über <strong>die</strong> Geschichte von Veszprém zur Türkenzeit], Veszprém, 1998, S. 91-188. (=Veszprémi<br />
Múzeumi Konferenciák 9)<br />
Pálffy Géza: Hírszerzés és hírközlés a törökkori Magyarországon [Nachrichten<strong>die</strong>nst <strong>und</strong><br />
Nachrichtenübermittlung in Ungarn von 15-17. Jahrh<strong>und</strong>ert], In: Tivadar Petercsák-Mátyás Berecz (Hrsg.),
Információáramlás a magyar és török végvári rendszerben [Nachrichtenübermittlung in den ungarischen <strong>und</strong><br />
osmanischen Grenzfestungen in Ungarn], Eger, 1999, S. 33-63. (= Studia Agriensia, Bd. 20) [=Pálffy,<br />
1999/1]<br />
Pálffy Géza: A császárváros védelmében: A gyõri fõkapitányság története 1526-1598 [In Verteidigung<br />
der Kaiserstadt: Geschichte der Raaber Grenze von 1526 bis 1598], Gyõr, 1999. [=Pálffy, 1999/2]<br />
Pálffy Géza: Európa védelmében: Haditérképészet a Habsburg Birodalom magyarországi határvidékén a<br />
16-17. században [Verteidigung Europas: Militärkartographie auf dem ungarischen Kriegsschauplatz des<br />
Habsburgerreiches <strong>gegen</strong> <strong>die</strong> Osmanen im 16. <strong>und</strong> 17. Jahrh<strong>und</strong>ert], 2. verb. <strong>und</strong> erg. Aufl. Pápa, 2000.<br />
[=Pálffy, 2000/1]<br />
Pálffy Géza: The Origins and Development of the Border Defence System Against the Ottoman Empire<br />
in Hungary (Up to the Early Eighteenth Century), In: Ottomans, Hungarians, and Habsburgs in Central<br />
Europe: The Military Confines in the Era of the Ottoman Conquest. Ed.: Géza Dávid and Pál Fodor. Leiden-<br />
Boston-Köln, 2000, S. 3-69. (=The Ottoman Empire and its Heritage, Politics, Society and Economy, Ed.:<br />
Suraiya Faroqhi and Halil Inalcik, Vol. 20) [=Pálffy, 2000/2]<br />
Pálffy Géza-Perger, Richard: A magyarországi török háborúk résztvevõinek síremlékei Bécsben (XVI-<br />
XVII. század) [Wiener Grabdenkmäler der Teilnehmer der Türkenkriegen in Ungarn (Datenbank – 16-17.<br />
Jahrh<strong>und</strong>ert], In: Fons: Forráskutatás és Történeti Segédtudományok [Fons: Quellenforschung <strong>und</strong><br />
historische Hilfswissenschaften] 5 (1998), Heft 2, S. 207-263.<br />
Pataki Vidor: A XVI. századi várépítés Magyarországon [Festungsbauten in Ungarn im 16. Jahrh<strong>und</strong>ert],<br />
In: A Bécsi Magyar Történeti Intézet Évkönyve [Jahrbuch des Instituts für Ungarische Geschichtsforschung<br />
in Wien] 1 (1931), S. 98-132.<br />
Pausch, Alfons: Türkensteuer im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation: Dokumente aus dem 16.<br />
Jahrh<strong>und</strong>ert, Köln, 1986.<br />
Perger, Richard: Die Haiden von Guntramsdorf, In: Jahrbuch der Heraldisch-Genealogischen<br />
Gesellschaft „Adler“ 3. Folge 7 (1967-1970), S. 95-127.<br />
Perjés Géza: Zrínyi Miklós és kora [Nikolaus Zrínyi <strong>und</strong> seine Zeit], Budapest, 1965.<br />
Pertl, Franz: Die Grenzabwehr <strong>gegen</strong> <strong>die</strong> Türken im westlichen Ungarn <strong>und</strong> <strong>die</strong> niederösterreichischen<br />
Stände 1564-1601, Wien, 1939. (= Ungedr. phil. Diss.)<br />
Pfannl Jenõ: Régi ábrák és képek Gyõr váráról [Alte Darstellungen <strong>und</strong> Bilder über <strong>die</strong> Festung Raab],<br />
In: Gyõri Szemle [Raaber R<strong>und</strong>schau] 1 (1930), S. 217-242.<br />
Pichler, Fritz-Meran, Franz Graf: Das Landes-Zeughaus in Graz, Bd. 1-2, Leipzig, 1880.<br />
Pollack, Martha D.: Military Architecture, Cartography and the Representation of the Early Modern<br />
European City: A Checklist of Treatises on Fortification in The Newberry Library, Chigaco, 1991.<br />
Regele, Oskar: Der österreichische Hofkriegsrat 1556-1848, Wien, 1949. (=Mitteilungen des<br />
Österreichischen Staatsarchivs Erg. Bd. 1/1)<br />
Roth, Franz Otto: Wihitsch <strong>und</strong> Weitschawar: Zum Verantwortungsbewußtsein der adeligen Landstände<br />
Innerösterreichs in Gesinnung <strong>und</strong> Tat im türkischen ‚Friedensjahr’ 1578. Teil I-II, In: Zeitschrift des<br />
Historischen Vereines für Steiermark 60 (1969), S. 199-275 <strong>und</strong> 61 (1970), S. 151-214.<br />
Sapper, Christian: Die Zahlamtsbücher im Hofkammerarchiv 1542-1825, in: Mitteilungen des<br />
Österreichischen Staatsarchivs 35 (1982), S. 404-455.<br />
Schmidtchen, Volker: Bombarden, Befestigungen, Büchsenmeister. Von den ersten Mauerbrechern des<br />
Spätmittelalters zur Belagerungsartillerie der Renaissance: Eine Stu<strong>die</strong> zur Entwicklung der Militärtechnik,<br />
Düsseldorf, 1977.<br />
Schnur, Roman: Lazarus von Schwendi (1522-1583): Ein unerledigtes Thema der historischen<br />
Forschung, In: Zeitschrift für Historische Forschung 14 (1987), S. 27-46.<br />
Schulze, Winfried: Landesdefension <strong>und</strong> Staatsbildung: Stu<strong>die</strong>n zum Kriegswesen des<br />
innerösterreichischen Territorialstaates (1564-1619). Wien-Köln-Graz, 1973. (=Veröffentlichungen der<br />
Kommission für neuere Geschichte Österreichs 60)<br />
Schulze, Winfried: Reich <strong>und</strong> Türkengefahr im späten 16. Jahrh<strong>und</strong>ert: Stu<strong>die</strong>n zu den politischen <strong>und</strong><br />
gesellschaftlichen Auswirkungen einer äußeren Bedrohung, München, 1978.<br />
Schwarzenberg, Karl, Fürst zu: Geschichte der reichsständischen Hauses Schwarzenberg, Neustadt an
der Aisch, 1963. (=Veröffentlichungen der Gesellschaft für Fränkische Geschichte, Reihe IX: Darstellungen<br />
aus der fränkischen Geschichte Bd. 16; Bibliothek familiengeschichtlicher Arbeiten XXX)<br />
Sedlák, František: Z dejín pevnosti Leopoldov [Aus der Geschichte der Festung Leopoldstadt], In:<br />
Vlastivedný èasopis [Heimatgeschichtliche Zeitschrift] 12 (1963), S. 151-153.<br />
Setton, Kenneth M.: The Papacy and the Levant (1204-1571), Vol. IV, The Sixteeenth Century from<br />
Julius III to Pius V, Philadelphia, 1984. (=Memoirs of the American Philosophical Society, Held at<br />
Philadelphia for Promoting Useful Knowledge Vol. 162)<br />
Siebmacher’s großes <strong>und</strong> allgemeines Wappenbuch, Bd. IV, Abt. 15, Wappenbuch des Adels von Ungarn<br />
samt den Nebenländern der St. Stephans-Krone. Hrsg.: Géza Csergheö de N.Tacskánd, Heft 1-7, Heft 8-14<br />
<strong>und</strong> Suppl.-Bd. Nürnberg, 1885-1894.<br />
Simon Éva: Magyar nagybirtokosok tervezetei a Kanizsával szembeni végvidék kiépítésérõl [Pläne der<br />
ungarischen Großgr<strong>und</strong>besitzer über <strong>die</strong> Erbauung der <strong>gegen</strong>über von Kanizsa liegenden<br />
Grenzoberhauptmannschaft], In: Csaba Káli (Hrsg.), Zalai történeti tanulmányok [Zalaer Geschichtliche<br />
Stu<strong>die</strong>n], Zalaegerszeg, 1997, S. 61-86. (=Zalai Gyûjtemény 42)<br />
Simoniti, Vasko: Prispevek k poznavanju turških vpadov v letih od 1570 do 1575 [Beitrag zur Kenntnis<br />
der Geschichte der Türkeneinfälle in Slowenien in den Jahren 1570-1575], In: Zgodovinski èasopis<br />
[Historische Zeitschrift] 32 (1977), Heft 4, S. 491-505.<br />
Simoniti, Vasko: Prispevek k poznavanju turških vpadov od leta 1576 do zaèetka gradnje Karlovca leta<br />
1579 [Beitrag zur Kenntnis der Geschichte der Türkeneinfälle in Slowenien vom Jahre 1576 bis zum Anfang<br />
des Aufbaues der Stadt Karlovac im Jahre 1579], 40In: Zgodovinski èasopis [Historische Zeitschrift]34<br />
(1980), Heft 1-2, S. 87-99.<br />
Simoniti, Vasko: Prispevek k poznavanju virov za zgodovino turških vpadov v letih od 1580-1589<br />
[Beitrag zur Kenntnis der Quellen über <strong>die</strong> Türkeneinfälle in Slowenien in den Jahren 1580-1589], In:<br />
Arhivi: Glasilo Arhivskego društva in arhivov Slovenije [Archiven: Jahrbuch der Archivgesellschaft in<br />
Slowenien] 4 (1981), Heft 1-2, S. 109-119.<br />
Simoniti, Vasko: Turki so v deželi že: Turški vpadi na slovensko ozemlje v 15. in 16. stoletju<br />
[Türkeneinfälle in Slowenien im 15. <strong>und</strong> 16. Jahrh<strong>und</strong>ert], Celje, 1990.<br />
Simoniti, Vasko: Vojaška organizacija na Slovenskem v 16. stoletju [Kriegsorganisation in Slowenien im<br />
16. Jahrh<strong>und</strong>ert], Ljubljana, 1991.<br />
Söptei István (Hrsg.): Nádasdy Tamás (1498-1562), Tudományos emlékülés: Sárvár, 1998. szeptember<br />
10-11. [Thomas Nádasdy (1498-1562): wissenschaftliche Gedenktagung, Sárvár, 10-11. September 1998],<br />
Sárvár, 1999. (= A Nádasdy Ferenc Múzeum kiadványai Bd. 3)<br />
Steglich, Wolfgang: Die Reichstürkenhilfe in der Zeit Karls V., In: Militärgeschichtliche Mitteilungen<br />
(1972) Heft 1, S. 7-55.<br />
Die Steiermark: Brücke <strong>und</strong> Bollwerk, Katalog der Landesausstellung, Schloß Herberstein bei<br />
Stubenberg, 3. Mai bis 26. Oktober 1986, Hrsg.: Gerhard Pferschy-Peter Krenn, Graz, 1986.<br />
(Veröffentlichungen des Steiermärkischen Landesarchivs 16)<br />
Steinwenter, Artur: Ein General-Intendant im 16. Jahrh<strong>und</strong>erte, In: Zeitschrift des Historischen Vereines<br />
für Steiermark 11 (1913), Heft 1-2, S. 51-84.<br />
Šimonièiæ, Jozef: Mesto Leopoldov – jeho vznik a vývoj [Leopoldstadt – seine Entstehung <strong>und</strong><br />
Entwicklung], In: Vlastivedný èasopis [Heimatgeschichtliche Zeitschrift] 20 (1971), S. 72-73.<br />
Szabó István: Ellenreformáció a végvárakban 1670-1681 [Gegenreformation in den Grenzfestungen<br />
1670-1681], In: Emlékkönyv Károlyi Árpád születése nyolcvanadik fordulójának ünnepére, 1933 október 7<br />
[Festschrift zum 80. Geburtstag von Árpád Károlyi, 7. Oktober 1933], Budapest, 1933, S. 457-470.<br />
Szabó István: Protestáns egyháztörténeti adatok az 1670-1681. évekbõl a bécsi hadilevéltárból [Angaben<br />
zur protestantischen Kirchengeschichte in den Jahren 1670-1681 aus dem Wiener Kriegsarchiv], In:<br />
Egyháztörténet [Kirchengeschichte] 4 (1958), Heft 1, S. 203-230; 5 (1959) Heft 1-2, S. 132-174 <strong>und</strong> Heft 3-<br />
4, S. 301-370.<br />
Szakály Ferenc: Hungaria eliberata: Die Rückeroberung von Buda im Jahr 1686 <strong>und</strong> Ungarns Befreiung<br />
von der Osmanenherrschaft (1683-1718), Budapest, 1987.<br />
Szakály Ferenc: L’espansione turca in Europa centrale dagli inizi alla fine del secolo XVI, In: Giovanna<br />
Motta-Franco Angeli (Hrsg.), I Turchi il Mediterraneo e l’Europa, Milano, 1998, S. 133-151.
Széchy Károly: Gróf Zrínyi Miklós (1620-1664) [Graf Nikolaus Zrínyi (1620-1664)], Bd. I-V, Budapest,<br />
1896-1902. (=Magyar Történeti Életrajzok sorozat)<br />
Szendrei János: Váraink rendszere és fölszerelése a XVI. és XVII. században [System <strong>und</strong> Versorgung<br />
der Burgen im 16. <strong>und</strong> 17. Jahrh<strong>und</strong>ert], In: Hadtörténelmi Közlemények [Militärgeschichtliche<br />
Mitteilungen] 1 (1888), S. 86-103, 416-430 <strong>und</strong> 617-631.<br />
Szendrei János (Hrsg.): Magyar hadtörténelmi emlékek az ezredéves országos kiállításon [Ungarische<br />
militärgeschichtliche Objekte an der Millenniums-Landesausstellung], Budapest, 1896.<br />
Takáts Sándor: A magyar gyalogság megalakulása [Die Aufstellung der ungarischen Fußknechte],<br />
Budapest, 1908.<br />
Takáts Sándor: Rajzok a török világból [Skizzen aus der Türkenzeit], Bd. 1-3, Budapest, 1915-1917.<br />
Tóth Sándor László: A mezõkeresztesi csata és a tizenöt éves háború [Die Schlacht bei Mezõkeresztes<br />
1596 <strong>und</strong> der „Lange Türkenkrieg“], Szeged, 2000.<br />
Traut, Hermann: Kurfürst Joachim II. von Brandenburg <strong>und</strong> der Türkenfeldzug vom Jahre,<br />
Gummersbach, 1892.<br />
Valentinitsch, Helfried: Großunternehmer <strong>und</strong> Heereslieferanten in der Steiermark <strong>und</strong> an der<br />
Windischen Grenze: Zur Geschichte des Tuchhandels im 17. Jahrh<strong>und</strong>ert, In: Zeitschrift des Historischen<br />
Vereines für Steiermark 66 (1975), S. 141-165.<br />
Valentinitsch, Helfried: Nürnberger Waffenhändler <strong>und</strong> Heereslieferanten in der Steiermark im 16. <strong>und</strong><br />
17. Jahrh<strong>und</strong>ert, In: Mitteilungen des Vereines für Geschichte der Stadt Nürnberg 64 (1977), S. 165-182.<br />
Valentinitsch, Helfried: Zur Geschichte des Handels <strong>und</strong> der Produktion von Handfeuerwaffen in der<br />
Steiermark im Zeitalter der Türkenkriege, In: Trommel <strong>und</strong> Pfeifen–Militärzelte–Anderthalbhänder–<br />
Nürnberger Waffen–Waffenhandel <strong>und</strong> Gewehrerzeugung in der Steiermark. Graz, o. J., S. 97-143.<br />
(=Veröffentlichungen des Landeszeughauses Graz 6)<br />
Vándor László: Bajcsa vára (Egy rövid életû vár Kanizsa határában) [Die Burg Weitschawar – eine<br />
kurzlebige Burg in der Gemarkung von Kanizsa], In: Zalai Múzeum [Zalaer Museum] 7 (1997), S. 27-30.<br />
Vándor László: A bajcsai vár feltárásáról (1995-1996. évi eredmények)/Die Freilegung der Festung<br />
Bajcsa, In: Katalin H. Simon (Hrsg.): Népek a Mura mentén/Völker an der Mur/Ljudi uz Muru/Ljudje ob<br />
Muri, Bd. 2, Zalaegerszeg, 1998, S. 101-109.<br />
Varga J. János: Szervitorok katonai szolgálata a XVI-XVII. századi dunántúli nagybirtokon [Der<br />
Soldaten<strong>die</strong>nst der Servitores auf dem Großgr<strong>und</strong>besitz in Transdanubien im 16. <strong>und</strong> 17. Jahrh<strong>und</strong>ert],<br />
Budapest, 1981. (=Értekezések a történeti tudományok körébõl, Új sorozat 94)<br />
Varga J. János: Gefangenenhaltung <strong>und</strong> Gefangenenhandel auf dem Batthyány-Gr<strong>und</strong>besitz im 16.-17.<br />
Jahrh<strong>und</strong>ert, In: Burgenländische Heimatblätter 4 (1995), S. 145-162.<br />
Vilfan, Sergij: Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Türkenkriege aus der Sicht der Ranzionierung, der<br />
Steuern <strong>und</strong> Preisbewegung, In: Othmar Pickl (Hrsg.), Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Türkenkriege:<br />
Die Vorträge des 1. Internationalen Grazer Symposions zur Wirtschafts- <strong>und</strong> Sozialgeschichte Südosteuropas<br />
(5. bis 10. Oktober 1970), Graz, 1971, S. 177-199. (=Grazer Forschungen zur Wirtschafts- <strong>und</strong><br />
Sozialgeschichte Bd. 1)<br />
Villányi Szaniszló: Gyõr-vár és város helyrajza, erõdítése, háztelek- és lakossági viszonyai a XVI. és<br />
XVII. században [Gr<strong>und</strong>riß, Befestigung, Häuser <strong>und</strong> Bevölkerung der Burg <strong>und</strong> Stadt Raab im 16. <strong>und</strong> 17.<br />
Jahrh<strong>und</strong>ert], Gyõr, 1882.<br />
Wagner, Georg: Das Türkenjahr 1664: Eine europäische Bewährung: Raim<strong>und</strong> Montecuccoli, <strong>die</strong><br />
Schlacht von St. Gotthard-Mogersdorf <strong>und</strong> der Friede von Eisenburg (Vasvár), Eisenstadt, 1964.<br />
(=Burgenländische Forschungen 48)<br />
Wessely, Kurt: Die Regensburger „harrige” Reichshilfe 1576, In: Die russische Gesandtschaft am<br />
Regensburger Reichstag 1576. Mit Beiträgen von Ekkehard Völkl <strong>und</strong> Kurt Wessely, Regensburg, 1976, S.<br />
31-55. (=Schriftenreihe des Regensburger Osteuropainstituts 3)<br />
Widter, A[nton]: Die Teufel zu Winzendorf, In: Berichte <strong>und</strong> Mitteilungen des Altertums-Vereines zu<br />
Wien 23 (1886), S. 104-114.<br />
Wissgrill, Franz Karl: Teufel von Krottendorf Freyh: zu G<strong>und</strong>ersdorf, Eckhartsau etc., In: Berichte <strong>und</strong><br />
Mitteilungen des Altertums-Vereines zu Wien 23 (1886), S. 131-136.
Zahn, Joseph v[on]: Kreidfeuer, In: ders.: Styriaca: GeDrucktes <strong>und</strong> ungeDrucktes zur steierm.<br />
Geschichte <strong>und</strong> Culturgeschichte, Graz, 1894, S. 84-113.<br />
Zmegaè, Andrej: Karlstadt – Karlovac. Zur Frage der befestigten Idealstadt, In: Militärische Bedrohung<br />
<strong>und</strong> bauliche Reaktion: Festschrift für Volker Schmidtchen, Hrsg.: Elmar Brohl, Marburg, 2000, S. 62-70.<br />
Žontar, Josef: Michael Èernoviæ, Geheimagent Ferdinands I. <strong>und</strong> Maximilians II., <strong>und</strong> seine<br />
Berichterstattung, In: Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs 24 (1971), S. 169-222.<br />
Žontar, Josip: Obvešèevalna služba in diplomacija avstrijskih Habsburžanov v boju proti Turkom v 16.<br />
stoletju [Der K<strong>und</strong>schafter<strong>die</strong>nst <strong>und</strong> <strong>die</strong> Diplomatie der österreichischen Habsburger im Kampf <strong>gegen</strong> <strong>die</strong><br />
Türken im 16. Jahrh<strong>und</strong>ert], Ljubljana, 1973. (=Slovenska Akademija Znanosti i Umetnosti, Razred za<br />
Zgodovinske i Družbene Vede I. Dela 18; Inštitut za Obèo in Naradno Zgodovino 5)