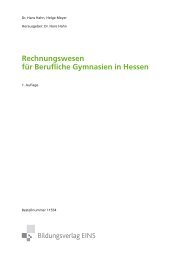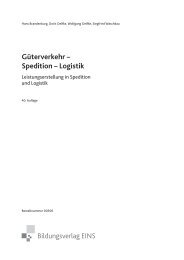Die Rolle als Wirtschaftsbürger - Nelson Thornes
Die Rolle als Wirtschaftsbürger - Nelson Thornes
Die Rolle als Wirtschaftsbürger - Nelson Thornes
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Alfons Axmann, Manfred Scherer<br />
Betrifft<br />
Wirtschaft<br />
Arbeitsheft<br />
5. Auflage<br />
Bestellnummer 3606A
Haben Sie Anregungen oder Kritikpunkte zu diesem Produkt?<br />
Dann senden Sie eine E-Mail an 3606A_005@bv-1.de<br />
Autoren und Verlag freuen sich auf Ihre Rückmeldung.<br />
Bildquellenverzeichnis<br />
akg-images, Berlin, S. 10<br />
Bildungsverlag EINS/Angelika Brauner, S. 88, 89<br />
Deutscher Sparkassen Verlag, Stuttgart, S. 91<br />
dpa-infografik, Hamburg, S. 7, 8, 28, 30, 31, 38, 50, 76, 86<br />
Erich Schmidt Verlag, Berlin, S. 51, 54<br />
Fotolia.com, S. 5 (santi), 42 rechts (Yvonne Bogdanski)<br />
Haitzinger, Horst, S. 17<br />
IHK Erfurt, S. 8<br />
imu-infografik, Duisburg, S. 90<br />
MEV Verlag, Augsburg, Umschlag, S. 13 (2x)<br />
Poth, Chlodwig, www.chlodwig-poth.com, S. 9<br />
Project Photos, Augsburg, S. 42 links<br />
www.bildungsverlag1.de<br />
Bildungsverlag EINS GmbH<br />
Sieglarer Straße 2, 53842 Troisdorf<br />
ISBN 978-3-8242-3606-0<br />
© Copyright 2010: Bildungsverlag EINS GmbH, Troisdorf<br />
Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Nutzung in anderen <strong>als</strong> den gesetzlich zugelassenen<br />
Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.<br />
Hinweis zu § 52a UrhG: Weder das Werk noch seine Teile dürfen ohne eine solche Einwilligung eingescannt und<br />
in ein Netzwerk eingestellt werden. <strong>Die</strong>s gilt auch für Intranets von Schulen und sonstigen Bildungseinrichtungen.
Inhaltsverzeichnis<br />
Der Jugendliche und seine Arbeitswelt Seite<br />
Wirtschaftssubjekte<br />
1. <strong>Die</strong> <strong>Rolle</strong> <strong>als</strong> <strong>Wirtschaftsbürger</strong> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5<br />
2. Wirtschaftliche Bedeutung des Betriebes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6<br />
Ausbildungs- und Arbeitsverhältnis<br />
1. Berufsausbildung <strong>als</strong> Investition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7<br />
2. Das Berufsausbildungsverhältnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8<br />
Arbeitsschutz<br />
1. Arbeitsschutz gestern und heute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10<br />
2. Arbeitszeitgesetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11<br />
3. Kündigung und Kündigungsschutz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12<br />
4. Jugendarbeitsschutz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13<br />
5. Mutterschutz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15<br />
6. Schwerbehindertenschutz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16<br />
7. Datenschutz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17<br />
8. Humanisierung der Arbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18<br />
9. Technischer Arbeitsschutz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19<br />
Formen der Entlohnung<br />
1. Lohnformen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20<br />
Entgelt und Steuerabzüge<br />
1. <strong>Die</strong> Lohnabrechnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21<br />
2. <strong>Die</strong> Lohnsteuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22<br />
3. Einkommensteuererklärung (Lohnsteuerjahresausgleich) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23<br />
Sozialversicherung<br />
1. Entstehung und Prinzipien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24<br />
2. Das Gebäude der Sozialversicherung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25<br />
3. <strong>Die</strong> Krankenversicherung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26<br />
4. <strong>Die</strong> Arbeitslosenversicherung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27<br />
5. <strong>Die</strong> Rentenversicherung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28<br />
6. <strong>Die</strong> Unfallversicherung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29<br />
7. <strong>Die</strong> Pflegeversicherung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30<br />
Individualversicherungen<br />
1. Individualversicherungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31<br />
Zahlungsverkehr<br />
1. Zahlungsarten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32<br />
2. Western Union Money Transfer und Zahlschein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33<br />
3. Zahlen mit Scheck und EC- bzw. Maestro-Karte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34<br />
4. Überweisung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35<br />
5. Der Wechsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36<br />
Verwendung des Einkommens<br />
1. Sparen und Konsumieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37<br />
2. Vermögensbildung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38<br />
Konsument und Produzent im Wirtschaftsleben<br />
Rechts- und Geschäftsfähigkeit<br />
1. Rechtsfähigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39<br />
2. Geschäftsfähigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40<br />
Grundlagen des Vertragswesens<br />
1. Rechtsgeschäfte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41<br />
Kaufvertrag<br />
1. Abschluss und Erfüllung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42<br />
2. Lieferungs- und Zahlungsbedingungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43<br />
3. Kaufvertragsstörungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44<br />
3
4<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
Seite<br />
4. Mahnverfahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46<br />
5. Verjährungsfristen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47<br />
6. Ratenkauf (Teilzahlungsgeschäft) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48<br />
Weitere Vertragsarten<br />
1. Wichtige Vertragsarten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49<br />
Gründung und Formen der Unternehmung<br />
1. Gründung eines Unternehmens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50<br />
2. Unternehmensformen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51<br />
3. Einzelunternehmung und Personengesellschaften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52<br />
4. Kapitalgesellschaften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53<br />
5. Unternehmenszusammenschlüsse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54<br />
Betriebliche Grundfunktionen<br />
1. Betriebliche Grundfunktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55<br />
2. Fertigungsarten und -verfahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56<br />
3. Ziele und Kennziffern des Betriebes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57<br />
Verhältnis zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber<br />
1. Betriebliche Mitbestimmung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59<br />
2. Mitbestimmung auf Unternehmensebene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60<br />
3. Tarifverträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61<br />
4. Arbeitskampf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62<br />
Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit<br />
1. Arbeits- und Sozialgericht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63<br />
Grundlagen und Probleme der Wirtschaft<br />
Volkswirtschaftliche Grundlagen und Zusammenhänge<br />
1. Bedürfnisse und Bedarf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64<br />
2. Güter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65<br />
3. Ökonomisches Prinzip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66<br />
4. Produktionsfaktoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67<br />
5. Der Wirtschaftskreislauf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68<br />
6. Arten und Funktionen des Geldes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69<br />
7. Inflation und Deflation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70<br />
8. <strong>Die</strong> Währung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71<br />
9. Kreditarten und -sicherung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72<br />
10. Der Markt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73<br />
11. Preisbildung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74<br />
12. Das Bruttoinlandsprodukt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76<br />
13. Steuern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77<br />
14. Wirtschaftspolitische Ziele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78<br />
15. Konjunktur und Konjunkturpolitik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79<br />
Wandel der Wirtschaft<br />
1. Technischer Fortschritt, Schlüsseltechnologien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80<br />
2. Arbeiten in der Informationsgesellschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81<br />
3. Berufliche Weiterbildung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82<br />
Wirtschaftsordnungen<br />
1. Wirtschaftsordnungen im Modell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83<br />
2. <strong>Die</strong> soziale Marktwirtschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85<br />
Strukturen der deutschen und europäischen Wirtschaft<br />
1. Wirtschaftsstruktur der Bundesrepublik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86<br />
2. Wirtschaftsstruktur am Beispiel Thüringens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87<br />
3. Der europäische Binnenmarkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88<br />
Wirtschaft, Umwelt und Entwicklungsländer<br />
1. Ökologie und Ökonomie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90<br />
2. Nord-Süd-Gefälle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
1<br />
2<br />
3<br />
Wirtschaftssubjekte<br />
<strong>Die</strong> <strong>Rolle</strong> <strong>als</strong> <strong>Wirtschaftsbürger</strong> Seite 10<br />
Sabine (16) ist Auszubildende im ersten Ausbildungsjahr. Beim Frühstück liest sie die folgenden Schlagzeilen<br />
im Wirtschaftsteil ihrer Tageszeitung:<br />
Beiträge zur Krankenversicherung<br />
steigen<br />
Niedrigere Inflationsrate<br />
Lehrlingsmangel im Handwerk<br />
„Plastik-Geld“ immer beliebter<br />
Name: _______________________________________________________ Klasse: _____________________ Datum: _____________________<br />
© Bildungsverlag EINS GmbH<br />
Tarifverhandlungen im Metall -<br />
bereich gescheitert<br />
EU unterstützt Aufbau Ost<br />
Einzelhandel zufrieden mit<br />
dem Sonntagsverkauf<br />
Chemie-Industrie investiert<br />
mehr in den Umweltschutz<br />
Aus welchen Wirtschaftsbereichen stammen die Schlagzeilen?<br />
Tragen Sie diese in das Schaubild ein.<br />
Nennen Sie weitere Wirtschaftsbereiche, von denen Sie betroffen sind:<br />
Dollarkurs wieder gestiegen<br />
<strong>Die</strong> meisten Ölkonzerne<br />
heben Spritpreise an<br />
Neues Mietrecht schützt Mieter<br />
<strong>Die</strong> Wirtschaft beeinflusst viele unserer Lebensbereiche.<br />
Wie können wir Einfluss auf die Gestaltung und Entwicklung der Wirtschaftspolitik nehmen?<br />
5
1<br />
Jugendarbeitsschutz Seiten 31–33<br />
Notieren Sie mithilfe des Jugendarbeitsschutzgesetzes die wichtigsten Bestimmungen zum Jugend -<br />
arbeitsschutz.<br />
Berufsschule<br />
Freistellung<br />
Beschäftigungsverbot<br />
Name: _______________________________________________________ Klasse: _____________________ Datum: _____________________<br />
© Bildungsverlag EINS GmbH<br />
Arbeitszeit<br />
Jugendarbeitsschutzbestimmungen<br />
auf einen Blick<br />
Kinderarbeit<br />
Ruhepausen<br />
Freizeit<br />
Urlaub<br />
Ärztliche Untersuchung<br />
Arbeitsschutz<br />
13
Arbeitsschutz<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
Jugendarbeitsschutz Seiten 31–33<br />
Wer ist im Sinne des Gesetzes Jugendlicher?<br />
Für wen gelten die Bestimmungen des Jugendarbeitsschutzgesetzes?<br />
Wer überwacht die Einhaltung der Bestimmungen des Jugendarbeitsschutzgesetzes?<br />
Silke, Auszubildende, wird im September 17 Jahre alt. Wie viele Tage Urlaub stehen ihr in diesem Jahr zu?<br />
Silke muss aus betrieblichen Gründen ihren Urlaub im Juni nehmen. <strong>Die</strong> Schulferien beginnen erst zwei<br />
Wochen später, sodass Silke an zwei Tagen während ihres Urlaubs den Berufsschulunterricht besucht. Gelten<br />
die beiden Berufsschultage <strong>als</strong> Urlaub? Begründen Sie Ihre Entscheidung.<br />
Andreas, 16 Jahre alt, beginnt um 7:30 Uhr mit der Arbeit. Wegen unaufschiebbarer Arbeiten konnte er bis<br />
11:45 Uhr keine Pause einlegen.<br />
a) Wann hat Andreas spätestens Anspruch auf eine Pause?<br />
b) Wie lange muss die Pause mindestens dauern?<br />
c) Andreas arbeitet am Tag 8 Stunden. Wie muss die Pausenregelung für Andreas aussehen?<br />
In welchen Fällen wird gegen Bestimmungen des JArbSchG verstoßen?<br />
■ Manuela, 16, arbeitet am Fließband Akkord.<br />
■ Bernd, 17, hat am <strong>Die</strong>nstleistungsabend erst um 20:30 Uhr Feierabend.<br />
■ Sven, 17, muss <strong>als</strong> Kellner bis 21:00 Uhr arbeiten.<br />
■ Vanessa, 16, arbeitet in der Woche 4 Überstunden, die sie bezahlt bekommt.<br />
■ Der 13-jährige Jörg trägt einmal in der Woche Prospekte aus.<br />
■ Elina, 15, arbeitet nach 6 Stunden Berufsschulunterricht im Betrieb.<br />
14 © Bildungsverlag EINS GmbH
Arbeitsschutz<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
Humanisierung der Arbeit Seiten 41–42<br />
Eigentlich hat Laura P. Spaß an ihrer Arbeit, wären<br />
da nicht die quälenden Kopf- und Rückenschmerzen,<br />
die sie schon nach kurzer Zeit an ihrem neuen<br />
Arbeitsplatz plagen und ein konzentriertes Arbeiten<br />
unmöglich machen. Verzweifelt wendet sich Laura P.<br />
schließlich nach Wochen an den Betriebsarzt, der ihr<br />
nicht nur Medikamente verschreibt, sondern nach<br />
möglichen Ursachen sucht, Ursachen, die direkt mit<br />
dem Arbeitsplatz der jungen Frau zusammenhängen.<br />
Eine Besichtigung des Arbeitsplatzes von Laura P.<br />
durch Arzt und Qualitätskontrolleurin ergibt:<br />
Was ist unter einem „ergonomischen Rezept“ zu verstehen?<br />
a) Erstellen Sie anhand der Angaben des Betriebsarztes eine Mängelliste über den Arbeitsplatz von Frau<br />
Laura P.<br />
b) Stellen Sie den Mängeln ergonomische Verbesserungsvorschläge gegenüber.<br />
Wie lautet der Grundsatz der Humanisierung des Arbeitsplatzes?<br />
Weder der Bürostuhl noch der Arbeitstisch verfügen<br />
über eine Höhenverstellung, dem Stuhl fehlen darüber<br />
hinaus Armlehnen. Da der Computerbildschirm<br />
nicht entspiegelt ist, wird die Sicht auf den Monitor<br />
durch Lichtreflexe von der Deckenbeleuchtung<br />
gestört. Der Laserdrucker steht benutzerunfreundlich<br />
in Kopfhöhe.<br />
Nachdem der Arzt Laura P. ein „ergonomisches<br />
Rezept“ ausgestellt hat, nehmen die Beschwerden so<br />
rasch wieder ab, wie sie gekommen sind.<br />
Mängel Verbesserungsvorschläge<br />
Autorentext<br />
Überlegen Sie sich, welche ergonomische Maßnahmen an Ihrem Arbeitsplatz vorgenommen und welche<br />
Arbeitsabläufe verbessert werden können.<br />
18 © Bildungsverlag EINS GmbH
1<br />
2<br />
Einkommensteuererklärung<br />
(Lohnsteuerjahresausgleich) Seiten 57–59<br />
Stefanie hat ihre Unterlagen und Belege für die Einkommensteuererklärung gesammelt und nummeriert:<br />
(1) Gewerkschaftsjahresbeitrag (230,00 EUR) / (2) Private Unfallversicherung (130,00 EUR) / (3) Fortbildungsseminar<br />
(720,00 EUR) / (4) Kontoführungsgebühr (15,00 EUR) / (5) Arbeitskleidung (180,00 EUR) / (6) Fachbücher<br />
(120,00 EUR) / (7) Lebensversicherung (670,00 EUR) / (8) Kfz-Haftpflichtversicherung (280,00 EUR für ihr Auto<br />
(KO-MK 390), das sie an 5 Arbeits tagen in der Woche benutzt, insgesamt an 205 Tagen (bei 36 Urlaubs- und<br />
Krankheitstagen), um die 47 km zu ihrem Arbeitsplatz (Dix-Conzept, Koblenz, Bachweg) zurück zulegen / (9) Ihre<br />
Lohnsteuerkarte weist einen Arbeitnehmeranteil für die Kranken-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung über<br />
2.616,72 EUR, für die Rentenversicherung von 2.473,92 EUR aus.<br />
Ordnen Sie die Belege nach Werbungskosten und Sonderausgaben.<br />
Werbungskosten: Belege Nr.<br />
Sonderausgaben: Belege Nr.<br />
Übertragen Sie Stefanies Belege und Angaben in das Antragsformular „Werbungskosten“ zur Einkommensteuererklärung.<br />
Name: _______________________________________________________ Klasse: _____________________ Datum: _____________________<br />
© Bildungsverlag EINS GmbH<br />
Entgelt und Steuerabzüge<br />
23
1<br />
Sozialversicherung<br />
Das Gebäude der Sozialversicherung Seiten 61–62<br />
Vervollständigen Sie das Schaubild.<br />
Krankenversicherung<br />
Gesunde<br />
Name: _______________________________________________________ Klasse: _____________________ Datum: _____________________<br />
© Bildungsverlag EINS GmbH<br />
<strong>Die</strong> Versicherten helfen sich gegenseitig.<br />
=<br />
=<br />
Beschäftigte<br />
helfen durch ihre Beiträge zur Sozialversicherung<br />
Alten<br />
Unfallopfern<br />
Versicherte und Arbeitgeber wirken bei den Entscheidungen<br />
der Versicherungsträger mit.<br />
Pflege -<br />
versicherung<br />
Pflege -<br />
bedürftigen<br />
25