Zeitgeschichtlicher Hintergrund - Volkstheater Rostock
Zeitgeschichtlicher Hintergrund - Volkstheater Rostock
Zeitgeschichtlicher Hintergrund - Volkstheater Rostock
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Zeitgeschichtlicher</strong> <strong>Hintergrund</strong><br />
� Das Leben am Württembergischen Hof<br />
� Das Mätressenwesen<br />
� Der Soldatenhandel<br />
aus: Mittelberg, E. (Hrsg.): Kabale und Liebe. Text und Materialien, Berlin 1984, S. 109-<br />
116
Das Leben am Württembergischen Hof<br />
[...] Der Hof eines Landes, das nicht mehr als 600000 Einwohner auf 155 Quadratmeilen zählte, wurde der<br />
prächtigste in Europa. Der Hofstaat umfasste 2 000 Personen, unter denen sich 169 Kammerherren von<br />
Adel nebst 20 Prinzen und Reichsgrafen befanden. Wenn der Herzog auf Reisen ging, und er reiste<br />
leidenschaftlich gern, so bestand sein Gefolge aus 700 Personen und 610 Pferden. Die Feste drängten<br />
sich, Bälle, Konzerte, Schlittenfahrten, Jagden, Feuerwerke reihten sich aneinander und zogen Vornehme<br />
in Scharen an. Manchmal hat der Herzog 300 Personen von Rang wochenlang unterhalten und mit den<br />
feinsten und teuersten Leckerbissen bewirtet. Einzelne dieser Veranstaltungen kosteten 3 bis 400000<br />
Gulden, erhielten die Damen doch manches Mal dabei Geschenke im Werte von 50000 Talern. Ganz<br />
besonders berühmt waren die Feiern, mit denen der Herzog seinen Geburtstag beging. 1763 war in<br />
Ludwigsburg bei dieser Gelegenheit eine Orangerie errichtet worden, die tausend Fuß lang war, sodass<br />
die Orangen- und Zitronenbäume hohe, gewölbte Gänge bildeten. Als die Eingeladenen sich in ihnen dem<br />
Schloss nähern, befinden sie sich plötzlich in Wolken, die sich aber auf einen Wink des Herzogs teilen und<br />
den Olymp mit allen Göttern sehen lassen. Zeus befiehlt den Palast der Pracht zu errichten, worauf auch<br />
die letzte Wolke verschwindet und man im mittleren Schlosshof den Palast erblickt, den goldene Säulen<br />
tragen und 200000 Kerzen und Lampen erleuchten. Während die Götter italienische Gesänge anstimmen,<br />
beginnt die Tafel, aus deren Mitte plötzlich Venus aufsteigt, umgeben von 16 Liebesgöttern, die sich<br />
beeilen den Damen köstliche Sträuße aus Porzellanblumen zu überreichen. Als das vorüber ist, schießt<br />
Amor seinen Pfeil gegen eine Mauer ab, die sich im <strong>Hintergrund</strong>e befindet; sie verschwindet und enthüllt<br />
einen Saal, in dem ein Ballett getanzt wird. Den Beschluss macht ein Riesenfeuerwerk von 14000<br />
Raketen, 6000 von ihnen wurden auf einen Schlag abgebrannt. Derartige Feuerwerke kosteten für sich<br />
allein 50000 fl. und mehr. 1764 gab es zum Geburtstag des Herzogs ein großes Karussell, bei dem die<br />
Grafen Hohenlohe, Wittgenstein, Wimpffen, die Freiherren von Pöllnitz, Brandenstein, Uexküll,<br />
Reizenstein, Lengefeld u. a. eine Quadrille der vier Weltteile ausführten. Ein andermal wurden<br />
Schlittenfahrten und »Wirtschaften" in Bauernkostümen unternommen, zu denen die Bauern genötigt<br />
waren ihre Sonntagskleider zu leihen. [...]<br />
Regelmäßig war Montag und Donnerstag Redoute, Dienstag und Freitag Oper, Mittwoch und Samstag<br />
französische Komödie, außerdem noch Bälle, Empfange, Konzerte. [...]<br />
Die Oper Karl Eugens stellte die Pariser in Schatten und rivalisierte in ihren Darbietungen erfolgreich mit<br />
den berühmtesten Bühnen Italiens. [...] Einzelne Opern und Ballette kosteten 100000 fl., empfing doch der<br />
erste Tänzer Vestris, eine europäische Berühmtheit, für ein Engagement von sechs Monaten allein 12000<br />
fl., die übrigen sechs Monate war er an der Großen Oper in Paris angestellt. [...]<br />
Max von Boehn: Deutschland im 18. Jahrhundert. Berlin 1921, S. 454 f., 456, 459<br />
[...] Nicht weniger glänzend als die Geburtsfeste, fährt unser Berichterstatter fort, waren die Festinjagden,<br />
die bald in dieser, bald in jener Gegend des Landes veranstaltet wurden. Der Herzog liebte diese Art von<br />
Vergnügen ebenso leidenschaftlich als er andererseits der kostspieligsten Baulust fröhnte. Ein zahlreiches<br />
Korps von höhern und niedern Jagdbedienten war ihm zu Gebote. Seiner Nachsicht gewiss durften sie<br />
sich die rohesten Misshandlungen und die schreiendsten Ungerechtigkeiten gegen den seufzenden<br />
Landmann erlauben. Man zählte in den herrschaftlichen Zwingern und auf den mit dieser Art von<br />
Dienstbarkeit belasteten Bauerhöfen über tausend Jagdhunde. Das Wild ward im verderblichsten<br />
Uebermaße gehegt. Heerdenweise fiel es in die Aecker und Weinberge, die zu verwahren den<br />
Eigenthümern streng verboten war, und zerstörte oft in einer Nacht die Arbeit eines ganzen Jahres; jede<br />
Art von Selbsthilfe ward mit Festungs- und Zuchthausstrafe gebüßt, nicht selten gingen die Züge der Jäger<br />
und ihres Gefolges durch blühende und reifende Saaten. Wochenlang wurde oft die zum Treiben<br />
gepresste Bauerschaft, mitten in den dringendsten Feldgeschäften, ihren Arbeiten entrissen, in weit<br />
entfernte Gegenden fortgeschleppt. Ward, was nicht selten geschah, eine Wasserjagd auf dem Gebirge<br />
angestellt, so mussten die Bauern hierzu eine Vertiefung graben, sie mit Thon ausschlagen, Wasser aus<br />
den Thälern herbeischleppen und so einen See zu Stande bringen. [...]<br />
Johannes Scherr: Deutsche Kultur- und Sittengeschichte. Leipzig 51873, S.<br />
434
Das Mätressenwesen<br />
Nichts ist so sehr geeignet uns die furchtbare Macht des von oben gegebenen Beispiels kecker<br />
Hinwegsetzung über die hergebrachte Sitte und das allmälige Umsichgreifen einer lasterhaften<br />
Gewohnheit vor Augen zu stellen als die Geschichte der Mätressenwirthschaft an den deutschen Höfen.<br />
Als zuerst einzelne Fürsten, halb schüchtern noch, ihren unordentlichen Neigungen in dieser Richtung<br />
freien Lauf ließen, da zeigte sich die öffentliche Sitte dadurch aufs Höchste empört. Die ersten fürstlichen<br />
Geliebten wurden, wie ein Schriftsteller aus dem vorigen Jahrhundert erzählt, vom Volke mit Koth<br />
beworfen. Die protestantische Geistlichkeit hielt sich in ihrem Gewissen verpflichtet den Fürsten ernstliche<br />
Vorstellungen wegen der Sünde zu machen, die sie durch solche Ausschweifungen begingen. [...] Auch<br />
die weltlichen Rathgeber der Fürsten versuchten anfangs dieselben von solchen ungesetzlichen<br />
Verbindungen zurückzuhalten, deren schädlichen Einfluss auf die öffentliche Moral wie auf die Verwaltung<br />
der Länder sie wohl voraussahen. Aber dieser Widerstand war in der Regel nur kurz und ohnmächtig. An<br />
der Stelle sittenstrenger Theologen fanden sich andere, welche minder scrupulös waren. Die Beamten<br />
oder Hofdiener, welche sich dem Einfluss einer Mätresse nicht beugen oder ihr die gebührende<br />
Ehrerbietung nicht erweisen wollten, wurden durch gefügigere ersetzt. [...] Das Volk verlernte allmälig<br />
seine anfängliche sittliche Entrüstung gegen die fürstlichen Buhlerinnen und jauchzte am Ende selbst<br />
diesen zu, wenn sie an ihm im Glanze des mit seinem Schweiße bezahlten Schmuckes vorüberfuhren<br />
oder mit verschwenderischer Hand die goldenen Gaben ausstreuten, womit die Freigebigkeit ihrer<br />
fürstlichen Geliebten sie überschüttete. Zuletzt hatte sich die öffentliche Meinung so sehr an diese<br />
Mätressenwirthschaft gewöhnt, dass eine Mätresse als ein nothwendiger Bestandtheil jeder fürstlichen<br />
Hofhaltung, ihre Abwesenheit als ein fühlbarer Mangel erschien. "Nun fehlt unserem Fürsten nichts mehr<br />
als eine schöne Mätresse!", rief gerührt ein Bürger der Residenzstadt eines kleinen Fürstenthums aus, als<br />
er seinen jungen Fürsten mit seiner soeben angetrauten liebenswürdigen Gemahlin, von Zufriedenheit<br />
strahlend vorüberfahren sah. [...] Carl Eugen von Würtemberg vertheilte seine Gunstbezeigungen, neben<br />
den erklärten, officiellen Mätressen, an die sämmtlichen Sängerinnen und Tänzerinnen seiner Oper und<br />
seines Ballets, hatte auch außerdem noch häufige Liebschaften in den Residenzen und im Lande umher.<br />
[...]<br />
Karl Biedermann: Deutschland im 18. Jahrhundert. Band 2.1. Leipzig 1857. Zitiert<br />
nach: Neudruck der 2. Auflage Leipzig 1880: Aalen 1969, S. 100 f., 102<br />
[...] Besonderer Erwähnung bedarf ein tragischer Fall, mit dem der Herzog in höchst unrühmlicher Weise<br />
verknüpft ist. Betraf es doch ein Madchen aus einer der angesehensten Familien, das Opfer der Begierden<br />
des schrankenlos sich auslebenden Landesfürsten wurde. Über den berüchtigten Solituder Fall sagen die<br />
äußerst zurückhaltend verfasste Geburtsanzeige und eine Todesanzeige vom gleichen Tag für den<br />
kundigen Leser genügend aus. Er brachte großes Leid in die Familie des bekannten Professors Jahn an<br />
der militärischen Pflanzschule. Die erste Anzeige vom 21. April 1772 lautet: Geboren ein Sohn namens<br />
"Carl", Mutter. Die Jungfer Friderike Jahnin, Pate: Gerlinger Pfarrer und Hofstaatsprediger Pfeilsticker und<br />
Professor Drescher an der militärischen Pflanzschule. (Die Vaterschaft ist begreiflicherweise nicht<br />
angegeben, der Name des Kindes sagt es; wie umfangreich wäre die Patenschaft im Professorenhaus<br />
ausgefallen, wenn es sich um ein glückliches Ereignis gehandelt hatte.) Fast bedrückend und schmerzvoll<br />
liest sich die Traueranzeige über den Tod der 17-jährigen Mutter wider Willen: Am 21. April 1772 mittags<br />
um 4 Uhr starb an starkem Verbluten und Verkälten nach einem gehabten unglücklichen Zufall Jungfer<br />
Friderika, S. T. Herro Professoris M. Joh. Friedr. Jahnen älteste Tochter und wurde den 23. darauf abends<br />
auf einem Trauerwagen hierher (Friedhof Gerlingen) gebracht und nach einer kurzen christlichen<br />
Einsegnungsrede Pastoris in ihr Grab eingesenkt. [...]<br />
f.<br />
Gotthilf Kleemann: Schloss Solitude bei Stuttgart. Stuttgart 1966, S. 124
Der Soldatenhandel<br />
[...] Die ganze Summe der Truppen, welche die sämmtlichen deutschen Staaten für gewöhnlich unter den<br />
Waffen hatten, schätzte man auf 625000 Mann, was bei etwa 29 Millionen Einwohnern ungefähr 2,16<br />
Prozent der Bevölkerung ausmacht.<br />
Für die Fürsten freilich war eine solche unverhältnismäßig starke Militärmacht oftmals eine sehr glückliche<br />
Finanzspeculation theils durch die Subsidien, welche sie sich von fremden Mächten für ihre<br />
Bundesgenossenschaft oder ihre Neutralität zahlen ließen, theils auf noch directerem Wege durch die<br />
Lieferung von Soldaten in fremde Kriegsdienste. Dieser Menschenhandel, den unser großer Dichter<br />
Schiller in seinem Drama Kabale und Liebe so vernichtend gebrandmarkt hat, war in der That beinahe das<br />
Aergste, was der landesväterliche Despotismus jener Zeit dem in alles sich geduldig fügenden Sinne des<br />
deutschen Volkes zu bieten wagte. [. ..]<br />
Am schamlosesten [...] ward dieser Menschenhandel während des Krieges der Engländer gegen ihre<br />
nordamerikanischen Colonien getrieben. Während der acht Jahre 1775-1783 erfolgten gegen Geld die<br />
nachbenannten Truppenlieferungen aus deutschen Ländern:<br />
von Braunschweig 5723 Mann oder 3,45 % der Bevölkerung<br />
von Hessen-Cassel 16992 Mann oder 4,55 % der Bevölkerung<br />
von Hessen-Hanau 2422 Mann oder 3,95 % der Bevölkerung<br />
von Ansbach 1 644 Mann oder 0,79 % der Bevölkerung<br />
von Waldeck 1225 Mann oder 1,50 % der Bevölkerung<br />
von Anhalt-Zerbst 1160 Mann oder 5,05 % der Bevölkerung<br />
im Ganzen 29166 Mann<br />
Davon gingen verloren:<br />
von Braunschweig 3015 Mann<br />
von Hessen-Cassel 6500 Mann<br />
von Hessen-Hanau 981 Mann<br />
von Ansbach 461 Mann<br />
von Waldeck 720 Mann<br />
von Anhalt-Zerbst 176 Mann<br />
im Ganzen 11 853 Mann<br />
Die Einnahmen der Landesväter für den Verkauf ihrer Landeskinder setzten sich aus verschiedenen<br />
Posten zusammen, waren auch zum Theil verschieden je nach den speciellen Verträgen, die darüber<br />
abgeschlossen wurden. Zuvorderst erhielt der Landesherr ein bestimmtes Werbegeld für jeden einzelnen<br />
Soldaten. Dieses betrug gleichmäßig überall 30 Kronen Banco zu etwas über 5 Mark, also etwa 150 Mark.<br />
Für einen gefallenen oder drei verwundete Soldaten erhielt der Landesherr nochmals das Werbegeld von<br />
30 Kronen, musste dafür aber einen Ersatzmann schaffen. Außerdem machten sich die meisten Fürsten<br />
eine jährliche "Subsidie" aus, die nicht nur während des Krieges, sondern auch noch zwei Jahre nach dem<br />
Kriege, und zwar dann verdoppelt (weil dann die Löhnung der Truppen aus fremdem Gelde aufhörte)<br />
gezahlt werden musste; der Landgraf von Cassel war so schlau sich eine solche doppelte Subsidie gleich<br />
von Anfang an auszubedingen, die dafür aber nur noch ein Jahr nach dem Schluss des Krieges fortdauern<br />
sollte. Bei früheren Gelegenheiten hatten deutsche Fürsten auch von der hohen englischen Löhnung, die<br />
bedeutend mehr betrug als die gewöhnliche deutsche, dieses Mehr in ihre eigenen Taschen gesteckt. In<br />
den Verträgen wegen des amerikanischen Krieges setzte man englischerseits deshalb fest, dass diese<br />
Löhnung direct an die Truppen ausgezahlt werden sollte - eine fremde Regierung musste das Interesse<br />
der deutschen Soldaten gegen ihre eigenen Fürsten wahrnehmen! [...]<br />
Eine eigene bittere Ironie lag außerdem noch darin, dass diese unglücklichen Schlachtopfer fürstlichen<br />
Eigennutzes ihr Leben an die Unterdrückung der Freiheit einer andern Nation setzen mussten, und das in<br />
demselben Augenblicke, wo der Freiheitskampf der Amerikaner von deutschen Dichtern und Philosophen<br />
als die Morgenröthe einer neuen, besseren Zeit auch für Europa und für Deutschland gefeiert ward.<br />
Karl Biedermann: Deutschland im 18. Jahrhundert. Band I. Leipzig 11854. Zitiert<br />
nach: Neudruck der 2. Auflage Leipzig 1880: Aalen 1969, S. 200-203<br />
In den ersten Jahren seiner Regierung enthielt sich Karl Eugen jedes gewaltthätigen Eingriffs in die Rechte<br />
seiner Unterthanen und zwang sie namentlich nicht zum Dienste. Erst allmälig entwickelte sich der Sultan<br />
in ihm. Als der Siebenjährige Krieg ausgebrochen war und als der Herzog neben den 6 000 Mann
Hilfstruppen, die er Frankreich geliefert hatte, sein Reichskontingent stellen sollte, das bis dahin nicht<br />
vorhanden war, da schritt er mit einer Rücksichtslosigkeit zur gewaltsamen Aushebung seiner Bürger und<br />
Bauern, die im schroffsten Gegensatze zu deren verbrieften Rechten stand und zu langjährigen<br />
Zwistigkeiten mit den Landständen führte. Der berüchtigte Major Rieger erhielt Vollmacht, in kürzester Zeit<br />
die nöthige Truppenzahl zu liefern. So schwer das war, da die Schwaben gegen Friedrich den Großen als<br />
Beschützer des Protestantismus in Deutschland nicht dienen wollten - Karl Eugen war katholisch - so<br />
erfüllte Rieger doch seinen Auftrag. Wer achtzehn Jahre und sonst tauglich war, musste Soldat werden;<br />
vom Feld und aus den Werkstätten, aus den Häusern und aus den Betten holte man die Leute, umstellte<br />
sonntags die Kirche und ließ sie von da gewaltsam fortschleppen; zur Unterzeichnung der Kapitulation<br />
aber zwang man sie durch Hunger und Gefängniß. Beamte, die sich hierbei nicht recht thätig zeigten,<br />
wurden mit strengen Strafen bedroht. Die auf solche Art zusammengeraffte Mannschaft empörte sich<br />
jedoch, als sie in's Feld ziehen sollte, und Rieger musste mit noch grausamerer Strenge ein neues Heer<br />
zusammenbringen. - Ueber dies Verfahren entstand allgemeiner Unwille im Lande; indessen fruchteten<br />
die wiederholten wehmüthigsten, aber respektvollsten Vorstellungen des ständischen Ausschusses nicht.<br />
Weil aber die Desertionen so sehr überhand nahmen, dass die Truppen in kurzer Zeit 360 Deserteure<br />
zählten und im September 1757 allein aus dem Feldlager bei Linz 62 ausrissen, so wurden die Gesetze<br />
gegen das Desertiren bedeutend verschärft. Selbst wer mit Gewalt zum Kriegsdienst weggenommen war,<br />
wurde, sobald man ihn wieder ergriff, gehängt und mit Vermögensverlust bestraft. Wer einem Deserteur<br />
half, verlor das Bürgerrecht, wurde ohne weitern Prozess ins Zuchthaus abgeführt und hier, unter<br />
wiederholtem Willkomm (d. h. Stockprügeln) zu harter Arbeit angehalten. [...]<br />
Sir Joseph Yorke hatte Suffolk im September 1775 den Herzog von Würtemberg als einen Fürsten<br />
genannt, der wohl im Stande sein werde, einige tausend Mann zu liefern; auch der Herzog selbst hatte<br />
sich dem Minister angeboten. Es kam also zunächst auf den Versuch an, Verhandlungen mit ihm<br />
anzuknüpfen. [...]<br />
Am 19. Januar 1777 bot Römer in aller Förmlichkeit 3 000 Würtemberger an, die gegen Mitte März in<br />
Heilbronn eintreffen und sich dort einschiffen sollten. "Ich erlaube mir", schrieb Römer, "am Schlusse zu<br />
versichern, dass der Herzog bei seiner hohen persönlichen Ehrerbietung vor Seiner Majestät alles<br />
aufbieten wird sich bei dieser Gelegenheit durch sorgfältig ausgewählte Mannschaften und gute<br />
Ausrüstung der Offiziere und Soldaten auszuzeichnen und dass er den König, Ew. Lordschaft und den<br />
Oberbefehlshaber in Amerika zu befriedigen suchen wird." [...]<br />
Anders lautete die Lesart, die [...] Faucitt bei genauerer Besichtigung gab.<br />
„Ich wurde", schreibt er am 7. Februar 1777 von Stuttgart, "dem Herzoge am Tage meiner Ankunft [...]<br />
vorgestellt. Er versprach mir sofort dem Könige die 3 000 Mann zur festgesetzten Zeit zu liefern; die<br />
Minister versicherten aber, dass dieses Versprechen sich unmöglich erfüllen lasse. Ich bedaure, dass<br />
meine Verhandlungen an diesem Hofe voraussichtlich zu Nichts führen werden. Der Herzog ist nicht im<br />
Stande, ein Drittel der in Aussicht gestellten Truppen zu liefern. Sein Kredit und seine Finanzen sind bei<br />
einer so niedrigen Ebbe angekommen, dass er, selbst wenn er die Truppen auszuheben vermag,<br />
unmöglich gute Waffen und Uniformen anschaffen kann, um sie für's Feld auszurüsten. [...] Seine ganze<br />
Armee besteht aus 1690 Mann (Offiziere und Unteroffiziere nicht mit eingeschlossen). [...] Ein großer Theil<br />
der Soldaten ist beurlaubt. Was bei den Fahnen steht, ist der steif, alt und dekrepit gewordene Ueberrest<br />
aus dem letzten Kriege. Um die Desertion zu verhindern, giebt man den Soldaten, deren Zeit längst<br />
abgelaufen ist, ihre fällig gewordene Löhnung nicht. Ihre Waffen stammen aus dem letzten Kriege, sie sind<br />
von allen Kalibern, dabei abgenutzt und werthlos. Ihre Feld-Ausrüstung und Zelte sind von noch<br />
schlechterer Beschaffenheit. Die Offizierszelte sind in Stücke geschnitten und in verschiedene Formen<br />
gebracht um bei den ländlichen Festen des Herzogs zu dienen. Ohne neue Zelte können sie gar nicht<br />
marschiren. Dieser entmuthigende Zustand der würtembergischen Armee erschreckte mich derartig, dass<br />
ich mir des Herzogs Geständniß, er könne nicht alle 3 000 Mann in der vorgeschriebenen Zeit liefern, zu<br />
Nutze machte und erklärte, ich müsse auf der ganzen Zahl bestehen, jedenfalls Ihnen aber erst Bericht<br />
erstatten. Der Herzog ernannte zwei seiner Minister und einen Major zur Unterhandlung mit mir, welche<br />
keinen der bisherigen Verträge kannten. Ich entwarf einen nach dem Muster des braunschweigischen, da<br />
dieser der mäßigste von allen ist. Die Subsidien beschränkte ich auf sechs Monate, statt zwei Jahre wie in<br />
Braunschweig einzuräumen. Ebenso bewilligte ich vor dem Abmarsch nur sieben Tage Löhnung statt zwei<br />
Monate. Ich war natürlich bereit bessere Bedingungen zu gestalten, falls es verlangt würde. Die Herren<br />
machten aber nicht die geringsten Einwendungen."<br />
Friedrich Kapp: Der Soldatenhandel deutscher Fürsten nach Amerika. Berlin<br />
1874,<br />
S.94 f., 92, 99, 100 f.
Die Legende von den "verkauften Hessen",<br />
"Es traten wohl so etlich vorlaute Bursch' vor die Front heraus und fragten den Obersten, wie teuer der<br />
Fürst das Joch Menschen verkaufe? Aber unser gnädigster Landesherr ließ alle Regimenter auf dem<br />
Paradeplatz aufmarschieren und die Maulaffen niederschießen. Wir hörten die Büchsen knallen, sahen ihr<br />
Gehirn auf das Pflaster spritzen, und die ganze Armee schrie: Juchhe nach Amerika", schrieb Schiller in<br />
Kabale und Liebe 1784. Schiller war nicht der einzige; in ganz Deutschland empörte man sich plötzlich<br />
über den "Menschenhandel" der Fürsten. Der Anlaß war die Vermietung von Truppen zur Niederschlagung<br />
des Aufstandes in Nordamerika. Die Kritik richtete sich hauptsächlich gegen Hessen- Kassel, das den<br />
Löwenanteil der Söldner geliefert hatte. Doch bei genauerer Betrachtung entpuppt sich das Bild von den<br />
"verkauften Hessen" als eine Legende.<br />
Für Hessen-Kassel war der Soldatenhandel ein Geschäft mit Tradition. Das Land hatte am Ende des<br />
Dreißigjährigen Krieges eine der größten Armeen unterhalten, woraus dann die ersten stehenden<br />
Regimenter gebildet worden waren. Da große Teile des Landes verwüstet waren, war der Kriegsdienst<br />
eine der wenigen Erwerbsmöglichkeiten der Bevölkerung. Zudem konnte der Kleinstaat nur durch fremden<br />
Subsidien sein starkes Heer unterhalten und sich dadurch vor weiteren Übergriffen schützen. Bereits 1677<br />
ging ein erstes Regiment nach Dänemark, das vorher schon an den Kaiser vermietet worden war. Danach<br />
vermietete Hessen-Kassel Truppen an Spanien, den Kaiser, Venedig und mehrmals an die Niederlande.<br />
Ab 1694 begann das Geschäft mit England, das dann zum Hauptkunden wurde. Mit der Zeit übernahmen<br />
die Hessen in England die Funktion der Schweizer in Frankreich. Mit den englischen Subsidien wurde<br />
Hessen-Kassel zu einem regelrechten Söldnerstaat, der sogar eine proportional größere Armee als das für<br />
seinen Militarismus bekannte Preußen unterhalten konnte.<br />
Als England nun nach dem Siebenjährigen Krieg damit begann einige dieser Subsidien in seinen Kolonien<br />
wieder einzutreiben und damit den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg auslöste, lag es auf der Hand<br />
wieder auf die bewahrten Hessen zurockzugreifen. Da die Engländer jedoch gleich eine ganze Armee<br />
mieten wollten, wandten sie sich zuerst an Rußland. Katharina die Große hatte zwar keine Sympathien für<br />
Revolutionäre, sah aber die Schwierigkeiten der konkurrierenden Großmacht mit Wohlwollen und wies<br />
deshalb die Anfrage empört zurück. Erst jetzt kamen die deutschen Fürsten zum Zug. Auch von ihnen<br />
lehnten zwar einige ab, aber Hessen-Kassel, Braunschweig, Hessen-Hanau, Ansbach-Bayreuth, Waldeck<br />
und Anhalt-Zerbst lieferten, was sie aufbringen konnten.<br />
Hessen-Kassel mit seiner langen Söldnertradition verfügte über eine große Zahl an gut ausgebildeten<br />
Truppen und konnte deshalb gleich große Kontingente in Marsch setzen. Der Siebenjährige Krieg lag zwar<br />
schon einige Jahre zurück, hatte aber genug Veteranen hinterlassen, die nun ein armseliges Leben<br />
fristeten. Die Wunden waren verheilt, die Schrecken verblaßt und in Amerika warteten Sold und Beute. In<br />
vielen hessischen Familien war es wie in der Schweiz Tradition, daß immer einige Söhne ihr Glück bei den<br />
Soldaten versuchten, so daß kein Mangel an Freiwilligen herrschte. Die jungen Burschen hatten sich oft<br />
genug die Geschichten ihrer Väter und Onkel angehört und träumten von wilden Abenteuern in fernen<br />
Ländern. Zudem galten die rebellischen Kolonisten nicht als ernstzunehmende Gegner. Bei dem ganzen<br />
Unternehmen schien es sich eher um eine größere Polizeiaktion zu handeln, bei der manch einer sein<br />
Glück machen konnte. Sehr viele Freiwillige gab es auch unter den Offizieren. Diejenigen, die im Frieden<br />
nicht entlassen worden waren, waren oft zurückgestuft worden und konnten in der Regel Jahrzehnte auf<br />
eine Beförderung warten. Nur der Krieg versprach ein schnelles Avancement. Auch viele Deutsche aus<br />
anderen Staaten, Iren, Italiener und Franzosen meldeten sich. Alle hofften auf Abenteuer und Beute im<br />
sagenhaften Amerika, wie es in einem hessischen Soldatenlied deutlich zum Ausdruck kommt:<br />
Frisch auf ihr Brüder, ans Gewehr; 's geht nach Amerika!<br />
Versammelt schon ist unser Heer, Vivat, Viktoria!<br />
Das rote Gold, das rote Gold,<br />
das kommt man nur so hergerollt,<br />
da gibt's auch, da gibt's auch, da gibt's auch bessern Sold!<br />
Adchö, mein Hessenland, adchö! Jetzt kommt Amerika.<br />
Und unser Glück geht in die Höh', Goldberge sind allda!<br />
Dazu, dazu in Feindesland,<br />
was einem fehlt, das nimmt die Hand.<br />
Das ist ein, das ist ein, das ist ein anderer Stand!
Rotes Gold, reiche Beute und besseren Sold hatten ihnen die Werber versprochen und sie glaubten es nur<br />
allzu gerne. Manch einer trug sich sicher auch mit dem Gedanken, sich nach einem leichten Sieg auf<br />
einem Hof oder einer Plantage der Rebellen anzusiedeln. Den unter großem Trubel ausrückenden<br />
Waldeckern rief ein hoher Beamter hinterher: "Die, welche hiervon wieder zurückkommen, will ich alle in<br />
Kutschen fahren sehen!"<br />
Zu Szenen, wie sie Schiller beschrieben hat, kam es beim Ausmarsch nicht. Meutereien und Streiks, die<br />
alten Methoden, mit denen sich die Landsknechte manchmal noch erfolgreich zur Wehr gesetzt hatten,<br />
waren nicht mehr möglich. Wer sein Handgeld genommen hatte, der hatte seine Haut verkauft und als<br />
einzige Möglichkeit der Auflehnung blieb ihm die Desertion. Söldner waren zwar schon immer desertiert,<br />
ganz besonders in langen Kriegen und bei schlechter Versorgung, aber im 18. Jahrhundert wurden<br />
Deserteure zum Hauptproblem aller Armeen. Trotz drakonischer Strafen flohen allein aus der preußischen<br />
Armee Zehntausende, Kopfgelder wurden ausgesetzt und Frankreich bemannte mit eingefangenen<br />
Deserteuren seine Galeeren. Kaum ein Feldherr wagte es, seine Truppen in unübersichtlichem Gelände<br />
oder in aufgelockerter Formation einzusetzen, aus Angst sie dabei zu verlieren. Nachts und auf dem<br />
Marsch wurden die Söldner von leichten Reitern bewacht. Allerdings schafften nur die wenigsten, denen<br />
die Flucht glückte, den Absprung ins Zivilleben. Arbeitslos und ohne Papiere dauerte es meistens nicht<br />
lange bis sie einem anderen Werber in die Hände fielen und erneut kapitulierten.<br />
Nichts davon bei den Hessen. Auf dem Marsch des ersten Kontingents zur Einschiffung nach Bremerlehe<br />
desertierten von den 8.397 Mann ganze 13. Doch es kam noch besser. Die Amerikaner, die sich gerade<br />
gegen ihren König erhoben hatten, hatten schon von den gepreßten und verkauften Söldnern gehört und<br />
rechneten damit, daß viele bei der ersten Gelegenheit desertieren und vielleicht sogar ebenfalls gegen die<br />
Tyrannei zur Waffe greifen würden. Jedem Überlaufer wurden 50 Morgen Land in Aussicht gestellt, jedem<br />
Hauptmann, der 40 seiner Leute mitbrachte, sogar 800 Morgen, dazu Vieh und Steuerfreiheit für mehrere<br />
Jahre. Keiner der Überlaufer sollte gezwungen werden, weiter zu dienen. Falls sie sich doch dazu<br />
entschließen konnten, sollten die Offiziere einen Rang hoher eingestuft werden. Aber all diese<br />
Versprechungen trafen weitgehend auf taube Ohren. Nur ganz wenige Hessen nutzten die Gelegenheit.<br />
Sogar viele, die in Gefangenschaft geraten waren, warteten brav bis sie ausgetauscht wurden und<br />
schlossen sich dann ihren alten Regimentern wieder an.<br />
Das war nicht das verkaufte Schlachtvieh, dessen Schicksal Schiller später so lautstark anprangern sollte.<br />
Man sollte allerdings nach den Gründen fragen. Auf der Morea waren deutsche Söldner bei jeder<br />
Gelegenheit zu den Türken übergelaufen, und es ist kaum anzunehmen, daß die Stöcke der Drillmeister<br />
plötzlich eine größere Loyalität in ihnen hervorgerufen haben sollten. Aber anders als in den meisten<br />
Armeen bestand der Großteil der hessischen Söldner aus Landeskindern, deren Verwandte für Deserteure<br />
haftbar gemacht wurden. Die Gemeinen wurden durch das sogenannte Kantonsystem rekrutiert, durch<br />
das jedem Regiment ein bestimmtes Rekrutierungsgebiet, eben ein Kanton, zugewiesen wurde. In<br />
gewisser Weise waren die Hessen also eher Wehrpflichtige als richtige Söldner. Zudem hatten die<br />
Engländer wahre Schauermärchen über die Grausamkeit der Rebellen verbreitet. Aber vor allem fühlte<br />
man sich auf der sicheren Seite der Sieger, und der Krieg war, verglichen mit den Gemetzeln in Europa,<br />
selten mehr als ein Geplänkel. Des öfteren wurde später betont, daß von den 19.000 verkauften Hessen<br />
nach sechs Jahren nur noch etwa 10.500 zurückkehrten. Doch solche Verlustraten erreichte Friedrich der<br />
Große sogar in seinen siegreichen Schlachten. Von den Hessen waren dagegen bis Kriegsende nur 535<br />
im Kampf gefallen, über 4.000 an Krankheiten gestorben und 3.000 nach dem Friedensschluß freiwillig in<br />
Amerika geblieben.<br />
In der ersten großen Schlacht des Krieges bei Flatbush im August 1776 wurden die Amerikaner von der<br />
disziplinierten europäischen Infanterie förmlich überrannt. Der Feuergeschwindigkeit und vor allem dem<br />
gefürchteten Bajonettangriff der Hessen hatten sie nichts entgegenzusetzen. Ein hessischer Oberst<br />
schrieb: "Die Riflemans sind mehrentheils mit dem Bajonett an die Bäume gespießt worden; diese<br />
fürchterlichen Leute verdienen eher Mitleid als Furcht. Sie müssen immer eine Viertelstunde Zeit haben,<br />
um ein Gewehr zu laden und in dieser Zeit fühlen sie unsere Kugeln und Bajonette". Engländer und<br />
Hessen wüteten furchtbar unter den Amerikanern und massakrierten selbst noch viele von denen, die sich<br />
ergeben wollten. Weit über 3.000 toten und gefangenen Amerikanern standen zwei tote Hessen und 61<br />
tote Engländer gegenüber. Kein Wunder, daß das Überlegenheitsgefühl der Söldner danach geradezu ins<br />
Unermeßliche wuchs. Aber auch die Verluste bei Niederlagen hielten sich in Grenzen. Beim ersten<br />
wichtigen Sieg Washingtons bei Trenton im Dezember 1776 verloren die Hessen zwar mit 933 Mann gut<br />
die Hälfte ihrer eingesetzten Truppen, darunter waren jedoch lediglich 17 Tote und 78 Verwundete. Für<br />
europäische Armeen waren solche Verluste Lappalien.
Im großen Ganzen aber blieben Kämpfe relativ seltene Ausnahmen. So gab es Einheiten, die während<br />
des ganzen Krieges an keinem einzigen Gefecht teilgenommen hatten. Statt dessen marschierten die<br />
Truppen durch die menschenleere Wildnis oder verbrachten Monate und Jahre beim monotonen<br />
Garnisonsdienst. Hier begegneten die Söldner dann ihren gefährlichsten Feinden: Klima und Krankheiten.<br />
Die schönen Paradeuniformen erwiesen sich von Anfang an als völlig untauglich, und es klingt wie ein<br />
schlechter Witz, daß eine Menge Söldner auf den Marschen im Sommer am Hitzschlag starben. Aber<br />
auch in den bitterkalten Wintern nutzten die zerschlissenen Uniformen kaum mehr als die dünnen Decken<br />
und Zelte. Vor allem in Kanada gab es starke Verluste durch Erfrierungen. Diejenigen, die länger an einem<br />
Ort stationiert waren, hausten in Erdhütten, die mit Brettern, Asten und Stroh notdürftig abgedeckt waren.<br />
Bei Regen liefen sie voll Wasser und im Winter trieb Schnee herein. In diesen Lagern entstanden durch<br />
Fieber, Lungenentzündung, Ruhr und Typhus die schwersten Verluste Opfer des Krieges.<br />
Die Toten wurden zwar bezahlt, mußten aber ersetzt werden. Außerdem forderten die Engländer<br />
Verstärkungen. Da die echten Freiwilligen bereits mit den ersten Einheiten ausgezogen waren, mußten die<br />
Werber zunehmend zum Zwang greifen, um ihr Soll zu erfüllen. In Hessen begann es bereits an<br />
Arbeitskräften zu mangeln, Felder lagen brach und Höfe verkamen, da in manchen Familien nur Frauen,<br />
Kinder und Alte zuruckgeblieben waren. Um seinen Staat nicht völlig auszubluten, ließ der Landgraf in den<br />
Reichsstädten und anderen Ländern werben. Die Altersgrenzen wurden ausgedehnt, Gefängnisse<br />
und Armenhäuser nach Rekruten durchforstet; Schuldner, Arbeitslose, Vagabunden, Handwerksburschen,<br />
Studenten und Unruhestifter wurden in Armee gepreßt. Man nahm Sechzigjährige und halbe Kinder,<br />
Lahme und Epileptiker, manchen fehlte ein Auge, anderen die Zähne. Je länger der Krieg dauerte, desto<br />
mehr häuften sich deshalb die Klagen der Offiziere in Amerika über das "Gesindel", das sie als Ersatz<br />
geliefert bekamen.<br />
Unter diesem "Gesindel" befand sich auch der spätere Dichter Johann Gottfried Seume. Während seines<br />
Studiums in Leipzig hatte ihn die Unruhe gepackt. Kurz entschlossen verkaufte er seine Bücher und<br />
machte sich auf den Weg nach Paris. Er kam nur bis nach Hessen. Dort griffen ihn Werber auf, zerrissen<br />
seine Papiere und warfen ihn zu den anderen Rekruten in die Festung Ziegenhain. Seine "Kameraden<br />
waren noch ein verlaufener Musensohn aus Jena, ein bankerotter Kaufmann aus Wien, ein Posamentierer<br />
aus Hannover, ein abgesetzter Postschreiber aus Gotha, ein Mönch aus Würzburg, ein Oberamtmann aus<br />
Meiningen, ein preußischer Husarenwachtmeister, ein kassierter hessischer Major von der Festung und<br />
andere von ähnlichem Stempel". Die Gefangenen schmiedeten Fluchtpläne, aber aus den Fängen des<br />
Militärs gab es kein Entkommen. Wie schon so viele vor ihm fügte sich Seume in sein Schicksal und<br />
versuchte sich mit seinen guten Seiten anzufreunden: "Am Ende ärgerte ich mich nicht weiter; leben muß<br />
man überall: wo so viele durchkommen, wirst du auch: Über den Ozean zu schwimmen war für einen<br />
jungen Kerl einladend genug; und zu sehen gab es jenseits auch etwas."<br />
Mit diesem zusammengewürfelten Ersatz schwand sich auch langsam die Zuverlässigkeit der alten<br />
Regimenter. Viele der neugeworbenen Rekruten waren mehrfache Deserteure, denen es nur auf das<br />
Handgeld ankam, oder die nach einer freien Oberfahrt nach Amerika gesucht hatten. Ais Wachen waren<br />
sie kaum zu verwenden, da sie bei der ersten Gelegenheit verschwanden. Einige wurden zur<br />
Abschreckung gehängt, und in Kanada schickte man indianische Skalpjäger hinter ihnen her. Aber<br />
Söldner waren knapp, und so beschränkte man sich bei gefaßten Deserteuren in der Regel auf<br />
mehrmaliges Spießrutenlaufen und steckte sie dann wieder ins Glied. Doch auch bei den alten Truppen<br />
ließ die Zuverlässigkeit nach durch die zwangsläufig engen Kontakte zur Bevölkerung hatten sich die<br />
Vorurteile von den primitiven und blutrünstigen Rebellen verflüchtigt. In den Städten verdienten die Söldner<br />
gutes Geld als Hafenarbeiter; auf dem Land halfen sie den Bauern, bei denen sie einquartiert waren. Viele<br />
hatten Beziehungen mit amerikanischen Frauen und Familienanschluß. Zudem schwand mit der Zeit der<br />
Glaube an einen englischen Sieg.<br />
Aber auch das alles führte nicht zu Massendesertionen. Die meisten Hessen verrichteten weiter brav ihren<br />
Dienst, arbeiteten in ihrer Freizeit bei den Amerikanern, schickten Geld nach Hause, pflanzten im Lager<br />
Gemüse, hielten sich Hühner und richteten Schulen für ihre Kinder ein. Erst nach der Unterzeichnung des<br />
Waffenstillstandes stiegen die Zahlen deutlich an. Diese Deserteure flohen weniger vor dem Krieg in<br />
Amerika als vor der Rückkehr. Sie hatten sich eingerichtet und fürchteten in Deutschland an andere<br />
Armeen, vor allem an die preußische, weiterverkauft zu werden. Unter denen, die nach dem<br />
Friedensschluss freiwillig in Amerika blieben, war auch ein gewisser Küster, dessen Nachkomme dann als<br />
General Custer in den Indianerkriegen bekannt werden sollte.
Trotz des großen Wirbels, den die "verkauften Hessen" ausgelöst haben, waren sie so bieder wie das<br />
ganze Geschäft. In fast allen europäischen Armeen herrschten weit schlimmere Zustande. Verglichen mit<br />
den Kriegen im wilden Feld, auf Kreta oder der Morea waren im Soldatenhandel geradezu zivilisierte<br />
Verhältnisse eingezogen. Ähnlich müssen es auch die Söldner empfunden haben, denn nur so läßt sich<br />
die relativ geringe Anzahl von Deserteuren erklären. Doch während die wirklich schmutzigen Geschichten<br />
nie richtig zur Kenntnis genommen wurden und fast völlig vergessen sind, löste der Soldatenhandel im<br />
Unabhängigkeitskrieg eine wahre Flut von Artikeln und Veröffentlichungen aus. Die Ideen der Aufklärung<br />
über Menschenrechte und bürgerliche Freiheiten bestimmten zunehmend die öffentliche Meinung.<br />
Intellektuelle eiferten gegen den Handel mit Menschenblut und bezeichneten die Fürsten als Tyrannen, die<br />
ihre Untertanen wie Vieh oder Sklaven verkauften. Diese Gedanken mögen sicher ihre Berechtigung<br />
haben, nur waren die, um die es dabei ging, meistens anderer Meinung. Sie übten einen in Europa und<br />
ganz besonders in Hessen altehrwührdigen Beruf aus. Selbst Seume, der immer wieder als Kronzeuge<br />
gegen diesen Menschenhandel aufgeführt wird, konnte sich über sein Schicksal nur schlecht beklagen. In<br />
Amerika erfreute er sich dank seiner Bildung der Protektion der Offiziere und wurde als Schreiber vom<br />
Dienst freigestellt. Er und seine Kameraden waren in keinerlei Kampfe verwickelt und gebrauchten ihre<br />
Musketen nur beim Exerzieren oder auf der Jagd. Später wieder in Europa hatte er keine Bedenken eine<br />
Offiziersstelle in der russischen Armee anzunehmen und sich in ihren Reihen an der Niederschlagung des<br />
polnischen Aufstandes zu beteiligen.<br />
Viele Schriften, die vehement gegen den Soldatenhandel Stellung bezogen, kamen ausgerechnet aus,<br />
Frankreich und wurden von deutschen Intellektuellen begeistert aufgegriffen. Dabei wurde nur allzu gerne<br />
vergessen, daß das Hilfskorps, das Frankreich zur Unterstützung Washingtons nach Amerika schickte,<br />
ebenfalls zum Teil aus deutschen Truppen bestand. Darunter befand sich das Regiment "Royal Allemand<br />
de Deux-Ponts", das Herzog Christian IV. von Zweibrücken 1756 für Frankreich aufgestellt hatte. Das<br />
Regiment, das schon im Siebenjährigen Krieg gegen die Engländer und deren hessische Söldner<br />
gekämpft hatte, stand diesen nun wieder bei der Belagerung von Yorktown gegenüber. Yorktown wurde<br />
manchmal als "deutsche Schlacht" bezeichnet, da den Hessen und Ansbach-Bayreuthern der Engländer<br />
nicht nur die Zweibrücker sondern auch starke deutsche Milizen der Amerikaner unter dem Befehl des<br />
Generals Steuben gegenüberstanden. Die Gemeinsamkeiten zwischen französischen, englischen und<br />
deutschen Söldnertruppen waren weitaus größer, als die zwischen den Franzosen und ihren<br />
amerikanischen Verbündeten. Für die französischen Aristokraten waren die amerikanischen Milizen<br />
lediglich Pack und ihre Offiziere feige Bauernlümmel. Nach der Kapitulation von Yorktown luden sie ihre<br />
englischen und hessischen Waffenbrüder zum Dinner, lobten ihre Tapferkeit und versuchten ihnen die<br />
Gefangenschaft zu erleichtern. Amerikanische Offiziere waren von solchen Geselligkeiten<br />
selbstverständlich ausgenommen.


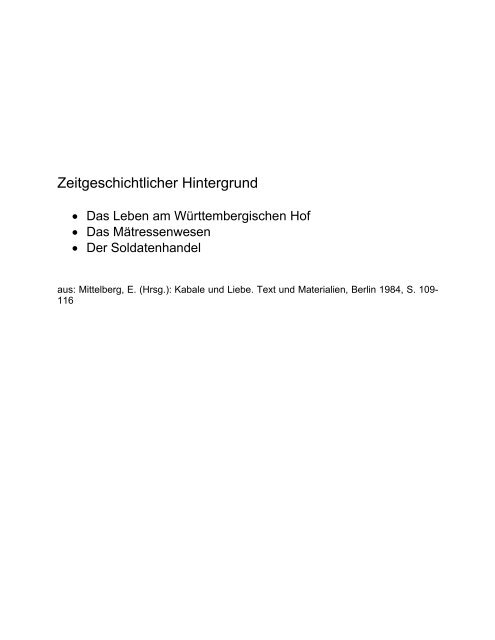
![Download [/ 48,52 kB] - Volkstheater Rostock](https://img.yumpu.com/51265681/1/184x260/download-4852-kb-volkstheater-rostock.jpg?quality=85)

![Download [/ 1033,53 kB] - Volkstheater Rostock](https://img.yumpu.com/46128731/1/190x180/download-103353-kb-volkstheater-rostock.jpg?quality=85)


![Download [/ 22,85 kB] - Volkstheater Rostock](https://img.yumpu.com/35409941/1/184x260/download-2285-kb-volkstheater-rostock.jpg?quality=85)


![Download [/ 7877,68 kB] - Volkstheater Rostock](https://img.yumpu.com/33043605/1/184x260/download-787768-kb-volkstheater-rostock.jpg?quality=85)

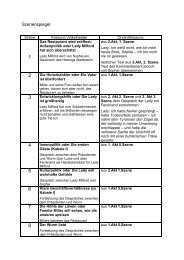

![Download [/ 7584,78 kB] - Volkstheater Rostock](https://img.yumpu.com/21677340/1/190x180/download-758478-kb-volkstheater-rostock.jpg?quality=85)
![Download [/ 1657,43 kB] - Volkstheater Rostock](https://img.yumpu.com/21671498/1/190x89/download-165743-kb-volkstheater-rostock.jpg?quality=85)
