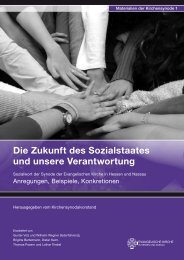hohe Auflösung - Evangelische Kirche in Hessen und Nassau
hohe Auflösung - Evangelische Kirche in Hessen und Nassau
hohe Auflösung - Evangelische Kirche in Hessen und Nassau
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Bauen <strong>und</strong> Erhalten <strong>in</strong> der <strong>Evangelische</strong>n <strong>Kirche</strong> <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>und</strong> <strong>Nassau</strong><br />
2<br />
Oberkirchenrat <strong>Kirche</strong>nbaudirektor<br />
He<strong>in</strong>z Thomas Striegler Dipl.-Ing. Georg Weber<br />
Leiter des Dezernats Leiter der Referatsgruppe<br />
F<strong>in</strong>anzen, Bau <strong>und</strong> Liegenschaften Bauwesen<br />
In den 1.178 <strong>Kirche</strong>ngeme<strong>in</strong>den der <strong>Evangelische</strong>n<br />
<strong>Kirche</strong> <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>und</strong> <strong>Nassau</strong> wird gegenwärtig<br />
e<strong>in</strong> Bestand von r<strong>und</strong> 4.100 Gebäuden unterhalten<br />
<strong>und</strong> gepflegt. H<strong>in</strong>zu kommen 71 Objekte im<br />
gesamtkirchlichen Eigentum. Mit 1.650 Gebäuden<br />
unter Denkmalschutz unterliegen ca. 40 % des<br />
Gebäudebestands den staatskirchenvertraglichen<br />
Regelungen <strong>in</strong> den Ländern <strong>Hessen</strong> <strong>und</strong> Rhe<strong>in</strong>land-Pfalz.<br />
Nach e<strong>in</strong>er im Jahr 1999 veröffentlichten Dokumentation<br />
über die Neubautätigkeit soll mit dem<br />
vorliegenden Band e<strong>in</strong> Überblick über die umfängliche<br />
<strong>und</strong> breit gefächerte Tätigkeit der Referatsgruppe<br />
Bauwesen der EKHN im Umgang mit<br />
den bestehenden Gebäuden gegeben werden.<br />
Komplexe Gesamtsanierungen hochkarätiger Baudenkmale<br />
stehen neben zahlreichen Renovierungsprojekten<br />
an <strong>Kirche</strong>ngeme<strong>in</strong>den aus den<br />
verschiedenen Bauepochen <strong>und</strong> reizvollen Restaurierungsaufgaben.<br />
Daneben illustrieren Beispiele<br />
für die zunehmend <strong>in</strong>s Blickfeld rückenden<br />
Bau-aufgaben zur Nutzungserweiterung von <strong>Kirche</strong>ngebäuden<br />
e<strong>in</strong>en weiteren Schwerpunkt.<br />
Durch außergewöhnliches Engagement aufgeschlossener<br />
<strong>Kirche</strong>nvorstände, qualitätsbewusster<br />
Architekten <strong>und</strong> Ingenieure, erfahrener <strong>und</strong><br />
leistungsfähiger Handwerker, der Denkmalbehörden<br />
<strong>in</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>und</strong> Rhe<strong>in</strong>land-Pfalz sowie e<strong>in</strong>er<br />
Vielzahl fachlich Beteiligter unterschiedlichster<br />
Spezialgebiete s<strong>in</strong>d Ergebnisse erzielt worden,<br />
die als Beispiele für künftige Aufgabenstellungen<br />
herangezogen werden können. Allen, die daran<br />
mitgewirkt haben, sei an dieser Stelle herzlich gedankt.<br />
Dezernat 3–F<strong>in</strong>anzen, Bau <strong>und</strong> Liegenschaften<br />
Oberkirchenrat He<strong>in</strong>z Thomas Striegler<br />
Referatsgruppe Bauwesen<br />
<strong>Kirche</strong>nbaudirektor Georg Weber<br />
Referat Bauwesen <strong>Kirche</strong>ngeme<strong>in</strong>den <strong>und</strong> Dekanate 1<br />
<strong>Kirche</strong>nbaudirektor Dipl.-Ing. Georg Weber<br />
Dipl.-Ing. Wolfgang Feilberg<br />
Dipl.-Ing. Stefanie Ebenritter<br />
Dipl.-Ing. Angela Gotthardt<br />
Dipl.-Ing. Barbara Schmid<br />
Referat Bauwesen <strong>Kirche</strong>ngeme<strong>in</strong>den <strong>und</strong> Dekanate 2<br />
<strong>Kirche</strong>noberbaurat Dipl.-Ing. Hans-Georg Lange<br />
Dipl.-Ing. Dorothee Re<strong>in</strong>iger-Po<strong>in</strong>tner<br />
Dipl.-Ing. Joachim Bay<br />
Dipl.-Ing. Knut Faust<br />
Dipl.-Ing. Thomas Lang<br />
Dipl.-Ing. Heike L<strong>in</strong>ke<br />
Dipl.-Ing. Joachim Sykala<br />
Referat Bauwesen Gesamtkirche, Bauleitplanung <strong>und</strong><br />
Dokumentation<br />
<strong>Kirche</strong>noberbaurat Dipl.-Ing. Hans-Otto Dierkes<br />
Dipl.-Ing. Joachim Benz<br />
Dipl.-Ing. Klaus Haßkerl<br />
Dipl.-Ing. Dieter H<strong>in</strong>z<br />
Nicole Kettenr<strong>in</strong>g<br />
Dorothea Schlender-Bobrowski<br />
Sachgebiet für Energieberatung, Heizungsmaßnahmen<br />
<strong>und</strong> Verbrauchsdatenerfassung<br />
Dipl.-Ing. Hartmut Hanke<br />
Dipl.-Ing. Burkhard Müller<br />
Sachgebiet Arbeitssicherheit<br />
Dipl.-Ing. Siegfried Eyrich<br />
Re<strong>in</strong>hard Franke<br />
Helmut Krebs<br />
Josef Nill<strong>in</strong>g<br />
Serviceteam<br />
Elke Pfeifer<br />
Ursula Berleth<br />
Hiltrud Holz<br />
Petra Kaltwasser-Pipp<strong>in</strong>g
Babenhausen, Stadtkirche 19<br />
Bad Ems, Mart<strong>in</strong>skirche 22<br />
Bad Homburg, Gedächtniskirche 23<br />
Beilste<strong>in</strong>, Schlosskirche 32<br />
Birkenau, <strong>Kirche</strong> 30<br />
Breidenbach, <strong>Kirche</strong> 29<br />
Büd<strong>in</strong>gen, Marienkirche 21<br />
Büttelborn, <strong>Kirche</strong> 22<br />
Darmstadt, <strong>Kirche</strong>nverwaltung 27<br />
Frankfurt-Bockenheim,<br />
Geme<strong>in</strong>dezentrum 12<br />
Frankfurt-Bockenheim,<br />
Zentrum Verkündigung 13<br />
Frankfurt, Dornbuschkirche 11<br />
Frankfurt, Jugendkulturkirche 4<br />
Fraurombach, <strong>Kirche</strong> 18<br />
Friedberg, Stadtkirche 21<br />
Gießen, Geme<strong>in</strong>dezentrum 26<br />
Görsroth, Geme<strong>in</strong>dehaus 10<br />
Hachenburg, Schlosskirche 26<br />
Hackenheim, Alte <strong>Kirche</strong> 27<br />
Höchst Kloster, Tagungshaus 9<br />
Hohensolms, Jugendburg 11<br />
Kirch-Göns, Geme<strong>in</strong>dehaus 7<br />
Kronberg, Johanneskirche 16<br />
Leusel, <strong>Kirche</strong> 25<br />
Lich, Marienstiftskirche 15<br />
Löhnberg, <strong>Kirche</strong> 25<br />
Ma<strong>in</strong>z, Christuskirche 14<br />
Maxsa<strong>in</strong>, <strong>Kirche</strong> 24<br />
Maxsa<strong>in</strong>, Pfarrhaus 24<br />
Nieder-Seemen, <strong>Kirche</strong> 18<br />
Niederweidbach, Marienaltar 30<br />
Nochern, <strong>Kirche</strong> 32<br />
Oberhöchstadt, K<strong>in</strong>dergarten 7<br />
Ober-Ramstadt, Geme<strong>in</strong>dezentrum 8<br />
Oberursel, Geme<strong>in</strong>dezentrum 6<br />
Offenbach-Waldheim,<br />
<strong>Kirche</strong>nzentrum 5<br />
Oppenheim, St. Kathar<strong>in</strong>en-<strong>Kirche</strong> 20<br />
Ortenberg, Marienkirche 16<br />
Rod ander Weil, Geme<strong>in</strong>dehaus 10<br />
Schotten, Stadtkirche 17<br />
Ste<strong>in</strong>fischbach, Pfarrhaus 6<br />
Ste<strong>in</strong>heim, <strong>Kirche</strong> 23<br />
Weilburg, Schlosskirche 28<br />
Wiesbaden, R<strong>in</strong>gkirche 33<br />
Worms, Dreifaltigkeitskirche 31<br />
3
Frankfurt –Umbau der Peterskirche zur Jugendkulturkirche<br />
4<br />
Durch ihre vorteilhafte Lage nahe der Zeil<br />
eignet sich die Peterskirche besonders gut<br />
für e<strong>in</strong>e moderne, ökumenisch offene Jugend-Kultur-<strong>Kirche</strong>.<br />
Durch umfangreiche Umbaumaßnahmen<br />
wird e<strong>in</strong> multifunktionaler<br />
Veranstaltungsraum für bis zu 1000 Personen<br />
geschaffen. Daneben wird die <strong>Kirche</strong><br />
e<strong>in</strong> Café, Sem<strong>in</strong>ar- <strong>und</strong> Büroräume sowie e<strong>in</strong>e<br />
Kapelle beherbergen. Extrem unterschiedliche<br />
Nutzungen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>- <strong>und</strong> demselben<br />
Raum erfordern e<strong>in</strong> <strong>hohe</strong>s Maß anFlexibilität.<br />
Die Alltagsfunktionen werden im<br />
Seitenschiff gestapelt <strong>und</strong> haben sowohl visuellen<br />
Bezug nach außen als auch zum <strong>Kirche</strong>n<strong>in</strong>nenraum.<br />
Der große <strong>Kirche</strong>nraum ist<br />
durch die ortsveränderbaren E<strong>in</strong>bauten des<br />
Bartresens <strong>und</strong> der Bühne unterschiedlich<br />
nutzbar <strong>und</strong> <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er Größe veränderbar.<br />
Von der Decke abfahrbare, raum<strong>hohe</strong> Banner<br />
lassen spürbare Zonierungen zu, ohne<br />
den Hauptraum zu stören. Mehrschichtiges<br />
Gittergewebe ermöglicht vielschichtige Projektionen.<br />
Zentrales Gestaltungselement<br />
<strong>und</strong> Rückgrat des Konzeptes ist die so genannte<br />
Lichtwand: e<strong>in</strong>e ca. 400 m 2 große,<br />
beidseitig mit Licht bespielbare Trennung<br />
zwischen Veranstaltungsraum <strong>und</strong> dah<strong>in</strong>ter<br />
liegenden Nutzflächen.<br />
Bauherr: jugend-kultur-kirche<br />
sankt peter gGmbH, Frankfurt<br />
Architekt: 54f architekten +<strong>in</strong>genieure,<br />
Darmstadt<br />
Bau- <strong>und</strong> Liegenschaftsabteilung<br />
<strong>Evangelische</strong>r Regionalverband<br />
Frankfurt: Klaus Weilmünster<br />
Bauzeit: 2004-2007
In der städtebaulichen Situation gruppieren<br />
sich Geme<strong>in</strong>dehaus, K<strong>in</strong>dertagesstätte <strong>und</strong><br />
Wohnhaus um e<strong>in</strong>en Platz. Während die K<strong>in</strong>dertagesstätte<br />
<strong>und</strong> das Wohnhaus den abknickenden<br />
Verlauf der umgebenden Bebauung<br />
fortführen, betont das Geme<strong>in</strong>dehaus<br />
durch se<strong>in</strong>e exponierte Stellung <strong>und</strong> den<br />
vorgestellten Glockenträger se<strong>in</strong>en sakralen<br />
Charakter.<br />
Die gesamte Anlage ist e<strong>in</strong>geschossig <strong>und</strong><br />
komplett <strong>in</strong> Holzständerbauweise errichtet.<br />
Die Wand- <strong>und</strong> Dachelemente wurden werkseitig<br />
vorgefertigt <strong>und</strong> auf der Baustelle <strong>in</strong><br />
kurzer Bauzeit montiert.<br />
In den Hauptachsen des Saales e<strong>in</strong>gestellte<br />
Stahlrahmen tragen die e<strong>in</strong>gelegten Dachelemente<br />
<strong>und</strong> übernehmen die Aussteifung<br />
des Gebäudes <strong>in</strong> Querrichtung. Zu Gunsten<br />
e<strong>in</strong>er klaren <strong>und</strong> e<strong>in</strong>fachen L<strong>in</strong>ienführung im<br />
Innenraum s<strong>in</strong>d alle konstruktiven Bauteile<br />
<strong>in</strong> die Dämmebene von Dach <strong>und</strong> Wand <strong>in</strong>tegriert.<br />
E<strong>in</strong>e feuchtegesteuerte M<strong>in</strong>imallüftung<br />
sorgt zum e<strong>in</strong>en für e<strong>in</strong>en hygienischen<br />
Luftaustausch, zum anderen werden die<br />
beim Lüften entstehenden Wärmeverluste<br />
so ger<strong>in</strong>g wie möglich gehalten. Die Realisierung<br />
e<strong>in</strong>er ökologisch s<strong>in</strong>nvollen lowtech<br />
Architektur schlägt sich <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em ger<strong>in</strong>gen<br />
Bedarf an Heizenergie <strong>und</strong> niedrigen<br />
Unterhaltskosten nieder.<br />
KIRCHENRAUM<br />
Der städtebaulichen Absicht folgend bef<strong>in</strong>det<br />
sich der kreuzförmige Sakralraum zusammen<br />
mit dem Glockenturm an vorderster<br />
Stelle des Langhauses. Die anschließenden<br />
Räume, kle<strong>in</strong>er <strong>und</strong> großer<br />
Saal, können bei Bedarf zugeschaltet werden.<br />
Die Materialität von Holz wird <strong>in</strong>den Oberflächen<br />
des Innenraums, den E<strong>in</strong>bauten <strong>und</strong><br />
den Außenfassaden thematisiert. Die reduzierte<br />
Verwendung von Materialien sowie<br />
der Verzicht auf konstruktive Merkmale dienen<br />
der <strong>in</strong>tuitiven Wahrnehmung von Licht<br />
<strong>und</strong> Architektur.<br />
Bauherr: <strong>Evangelische</strong>r<br />
<strong>Kirche</strong>ngeme<strong>in</strong>deverband<br />
Offenbach<br />
Bauberatung: Gerd Lippisch<br />
Architekt: architektengruppe s+e+s,<br />
Mühlheim am Ma<strong>in</strong><br />
Baureferat der EKHN: Hans-Georg Lange,<br />
Dorothee Re<strong>in</strong>iger-Po<strong>in</strong>tner<br />
Bauzeit: 2002 -2003<br />
Offenbach-Waldheim –Neubau e<strong>in</strong>es <strong>Kirche</strong>nzentrums<br />
5
Ste<strong>in</strong>fischbach –Neubau e<strong>in</strong>es Pfarrhauses<br />
Oberursel –Neubau e<strong>in</strong>es Geme<strong>in</strong>dezentrums<br />
für die <strong>Evangelische</strong> Versöhnungsgeme<strong>in</strong>de<br />
6<br />
Das neue Pfarrhaus nutzt die Topografie<br />
des Hanggr<strong>und</strong>stückes. Die Wohnräume<br />
s<strong>in</strong>d nach Süden <strong>und</strong> Westen ausgerichtet.<br />
Die großzügige Verglasung wird für den solaren<br />
Wärmegew<strong>in</strong>n im W<strong>in</strong>ter genutzt <strong>und</strong><br />
gibt e<strong>in</strong>en w<strong>und</strong>erschönen Weitblick <strong>in</strong> das<br />
Talfrei. Durch den kompakten Gr<strong>und</strong>riss ist<br />
e<strong>in</strong> wirtschaftliches Verhältnis zwischen<br />
Baukörper <strong>und</strong> Wohnfläche gegeben. Die<br />
gewählte Konstruktion, gemauerte Außenwände<br />
<strong>und</strong> tragende Innenstützen, ermöglicht<br />
die freie, <strong>in</strong>dividuelle E<strong>in</strong>teilung der<br />
Räume.<br />
Bauherr: <strong>Evangelische</strong> <strong>Kirche</strong>ngeme<strong>in</strong>de<br />
Ste<strong>in</strong>fischbach-Reichenbach<br />
Architekt: Reuter +Werr, Idste<strong>in</strong><br />
Baureferat der EKHN: Hans-Georg Lange,<br />
Dorothee Re<strong>in</strong>iger-Po<strong>in</strong>tner<br />
Fotos: Bernd Schuster, Hünstetten<br />
Bauzeit: 2003 -2004<br />
Mit se<strong>in</strong>en beiden differenziert gestalteten<br />
Baukörpern fügt sich der Neubau gut <strong>in</strong> die<br />
bestehende Bebauung e<strong>in</strong>. Die Straßenfassade<br />
zeigt klar se<strong>in</strong>e Bestimmung als evangelisches<br />
Geme<strong>in</strong>dezentrum.<br />
E<strong>in</strong> großflächig, teilweise über zwei Geschosse<br />
verglaster zentraler E<strong>in</strong>gangsbereich<br />
mit Galerie auf der Vorplatzseite verb<strong>in</strong>det<br />
Hauptbaukörper mit Gottesdienstraum<br />
<strong>und</strong> Nebenbaukörper mit Küche,<br />
Haustechnik <strong>und</strong> Büro. Der Gottesdienstraum<br />
mit glaskünstlerisch gestalteter gebogener<br />
Apsiswand über zwei Geschosse ist<br />
mit dem Gruppenraum mittels flexibler<br />
Trennwand zusammenschaltbar. E<strong>in</strong> großzügiges<br />
Foyer erschließt die unterschiedlichen<br />
Nutzungsbereiche. Geme<strong>in</strong>deraum, Jugendraum,<br />
Archivraum <strong>und</strong> Geme<strong>in</strong>debüro r<strong>und</strong>en<br />
das Raumprogramm ab.<br />
Bauherr: <strong>Evangelische</strong><br />
Versöhnungsgeme<strong>in</strong>de Oberursel<br />
Architekt: Architektengruppe GHP, Oberursel<br />
Baureferat der EKHN: Hans-Georg Lange,<br />
Dorothee Re<strong>in</strong>iger-Po<strong>in</strong>tner<br />
Bauzeit: 2003 -2004
In e<strong>in</strong>em Wettbewerb wurde die architektonische<br />
Lösung für die bauliche Umsetzung<br />
des angestrebten pädagogischen Konzeptes<br />
gef<strong>und</strong>en. Der K<strong>in</strong>dergarten arbeitet mit<br />
dem „Offenen Konzept“, e<strong>in</strong>er weitgehenden<br />
Selbstbestimmung der K<strong>in</strong>der <strong>und</strong> der<br />
Reggio-Pädagogik ,deren Schwerpunkt auf<br />
der S<strong>in</strong>nesschärfung <strong>und</strong> dem Erleben der<br />
Umwelt sowie des Mite<strong>in</strong>anders <strong>in</strong> der Natur<br />
liegt. Der Anbau gibt dem bereits bestehenden<br />
K<strong>in</strong>dergarten e<strong>in</strong>e neue, eigene Identität<br />
durch die Verwendung verschiedener natürlicher<br />
Baumaterialien <strong>und</strong> deren ästhetischem<br />
Zusammenspiel.<br />
Bauherr: <strong>Evangelische</strong> <strong>Kirche</strong>ngeme<strong>in</strong>de<br />
Oberhöchstadt<br />
Architekt: Kulla Architekten,<br />
Hattersheim am Ma<strong>in</strong><br />
Baureferat der EKHN: Georg Weber, Barbara Schmid<br />
Bauzeit: 2003<br />
Das neue Geme<strong>in</strong>dehaus sollte für die verschiedensten<br />
Aktivitäten der ländlichen <strong>Kirche</strong>ngeme<strong>in</strong>de<br />
nutzbar se<strong>in</strong>. E<strong>in</strong> äußerst flexibles<br />
Raumangebot wird dieser Forderung<br />
gerecht. Das ane<strong>in</strong>er langen Dorfstraße liegende<br />
Gr<strong>und</strong>stück ist von Wiesen <strong>und</strong> e<strong>in</strong>er<br />
lockeren Ortsrandbebauung umgeben. Daher<br />
wurde bewusst e<strong>in</strong>e selbständige Form<br />
gewählt, die aus den <strong>in</strong>neren Vorgaben entwickelt<br />
worden ist <strong>und</strong> e<strong>in</strong>e <strong>in</strong>tensive Verb<strong>in</strong>dung<br />
zu den weiten Aussichten <strong>in</strong> der<br />
Ost-West-Ausrichtung ermöglicht. Leichtigkeit,<br />
Transparenz <strong>und</strong> Geborgenheit vermittelt<br />
die Gebäudeform von Geme<strong>in</strong>desaal<br />
<strong>und</strong> Foyer durch komplett verglaste Stirnseiten<br />
<strong>und</strong> geschwungene L<strong>in</strong>ienführung<br />
des Pultdaches <strong>und</strong> der Südwand. Dem<br />
schließt sich der geradl<strong>in</strong>ige Kubus für Nebenräume,<br />
Technik, Küche <strong>und</strong> kle<strong>in</strong>em<br />
Gruppenraum an. Verstärkt wird der<br />
Gesamte<strong>in</strong>druck durch die Pfosten-Riegel-<br />
Konstruktion der Fassaden <strong>und</strong> die Gebäudehülle<br />
aus leichtem Alum<strong>in</strong>iumblech.<br />
Bauherr: <strong>Evangelische</strong> <strong>Kirche</strong>ngeme<strong>in</strong>de<br />
Kirch-Göns<br />
Architekt: Alexander Ehrenspeck, Fernwald<br />
Baureferat der EKHN: Hans-Georg Lange,<br />
Dorothee Re<strong>in</strong>iger-Po<strong>in</strong>tner<br />
Bauzeit: 2004<br />
Oberhöchstadt –Erweiterung des K<strong>in</strong>dergartens<br />
Kirch-Göns –<br />
Neubau e<strong>in</strong>es Geme<strong>in</strong>dehauses<br />
7
Ober-Ramstadt –<br />
Sanierung <strong>und</strong> Erweiterung des Geme<strong>in</strong>dezentrums "Prälat-Diehl-Haus"<br />
8<br />
Die <strong>in</strong>den 1950er Jahren mit e<strong>in</strong>em Großen<br />
Saal, Sitzungszimmer <strong>und</strong> Empore erweiterte<br />
ehemalige Hofreite war <strong>in</strong> die Jahre gekommen.<br />
Mit der aktuellen Sanierung sollte<br />
das Gebäude heutigen Bedürfnissen angepasst<br />
<strong>und</strong> die Erschließung auf die Südseite<br />
verlegt werden. Die Umstrukturierung erfolgte<br />
im behutsamen Umgang mit der ursprünglichen<br />
Architektur <strong>und</strong> dem Erhalt der<br />
maßstäblichen Proportionen. So tritt z.B.<br />
der neue W<strong>in</strong>dfang eigenständig vor die erhaltene<br />
Fassade <strong>und</strong> kennzeichnet die Bedeutung<br />
des Hauses lediglich durch e<strong>in</strong> <strong>in</strong><br />
die Wand geschnittenes Kreuz. Der Küchenbereich<br />
wurde aus dem Kellergeschoss mit<br />
direktem Bezug zum jetzt teilbaren Großen<br />
Saal <strong>in</strong> das Erdgeschoss verlegt. Die Jugend<br />
erhielt im Untergeschoss, verb<strong>und</strong>en mit<br />
dem Lichthof, e<strong>in</strong>en neuen Bereich.<br />
Das vorgegebene Raumprogramm für das<br />
Dekanat wurde mit e<strong>in</strong>em neuen Baukörper<br />
<strong>in</strong> moderner Architektursprache realisiert.<br />
Es entstanden Büroräume, e<strong>in</strong> Sitzungszimmer<br />
sowie e<strong>in</strong>e großzügige kommunikative<br />
Halle mit Teeküche. Dank e<strong>in</strong>es geme<strong>in</strong>samen<br />
Farbkonzeptes stehen Alt- <strong>und</strong> Neubau<br />
e<strong>in</strong>trächtig nebene<strong>in</strong>ander. Esdom<strong>in</strong>iert e<strong>in</strong><br />
erdverb<strong>und</strong>enes <strong>in</strong>tensives Rot den cremefarbenen<br />
Putz <strong>und</strong> die naturfarbene Holzverkleidung.<br />
Bauherr: <strong>Evangelische</strong> <strong>Kirche</strong>ngeme<strong>in</strong>de<br />
Ober-Ramstadt<br />
Architekt: Peter Würtenberger,<br />
Ober-Ramstadt<br />
Baureferat der EKHN: Georg Weber, Angela Gotthardt,<br />
Barbara Schmid<br />
Bauzeit: 2003 -2004
Kloster Höchst –Umbau <strong>und</strong> Sanierung des Tagungshauses<br />
der <strong>Evangelische</strong>n <strong>Kirche</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>und</strong> <strong>Nassau</strong><br />
Das <strong>in</strong>se<strong>in</strong>en Ursprüngen aus dem 12. Jh.<br />
stammende Kloster steht als Gesamtanlage<br />
unter Denkmalschutz. Nach wechselvoller<br />
Geschichte wurde es <strong>in</strong> den 1950er Jahren<br />
zur Jugendbildungsstätte umgestaltet. Anlass<br />
für den erneuten Umbau <strong>und</strong> die Sanierung<br />
waren die nicht mehr zeitgemäße<br />
Ausstattung der Gästezimmer <strong>und</strong> Tagungsräume,<br />
die aktuellen brandschutztechnischen<br />
Anforderungen <strong>und</strong> vor allem die veraltete<br />
<strong>und</strong> desolate Haustechnik. Weitere<br />
Gründe waren schlechte Orientierungsmöglichkeiten<br />
für die Gäste, fehlende Verb<strong>in</strong>dungen<br />
zwischen den e<strong>in</strong>zelnen Gebäudeteilen<br />
<strong>und</strong> dadurch bed<strong>in</strong>gt e<strong>in</strong>e sehr aufwändige<br />
Bewirtschaftung. Bei allen Maßnahmen<br />
sollten der Charme der Anlage, die<br />
unterschiedlichen Charaktere der Höfe erhalten<br />
<strong>und</strong> betont werden. Jetzt erschließt<br />
e<strong>in</strong> neues Foyer mit Treppen- <strong>und</strong> Aufzugsanlage<br />
<strong>in</strong> der Gebäudemitte die verschiedenen<br />
Bereiche wie Aula <strong>und</strong> Speisesaal im<br />
ehemaligen Refektorium. Weiter verfügt das<br />
Haus über e<strong>in</strong>en Raum der Stille sowie 118<br />
Betten <strong>in</strong> E<strong>in</strong>zel- <strong>und</strong> Doppelzimmern mit<br />
Bad.<br />
Bauherr: <strong>Evangelische</strong> <strong>Kirche</strong> <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong><br />
<strong>und</strong> <strong>Nassau</strong><br />
Architekten: Kolb +Neumann, Darmstadt<br />
Baureferat der EKHN: Hans-Otto Dierkes,<br />
Joachim Benz<br />
Bauzeit: 2003 -2004<br />
Fotos: Kolb +Neumann, Darmstadt<br />
9
Görsroth –Umnutzung e<strong>in</strong>er Scheune zum Geme<strong>in</strong>dehaus<br />
Rod ander Weil –<br />
Durch den Umbau der alten Scheune nutzte<br />
die Geme<strong>in</strong>de die Chance, e<strong>in</strong> offenes Haus<br />
zu gestalten <strong>und</strong> gleichzeitig das Gebäude<br />
<strong>in</strong> das vorhandene Ortsbild e<strong>in</strong>zupassen.<br />
Die bestehende Gr<strong>und</strong>rissaufteilung <strong>in</strong> drei<br />
Zonen im Erdgeschoss <strong>und</strong> e<strong>in</strong>en großen<br />
Raum im Obergeschoss (ehemalige Tenne)<br />
wurde <strong>in</strong> ihrem Charakter beibehalten. Die<br />
neuen, notwendigen Ergänzungen spielen<br />
mit dem reizvollen Kontrast von Alt <strong>und</strong><br />
Neu.<br />
Bauherr: <strong>Evangelische</strong> <strong>Kirche</strong>ngeme<strong>in</strong>de<br />
Görsroth<br />
Architekt: Reuter +Werr, Idste<strong>in</strong><br />
Baureferat der EKHN: Hans-Georg Lange, Steffen Theil<br />
Fotos: Bernd Schuster, Hünstetten<br />
Bauzeit: 2000<br />
Umnutzung <strong>und</strong> Erweiterung der Pfarrscheune zum Geme<strong>in</strong>dehaus<br />
10<br />
Die zum Ensemble des Kirchhofes gehörende<br />
Pfarrscheune sollte behutsam saniert<br />
<strong>und</strong> mit e<strong>in</strong>em Erweiterungsbau versehen<br />
werden, um e<strong>in</strong>e neue Nutzung als Geme<strong>in</strong>desaal<br />
zu ermöglichen. Die Orig<strong>in</strong>alsubstanz<br />
aus dem späten 18. Jh. konnte<br />
hierzu weitgehend erhalten bleiben. Die<br />
B<strong>und</strong>wände <strong>und</strong> liegenden Stühle haben ihre<br />
ursprüngliche Tragefunktion im Zusammenhang<br />
mit dem Gesamttragwerk vollständig<br />
behalten. Die typische sechsteilige<br />
Gr<strong>und</strong>struktur der Scheune bleibt durch die<br />
Angliederung des Erweiterungsbaus ungestört.<br />
Die ehemalige Tenne thematisiert die<br />
mittige Durchfahrt als Foyer mit halböffentlichem<br />
Charakter. Der Saal wird giebelseitig<br />
durch große Doppelflügeltüren großzügig<br />
belichtet <strong>und</strong> ist <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er äußeren Gestalt<br />
bewusst schlicht gehalten. Die Ausfachung<br />
des Holztragwerks erfolgte <strong>in</strong> allen Bereichen<br />
mit Lehmbaustoffen.<br />
Bauherr: <strong>Evangelische</strong> <strong>Kirche</strong>ngeme<strong>in</strong>de<br />
Rod an der Weil<br />
Architekt: Architektengruppe GHP, Oberursel<br />
Baureferat EKHN: Hans-Georg Lange,<br />
Dorothee Re<strong>in</strong>iger-Po<strong>in</strong>tner<br />
Bauzeit: 2003 -2004
Die aus den 1960er Jahren stammende Dornbuschkirche<br />
sollte aufgr<strong>und</strong> des extremen<br />
Rückganges an Gottesdienstbesuchern verkle<strong>in</strong>ert<br />
oder abgerissen werden. Durch Planungsstudien<br />
konnte nachgewiesen werden,<br />
dass e<strong>in</strong> Teilabbruch die beste Lösung darstellt.<br />
Städtebaulich verbleibt e<strong>in</strong> räumlich<br />
<strong>und</strong> funktional <strong>in</strong>taktes Ensemble –bestehend<br />
aus Geme<strong>in</strong>dezentrum, "Restkirche"<br />
<strong>und</strong> Turm; es entsteht e<strong>in</strong> neuer Kirchplatz<br />
mit großem öffentlichen Potential. Der<br />
geräumige Altarbereich bzw. Chor verbleibt<br />
als alte/ neue <strong>Kirche</strong>.<br />
Die nach dem Abbruch offen verbliebene<br />
Baukörperseite wird mit e<strong>in</strong>er neuen Wand<br />
bzw. Fassade verschlossen, die durch Stanzungen<br />
<strong>und</strong> Abdrücke der "alten" <strong>Kirche</strong> –<br />
d.h. der entfernten baulichen Elemente wie<br />
E<strong>in</strong>gangsfassade, Altar <strong>und</strong> Empore – aus<br />
der Fläche heraus zu e<strong>in</strong>er plastischen<br />
Struktur verformt wird. Auf dem Platz wird<br />
der Gr<strong>und</strong>riss der abgebrochenen <strong>Kirche</strong><br />
wiedergegeben.<br />
Frankfurt –Rückbau der Dornbuschkirche<br />
Bauherr: Ev. Regionalverband Frankfurt<br />
Architekten: Meixner, Schlüter Wendt,<br />
Frankurt/Ma<strong>in</strong><br />
Bau- <strong>und</strong> Liegenschaftsabteilung Ev. Regionalverband<br />
Frankfurt: Klaus Weilmünster<br />
Bauzeit: 2003 -2005<br />
<strong>Evangelische</strong> Jugendburg Hohensolms mit Kulturzentrum Regenbogenhalle<br />
Die als <strong>Evangelische</strong> Jugendbildungsstätte<br />
genutzte <strong>und</strong> aus dem 14.Jh. stammende,<br />
denkmalgeschützte Burg Hohensolms war<br />
im H<strong>in</strong>blick auf e<strong>in</strong>e zeitgemäße Nutzung zu<br />
sanieren. Das bisher ungenutzte Stall- <strong>und</strong><br />
Scheunengebäude "Regenbogenhalle" wurde<br />
zur Vervollständigung des Bildungsangebots<br />
zum Kulturzentrum mit Tonstudio, Räumen<br />
für Musikproben <strong>und</strong> Besprechungen,<br />
"Internetcafé" <strong>und</strong> e<strong>in</strong>em multifunktionalen<br />
Saal ausgebaut.<br />
E<strong>in</strong> angebautes neues Foyer mit Treppenhaus,<br />
Aufzug <strong>und</strong> Begegnungszone erschließt<br />
die bisher nicht <strong>in</strong>tern verb<strong>und</strong>enen<br />
Geschosse.<br />
Soweit möglich wurden alle alten historischen<br />
Bauteile bewahrt <strong>und</strong> fachgerecht restauriert.<br />
Alle erforderlichen neuen Bauteile<br />
<strong>und</strong> statischen Elemente wurden als deutlich<br />
zum 21. Jh. gehörend gestaltet. Die bewusste<br />
Verwendung "moderner Materialien"<br />
wie Stahl <strong>und</strong> Glas, <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung mit den<br />
auch früher schon <strong>in</strong> der Burg verbauten<br />
Hölzern <strong>und</strong> Naturste<strong>in</strong>en, schuf zusammen<br />
mit den gewählten Detailausbildungen e<strong>in</strong><br />
besonderes Spannungsfeld zwischen alt<br />
<strong>und</strong> neu.<br />
Bauherr: <strong>Evangelische</strong> <strong>Kirche</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>und</strong> <strong>Nassau</strong><br />
Architekt: Re<strong>in</strong>er Bierbach, Herborn<br />
Baureferat der EKHN: Hans-Otto Dierkes,<br />
Klaus Haßkerl, Dieter H<strong>in</strong>z<br />
Bauzeit: 2001 -2003<br />
11
Frankfurt-Bockenheim –Neubau e<strong>in</strong>es Geme<strong>in</strong>dezentrums mit Umgestaltung<br />
<strong>und</strong> Sanierung der St. Jakobskirche<br />
12<br />
Die Zusammenführung von bisher über mehrere<br />
Orte verteilter E<strong>in</strong>richtungen der <strong>Kirche</strong>ngeme<strong>in</strong>de<br />
unmittelbar bei der historischen<br />
Jakobskirche sollte e<strong>in</strong>en Identifikationsgew<strong>in</strong>n,<br />
aber auch erhebliche Vorteile <strong>in</strong><br />
funktionaler <strong>und</strong> betriebswirtschaftlicher H<strong>in</strong>sicht<br />
bewirken. So entstand e<strong>in</strong> e<strong>in</strong>deutiges<br />
Geme<strong>in</strong>de-Zentrum, das Bauwerke aus drei<br />
Epochen verzahnt: das moderne Geme<strong>in</strong>dezentrum,<br />
den historischen Kirchturm von<br />
1853 <strong>und</strong> das nach dem Krieg wieder errichtete<br />
Gotteshaus, das auf e<strong>in</strong>em Vorläuferbau<br />
aus dem 14. Jh. fußt.<br />
Das Geme<strong>in</strong>dehaus mit zweckmäßigem<br />
Raumprogramm wurde an den historischen<br />
Turm der Jakobskirche angebaut. E<strong>in</strong>e gläserne<br />
E<strong>in</strong>gangshalle dient als zentrale Erschließung,<br />
als B<strong>in</strong>deglied zwischen Alt <strong>und</strong><br />
Neu. E<strong>in</strong> frei durch den Luftraum der Halle<br />
gespannter Steg verb<strong>in</strong>det im Obergeschoss<br />
den Neubau mit dem Turm. Dessen archaisch<br />
wirkende Mauern aus Naturste<strong>in</strong> wurden freigelegt,<br />
Spuren der wechselvollen Vergangenheit<br />
bewusst sichtbar belassen. Alle E<strong>in</strong>bauten<br />
<strong>und</strong> Möbel wurden speziell für diese Gebäude<br />
entworfen. Der neu gestaltete Vorplatz<br />
mit Rampen, Sitzmauern <strong>und</strong> Stufen öffnet<br />
die Anlage zum städtischen Platz <strong>und</strong> lädt<br />
zum Verweilen <strong>und</strong> Festefeiern e<strong>in</strong>. Offenheit<br />
<strong>und</strong> leichte Zugänglichkeit entsprechen dem<br />
heutigen Selbstverständnis der Geme<strong>in</strong>de.<br />
Mit der Umgestaltung der St. Jakobskirche<br />
fand die Geme<strong>in</strong>defusion ihren Abschluss.<br />
Der gesamte <strong>Kirche</strong>nraum e<strong>in</strong>schließlich des<br />
neuen Altarbereiches lässt sich, jetzt ebenerdig,<br />
mit ger<strong>in</strong>gem Aufwand verändern <strong>und</strong><br />
den vielfältigen (auch profanen) Nutzungen<br />
anpassen. E<strong>in</strong>e flexible E<strong>in</strong>zelbestuhlung ersetzt<br />
die festen Bankreihen. Die Orgel- <strong>und</strong><br />
Sängerempore wurde unter Beibehaltung<br />
großer Teile der tragenden Konstruktion<br />
komplett umgebaut, so dass sie wieder ausreichenden<br />
Platz für den <strong>Kirche</strong>nchor bietet.<br />
Das verwandelbare Altar-Retabel aus Metallgewebe<br />
dient gleichzeitig der Raumakustik.<br />
Neue Glasfenster von Saskia Schulz ergänzen<br />
die wertvollen Crodel-Fenster der 1950er Jahre.<br />
Bauherr: <strong>Evangelische</strong>r Regionalverband Frankfurt<br />
Architekten: Gottste<strong>in</strong> Architekten mit Architekturbüro<br />
Nieper <strong>und</strong> Partner, Darmstadt<br />
Bau- <strong>und</strong> Liegenschaftsabteilung Ev. Regionalverband<br />
Frankfurt: Thomas Voigtländer<br />
Fotos: Madjid Asghari<br />
Bauzeit: 2002-2005
Die imZeichen zurückgehender Mitgliederzahlen<br />
aufgegebene Markuskirche wurde für<br />
das Zentrum Verkündigung vorgesehen, <strong>in</strong><br />
dem mehrere Fachabteilungen <strong>und</strong> Handlungsfelder<br />
der EKHN zusammengefasst<br />
s<strong>in</strong>d. Im ehemaligen großen <strong>Kirche</strong>nschiff<br />
s<strong>in</strong>d alle Raumelemente der sakralen <strong>und</strong><br />
geme<strong>in</strong>schaftlichen Nutzungen untergebracht:<br />
der neue, deutlich kle<strong>in</strong>ere Sakralraum,<br />
e<strong>in</strong> Foyer für die Raumverteilung, die<br />
Bibliothek <strong>und</strong> der Meditationsraum. Der<br />
<strong>Kirche</strong>nbaukörper wurde zwischen den alten<br />
Strebepfeilern auf der Ost- <strong>und</strong> Westseite<br />
geöffnet, um Licht <strong>in</strong>s Innere zubr<strong>in</strong>gen <strong>und</strong><br />
damit auch den ehemaligen Lichtzustand<br />
der Jugendstilkirche wieder herzustellen.<br />
Dabei kragt die Bibliothek <strong>in</strong> das Volumen<br />
des <strong>Kirche</strong>nraumes <strong>und</strong> bildet damit den<br />
kreuzförmigen Gr<strong>und</strong>riss. Die Anbauten für<br />
die Verwaltungs- <strong>und</strong> Gruppenräume formieren<br />
sich um die Lichthöfe.<br />
Im Inneren der <strong>Kirche</strong> wird Profilbauglas für<br />
die Abtrennung, z.B. zwischen <strong>Kirche</strong> <strong>und</strong><br />
Bibliothek, e<strong>in</strong>gesetzt. Damit wird durch die<br />
gleiche Materialität wie die der Außenwände<br />
e<strong>in</strong>e Verb<strong>in</strong>dung zwischen den neuen Anbauten<br />
<strong>und</strong> der <strong>Kirche</strong> hergestellt. Durch die<br />
Verwendung von opaken <strong>und</strong> transluzenten<br />
Baustoffen, durch die Überlagerung von Materialien<br />
wie Glas, Gewebe <strong>und</strong> Textilien<br />
wird das Tageslicht durch verschiedene<br />
Schichten <strong>und</strong> Räume bis <strong>in</strong>s Innere des <strong>Kirche</strong>nraums<br />
geführt <strong>und</strong> gefiltert. Je nach Tageslicht<br />
entstehen unterschiedliche Reflexionen<br />
<strong>und</strong> Lichtstimmungen. Hierdurch erhält<br />
der <strong>Kirche</strong>nraum se<strong>in</strong>e sakrale Anmutung.<br />
Frankfurt-Bockenheim –<br />
Umbau der Markuskirche zum Zentrum Verkündigung<br />
Bauherr/Projektleitung : Ev. Regionalverband Frankfurt am Ma<strong>in</strong><br />
Nutzer : <strong>Evangelische</strong> <strong>Kirche</strong> <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>und</strong> <strong>Nassau</strong>, Darmstadt<br />
Architekt /Generalplaner : pfeifer. kuhn. architekten –Feiburg<br />
Statik: Ingenieurbüro Schlier u. Partner, Darmstadt<br />
Bau- <strong>und</strong> Liegenschaftsabteilung<br />
Ev. Regionalverband Frankfurt: Steffen Theil<br />
Fotos: Ruedi Walti –Basel /Schweiz<br />
Planungs- <strong>und</strong> Bauzeit : 2000 -2005<br />
13
Ma<strong>in</strong>z –<br />
Gesamtsanierung der Christuskirche<br />
14<br />
Die Christuskirche wurde nach Plänen des<br />
Ma<strong>in</strong>zer Stadtbaumeisters Eduard Kreyssig<br />
zwischen 1896 <strong>und</strong> 1903 als Zentralbau<br />
nach dem Vorbild des kurz zuvor entstandenen<br />
Berl<strong>in</strong>er Doms erbaut. Mit dem Wiederaufbau<br />
nach dem zweiten Weltkrieg erfuhr<br />
der ursprüngliche Vierungsraum e<strong>in</strong>e<br />
Umdeutung als Zentralraum. Im Zuge sich<br />
wandelnder liturgischer Konzepte genügten<br />
diese räumlichen Lösungen immer weniger<br />
den Ansprüchen der Nutzer. Zugleich nahm<br />
die Bedeutung als Veranstaltungsort für<br />
Konzerte <strong>und</strong> Ausstellungen kont<strong>in</strong>uierlich<br />
zu. Der aktuelle Innenumbau umfasst deshalb<br />
auch e<strong>in</strong>e räumliche Erweiterung durch<br />
den Teilausbau des Untergeschosses. Die<br />
Umgestaltung des <strong>Kirche</strong>nraums orientiert<br />
sich an der Lage der neuen Pr<strong>in</strong>zipalstücke,<br />
an den Anforderungen e<strong>in</strong>er flexiblen Nutzbarkeit<br />
<strong>und</strong> an raumakustischen Erfordernissen.<br />
Das zur Raummitte gekrümmte<br />
Chorpodest wurde abgebrochen <strong>und</strong> wieder<br />
mit geraden Stufen aufgebaut, die vermauerten<br />
Pfeiler geöffnet, die Trennwand<br />
zur Vorkirche umgebaut sowie Fußboden,<br />
elektrische Ausstattung <strong>und</strong> Bestuhlung erneuert.<br />
Im Rahmen der Baumaßnahmen wurden<br />
Fassaden <strong>und</strong> Bauzier gere<strong>in</strong>igt <strong>und</strong> denkmalgerecht<br />
<strong>in</strong>stand gesetzt. Die Kupferdeckungen<br />
auf der Kuppel, den Kranzgesimsen,<br />
Balustraden <strong>und</strong> im Glockenraum<br />
wurden erneuert. Frisch vergoldet erstrahlt<br />
die Kupferverkleidung des Kuppelkreuzes<br />
aus der Bauzeit <strong>in</strong> neuem Glanz.<br />
Bauherr: <strong>Evangelische</strong><br />
Christuskirchengeme<strong>in</strong>de Ma<strong>in</strong>z<br />
Bauberatung: Alfred Holetzke<br />
Architekt: B<strong>in</strong>genheimer, Hädler,<br />
Schmil<strong>in</strong>sky, BHS, Darmstadt<br />
Baureferat EKHN: Dieter Blechschmidt,<br />
Hans Mittmann<br />
Georg Weber,<br />
Wolfgang Feilberg<br />
Fotos, <strong>in</strong>nen: Ralf Heidenreich, Offenbach<br />
Bauzeit: 1998 –2003 (Außensanierung)<br />
Bauzeit: 2002 –2004 (Innensanierung)
Das im16. Jh. entstandene Bauwerk gilt als<br />
die letzte mittelalterliche Hallenkirche <strong>Hessen</strong>s.<br />
Zwei schmale Seitenschiffe bilden e<strong>in</strong>en<br />
Umgang um den Chorraum, e<strong>in</strong>e überputzte<br />
Holztonne deckt das Mittelschiff. Die<br />
letzte Renovierung erfolgte <strong>in</strong> den 1950er<br />
Jahren, daher war es nicht verw<strong>und</strong>erlich,<br />
dass sich die Farbgebung <strong>in</strong>zwischen als<br />
grau <strong>in</strong> grau darstellte <strong>und</strong> z.B. die Renaissance-Rollwerkmalereien<br />
kaum noch erkennbar<br />
waren. Untersuchungen an den<br />
signifikanten Stellen des Baukörpers führten<br />
immer wieder auf die Spur der ältesten,<br />
aus der Erbauungszeit um 1500 stammenden<br />
Farbfassung. Deren Farbkonzeption beruht<br />
ausschließlich auf der Unterstreichung<br />
der architektonischen Gliederung mittels e<strong>in</strong>er<br />
Graufassung auf allen Werkste<strong>in</strong>en, Arkadbögen,<br />
Scheidebögen, Pfeilern, Rippen,<br />
Maßwerken <strong>und</strong> Fensterlaibungen. Die systematische,<br />
Werkste<strong>in</strong> unterstützende, helle<br />
Fugenmalerei verb<strong>in</strong>det Farbfassung <strong>und</strong><br />
Architektur. Umdie Raumwirkung der gotischen<br />
Hallenkirche zu betonen, entfernte<br />
man die Banke<strong>in</strong>bauten <strong>in</strong> den Seitenschiffen,<br />
nivellierte den Fußboden <strong>und</strong> stellte<br />
weitestgehend die ursprüngliche Farbfassung<br />
wieder her, wobei die Rollmalereien<br />
lediglich e<strong>in</strong>er gründlichen Re<strong>in</strong>igung bedurften.<br />
Bauherr: <strong>Evangelische</strong><br />
Marienstiftsgeme<strong>in</strong>de, Lich<br />
Architekt: Architekt-In-Duo,<br />
Marion Krimmel +<br />
Katja Hartmann, Ober-Mörlen<br />
Restaurator: Karl-Bernd Beierle<strong>in</strong>, Marburg<br />
Baureferat EKHN: Hans-Georg Lange, Heike L<strong>in</strong>ke<br />
Bauzeit: 2002<br />
Lich –<br />
Innenrestaurierung der Marienstiftskirche<br />
15
Ortenberg –Gesamtsanierung der Marienkirche<br />
16<br />
Der ursprünglich romanische <strong>Kirche</strong>nbau<br />
wurde <strong>in</strong> der seltenen Form e<strong>in</strong>er e<strong>in</strong>schiffigen<br />
Anlage mit Querhaus errichtet. Im 14.<br />
Jh. entstand der Chor <strong>und</strong> im 15. Jh. erfolgte<br />
e<strong>in</strong>e Erweiterung um die beiden Seitenschiffe.<br />
Der Innenraum ist <strong>in</strong> mehreren späteren<br />
Umbauphasen gestaltet worden <strong>und</strong><br />
vermittelt den typisch gotischen Raume<strong>in</strong>druck<br />
e<strong>in</strong>es Licht durchfluteten, <strong>in</strong> die Höhe<br />
strebenden Raumes.<br />
Nach Abschluss der erforderlichen Sanierungsmaßnahmen<br />
an der Baukonstruktion<br />
war für die Neugestaltung des Innenraumes<br />
die Wiederherstellung der Farbfassungen<br />
beispielsweise der Gewölbemalereien <strong>und</strong><br />
die Gestaltung der Ausstattungselemente<br />
von besonderer Bedeutung. Im Zuge e<strong>in</strong>er<br />
neuen Nutzungskonzeption des gesamten<br />
<strong>Kirche</strong>nraumes auch für profane kulturelle<br />
Veranstaltungen, konnte das Turmuntergeschoss<br />
nutzbar gemacht werden. Vor diesem<br />
H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong> erfuhr die gesamte Haustechnik,<br />
besonders die Lichtgestaltung, e<strong>in</strong>e<br />
zeitgemäße Erneuerung. Die Neugestaltung<br />
der Außenanlagen macht die <strong>Kirche</strong> im<br />
Stadtraum wieder erlebbar.<br />
Bauherr: Ev. <strong>Kirche</strong>ngeme<strong>in</strong>de Ortenberg<br />
Architekt: Claus Giel, Dieburg<br />
Restaurator: Michael Hangleiter, Otzberg<br />
Statik: Marks +Zimmermann, Siegen<br />
Baureferat EKHN: Hans-Georg Lange, Joachim Sykalla<br />
Bauzeit: 2003 -2007<br />
Kronberg –Dach- <strong>und</strong> Dachkonstruktionssanierung der Johanneskirche<br />
Bauherr: <strong>Evangelische</strong> <strong>Kirche</strong>ngeme<strong>in</strong>de<br />
St. Johann, Kronberg<br />
Architekt: Architekturbüro He<strong>in</strong>rich, Dornburg<br />
Statik: Hans Benn<strong>in</strong>ghoven, Frankfurt<br />
Baureferat der EKHN: Georg Weber, Barbara Schmid<br />
Bauzeit: 2003<br />
Langjähriger Wassere<strong>in</strong>trag durch die<br />
schadhafte Schiefere<strong>in</strong>deckung hatte den<br />
aus Nadelholz gefertigten gotischen<br />
Dachstuhl stark geschädigt. Bei der erforderlichen<br />
Sanierung war besonders auf den<br />
Schutz der reichen Bemalung aus dem 17<br />
Jh. auf der raumseitigen Brettverschalung<br />
e<strong>in</strong>er Holztonnen-Decke über dem <strong>Kirche</strong>nschiff<br />
zuachten. Nach Abbruch der Dache<strong>in</strong>deckung<br />
dichteten die Zimmerleute das<br />
Dach am Ende e<strong>in</strong>es jeden Arbeitstages mit<br />
Folie wieder sicher ab. Zur Sanierung wurden<br />
alle geschädigten Hölzer durch neue<br />
Bauteile <strong>in</strong> gleicher Form <strong>und</strong> gleichem<br />
Querschnitt ersetzt. Zug umZug erfolgte die<br />
Ertüchtigung der Knotenpunkte der Konstruktionshölzer.<br />
Nach der statischen Sicherung<br />
erfolgte die E<strong>in</strong>deckung der Dachflächen<br />
mit Deutschem Schiefer <strong>in</strong> Altdeutscher<br />
Deckung.
Die evangelische Stadtkirche Schotten<br />
(ehemalige Wallfahrtskirche Unserer Lieben<br />
Frau) wurde <strong>in</strong> den Jahren 1966/67 (<strong>in</strong>nen)<br />
<strong>und</strong> 1970-1978 (außen) umfassend saniert.<br />
Im Zusammenhang mit diesen Maßnahmen<br />
erfolgten verschiedene E<strong>in</strong>griffe <strong>in</strong> die<br />
Dachkonstruktionen über <strong>Kirche</strong>nschiff <strong>und</strong><br />
Chor.<br />
Durch die vielfältigen Verschneidungen der<br />
Dachgeometrie des Rhombendaches kam<br />
es <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung mit se<strong>in</strong>erzeit nicht fachgerecht<br />
ausgeführten Reparaturmaßnahmen<br />
an der Dachkonstruktion fortwährend<br />
zum Wassere<strong>in</strong>tritt <strong>in</strong>folge von Undichtigkeiten,<br />
<strong>in</strong>sbesondere an den Kehlen <strong>und</strong><br />
Dachverschneidungen. Dieser Wassere<strong>in</strong>tritt<br />
führte im Laufe der letzten Jahrzehnte zu<br />
umfassenden Schädigungen der Tragglieder<br />
des Dachstuhls sowie angrenzender Bereiche<br />
der Mauerwerkskonstruktion <strong>und</strong> der<br />
Gewölbe.<br />
Die dadurch auftretenden Schäden wurden<br />
<strong>in</strong> der Vergangenheit häufig durch lokale<br />
Reparatur- <strong>und</strong> Flickmaßnahmen behoben,<br />
ohne die Schadensursachen zu beseitigen.<br />
Es zeigten sich neben den Schädigungen<br />
des Holzwerkes der Dachkonstruktion <strong>in</strong>sbesondere<br />
flächiger mikrobiologischer Befall<br />
der Gewölbekonstruktion sowie der<br />
Raumschale.<br />
Da die gravierendsten Schäden im Bereich<br />
des Dachstuhles über dem <strong>Kirche</strong>nschiff zu<br />
f<strong>in</strong>den <strong>und</strong> sämtliche Kehlbereiche <strong>in</strong> diesem<br />
Bereich konstruktiv mangelhaft ausgeführt<br />
waren, wurde das Dachtragwerk <strong>in</strong>e<strong>in</strong>em<br />
ersten Bauabschnitt erneuert.<br />
In e<strong>in</strong>em zweiten Bauabschnitt wurden die<br />
Dachtragwerke des westlichen Walmdaches<br />
<strong>und</strong> über dem Chor <strong>in</strong> situ zimmermannsmäßig<br />
<strong>in</strong>stand gesetzt. Die Türme im Südwesten<br />
<strong>und</strong> Norden wurden ebenfalls konstruktiv<br />
überarbeitet.<br />
Alle Dachflächen wurden neu verschiefert,<br />
die Dachentwässerung <strong>in</strong> Kupfer erneuert.<br />
Schotten –Sanierung des Dachtragwerks der Stadtkirche<br />
Bauherr: <strong>Evangelische</strong> <strong>Kirche</strong>ngeme<strong>in</strong>de Schotten<br />
Architekt: Sichau &Walter, Fulda<br />
Statik: VHT, Ulrich Grimm<strong>in</strong>ger, Darmstadt<br />
Baureferat der EKHN: Hans-Georg Lange,<br />
Joachim Sykala<br />
Bauzeit: 2003 –2004<br />
17
Fraurombach –Sanierung <strong>Kirche</strong>nschiff <strong>und</strong> Chordach der <strong>Kirche</strong><br />
Bauherr: <strong>Evangelische</strong> <strong>Kirche</strong>ngeme<strong>in</strong>de<br />
Fraurombach<br />
Architekt: Sichau <strong>und</strong> Walter, Fulda<br />
Statik: VHT, Ulrich Grimm<strong>in</strong>ger, Darmstadt<br />
Baureferat der EKHN: Hans-Georg Lange, Heike L<strong>in</strong>ke<br />
Bauzeit: 2000 –2002<br />
Nieder-Seemen – Gesamtsanierung der <strong>Kirche</strong><br />
18<br />
Die ehemalige Wallfahrtskirche Liebfrauen mit<br />
schlichtem romanischen Schiff stammt <strong>in</strong> ihren<br />
Ursprüngen aus dem 12. Jh. Später erhielt sie<br />
zur Unterbr<strong>in</strong>gung von Pilgern e<strong>in</strong> aufgesetztes<br />
Fachwerkobergeschoss sowie e<strong>in</strong>en Anbau für<br />
die Sakristei. An der gesamten Primärkonstruktion<br />
des Dachstuhles aus dem 16. Jh. zeigten<br />
sich gravierende Schäden. Zur Instandsetzung<br />
wurde das geschädigte Holztragwerk gemäß<br />
dem orig<strong>in</strong>alen Vorbild weitgehend konstruktiv<br />
repariert. Die Zimmerarbeiten wurden <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung<br />
mit konservatorischen Maßnahmen<br />
am Mauerwerk ausgeführt. Der geschlossene,<br />
überkommene Gesamtzustand der Orig<strong>in</strong>alkonstruktion<br />
des Dachtragwerks sowie die romanischen<br />
<strong>und</strong> gotischen Putz- <strong>und</strong> Fugmörtel der<br />
Chorscheidewand des <strong>Kirche</strong>nschiffs s<strong>in</strong>d von<br />
besonderer Qualität. Hier erfolgten konservatorische<br />
Sicherungsmaßnahmen. Die Mauerkronen<br />
konnten durch Verfüll-, Ergänzungs-, Vernadelungs-<br />
<strong>und</strong> Mauerarbeiten konstruktiv <strong>in</strong>stand<br />
gesetzt werden. Die Raumschale des<br />
Chores wurde durch Sicherungsmaßnahmen<br />
geschützt. Nach Abschluss der Arbeiten am<br />
Dachstuhl erfolgte die Wiedere<strong>in</strong>deckung des<br />
Daches, wobei Fehlstellen ausgebessert, Dachentwässerung<br />
<strong>und</strong> Blitzschutz neu verlegt wurden.<br />
Die neue Elektrotechnik mit Beleuchtung<br />
konnte im Dachraum <strong>in</strong>stalliert werden.<br />
Die evangelische <strong>Kirche</strong> <strong>in</strong> Nieder-Seemen<br />
ist e<strong>in</strong> spätgotischer Saalbau mit rechteckigem,<br />
leicht im W<strong>in</strong>kel versetzten Chor. <strong>Kirche</strong>nraum<br />
<strong>und</strong> Chor haben als oberen Abschluss<br />
e<strong>in</strong>e durchgehende Holzbalkendecke.<br />
In der Mitte des steilen Satteldaches<br />
erhebt sich der Turm <strong>in</strong> Form e<strong>in</strong>es Dachreiters<br />
mit barocker Turmhaube. Der Standort<br />
des Bauwerkes an hochwassergefährdeter<br />
Stelle <strong>in</strong> unmittelbarer Nähe des Seemenbaches<br />
führte über die Jahrh<strong>und</strong>erte immer<br />
wieder zu Schäden <strong>und</strong> Schädl<strong>in</strong>gsbefall auf<br />
Gr<strong>und</strong> anhaltender Durchfeuchtung. Neuerlich<br />
zu sanieren waren daher die Deckenkonstruktion,<br />
die Dachkonstruktion, das<br />
Mauerwerk, Außen- <strong>und</strong> Innenputz, die F<strong>und</strong>amente<br />
<strong>und</strong> Außenanlagen sowie die Heizung.<br />
Bauherr: <strong>Evangelische</strong> <strong>Kirche</strong>ngeme<strong>in</strong>de<br />
Nieder-Seemen<br />
Architekt: Re<strong>in</strong>hold Melzer, Büd<strong>in</strong>gen<br />
Restaurator: Stefan Klöckner, Gelnhausen<br />
Baureferat EKHN: Hans-Georg Lange, Joachim Sykala<br />
Bauzeit: 2003
Ihre heutige Form erhielt die Stadtkirche im<br />
15. Jh., erfuhr jedoch mehrfach gr<strong>und</strong>legende<br />
Umgestaltungen, besonders im Inneren.<br />
Dies führte zu der letztlich so unbefriedigenden<br />
Raumwirkung, die es bei der letzten<br />
auch statisch <strong>und</strong> raumklimatisch erforderlichen<br />
Maßnahme zu sanieren galt.<br />
Das Innenniveau im Langhaus wurde auf<br />
den Stand von 1475 abgesenkt, verb<strong>und</strong>en<br />
mit der Tieferlegung des angrenzenden<br />
Straßenniveaus <strong>und</strong> des Marktplatzes. Der<br />
Glockenstuhl im Turm wurde um e<strong>in</strong>e Ebene<br />
tiefer gelegt. Damit war die denkmalgerechte<br />
Sanierung des Turmdachstuhls möglich.<br />
Parallel dazu erfolgte der Austausch<br />
des alten Zementputzes durch e<strong>in</strong>en offenporigen<br />
Kalkputz. Detailgenau erfolgte die<br />
Sanierung des Dachstuhls über Chor <strong>und</strong><br />
Langhaus. Der barocke Dachreiter über<br />
dem Weste<strong>in</strong>gang erhielt wieder die historisch<br />
überlieferte offene Laterne mit e<strong>in</strong>er<br />
Glocke. Der schiefe Turm konnte <strong>in</strong> situ repariert<br />
<strong>und</strong> stabilisiert werden. Im Inneren<br />
wurde e<strong>in</strong> neuer Bodenaufbau mit Sandste<strong>in</strong>plattenbelag<br />
hergestellt. Die farbliche<br />
Neufassung des Innenraumes erfolgte nach<br />
historischen Bef<strong>und</strong>en.<br />
Bauherr: <strong>Evangelische</strong> <strong>Kirche</strong>ngeme<strong>in</strong>de<br />
Babenhausen<br />
Architekt: Claus Giel, Dieburg<br />
Statik: Marks +Zimmermann, Siegen<br />
Restaurator: Michael Hangleiter, Otzberg<br />
Baureferat der EKHN: Georg Weber, Angela Gotthardt<br />
Bauzeit: 2001 -2006<br />
Babenhausen –Sanierung der Stadtkirche<br />
19
Oppenheim –<br />
Gesamtsanierung der St. Kathar<strong>in</strong>en-<strong>Kirche</strong><br />
20<br />
Bauherr: <strong>Evangelische</strong> <strong>Kirche</strong>ngeme<strong>in</strong>de<br />
St. Kathar<strong>in</strong>en, Oppenheim<br />
Architekt: He<strong>in</strong>rich Jost, Lambrecht<br />
Statik: Dr.-Ing. O. Schwab u.<br />
Dipl.-Ing. Lemke, Köln<br />
Restaurator: Vitus Wurmdobler, Erbes-Büdesheim<br />
Landschaftsarchitekt<strong>in</strong>: Stella Junker-Mielke, Worms<br />
Baureferat der EKHN: Dieter Blechschmidt,<br />
Hans Mittmann, Georg Weber,<br />
Wolfgang Feilberg<br />
Bauzeit: 1996 -2006<br />
Die im13. bis 15. Jh. erbaute <strong>Kirche</strong> St. Kathar<strong>in</strong>en<br />
fand <strong>in</strong> der jüngeren Vergangenheit<br />
Aufnahme <strong>in</strong> verschiedene nationale <strong>und</strong> <strong>in</strong>ternationale<br />
Baudenkmal-Forschungs- <strong>und</strong><br />
Förderprogramme, die kont<strong>in</strong>uierliche qualitätvolle<br />
Sanierungsarbeiten unterstützen.<br />
Besonders die Restaurierung der mittelalterlichen<br />
Farbverglasungen der Fenster<br />
konnte dabei auf f<strong>und</strong>ierte Forschungsergebnisse<br />
aufbauen.<br />
Die Neudeckung <strong>und</strong> Sanierung der Dächer,<br />
zusammen mit der Herstellung e<strong>in</strong>er funktionsfähigen<br />
Wasserableitung zum Schutz<br />
des Bauwerks <strong>und</strong> se<strong>in</strong>er Bauzier waren<br />
schon von jeher e<strong>in</strong>e vordr<strong>in</strong>gliche <strong>und</strong><br />
auch kostspielige Aufgabe aller Erhaltungsmaßnahmen.<br />
Die <strong>in</strong>den 1930er Jahren zuletzt<br />
durchgeführte Komplettsanierung aller<br />
Dachflächen war unter heutigen Gesichtspunkten<br />
nicht fachgerecht durchgeführt<br />
worden <strong>und</strong> daher bereits wieder desolat,<br />
so dass die gesamte Dachfläche mit Altlayer<br />
Schiefer <strong>in</strong> altdeutscher Deckung erneuert<br />
werden musste.<br />
Es s<strong>in</strong>d nicht nur die noch teilweise gut erhaltenen<br />
bauzeitlichen Maßwerkteile aus<br />
dem 14. Jh., sondern auch die bei den<br />
großen Restaurierungen des 19. Jh. <strong>und</strong> zwischen<br />
1934-37 e<strong>in</strong>gebrachten Architekturteile,<br />
die <strong>in</strong>zwischen mehr oder m<strong>in</strong>der stark<br />
<strong>in</strong> Mitleidenschaft gezogen worden waren.<br />
Das Baumaterial, Buntsandste<strong>in</strong> aus dem<br />
Raum Miltenberg, war aufgr<strong>und</strong> unzureichender<br />
Widerstandsfähigkeit gegen Witterungse<strong>in</strong>flüsse<br />
an vielen Stellen sanierungsbedürftig.<br />
H<strong>in</strong>zu kamen sämtliche Arbeiten<br />
zur Wiederherstellung der verputzten Fassadenflächen.<br />
Zur Wiedergew<strong>in</strong>nung der mittelalterlichen<br />
Raumfassung des Westchores <strong>und</strong> e<strong>in</strong>er Rekonstruktion<br />
des Raume<strong>in</strong>drucks des 19. Jh.<br />
im Langhaus, im Querhaus <strong>und</strong> im Ostchor<br />
kamen auch im Innenraum Ste<strong>in</strong>metze, Maler,<br />
Restauratoren <strong>und</strong> andere Fachleute<br />
zum Zuge. Die Haustechnik wurde komplett<br />
erneuert. Den Abschluss der Maßnahme bildete<br />
der Neubau e<strong>in</strong>es Funktionsgebäudes<br />
sowie die Wiederherstellung der Außenanlagen<br />
nach Vorlagen des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts.
Die aus dem 15. Jh. stammende Marienkirche<br />
wurde außen <strong>und</strong> <strong>in</strong>nen umfassend saniert.<br />
Der historische Dachstuhl wurde zimmermannsmäßig<br />
ausgebessert <strong>und</strong> Fehlstellen<br />
erneuert. Wo erforderlich, erfolgte<br />
die Schiefer-Neue<strong>in</strong>deckung des Daches.<br />
Gr<strong>und</strong>legend restauriert wurde die <strong>in</strong>nere<br />
Raumschale des Bauwerks. Besondere Aufmerksamkeit<br />
schenkte man den historischen<br />
Wandmalereien über dem Chorbogen<br />
<strong>und</strong> den aus Werkste<strong>in</strong> gefertigten Architektur-<br />
<strong>und</strong> Bauzierelementen. Zudem<br />
mussten statische Sicherungsarbeiten an<br />
den Gewölberippen durchgeführt werden.<br />
Die künstlerische Ausgestaltung der Annenkapelle<br />
erfolgte nach e<strong>in</strong>em Entwurf von<br />
Madele<strong>in</strong>e Dietz. Abger<strong>und</strong>et wurden die<br />
Maßnahmen durch e<strong>in</strong>e zeitgemäße Überarbeitung<br />
<strong>und</strong> Ergänzung der Fußböden sowie<br />
der haustechnischen Anlagen.<br />
Bauherr: <strong>Evangelische</strong> <strong>Kirche</strong>ngeme<strong>in</strong>de Büd<strong>in</strong>gen<br />
Architekt: Schulteß Planungsgesellschaft mbH, Friedberg<br />
Statik: VHT, Ulrich Grimm<strong>in</strong>ger, Darmstadt<br />
Restaurator: Gerd Belk, Schlitz<br />
Baureferat der EKHN: Hans-Georg Lange, Stefanie Ebenritter<br />
Bauzeit: 2001 –2003<br />
Im Jahr 1260 wurde mit dem Bau der Stadtkirche<br />
als dreischiffige Hallenkirche "Unserer<br />
Lieben Frau" begonnen. Sie gehört aufgr<strong>und</strong><br />
ihrer architektonischen Qualität <strong>und</strong><br />
ihrer Größe zu den wichtigsten <strong>Kirche</strong>nbauten<br />
<strong>in</strong> <strong>Hessen</strong>. Hochwertige Ausstattungsstücke<br />
der mittelalterlichen Ste<strong>in</strong>metz- <strong>und</strong><br />
Holzbildhauerkunst sowie die qualitätvollen<br />
Glasmalereien vom 14.Jh. bis zur heutigen<br />
Zeit tragen ihren Teil dazu bei.<br />
Die Außensanierung der Stadtkirche umfasste<br />
neben der Überarbeitung <strong>und</strong> Ausbesserung<br />
der Sandste<strong>in</strong>- <strong>und</strong> Putzflächen an<br />
der Fassade die Reparatur des Dachstuhls<br />
<strong>und</strong> der Schieferdeckung. Instand gesetzt<br />
wurden auch die Kehlen zwischen den<br />
Zwerchhäusern. Neu angebrachte Schutzverglasungen<br />
bewahren die mittelalterlichen<br />
Fenster. Die übrigen Fenster wurden<br />
durch Edelstahlnetze gesichert.<br />
Büd<strong>in</strong>gen –<br />
Gesamtsanierung der Marienkirche<br />
Friedberg –<br />
Aussensanierung der Stadtkirche<br />
Bauherr: <strong>Evangelische</strong> <strong>Kirche</strong>ngeme<strong>in</strong>de Friedberg<br />
Architekt: Schulteß Planungsgesellschaft mbH, Friedberg<br />
Statik: Dr.-Ing. Ra<strong>in</strong>er Gräfe, Dreieich<br />
Restaurator: Gerd Belk, Schlitz<br />
Baureferat der EKHN: Hans-Georg Lange, Stefanie Ebenritter<br />
Bauzeit: 1996 -2002<br />
21
Bad-Ems –<br />
Aussenrenovierung der Mart<strong>in</strong>skirche<br />
Büttelborn –<br />
Innenrenovierung der <strong>Kirche</strong><br />
22<br />
Die im12. Jh. im Stil e<strong>in</strong>er flach gedeckten<br />
romanischen Emporenbasilika erbaute Mart<strong>in</strong>skirche<br />
hat im Laufe der Jahrh<strong>und</strong>erte<br />
verschiedenste Umbauten <strong>und</strong> stilistische<br />
Wandlungen erfahren, bis sie <strong>in</strong> den 1950er<br />
Jahren wieder ihren romanischen Charakter<br />
erhielt. Voruntersuchungen zur anstehenden<br />
Außenrenovierung hatten den teilweise<br />
desolaten Zustand des Putzes durch Witterungse<strong>in</strong>flüsse<br />
aber auch unsachgemäße<br />
vorangegangene Ausbesserungsarbeiten ergeben.<br />
Nach Abschluss der qualitätvollen<br />
Außensanierung erhielten die Außenwandflächen<br />
<strong>und</strong> Architekturgliederungen e<strong>in</strong>e<br />
Neufassung mit M<strong>in</strong>eralfarbe entsprechend<br />
dem letzten Ersche<strong>in</strong>ungsbild.<br />
E<strong>in</strong>e Herausforderung war die Restaurierung<br />
des Südportals, da es ke<strong>in</strong>e H<strong>in</strong>weise auf<br />
die ursprünglich filigrane Ausarbeitung der<br />
Pilasterbasen gab. Auf Empfehlung der Restaurator<strong>in</strong><br />
erfolgte die Neufassung schließlich<br />
<strong>in</strong> schmucklosen Grautönen, die sich im<br />
Gesamtbild harmonisch e<strong>in</strong>fügen.<br />
Bauherr: <strong>Evangelische</strong><br />
Mart<strong>in</strong>skirchengeme<strong>in</strong>de Bad Ems<br />
Architekt: Hans-Joachim Becker, Koblenz<br />
Baureferat EKHN: Georg Weber, Angela Gotthardt<br />
Bauzeit: 1997 -2000<br />
Die aus dem 18. Jh. stammende <strong>Kirche</strong> <strong>in</strong><br />
Büttelborn bedurfte e<strong>in</strong>er umfassenden Renovierung.<br />
In Zuge der Arbeiten traten Emporenmalereien<br />
aus der Bauzeit zu Tage,<br />
die bislang unter verschiedensten Farbschichten<br />
verborgen gelegen hatten. Nach<br />
ihrer Restaurierung zeigen sich auf 15 Tafeln<br />
die zwölf Apostel sowie Jesus Christus, Luther<br />
<strong>und</strong> der Kalvarienberg. In Anlehnung<br />
an ihre ursprüngliche Farbfassung erhielt<br />
auch die Barockorgel e<strong>in</strong>en Spezial-Anstrich,<br />
der nicht neu <strong>und</strong> perfekt wirkt, sondern<br />
mit dem Gesamtraumkonzept harmoniert.<br />
Bauherr: <strong>Evangelische</strong> <strong>Kirche</strong>ngeme<strong>in</strong>de<br />
Büttelborn<br />
Architekt: Schmitt <strong>und</strong> Partner,<br />
Büttelborn<br />
Restaurator: Matthias Steyer, Eppste<strong>in</strong><br />
Baureferat der EKHN: Hans-Georg Lange,<br />
Stefanie Ebenritter<br />
Bauzeit: 2003
Zum 100-jährigen Jubiläum wurde die <strong>Kirche</strong><br />
wieder <strong>in</strong> ihrer ursprünglichen farblichen<br />
Raumfassung gestaltet. Um mehr<br />
Platz für e<strong>in</strong>e flexible Nutzung zu schaffen,<br />
entfernte man Taufbecken, Kanzel <strong>und</strong> die<br />
erste Bankreihe im Chor. Der im Zuge e<strong>in</strong>er<br />
früheren Umgestaltung e<strong>in</strong>gebaute ste<strong>in</strong>erne<br />
Altar konnte durch e<strong>in</strong>en vorhandenen<br />
Holzaltar ersetzt werden. Böden <strong>und</strong> Sitzbänke<br />
wurden aufgearbeitet, e<strong>in</strong> neues Beleuchtungskonzept<br />
setzt den restaurierten<br />
<strong>Kirche</strong>nraum stilvoll <strong>in</strong> Szene.<br />
Bauherr: <strong>Evangelische</strong> <strong>Kirche</strong>ngeme<strong>in</strong>de<br />
Ste<strong>in</strong>heim<br />
Architekt: architektengruppe s+e+s,<br />
Mühlheim am Ma<strong>in</strong><br />
Restaurator: Michael Hangleiter, Otzberg<br />
Baureferat der EKHN: Hans-Georg Lange,<br />
Stefanie Ebenritter<br />
Bauzeit: 2002<br />
Die Innenrenovierung der Anfang des 20.<br />
Jh. erbauten Gedächtniskirche schloss auch<br />
die Taufkapelle <strong>und</strong> die Vorhalle e<strong>in</strong>. Dabei<br />
konnten Wände, Deckenbemalung <strong>und</strong><br />
Holzwerk nach bauzeitlichen Bef<strong>und</strong>en ausgestaltet<br />
werden. Der Altarraum erfuhr e<strong>in</strong>e<br />
zeitgemäße Umstrukturierung. Um e<strong>in</strong>e<br />
größere Flexibilität <strong>in</strong> der Nutzbarkeit zu erreichen,<br />
baute man die starren <strong>Kirche</strong>nbänke<br />
zu beweglichen Elementen um. E<strong>in</strong> neues<br />
Beleuchtungskonzept unterstreicht die<br />
Wirkung der wiederhergestellten Räume.<br />
Bauherr: <strong>Evangelische</strong><br />
Gedächtniskirchengeme<strong>in</strong>de<br />
Bad Homburg<br />
Architekt: architektengruppe s+e+s,<br />
Mühlheim am Ma<strong>in</strong><br />
Restaurator: Matthias Steyer, Eppste<strong>in</strong><br />
Baureferat der EKHN: Hans-Georg Lange,<br />
Dorothee Re<strong>in</strong>iger-Po<strong>in</strong>ter<br />
Bauzeit: 2002<br />
Ste<strong>in</strong>heim –<br />
Renovierung des <strong>Kirche</strong>n<strong>in</strong>nenraumes<br />
Bad Homburg –Innenrenovierung der Gedächtniskirche<br />
23
Maxsa<strong>in</strong> –Aussensanierung des Pfarrhauses<br />
Maxsa<strong>in</strong> –Aussensanierung der <strong>Kirche</strong><br />
24<br />
Die Planung für das ortsbildprägende <strong>und</strong><br />
denkmalpflegerisch höchst <strong>in</strong>teressante Anwesen<br />
wurde 1902 von dem Düsseldorfer<br />
Architekt Ernst Roet<strong>in</strong>g durchgeführt, dessen<br />
orig<strong>in</strong>ale Entwurfszeichnungen mit Genehmigungsvermerken<br />
<strong>und</strong> verschiedenen<br />
Detailzeichnungen noch vorliegen. Entsprechend<br />
konnten die Außenfassade <strong>und</strong><br />
Dache<strong>in</strong>deckung von Haupt- <strong>und</strong> Nebengebäude<br />
saniert werden. Orig<strong>in</strong>algetreu wiederhergestellt<br />
werden konnten die Überdachung<br />
des E<strong>in</strong>gangs sowie die Gr<strong>und</strong>stückse<strong>in</strong>friedung.<br />
Bauherr: <strong>Evangelische</strong> <strong>Kirche</strong>ngeme<strong>in</strong>de<br />
Maxsa<strong>in</strong><br />
Architekt: Walter Herz, Selters;<br />
Mitarbeit: Herkenroth +Schwickert,<br />
Wirges<br />
Baureferat EKHN: Georg Weber, Thomas Lang,<br />
Joachim Bay<br />
Bauzeit: 2002 -2004<br />
In se<strong>in</strong>er jetzigen Form entstand das <strong>Kirche</strong>nschiff<br />
im Barockstil des ausgehenden<br />
18. Jh. Der historische Kirchturm stammt<br />
aus dem 14. Jh. <strong>und</strong> erhielt im Verlauf der<br />
jetzigen Sanierung neue Dachbalken, e<strong>in</strong>e<br />
neue Schalung <strong>und</strong> e<strong>in</strong>e neue E<strong>in</strong>deckung.<br />
Die neu verputzte Außenfassade der <strong>Kirche</strong><br />
wurde nach bauzeitlichen Bef<strong>und</strong>en farbig<br />
gefasst. Auf dem Turmdach verleiht der<br />
frisch vergoldete Wetterhahn der <strong>Kirche</strong><br />
wieder strahlenden Glanz.<br />
Bauherr: <strong>Evangelische</strong> <strong>Kirche</strong>ngeme<strong>in</strong>de<br />
Maxsa<strong>in</strong><br />
Architekt: Herkenroth +Schwickert, Wirges<br />
Baureferat EKHN: Georg Weber, Thomas Lang<br />
Bauzeit: 2001
Die ehemalige Hof- <strong>und</strong> Schlosskirche<br />
stammt <strong>in</strong> ihrer jetzigen Präsentation aus<br />
dem 18. Jh. Sie ist reich geschmückt mit<br />
farbkräftigen Decken- <strong>und</strong> Brüstungsmalereien<br />
sowie prächtigen Schnitzereien an der<br />
vor der Chorempore situierten Kanzel. Die<br />
Restaurierung des Innenraumes gliederte<br />
sich <strong>in</strong> die Gewerke der Baudenkmalpflege<br />
sowie der Gemälde- <strong>und</strong> Skulpturenrestaurierung.<br />
Dazu zählten allgeme<strong>in</strong>e Renovierungs-<br />
<strong>und</strong> Anstricharbeiten an den Wänden,<br />
die Überarbeitung der Chordecke, die<br />
Konservierung der Bretterdecke im <strong>Kirche</strong>nschiff,<br />
der Emporenbrüstungen, der Gestühle<br />
<strong>und</strong> der Kanzel. Innenraum <strong>und</strong> Ausstattung<br />
wurden <strong>in</strong> der ursprünglichen Farbigkeit<br />
rekonstruiert.<br />
Bauherr: <strong>Evangelische</strong> <strong>Kirche</strong>ngeme<strong>in</strong>de<br />
Löhnberg<br />
Architekt: Dieter Herget,<br />
Löhnberg-Niedershausen<br />
Restaurator: Ochsenfarth Restaurierungen,<br />
Paderborn<br />
Baureferat der EKHN: Georg Weber, Angela Gotthardt<br />
Bauzeit: 1998<br />
Als e<strong>in</strong> vorzüglich erhaltenes Beispiel e<strong>in</strong>er<br />
ländlichen Barockkirche, die vor allem<br />
durch ihre Ausstattung bee<strong>in</strong>druckt, gilt die<br />
kle<strong>in</strong>e Landkirche <strong>in</strong> Leusel. Besonders die<br />
<strong>Kirche</strong>ndecke <strong>und</strong> das Dach waren erheblich<br />
restaurierungsbedürftig. Die Verb<strong>in</strong>dung<br />
zwischen Dachsparren <strong>und</strong> Mauerlatten<br />
auf der zweischaligen Außenmauer war<br />
durchgängig schadhaft. Die reich bemalte<br />
Holztonnendecke wies erhebliche, zum Teil<br />
durch Wasser verursachte Schäden auf <strong>und</strong><br />
wurde sorgfältig gere<strong>in</strong>igt, restauriert <strong>und</strong><br />
konserviert. Die Außenschale der <strong>Kirche</strong><br />
wurde mit Kalkputz erneuert, <strong>in</strong>nen erfolgte<br />
e<strong>in</strong> neuer Anstrich.<br />
Bauherr: <strong>Evangelische</strong> <strong>Kirche</strong>ngeme<strong>in</strong>de<br />
Leusel<br />
Architekt: Karlhe<strong>in</strong>z Geißler, Alsfeld<br />
Statik: VHT, Ulrich Grimm<strong>in</strong>ger,<br />
Darmstadt<br />
Restaurator: Manfred Lausmann,<br />
Schwalmstadt<br />
Baureferat der EKHN: Hans-Georg Lange, Heike L<strong>in</strong>ke<br />
Bauzeit: 2003-2004<br />
Löhnberg –Innenrenovierung der <strong>Kirche</strong><br />
Leusel –Innen- <strong>und</strong> Aussensanierung der <strong>Kirche</strong><br />
25
Hachenburg –Aussensanierung der Schlosskirche<br />
Giessen –<br />
Sanierung <strong>und</strong> Erweiterung des Geme<strong>in</strong>dezentrums der Pankratiusgeme<strong>in</strong>de<br />
26<br />
Die Schlosskirche aus dem 18. Jh. mit spätgotischem<br />
Chor wies erhebliche Schäden im<br />
Bereich des Dachgesimses <strong>und</strong> der Außenhaut<br />
auf. Nach entsprechenden Voruntersuchungen<br />
wurden die schadhaften Holzgesimse<br />
<strong>in</strong> Eichenholz ergänzt <strong>und</strong> farblich angelegt.<br />
Nach Abschluss der Überarbeitung<br />
sämtlicher Dachflächen wurden die Anschlüsse<br />
weitgehend erneuert. In Abstimmung<br />
mit dem Landesamt für Denkmalpflege<br />
erfolgte die Farbgestaltung der Außenflächen<br />
nach bauzeitlichen Bef<strong>und</strong>en. Der<br />
talseitige Sockelbereich erhielt e<strong>in</strong>en Sanierputz.<br />
Bauherr: <strong>Evangelische</strong> <strong>Kirche</strong>ngeme<strong>in</strong>de<br />
Hachenburg<br />
Architekt: Dieter Herget,<br />
Löhnberg-Niedershausen<br />
Restaurator<strong>in</strong>: Christiane E. Kunz, Bad Homburg<br />
Baureferat EKHN: Georg Weber, Thomas Lang,<br />
Joachim Bay<br />
Bauzeit: 2002<br />
Das Gründerzeitgebäude <strong>in</strong> zentraler <strong>in</strong>nerstädtischer<br />
Lage, seit Jahren als kirchliches<br />
Geme<strong>in</strong>dezentrum genutzt, wurde als Ergebnis<br />
e<strong>in</strong>es beschränkten Architektenwettbewerbs<br />
im Inneren umfassend saniert <strong>und</strong><br />
um e<strong>in</strong>en kle<strong>in</strong>en Anbau, der Foyer <strong>und</strong> notwendige<br />
Nebenräume aufnimmt, erweitert.<br />
Wesentlicher Aspekt der Ause<strong>in</strong>andersetzung<br />
mit dem Altbau ist die bescheidene Rücknahme<br />
der Neubaumasse auf e<strong>in</strong>en e<strong>in</strong>fachen<br />
<strong>und</strong> reduzierten e<strong>in</strong>geschossigen Putzbau,<br />
der über e<strong>in</strong>e Glasfuge -das neue Foyer<br />
- formal deutlich vom Altbau getrennt<br />
wird <strong>und</strong> diesen <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er zeitgemäßen Form<br />
belässt.<br />
Die dunklere Farbe des Neubaus verb<strong>in</strong>det<br />
sich mit der Farbe des Altbausockels, <strong>und</strong><br />
der hellereAltbau wird -quasi wie auf e<strong>in</strong>em<br />
Präsentierteller -se<strong>in</strong>er <strong>in</strong>haltlichen Bedeutung<br />
gerecht <strong>in</strong> Szene gesetzt.<br />
Bauherr: <strong>Evangelische</strong>r<br />
<strong>Kirche</strong>ngeme<strong>in</strong>deverband Gießen<br />
Architekten: Rohrbach +Schmees, Gießen<br />
Baureferat der EKHN: Hans-Georg Lange,<br />
Dorothee Re<strong>in</strong>iger-Po<strong>in</strong>tner<br />
Bauzeit: 2004 -2005
Darmstadt –Sanierung des Dienstgebäudes der <strong>Kirche</strong>nverwaltung<br />
Das denkmalgeschützte Gebäude der <strong>Kirche</strong>nverwaltung<br />
der <strong>Evangelische</strong>n <strong>Kirche</strong> <strong>in</strong><br />
<strong>Hessen</strong> <strong>und</strong> <strong>Nassau</strong>, erbaut 1906 –1912 als<br />
hessische Landeshypothekenbank, musste<br />
wegen gravierender technischer <strong>und</strong> funktionaler<br />
Unzulänglichkeiten umfassend saniert<br />
werden. Wesentliche Maßnahmen waren die<br />
Verbesserung des Brandschutzes, z.B. die<br />
Umgestaltung der Treppenhäuser zu Fluchttreppenhäusern<br />
nach heutigen Anforderungen.<br />
Die zum Flur offenen Treppenhäuser<br />
konnten durch den E<strong>in</strong>bau verglaster Brandschutztüren<br />
<strong>in</strong> den Fluren erhalten bleiben.<br />
Verträglich mit der historischen Bausubstanz<br />
wurde die Haustechnik erneuert: die technischen<br />
Trassen verlaufen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er abgehängten<br />
Unterdecke. Von dort aus wird jeweils<br />
die darunter <strong>und</strong> die darüber liegende Etage<br />
versorgt. Zusätzliche Fläche schufen der Ausbau<br />
von Dachbereichen <strong>und</strong> die Unterbauung<br />
e<strong>in</strong>er Terrasse.<br />
Die Farb- <strong>und</strong> Materialwahl für die Innengestaltung<br />
<strong>und</strong> das damit verb<strong>und</strong>ene Beleuchtungskonzept<br />
geben dem historischen<br />
Bestand <strong>und</strong> der künstlerischen Ausstattung<br />
e<strong>in</strong>en angemessenen Rahmen.<br />
Bauherr: <strong>Evangelische</strong> <strong>Kirche</strong> <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong><br />
<strong>und</strong> <strong>Nassau</strong><br />
Architekt: Hoechstetter <strong>und</strong> Partner,<br />
Darmstadt<br />
Baureferat der EKHN: Hans-Otto Dierkes<br />
Bauzeit: 2001-2002<br />
E<strong>in</strong>e wechselvolle Geschichte e<strong>in</strong>schließlich<br />
profaner Nutzung hatte die 1815 als katholische<br />
<strong>Kirche</strong> geweihte Alte <strong>Kirche</strong> im Ortsmittelpunkt<br />
durchlaufen, bis sie 2003 von<br />
der evangelischen Geme<strong>in</strong>de erworben<br />
wurde. Die ehemalige Sakristei nimmt jetzt<br />
Funktionsräume auf, <strong>und</strong> e<strong>in</strong> Mehrzweckraum<br />
für die Geme<strong>in</strong>de konnte durch e<strong>in</strong>e<br />
gläserne Raumtrennung unter der Empore<br />
gewonnen werden. Nach Abschluss der Innensanierung<br />
gaben die wiederhergestellten<br />
Orig<strong>in</strong>alfenster, ergänzt durch neue,<br />
künstlerisch gestaltete Fenster, der <strong>Kirche</strong><br />
wieder ihren würdigen Charakter.<br />
Bauherr: <strong>Evangelische</strong> <strong>Kirche</strong>ngeme<strong>in</strong>de<br />
Hackenheim<br />
Architekt: Ekkehard Enders, Hochheim am Ma<strong>in</strong><br />
Baureferat EKHN: Dieter Blechschmidt, Wolfgang Feilberg<br />
Bauzeit: 2003-2004<br />
Hackenheim –Restaurierung der Alten <strong>Kirche</strong><br />
27
Weilburg –<br />
Sanierung der Schlosskirche<br />
28<br />
Die Schlosskirche <strong>in</strong> Weilburg entstand im<br />
Rahmen der Stadt- <strong>und</strong> Schlosserneuerung<br />
durch Graf Johann Ernst von <strong>Nassau</strong>-Weilburg<br />
(1684 –1719) <strong>und</strong> wurde 1713 fertig<br />
gestellt. Erbaut vom Architekten Julius Ludwig<br />
Rothweil, ist sie der größte <strong>und</strong> bedeutendste<br />
protestantische <strong>Kirche</strong>nbau <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong><br />
<strong>und</strong> wurde zum Vorbild zahlreicher <strong>Kirche</strong>nbauten<br />
entlang der Lahn, im Westerwald,<br />
im Taunus <strong>und</strong> <strong>in</strong> der Pfalz.<br />
Neben dem großartigen Muldengewölbe<br />
s<strong>in</strong>d der prächtige Kanzelaltar von Anton<br />
Ruprecht, die eleganten Stuckaturen von<br />
Andrea Gallas<strong>in</strong>i <strong>und</strong> die Malereien von Georg-Christian<br />
Seekatz d. Ä. als gestalterische<br />
Schwerpunkte hervorzuheben. 1760<br />
erfolgte bereits e<strong>in</strong>e erste Renovierung an<br />
der Gewölbekonstruktion <strong>und</strong> zwischen<br />
1820 <strong>und</strong> 1831 e<strong>in</strong>e zweite. Seit Beg<strong>in</strong>n des<br />
20. Jahrh<strong>und</strong>erts wurden weitere Renovierungsmaßnahmen<br />
ausgeführt. Nachdem die<br />
<strong>Kirche</strong> wegen akuter E<strong>in</strong>sturzgefahr der<br />
Decke gesperrt werden musste, wurde die<br />
aktuelle Sanierung begonnen.<br />
Hauptprobleme der <strong>in</strong> zwei Abschnitten<br />
durchgeführten Maßnahme waren:<br />
-die statische Sicherung der Kuppelkonstruktion<br />
<strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung mit der Dachkonstruktion<br />
-das Festlegen der restauratorischen Gesamtkonzeption<br />
des <strong>Kirche</strong>n<strong>in</strong>nenraumes<br />
-die Restaurierung der Ausstattungsgegenstände,<br />
wie z.B. Kanzelaltar <strong>und</strong> Kanzelrückwandgemälde<br />
-die Sicherung <strong>und</strong> Wiederbefestigung der<br />
absturzgefährdeten Stuckaturen <strong>und</strong> Putzflächen<br />
Bauherr: <strong>Evangelische</strong> <strong>Kirche</strong>ngeme<strong>in</strong>de<br />
Weilburg<br />
Architekt: Rohrbach +Schmees, Gießen<br />
Statik: Karl Hofmann, Frankfurt-Höchst<br />
Restaurator: Josef Weimer, Elz<br />
Jean Kramer, Fulda<br />
Baureferat EKHN: Georg Weber<br />
Bauzeit: 1989 -1998
Das Wahrzeichen der Mitte des 13. Jh. erbauten,<br />
leicht erhöht stehenden Hallenkirche<br />
ist ihr <strong>hohe</strong>r, schlanker Turm, bekrönt<br />
von e<strong>in</strong>em außerordentlich spitzen Helm<br />
mit achteckigem Gr<strong>und</strong>riss, der <strong>in</strong> sich stark<br />
verdreht ist. Wohl schon bald nach der Errichtung<br />
haben sich durch unzureichende<br />
F<strong>und</strong>amentierung <strong>und</strong> e<strong>in</strong> schlechtes statisches<br />
System die Außenwände durch den<br />
Gewölbedruck nach außen gelehnt, <strong>und</strong><br />
auch die Innenpfeiler stehen nicht mehr im<br />
Lot. Mangelnde Pflege <strong>und</strong> unsachgemäße<br />
Reparaturen <strong>in</strong> den vergangenen Jahrh<strong>und</strong>erten<br />
machten e<strong>in</strong>e umfassende Sanierung<br />
<strong>in</strong> drei Bauabschnitten notwendig. Im<br />
Vordergr<strong>und</strong> stand dabei die Erhaltung der<br />
Standsicherheit des historischen Gebäudes.<br />
1. Bauabschnitt:<br />
Instandsetzung der Holzkonstruktion des<br />
Turmhelmes e<strong>in</strong>schließlich Neue<strong>in</strong>deckung<br />
mit Schiefer <strong>und</strong> Sanierung der Mauerkrone<br />
des Turms.<br />
2. Bauabschnitt:<br />
Instandsetzung der Holzkonstruktion des<br />
Dachtragwerks über dem <strong>Kirche</strong>nschiff <strong>und</strong><br />
dem Chor, Sanierung der Mauerkronen <strong>und</strong><br />
der Gewölbeoberseite, Verpressen der Strebepfeiler<br />
<strong>und</strong> der westlichen Giebelwände.<br />
Dache<strong>in</strong>deckung mit Schiefer <strong>und</strong> Ausbesserung<br />
des Fassadenverputzes <strong>und</strong> Erneuerung<br />
des Außenanstrichs.<br />
3. Bauabschnitt:<br />
Verfüllen der Risse <strong>und</strong> Hohlstellen <strong>in</strong> Gewölbe<br />
<strong>und</strong> Gurtbögen, Restaurierung der<br />
<strong>in</strong>neren Raumschale sowie der Ausstattung.<br />
Breidenbach –<br />
Gesamtsanierung der <strong>Kirche</strong><br />
Bauherr: <strong>Evangelische</strong> <strong>Kirche</strong>ngeme<strong>in</strong>de<br />
Breidenbach<br />
Architekt: Walter Dörr, Lohra<br />
Restaurator<strong>in</strong>: Ulrike Höhfeld, Marburg<br />
Statik: Haberland +Arch<strong>in</strong>al +<br />
Zimmermann, Marburg<br />
Baureferat der EKHN: Georg Weber, Thomas Lang<br />
Bauzeit: 1999 -2005<br />
29
Birkenau –<br />
Innenrenovierung der <strong>Kirche</strong><br />
Niederweidbach –<br />
Restaurierung des Marienaltares<br />
30<br />
Bauherr: Ev. <strong>Kirche</strong>ngeme<strong>in</strong>de Birkenau<br />
Architekten: happel architekten, Reichelsheim<br />
Restaurator<strong>in</strong>: Andrea Frenzel, Wiesbaden<br />
Baureferat der EKHN: Georg Weber, Angela Gotthardt<br />
Bauzeit: 2002<br />
Bauherr: <strong>Evangelische</strong> <strong>Kirche</strong>ngeme<strong>in</strong>de<br />
Niederweidbach<br />
Restaurator: Peter Weller-Plate, Ockenheim<br />
Baureferat der EKHN: Georg Weber, Thomas Lang<br />
Restaurierungszeit: 2004 -2005<br />
Nach Plänen des Darmstädter Architekten<br />
Georg Moller entstand 1818 die klassizistische<br />
Landkirche auf rechteckigem Gr<strong>und</strong>riss<br />
mit dreiseitig umlaufenden Emporen auf dorischen<br />
Sandste<strong>in</strong>säulen. Darüber tragen<br />
hölzerne Säulen, ebenfalls <strong>in</strong> dorischer Ordnung,<br />
die flache Decke. Sakristei <strong>und</strong> Gerätekammer<br />
s<strong>in</strong>d durch Innenwände abgetrennt,<br />
Altar, Orgel <strong>und</strong> Kanzel <strong>in</strong> der Mittelachse<br />
situiert. Die <strong>Kirche</strong> wurde als<br />
schmuckloser Putzbau mit R<strong>und</strong>bogenfenstern<br />
<strong>und</strong> quadratischem Dachreiter mit flachem<br />
Helm errichtet.<br />
1914 erhielten die Emporenbrüstungen e<strong>in</strong>e<br />
hochwertige Ornamentmalerei, ebenso die<br />
Orgelbrüstung <strong>und</strong> die Putzdecke. Graue<br />
E<strong>in</strong>farbigkeit charakterisierte dann die letzte<br />
Modernisierung 1963.<br />
Die Innenraumgestaltung erfolgte <strong>in</strong> der<br />
Fassung von 1914, der stimmigsten Farbgebung<br />
für den klassizistischen Bau. Verschiedene<br />
Arbeiten am Sandste<strong>in</strong>portal des E<strong>in</strong>gangs<br />
sowie an Dach <strong>und</strong> Wänden des Anbaues<br />
waren notwendig, außerdem wurde<br />
die Haustechnik komplett erneuert. Die Entfernung<br />
e<strong>in</strong>iger Bankreihen im vorderen <strong>Kirche</strong>nraum<br />
vergrößerte den Chorbereich.<br />
Der spätmittelalterliche Schnitzaltar zählt zu<br />
den bedeutendsten <strong>und</strong> wertvollsten Schätzen<br />
sakraler Kunst <strong>in</strong> Mittelhessen. Er gliedert<br />
sich <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e hölzerne, kastenförmige<br />
Predella, den mit Skulpturen geschmückten<br />
Schre<strong>in</strong> <strong>und</strong> die beiden beidseitig bemalten<br />
Flügel. Nach vorangegangenen Sicherungsarbeiten<br />
war das vordr<strong>in</strong>gliche Ziel der<br />
jüngsten Restaurierung die Konsolidierung<br />
der geschädigten Holzsubstanz sowie die<br />
Sicherung der bedrohten Mal- <strong>und</strong> Gr<strong>und</strong>ierschichten.<br />
Damit verb<strong>und</strong>en war die Abnahme<br />
der Substanz gefährdenden, verbräunten<br />
Überzüge <strong>und</strong> der Überfassungen<br />
des Schre<strong>in</strong>s. Alte Kittungen mussten, da<br />
sie viel zu hart waren, entfernt werden. Um<br />
den geschwächten hölzernen Träger vor<br />
weiteren Schäden zu schützen, wurden alle<br />
Fehlstellen gekittet, auch wenn dies e<strong>in</strong>en<br />
erheblichen Aufwand an Retuschierarbeiten<br />
nach sich zog.
Die e<strong>in</strong>schiffige, barocke Hallenkirche wurde<br />
im Jahr 2002/2003 e<strong>in</strong>er kompletten<br />
Außensanierung unterzogen. Die Innensanierung<br />
folgte im Jahr 2005, da diverse<br />
Schäden im Bereich der Holzdecke <strong>und</strong> an<br />
den Wänden aufgetreten waren. Die neu<br />
gewählten Farben der Wand- <strong>und</strong> Deckenflächen<br />
entsprechen den ursprünglichen<br />
Farbtönen der vorangegangenen restauratorischen<br />
Bestandsuntersuchungen. Die<br />
komplette Innenausstattung wurde <strong>in</strong> Anpassung<br />
an diese Farbtöne überarbeitet,<br />
die Orgel saniert. Der teilweise stark beschädigte<br />
Sandste<strong>in</strong>boden wurde gere<strong>in</strong>igt<br />
<strong>und</strong> restauriert.<br />
Dr<strong>in</strong>gend erforderlich war auch die Erweiterung<br />
<strong>und</strong> Modernisierung der veralteten<br />
WC-Anlagen im Kellergeschoss, um dem<br />
großen Publikumsandrang bei kirchlichen<br />
Veranstaltungen <strong>und</strong> Konzerten gerecht zu<br />
werden. Dabei konnte der bisher abgetrennte<br />
Gr<strong>und</strong>ste<strong>in</strong>raum zugänglich gemacht<br />
<strong>und</strong> <strong>in</strong> den Flurbereich im Keller <strong>in</strong>tegriert<br />
werden.<br />
Die erneuerte Elektro<strong>in</strong>stallation <strong>und</strong> die<br />
Beschallungsanlage, die erweiterte Beleuchtung<br />
mit den für Wartungsarbeiten erforderlichen<br />
umlaufenden Stahl- <strong>und</strong> Holzkonstruktionen<br />
<strong>und</strong> die Beachtung aller sicherheitstechnischen<br />
Aspekte s<strong>in</strong>d die<br />
Hauptbestandteile der haustechnischen<br />
Modernisierung.<br />
Worms –<br />
Innensanierung der Dreifaltigkeitskirche<br />
Bauherr<strong>in</strong>: <strong>Evangelische</strong> Gesamtgeme<strong>in</strong>de Worms<br />
Architekt: Helmut Schembs, Worms<br />
Restaurator<strong>in</strong>: Iris Uhrig, Alzey<br />
Baureferat der EKHN: Georg Weber, Wolfgang Feilberg<br />
Bauzeit: 2005<br />
Fotos: Kühnle, Baranenko<br />
31
Beilste<strong>in</strong> –<br />
Instandsetzung des Turmhelmes <strong>und</strong> des Daches der Schlosskirche<br />
Nochern –Innenrenovierung der <strong>Kirche</strong><br />
32<br />
E<strong>in</strong>gehende Voruntersuchungen hatten ergeben,<br />
dass die Schieferdeckungen des<br />
Turmhelmes <strong>und</strong> auch des <strong>Kirche</strong>ndaches<br />
Schäden <strong>und</strong> Mängel <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em solchen<br />
Maße aufwiesen, dass die Erneuerung der<br />
E<strong>in</strong>deckungen <strong>und</strong> die Sanierung der<br />
Dachstuhlkonstruktion erforderlich waren.<br />
Zusätzlich mussten statische Sicherungsmaßnahmen<br />
durchgeführt werden. Die<br />
Schäden am Holzwerk beruhen größtenteils<br />
auf dauerhaftem Wassere<strong>in</strong>trag durch die<br />
<strong>und</strong>ichte Dache<strong>in</strong>deckung <strong>und</strong> so entstandene<br />
Fäule <strong>und</strong> Schwammbefall des Holzes.<br />
Die denkmalgerechte Neue<strong>in</strong>deckung erfolgte<br />
mit Moselschiefer <strong>in</strong> Altdeutscher<br />
Deckung.<br />
Bauherr: <strong>Evangelische</strong> <strong>Kirche</strong>ngeme<strong>in</strong>de<br />
Beilste<strong>in</strong>-Rodenroth<br />
Architekt: Architekturbüro He<strong>in</strong>rich, Dornburg<br />
Statik: Dr.-Ing. Ra<strong>in</strong>er Gräfe, Dreieich<br />
Baureferat EKHN: Hans-Georg Lange, Thomas Lang<br />
Bauzeit: 2005 <strong>und</strong> 2006<br />
Es war e<strong>in</strong> Glücksfall, dass die ursprüngliche<br />
Holzkonstruktion sowie Empore, Orgel<br />
<strong>und</strong> Gestühl im Orig<strong>in</strong>alzustand erhalten<br />
waren. Verdeckt durch e<strong>in</strong>e Paneeldecke<br />
aus den 1960er Jahren lag auch die bauzeitliche<br />
Farbfassung, so dass der <strong>Kirche</strong>n<strong>in</strong>nenraum<br />
stilecht renoviert werden<br />
konnte. Unter Berücksichtigung denkmalpflegerischer<br />
Gesichtspunkte erfolgte der<br />
E<strong>in</strong>bau e<strong>in</strong>er kle<strong>in</strong>en Teeküche sowie von<br />
Sanitärräumen <strong>in</strong> der Sakristei. So bietet<br />
sich den Geme<strong>in</strong>demitgliedern die Möglichkeit,<br />
die <strong>Kirche</strong> auch für Zusammenkünfte<br />
außerhalb der Gottesdienste zu nutzen.<br />
Bauherr: <strong>Evangelische</strong> <strong>Kirche</strong>ngeme<strong>in</strong>de<br />
Nochern<br />
Architekt: Christof Heil<br />
Restaurator<strong>in</strong>: Andrea Frenzel, Wiesbaden<br />
Baureferat EKHN: Georg Weber, Robert Seregely,<br />
Joachim Bay<br />
Bauzeit: 2004
Die imausgehenden 19. Jh. im Stil des Historismus<br />
von dem Berl<strong>in</strong>er Architekturprofessor<br />
Johannes Otzen erbaute <strong>und</strong> für ihre<br />
Zeit typische R<strong>in</strong>gkirche erfährt seit Anfang<br />
2003 e<strong>in</strong>e umfassende Sanierung der<br />
Außenhaut. Generell be<strong>in</strong>halten die Arbeiten<br />
die Re<strong>in</strong>igung <strong>und</strong> Festigung der Ste<strong>in</strong>e<br />
sowie die Neuverfugung der gesamten Fassade,<br />
wobei besonders beanspruchte Fugen<br />
mit Blei verfüllt werden. Wo nötig, werden<br />
e<strong>in</strong>zelne Partien entsalzt <strong>und</strong> stark verwitterte<br />
Teile durch neue Sandste<strong>in</strong>e ersetzt.<br />
Erforderlich s<strong>in</strong>d auch die Reparatur<br />
der bleiverglasten Fenster sowie e<strong>in</strong>e wirksame<br />
Taubenvergrämung. In der Doppelturmanlage<br />
zeigen sich Risse, die nach e<strong>in</strong>gehenden<br />
statischen Untersuchungen behoben<br />
werden. E<strong>in</strong> zusätzlicher Innenraum<br />
für die zeitgemäße geme<strong>in</strong>dliche Nutzung<br />
der <strong>Kirche</strong> entstand durch e<strong>in</strong>e zweite,<br />
äußere Verglasung der so genannten Reformatorenhalle.<br />
Auf Gr<strong>und</strong> ihrer besonderen<br />
städtebaulichen, bauhistorischen <strong>und</strong> kirchengeschichtlichen<br />
Bedeutung wird die<br />
R<strong>in</strong>gkirche als nationales Kulturdenkmal<br />
geführt.<br />
Bauherr: <strong>Evangelische</strong> R<strong>in</strong>gkirchengeme<strong>in</strong>de<br />
Bauberatung: He<strong>in</strong>rich Schmiedeberg<br />
Architekt: Planergruppe H.T.W.W., Wiesbaden<br />
Baureferat EKHN: Hans-Georg Lange<br />
Baubeg<strong>in</strong>n: 2003<br />
Wiesbaden –<br />
Aussensanierung der R<strong>in</strong>gkirche<br />
33