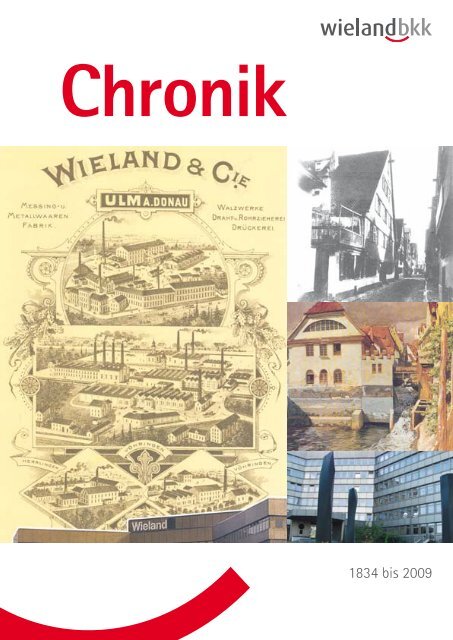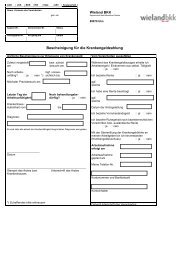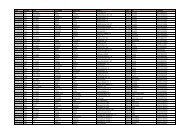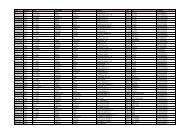Chronik der Wieland BKK von 1834 bis 2009
Chronik der Wieland BKK von 1834 bis 2009
Chronik der Wieland BKK von 1834 bis 2009
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Chronik</strong><br />
<strong>1834</strong> <strong>bis</strong> <strong>2009</strong>
<strong>1834</strong> <strong>bis</strong> 1910<br />
Der 15.6.1883 war <strong>der</strong> Tag<br />
<strong>der</strong> Annahme des „Gesetzes<br />
betreffend die Krankenversicherung<br />
<strong>der</strong> Arbeiter“ im Deutschen<br />
Reichstag. Der Tag gilt<br />
als Geburtstag <strong>der</strong> deutschen<br />
Sozialversicherung. Der Geburtstag<br />
<strong>der</strong> Fabrikkrankenkasse <strong>der</strong><br />
<strong>Wieland</strong>-Werke ist nicht mehr<br />
bekannt, aber das Geburtsjahr.<br />
2<br />
<strong>1834</strong> und damit vor über 175 Jahren<br />
gründete <strong>der</strong> Besitzer <strong>der</strong> Firma <strong>Wieland</strong><br />
& Co., Philipp Jakob <strong>Wieland</strong>, eine Fabrikkrankenkasse,<br />
<strong>der</strong> damals rund 50 Arbeiter<br />
angehörten. „Im Verlangen nach<br />
sozialem Schutz gegen die Geldopfer, die<br />
Krankheit und Todesfälle den Betroffenen<br />
auferlegen“, hatte <strong>der</strong> Firmengrün<strong>der</strong><br />
schon kurz nach <strong>der</strong> Übernahme <strong>der</strong><br />
Glockengießerei Frauenlob die Kasse gegründet.<br />
Damit gehört sie zu den ältesten<br />
Krankenkassen überhaupt.<br />
Die Grün<strong>der</strong>jahre<br />
Der Versicherungsbeitrag betrug ca.<br />
1,5 % des Lohnes. Die Firma übernahm<br />
die gesamten personellen und sachlichen<br />
Kosten des Versicherungsbetriebes durch<br />
wie<strong>der</strong>holte Geldzuwendungen. Ab 1869<br />
sind jährliche feste Zuschüsse nachgewiesen.<br />
Die Leistungen <strong>der</strong> Fabrikkasse bestanden<br />
zunächst in <strong>der</strong> Zahlung <strong>von</strong> Krankengeld<br />
<strong>bis</strong> zu 26 Wochen (13 Wochen<br />
volles und 13 Wochen halbes Kranken-<br />
geld) sowie in <strong>der</strong> Zahlung<br />
<strong>von</strong> Sterbegeld. Die Unterstützung<br />
des erkrankten<br />
Mitarbeiters erfolgte<br />
also zu Beginn in einer<br />
wirtschaftlichen Absicherung<br />
und nicht<br />
durch Deckung <strong>der</strong><br />
infolge <strong>der</strong> Erkrankung<br />
entstehenden<br />
zusätzlichen Kosten.<br />
Außergewöhnlich, aber<br />
dem Geiste des Firmengrün<strong>der</strong>s<br />
entsprechend,<br />
war, dass bei <strong>der</strong> Fabrikkasse<br />
<strong>der</strong> <strong>Wieland</strong>-Werke <strong>von</strong> Anfang<br />
an ein Arbeiterausschuss bei<br />
<strong>der</strong> Verwaltung mitwirkte.<br />
Am 31. Oktober 1884 protokollierten <strong>der</strong><br />
Fabrikdirektor Wiegandt und acht weitere<br />
Vertreter des Unternehmens und <strong>der</strong><br />
Arbeiterschaft Folgendes:<br />
„Nach vorangegangener Verständigung<br />
mit <strong>der</strong> Aufsichtsbehörde wird die <strong>bis</strong>herige<br />
Arbeiter-Krankenkasse <strong>der</strong> Firma<br />
<strong>Wieland</strong> & Co. in eine Fabrikkasse nach<br />
dem Reichsgesetz vom 15. Juni 1883 umgewandelt.“<br />
Die freiwillige Arbeiterkasse<br />
wurde also am 31. Oktober 1884 eine gesetzliche<br />
Krankenkasse.<br />
Waren zur Gründung rund 50 Arbeiter<br />
versichert, betrug <strong>der</strong> Mitglie<strong>der</strong>bestand<br />
1884 schon 281 Personen. Dies war auch<br />
Ausdruck <strong>der</strong> positiven Firmenentwicklung<br />
<strong>der</strong> <strong>Wieland</strong>-Werke.<br />
Die Errichtung <strong>der</strong> reichsgesetzlichen<br />
Krankenkasse erweiterte die Leistungen<br />
für die Mitglie<strong>der</strong>. Ganz wesentlich war,<br />
dass nun auch die Kosten für ärztliche<br />
Behandlung und Medikamente bezahlt<br />
wurden. Die Folge war eine Beitragssatzerhöhung<br />
auf 2,5 % des Lohnes. Die<br />
<strong>Wieland</strong>-Werke hatten sich mit einem<br />
Anteil <strong>von</strong> einem Drittel zu beteiligen.
Ganz im Gegensatz zu<br />
heute konnte die Kasse<br />
vieles selbst regeln. So<br />
wurde die Höhe des<br />
Sterbegeldes wie<strong>der</strong>holt<br />
nach oben und<br />
nach unten geän<strong>der</strong>t<br />
und die dreitägige<br />
Karenzzeit für das<br />
Krankengeld gestrichen<br />
und wie<strong>der</strong> eingeführt.<br />
Im Jahr 1894<br />
beschloss zum Beispiel<br />
eine außerordentliche Generalversammlung<br />
die Wie<strong>der</strong>einführung<br />
<strong>der</strong> Karenzzeit.<br />
Als Ursache wurde „das zahlreiche<br />
Auftreten simulierter Krankheiten,<br />
hauptsächlich durch neu hinzugetretene<br />
Mitglie<strong>der</strong>“ protokolliert.<br />
1897 wurde <strong>der</strong> Antrag, Mitglie<strong>der</strong>, die<br />
noch nicht 10 Jahre <strong>der</strong> Kasse angehören,<br />
nur <strong>bis</strong> zu 13 Wochen zu unterstützen,<br />
vom Königlichen Oberamt nicht genehmigt.<br />
Freie Arztwahl und den Zugang zu allen<br />
Apotheken gab es noch nicht. Die Kasse<br />
schloss mit einzelnen Ärzten Verträge.<br />
Mit <strong>der</strong> Arzneilieferung wurde jährlich<br />
eine an<strong>der</strong>e Apotheke in Ulm und Vöhringen<br />
beauftragt. Mit dem 1. Juni 1904<br />
gewährte die Kasse für Ulm die freie Arztwahl.<br />
Am 1. April 1907 wurde die „Familienunterstützung“<br />
eingeführt. Die Beiträge<br />
stiegen <strong>von</strong> 2,5 % auf 3,6 %. Dafür übernahm<br />
die Kasse zwei Drittel <strong>der</strong> Kosten<br />
für ärztliche Behandlung und Arzneimittel<br />
für Ehefrauen und für Kin<strong>der</strong> <strong>bis</strong> zum<br />
15. Lebensjahr, sofern sie mit dem Mitglied<br />
in einem Haushalt lebten.<br />
1909, also 75 Jahre nach ihrer Gründung,<br />
hatte die Kasse 1.571 Mitglie<strong>der</strong>. Das Vermögen<br />
betrug 1884 1.500 Mark und stieg<br />
<strong>bis</strong> 1909 auf 36.600 Mark. Die Ausgaben<br />
für ärztliche Behandlung stiegen in diesen<br />
25 Jahren <strong>von</strong> 770 Mark auf 9.500<br />
Mark, das Krankengeld <strong>von</strong> 1.760 Mark<br />
auf 20.300 Mark.<br />
In einem Jubiläumsbericht schrieb <strong>der</strong><br />
Kassenführer Friedrich Butz am 1. Dezember<br />
1909 dazu: „Diese Zahlenvergleiche<br />
beleuchten nicht nur das Anwachsen<br />
<strong>der</strong> Kasse an sich, son<strong>der</strong>n aus ihren teils<br />
unverhältnismäßigen Steigerungen<br />
spricht zu einem guten Teil die Verän<strong>der</strong>ung<br />
<strong>der</strong> Zeitverhältnisse überhaupt, <strong>der</strong>gestalt,<br />
dass die Kasse für alle Leistungen,<br />
sei es durch Ärzte, Apotheker o<strong>der</strong><br />
Krankenhäuser, eben durchweg mehr zu<br />
zahlen hat, weil alles teurer wurde, als es<br />
vor 10 und 20 Jahren war.“<br />
Er schloss seinen Bericht mit den Worten<br />
„<strong>der</strong> heutige Gedenktag des 25-jährigen<br />
Bestehens <strong>der</strong> reichsgesetzlichen<br />
Krankenversicherung steht ziemlich am<br />
Ende <strong>der</strong> ersten Gesetzesperiode, da zurzeit<br />
eine allgemeine Reichsversicherungsordnung<br />
in Vorbereitung ist, die für die<br />
Krankenkassen tiefgreifende Än<strong>der</strong>ungen<br />
bringen soll. Es ist zu hoffen, dass die gesunde<br />
Entwicklung, die unsere Kasse <strong>bis</strong>her<br />
aufzuweisen hat, auch unter dem, in<br />
einigen Jahren zu erwartenden, neuen<br />
Gesetz ihren Fortgang nehmen wird.“<br />
Die Regelungen <strong>der</strong> Kranken-, Unfall- und<br />
Arbeiterrentenversicherung wurden dann<br />
am 19.7.1911 in <strong>der</strong> Reichsversicherungsordnung<br />
RVO zusammengefasst.<br />
3
1911 <strong>bis</strong> 1932<br />
1911 entstand mit <strong>der</strong> Reichsversicherungsordnung<br />
ein geschlossenes<br />
Werk, das das <strong>bis</strong>herige<br />
Sozialversicherungsrecht<br />
zusammenfasste und <strong>bis</strong> 1989<br />
das Kernstück des deutschen<br />
Sozialrechts blieb.<br />
Betriebskrankenkassen mit weniger als<br />
100 Mitglie<strong>der</strong>n wurden geschlossen,<br />
neue konnten gegründet werden, wenn<br />
das Unternehmen mindestens 150 versicherungspflichtige<br />
Mitarbeiter hatte.<br />
Die <strong>Wieland</strong>-Betriebskrankenkasse hatte<br />
zu diesem Zeitpunkt 1.602 Mitglie<strong>der</strong><br />
und war damit <strong>von</strong> <strong>der</strong> Zwangsschließung<br />
nicht betroffen.<br />
In einem Punkt enttäuschte die Reichsversicherungsordnung<br />
die Betriebskrankenkassen.<br />
Das Gesetz sah keine Bestimmungen<br />
im Umgang <strong>der</strong> Krankenkassen<br />
mit den Ärzten vor, die über die <strong>bis</strong>herigen<br />
Regelungen hinausgingen. Ein Konflikt<br />
um die freie Arztwahl und um eine<br />
angemessene Vergütung entstand. Die<br />
Lage eskalierte so weit, dass die Ärzte<br />
bundesweit einen bereits lange angedrohten<br />
Generalstreik ausriefen. Dieser<br />
wurde erst in allerletzter Minute mit<br />
4<br />
Hilfe des Reichsinnenministeriums abgewendet.<br />
Das Berliner Abkommen gab<br />
den Ärzten erstmals ein Mitspracherecht<br />
bei <strong>der</strong> Kassenzulassung und verlangte<br />
angemessene Honorare. Die Situation<br />
entspannte sich <strong>bis</strong> in die Inflationszeit<br />
nach dem Ersten Weltkrieg.<br />
Am 2. August 1914 unterwarf die Mobilmachung<br />
Leben und Arbeiten in Deutschland<br />
für vier Jahre den unerbittlichen<br />
Gesetzen des Ersten Weltkrieges. Nach<br />
und nach wurden die Männer im wehrfähigen<br />
Alter zum Kriegsdienst eingezogen.<br />
Von den einberufenen Arbeitern und<br />
Angestellten <strong>der</strong> <strong>Wieland</strong>-Werke in Ulm<br />
und Vöhringen starben 129.<br />
Als dann im Sommer 1918 ein neuer, <strong>bis</strong><br />
dahin unbekannter Krankheitserreger<br />
Europa erreichte, fielen ihm zunächst<br />
Soldaten auf den Schlachtfel<strong>der</strong>n in<br />
Frankreich zum Opfer. Doch innerhalb<br />
weniger Wochen griff diese Epidemie, die<br />
bald als Spanische Grippe bekannt werden<br />
sollte, auch auf die Zivilbevölkerung<br />
über. Als im November 1918 endlich<br />
Friede herrschte, rangen in Deutschland<br />
bereits Zehntausende Grippekranke mit<br />
dem Tode. Weltweit sollten <strong>bis</strong> zu 50 Mio.<br />
Menschen daran sterben.<br />
Trotz <strong>der</strong> schwierigen Situation in den<br />
ersten Jahren nach dem Krieg arbeitete<br />
die Selbstverwaltung <strong>der</strong> <strong>BKK</strong> weiter.<br />
Bemerkenswertes finden wir unter <strong>der</strong><br />
Vorstandsbesprechung vom 20. Januar<br />
1920:<br />
„Unterm 13. Dezember 1919 teilte <strong>der</strong><br />
Arbeiterausschuss Ulm mit, dass eine tags<br />
zuvor im Greifensaal in Ulm stattgefundene<br />
Betriebsversammlung den Beschluss<br />
gefasst habe, die Aufhebung <strong>der</strong> Betriebskrankenkasse<br />
und ihre Verschmelzung<br />
mit <strong>der</strong> Ortskrankenkasse Ulm zu<br />
beantragen.<br />
Der Vorsitzende eröffnet den Vorstandsmitglie<strong>der</strong>n,<br />
dass die Betriebskrankenkasse<br />
nur auf Antrag <strong>der</strong> Firma aufgelöst<br />
werden könne, möchte den Vorstand aber<br />
doch um seine Meinung fragen, wie er<br />
sich <strong>der</strong> Aufhebung <strong>der</strong> Betriebskrankenkasse<br />
gegenüber verhalte.<br />
Die Vorstandsmitglie<strong>der</strong> sowohl in Ulm<br />
als auch in Vöhringen hielten eine Verschmelzung<br />
mit <strong>der</strong> Ortskrankenkasse<br />
Ulm bzw. Illertissen nicht für angezeigt,<br />
solange unsere Betriebskrankenkasse<br />
leistungsfähiger sei, als jede <strong>der</strong> genannten<br />
Ortskrankenkassen.“<br />
In <strong>der</strong> Sitzung am 28. Februar 1920 wurden<br />
verschiedene Leistungen erweitert.<br />
Das Krankengeld wurde auf 75 % des<br />
Lohnes erhöht. Der Geldbetrag für Krankenkost<br />
wurde <strong>von</strong> 1 Mark auf 3 Mark<br />
täglich erhöht und kleinere Heilmittel<br />
wurden <strong>bis</strong> 50 Mark komplett bezahlt.<br />
Der Beitragssatz musste aufgrund dieser<br />
Maßnahmen <strong>von</strong> 4,5 % auf 6 % erhöht<br />
werden.<br />
Am 25. Mai 1920 begann im Deutschen<br />
Reich mit Ausnahme Württembergs ein<br />
Ärztestreik, <strong>der</strong> vorerst die Mitglie<strong>der</strong> in<br />
Vöhringen betraf. Sie konnten nur gegen<br />
Vorauszahlung <strong>der</strong> Gebühr behandelt<br />
werden. Im Protokoll steht: „Dieser Zustand<br />
ist für die Vöhringer sehr misslich,<br />
hauptsächlich deshalb, weil Herr Dr. S.<br />
versucht habe, Erkrankte sogar vom Eintritt<br />
ins Krankenhaus Illertissen zurückweisen<br />
zu lassen“. Die Stimmung muss<br />
angespannt gewesen sein, denn <strong>der</strong><br />
Vorsitzende riet den Vöhringer Vorstandsmitglie<strong>der</strong>n,<br />
„doch darauf hinzuwirken,<br />
dass es nicht zu Gewalttätigkeiten<br />
komme.“
1921 diskutierten die Versichertenvertreter<br />
leidenschaftlich die Ausweitung des<br />
Krankengeldes auf Sonntage und die<br />
damit verbundene Ausgabensteigerung.<br />
Ferner entstand <strong>der</strong> Wunsch, sogenannte<br />
„Naturheilkundige“ zuzulassen. Dies<br />
war allerdings schon damals rechtlich<br />
nicht möglich.<br />
Maßnahmen zur Prävention gab es auch.<br />
An einer Vorführung des Films „Entstehung,<br />
Wesen und Gefahren <strong>der</strong> Geschlechtskrankheiten“<br />
beteiligte sich die<br />
<strong>BKK</strong> mit 500 Mark. Damit hatten die<br />
Mitglie<strong>der</strong> freien Zugang.<br />
1923 hatte die Inflation die gesamte<br />
Wirtschaft und damit auch die <strong>BKK</strong> fest<br />
im Griff. Eine Bilanz für 1923 war infolge<br />
<strong>der</strong> Geldentwertung nicht möglich. Die<br />
einst auf Goldreserven gegründete deutsche<br />
Währung verfiel dramatisch. Die<br />
Staatsdruckerei kam mit dem Druck <strong>von</strong><br />
Papiermarkscheinen nicht mehr nach.<br />
Kommunen, Kreisverbände und sogar<br />
Betriebe mussten einspringen. Auch die<br />
<strong>Wieland</strong>-Werke druckten 1923 eigenes<br />
Notgeld, um Löhne und Gehälter auszahlen<br />
zu können. Ein Pfund Brot kostete im<br />
Herbst 1923 250 Mrd. Mark. Am 20.<br />
November fand <strong>der</strong> Hexentanz <strong>der</strong> Zahlen<br />
durch verschiedene Maßnahmen ein<br />
Ende.<br />
1926 diskutierten die Vorstandsmitglie<strong>der</strong>,<br />
ob sie die Zahnklinik <strong>der</strong> AOK Ulm zulassen<br />
sollen, damit sich die Versicherten<br />
auch dort behandeln lassen können. Ein<br />
Vorstandsmitglied berichtete, „dass ihm<br />
sowohl die Behandlung als auch die<br />
Tatsache, dass er bei jedem Besuch<br />
höchstens eine halbe Stunde habe warten<br />
müssen, imponiert habe“.<br />
Am 10. September 1929 entschloss sich<br />
<strong>der</strong> Vorstand, eine eigene Mitglie<strong>der</strong>kartei<br />
zu schaffen und hierfür ein teures,<br />
aber durchaus mo<strong>der</strong>nes Karteisystem<br />
namens Kardex zu kaufen. Die Kartei<br />
sollte die <strong>BKK</strong> die nächsten 60 Jahre begleiten,<br />
um dann durch den Computer<br />
ersetzt zu werden.<br />
Im November desselben Jahres rangen<br />
die Vorstandsmitglie<strong>der</strong> um die Entscheidung<br />
über die Zulassung eines Dentisten<br />
in Vöhringen.<br />
1930 wurde über die unterschiedlichen<br />
Entwicklungen <strong>der</strong> Ausgaben in Ulm und<br />
Vöhringen gestritten. „Die Zahl <strong>der</strong><br />
Krankheitstage, berechnet auf 1 Mitglied,<br />
sei in Ulm 9,1, in Vöhringen dagegen 12,9;<br />
es finde in Vöhringen eine größere Inanspruchnahme<br />
<strong>der</strong> Kasse statt, wobei es<br />
sich häufig um leichtere Fälle handelt.<br />
Bei getrennter Kassenführung würden<br />
sich die Ulmer Mitglie<strong>der</strong> günstiger<br />
stellen. Das Verhalten <strong>der</strong> Vöhringer ist<br />
sehr unkameradschaftlich.“<br />
5
1933 <strong>bis</strong> 1945<br />
Mit <strong>der</strong> Machtübernahme <strong>der</strong> Nationalsozialisten<br />
begann in fast allen Lebensbereichen<br />
die sogenannte Gleichschaltung.<br />
Das betraf schnell auch die Krankenversicherung<br />
und die <strong>bis</strong>her unter<br />
Selbstverwaltung stehenden Krankenkassen.<br />
Im Mai 1933 führte ein Erlass des Reichskommissars<br />
für die Krankenkassen<br />
Württembergs zu einer Beitragsherabsetzung<br />
bei den Krankenkassen, <strong>der</strong>en<br />
Rücklage die gesetzliche Höhe überschritt.<br />
Die <strong>BKK</strong> senkte daraufhin ihren<br />
Beitragssatz <strong>von</strong> 3 % auf 1,5 %.<br />
Die nationalsozialistische Regierung kontrollierte<br />
bereits kurz nach <strong>der</strong> Machtübernahme<br />
das gesamte öffentliche<br />
Leben in Deutschland – auch bei den<br />
Betriebskrankenkassen.<br />
Bereits am 17. März 1933 erlaubte eine<br />
erste „Verordnung zur Neuordnung <strong>der</strong><br />
Krankenversicherung“ dem Reichsarbeitsminister,<br />
Kassenverbände und<br />
Kassen unter die Aufsicht linientreuer<br />
Kommissare zu stellen. Im Mai 1933<br />
sicherte sich das NS-Regime im „Gesetz<br />
über die Ehrenämter in <strong>der</strong> sozialen Ver-<br />
6<br />
sicherung und <strong>der</strong> Reichsversicherung“<br />
auch den direkten Eingriff in die Auswahl<br />
<strong>der</strong> Versicherungsvertreter.<br />
Am 29. Juni 1933 setzte die <strong>BKK</strong> den Erlass<br />
„des Herrn Reichskommissars für die<br />
Krankenkassen Württemberg vom<br />
7.6.1933“ um. Das Versicherungsamt Ulm<br />
hatte in seinem Run<strong>der</strong>lass vom 13. Juni<br />
1933 empfohlen, dass sämtliche Mitglie<strong>der</strong><br />
<strong>der</strong> Kassenorgane ihr <strong>bis</strong>heriges Ehrenamt<br />
freiwillig zur Verfügung stellen.<br />
Ein Jahr später las sich dies dann im Protokoll<br />
<strong>der</strong> Ausschuss-Sitzung vom 11. Mai<br />
1934 so:<br />
„Der Vorsitzende begrüßt die vollständig<br />
erschienenen Ausschuss-Mitglie<strong>der</strong> mit<br />
Wärme, darauf hinweisend, dass mit ihnen<br />
ein neuer Geist in den Ausschuss <strong>der</strong><br />
Krankenkasse eingezogen sei, <strong>der</strong> den<br />
Kampfruf hier Arbeitnehmer, hier Arbeitgeber<br />
nicht mehr gelten lasse, son<strong>der</strong>n<br />
das Heil in all wahrhaft einträchtiger Zusammenarbeit<br />
gegründet wisse.“<br />
Das „Gesetz über die Vereinheitlichung<br />
des Gesundheitswesens“ vom 3. Juli 1934<br />
schuf die rechtlichen Voraussetzungen<br />
für die Einrichtung staatlicher Gesundheitsämter<br />
ab dem 1. April 1935. Sie<br />
waren zunächst vor allem mit <strong>der</strong> ärztlichen<br />
Feststellung und Begutachtung in<br />
Fragen <strong>der</strong> Gesundheitspolizei betraut,<br />
dazu zählte insbeson<strong>der</strong>e die „Erb- und<br />
Rassenpflege“, einschließlich <strong>der</strong> Eheberatung.<br />
Am 3. Januar 1935 war die Gleichschaltung<br />
in <strong>der</strong> Sozialversicherung endgültig<br />
vollzogen. Der Vorstand <strong>der</strong> <strong>BKK</strong> wurde<br />
per Verordnung abgesetzt. An seine<br />
Stelle trat ein durch die Aufsichtsbehörde<br />
zu ernennen<strong>der</strong> Beirat.<br />
Der Beirat übernahm eine konstruktive<br />
Rolle. Als in <strong>der</strong> Beiratssitzung am 5.<br />
Dezember 1935 über eine Beitragssatzerhöhung<br />
diskutiert wurde und folgerichtig<br />
auch die Mehrleistungen geprüft<br />
wurde, stand im Protokoll:<br />
„Leiter und Beiräte treten dafür ein, erst<br />
im äußersten Falle mit den Leistungen<br />
zurückzugehen. Die Beiräte bekunden<br />
ausdrücklich, dass es die Mitglie<strong>der</strong> mit<br />
Genugtuung empfunden hätten, dass die<br />
Kassenleitung seit <strong>der</strong> Gründung <strong>der</strong><br />
Kassen einen besonnenen und stetigen<br />
Kurs eingehalten habe und beson<strong>der</strong>s im<br />
Ausbau <strong>der</strong> Mehrleistungen Schritt um<br />
Schritt vorgegangen sei; es würde in<br />
heutiger Zeit beson<strong>der</strong>s schmerzlich empfunden<br />
werden, wenn mit einmal ein<br />
Rückschritt eintreten würde.“ Der<br />
Beitragssatz wurde deshalb <strong>von</strong> 3,9 %<br />
auf 4,8 % erhöht.<br />
Trotzdem hatte die Kasse finanzielle<br />
Schwierigkeiten und nahm bereits im<br />
Januar 1936 <strong>von</strong> den <strong>Wieland</strong>-Werken<br />
ein Darlehen in Höhe <strong>von</strong> 3.500 Reichsmark<br />
auf. Die Rückzahlung gestaltete sich<br />
schwierig, weil „die Barmittel <strong>der</strong> Kasse<br />
dauernd <strong>bis</strong> zum Letzten beansprucht<br />
werden“.
Ursache waren unter an<strong>der</strong>em die Kosten<br />
<strong>der</strong> Wochenhilfe. Es musste „die<br />
Wahrnehmung gemacht werden, dass<br />
Wöchnerinnen kurz ehe sie wegen nahen<strong>der</strong><br />
Geburt mit <strong>der</strong> Arbeit aussetzen<br />
müssen, danach trachten, möglichst<br />
hohe Akkordverdienste zu erzielen, um<br />
ein entsprechend hohes Wochen- und<br />
Stillgeld sich zu sichern“.<br />
Mit sofortiger Wirkung wurde deshalb<br />
am 31. Juli 1936 beschlossen, das Höchststillgeld<br />
<strong>von</strong> <strong>bis</strong>her 1,50 Reichsmark auf<br />
0,50 Reichsmark zu senken.<br />
Am 31. Dezember 1936 hatte die <strong>Wieland</strong><br />
<strong>BKK</strong> 2.372 Mitglie<strong>der</strong>.<br />
Eine Verordnung vom 14. April 1938<br />
schrieb den Sozialversicherungsträgern<br />
vor, fast drei Viertel ihres Vermögens in<br />
Reichs- o<strong>der</strong> Staatsanleihen anzulegen.<br />
Dies trug dazu bei, dass die Sozialversicherung<br />
nach 1945 materiell ausgelaugt<br />
war.<br />
Die Beiratssitzung am 8. März 1939 begann<br />
mit einer Ehrung. Der Leiter, Herr<br />
Auler, gab bekannt, „dass <strong>der</strong> Führer und<br />
Reichskanzler dem Geschäftsführer,<br />
Herrn Butz, das silberne Treudienst-<br />
ehrenzeichen für 25-jährige treue Dienste<br />
verliehen hat“.<br />
Erstmals wurde in dieser Sitzung ein<br />
Zahlenvergleich mit <strong>der</strong> AOK Ulm präsentiert.<br />
„Hierbei ergibt sich, dass die Aufwendungen<br />
unserer Kasse für Leistungen<br />
durchweg höher sind, als bei <strong>der</strong> Ortskrankenkasse.<br />
Beson<strong>der</strong>s auffallend ist<br />
<strong>der</strong> Unterschied beim Krankengeld;<br />
während bei <strong>der</strong> AOK auf 1 Mitglied 11,19<br />
Reichsmark entfallen, hat unsere Kasse<br />
25,81 Reichsmark je Mitglied bezahlt. Bei<br />
den Verwaltungskosten entfallen bei <strong>der</strong><br />
AOK auf 1 Mitglied 7,37 Reichsmark, bei<br />
unserer Kasse dagegen nur 0,73 Reichsmark,<br />
also <strong>der</strong> zehnte Teil. Der<br />
Leiter weist bei dieser Gelegenheit auf<br />
den beson<strong>der</strong>en Wert <strong>der</strong> Betriebskrankenkasse<br />
für die Versicherten hin.“<br />
Eine Grippeepidemie im Frühjahr 1939<br />
steigerte erheblich die Ausgaben. Der<br />
Beginn des Krieges erschwerte die Planungen.<br />
Verschiedene Beiratsmitglie<strong>der</strong><br />
wurden in die Wehrmacht eingezogen.<br />
Der Beirat war nicht mehr handlungsfähig.<br />
Die Krankenkassen wurden nun verpflichtet,<br />
hohe Krankenstände dem zuständigen<br />
Vertrauensarzt zu melden. Die Landesvertrauensärzte<br />
konnten mit sogenannten<br />
Stoßtrupps die Krankenkassen<br />
prüfen. Bei einem Krankenstand <strong>von</strong><br />
3,3 % wurde <strong>von</strong> einem umgreifenden<br />
Simulantentum ausgegangen. „Krankfeiern<br />
im Kriege“ sollte wirksam bekämpft<br />
werden.<br />
Wie alle Kassen wurden auch die Betriebskrankenkassen<br />
zum Sprachrohr dieser<br />
Politik zur Erhaltung und För<strong>der</strong>ung<br />
<strong>der</strong> deutschen „Volkskraft“ und kritisierten<br />
öffentlich den „schwachen Gesundheitswillen“<br />
mancher Kassenpatienten.<br />
Der Leistungskatalog <strong>der</strong> gesetzlichen<br />
Krankenversicherung wurde während des<br />
Krieges in wenigen Punkten erweitert,<br />
was propagandistisch als sozialpolitische<br />
Erfolge <strong>der</strong> NS-Regierung dargestellt<br />
wurde.<br />
„Das Gesetz zum Schutze <strong>der</strong> erwerbstätigen<br />
Mutter“ vom Mai 1942 sollte die<br />
Rolle <strong>der</strong> Mutter als „Hüterin und<br />
Walterin <strong>der</strong> Familie“ stärken. Die Kassenleistung<br />
des Wochen- und Stillgelds<br />
wurde per Gesetz erhöht.<br />
Von 1942 an gab es in <strong>der</strong> <strong>BKK</strong> keine<br />
Sitzungen mehr, son<strong>der</strong>n nur noch protokollierte<br />
Verfügungen, mit denen Anordnungen<br />
des Reichsarbeitsministers<br />
umgesetzt wurden. Auffällig war auch,<br />
dass dies handschriftlich und nicht mehr<br />
mit Maschinenschrift protokolliert wurde.<br />
Zwischen einer Anordnung vom 15.<br />
September 1945 und einer Nie<strong>der</strong>schrift<br />
vom 29. August 1947, also knapp 2 Jahre,<br />
gab es gar keine Beschlüsse. Bemerkenswert<br />
ist, dass die Beitragssatzerhöhung<br />
vom 5.12.1935 auf 4,8 % auch noch<br />
am 30.6.1947 Bestand hatte und mit<br />
Wirkung ab 1.7.1947 auf 6,0 % erhöht<br />
wurde.<br />
7
1946 <strong>bis</strong> 1969<br />
1951 beschloss <strong>der</strong> Bundestag das bereits<br />
1949 vom Wirtschaftsrat <strong>der</strong> Alliierten<br />
genehmigte Selbstverwaltungsgesetz.<br />
Wie vor 1933 waren die Sozialpartner<br />
durch gewählte Repräsentanten<br />
wie<strong>der</strong> Verantwortungsträger in <strong>der</strong> Sozialversicherung.<br />
Im selben Jahr ist die <strong>BKK</strong> finanziell sehr<br />
liquide und legt 60.000 DM beim Trägerunternehmen<br />
an. 1953 interveniert dazu<br />
das Versicherungsamt, weil diese Anlageform<br />
nicht <strong>von</strong> den Bestimmungen <strong>der</strong><br />
Reichsversicherungsordnung gedeckt seien.<br />
Der Betrag sei in mündelsicheren<br />
Wertpapieren anzulegen.<br />
Eine Grippe-Epidemie zu Beginn des Jahres<br />
1953 verursacht Mehrausgaben in<br />
Höhe <strong>von</strong> 30.000 DM. Auch die Pflegesätze<br />
im Krankenhaus steigen deutlich.<br />
Eine zunächst geplante Beitragssatzsenkung<br />
kann daher nicht umgesetzt werden.<br />
Die Jahresrechnung 1953 verzeichnet<br />
bei einem Volumen <strong>von</strong> rund 565.000<br />
DM Mehreinnahmen <strong>von</strong> 1.028,07 DM.<br />
In seiner Sitzung vom 11.3.1954 richtet<br />
<strong>der</strong> Vorstand erstmals eine Wi<strong>der</strong>spruchsstelle<br />
ein. Grund ist eine am<br />
1.1.1954 in Kraft getretene Än<strong>der</strong>ung des<br />
Sozialgerichtsgesetzes. Die Vertreterversammlung<br />
benennt dann am 18.3.1954<br />
folgende Personen in diese Stelle:<br />
• Vertreter des Arbeitgebers: Herr Auler<br />
• Vertreter <strong>der</strong> Versicherten des Werkes<br />
Vöhringen: Herr Hofer<br />
• Vertreter <strong>der</strong> Versicherten des Werkes<br />
Ulm: Herr Strohmeier<br />
1955 erhöht <strong>der</strong> Vorstand die Zuschüsse<br />
für festsitzenden Zahnersatz für Mitglie<strong>der</strong><br />
<strong>von</strong> 20 DM auf 25 DM je Krone, Stiftzahn<br />
o<strong>der</strong> Brückenglied und 150 DM<br />
Höchstbetrag im Jahr und für Familienversicherte<br />
<strong>von</strong> 15 DM auf 20 DM und<br />
120 DM Höchstbetrag im Jahr.<br />
8<br />
Aufgrund einer Rechtsän<strong>der</strong>ung des<br />
Selbstverwaltungsgesetzes hat <strong>der</strong> Vorstand<br />
bei <strong>der</strong> Behandlung <strong>von</strong> Fragen,<br />
„die die Volksgesundheit berühren, einen<br />
auf dem Gebiet <strong>der</strong> Volksgesundheit und<br />
<strong>der</strong> Sozialversicherung erfahrenen Arzt<br />
mit beraten<strong>der</strong> Stimme hinzuzuziehen“.<br />
Ob es sich um eine Frage handelt, die die<br />
Volksgesundheit berührt, liegt allein im<br />
Ermessen des Vorstandes.<br />
Das Jahresergebnis 1955 führt zu einem<br />
Fehlbetrag <strong>von</strong> 10.779,47 DM. Der Vorstand<br />
plant eine Beitragssatzerhöhung<br />
<strong>von</strong> 5,5 % auf 6,0 %.<br />
Grippe-Pandemie<br />
1957 nähert sich das Haushaltsvolumen<br />
<strong>der</strong> Millionengrenze an. Im Voranschlag<br />
werden 998.500 DM an Einnahmen und<br />
992.700 DM an Ausgaben erwartet.<br />
Tatsächlich wird dann die Millionengrenze<br />
überschritten. 1957 bricht die sogenannte<br />
Asiatische Grippe in Hongkong<br />
aus. Chinesische Flüchtlinge hatten das<br />
Virus in die Stadt gebracht. Von dort breitet<br />
es sich schnell in die USA und nach<br />
Europa aus. Um die 30.000 Menschen<br />
sterben in Deutschland.<br />
Die Ausgaben, insbeson<strong>der</strong>e für ärztliche<br />
Behandlung und für Krankengeld, steigen<br />
erheblich. Allein die Ausgaben für Krankengeld<br />
sind in drei Monaten so hoch wie<br />
die Rücklage. Diese Rücklage baut die<br />
<strong>BKK</strong> ab und erhöht den Beitragssatz <strong>von</strong><br />
6,0 % auf 6,8 %. Zudem unterstützen die<br />
<strong>Wieland</strong>-Werke die <strong>BKK</strong> mit einem zinslosen<br />
Darlehen <strong>von</strong> 45.000 DM. Die <strong>Wieland</strong>-Werke<br />
verzichten 1961 auf die<br />
Rückzahlung des Darlehens. Am 1.10.1957<br />
meldet <strong>der</strong> Geschäftsführer <strong>der</strong> <strong>BKK</strong>, Hermann<br />
Dermühl, einen Krankenstand <strong>von</strong><br />
20 % in jedem Werk. Die Unterschiede<br />
liegen lediglich hinter dem Komma.<br />
Auch nachdem die Pandemie vorüber ist,<br />
bleibt es beim hohen Ausgabenniveau.<br />
Geschäftsführer und Vorstand diskutieren<br />
eingehend über das Krankengeld. Ein<br />
Teilnehmer regt an, „die Versicherten<br />
durch systematische Aufklärung zur verantwortlichen<br />
Mitarbeit zu erziehen, weil<br />
nach seiner Ansicht nur so das dauernde<br />
Ansteigen des Krankenstandes und damit<br />
<strong>der</strong> Ausgaben für Krankengeld eingedämmt<br />
werden kann. Der Beitragssatz<br />
wird zum 1.1.1959 <strong>von</strong> 6,8 % auf 7,5 %<br />
und am 1.1.1960 auf 8,0 % erhöht.<br />
Um die teuren neuen, mit Einsatz einer<br />
Herz-Lungen-Maschine nun möglichen<br />
Herzoperationen finanzieren zu können,<br />
hat <strong>der</strong> <strong>BKK</strong> Bundesverband über die Landesverbände<br />
ein Umlageverfahren vorgeschlagen.<br />
Die Umlage beträgt je Mitglied<br />
und Fall 1,25 DM. Die <strong>Wieland</strong> <strong>BKK</strong><br />
tritt diesem Umlageverfahren bei.
Der Voranschlag für das Jahr 1962 übersteigt<br />
erstmals die Grenze <strong>von</strong> 2 Mio. DM.<br />
Die Leistungsausgaben steigen insbeson<strong>der</strong>e<br />
durch gesetzliche Maßnahmen.<br />
So wird die Dauer <strong>der</strong> statio nären Behandlung<br />
<strong>von</strong> <strong>bis</strong>her 26 auf nunmehr 78<br />
Wochen verlängert. Zum 1.7.1962 müssen<br />
daher erneut die Beiträge erhöht<br />
werden. Der Beitragssatz steigt <strong>von</strong><br />
8,0 % auf 9,0 %.<br />
Neue Honorierung <strong>der</strong> Ärzte<br />
1964 diskutieren Geschäftsführer und<br />
Vorstand intensiv, ob die <strong>BKK</strong> <strong>der</strong> Kassenärztlichen<br />
Vereinigung einen Wechsel<br />
<strong>von</strong> <strong>der</strong> Pauschalhonorierung hin zu<br />
einer Einzelleistungsvergütung anbieten<br />
soll. Auch die Geschäftsleitung <strong>der</strong> <strong>Wieland</strong>-Werke<br />
ist daran interessiert, „weil<br />
sie sich dadurch eine Verbesserung des<br />
Verhältnisses zwischen Krankenkasse<br />
bzw. Patient einerseits und Arzt an<strong>der</strong>erseits<br />
verspricht, was sich sicherlich zum<br />
Wohle <strong>der</strong> Versicherten auswirken werde“.<br />
Die <strong>Wieland</strong>-Werke sind auch bereit,<br />
„für zwei Jahre die Bürgschaft dafür zu<br />
übernehmen, dass durch den Übergang<br />
vom Pauschalhonorierungssystem zur<br />
Bezahlung nach Einzelleistungen keine<br />
Beitragserhöhung notwendig wird“.<br />
Die Verhandlungen mit <strong>der</strong> Kassenärztlichen<br />
Vereinigung werden aufgenommen.<br />
Am 14.12.1964 beschließt <strong>der</strong> Vorstand,<br />
„ab 1.1.1965 zur Honorierung <strong>der</strong> Ärzte<br />
nach Einzelleistungen unter Anwendung<br />
<strong>der</strong> E-Adgo (Abrechnungsgebührenordnung<br />
<strong>der</strong> Ersatzkassen) überzugehen. Es<br />
muss jedoch seitens <strong>der</strong> Kassenärztlichen<br />
Vereinigung Nord-Württemberg sichergestellt<br />
werden, dass die Einzelleistungsvergütung<br />
nicht nur innerhalb ihres eigenen<br />
Bezirks, son<strong>der</strong>n auch im Bereich<br />
<strong>der</strong> Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns<br />
hinsichtlich <strong>der</strong> dort wohnhaften<br />
Mitglie<strong>der</strong> durchgeführt wird. Eine ent-<br />
Finanzlage 1957<br />
sprechende Vereinbarung soll zunächst<br />
für die Dauer eines Jahres geschlossen<br />
werden.<br />
Am 29.5.1965 stirbt <strong>der</strong> langjährige Vorsitzende<br />
des Vorstands und Vertreter <strong>der</strong><br />
<strong>Wieland</strong>-Werke Karl Stiegele. Sein Nachfolger<br />
wird Friedhelm Greischel.<br />
Das 1960 eingeführte Umlageverfahren<br />
für teure Leistungsfälle wird 1965 auf die<br />
neuen Operationen zur Implantation <strong>von</strong><br />
Herzschrittmachern und 1967 auf die<br />
Kosten <strong>der</strong> Behandlung mit <strong>der</strong> künstlichen<br />
Niere ausgedehnt.<br />
Nach einem erfolgreichen Start <strong>der</strong> neuen<br />
ärztlichen Vergütung wird <strong>der</strong> Vertrag<br />
für das zweite Jahr ausgebaut. Es wird<br />
vereinbart, „zu denjenigen Leistungen, die<br />
vom Arzt ganz persönlich erbracht werden<br />
müssen und beson<strong>der</strong>s geeignet sind,<br />
das notwendige Vertrauensverhältnis<br />
zwischen Arzt und Patient zu schaffen<br />
und zu vertiefen, einen Zuschlag zu gewähren“.<br />
Es handelt sich um Zuschläge<br />
bei Beratungen und Hausbesuchen.<br />
1968 hat die <strong>BKK</strong> über 5.000 Mitglie<strong>der</strong>.<br />
Aufgrund <strong>der</strong> Kassengröße beschließt <strong>der</strong><br />
Vorstand am 17.7., dem Geschäftsführer,<br />
Hermann Dermühl, einen Stellvertreter<br />
zur Seite zu stellen, und ernennt Walter<br />
Ba<strong>der</strong> zum stellvertretenden Geschäftsführer<br />
<strong>der</strong> <strong>BKK</strong>.<br />
Ab 1969 gibt die <strong>BKK</strong> Krankenscheinhefte<br />
aus und führt die bargeldlose Zahlung<br />
des Krankengeldes und des Mutterschaftsgeldes<br />
ein. Sterbegeld, Fahrgeld<br />
und an<strong>der</strong>e Zuschüsse werden weiterhin<br />
bar jeweils freitags ausbezahlt.<br />
Zum 1.1.1969 tritt eine erhebliche Rechtsän<strong>der</strong>ung<br />
in Kraft. Arbeiter erhalten wie<br />
Angestellte im Falle einer Krankheit<br />
ihren Lohn <strong>bis</strong> zur Dauer <strong>von</strong> sechs Wochen<br />
fortgezahlt. Dies hat auf die Ausgaben<br />
für Krankengeld und letztlich auch<br />
auf den Beitragssatz erhebliche Auswirkungen.<br />
9
1970 <strong>bis</strong> 1988<br />
„Das Gesetz über die Fortzahlung<br />
des Arbeitsentgelts im Krankheitsfalle“<br />
bringt erstmals seit<br />
Langem eine finanzielle Entlastung.<br />
Nach <strong>der</strong> neuen Regelung<br />
zahlt <strong>der</strong> Arbeitgeber nun auch<br />
dem Arbeiter in den ersten sechs<br />
Wochen seiner Arbeitsunfähigkeit<br />
den Lohn weiter. Dies war<br />
<strong>bis</strong> dahin nur bei den Angestellten<br />
<strong>der</strong> Fall gewesen.<br />
Dadurch reduzieren sich die Ausgaben<br />
für Krankengeld. Bei <strong>der</strong><br />
<strong>Wieland</strong> <strong>BKK</strong> sinkt <strong>der</strong> Beitragssatz<br />
<strong>von</strong> 9,6 % auf 6,4 %.<br />
Zum 1.1.1970 führt <strong>der</strong> Gesetzgeber eine<br />
neue Regelung ein, die im Volksmund bald<br />
„Krankenscheinprämie“ genannt wird.<br />
Wer in einem Quartal keine Leistungen<br />
in Anspruch nimmt, erhält eine Prämie<br />
<strong>von</strong> 10 DM.<br />
Im selben Jahr beschließt die Selbstverwaltung<br />
<strong>der</strong> <strong>BKK</strong> in <strong>der</strong> Satzung, den Kassenbereich<br />
„auf alle Außenbüros <strong>der</strong> <strong>Wieland</strong>-Werke<br />
im Gebiet <strong>der</strong> Bundesrepublik<br />
und in Westberlin“ zu erweitern und<br />
in <strong>der</strong> Krankenordnung die Ausgehzeiten<br />
bei Arbeitsunfähigkeit neu zu regeln.<br />
1970 hat die <strong>Wieland</strong> <strong>BKK</strong> 5.791 Mitglie<strong>der</strong>.<br />
Es sind 4.139 Pflichtmitglie<strong>der</strong>, 454<br />
freiwillige Mitglie<strong>der</strong> und 1.198 Rentner.<br />
Die Ausgaben betragen 4.860.382 DM<br />
und werden fast genau <strong>von</strong> 4.825.100<br />
DM Einnahmen gedeckt.<br />
Die 1969 an die Regierung gekommene<br />
sozialliberale Koalition verabschiedet<br />
nach und nach eine Vielzahl <strong>von</strong> neuen<br />
Sozialgesetzen. In <strong>der</strong> gesetzlichen Krankenversicherung<br />
werden <strong>der</strong> Leistungskatalog<br />
und <strong>der</strong> versicherte Personenkreis<br />
in den nächsten Jahren kontinuierlich<br />
erweitert.<br />
10<br />
So werden Früherkennungsuntersuchungen<br />
für Männer, Frauen, Neugeborene<br />
und Kin<strong>der</strong> eingeführt. Die Behandlung<br />
im Krankenhaus wird zeitlich unbefristet<br />
übernommen.<br />
Ein tragischer Unfall führt 1971 zur Erweiterung<br />
<strong>der</strong> Krankenordnung. Ein wegen<br />
eines Herzleidens arbeitsunfähiges<br />
Kassenmitglied erlitt am Lenkrad seines<br />
Kraftfahrzeugs einen Herzschlag und verstarb.<br />
Die Vertreterversammlung nimmt<br />
daraufhin folgenden Passus in die Krankenordnung<br />
auf: „Es wird dringend empfohlen,<br />
während bestehen<strong>der</strong> Arbeitsunfähigkeit,<br />
wenn das Herz o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Kreislauf<br />
geschädigt sein könnten, das Führen<br />
eines Kraftfahrzeugs zu unterlassen.“<br />
Eine Neuregelung des Finanzausgleichs<br />
für teure Leistungsfälle unterstützt die<br />
<strong>BKK</strong> nicht, da sie bei <strong>der</strong> vorgeschlagenen<br />
Regelung meint, dass diese noch<br />
in die Eigenleistung einer einzelnen <strong>BKK</strong><br />
fällt und <strong>der</strong> Schwellenwert höher sein<br />
müsste.<br />
Am 18.9.1973 stirbt Hans Strohmaier, er<br />
war Stellvertreter des Vorstandsvorsitzenden.<br />
Ihm folgt im Amt Karl Hofer. 1975<br />
geht <strong>der</strong> Geschäftsführer Hermann Dermühl<br />
nach 37-jähriger Dienstzeit in den<br />
Ruhestand. Der Vorstand bestellt Walter<br />
Ba<strong>der</strong> zum Geschäftsführer <strong>der</strong> <strong>BKK</strong>.<br />
Seit 1.10.1974 ist das Gesetz zur Angleichung<br />
<strong>der</strong> Leistungen zur Rehabilitation<br />
in Kraft und bedingt weitreichende Än<strong>der</strong>ungen.<br />
Für den Vorstand und den Geschäftsführer<br />
galt es beispielsweise, die<br />
<strong>bis</strong>her in Richtlinien geregelten Zuschüsse<br />
für Zahnersatz und Zahnkronen in eine<br />
Satzungsregelung zu überführen und<br />
<strong>der</strong> Vertreterversammlung zum Beschluss<br />
vorzulegen.<br />
Wie die meisten Kassen beschließen Vorstand<br />
und Vertreterversammlung, künftig<br />
90 % <strong>der</strong> Kosten zu übernehmen und<br />
den Zuschuss bei Interimsprothesen auf<br />
60 % zu begrenzen.<br />
Allerdings erwartet die <strong>BKK</strong> damit eine<br />
Verdoppelung <strong>der</strong> <strong>bis</strong>herigen Ausgaben<br />
für Zahnersatz.<br />
Die Leistungsausweitungen in <strong>der</strong> GKV<br />
erhöhen erheblich die Ausgaben. Gleichzeitig<br />
sinken die Beitragseinnahmen infolge<br />
<strong>der</strong> durch die Ölkrise ausgelösten<br />
Konjunkturprobleme. Die <strong>BKK</strong> erhöht zum<br />
1.1.1976 ihren Beitragssatz <strong>von</strong> 7,0 % auf<br />
8,6 %. Das ist eine erhebliche Steigerung.<br />
Allerdings bleibt dieser Beitragssatz auch<br />
für stolze 6 Jahre stabil.<br />
Mit dem Haushaltsplan 1976 übersteigt<br />
das Volumen <strong>der</strong> <strong>BKK</strong> erstmals die Grenze<br />
<strong>von</strong> 10 Mio. DM. Um die Ausgaben zu<br />
senken, än<strong>der</strong>t die <strong>BKK</strong> im selben Jahr ihre<br />
Satzung und reduziert ihre Zuschüsse<br />
bei Zahnersatz <strong>von</strong> 90 % auf 80 % <strong>der</strong><br />
Kosten.<br />
1977 reagiert die Politik auf die erheblich<br />
gestiegenen Ausgaben mit einem<br />
Kostendämpfungsgesetz. Erstmals werden<br />
Zuzahlungen, insbeson<strong>der</strong>e für<br />
Medikamente eingeführt.
Geschäftsführer und Vorstand sehen in<br />
dem Gesetzesvorhaben eine ernsthafte<br />
Schwächung <strong>der</strong> Selbstverwaltung und<br />
erste Schritte zur Einheitsversicherung.<br />
Sie wenden sich mit ihren Bedenken an<br />
den <strong>BKK</strong> Landesverband. Die Sorgen werden<br />
mit dem Beschluss zur Einheitsversicherung<br />
auf dem 12. ordentlichen IG-<br />
Metall-Gewerkschaftstag bestätigt. Die<br />
<strong>BKK</strong> setzt daraufhin im Geschäftsverkehr<br />
Aufkleber mit dem Text „Gegen Einheitsversicherung<br />
– für Betriebskrankenkassen“<br />
ein.<br />
1979 gründen die Vertreter aller Kassenarten<br />
in Ulm und im Alb-Donau-Kreis eine<br />
Arbeitsgemeinschaft, „zum Zwecke<br />
<strong>der</strong> Koordinierung in gemeinsam berührenden<br />
Vertragsangelegenheiten“. Die<br />
<strong>Wieland</strong> <strong>BKK</strong> tritt <strong>der</strong> Arbeitsgemeinschaft<br />
bei.<br />
Aus dem <strong>bis</strong> Mitte <strong>der</strong> 70er-Jahre vier<br />
Seiten umfassenden Voranschlag ist 1981<br />
ein Haushaltsplan <strong>von</strong> 150 Seiten geworden.<br />
Der Vorstand kritisiert, dass die<br />
Selbstverwaltung durch immer kompliziertere<br />
Vorschriften überfor<strong>der</strong>t und <strong>der</strong><br />
Verwaltung ausgeliefert wird.<br />
Dem ersten Kostendämpfungsgesetz folgen<br />
fast jährlich weitere Maßnahmen, die<br />
zunächst Krankenhaus-Kostendämpfungsgesetz<br />
(1981), Kostendämpfungsergänzungsgesetz<br />
(1981) und dann Haushaltsbegleitgesetze<br />
(1982, 1984) genannt<br />
wurden. Den Leistungsausweitungen vor<br />
10 Jahren folgen nun Beitragserweiterungen.<br />
Betriebsrenten und an<strong>der</strong>e Versorgungsbezüge<br />
werden ebenso beitragspflichtig<br />
wie Krankengeld und an<strong>der</strong>e<br />
Entgeltersatzleistungen. Im Durchschnitt<br />
waren die Beitragssätze 1982 auf den Rekordwert<br />
<strong>von</strong> 12,2 % gestiegen.<br />
1984 feiert die <strong>BKK</strong> ihr 150-jähriges Bestehen.<br />
Der Beitragssatz beträgt 9,2 %.<br />
Die <strong>BKK</strong> versichert 6.200 Mitglie<strong>der</strong><br />
(3.585 Pflichtversicherte, 585 Freiwillige<br />
und 2.030 Rentner).<br />
Im Herbst 1985 zieht die elektronische<br />
Datenverarbeitung in die <strong>BKK</strong> ein. Erstmals<br />
haben die <strong>BKK</strong>-Mitarbeiterinnen<br />
und -Mitarbeiter ein Datensichtgerät und<br />
eine Tastatur auf ihrem Schreibtisch. Die<br />
<strong>BKK</strong> betreibt für sich und acht weitere<br />
Betriebskrankenkassen in Ulm, im Alb-<br />
Donau-Kreis und in Biberach ein eigenes<br />
kleines Rechenzentrum. In den folgenden<br />
15 Monaten werden nach und nach alle<br />
Prozesse neu organisiert und mit Hilfe<br />
<strong>der</strong> Programme abgewickelt. Die 1929<br />
gekaufte Kartex-Kartei hatte ausgedient.<br />
1986 übersteigt <strong>der</strong> Haushalt <strong>der</strong> <strong>BKK</strong><br />
erstmals die Grenze <strong>von</strong> 20 Mio. DM.<br />
1987 überschreitet <strong>der</strong> Beitragssatz erstmals<br />
die Grenze <strong>von</strong> 10 % (10,3 %). Nach<br />
16 Jahren hat er zudem auch die Höhe<br />
vor Einführung <strong>der</strong> Lohnfortzahlung 1970<br />
überschritten.<br />
Zum 1.1.1989 steht ein großes Reformwerk<br />
an. Mit dem Gesundheitsreformgesetz<br />
werden die gesetzlichen Regelungen<br />
<strong>der</strong> Krankenversicherung aus <strong>der</strong> Reichsversicherungsordnung<br />
(RVO) in das fünfte<br />
Sozialgesetzbuch übertragen. Die 1911<br />
geschaffene RVO hat nun <strong>bis</strong> auf wenige<br />
Son<strong>der</strong>regelungen ausgedient.<br />
11
Quelle: <strong>Wieland</strong> <strong>BKK</strong><br />
1989 <strong>bis</strong> <strong>2009</strong><br />
Das Jahr 1988 endet mit einem<br />
Paukenschlag. Am 16.12.1988<br />
stimmt <strong>der</strong> Bundesrat <strong>der</strong><br />
Blüm‘schen Gesundheitsreform<br />
zu. Schon am 19.12.1988 tagt<br />
außerplanmäßig <strong>der</strong> Vorstand<br />
<strong>der</strong> <strong>BKK</strong>, um über eine am<br />
1.1.1989 mit dem Gesundheitsreformgesetz<br />
in Kraft tretende<br />
Option zu beraten.<br />
Geschäftsführer und Vorstand empfehlen<br />
anschließend <strong>der</strong> Vertreterversammlung,<br />
die Beitragsrückzahlung als Modellversuch<br />
über fünf Jahre zu erproben und<br />
die Satzung entsprechend zu än<strong>der</strong>n. Am<br />
Nachmittag desselben Tages tritt die Vertreterversammlung<br />
zusammen und fasst<br />
den notwendigen Beschluss.<br />
Die <strong>Wieland</strong> <strong>BKK</strong> ist damit die erste Krankenkasse<br />
in Deutschland, die ihren Versicherten<br />
erstmals die komplette Transparenz<br />
über die Kosten beanspruchter<br />
Leistungen ermöglicht. Mitglie<strong>der</strong>, die<br />
keine o<strong>der</strong> nur geringfügige Leistungen<br />
in Anspruch nahmen, erhalten zusätzlich<br />
<strong>bis</strong> zu einem Zwölftel ihres Jahresbeitrags<br />
zurückerstattet.<br />
12<br />
Im Juli 1989 wird Friedhelm Greischel auf<br />
eigenen Wunsch <strong>von</strong> seinen Aufgaben als<br />
Vertreter <strong>der</strong> <strong>Wieland</strong>-Werke im Vorstand<br />
und in <strong>der</strong> Vertreterversammlung entbunden.<br />
Er beendet sein Arbeitsleben und<br />
geht in den Ruhestand. 25 Jahre lang war<br />
er in <strong>der</strong> <strong>BKK</strong>-Selbstverwaltung tätig.<br />
Sein Nachfolger wird Dr. Hans Pentz.<br />
Das Gesundheitsreformgesetz entwickelt<br />
seine Wirkung. Das Haushaltsjahr 1989<br />
schließt mit einem Einnahmenüberschuss<br />
<strong>von</strong> rund 1 Mio. DM. Zum 1.9.1990 senkt<br />
die <strong>BKK</strong> ihren Beitragssatz <strong>von</strong> 10 %<br />
auf 9,6 %.<br />
Beitragsrückzahlung – 1990<br />
Im Juli 1990 schließt die <strong>BKK</strong> termingerecht<br />
das erste Erprobungsjahr <strong>der</strong> Beitragsrückzahlung<br />
ab und zahlt an 1.538<br />
Mitglie<strong>der</strong> 305.000 DM aus. Auf den gesetzlichen<br />
Anspruch, diesen Betrag auf<br />
alle Betriebskrankenkassen umzulegen,<br />
verzichtet die <strong>BKK</strong>. Im selben Jahr hat die<br />
<strong>BKK</strong> 6.697 Mitglie<strong>der</strong>.<br />
Ebenfalls im Juli 1990 erstellt die <strong>BKK</strong><br />
erstmals für die <strong>Wieland</strong>-Werke einen betrieblichen<br />
Gesundheitsbericht. Mit ihm<br />
erhält das Unternehmen in komprimierter<br />
Form einen Überblick über die Arbeitsunfähigkeiten<br />
nach Werken, Bereichen<br />
und Abteilungen. Um Verläufe sichtbar<br />
zu machen, wird in den nächsten Jahren<br />
<strong>der</strong> Bericht erneut vorgelegt.<br />
Pflegebedürftigkeit – 1991<br />
Zum 1.1.1991 erweitert <strong>der</strong> Gesetzgeber<br />
den Leistungskatalog <strong>der</strong> Krankenkassen<br />
um Leistungen bei Pflegebedürftigkeit.<br />
Im Herbst 1991 übernimmt <strong>der</strong> Geschäftsführer<br />
Walter Ba<strong>der</strong> auch die Führung<br />
<strong>der</strong> <strong>BKK</strong> Arbeitsgemeinschaft Donau-Ries.<br />
In <strong>der</strong> Arbeitsgemeinschaft<br />
stimmen sich alle Betriebskrankenkassen<br />
in Ulm, dem Alb-Donau-Kreis und dem<br />
Landkreis Biberach untereinan<strong>der</strong> ab.<br />
Im Juni 1992 diskutieren Geschäftsführer<br />
und Vorstand intensiv über die Ausgabensteigerungen<br />
für Krankengeld. Von<br />
1984 <strong>bis</strong> 1991 hat sich dieser Posten verdoppelt.<br />
Ein Grund ist die stetige Zunah-<br />
me <strong>von</strong> Langzeiterkrankungen, insbeson<strong>der</strong>e<br />
bei Muskel- und Skeletterkrankungen.<br />
Dies unterstreicht <strong>der</strong> betriebliche<br />
Gesundheitsbericht <strong>der</strong> <strong>BKK</strong>. Zusätzlich<br />
zu den bereits bestehenden Kursen (Rückenschule<br />
und an<strong>der</strong>e) will <strong>Wieland</strong> nun<br />
gemeinsam mit den Werksärzten stärker<br />
auf eine gesundheitsgerechte Gestaltung<br />
<strong>der</strong> Arbeitsplätze und Arbeitsabläufe<br />
achten.<br />
Zum 1.1.1993 tritt mit dem Gesundheitsstrukturgesetz<br />
die nächste Reform in<br />
Kraft. 11 Mrd. DM sollen gespart werden.<br />
Dies erfolgt durch eine zunächst auf drei<br />
Jahre geplante strikte Ausgabenbudgetierung.<br />
Tatsächlich bleiben die meisten<br />
Budgets sehr viel länger bestehen.<br />
Risikostrukturausgleich – 1994<br />
Maßgeblich wird das Gesundheitsstrukturgesetz<br />
den Kassenwettbewerb verän<strong>der</strong>n.<br />
Ab 1997 sollen alle Versicherten<br />
ihre Krankenkasse wählen können, das<br />
<strong>bis</strong>herige Zuweisungsprinzip entfällt<br />
dann. Schon ab 1994 soll ein einnahmeorientierter<br />
Risikostrukturausgleich für<br />
gleiche Startbedingungen im neuen<br />
Wettbewerb sorgen.<br />
Die Ausgabenentwicklung <strong>bis</strong> zum Jahresende<br />
1992 sorgt auch die <strong>BKK</strong>. Das<br />
Geschäftsjahr schließt mit dem Rekordminus<br />
<strong>von</strong> fast 3,5 Mio. DM. Zum 1.1.1993<br />
muss die <strong>BKK</strong> ihren Beitragssatz <strong>von</strong><br />
9,6 % auf 10,7 % erhöhen.<br />
Der Haushaltsplan für 1994 zeigt die positiven<br />
Wirkungen bei den Ausgaben und<br />
die ersten Folgen des neuen Finanzausgleichs.<br />
In den Risikostrukturausgleich<br />
zahlt die <strong>BKK</strong> 1994 voraussichtlich<br />
2,5 Mio. DM. Zum 1.1.1994 wird deshalb<br />
<strong>der</strong> Beitrag erneut erhöht, auf nun<br />
11,4 %.
1994 besprechen Geschäftsführer und<br />
Vorstand mit dem Vorstand <strong>der</strong> <strong>Wieland</strong>-<br />
Werke die künftige Strategie <strong>der</strong> <strong>BKK</strong>.<br />
Einvernehmlich entscheiden sie, die <strong>BKK</strong><br />
als Nischenkasse in den Wettbewerb zu<br />
führen und nicht für Betriebsfremde zu<br />
öffnen. Diese Entscheidung wird sich in<br />
den folgenden – teilweise turbulenten –<br />
Jahren als richtig erweisen.<br />
Im selben Jahr beginnt die <strong>BKK</strong>, sich intensiv<br />
auf den neuen Kassenwettbewerb<br />
vorzubereiten. Die Aufbauorganisation<br />
wird auf die neuen Erfor<strong>der</strong>nisse ausgerichtet.<br />
Mitarbeiter durchlaufen Trainings<br />
zur Teamentwicklung. Das Erscheinungsbild<br />
<strong>der</strong> <strong>BKK</strong> än<strong>der</strong>t sich.<br />
Gemeinsam mit den an<strong>der</strong>en Ulmer Betriebskrankenkassen<br />
startet die <strong>BKK</strong> eine<br />
Kampagne gegen Drogenmissbrauch<br />
und führt Aktionen im Ulmer ROXY und<br />
beim Vöhringer Stadtfest durch. Außerdem<br />
gibt es mit dem „<strong>BKK</strong>-Gesundheitsdialog“<br />
eine Vortragsreihe im Ulmer<br />
Stadthaus.<br />
Im Sommer zahlt die <strong>BKK</strong> letztmals Beiträge<br />
für nicht o<strong>der</strong> nur geringfügig beanspruchte<br />
Leistungen zurück. Der auf<br />
fünf Jahre angelegte Modellversuch endet.<br />
Die wissenschaftliche Begleitung<br />
wird anschließend feststellen, dass die<br />
erreichte Kostentransparenz sehr wertvoll<br />
ist, <strong>der</strong> Anreiz einer Beitragsrückzahlung<br />
aber offensichtlich kein stärkeres<br />
Kostenbewusstsein <strong>der</strong> Mitglie<strong>der</strong> auslöst.<br />
Pflegeversicherungsgesetz – 1995<br />
Zum 1.1.1995 tritt das Pflegeversicherungsgesetz<br />
in Kraft. Nach langem politischem<br />
Ringen gibt es nun eine fünfte<br />
Säule <strong>der</strong> Sozialversicherung. Die <strong>BKK</strong><br />
muss seither zwei Firmen führen; die Betriebskrankenkasse<br />
und die <strong>BKK</strong>-Pflegekasse.<br />
Das bedeutet jährlich zwei Haushaltspläne<br />
und zwei Jahresrechnungen<br />
und jeweils separate Sitzungen <strong>der</strong><br />
Selbstverwaltung.<br />
Die auf unsicheren Daten beruhende Einführung<br />
des Risikostrukturausgleiches<br />
zeigt ihre Wirkung. 1995 werden die<br />
Rentner einbezogen. Die Zahlungen <strong>der</strong><br />
<strong>BKK</strong> steigen über zunächst 4,2 Mio. DM<br />
auf dann 5 Mio. DM an. 13,4 % <strong>der</strong> Einnahmen<br />
führt die <strong>BKK</strong> in den Topf ab.<br />
Schon zum 1.10.1995 muss sie erneut den<br />
Beitragssatz auf nunmehr 12,2 % anheben.<br />
Die nächste Anpassung erfolgt am<br />
1.5.1996 auf 12,8 %. Eine perspektivische<br />
Finanzplanung ist in diesen Jahren<br />
nicht mehr möglich. 1995 hat die <strong>BKK</strong><br />
6.891 Mitglie<strong>der</strong>.<br />
Zum 1.1.1996 reformiert <strong>der</strong> Gesetzgeber<br />
die Selbstverwaltung <strong>der</strong> Krankenversicherung.<br />
Anstelle des ehrenamtlichen<br />
Vorstands und <strong>der</strong> Vertreterversammlung<br />
gibt es nun einen Verwaltungsrat. Anstelle<br />
des Geschäftsführers gibt es nun einen<br />
hauptamtlichen Vorstand mit weitreichenden<br />
Entscheidungsbefugnissen.<br />
Die durch die Ausgabenbudgetierung erzielten<br />
Effekte verpuffen nach drei Jahren.<br />
Die Bundesregierung reagiert mit einem<br />
Beitragsentlastungsgesetz. Durch<br />
Leistungskürzungen und höhere Zuzahlungen<br />
sollen 7,5 Mrd. DM gespart werden.<br />
Gleichzeitig hebelt die Politik die<br />
Selbstverwaltung aus und schreibt eine<br />
Beitragssatzsenkung um 0,4 Prozentpunkte<br />
vor.<br />
Im Sommer 1996 stirbt völlig überraschend<br />
<strong>der</strong> Vorsitzende des Verwaltungsrats<br />
und Vertreter <strong>der</strong> <strong>Wieland</strong>-Werke,<br />
Dr. Hans Pentz. In seiner kurzen Amtszeit<br />
erlebte er den starken Wandel in <strong>der</strong> gesetzlichen<br />
Krankenversicherung. Sein<br />
Nachfolger wird Dr. Manfred Eisenmann.<br />
<strong>BKK</strong>-Patientenbegleitung – 1998<br />
Am 1.10.1998 startet die <strong>BKK</strong> ein neues<br />
Projekt, das sich heute längst etabliert<br />
hat: die <strong>BKK</strong>-Patientenbegleitung. Damals<br />
hieß sie noch <strong>BKK</strong>-Versichertenberatung<br />
im Krankenhaus. Sie weitet das<br />
Serviceangebot <strong>der</strong> <strong>BKK</strong> erheblich aus.<br />
Seit dieser Zeit steuert Helge Bach Menschen<br />
in schwierigen Lebenssituationen<br />
durch die vielen Möglichkeiten des Gesundheitssystems<br />
und sorgt dafür, dass<br />
die einzelnen Maßnahmen sinnvoll aufeinan<strong>der</strong><br />
abgestimmt sind.<br />
Zum 30.6.2000 scheidet Dr. Manfred Eisenmann<br />
als Vorsitzen<strong>der</strong> und Vertreter<br />
<strong>der</strong> <strong>Wieland</strong>-Werke aus dem Verwaltungsrat<br />
aus. Er beendet sein Arbeitsleben<br />
und geht in den Ruhestand. Sein<br />
Nachfolger wird Horst Kuchenbecker. Die<br />
<strong>BKK</strong> behauptet sich im Kassenwettbewerb.<br />
In den letzten fünf Jahren stieg die<br />
Mitglie<strong>der</strong>zahl kontinuierlich auf nun<br />
7.709.<br />
13<br />
Fotos: Archiv
<strong>2009</strong><br />
Rund 90 % <strong>der</strong> bei <strong>Wieland</strong><br />
Beschäftigten sind inzwischen<br />
bei <strong>der</strong> <strong>BKK</strong>.<br />
Zum 31.12.2001 geht <strong>der</strong> Vorstand <strong>der</strong><br />
<strong>BKK</strong>, Walter Ba<strong>der</strong>, in den Ruhestand. Seit<br />
1968 hat er in <strong>der</strong> <strong>BKK</strong> eine leitende<br />
Position; zunächst als stellvertreten<strong>der</strong><br />
Geschäftsführer, ab 1975 als Geschäftsführer<br />
und ab 1996 als Vorstand. Er hat<br />
34 Jahre <strong>BKK</strong>-Geschichte mitgeprägt.<br />
Sein Nachfolger wird Jürgen Schnei<strong>der</strong>.<br />
Der Risikostrukturausgleich bleibt dauerhaft<br />
ein politisches Handlungsfeld. 2002<br />
werden Personen, die an beson<strong>der</strong>en,<br />
leitlinienorientierten Behandlungsprogrammen<br />
teilnehmen, beson<strong>der</strong>s berücksichtigt.<br />
Für teure Leistungsfälle wird<br />
zusätzlich ein Risikopool eingerichtet.<br />
Die Abrechnung <strong>der</strong> Leistungen im Krankenhaus<br />
wird ab 2003 schrittweise<br />
reformiert. Rechnungserstellung und<br />
-prüfung werden wesentlich komplexer.<br />
Sechzehn Monate verhandelt die <strong>BKK</strong> mit<br />
Ärzten in Vöhringen und Umgebung über<br />
ein Praxisnetz. Damit soll die Versorgung<br />
<strong>der</strong> <strong>BKK</strong>-Versicherten optimiert und die<br />
Honorierung <strong>der</strong> ärztlichen Leistung<br />
verbessert werden. Im Juni 2002 ist <strong>der</strong><br />
Vertrag unterschriftsreif und wird am<br />
Ende doch nicht unterschrieben. Es wird<br />
<strong>bis</strong> zum Jahr <strong>2009</strong> dauern, <strong>bis</strong> ein neuer<br />
Anlauf Erfolg versprechend erscheint.<br />
Die Ruhe bei <strong>der</strong> Finanzplanung und damit<br />
bei den Beitragssätzen ist mit den<br />
weiteren Än<strong>der</strong>ungen im Risikostrukturausgleich<br />
wie<strong>der</strong> vorbei. Zudem verpuffen<br />
die Maßnahmen <strong>der</strong> Gesundheitsreform<br />
2000 bereits wie<strong>der</strong>. Das Vermögen<br />
<strong>der</strong> <strong>BKK</strong> sinkt dramatisch. Mit <strong>der</strong><br />
Jahresrechnung 2003 beträgt es noch<br />
5 % des Sollvermögens. Beitragssatzerhöhungen<br />
sind die Folge.<br />
14<br />
Gesundheitssystem-<br />
Mo<strong>der</strong>nisierungsgesetz – 2004<br />
Mit dem Gesundheitssystem-Mo<strong>der</strong>nisierungsgesetz<br />
2004 plant <strong>der</strong> Gesetzgeber<br />
für 2007 weitreichende Än<strong>der</strong>ungen<br />
beim Risikostrukturausgleich, die<br />
eine weitgehende Angleichung <strong>der</strong> Beitragssätze<br />
erwarten lassen. Wie 1994<br />
bereitet sich die <strong>BKK</strong> intensiv darauf vor<br />
und startet unter dem Titel VISO einen<br />
intensiven Verän<strong>der</strong>ungsprozess.<br />
Am 24.2.2005 stärken über 30 geschlossene<br />
Betriebskrankenkassen ihre politische<br />
Schlagkraft, indem sie eine gemeinsame<br />
Interessenvertretung, den Verein<br />
„<strong>BKK</strong> im Unternehmen e. V.“, gründen. Die<br />
<strong>Wieland</strong> <strong>BKK</strong> ist Gründungsmitglied.<br />
<strong>BKK</strong>-Vorstand Jürgen Schnei<strong>der</strong> wirkt<br />
seither auch im Vorstand des Vereins mit.<br />
In den 4 Jahren hat die Gemeinschaft<br />
bewiesen, dass sie politisch ernsthaft<br />
wahrgenommen wird.<br />
Betrieblichen Gesundheitsför<strong>der</strong>ung<br />
– 2006<br />
Im Herbst 2006 startet die <strong>BKK</strong> in <strong>der</strong><br />
Abteilung Rohrzug Vöhringen unter dem<br />
Titel „Werkbank“ ein Pilotprojekt <strong>der</strong><br />
betrieblichen Gesundheitsför<strong>der</strong>ung.<br />
Erstmals können Mitarbeiterinnen und<br />
Mitarbeiter im Werk – auch während <strong>der</strong><br />
Nachtschicht – unter Anleitung eines<br />
Trainers an Geräten gezielt ihre Bauch-<br />
und Rückenmuskulatur trainieren. Drei<br />
Jahre später ist das Projekt etabliert und<br />
kann <strong>von</strong> allen Abteilungen in Ulm und<br />
Vöhringen genutzt werden.<br />
Einheitsbeitragssatz – <strong>2009</strong><br />
<strong>2009</strong> findet wie<strong>der</strong> einmal eine erhebliche<br />
Zäsur in <strong>der</strong> gesetzlichen Krankenversicherung<br />
statt. Der Gesetzgeber führt<br />
für alle Kassen einen Einheitsbeitragssatz<br />
ein und verwaltet die Gel<strong>der</strong> zentral in<br />
einem Gesundheitsfonds. Die Selbstverwaltung<br />
wird ihrer Finanzhoheit beraubt.<br />
Die Geldzuteilung erfolgt über eine neue<br />
Form des Risikostrukturausgleichs.<br />
Allen Stürmen zum Trotz feiert die<br />
<strong>Wieland</strong> <strong>BKK</strong> im selben Jahr ihr 175-jähriges<br />
Bestehen.
Impressum<br />
Herausgeber: <strong>Wieland</strong> <strong>BKK</strong><br />
Verantwortlich: Jürgen Schnei<strong>der</strong>,<br />
Vorstand<br />
Gestaltung: AGIS Verlag,<br />
Baden-Baden<br />
© 2012 <strong>Wieland</strong> <strong>BKK</strong><br />
15<br />
Fotos: Archiv
Sie können sich auf uns verlassen –<br />
seit über 175 Jahren.<br />
... ganz nah dran!