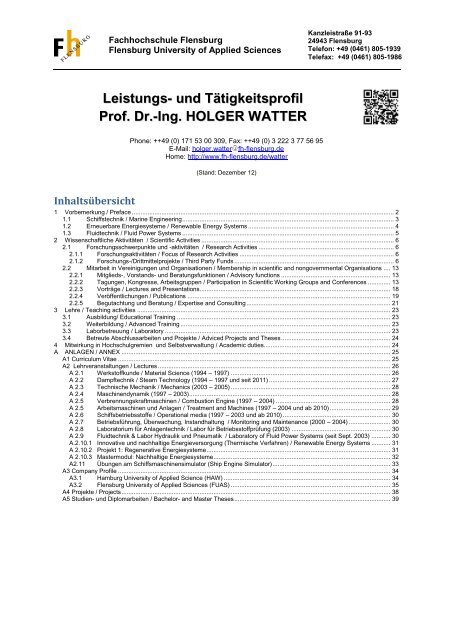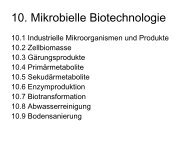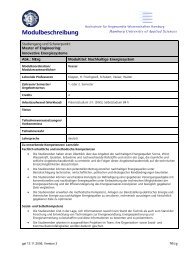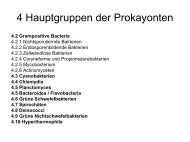Leistungs- und Tätigkeitsprofil Prof. Dr.-Ing. HOLGER WATTER
Leistungs- und Tätigkeitsprofil Prof. Dr.-Ing. HOLGER WATTER
Leistungs- und Tätigkeitsprofil Prof. Dr.-Ing. HOLGER WATTER
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Inhaltsübersicht<br />
Fachhochschule Flensburg<br />
Flensburg University of Applied Sciences<br />
<strong>Leistungs</strong>- <strong>und</strong> <strong>Tätigkeitsprofil</strong><br />
<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>.-<strong>Ing</strong>. <strong>HOLGER</strong> <strong>WATTER</strong><br />
Phone: ++49 (0) 171 53 00 309, Fax: ++49 (0) 3 222 3 77 56 95<br />
E-Mail: holger.watter fh-flensburg.de<br />
Home: http://www.fh-flensburg.de/watter<br />
(Stand: Dezember 12)<br />
Kanzleistraße 91-93<br />
24943 Flensburg<br />
Telefon: +49 (0461) 805-1939<br />
Telefax: +49 (0461) 805-1986<br />
1 Vorbemerkung / Preface ....................................................................................................................................................... 2<br />
1.1 Schiffstechnik / Marine Engineering .......................................................................................................................... 3<br />
1.2 Erneuerbare Energiesysteme / Renewable Energy Systems .................................................................................... 4<br />
1.3 Fluidtechnik / Fluid Power Systems .......................................................................................................................... 5<br />
2 Wissenschaftliche Aktivitäten / Scientific Activities ............................................................................................................... 6<br />
2.1 Forschungsschwerpunkte <strong>und</strong> -aktivitäten / Research Activities .............................................................................. 6<br />
2.1.1 Forschungsaktivitäten / Focus of Research Activities ......................................................................................... 6<br />
2.1.2 Forschungs-/<strong>Dr</strong>ittmittelprojekte / Third Party F<strong>und</strong>s ............................................................................................ 6<br />
2.2 Mitarbeit in Vereinigungen <strong>und</strong> Organisationen / Membership in scientific and nongovernmental Organisations .... 13<br />
2.2.1 Mitglieds-, Vorstands- <strong>und</strong> Beratungsfunktionen / Advisory functions ............................................................... 13<br />
2.2.2 Tagungen, Kongresse, Arbeitsgruppen / Participation in Scientific Working Groups and Conferences ............. 13<br />
2.2.3 Vorträge / Lectures and Presentations.............................................................................................................. 18<br />
2.2.4 Veröffentlichungen / Publications ..................................................................................................................... 19<br />
2.2.5 Begutachtung <strong>und</strong> Beratung / Expertise and Consulting ................................................................................... 21<br />
3 Lehre / Teaching activities .................................................................................................................................................. 23<br />
3.1 Ausbildung/ Educational Training ........................................................................................................................... 23<br />
3.2 Weiterbildung / Advanced Training ......................................................................................................................... 23<br />
3.3 Laborbetreuung / Laboratory .................................................................................................................................. 23<br />
3.4 Betreute Abschlussarbeiten <strong>und</strong> Projekte / Adviced Projects and Theses ............................................................... 24<br />
4 Mitwirkung in Hochschulgremien <strong>und</strong> Selbstverwaltung / Academic duties......................................................................... 24<br />
A ANLAGEN / ANNEX ........................................................................................................................................................... 25<br />
A1 Curriculum Vitae ............................................................................................................................................................. 25<br />
A2 Lehrveranstaltungen / Lectures ...................................................................................................................................... 26<br />
A 2.1 Werkstoffk<strong>und</strong>e / Material Science (1994 – 1997) ............................................................................................ 26<br />
A 2.2 Dampftechnik / Steam Technology (1994 – 1997 <strong>und</strong> seit 2011) ...................................................................... 27<br />
A 2.3 Technische Mechanik / Mechanics (2003 – 2005) ............................................................................................ 28<br />
A 2.4 Maschinendynamik (1997 – 2003) .................................................................................................................... 28<br />
A 2.5 Verbrennungskraftmaschinen / Combustion Engine (1997 – 2004) .................................................................. 28<br />
A 2.5 Arbeitsmaschinen <strong>und</strong> Anlagen / Treatment and Machines (1997 – 2004 <strong>und</strong> ab 2010) ................................... 29<br />
A 2.6 Schiffsbetriebsstoffe / Operational media (1997 – 2003 <strong>und</strong> ab 2010) .............................................................. 30<br />
A 2.7 Betriebsführung, Überwachung, Instandhaltung / Monitoring and Maintenance (2000 – 2004) ........................ 30<br />
A 2.8 Laboratorium für Anlagentechnik / Labor für Betriebsstoffprüfung (2003) ......................................................... 30<br />
A 2.9 Fluidtechnik & Labor Hydraulik <strong>und</strong> Pneumatik / Laboratory of Fluid Power Systems (seit Sept. 2003) ........... 30<br />
A.2.10.1 Innovative <strong>und</strong> nachhaltige Energieversorgung (Thermische Verfahren) / Renewable Energy Systems ........... 31<br />
A 2.10.2 Projekt 1: Regenerative Energiesysteme .......................................................................................................... 31<br />
A 2.10.3 Mastermodul: Nachhaltige Energiesysteme ...................................................................................................... 32<br />
A2.11 Übungen am Schiffsmaschinensimulator (Ship Engine Simulator) .................................................................... 33<br />
A3 Company <strong>Prof</strong>ile ............................................................................................................................................................. 34<br />
A3.1 Hamburg University of Applied Science (HAW) ................................................................................................ 34<br />
A3.2 Flensburg University of Applied Sciences (FUAS) ............................................................................................ 35<br />
A4 Projekte / Projects ........................................................................................................................................................... 38<br />
A5 Studien- <strong>und</strong> Diplomarbeiten / Bachelor- and Master Theses .......................................................................................... 39
<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>.-<strong>Ing</strong>. Holger Watter Flensburg University of Applied Sciences<br />
1 Vorbemerkung / Preface<br />
Das Schiff ist das energieeffizienteste, ökonomischste <strong>und</strong> ökologischste Transportmittel. Die Emissions-<br />
<strong>und</strong> Kostenstrukturen liegen um mehrere Zehnerpotenzen unter den Vergleichswerten anderer<br />
Transportsysteme. Es trägt daher überproportional zum globalen Warenaustausch bei.<br />
� Wir tragen mit unserem Sachverstand zur Weiterentwicklung <strong>und</strong> Verbesserung dieses<br />
Transportsystems in den Bereichen maritime Technologie <strong>und</strong> Forschung bei.<br />
� Wir fühlen uns den Zielen Energieeffizienz, Emissionsminderung <strong>und</strong> umweltfre<strong>und</strong>licher<br />
Schiffsbetrieb verpflichtet.<br />
� Dazu bringen wir unsere technologische <strong>und</strong> wissenschaftliche Expertise in Aus- <strong>und</strong><br />
Weiterbildung sowie Forschung- <strong>und</strong> Entwicklung für die maritime Industrie ein.<br />
� Uns locken neue Herausforderungen <strong>und</strong> Problembeschreibungen. Wir leisten unseren Lösungsbeitrag<br />
über Studien- <strong>und</strong> Diplomarbeiten, bzw. Bachelor- <strong>und</strong> Masterarbeiten<br />
sowie unterstützen im Rahmen unserer Möglichkeiten mit Hilfe unseres Kompetenznetzwerkes.<br />
Dazu bringen wir uns auf unterschiedlichen gesellschaftlichen Ebenen in die Arbeit von<br />
Vereinen <strong>und</strong> Verbänden sowie in Forschungs- <strong>und</strong> Entwicklungsprojekte tatkräftig mit<br />
ein. Wir identifizieren uns mit den Zielen der Verbände …<br />
SAFETY<br />
FIRST<br />
GREENER<br />
OCEANS<br />
NEW<br />
ENERGY<br />
FUTURE<br />
MOBILITY<br />
PRODUCTIVITY<br />
COMPETITION<br />
COMPE-<br />
TENCE<br />
― schaffen wir die technischen Voraussetzungen <strong>und</strong> geeigneten Prozessabläufe für den sicheren<br />
<strong>und</strong> effizienten Betrieb von Schiffen <strong>und</strong> meerestechnischen Anlagen. Wir übernehmen Verantwortung<br />
für die Sicherheit von Menschen <strong>und</strong> Investitionsgütern unter den anspruchsvollen Umgebungsbedingungen<br />
auf Meeren <strong>und</strong> Ozeanen;<br />
― entwickeln wir die erforderlichen Technologien für die Erreichung umwelt- <strong>und</strong> klimapolitischer<br />
Ziele <strong>und</strong> leisten einen maritimen Beitrag zur Umstellung der Verkehrs- <strong>und</strong> Energiewirtschaft<br />
von fossilen auf alternative <strong>und</strong> regenerative Energieträger. Wir übernehmen Verantwortung für<br />
den nachhaltigen Umgang mit der Natur <strong>und</strong> endlichen Ressourcen;<br />
― realisieren wir fortschrittliche Förder- <strong>und</strong> Transportkonzepte für die sichere <strong>und</strong> umweltfre<strong>und</strong>liche<br />
Energie- <strong>und</strong> Rohstoffversorgung Deutschlands aus dem Meer. Wir übernehmen Verantwortung<br />
für die wirtschaftlichen Gr<strong>und</strong>lagen <strong>und</strong> Wachstumspotenziale kommender Generationen;<br />
― zu Energieeffizienz <strong>und</strong> Transportlogistik schaffen wir die technischen Voraussetzungen für die<br />
Verkehrsverlagerung von der Straße auf das Wasser. Wir übernehmen Verantwortung im Kampf<br />
gegen den Verkehrsinfarkt <strong>und</strong> für die Sicherung nachhaltiger Mobilität für die Industrie- <strong>und</strong> Exportnation<br />
Deutschland;<br />
― optimieren wir die Anlagen <strong>und</strong> Prozesse in Schiffbau <strong>und</strong> Schifffahrt sowie Offshore-Technik<br />
<strong>und</strong> erreichen Exzellenz in der Produktion, Betrieb <strong>und</strong> Dienstleistung. Wir entwickeln die technologischen<br />
<strong>und</strong> methodischen Voraussetzungen dafür, dass trotz Lohnkostennachteils Schiffe <strong>und</strong><br />
meerestechnische Anlagen nach dem Stand der Technik wirtschaftlich in Deutschland produziert<br />
<strong>und</strong> betrieben werden können. Wir übernehmen Verantwortung für den Erhalt wettbewerbsfähiger<br />
Arbeitsplätze in Schifffahrt, Schiffbau <strong>und</strong> Meerestechnik;<br />
― <strong>und</strong> durch Aus- <strong>und</strong> Weiterbildung leisten wir einen Beitrag zum Erhalt der Technologieführerschaft<br />
<strong>und</strong> zur Erhöhung der maritimen Kompetenz. Wir übernehmen Verantwortung für den<br />
akademischen Nachwuchs <strong>und</strong> für den Bildungsstandort Deutschland.<br />
2<br />
Quelle: VSM<br />
An der Fachhochschule Flensburg werden anwendungsorientierte maritime Forschungs- <strong>und</strong> Entwicklungsarbeiten<br />
sowie Beratungs- <strong>und</strong> Begutachtungstätigkeiten durchgeführt. Diese Tätigkeiten sind<br />
dialogorientiert <strong>und</strong> durch Netzwerkstrukturen geprägt.<br />
Durch die ausgesprochene Breite der Kompetenzen an der Hochschule können - für eine Vielzahl von<br />
Problemstellungen im Verb<strong>und</strong> mit der maritimen Wirtschaft - ganz spezifische Lösungskonzepte erarbeitet<br />
werden: Nautik <strong>und</strong> Schiffsbetriebstechnik, Umwelt- <strong>und</strong> Verfahrenstechnik, Informations- <strong>und</strong><br />
Kommunikationstechnik, Logistik <strong>und</strong> Umschlagstechnik, Beratung <strong>und</strong> Begutachtung ......<br />
Das nachfolgende <strong>Leistungs</strong>- <strong>und</strong> <strong>Tätigkeitsprofil</strong> soll einen Einblick dazu geben.
<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>.-<strong>Ing</strong>. Holger Watter Flensburg University of Applied Sciences<br />
1.1 Schiffstechnik / Marine Engineering<br />
…. weltweit verfügbar <strong>und</strong> nachgefragt…. mit Beiträgen von <strong>Prof</strong>essoren der FH Flensburg (<strong>Prof</strong>.<br />
Meier-Peter, <strong>Prof</strong>. Boy, <strong>Prof</strong>. Diederichs, Stud.-Dir. Dipl.-Chem. Kehm u.a.) …..<br />
… in deutsch … in englisch … in chinesisch<br />
Mit dem "Handbuch Schiffsbetriebstechnik" schließt der Seehafen Verlag die Lücke, die die beiden<br />
längst vergriffenenStandardwerke "Schiffsmaschinenbetrieb" (Hrsg. Moeck) <strong>und</strong> "Handbuch der<br />
Schiffsbetriebstechnik" (Hrsg. Illies) hinterlassen haben. Auf dem neuesten Stand der Technik beschreibt<br />
das neue "Handbuch Schiffsbetriebstechnik" bewährte technische Lösungen <strong>und</strong> bietet praktische<br />
Hilfestellungen <strong>und</strong> Lösungsansätze zur systematischen Fehlersuche bei Störungen <strong>und</strong> Unregelmäßigkeiten.<br />
After the great success of the German edition now available in English!<br />
According to the German edition this book represents a compilation of marine engineering expeering<br />
experience. It is based on the research of scientists and the reports of many field engineers all over<br />
the world.<br />
This book is mainly directed towards practising marine engineers, principally within the marine<br />
industry, towards ship operators, superintendents and surveyors but also towards those in training and<br />
research institutes as well as designers and consultants.<br />
The book is also available in Chinese!<br />
http://www.schiff<strong>und</strong>hafen.de/buecher-shop/fachbuecher.html<br />
3
<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>.-<strong>Ing</strong>. Holger Watter Flensburg University of Applied Sciences<br />
1.2 Erneuerbare Energiesysteme / Renewable Energy Systems<br />
Autor: Watter, Holger<br />
Regenerative Energiesysteme<br />
Gr<strong>und</strong>lagen, Systemtechnik <strong>und</strong> Anwendungsbeispiele<br />
aus der Praxis<br />
2009. XII, 340 S. Mit 180 Abb. u. 46 Tab. Br.<br />
ISBN: 978-3-8348-0742-7<br />
EUR: 23,90 Buch bestellen<br />
Der Titel befindet sich in der Planung.<br />
(voraussichtl. Erscheinungstermin:<br />
15.01.2009)<br />
Nachhaltige Energiesysteme - kurz <strong>und</strong><br />
prägnant<br />
Erneuerbare Energien <strong>und</strong> nachhaltige Energiesysteme<br />
stehen auf Gr<strong>und</strong> der Klimaveränderung<br />
im Mittelpunkt der gesellschaftlichen<br />
Diskussion. Das Ziel dieses Lehrbuches ist es,<br />
wesentliche Funktionsmechanismen wichtiger<br />
nachhaltiger Energiesysteme darzustellen,<br />
Einflussparameter zu erläutern <strong>und</strong> Potentiale<br />
durch Überschlagsrechnungen aufzuzeigen.<br />
Beispielanlagen aus der Praxis geben zuverlässige<br />
Informationen für die tägliche Arbeit.<br />
Dabei liegt der Schwerpunkt auf kleinen, dezentralen<br />
Anlagen. Übungen mit Lösungen<br />
erleichtern den Zugang zu den verschiedenen<br />
Stoffgebieten.<br />
Aus dem Inhalt<br />
Photovoltaik - Solarthermie - Windenergie - Wasserkraft - Erdwärme <strong>und</strong> Wärmepumpe - Biomasse - Biogas -<br />
Biokraftstoffe - Geothermische Strom- <strong>und</strong> Wärmeerzeugung - Solare Kraftwerke - Kraft-Wärmekopplung mittels<br />
Motoren, Gas- oder Dampfturbinen, Stirling-Motor, Brennstoffzellen u.a. - Wasserstoff als Energieträger - Beispieldaten<br />
- Lösungen<br />
Zielgruppe<br />
Studierende in Bachelor- <strong>und</strong> Masterstudiengängen des Maschinenbaus, der Energie-<br />
<strong>und</strong> Umwelttechnik sowie artverwandter Studiengänge an Fachhochschulen,<br />
Technischen Hochschulen <strong>und</strong> Universitäten mit den Schwerpunkten erneuerbare<br />
Energie, nachhaltige <strong>und</strong> regenerative Energiesysteme<br />
Berater <strong>und</strong> Sachverständige für das Marktsegment<br />
Über den/die Autor(en)<br />
<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>.-<strong>Ing</strong>. Holger Watter lehrt am Fachbereich Maschinenbau der HAW Hamburg<br />
u.a. die Fachgebiete Erneuerbare Energien <strong>und</strong> Nachhaltige Energiesysteme.<br />
http://www.viewegteubner.de/index.php;do=show/sid=9080267974950f9a99b07f702234770/site=v/book_id=17148<br />
4
<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>.-<strong>Ing</strong>. Holger Watter Flensburg University of Applied Sciences<br />
1.3 Fluidtechnik / Fluid Power Systems<br />
Autor: Watter, Holger<br />
Hydraulik <strong>und</strong> Pneumatik<br />
Gr<strong>und</strong>lagen <strong>und</strong> Übungen - Anwendungen<br />
<strong>und</strong> Simulation<br />
2., überarb. Aufl. 2008. XIV, 242 S. Mit<br />
161 Abb. u. 23 Tab. Br.<br />
ISBN: 978-3-8348-0539-3 - Sofort<br />
lieferbar<br />
Lehrbuch<br />
EUR: 23,90 Buch bestellen<br />
Hydraulische <strong>und</strong> pneumatische<br />
Systeme in einem Lehrbuch mit zahlreichen<br />
Übungsbeispielen<br />
Dieses Lehr- <strong>und</strong> Übungsbuch gibt eine<br />
anwendungs- <strong>und</strong> praxisorientierte<br />
Darstellung zu hydraulischen <strong>und</strong><br />
pneumatischen Systemen. Wichtige<br />
Konstruktionselemente <strong>und</strong> deren Regelung<br />
sowie die Darstellung von Simulationsberechnungen<br />
ermöglichen einen<br />
schnellen Überblick über die behandelte<br />
Thematik. Durch zahlreiche Berechnungs-<br />
<strong>und</strong> Übungsbeispiele mit Lösungen<br />
<strong>und</strong> ergänzenden Hinweisen ist das<br />
Buch sehr gut für das Selbststudium<br />
geeignet. Die zweite Auflage wurde bei<br />
den Abbildungen vollständig überarbeitet<br />
<strong>und</strong> im Bereich Blendengleichung<br />
ausführlicher <strong>und</strong> verständlicher gestaltet.<br />
Aus dem Inhalt<br />
Physikalisch-chemische Eigenschaften der <strong>Dr</strong>uckflüssigkeiten - <strong>Dr</strong>uckflüssigkeitsarten - Biologisch abbaubare<br />
Hydraulikflüssigkeiten - <strong>Dr</strong>uckluft - Gr<strong>und</strong>lagen der Fluidmechanik - Komponenten<br />
<strong>und</strong> Bauteile - Steuern, Regeln, Simulieren - Anhang mit Lösungen<br />
Zielgruppe<br />
Studierende des Maschinenbaus, der Mechatronik <strong>und</strong> artverwandter Fachbereiche<br />
an Fachhochschulen <strong>und</strong> Technischen Universitäten in Diplom- <strong>und</strong><br />
Bachelor-/Masterstudiengängen <strong>Ing</strong>enieure <strong>und</strong> Techniker in der Praxis.<br />
Über den/die Autor(en)<br />
<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>.-<strong>Ing</strong>. Holger Watter lehrt am Fachbereich Maschinenbau der HAW<br />
Hamburg u.a. die Fachgebiete Hydraulik <strong>und</strong> Pneumatik.<br />
http://www.viewegteubner.de/index.php;do=show/sid=13182746584950f81a2b723033415186/site=v/book_id=16956<br />
5
<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>.-<strong>Ing</strong>. Holger Watter Flensburg University of Applied Sciences<br />
2 Wissenschaftliche Aktivitäten / Scientific Activities<br />
2.1 Forschungsschwerpunkte <strong>und</strong> -aktivitäten / Research Activities<br />
2.1.1 Forschungsaktivitäten / Focus of Research Activities<br />
� Evaluationen zum Stand der Technik in der Schiffstechnik,<br />
� Nachhaltige Energiesysteme <strong>und</strong> Energieeffizienz (Mitglied der Steuerungsgruppe<br />
CC4E – Kompetenzzentrum für Erneuerbare Energien, Energieeffizienz an der HAW Hamburg:<br />
http://www.haw-hamburg.de/cc4e.html, Mitglied des Forschungsschwerpunktes<br />
(FSP) 'Hochtemperaturbrennstoffzellen <strong>und</strong> rationelle Energieverwendung' am Fachbereich<br />
Maschinenbau <strong>und</strong> Produktion (M&P), Lehrveranstaltungen Nachhaltige Energiesysteme,<br />
Erneuerbare Energiesysteme, Regenerative Energiesysteme (vgl. Buchveröffentlichung<br />
zum Thema bei Vieweg-Verlag)<br />
� Optimierung dynamischer Prozesse in der Fluidtechnik (vgl. Buchveröffentlichung zum<br />
Thema bei Vieweg-Verlag)<br />
2.1.2 Forschungs-/<strong>Dr</strong>ittmittelprojekte / Third Party F<strong>und</strong>s<br />
� EU-Projekt: LLINCWA (loss/lost lubrication in coastal and inland water activities):<br />
In der B<strong>und</strong>esrepublik werden jährlich 1,2 Millionen Tonnen Mineralöl als Industrieschmierstoff,<br />
Hydrauliköl, Motoröl oder Kühlschmierstoff etc. eingesetzt. Hiervon gelangen<br />
mehr als 500.000 Tonnen in die Umwelt <strong>und</strong> gefährden Boden <strong>und</strong> Gewässer. Vor diesem<br />
Hintergr<strong>und</strong> wird auch vom Gesetzgeber der Einsatz biologisch schnell abbaubarer,<br />
ökotoxologisch unbedenklicher Öle gewünscht <strong>und</strong> gefördert.<br />
Im Technologietransferprojekt LLINCWA kooperieren 9 Partner aus 5 europäischen Ländern<br />
(Hochschulen, Forschungseinrichtungen, Schmieröllieferanten, Anlagenbetreiber). In<br />
den Partnerländern (Niederlande, Belgien, Frankreich, Deutschland, Spanien) wird in der<br />
Zeit vom 1. Februar 2000 bis zum 31. Januar 2003 eine umfassende Kampagne zur Verringerung<br />
von Gewässerverschmutzungen durch Mineralölprodukte mit dem Ziel durchgeführt,<br />
den Ersatz von Mineralöl durch biologisch abbaubare, nicht-toxische Produkte zu<br />
forcieren.<br />
Mehr Informationen via:<br />
http://www.llincwa.org <strong>und</strong><br />
http://www.haw-hamburg.de/~watter/llincwa_web/index.html<br />
6
<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>.-<strong>Ing</strong>. Holger Watter Flensburg University of Applied Sciences<br />
Lubricating agents are used on a very large scale, both on land and in water. The high<br />
consumption volume contributes significantly to the diffuse contamination of both soil and<br />
surface water. The Lubrication in Inland and Coastal Water Activities (LLINCWA) project is<br />
focused on prevention and diminishing pollution of the environmental compartment with<br />
the highest hazard potential, surface water. LLINCWA is a technology transfer project<br />
sponsored by the European DG Enterprise within the framework of the EU 5th innovation<br />
framework program. The general objectives of the LLINCWA project are: reduction of diffuse<br />
water pollution with lubricants and greases, increased use of non-toxic biodegradable<br />
lubricants, and protection of sweet water reserves. To achieve these goals important<br />
changes in the lubricant market have to be initiated. The following substitution oriented objectives<br />
are formulated. Increase of the number of users to add to the critical mass needed<br />
for market acceptance of bio-lubricants, stimulation of self-organizing and self-regulating<br />
processes on the lubricant market and increasing the transparency of the lubricant market<br />
and environmental methodologies.<br />
� BMBF/AIF-Antrag: Entwicklung <strong>und</strong> Systemintegration von hocheffizienten Gasturbinen-Brennstoffzellen-Kombianlagen<br />
(SOFC-GT) an Bord von Schiffen (beantragt<br />
zusammen mit <strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>. Winkler vom Fb M+P - Forschungsschwerpunkt 'Brennstoffzellen',<br />
Laufzeit: Sept. 2002 bis Feb. 2004).<br />
Brennstoffzellensysteme haben die<br />
Phase der Laborüberprüfungen absolviert<br />
<strong>und</strong> werden in Feldversuchen auf<br />
Ihre Praxistauglichkeit untersucht. Die<br />
größten Potentiale bezüglich Emissionsminderung<br />
<strong>und</strong> Wirkungsgrad bieten<br />
dabei die oxidkeramischen Brennstoffzellensysteme<br />
in Verbindung mit<br />
Gasturbinen (SOFC-GT). Ziel des Vorhabens<br />
ist die Systemintegration dieser<br />
hocheffizienten Systeme für maritime<br />
Anwendungen (Logistik, Brennstoffaufbereitung,<br />
Hilfssysteme,<br />
Sicherheitstechnik, besondere Betriebsbedingungen<br />
wie<br />
Seegangsbeschleunigungen, Inselbetrieb,<br />
internationale Vorschriften wie<br />
SOLAS etc.). Dazu soll die Übertragbarkeit<br />
der Erfahrungen mit mobilen<br />
<strong>und</strong> stationären Anlagen im Landbereich<br />
auf maritime Systeme evaluiert<br />
werden. Es wird eine konkrete Machbarkeitsstudie<br />
mit Spezifikationsempfehlungen<br />
vorgelegt. Mögliche Umsetzungsstrategien<br />
der Machbarkeitsstudie<br />
werden mit der Industrie vor Ort<br />
gemeinsam erarbeitet. Die Belange der<br />
Praxis sowie der Technologietransfer sollen zusammen mit mittelständischen <strong>und</strong> industriellen<br />
Partnern in Form eines Netzwerkes sichergestellt werden.<br />
http://www.haw-hamburg.de/m/forschung/brennstoffzellen/index.html<br />
The implementation of mobile fuel cell systems (FC) in automotive and submarine applications<br />
has this technology taken in a public focus. The proton conducting Polymer Electrolyte<br />
Membrane Fuel Cell (Proton Exchange Membrane - PEM) needs a hydrogenous fuel<br />
gas and has a low efficiency due to the temperature level of 80 °C. The oxygen conducting<br />
Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) with a high temperature level of about 1000°C allows<br />
easily a internal reforming process of natural gas or other commercial fuels. In combination<br />
with an exhaust gas turbine is an efficiency up to 80 % predicted (SOFC-GT). The<br />
US-Department of Energy and Siemens Westinghouse announced that a 220 kW-Version<br />
of this 'hybrid'-type of fuel cell power plant has been built and begin its test installation with<br />
an electrical efficiency of 57 %. International there are other similar power plants planned.<br />
For maritime installations the discussion about the 'All Electric Ship'-Concept is a driver for<br />
7
<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>.-<strong>Ing</strong>. Holger Watter Flensburg University of Applied Sciences<br />
fuel cell systems on board of ships. The proposal talks about actual developments and options<br />
for maritime applications.<br />
� AIF/BMBF-Antrag: Entwicklung <strong>und</strong> Systemintegration eines innovativen Zugdrachenkonzeptes<br />
zur Reduzierung von Kraftstoffverbrauch <strong>und</strong> Emissionen (SkySail),<br />
vgl. www.skysails.info , Laufzeit: Sept. 2003 bis Feb. 2005:<br />
Ziel dieses Vorhabens ist die Entwicklung<br />
<strong>und</strong> Systemintegration eines innovativen<br />
Zugdrachenkonzeptes zur Reduzierung von<br />
Kraftstoffverbrauch <strong>und</strong> Kraftstoffemissionen<br />
(SkySail). Das Vorhaben greift dabei<br />
zurück auf eine Patentanmeldung der Firma<br />
SkySail, dem sowohl von industriellen als<br />
auch von wissenschaftlichen Einrichtungen<br />
erhebliche Potentiale bescheinigt wurden.<br />
Hierbei sind jedoch stets nur Ausschnitte<br />
betrachtet worden. Eine umfassende, ganzheitliche<br />
Betrachtung <strong>und</strong> eine prof<strong>und</strong>e<br />
seemännische, nautische <strong>und</strong> technische<br />
Bewertung steht jedoch z.Zt. noch aus.<br />
Durch das Vorhaben sollen diese Lücken<br />
geschlossen werden <strong>und</strong> die aussichtsreiche,<br />
innovative Idee zur Marktreife gebracht<br />
werden. Dabei bildet der automatisierte Betrieb<br />
einen besonderen Schwerpunkt. Es<br />
sind Vorschläge für das vollautomatische<br />
Setzen <strong>und</strong> Bergen der Segel zu erarbeiten<br />
<strong>und</strong> das Systemverhalten für eine gesteuerte,<br />
optimierte Bahnführung des Schiffes regelungstechnisch<br />
zu beschreiben.<br />
The SkySails system consists of a towing kite filled with compressed air, an autopilot and<br />
wind-optimised route management. For the first time SkySails utilises wind energy as a<br />
strong and reliable propulsion power. Using this new form of energy intelligently combines<br />
hardware and software technology with an eye to the requirements of modern shipping.<br />
Almost every merchant and passenger vessel can be equipped or retrofitted with the Sky-<br />
Sails system. The propulsion system is protected world wide by two patents, which can be<br />
viewed <strong>und</strong>er the publication codes WO0192102 and 01/081691330 DE. An application<br />
for provisional examination has been made (PCT /DE / 01/02124 “Windangetriebenes<br />
Wasserfahrzeug”); the nationalisation phase has started.<br />
� Projektskizze ELCH (E-Learning-Consortium Hamburg, Sonderprogramm 'Projektförderung<br />
E-Learning <strong>und</strong> Multimedia'): Qualifizierungsoffensive für nautisches <strong>und</strong> technisches<br />
Führungspersonal auf Seeschiffen' (2002), http://www.e-learning-hamburg.de/ .<br />
� Integrated EU-Project “EuroEcolubes - Development of high performance EuroEcolubes<br />
for their extended use”: Expression of Interest (EoI), <strong>Dr</strong>aft Proposal, Collaboration Agreement<br />
(6 th framework program, 2003).<br />
� Mitarbeit am Project-Proposal: Eco-Antifoul (2003), i.V. mit www.chalex.co.uk<br />
� Mitarbeit am Project-Proposal: INNOHYP (2003), i.V. mit http://www.luerssen.de<br />
� Mitarbeit am Project-Proposal MARSIS (2006) i.V. mit http://www.elbitsystems.com/<br />
� Mitarbeit am Project-Proposal TRANSPORT SYSTEM SCENARIOS (2010) zum Call FP7-<br />
TPT-2012-RTD-1.<br />
8
<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>.-<strong>Ing</strong>. Holger Watter Flensburg University of Applied Sciences<br />
� HuP DYN: Dynamisches Verhalten von hydraulischen <strong>und</strong> pneumatischen Systemen<br />
in der Transportwirtschaft (Schiffe, Flugzeug, mobile Arbeits- <strong>und</strong> Antriebsmaschinen)<br />
– HAW internes Projekt gem. Ziff. 4.2 Richtlinie für angewandte Forschung <strong>und</strong><br />
Entwicklung an der HAW Hamburg, v. 27.05.04, gefördert gem. Fachbereichsratsbeschluss<br />
v. 26.05.05 für WS 2005/2006 bis SS 2008).<br />
In hydraulischen <strong>und</strong> pneumatischen Systemen kann es durch dynamische Zusatzbelastungen<br />
zu beträchtlichen <strong>Dr</strong>uckschwankungen (auch i.V. mit Resonanzen) kommen. Dadurch<br />
ergeben sich teilweise nur schwer vorhersagbare Betriebszustände, Beschädigungen<br />
<strong>und</strong>/oder nicht geplantes Systemverhalten. Die Problematik ist insbesondere bei mobilen<br />
Systemen der Transportwirtschaft interessant (Schiffe, Flugzeug, mobile Arbeits-<br />
<strong>und</strong> Antriebsmaschinen). Diese dynamischen <strong>Dr</strong>uckschwankungen ergeben sich aus der<br />
Kombination von Trägheitswirkungen (Induktivität L) <strong>und</strong> Kompressibilität des Mediums<br />
(Kapazität C). Die Erfahrungen zeigen, dass diese Eigenschaften bei <strong>Ing</strong>enieurabsolventen<br />
weitgehend unbekannt sind. In der „normalen Strömungslehre“ werden Flüssigkeiten<br />
als inkompressible Medien behandelt. Dabei stellt das Öl tatsächlich i.A. eine Steifigkeitsschwachstelle<br />
dar (es wirkt wie eine Feder). Die o.g. Aufgabenstellung soll durch klassische<br />
Berechnungsverfahren (Energiemethode), praktische Versuche <strong>und</strong> Simulationsrechnungen<br />
analysiert werden. Die Qualität der verschiedenen Verfahren soll verglichen<br />
<strong>und</strong> die Brauchbarkeit evaluiert werden. Wirkzusammenhänge <strong>und</strong> Optimierungspotentiale<br />
werden untersucht <strong>und</strong> dargestellt. Die Ergebnisse werden publiziert in:<br />
Watter, Holger:<br />
Hydraulik <strong>und</strong> Pneumatik: Gr<strong>und</strong>lagen + Übungen, Anwendungen + Simulation (Einführung - Betriebsstoffe<br />
- Fluidmechanik - Konstruktionselemente - Steuerung, Regelung - Bussysteme - Simulationsrechnung),<br />
Vieweg-Verlag, Wiesbaden, 08/2007, ISBN 3-8348-0190-9, 248 Seiten.<br />
F � m�<br />
�x<br />
� � �p<br />
� A<br />
QA D<br />
� A �c<br />
� � � A(<br />
s)<br />
�<br />
ohne Federn<br />
9<br />
2�<br />
�p<br />
�<br />
� Optimierung hydraulischer <strong>und</strong> pneumatischer Linearantriebe (HAW internes Projekt<br />
gem. Ziff. 4.2 Richtlinie für angewandte Forschung <strong>und</strong> Entwicklung an der HAW Hamburg,<br />
v. 27.05.04 aus Labormitteln, Projektbeauftragter: Dipl.-<strong>Ing</strong>. Siegfried Prust):<br />
Linearantrieb übernehmen in der Mobilhydraulik sowie in der Automatisierungs- <strong>und</strong> Produktionstechnik<br />
die Aufgabe, Massen axial zu verschieben. Diese Aufgabe wird mit hoher<br />
Präzision <strong>und</strong> geringen <strong>Leistungs</strong>dichte durchgeführt. Ziel dieses Vorhabens ist es Optimierungspotential<br />
herauszuarbeiten, umzusetzen <strong>und</strong> zu erproben. Dazu stehen im Labor<br />
ein hydraulischer <strong>und</strong> ein pneumatischer Versuchsstand mit entsprechenden Mess-,<br />
Steuer- <strong>und</strong> Regeleinrichtungen zu Verfügung. Nachfolgenden Arbeitspakete geplant: Erfassung<br />
des Status Quo <strong>und</strong> Durchführung einer Marktanalyse zum Stand der Technik<br />
<strong>und</strong> des Wissens (Produkt- <strong>und</strong> Marktbeobachtung); Analyse der Optimierungspotentiale<br />
zur Fluidtechnik sowie der Mess-, Steuer- <strong>und</strong> Regeleinrichtungen; praktische Umsetzung<br />
im Versuchsfeld; Transfer der Ergebnisse in die Lehre <strong>und</strong> die Industrie.
<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>.-<strong>Ing</strong>. Holger Watter Flensburg University of Applied Sciences<br />
� 2009-2010: Lernmodul „Solarthermische Anlagen“ für die Akademie für Erneuerbare<br />
Energien in Lüchow - https://lernportal.akademie-ee.de/. Erstellung eines Lernmoduls in<br />
MOODLE in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Technologiegestützte Bildung (ZTB)<br />
der Helmut-Schmidt-Universität (www.hsu-hh.de/teletutor). MOODLE ist eine Software für<br />
Online-Lernplattformen. Sie arbeiten in Kursräumen mit den Teilnehmer/innen zusammen.<br />
Dort stehen Lerninhalte, Kommunikations, Kooperations-<strong>und</strong> Prüfungswerkzeuge zur Verfügung.<br />
Besonders stark ist Moodle in der Förderung der Kooperation. Die Erarbeitung<br />
von Lerninhalten in der Gruppe verbessert das Lernergebnis. Moodle eignet sich daher<br />
auch für die Projektgruppenarbeit, als Knowledgebase <strong>und</strong> für den Mitarbeiter- <strong>und</strong> K<strong>und</strong>ensupport<br />
� www.moodle.de<br />
� 2009 – 2010 Entwicklung <strong>und</strong> Umsetzung eines Technikumkonzeptes für Nachhaltige<br />
Energiesysteme an der Fakultät Technik <strong>und</strong> Informatik (B<strong>und</strong>esministerium für<br />
Wirtschaft im Rahmen des Konjunkturprogramms II):<br />
10
<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>.-<strong>Ing</strong>. Holger Watter Flensburg University of Applied Sciences<br />
� Nationales Innovationsprogramm Wasserstoff- <strong>und</strong> Brennstoffzellentechnologie<br />
(NIP): Brennstoffzellen im maritimen Einsatz - E4Ship: www.e4ships.de (2010 bis<br />
2016):<br />
Ziel des bis 2016 laufenden Projekts ist es, die Funktionsfähigkeit von Brennstoffzellen in<br />
der Bordenergieversorgung von Schiffen unter Alltagsbedingungen nachzuweisen. Gegenüber<br />
herkömmlichen Schiffsaggregaten können Brennstoffzellen wesentlich zur Reduktion<br />
von Emissionen beitragen. Die Schadstoffe zu reduzieren, ist eine dringliche Anforderung<br />
an Reedereien, da in immer mehr Häfen strenge Umweltverordnungen gelten,<br />
die Emissionsobergrenzen vorschreiben (sogenannte ECA-Zonen). In e4ships kommen<br />
sowohl Hochtemperatur-Brennstoffzellen mit Schmelzkarbonattechnik, als auch Niedertemperatur-Brennstoffzellen<br />
mit PEM-Technologie (PEM = Proton Exchange Membrane)<br />
zum Einsatz. Die Herausforderungen im Projekt bestehen in der technischen Systemintegration<br />
in verschiedene Schiffstypen <strong>und</strong> der Ableitung einheitlicher technischer Standards.<br />
� Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG-GZ: INST 891/5-1 LAGG, 2011):<br />
Instruktorlose Schiffsmaschinensimulation: Beschaffung einer instruktorlosen<br />
Schiffsmaschinensimulation für den Lehr- <strong>und</strong> Lernbetrieb sowie die Forschungsaktivitäten<br />
am Maritimen Zentrum der FH Flensburg: Nationale <strong>und</strong> internationale Vorschriften<br />
schreiben den Simulatorbetrieb im Rahmen der Schiffsoffizierausbildung verbindlich vor.<br />
Die bisherigen Kapazitäten der FH reichen für einen qualitativ <strong>und</strong> quantitativen Lehrbetrieb<br />
nicht mehr aus. Es ist daher geplant das bestehende Modell auf mindestens 10 Studierendenarbeitsplätze<br />
zu erweitern. Die Forschungsaktivitäten beziehen sich auf den<br />
Energieeffizienten <strong>und</strong> ressourcenschonenden Schiffsbetrieb. Es sind daher komplexe,<br />
frei parametrisierbare Modelle erforderlich, mit dem die bestehenden Verfahren verbessert<br />
oder neue Verfahren erprobt werden können. In Verbindung mit dem Zentrum für wissenschaftliche<br />
Weiterbildung (ZWW) <strong>und</strong> Lehrstuhl für gewerblich-technische Wissenschaften<br />
der Bergischen Universität Wupperal sollen neue Lehr- <strong>und</strong> Lernverfahren erprobt <strong>und</strong> erarbeitet<br />
werden.<br />
11
<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>.-<strong>Ing</strong>. Holger Watter Flensburg University of Applied Sciences<br />
� Ballastwasserbehandlung<br />
Förderwettbewerb Ballastwassermanagementsystem<br />
des Ministerium<br />
für Wissenschaft, Wirtschaft <strong>und</strong><br />
Verkehr des Landes Schleswig-<br />
Holstein sowie der Wirtschaftsförderung<br />
<strong>und</strong> Technologietransfer<br />
Schleswig-Holstein GmbH: Ziel dieses<br />
Förderwettbewerbes ist die Entwicklung eines für eine Zertifizierung bereiten Ballastwassermanagementsystems,<br />
bei dem die Wertschöpfung überwiegend in Schleswig-<br />
Holstein erzielt wird <strong>und</strong> die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen <strong>und</strong> Wissenschaft<br />
gestärkt wird. Dabei soll das System den Kriterien der Internationalen Schifffahrtsorganisation<br />
(IMO) entsprechen: Sicherheit für das Schiff <strong>und</strong> die Besatzung,<br />
geringst mögliche Beeinträchtigung der Umwelt, einfache Bedienbarkeitdes Systems,<br />
Wirtschaftlichkeit. In Deutschland ist das B<strong>und</strong>esamt für Seeschifffahrt <strong>und</strong> Hydrographie<br />
(BSH) für die Zulassung von Ballastwasserbehandlungsanlagen zuständig (Förderung aus<br />
dem Zukunftsprogramm Wirtschaft mit Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung<br />
(EFRE) <strong>und</strong> Landesmitteln nach Maßgabe der FET-Richtlinie).<br />
12
<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>.-<strong>Ing</strong>. Holger Watter Flensburg University of Applied Sciences<br />
2.2 Mitarbeit in Vereinigungen <strong>und</strong> Organisationen / Membership in scientific<br />
and nongovernmental Organisations<br />
2.2.1 Mitglieds-, Vorstands- <strong>und</strong> Beratungsfunktionen / Advisory functions<br />
� Mitglied des Fachausschusses Maschinenbau im Technischen Beirat<br />
des GL (seit 2012): www.gl-group.com<br />
� Mitglied in den Fachausschüssen 'Schiffsmaschinen' sowie 'Messtechnik<br />
<strong>und</strong> Automation' der Schiffbautechnischen Gesellschaft STG<br />
(Gründungsmitglied der Arbeitsgruppe / des Fachausschusses 'Lüftung,<br />
Klima, Kälte' der STG), http://www.stg-online.de/ (seit 1997), seit<br />
2005 stellv. Leiter des Fachausschuss Schiffsmaschinen<br />
� Vorstandsmitglied im Verein der Schiffs-<strong>Ing</strong>enieure zu Hamburg VSIH,<br />
http://www.schiffsingenieure.de/ (1998-2011)<br />
� Stellv. Sprecher <strong>und</strong> Mitglied des Verwaltungsausschusses der Vereinigung<br />
Deutscher Schiffsingenieure VDSI (seit 2001)<br />
� Mitglied im Ständigen Fachausschuss des Deutschen Nautischen<br />
Vereins (StFA DNV) für die VDSI <strong>und</strong> STG (seit 2004)<br />
� Normenstelle Schiffs- <strong>und</strong> Meerestechnik (NSMT) im DIN, Hamburg<br />
(seit 2004), www.nsmt.din.de, seit 2006 Obmann des Arbeitsausschusses<br />
NA 132-02-01 AA <strong>Leistungs</strong>erzeugung, Vortrieb <strong>und</strong> Hilfsmaschinen,<br />
seit 2009 Stellv. Fachbereichsleiter NA 132-02 FBR<br />
Schiffsmaschinenbau.<br />
2.2.2 Tagungen, Kongresse, Arbeitsgruppen / Participation in Scientific Working<br />
Groups and Conferences<br />
2006<br />
18.01.06 Chemical Carrier Seminar, DNV Hamburg<br />
30.01.06 Messebeirat SMM 2006<br />
15.02.06 STG-Reedereisprechtag “Aktuelle Probleme des Schiffsbetriebes”<br />
28.02.06 Unterausschuss „Haupt- <strong>und</strong> Hilfsantriebe“ DIN NMST<br />
8./9.03.06 International Co-Operation on Marine Engineering Systems ICMES / World Maritime<br />
Technology Conference WMTC www.wmtc2006.com, London<br />
10.05.06 Fachausschuss “Schiffsmaschinen”<br />
16.05.06 Fachausschuss „Messtechnik <strong>und</strong> Automation“<br />
18.05.06 Sprechtag / Fachtagung „Schiff <strong>und</strong> Umwelt“, Potsdam<br />
30.05.06 Perspektiven der IMO-Vorschriftenentwicklung <strong>und</strong> korrespondierende Innovationsfähigkeit<br />
der Schiffbauindustrie, VSM / CMT, Hamburg<br />
20.06.06 DIN – Normenstelle für Schiffs- <strong>und</strong> Meerestechnik (NSMT), NA 312-02-01 AA<br />
<strong>Leistungs</strong>erzeugung, Vortrieb, Hilfsmaschinen<br />
23.06.09 Informationstagung des Instituts für Schiffsbetriebsforschung (ISF)<br />
29.06.06 Techn.-Wissenschaftlicher Beirat (TWB) der STG,<br />
08.09.06 Inbetriebnahme, Betrieb <strong>und</strong> Instandhaltung hydr. Anlagen, BOSCH REXROTH<br />
Service Center Hamburg.<br />
25.09.06 VDMA-Mitgliederversammlung, Hamburg.<br />
28.09.06 CIMAC-Kongress, Hamburg<br />
31.10.06 Fachbereichsrat „Schiffsmaschinenbau“ in NSMT DIN, Firma LÜRSSEN, Bremen<br />
21.11.06 Workshop der Gesellschaft für Maritime Technologie GMT, Hamburg<br />
22.11.06 Fachausschuss Messtechnik <strong>und</strong> Automation sowie Schiffsmaschinen, Hamburg<br />
28.11.06 DIN-Ausschusses NA 132-02-01 <strong>Leistungs</strong>erzeugung, Vortrieb <strong>und</strong> Hilfsmaschinen,<br />
04.12.06 Starterkonferenz zum 7. EU-Forschungsrahmenprogramm, Hamburg<br />
06.12.06 2. Statustagung „Maritime Forschung <strong>und</strong> Entwicklung in Europa“, CMT, VSM,<br />
VDMA<br />
13
<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>.-<strong>Ing</strong>. Holger Watter Flensburg University of Applied Sciences<br />
2007<br />
2008<br />
31.01.07 Informationsveranstaltung zum 7. EU-Rahmenprogr. (VSM, VDMA, CMT, GMT)<br />
07.02.07 Kolloquium Maschinenbau <strong>und</strong> Produktion, Getriebebau Nord, VDMA<br />
08.02.07 Fachtagung Logisitik<br />
20.02.07 Fachausschuss „Lüftung, Klima, Kälte“, Meyer-Werft, Papenburg<br />
07.03.07 Arbeitskreis Ballastwassersysteme im DIN NSMT<br />
22.03.07 STG-Sprechtag „Energieeinsparung im Schiffsbetrieb“, Hamburg<br />
02.05.07 Normenstelle Schiffs- <strong>und</strong> Meerestechnik: Arbeitskreis Ballastwasser<br />
10.05.07 Fachausschuss „Schiffsmaschinen“, Emden<br />
17.05.07 Delegiertenvers. Vereinigung Deutscher Schiffsingenieure VDSI, Flensburg<br />
05.06.07 Normenstelle Schiffs- <strong>und</strong> Meerestechnik: <strong>Leistungs</strong>erzeugung <strong>und</strong> Vortrieb<br />
06.06.07 Ständiger Fachausschuss des Deutschen Nautischen Vereins anlässlich des 32.<br />
Deutschen Seeschifffahrtstages im Emden<br />
08.06.07 Informationstagung des Instituts für Schiffsbetriebsforschung, Flensburg<br />
20.06.07 Kolloquium Maschinenbau, Lufthansa Technik, Hamburg<br />
21.06.07 Praxisseminar „Klimawandel im Maschinenraum“, Alfa Laval, Hamburg<br />
25./26.07.07 Praxisseminar Hydraulik, Bosch Rexroth AG<br />
06.09.07 Arbeitskreis Ballastwasserbehandlungsanlagen DIN NSMT<br />
11.09.07 Arbeitskreis „Ausbildung“ in DNV, Verband Deutscher Reeder, Hamburg<br />
13.09.07 Internationaler Congress for Ship Technology ICST 2007, CCH, Hamburg<br />
18.09.07 Fachausschuss „Lüftung, Klima, Kälte“, ImTech, Hamburg<br />
19.09.07 STG-Sprechtag „Elektr. Ausrüstung <strong>und</strong> techn. Sicherheit“, TUHH, Hamburg<br />
21.09.07 Seeverkehrsbeirat des B<strong>und</strong>esverkehrsministeriums, VDSI, Strals<strong>und</strong>,<br />
27.09.07 Techn.-Wissenschaftlicher Beirat der STG, GL Hamburg<br />
10.10.07 Arbeitskreis Fachausschuss „Messtechnik <strong>und</strong> Automation“<br />
21.10.07 Fachausschuss „Schiffsmaschinen“, Berlin<br />
30.10.07 Normenausschuss „Schiffsmaschinen“ im DIN NSMT<br />
31.10.07 Stud.-Sprechtag STG, TUHH<br />
27.11.07 Normenausschuss „<strong>Leistungs</strong>übertragung <strong>und</strong> Vortrieb“, Waren/Müritz<br />
11.12.07 Verwaltungsausschuss der Vereinigung Deutscher Schiffsingenieure VDSI<br />
13.12.07 Clusterprojekt „Maritime Wirtschaft <strong>und</strong> Wissenschaft in der Metropolregion<br />
Hamburg“<br />
22.01.08 B<strong>und</strong>esverkehrsministerium, Vorbereitung IMO BLG-Sitzung<br />
24.01.08 NORTEC-Konferenz Produktionstechnik i.V. mit dem VDMA<br />
30.01.08 Clusterprojekt „Maritime Wirtschaft <strong>und</strong> Wissenschafen“<br />
06.02.08 VDMA & Fre<strong>und</strong>eskreis Maschinenbau, Pelletiermaschinen, AMANDUS KAHL<br />
GmbH & Co. KG, Reinbek, www.akahl.de<br />
14.02.08 Fachtagung „Erneuerbare Energie“, TUHH<br />
15.02.08 VDR/CMT-Workshop Ballastwasserbehandlungsanlagen<br />
19.02.08 Fachausschuss „Lüftung, Klima, Kälte“, Hafenclub Hamburg<br />
07.03.08 NIP (Nationaler Innovationsplan) Wasserstoff <strong>und</strong> Brennstoffzellen, CMT<br />
13.03.08 nationale Vorbesprechung IMO MEPC 57, BMVBW/BSH Hamburg<br />
15.03.08 Kompetenzzentrum Biomasse, Messe „New Energy“, Husum.<br />
17.03.08 Clusterprojekt „Maritime Wirtschaft <strong>und</strong> Wissenschafen“<br />
01.04.08 Verwaltungsausschuss der Vereinigung Deutscher Schiffsingenieure<br />
06.05.08 Vorbereitung IMO MEPC (CO2-Betriebs- <strong>und</strong> Design-Index), GL Hamburg.<br />
07.05.08 Handwerkskammer Hamburg: Energie aus Biomasse.<br />
13.05.08 HAW Solar & Innovationsstiftung: Erneuerbare Energie<br />
22.05.08 Messebeirat SMM<br />
10.06.08 Shell-Marine-Products – Open Day, Hamburg.<br />
13.06.08 Informationsveranstaltung des Instituts für Schiffsbetriebsforschung,<br />
18.06.08 Fachausschuss Messtechnik & Automation,<br />
25.06.08 Informationstagung „maritime industrielle Gemeinschaftsforschung“, CMT<br />
26./27.06.08 Fachtagung „Fuelling the climate“, HAW Hamburg<br />
04.09.08 Normenausschuss “Ballastwasserbehandlungsanlagen”, Hamann AG,<br />
09.09.08 Normenausschuss „<strong>Leistungs</strong>übertragung <strong>und</strong> Vortrieb“, Piening, Glückstadt<br />
23.-26.09. SMM 2008, Messebeirat<br />
01.10.08 F&E-Information CMT, VSM & VDMA, Uni HH<br />
22.10.08 H2-Expo – International Conference and Trade Fair on Hydrogen and Fuel Cell<br />
Technologies<br />
14
<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>.-<strong>Ing</strong>. Holger Watter Flensburg University of Applied Sciences<br />
2009<br />
2010<br />
07.11.08 2 nd International Symposium Treatment of Wastewater and Liquid Waste on<br />
Ships (SOWOS), Hamburg.<br />
12.12.08 nationale Vorbespr. BLG 13/6 zum IGF-Code<br />
09.01.09 Vorbereitung Masterstudiengang Erneuerbare Energien, Akademie Lüchow<br />
21.01.09 STG-Sprechtag Messtechnik <strong>und</strong> Automation an der HAW Hamburg<br />
22.01.09 Competenzzentrum Erneuerbare Energie <strong>und</strong> Energieeffizienz CC4E<br />
25.02.09 Arbeitsausschuss „Schutz der Meeresumwelt“ beim DIN NSMT<br />
27.02.09 Einweihung Marine Training Center – MTC – Hamburg<br />
02.03.09 Der „Maritime Norden“ stellt sich vor, Landesvertretung Hamburg in Berlin<br />
13.03.09 Marine Simulation Seminar (CD-adapco & GL), Hamburg.<br />
26.03.09 CC4E-Windenergieworkshop, HAW Hamburg,<br />
02.04.09 Faszination Schiff (in Zusammenarbeit mit SAM Electronics)<br />
06.04.09 20. Kolloquium VDMA / Fre<strong>und</strong>eskreis M&P, Firma Fette, Schwarzenbek<br />
16.04.09 STG-Reedereisprechtag, Bremerhaven<br />
22.04.09 Emissionstagung, International Climate Change Information Programm (ICCIP)<br />
21.05.09 Jahreshaupt- <strong>und</strong> Delegiertenversammlung VDSI, Warnemünde.<br />
03.06.09 Workshop zur Marktstudie „Brennstoffzellen-Systeme in der Seefahrt“, GL<br />
17.06.09 Schiffbauforum, BOSCH REXROTH (Hydraulik <strong>und</strong> Pneumatik), Hamburg.<br />
19.06.09 Informationstagung des Instituts für Schiffsbetriebsforschung, Flensburg<br />
23.06.09 Praxis-Seminar „Abwettern … <strong>und</strong> dann?“, ALFA LAVAL, Hamburg.<br />
24.06.09 CMT-Status-Seminar, Hamburg<br />
10.09.09 International Congress on Ships Technology, ICST 2009, CCH Hamburg.<br />
22.09.09 Verwaltungsausschuss Vereinigung Deutscher Schiffsingenieure (VDSI),<br />
23.09.09 Anforderung für den umweltschonenden Schiffsbetrieb, RAL-ZU 110 „Blauer Engel“<br />
15.10.09 Workshop „Wasserstoff- <strong>und</strong> Brennstoffzellentechnologie in Hamburg“, Behörde<br />
für Wirtschaft <strong>und</strong> Arbeit (BWA)<br />
02.11.09 Tagung „Klima 2009“; www.climate2009.net, Handelskammer Hamburg.<br />
10.11.09 Projekt-Kick-Off „e4ship – Toplaterne“ (Brennstoffzellen im maritime Einsatz), Nationale<br />
Innovationsprogramm Wasserstoff <strong>und</strong> Brennstoffzellentechnologie (NIP),<br />
DNV Hamburg: http://www.e4ships.de/<br />
11.11.09 Landesinitiative Brennstoffzellen- <strong>und</strong> Wasserstofftechnologie Hamburg<br />
16.12.09 Fachausschuss Messtechnik <strong>und</strong> Automation der STG bei SAM Electronics<br />
15.01.10 Beiratsitzung GET NORD (Gebäudesystem <strong>und</strong> Energietechnik)<br />
http://www.hamburg-messe.de/get_nord/gn_de/start_main.php<br />
21.01.10 Project-Meeting DIREKT: Small Developing Island Renewable Energy<br />
Knowledge and Technology Transfer Network, Presentation: Benchmarking of<br />
Small Wind Energy Converter<br />
05.02.10 Kompensation von Seegangsbewegungen bei Schiffswinden, RINA Germany<br />
GmbH, Hamburg<br />
23.02.10 DIN-Arbeitsausschuss „<strong>Leistungs</strong>übertragung <strong>und</strong> Vortrieb“, Überarbeitung Propellernormen<br />
03.03.10 STG-Sprechtag „Innovative Schiffe“, Kieler Yachtclub<br />
8.-10.03. Gutachter für die Ausschreibung “Eco-innovations in shipbuilding” bei European<br />
Commission - DG Research – in Brüssel.<br />
18.03.10 Germanischer Lloyd First Class Exchange-Forum “Gas as Ship Fuel – Status and<br />
Trends”, Hamburg<br />
21.-28.03 Kooperationsgespräche zum Thema “Erneuerbare Energien <strong>und</strong> Energieeffizienz”<br />
bei der USST in Shanghai, http://sc.usst.edu.cn/en/aboutus.htm<br />
20.04.10 Zero Emission Ship – ZEMShips-Conference; Hamburg.<br />
21.04.10 Beiratsitzung GET NORD (Gebäudesystem <strong>und</strong> Energietechnik)<br />
http://www.hamburg-messe.de/get_nord/gn_de/start_main.php<br />
28.04.10 STG-Fachausschuss „Meßtechnik <strong>und</strong> Automation“, Marinearsenal Kiel<br />
13.05.10 Vereinigung Deutscher Schiffsingenieure; Bremen.<br />
19.05.10 STG-Fachausschuss „Schiffsmaschinen“ bei der FSG in Flensburg.<br />
10.06.10 Quantum- A Container Ship Concept for the Future, DNV Hamburg<br />
21.06.10 Expertenkreis beim BMWi für das Forschungsprogramm “Schifffahrt <strong>und</strong> Meerestechnik”<br />
15
<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>.-<strong>Ing</strong>. Holger Watter Flensburg University of Applied Sciences<br />
2011<br />
23.06.10 Informationsveranstaltung „Maritime industrielle Gemeinschaftsforschungsvorhaben“,<br />
CMT Hamburg.<br />
25.06.10 Informationstagung des Instituts für Schiffsbetriebsforschung, Flensburg<br />
01.07.10 Systemintegration erneuerbarer Energien, Fachgespräch zu Stromnetzen <strong>und</strong><br />
Energiespeicherung, BSU & HK Hamburg.<br />
01.09.10 CMT, Projekt e4ships, AP 1.1 <strong>und</strong> 1.2 Abstimmung<br />
06.09.-10.09.2010 Schiff, Marine, Meerestechnik, SMM 2010, Hamburg<br />
14.09.10 Fachausschuss Ausbildung in der STG; VA VDSI<br />
21.09.10 STG-Sprechtag "Anforderungen an die Elektrotechnik bei speziellen Schiffen" in<br />
Hamburg<br />
24.09.10 Workshop „Ausbildungs- <strong>und</strong> Stellensituation Schiffsbetriebstechnik“ beim Verband<br />
Deutscher Reeder VDR, Hamburg<br />
29.09.10 Fachausschuss Lüftung, Klima, Kälte bei der Firma Witt&Sohn, Pinneberg.<br />
1./2.10.10 International Seminar (kick-of-project-meeting) “Create a network of centers of<br />
excellence for maritime Training” 1.-2. October 2010, Poland, Szczecin,<br />
Szczerbcowa Street, Hall 7http://www.c4mt.eu<br />
02.11.10 Umsetzung des STCW-ÜE; Auftakt der StAK-Arbeitsgruppe, Hamburg<br />
12.11.10 4th International Symposium on Treatment of Wastewater and Waste on Ships,<br />
SOWOS, Hamburg, http://www.pia.rwth-aachen.de/sowos<br />
16/17.11. Fachmesse Gebäude, Energie, Technik (GET NORD), Fachmesse Elektro-, Gebäude-,<br />
Sanitär-, Heizung-, Klimatechnik: www.hamburg-messe.de/get_nord<br />
17.11.2010 Fachausschuss “Schiffsmaschinen”<br />
23.11.2010 STGF-Fachvortrag: Schwefelreduzierung <strong>und</strong> Auswirkung auf Schraubenspindelpumpen,<br />
Dipl.-<strong>Ing</strong>. Dubberstein, ALLWEILER AG.<br />
07.12.2010 Verwaltungsausschuss (VA) der Vereinigung Deutscher Schiffsingenieure (VDSI)<br />
19.01.2011 StAK-Umsetzung STCW Manila<br />
15.02.2011 STG-Sprechtag „Schwingungen, Festigkeit <strong>und</strong> Akustik“, Hamburg<br />
16.02.2011 Normenausschuss „<strong>Leistungs</strong>übertragung <strong>und</strong> Vortrieb“, Hamburg<br />
17.02.2011 GFK/CFG in maritimen Systems (Innovation Day), Stade.<br />
22.02.2011 Arbeitskreis Ausbildung im DNV <strong>und</strong> in der STG Hamburg<br />
24.02.2011 CMT, Projekt e4ships, AP 1.1 <strong>und</strong> 1.2 Abstimmungsgespräch, Hamburg.<br />
09.03.2011 StAK-Umsetzung STCW Manila<br />
05.04.2011 Reedereisprechtag der STG, Flensburg<br />
09.05.2011 Gründung des Norddeutsches des Norddeutschen Maritimen Clusters, Hamburg<br />
18.05.2011 Jahresempfang des Verbandes für Schiffs- <strong>und</strong> Meerestechnik (VSM) , Hamburg<br />
27./28.05. 7. Nationale Maritime Konferenz in Wilhelmshaven<br />
02.06.2011 Jahreshaupt- <strong>und</strong> Delegiertenversammlung der Vereinigung Deutscher Schiffsingenieure<br />
(VDSI) in Bremerhaven<br />
06.06.2011 Arbeitskreis Maritime Wirtschaft, IHK Kiel<br />
09.06.2011 Arbeitskreis Recht des Maritimen Arbeitskreises im Maritimen Cluster Norddeutschland,<br />
Kiel.<br />
15.06.2011 StAK Arbeitskreis Technik, BSH Hamburg<br />
22.06.2011 Workshop „Maritime Logistikkonzepte für Offshore-Windparks“, Hafenkooperation<br />
Offshore-Höfen Nordsee SH, Hamburg Hafen-Klub.<br />
24.06.2011 Informationstagung des Instituts für Schiffsbetriebsforschung<br />
28.06.2011 VA der VDSI, Hamburg<br />
24.08.2011 Workshop DIN/NSMT-Normenausschuss „Offshore-Windenergie“<br />
25.08.2011 GL Exchange-Forum „Actual Report on MEPC 62“<br />
01.09.2011 ICST, Internationaler Congress on Ships Technology, CCH, Hamburg<br />
06.09.2011 ALFA LAVAL Praxisseminar “Schifffahrt nach der Krise”, Hamburg<br />
13.09.2011 Normenausschuss <strong>Leistungs</strong>übertragung/Vortrieb DIN NSMT<br />
27.09.2011 Workshop Nationale Maritime Technologie (NMMT), Bremen<br />
29.09.2011 Gassymposium, VDR, Hamburg<br />
01.10.2011 VDR/GL LNG Symposium, Hamburg<br />
04.10.2011 STGF-Vortragsveranstaltung: EMV-Anforderungen für die Schiffselektrotechnik,<br />
Dietmar Frei, Phoenix-Testlab GmbH, Blomberg.<br />
05.10.2011 Agentur für Arbeit, Weiterbildung für Berufsberater, Anforderungen <strong>und</strong> Ausbildungsperspektiven<br />
in der Seeschifffahrt.<br />
18.10.2011 STGF-Vortrag „Installation, Betrieb <strong>und</strong> Instandhaltung von Startluftkompressoren“,<br />
Dipl.-<strong>Ing</strong>. Jens Sepke, J.P. SAUER & SOHN MASCHINENBAU GmbH.<br />
16
<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>.-<strong>Ing</strong>. Holger Watter Flensburg University of Applied Sciences<br />
2012<br />
01.11.2011 GL-Container-Ship-Forum<br />
08.11.2011 HATLAPA Anchor Handling and Towing Winches, STGF Flensburg.<br />
10.11.2011 Statusversammlung e4ships / Projekttreffen Toplaterne<br />
10.11.2011 Marine Fuels Future Developments and Prognosis, Container Feeder Shipping<br />
Update Seminar, DNV Germany, Hamburg.<br />
11.11.2011 Arbeitskreis Strömungsmaschinen, HSVA: „Fehlerabschätzung einer CFD-<br />
Berechnung am Beispiel eines Axialverdichters“ <strong>und</strong> „Validierung der CFD (Berechnung)<br />
mittels mehrdimensionaler Messwerte(felder)“, ANSYS.<br />
15.11.2011 Anforderungen <strong>und</strong> Prüfung von Ballastwasserbehandlungsanlagen, DIN NA-<br />
132-02-11-04 AK, Lloyd’s Register, Hamburg<br />
16.11.2011 Fachausschuss Schiffsmaschinen, Rostock<br />
22.11.2011 Zukunftsszenarien <strong>und</strong> Entwicklungstrends der Brenn- <strong>und</strong> Schmierstoffe im<br />
praktischen Bordbetrieb, BP Hamburg.<br />
30.01.2012 STG-Fachausschuss Messtechnik <strong>und</strong> Automation, GL Hamburg<br />
01.02.2012 StAK-Arbeitsgruppe Umsetzung STCW-Manila-Amendments<br />
03.02.2012 Offshore-Logistik-Konzepte, CE Wind, WTSH Kiel<br />
09.02.2012 „Herausforderungen <strong>und</strong> Perspektiven für Schleswig-Holstein durch die Energiewende“,<br />
Wirtschaftsrat, Neumünster<br />
14.02.2012 VA-VDSI<br />
1./2.03.12 Gutachtersitzung BMBF-Programm „Forschung an Fachhochschulen“ bei der AIF<br />
in Köln<br />
05.03.2012 Projektbesprechung LINAVO (Lernen im Netz, Aufstieg vor Ort – Offene Hochschulen<br />
in Schleswig-Holstein); Kiel<br />
06.03.2012 DIN-Normenausschuss „<strong>Leistungs</strong>übertragung“, Hamburg<br />
14.03.2012 STG-Fachausschuss Ausbildung, VSM, Hamburg<br />
17.04.2012 VA-VDSI<br />
18.04.2012 Evaluation des Forschungsprogramms „Maritime Technologien der nächsten Generation“<br />
beim BMWi in Berlin<br />
09.05.2012 Arbeitskreis „Maritime Wirtschaft“ der IHK zu Kiel<br />
16.05.2012 VSM-Jahresversammlung, Hamburg<br />
17.05.2012 VDSI-Jahreshaupt- <strong>und</strong> Delegiertenversammlung<br />
22.05.2012 Statusversammlung/Projekttreffen e4ships/Toplaterne, VSM Hamburg.<br />
30.05.2012 Projektbesprechung CAVIPURE – Ballastwasserbehandlungsanlage.<br />
08.06.2012 Landesfachkonferenz „Energiepolitik“, Wirtschaftsrat, Neumünster<br />
13.06.2012 STG-Fachausschuss Meerestechnik, FSG, Flensburg<br />
15.06.2012 Informationstagung zur Schiffsbetriebsforschung (ISF-Tagung), Flensburg<br />
03.07.2012 Expertenanhörung „Emissionsreduktion bei Kreuzfahrt-Neubauten“, TUI CRUI-<br />
SES, Hamburg<br />
17.08.2012 Vorbesprechung IGF-Code zur Vorbereitung BLG-17 beim VSM, Hamburg.<br />
20.08.2012 Wirtschaftsrat „Photovoltaik als Katalysator für die Energiewende“, Handewitt.<br />
3.-7.09.12 SMM 2012, Hamburg, inkl. Offshore-Dialog<br />
04.10.2012 Projektbesprechung „Ballastwasserbehandlungsanlage“, Flensburg<br />
18.10.2012 Projektstand Offshore Supportplattformen <strong>und</strong> Logistikkonzepte<br />
25.10.2012 STG-Tagung „Automation <strong>und</strong> Kommunikation & IT” in der Schiffsbetriebstechnik<br />
26.10.2012 STG-Tagung „Students meet Industries“, Bremen<br />
31.10.2012 Symposium „Antriebstechnik <strong>und</strong> Arbeitskräftemangel“, Flensburg<br />
07.11.2012 Statustagung zum „Nationalen Masterplan für Maritime Technologien (NMMT)“,<br />
B<strong>und</strong>esministerium für Wirtschaft <strong>und</strong> Technologie, Berlin.<br />
08.11.2012 GL-Fachausschuss Maschinenbau, Hamburg<br />
16.11.2012 GL-Arbeitskreises Strömungsmaschinen, FSG Flensburg.<br />
20.11.2012 STG-Fachausschuss „Messtechnik <strong>und</strong> Automation“, SIEMENS, Hamburg<br />
21.11.2012 STG-Fachausschuss „Schiffsmaschinenbau“, DNV Germany, Hamburg<br />
26.11.2012 Projektbesprechung „Ballastwasserbehandlungsanlage“<br />
27.11.2012 Berufungskommission „Elektrotechnik/Erneuerbare Energien“, HAW Hamburg.<br />
05.12.2012 Programmbeirat Projektträger Jülich „Schifffahrt <strong>und</strong> Meerestechnik“, Warnemünde.<br />
06.12.2012 Statustagung „Schifffahrt <strong>und</strong> Meerestechnik“, Projektträger Jülich im Auftrag des<br />
B<strong>und</strong>esministeriums für Wirtschaft <strong>und</strong> Technologie (BMWi), Warnemünde.<br />
11.12.2012 VA VDSI<br />
17
<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>.-<strong>Ing</strong>. Holger Watter Flensburg University of Applied Sciences<br />
2.2.3 Vorträge / Lectures and Presentations<br />
08.05.00 Entwicklungen <strong>und</strong> Stand der Technik in der Seeschifffahrt Vortragsreihe Planung,<br />
Logistik, Organisation, Infrastruktur, Technik für technische Schiffsoffiziere,<br />
Marinetechnikschule, Kiel.<br />
09.11.00 Die neue Schiffsmaschinensimulation der FH Hamburg, Verein der Schiffsingenieure<br />
zu Hamburg VSIH<br />
11.10.00 Schiffstechnik in der Seeschifffahrt - Quo Vadis ? Weiterbildungsseminar Technik/Logistik<br />
für Stabsoffiziere vom 09. - 13.10.00, Marinetechnikschule, Kiel.<br />
07.06.01 Chances and Opportunities of Combined Fuel-Cell-Systems on Board of Ships,<br />
Summer Conference STG, Technical University of Gdansk (PL).<br />
13.09.01 Der vollautomatische Schiffsbetrieb: Ausbildungsanforderung Status Quo <strong>und</strong><br />
Quo Vadis, International Congress on Ship's Technology, CCH.<br />
28.02.02 Automatisierungs- <strong>und</strong> Assistenzsysteme an Bord von Seeschiffen, 3. Braunschweiger<br />
Symposium, Gesamtzentrum für Verkehr der TU-Braunschweig,<br />
27./28.02.02.<br />
27.11.02 Nautische <strong>und</strong> schiffstechnische Hochschulkompetenz in Hamburg, Ausschuss<br />
für Hafen <strong>und</strong> Schifffahrt der Handelskammer Hamburg.<br />
10.01.05 Alternative Kältemittel, Führungsseminar Marine-Schifffahrtsleitstelle (MSLtOrg),<br />
Kiel.<br />
25.01.05 Nickel, Rolf / Watter, H.: Besonderheiten der Wasserstoff-Technologie in maritimen<br />
Normen, Vortragsreihe der Wasserstoff-Gesellschaft Hamburg e.V. / Handelskammer<br />
Hamburg.<br />
23.09.05 Messe EINSTIEG ABI 2005, Berlin, Messegelände (Expertentalkr<strong>und</strong>e „Planen,<br />
entwickeln, konstruieren – für Menschen, Medien <strong>und</strong> Maschinen“)<br />
29.09.06 Think-<strong>Ing</strong>-Veranstaltung des VDMA/VSM im Rahmen der Messe SMM 2006<br />
27.11.06 „Betriebserfahrungen mit einer solarthermischen Anlage“; Woche der Energie,<br />
HAW Hamburg<br />
29.11.07 Ökonomische <strong>und</strong> ökologische Bewertung von<br />
Erdwärmepumpen – eine probabilistische Untersuchung<br />
zur Suche nach der praktischen<br />
<strong>Leistungs</strong>zahl - Erfahrungen aus einem Studienprojekt;<br />
HAW Hamburg, 2. Woche der Energie.<br />
11.03.08 Krapp, Watter: Reducing Ship Emissions and potential for fuel efficiency, Green<br />
Ship Technology 2008, Rotterdam, Netherland.<br />
17.04.08 Tag der Logistik, Schwerpunkt “maritime <strong>und</strong> internationale Logistik”, Vortragsthema:<br />
Lösungsvorschläge zur Reduzierung von Schwefelemissionen im Seeverkehr.<br />
24.11.08 Energie aus Biomasse mit dem STIRLING-Motor, 3. Woche der Energie, HAW<br />
Hamburg, 2008.<br />
22.04.09 Krapp, Watter: Verringerung von Schiffsemissionen <strong>und</strong> Potentiale für Treibhauseffizienz,<br />
International Climate Change Information Programm (ICCIP), 22.04.09,<br />
Hamburg.<br />
26.06.09 Herausforderungen umweltschonenden Schiffsbetriebes, Staatl. Handelsschule<br />
Berliner Tor (Hamburg School of Transport and Shipping).<br />
29.10.09 Seegangskompensation bei Schiffswinden<br />
<strong>und</strong> Kränen, FH Flensburg.<br />
07.11.09 Engineering von Windkraftanlage, 3. Nacht<br />
des Wissens, HAW Hamburg (zusammen mit<br />
der Firma EASY WIND (www.easywind.org)<br />
12.11.09 Benchmarking von Kleinstwindkraftanlagen,<br />
4. Woche der Energie, HAW Hamburg:<br />
http://www.haw-hamburg.de/woche-derenergie-4.html<br />
21.01.10 Project-Meeting DIREKT: Small Developing Island Renewable Energy<br />
Knowledge and Technology Transfer Network, Presentation: Benchmarking of<br />
Small Wind Energy Converter<br />
05.02.10 Compensation of Ship Movements on Hydraulic Winch and Crane Systems,<br />
RINA, Annual Meeting, Hamburg<br />
18
<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>.-<strong>Ing</strong>. Holger Watter Flensburg University of Applied Sciences<br />
12.11.10 The Influence of international rules on ships engineering process evaluated by<br />
value benefit analysis, 4th International Symposium on Treatment of Wastewater<br />
and Waste on Ships, SOWOS, Hamburg<br />
19.04.11 Umweltfre<strong>und</strong>licher Schiffsbetrieb, Staatl. Handelsschule Berliner Tor (Hamburg<br />
School of Transport and Shipping).<br />
05.10.11 Ausbildungsanforderungen <strong>und</strong> Perspektiven in der<br />
Seeschifffahrt, Berufsk<strong>und</strong>liche Weiterbildung der Berufsberater<br />
aus den norddeutschen B<strong>und</strong>esländern,<br />
Agentur für Arbeit.<br />
10.11.11 Marine Fuels Future Developments and Prognosis,<br />
Container Feeder Shipping Update Seminar, DNV<br />
Germany, Hamburg.<br />
2.2.4 Veröffentlichungen / Publications<br />
[1] "Besondere Lernumgebungen zur Instandhaltungsausbildung<br />
in der Schiffsbetriebstechnik" in: Pahl, Jörg-Peter (Hrsg.):<br />
Lern- <strong>und</strong> Arbeitsumgebungen zur Instandhaltungsausbildung,<br />
Kallmeyer'sche Verlagsbuchhandlung, Seelze-Velber,<br />
1997.<br />
[2] Hypertext <strong>und</strong> Entscheidungssimulation in der Dampftechnikausbildung,<br />
SCHIFFSBETRIEBSTECHNIK FLENSBURG<br />
1/997, Seite 6 - 10.<br />
[3] Computerunterstützte Ausbildung (CUA): Effektive Option,<br />
DEUTSCHE SEESCHIFFAHRT 6/97, Seite 18 - 19.<br />
[4] Schiffsingenieurausbildung in Hamburg, SCHIFFS-<br />
INGENIEUR JOURNAL Nr. 253, Nov./Dez. 1997, Seite 5 - 6.<br />
[5] Verfügbarkeit <strong>und</strong> Red<strong>und</strong>anz bei Leitsystemen für die Schiffführung,<br />
Jahrbuch der SCHIFFBAUTECHNISCHEN GE-<br />
SELLSCHAFT 1998, Seite 67 - 72, Springer-Verlag, Berlin,<br />
Heidelberg, New York, 1999.<br />
[6] Verfügbarkeit <strong>und</strong> Red<strong>und</strong>anz bei Leitsystemen für die<br />
Schiffsführung, HINTERGRUND - SYSTEME FÜR DIE<br />
SCHIFFSFÜHRUNG (Hauszeitschrift STEIN SOHN GmbH),<br />
Kiel, 1998.<br />
[7] Perspektiven für die Zeit nach der Marine, BLAUE JUNGS<br />
Nr. 5/1999, Seite 6.<br />
[8] Die Ausbildung zum Schiffsbetriebsingenieur (SBO) in Hamburg<br />
nach der Umsetzung von STCW 95, Schiffahrtsinstitut<br />
Warnemünde e.V., Wissenschaftliche Beiträge Heft 2, Warnmünde,<br />
1999.<br />
[9] Die Patentausbildung in Hamburg, SCHIFF & HAFEN 6/99,<br />
Seite 108-112.<br />
[10] 250 Jahre Seefahrtsausbildung in Hamburg, SCHIFFS-<br />
INGENIEUR JOURNAL Nr. 261, März/April 1999, Seite 2-6.<br />
[11] 250 Jahre Seefahrtsausbildung in Hamburg, SCHIFFSBE-<br />
TRIEBSTECHNIK FLENSBURG Nr. 165 (1/1999), Seite 6 f.<br />
[12] Arbeitsgruppe "Lüftung, Klima, Kälte" (Mitteilungen der Schiffbautechnischen<br />
Gesellschaft), SCHIFF & HAFEN 1/99 Seite<br />
48 f<br />
[13] Harm, Watter: Seefahrtsbezogene Ausbildung in Hamburg (Offener<br />
Brief des VSIH an die Senatorin Frau Krista Sager),<br />
SCHIFFS-INGENIEUR JOURNAL Nr. 264, Sept./Okt. 1999,<br />
Seite 12/13.<br />
[14] Watter: Der neue Schiffsmaschinensimulator der FH Hamburg, VSIH/HGFS, Hamburg,<br />
9. Nov. 2000.<br />
[15] Müller-Schwenn, Winkler, Watter: Chances and Opportunities of Combined Fuel-Cell-<br />
Systems on Board of Ships, STG-Jahrbuch 2001, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg,<br />
New York, 2001.<br />
[16] Behrens, Volker; Matthes, Jürgen; Watter, Holger: Erzeugung von Klimakälte <strong>und</strong> Einsatz<br />
umweltfre<strong>und</strong>licher Kältemittel auf Schiffen, Jahrbuch der Schiffbautechnischen<br />
19
<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>.-<strong>Ing</strong>. Holger Watter Flensburg University of Applied Sciences<br />
Gesellschaft (STG) 2000, Seite 26 – 43, Springer-Verlag, Berlin,<br />
Heidelberg, New York, 2002.<br />
[17] Watter: Der vollautomatische Schiffsbetrieb: Ausbildungsanforderung<br />
Status Quo <strong>und</strong> Quo Vadis, Proceedings International<br />
Congress on Ship's Technology, Verein der Schiffs-<strong>Ing</strong>enieure<br />
zu Hamburg (VSIH), 2001.<br />
[18] Ullmer, Watter: Workshop Report 'Environmentally acceptable<br />
lubricants and hydraulic fluid contributing to surface water protection'<br />
(Koblenz, Federal Institute of Hydrology, 8 th Oct. 2001),<br />
Hamburg University of Applied Sciences, ISSUS (Supported by<br />
the European Commission, DG Enterprise), 2002.<br />
[19] Ullmer, Watter: Einsatz umweltverträglicher Betriebsstoffe in<br />
Schifffahrt <strong>und</strong> Hafenbau, SCHIFF & HAFEN 04/02, Seite 207<br />
bis 210.<br />
[20] Schüler, Watter: Automatisierungs- <strong>und</strong> Assistenzsysteme an Bord von Seeschiffen, 3.<br />
Braunschweiger Symposium, Gesamtzentrum für Verkehr der TU-Braunschweig,<br />
27./28.02.02 (VDI Fortschritts-Bericht Nr. 485, Reihe 12 Verkehrstechnik/Fahrzeugtechnik,<br />
VDI-Verlag, Düsseldorf, 2002,<br />
Seite 238 bis 259; ISBN 3-18-348 512-5).<br />
[21] Watter: Jahresbericht der Vereinigung Deutscher Schiffsingenieure<br />
VDSI, SCHIFF & HAFEN 04/02, Seite 224-225.<br />
[22] Broekhuizen, Theodori, Blansch, Ullmer, Watter u.a.: Lubrication<br />
in Inland and Coastal Water Activities – Growing acceptance<br />
for biolubricants a benefit for the environment, Balkema<br />
Publishers (Swets & Zeitlinger Publishers), Lisse, Abingdon,<br />
Tokyo, 2003 (ISBN 90 5809 612 2).<br />
[23] Thormann, J.; Winkler, W.; Watter, H.: Entwicklung <strong>und</strong> Systemintegration<br />
von hocheffizienten Gasturbinen-Brennstoffzellen-<br />
Kombianlagen (SOFC-GT) an Bord von Seeschiffen. Tagungsband<br />
VDI-GET-Tagung „Stationäre Brennstoffzellen – Technologien,<br />
Partnerschaften, Chancen“, Heilbronn, VDI-Bericht<br />
1752, 2003, S. 219.<br />
[24] Thormann, J.; v. Stryk, A.; Winkler, W.; Watter, H.: Application of<br />
Fuel Cell Systems on board of seagoing Ships, European conference<br />
and exhibition “Ele-<strong>Dr</strong>ive Transportation: Battery, Hybrid<br />
and Fuel Cell”, 17.-20. March 2004, Estoril Congress Center (Portugal).<br />
[25] Thormann, Winkler, Watter: Einsatz von hocheffizienten Brennstoffzellensystemen<br />
an Bord von Seeschiffen (Abschlussbericht<br />
zum AIF/BMBF-Forschungsprojekt SOFC-GT), HAW-Hamburg,<br />
Hamburg, 2004.<br />
[26] Meier-Peter / Watter: World Maritime Technology Conference,<br />
SCHIFF & HAFEN 02/2005, S. 35.<br />
[27] Hafit, Ahmed / Watter, Holger: Entwicklung <strong>und</strong> Systemintegration<br />
eines innovativen Zugdrachenkonzeptes zur Reduzierung von<br />
Kraftstoffverbrauch <strong>und</strong> Emissionen im Seeverkehr (SkySail),<br />
AIF/BMBF-Abschlussbericht (FKZ 17 108 03), HAW Hamburg,<br />
2005.<br />
[28] Schiffs-<strong>Ing</strong>enieurjournal (Mai/Juni 2006): Tätigkeitsbericht des<br />
Verwaltungsausschuss (VA) der Vereinigung Deutscher Schiffsingenieure<br />
(VDSI)<br />
[29] Meier-Peter, Bernhardt (Hrsg.) ….Watter et al.: Handbuch<br />
Schiffsbetriebstechnik, Seehafen Verlag, Hamburg, 2006, ISBN<br />
10: 3-87743-816-4 ISBN 13: 978-3-87743-816-9.<br />
[30] Jendroßek, Päper, Watter: Orientierungshilfen für Ballast-<br />
Wasserbehandlungsanlagen, SCHIFF & HAFEN 12/2006, S. 48.<br />
[31] Watter, H.: Energieeinsparung im Schiffsbetrieb, IMPETUS 7/07,<br />
Magazin der HAW, S. 23.<br />
[32] Watter, Holger: Hydraulik <strong>und</strong> Pneumatik: Gr<strong>und</strong>lagen <strong>und</strong><br />
Übungen, Anwendungen <strong>und</strong> Simulation (Einführung - Betriebsstoffe<br />
- Fluidmechanik - Konstruktionselemente - Steuerung,<br />
20
<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>.-<strong>Ing</strong>. Holger Watter Flensburg University of Applied Sciences<br />
Regelung - Bussysteme - Simulationsrechnung), Vieweg-Verlag, Wiesbaden, 09/2007,<br />
ISBN 3-8348-0190-9, 248 Seiten.<br />
[33] Schiffs-<strong>Ing</strong>enieurjournal (August 2008): Tätigkeitsbericht des<br />
Verwaltungsausschuss (VA) der Vereinigung Deutscher Schiffsingenieure<br />
(VDSI) für 2007 bis 2008; Sonderbeilage.<br />
[34] Watter, H.: Nachhaltige Energiesyteme - Gr<strong>und</strong>lagen, Systemtechnik<br />
<strong>und</strong> Anwendungsbeispiele aus der Praxis, Vieweg+Teubner-Verlag,<br />
Wiesbaden, 2009, ISBN: 978-3-8348-<br />
0742-7.<br />
[35] Meier-Peter, Bernhard (Hrsg.)…. Watter et al: Compendium Marine<br />
Engineering - Operation Monitoring – Maintenance, Seehafen<br />
Verlag, Hamburg, 2009, ISBN 978-3—87743-822-0<br />
[36] Watter, Holger: Regenerative Energiesysteme, - Gr<strong>und</strong>lagen,<br />
Systemtechnik <strong>und</strong> Anwendungsbeispiele aus der Praxis, Vieweg+Teubner-Verlag,<br />
Wiesbaden, 2., erw. Aufl. 2011. XII, 348 S.<br />
Mit 188 Abb. u. 48 Tab. Br. ISBN: 978-3-8348-1040-3<br />
[37] Watter, H.: Neubau des Maritimen Zentrums, MARINEFORUM 5/2011, S. 32 bis 34.<br />
[38] Boy, P.; Schmidt, G.; Watter, H.: Maritimes Zentrum „In Deutschland ganz oben“, DIE<br />
NEUE HOCHSCHULE - DNH 4-5/2011, Seite 156 - 160.<br />
[39] Limant, Schmidt, Watter: Neubau des Maritimen Zentrums, MARINEFORUM 5/2011, S.<br />
32 bis 34.<br />
[40] Watter, H.: The Influence of International Rules on Ship Engineering Process evaluated<br />
by a Benefits Value Analysis, Tagungsband „International Symposium on Treatment of<br />
Wastewater and Waste of Ships“ (Hrsg. <strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>. Pinnekamp), Aachen, 2011, ISBN<br />
978-3-938996-33-1.<br />
[41] Thiemke, M.; Watter, H.: Seefahrt = Leidenschaft + Technik, INGENIEURSPIEGEL<br />
1/2012, S. 75 bis 77.<br />
[42] Watter, H.: Schiffsemissionen – Forscher widerspricht NABU, DEUTSCHE SEE-<br />
SCHIFFFAHRT Mai 2012, S. 47 & div. Printmedien.<br />
2.2.5 Begutachtung <strong>und</strong> Beratung / Expertise and Consulting<br />
[1] Beurteilung einer Projektskizze für ein Demonstrationsvorhaben zur Ölschlammentsorgung<br />
an Bord von Schiffen, Innovationsstiftung Hamburg, 1999.<br />
[2] Ganzheitliche Betrachtung der Kosten- <strong>und</strong> <strong>Leistungs</strong>arten bei der planmäßigen <strong>und</strong><br />
außerplanmäßigen Instandhaltung von Fregatten <strong>und</strong> Korvetten, BMVg ARTeM, Bonn,<br />
1999.<br />
[3] Berufskommission im Berufungsverfahren C2/C3 Schiffsmaschinenanlagen, Hochschule<br />
Wismar, Fachbereich Seefahrt Warnemünde, 2000/2001.<br />
[4] Machbarkeitsstudie für ein mit Biogas aus der Schweinezucht betriebenes Blockheizkraftwerkes<br />
(2000)<br />
[5] Techn. Beratung zum Schlichtungsverfahren DORIS T<br />
("arbitration") für MCP Hamburg, 2001.<br />
[6] Fachliche Beratung MSG Hamburg zum technischen Befähigungszeugnis,<br />
2001.<br />
[7] Affiliation agreement between 'The Institute of Marine Engineering,<br />
Science and Technology' IMarEST, STG and<br />
VSIH/VDSI, 12.12.01 London (Meeting with Mr. Keith<br />
Read [Director GeneraL], <strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>. Meier-Peter [STG]).<br />
[8] Marine-Logistik-Führungszentrale Wilhelmshaven,<br />
02.09.02 - 13.09.02.<br />
[9] Marinerüstung (Marineamt MarA MR), Rostock, 01.09.03 – 12.09.03.<br />
[10] Stichling Hahn Hilbrich (Average Adjusters) LTD (Limassol/Zypern): Casualty Information<br />
regarding Torsional Vibration, 2004.<br />
[11] Motorschaden DEUTZ M 528 Bunkerboot OBERON.<br />
[12] Gutachter der AiF-Förderr<strong>und</strong>e 2004/2005 <strong>und</strong> 2006 (Arbeitsgemeinschaft industrieller<br />
Forschungsvereinigungen - www.aif.de) zum Programm des B<strong>und</strong>esministeriums<br />
für Bildung <strong>und</strong> Forschung (BMBF) zur Förderung angewandter<br />
Forschung an Fachhochschulen (FH³ - ehemals Programm aFuE).<br />
[13] Gutachter zum W2-Berufungsverfahren „<strong>Prof</strong>. für Nautik/Nautischer<br />
Schiffsbetrieb“ in Bremen (2006).<br />
21
<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>.-<strong>Ing</strong>. Holger Watter Flensburg University of Applied Sciences<br />
[14] Beirat in der Messe „Schiff, Marine, Meerestechnik“ SMM – www.smm2006.com (seit<br />
2004).<br />
[15] CO2-Äquivalent von Schiffen im Destillat- versus Schwerölbetrieb (Germanischer Lloyd,<br />
B<strong>und</strong>esverkehrsministerium).<br />
[16] Begutachtung CMT-Call-2008 <strong>und</strong> 2009, http://www.cmt-net.org/<br />
[17] VTG Deutschland GmbH, Pressure discharge rate of dry cement<br />
at wagon, 2008<br />
[18] Gutachter im Berufungsverfahren W2/W3 Arbeitsmaschinen <strong>und</strong><br />
Anlagenbetriebstechnik der Hochschule Wismar, 2008.<br />
[19] Windenschaden Hochseeschlepper, i.V. mit <strong>Ing</strong>enieurbüro<br />
Weselmann GmbH, http://www.weselmann.de/, 2009.<br />
[20] Evaluator in the Promotion Fo<strong>und</strong>ation (RPF), fo<strong>und</strong>ed by the<br />
Government of the Republic of Cyprus to promote research and innovation activities:<br />
www.research.org.cy, 2009.<br />
[21] Evaluation - 3rd Surface Tranport Call: 15th - 26th February 2010 and 8th – 12th March<br />
2010, evaluator in the programme “Eco-innovations in shipbuilding”, European Commission<br />
- DG Research.<br />
[22] Expertenkreis beim BMWi für das Forschungsprogramm “Schifffahrt <strong>und</strong> Meerestechnik”,<br />
21.06.2010<br />
[23] Begutachtung eines Forschungsantrags zur Minimierung des<br />
Energieeinsatzes bei <strong>Dr</strong>uckluft für die Deutschen B<strong>und</strong>esstiftung<br />
Umwelt (www.dbu.de), August 2010.<br />
[24] Umsetzung des STCW-ÜE; Auftakt der StAK-Arbeitsgruppe<br />
am 02.11.2010, 10.30 Uhr, Hamburg<br />
[25] Evaluation Sustainable Surface Transport Call FP7-SST-<br />
2011-RTD-1 Eco innovations in Ship Building and Waterborne<br />
Transportation (Jan. 2011).<br />
[26] AIF Begutachtung FHprofUnt 2011 (Dez. 2010 / Jan. 2011), AiF Arbeitsgemeinschaft<br />
industrieller Forschungsvereinigungen „Otto von Guericke“<br />
e.V., Bayenthalgürtel 23, 50968 Köln.<br />
[27] BMBF/AiF-Begutachtung „<strong>Ing</strong>enieurNachwuchs“ (Jan./März 2012). &<br />
„FHprofUnt“<br />
[28] Evaluation Sustainable Surface Transport Call FP7-SST-2012-RTD-1: Innovative<br />
fleet for efficient logistic chain (Jan. 2012).<br />
[29] Berufungskommission “Techn. Mechanik/Fluidtechnik” an der Hochschule<br />
für angewandte Wissenschaften (HAW) Hamburg.<br />
[30] Evaluation der Emissionsberechnungen des NABU zu<br />
den Emissionen von Kreuzfahrtschiffen (für div. Medienvertreter).<br />
[31] DFG-Begutachtung Infrastrukturausstattung an deutschen Hochschulen im Rahmen<br />
des Programms ,,Großgeräte der Länder"; www.dfg.de<br />
[32] Externer Gutachter für das Berufungsverfahren <strong>Prof</strong>essur W2<br />
„Elektrotechnik/Erneuerbare Energien“ an der HAW Hamburg,<br />
Fakultät Life Sciences, Department Verfahrenstechnik,<br />
[33] EU-Evaluation FP7-SST-2013-RTD-1, Nov. 2012/Jan. 2013, European<br />
Commission - DG Research.<br />
22
<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>.-<strong>Ing</strong>. Holger Watter Flensburg University of Applied Sciences<br />
3 Lehre / Teaching activities<br />
3.1 Ausbildung/ Educational Training<br />
Institut für Schiffsbetrieb, Seeverkehr <strong>und</strong> Simulation (ISSUS) – 1997 - 2004<br />
- Maschinendynamik,<br />
- Verbrennungskraftmaschinen I, II, III<br />
- Arbeitsmaschinen <strong>und</strong> Anlagen / Hilfsmaschinenbetrieb I, II, III<br />
- Schiffsbetriebsstoffe<br />
- Technische Betriebsführung <strong>und</strong> Schiffsmaschinensimulation<br />
Fachbereich Naturwissenschaftliche Technik 2004/2005<br />
- Technische Mechanik (Statik <strong>und</strong> Festigkeitslehre)<br />
Fachbereich Maschinenbau <strong>und</strong> Produktion (Fb M&P) 2004 - 2010<br />
- Techn. Mechanik I, II, III (2004-2006)<br />
- Betriebsstofflabor (2004-2005)<br />
- Laborleitung <strong>und</strong> Lehrveranstaltung Hydraulik <strong>und</strong> Pneumatik (HuP), seit 2004<br />
- Innovative Energieversorgung (IEV) – therm. Verfahren; Mastermodul Nachhaltige<br />
Energiesysteme (Biogas, Biomasse, Verflüssigung <strong>und</strong> Vergasung von Biomasse,<br />
Windenergie, Solarthermie, Erdwärme); Mastermodul Anlagensysteme nachhaltiger<br />
Enrergieversorgung; Projekt 1: Erneuerbare Energien<br />
Fachhochschule Flensburg<br />
- Betriebstechnik/Betriebsstoffe + Instandhaltung<br />
- Arbeitsmaschinen <strong>und</strong> Anlagentechnik<br />
- Schiffsmaschinensimulation<br />
Lehraufträge<br />
- FH Flensburg für das Fach Schiffstechnik (09/2008 - 2010)<br />
- Akademie Lüchow-Dannenberg im Masterstudiengang „Erneuerbare Energie“ (seit<br />
02/2009).<br />
- HAW Hamburg Fluidtechnik (seit 09/2010)<br />
Die Lerninhalte <strong>und</strong> einen Überblick zu den Fächern befindet sich in der Anlage.<br />
3.2 Weiterbildung / Advanced Training<br />
Es wurden bisher (jeweils in den Semesterferien) die nachfolgenden k<strong>und</strong>enspezifische Seminare<br />
am Ship Engine Simulator SES 4000 durchgeführt:<br />
� 28.-29.08.01 Firma NAUSSED, Bremen.<br />
� 04.-06.09.01 Firma MSG, Hamburg.<br />
� 25.-27.02.02 Firma MSG, Hamburg.<br />
Zur Schiffsmaschinensimulation siehe Anlage.<br />
� 09.09.2009 Refresher Course Ship Operation, Columbus Shipmanagement, Hamburg.<br />
3.3 Laborbetreuung / Laboratory<br />
1998 – 2004: Laborleitung Schiffsmaschinensimulator SES 4000<br />
Bei ISSUS wurden in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Maschinenbau <strong>und</strong> Produktion<br />
(M&P) die nachfolgenden Laborübungen durchgeführt:<br />
� Kreiselpumpen <strong>und</strong> Kavitationsprüfstand,<br />
� Kälteanlage,<br />
� Klimaanlage,<br />
� Hubkolbenverdichter / Liefergrad / mech. Indizieren,<br />
� elektronisches Indizieren, Motorkenndaten,<br />
� Kurbelwangenatmung <strong>und</strong> Einspritzpumpenprüfstand,<br />
� Öllabor.<br />
Seit Sept. 2003: Laborleitung Hydraulik <strong>und</strong> Pneumatik (HuP)<br />
23
<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>.-<strong>Ing</strong>. Holger Watter Flensburg University of Applied Sciences<br />
3.4 Betreute Abschlussarbeiten <strong>und</strong> Projekte / Adviced Projects and Theses<br />
Eine vollständige Auflistung aller betreuten Projekte, Studien- <strong>und</strong> Diplomarbeiten befindet sich<br />
im Anhang.<br />
4 Mitwirkung in Hochschulgremien <strong>und</strong> Selbstverwaltung / Academic<br />
duties<br />
1) Institutsrat: 1998 - 2000 stellv. Mitglied, 07/2000 – 09/2003 Mitglied<br />
2) Prüfungsausschuss ISSUS: 1998 - 2003<br />
3) Studienreformausschuss ISSUS: 1998 - 2003<br />
4) Forschungsschwerpunkt (FSP) „Brennstoffzellen <strong>und</strong> rationelle Energieanwendung“ ; seit<br />
Okt. 2000<br />
5) Arbeitsgruppe MSc: August 1999 – März 2001 (Leiter der Arbeitsgruppe „Masterstudiengang<br />
Waterborne Transport“.<br />
6) Arbeitsgruppe Zukünftiges ISSUS-<strong>Prof</strong>il (ZIP): Jan. 2001 – Dez. 2001<br />
7) Gründungskommission Studiengang ‚Transport <strong>und</strong> Verkehr’ : Juni 2000 – Sept. 2001<br />
8) Stellv. Geschäftsführender Direktor: März 2001 – Sept. 2004<br />
9) Laborleitung:<br />
Schiffsmaschinensimulator SES 4000: 1998 – 2004<br />
Hydraulik <strong>und</strong> Pneumatik seit Sept. 2003<br />
10) Stellv. Mitglied im Hochschulsenat: April 2005 – Juni 2006<br />
11) Berufungskommission: Technische Mechanik mechatronischer Systeme 2007<br />
12) Prodekan der Fakultät für Technik <strong>und</strong> Informatik <strong>und</strong> Vorsitzender des Forschungsausschusses<br />
der Fakultät: Juni 2005 – Juli 2010, div. Fakultätsgremien <strong>und</strong> Arbeitsgruppen<br />
a. <strong>Prof</strong>essionalisierung der Forschungsaktivitäten durch administrative Unterstützung im<br />
Forschungsbüro<br />
b. Konzeption <strong>und</strong> Modernisierung Technikum (7 Mio. Euro Investitionskosten)<br />
c. Projektleitung 1. Campustag 2009<br />
d. Neustrukturierung Infrastruktur: 165 <strong>Prof</strong>., 30 Laboreinrichtungen, 18 Studiengänge<br />
(Umstellung Bachelor/Master), 4 Departments (Maschinenbau & Produktion, Informations-<br />
<strong>und</strong> Elektronik, Fahrzeugtechnik <strong>und</strong> Flugzeugbau, Informatik)<br />
e. Mitglied der Steuerungsgruppe „Competence Center für Erneuerbare Energien &<br />
Energieeffizienz“ – CC4E<br />
f. kommissarischer Dekan 06/2009 bis 01/2010.<br />
13) Studienausschuss des Konvents Fachbereich Technik (08/2010 – 07/2012)<br />
14) Berufungsausschuss Nautik 1 <strong>und</strong> Nautik 2 sowie Schiffstechnik 2 (Vors.)<br />
15) Mitglied im Konvent des Fachbereiches „Maschinenbau, Verfahrenstechnik <strong>und</strong> maritime<br />
Technologie“ <strong>und</strong> stellv. Mitglied im Senat der Fachhochschule Flensburg ab 09/2012.<br />
24
<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>.-<strong>Ing</strong>. Holger Watter Flensburg University of Applied Sciences<br />
A ANLAGEN / ANNEX<br />
A1 Curriculum Vitae<br />
<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>.-<strong>Ing</strong>. <strong>HOLGER</strong> <strong>WATTER</strong><br />
Wohnort: Marderstieg 6, 24963 Tarp<br />
Tel./Fax: 04638 / 89 84 88<br />
Mobil: 0171 / 53 00 309<br />
Geb.-Datum: 26.05.1963 in Flensburg<br />
Beruflicher Werdegang:<br />
seit 08/2010 Fachhochschule Flensburg,<br />
Institut für Maschinen <strong>und</strong> Anlagen (IMA), seit 07/2011 Leitung IMA.<br />
Fachbereich Maschinenbau, Verfahrenstechnik <strong>und</strong> maritime Technologien (MVM),<br />
seit 2006 Obmann des Arbeitsausschusses NA 132-02-01 AA <strong>Leistungs</strong>erzeugung, Vortrieb <strong>und</strong><br />
Hilfsmaschinen <strong>und</strong> bei der Normenstelle Schiffs- <strong>und</strong> Meerestechnik (NSMT) im DIN, Hamburg<br />
(seit 2004), www.nsmt.din.de,<br />
seit 03/ 2001 Stellv. Sprecher der Vereinigung Deutscher Schiffs-<strong>Ing</strong>enieure VDSI.<br />
05/2005 – 07/2010 Prodekan für Forschung der Fakultät Technik <strong>und</strong> Informatik (<strong>Prof</strong>ildaten: 4700 Stud., 165<br />
<strong>Prof</strong>., 138 Mitarb. in Forschung, Lehre <strong>und</strong> Verwaltung; 30 Laboreinrichtungen, 18 Studiengänge,<br />
4 Departments: Maschinenbau u. Produktion, Fahrzeugtechnik <strong>und</strong> Flugzeugbau, Informations-<br />
<strong>und</strong> Elektrotechnik, Informatik)<br />
2008 – 07/2010 Mitglied der Steuerungsgruppe „Competence Center für Erneuerbare Energien & Energieeffizienz“<br />
– CC4E<br />
09/2004 – 07/2010 <strong>Prof</strong>essur für Maschinen <strong>und</strong> Anlagentechnik am Fachbereich Maschinenbau <strong>und</strong> Produktion<br />
(M&P) der Hochschule für angewandte Wissenschaften (HAW) Hamburg. Tätigkeitsschwerpunkte:<br />
Anwendungsorientierte Forschung sowie Wissens- <strong>und</strong> Technologietransfer auf den<br />
Gebieten: Maritime Technologie, schiffstechnische Systeme, Schiffsbetriebstechnik, Energie-<br />
<strong>und</strong> Umweltschutztechnik.<br />
09/2003 – 07/2010 Laborleitung Hydraulik <strong>und</strong> Pneumatik (HuP)<br />
10/2000 – 07/2010 Mitglied des Forschungsschwerpunktes (FSP) Brennstoffzellen <strong>und</strong> rationelle Energieanwendung<br />
am Fachbereich Maschinenbau <strong>und</strong> Produktion (M+P) der Hochschule für<br />
angewandete Wissenschaften (HAW),<br />
03/2001 – 09/2004 Stellv. Geschäftsführender Direktor ISSUS,<br />
1997 - 2003 <strong>Prof</strong>essur für Kraft- <strong>und</strong> Arbeitsmaschinen am Institut für Schiffsbetrieb, Seeverkehr <strong>und</strong><br />
Simulation (ISSUS) der FH Hamburg (seit 2002: Hochschule für angewandte Wissenschaften<br />
HAW), Tätigkeitsschwerpunkte: Verbrennungskraftmaschinen, Arbeitsmaschinen <strong>und</strong><br />
Anlagen, Schiffsbetriebsstoffe <strong>und</strong> Maschinendynamik für angehende Schiffsingenieure<br />
CI/CIW (nach neuer Bezeichnung: Technische Wachoffiziere).<br />
1999 - 2004 Laborleitung Schiffsmaschinensimulator (SES Ship Engine Simulator)<br />
1994 - 1997 Dozent an der Fachschule für Seefahrt in Flensburg, Tätigkeitsscherpunkte: Werkstofftechnik<br />
<strong>und</strong> Dampftechnik für angehende Patentinhaber CT/CTW,<br />
1990 - 1993 Nebenberufliche Promotion mit dem Thema „Ein Beitrag zur optimalen Lenkung von vollautonomen<br />
Unterwasserrobotern“ am Institut für Automatisierungstechnik der Universität der<br />
B<strong>und</strong>eswehr in Hamburg,<br />
1988 - 1994 Seefahrtzeiten als Schiffstechnischer Offizier auf verschiedenen Schiffen <strong>und</strong> Booten der<br />
B<strong>und</strong>esmarine, zuletzt: Leiter der Instandsetzungsgruppe eines Schnellbootgeschwaders<br />
auf einem Versorgungs- <strong>und</strong> Werkstattschiff (Staatliches Befähigungszeugnis CI),<br />
1983 - 1987 Studium Maschinenbau mit der Vertiefungsrichtung Schiffsmaschinenbau an Universität der<br />
B<strong>und</strong>eswehr <strong>und</strong> der TU Hamburg-Harburg,<br />
1982 - 1983 Ausbildung zum Marineoffizier.<br />
25
<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>.-<strong>Ing</strong>. Holger Watter Flensburg University of Applied Sciences<br />
A2 Lehrveranstaltungen / Lectures<br />
A 2.1 Werkstoffk<strong>und</strong>e / Material Science (1994 – 1997)<br />
1. Gr<strong>und</strong>lagen der Werkstoffk<strong>und</strong>e<br />
Werkstoffe, Werkstoffanforderung u. –kennwerte, Aufbau (Atome, Gitter, Gefüge, Kristalle), Gitterbaufehler,<br />
Thermische Analyse, Auswirkung der Kristallstruktur auf die mech. Eigenschaften<br />
(Anisotropie, Isotropie, Quasiisotropie, Textur, Verformungen), Rekristallisation<br />
2. Zweistoffsysteme<br />
System, Komponente, Phase, Mischungen in flüssige <strong>und</strong> feste Phase (Kristallgemisch - Mischkristalle),<br />
Schliffbild, Zustandsschaubild: Zustandsschaubild Kristallgemisch, Eutektikum, Hebelgesetz,<br />
Zustandsschaubild Mischkristall-System: Schichtkristall, Diffusion<br />
3. Eisen-Kohlenstoff-Legierung<br />
Thermische Analyse <strong>und</strong> Kristallstruktur des reinen Eisens, Ferrit, Graphit, Zementit, Austenit,<br />
Ledeburit (Eutektikum), Umwandlungsprozesse im festen Zustand (Stahlecke im EKD), Perlit,<br />
Einfluss des Kohlenstoffgehalts auf versch. Eigenschaften des Eisens, Wirkung der Eisenbegleiter<br />
4. Wärmebehandlung des Stahls<br />
Glühen, Härten, Martensit-Gefüge, Anlassen, Vergüten, Oberflächenhärtung<br />
5. Eisen- <strong>und</strong> Stahlerzeugung<br />
Erzaufbereitung, Hochofen, Stahlerzeugung, Seigerungen, Lunker<br />
6. Gusseisenwerkstoffe<br />
Verschiedene Gefügestrukturen, GS, GG, GGG, GTS, GTW<br />
7. Normung<br />
Unlegierte Stähle, Legierte Stähle, Gusswerkstoffe, Werkstoffnummern nach DIN 17007<br />
8. Legierte Stähle<br />
Mischkristallbildner, Carbitbildner, Austenitische Stähle, Ferritsche Stähle, Zeit-Temp.-<br />
Umwandlungsdiagramm (ZTU), Einfluss der Legierungselemente auf die höhere Temperatur,<br />
Einfluss auf Schweißeignung, Wirkung der wichtigsten Legierungselemente<br />
9. Nichteisenmetalle <strong>und</strong> ihre Legierungen<br />
Normung, Knet-, Automaten-, Gusslegierung, Aluminium, Kupfer (u. ausgewählte Legierungen)<br />
10. Plaste<br />
11. Hilfsstoffe<br />
12. Werkstoffprüfung<br />
Zugversuch, Härtemessung (HB Brinell, HV Vickers, HR Rockwell), Kerbschlagbiegeversuch,<br />
Dauerschwingversuch, Stirnabschreckversuch, Ultraschallprüfung, Magn. Rissprüfung, Schliffprüfung<br />
13. Schäden an Werkstücken<br />
26
<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>.-<strong>Ing</strong>. Holger Watter Flensburg University of Applied Sciences<br />
A 2.2 Dampftechnik / Steam Technology (1994 – 1997 <strong>und</strong> seit 2011)<br />
1. Einführung: Wasserdampf als Energieträger, Energieumwandlung <strong>und</strong> –nutzung, Hauptbauteile<br />
eines einfachen Dampfkreislaufs, Darstellung im h-s- <strong>und</strong> T-s-Diagramm, Einfluss der thermodyn.<br />
Rahmenparameter<br />
2. Dampferzeugung<br />
2.1 Anordnung <strong>und</strong> Funktion der Wärmetauscher: Luft- <strong>und</strong> Speisewasservorwärmer, Verdampfer,<br />
Überhitzer, Strahlungs- <strong>und</strong> Berührungsheizflächen, Überhitzerkennlinie, Zwischenüberhitzer,<br />
Wärmeströme <strong>und</strong> Verluste,<br />
2.2 Dampferzeugung <strong>und</strong> Wasserumlauf: Verdampfungsarten, Selbstverdampfung, Naturumlauf,<br />
Zwangsumlauf, Durchlauf- <strong>und</strong> Umlaufstörungen<br />
2.3 Kesselbauarten <strong>und</strong> Konstruktionsmerkmale: Kessel mit Naturumlauf (ungeordneter Umlauf:<br />
Großwasserraumkessel, Schottischer Kessel; geordneter Umlauf: Wasserrohrkessel<br />
(Steilrohr-, Eckrohr, Abgaskessel <strong>und</strong> Schnelldampferzeuger), Zwangslaufkessel: Zwangsumlauf<br />
(La-Mont-Kessel), Zwangsdurchlauf (Benson-Kessel)<br />
2.4 Hauptbauteile des Dampferzeugers: Trommel <strong>und</strong> Sammler, Trommeleinbauten, Hilfsdampfkühler;<br />
Heißdampfregelkühler, Kesselrohre<br />
2.5 Lage, Aufgabe <strong>und</strong> Funktion der Vorwärmer: Luvo (regenerativ (Ljungström, Rothemühle),<br />
rekuperativ), Economiser<br />
2.6 Ausrüstung des Dampferzeugers: Armaturen <strong>und</strong> Ventile, Wasserstandsanzeige, Abschäum-<br />
<strong>und</strong> Abschlämmeinrichtungen<br />
Überhitzeranfahrventil, Entlüftung, Entwässerung, Regler, Begrenzer, Wächter, Rußbläser<br />
2.7 Regeleinrichtungen: Dampfdruck- oder Lastregler, Heißdampftemperaturregler (Trommel- u.<br />
Einspritzkühler), Speisewasserregelung, Verbrennungsregelung<br />
2.8 Wärmetechnische Berechnung<br />
3. Verbrennung: Verbrennung in der Kesselfeuerung: Brennstoffaufbereitung, Gemischbildung,<br />
Verbrennung, Verbrennungsrechnung, Aufbau <strong>und</strong> Wirkungsweise der Brennerarten: Brenneranordnung,<br />
Zerstäuberarten, Brennergeschränke, Feuerraum<br />
4. Gesetzliche Bestimmungen: Gewerbeordnung, Dampfkesselverordung, TRD <strong>und</strong> SR Kesselpapiere,<br />
Kesselwärtervorschriften, UVV, Klassifikationsvorschriften <strong>und</strong> Betriebsanleitungen<br />
5. Inbetriebnahme des Dampferzeugers<br />
5.1 Inbetriebnahme: Vorbereitende Maßnahmen, Überprüfung der Kesselanlage, Sicherheitsmaßnahmen,<br />
Auffüllen, Vorlüften, Zünden, Überhitzerschutz, Zuschalten<br />
5.2 Kesselbetrieb <strong>und</strong> Betriebszustände: Schäumen, Kochen, Spucken; Überhitzerbrand; Speisewasserpflege;<br />
Korrosion: Wasserseitige Korrosion, Rauchgasseitige Korrosion (Nieder- <strong>und</strong><br />
Hochtemperaturkorrosion), Luft-Brennstoffverhältnis<br />
5.3 Außerbetriebnahme, Kesselkonservierung<br />
5.4 Wartung während des Betriebes: Rauchgasanalyse (Verbrennungskontrolle), Rußbläser,<br />
Rußbrände, Kugelregenanlagen, Sicherheitseinrichtungen, Betriebsdatenerfassung, Checklisten,<br />
Betriebsstörungen<br />
5.5. Amtl. Kesseluntersuchung: Aufgabe, Vorbereitung, Umfang <strong>und</strong> Durchführung<br />
6. Dampfbetrieb auf Motorschiffen: Abwärmenutzung, ORC-Anlagen, Thermalöl-Anlagen, Abgaskessel,<br />
Hilfskessel, Doppeldruckkessel<br />
7. Dampfturbine<br />
7.1 Energieumwandlung (Leit- <strong>und</strong> Laufvorrichtung)<br />
7.2 Turbinenarten: Gleichdruckturbinen (Laval, Curtis, Zoelly), Gegendruckturbinen, Reaktionsgrad;<br />
Geschwindigkeitsdreiecke, Verluste; Labyrinthdichtungen<br />
7.3 Turbinenarten <strong>und</strong> –bauteile, Läuferarten (Scheiben-, Trommelläufer), Schaufelbefestigungen,<br />
Fahr-, Schnellschluß- <strong>und</strong> Sicherheitseinrichtungen, Ver- <strong>und</strong> Entsorgungssysteme,<br />
Entwässerung, Stopfbuchsen- <strong>und</strong> Sperrdampfsystem, <strong>Leistungs</strong>übertragungsanlage<br />
7.4 <strong>Leistungs</strong>regelung, Mengen- <strong>und</strong> <strong>Dr</strong>osselregelung im h,s-Diagramm<br />
7.5 Betrieb: Inbetriebnahme, Fahrbetrieb <strong>und</strong> Regelung, Außerbetriebnahme, Notbetrieb<br />
8. Kondensator: Aufgabe, Aufbau <strong>und</strong> Betrieb, Hilfseinrichtungen, Luftabsauger <strong>und</strong><br />
Kondensatrückführung, Betriebsverhältnisse <strong>und</strong> Überwachung (Grädigkeiten, Leckagen, Betriebsstörungen)<br />
9. Vorwärmung <strong>und</strong> Entgaser: Kondensatvorwärmung: Aufbau, Aufgabe <strong>und</strong> Betrieb,<br />
Kondensatableitung, Entgaser, Kesselspeisepumpe<br />
10. Gesamtanlage: Wasser- <strong>und</strong> Dampfkreisläufe, Verbesserung der Energieausnutzung, Beurteilung<br />
ausgeführter Anlagen<br />
27
<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>.-<strong>Ing</strong>. Holger Watter Flensburg University of Applied Sciences<br />
A 2.3 Technische Mechanik / Mechanics (2003 – 2005)<br />
2003 – 2004 für Verfahrens- <strong>und</strong> Medizintechniker am Fachbereich Naturwissenschaftliche Technik in HH-Bergedorf,<br />
2004 – 2005 am Fachbereich Maschinenbau <strong>und</strong> Produktion<br />
Statik starrer Körper<br />
Gr<strong>und</strong>begriffe, Zusammensetzen <strong>und</strong> Zerlegen von Kräften, Kräftepaar <strong>und</strong> Moment, Schnittprinzip<br />
<strong>und</strong> Reaktionsprinzip, Gleichgewichtsbedingungen, Lagerreaktionen, statisch bestimmte<br />
<strong>und</strong> unbestimmte Systeme, Schnittgrößen des geraden Balkens, ebene Fachwerke<br />
Elastizität- <strong>und</strong> Festigkeitslehre<br />
Gr<strong>und</strong>begriffe, Spannungs-Dehnungszustand, HOOKsches Gesetz, ebene Biegung des<br />
längskraftfreien Balkens, elastische Linie, Superposition, axiale <strong>und</strong> polare Flächenträgheitsmomente,<br />
EULER-Knickung, Torsion zylindrischer Stäbe, <strong>Dr</strong>illung, BREDTsche Formeln,<br />
ebene Spannungszustände, Kesselformeln, Festigkeitshypothesen (SH <strong>und</strong> GEH)<br />
Kinematik <strong>und</strong> Kinetik<br />
Kinematische Gr<strong>und</strong>größen Weg, Geschwindigkeit, Beschleunigung, geradlinige Bewegung,<br />
Kreisbewegung, Bewegung auf beliebiger Bahn, gleichförmige <strong>und</strong> gleichförmig beschleunigte<br />
Bewegung, ungleichförmige Bewegung. Gr<strong>und</strong>gesetze der Kintetik: D‘Alembertsches Prinzip,<br />
Trägheitskräfte, Arbeit, Energie, Energieerhaltungssatz, Leistung, Impuls, Impulserhaltungssatz,<br />
Bewegung mit Widerstand, zentraler Stoß, freie Schwingungen, Körper mit veränderlicher<br />
Masse, Gr<strong>und</strong>gesetz der <strong>Dr</strong>ehbewegung, Massenträgheitsmomente, Hauptachsen,<br />
Hauptträgheitsmomente, Energieerhaltungssatz, Leistung, <strong>Dr</strong>ehimpuls, <strong>Dr</strong>ehimpulserhaltungssatz,<br />
Allgemeine ebene Bewegung des Körpers, Translation <strong>und</strong> Rotation, Geschwindigkeits-<br />
<strong>und</strong> Beschleunigungszustand, Momentanpol, Relativbewegung, Gr<strong>und</strong>lagen der<br />
Schwingungslehre.<br />
A 2.4 Maschinendynamik (1997 – 2003)<br />
Schwingungstechnische Gr<strong>und</strong>begriffe<br />
Klassifikation von Schwingungen, Freiheitsgerade, Eigenfrequenz, Einfluss statischer Kräfte<br />
(Gleichgewichtskraft)<br />
Beschreibungen von Schwingungen<br />
vektorielle Beschreibung (im Komplexen), Beschreibung mittels Winkelfunktionen, Weg – Geschwindigkeit<br />
- Beschleunigung, Federkennlinien / Hooksches Gesetz<br />
Lineare Schwinger mit einem Freiheitsgrad<br />
freie, ungedämpfte Schwingungen, freie, gedämpfte Schwingungen, erzwungene Schwingungen,<br />
harmonische Erregung, nichtharmonische Erregung,<br />
Koppelschwingungen<br />
Lineare Schwinger mit mehreren Freiheitsgraden,<br />
Auswuchttechnik, Maschinendynamik der Hubkolbenmaschine<br />
A 2.5 Verbrennungskraftmaschinen / Combustion Engine (1997 – 2004)<br />
VKM I: Gr<strong>und</strong>lagen der Hubkolbenmaschine<br />
Überblick, Geometrische Abmessungen, Vergleichsprozesse, Mitteldruck, Wirkungsgrade, Kinematik<br />
des Kurbeltriebs, Mittlere Kolbengeschwindigkeit<br />
Messungen am Motor<br />
Kennfelder, Propellerkennnlinie<br />
Reibungsverluste (Reibmitteldruck, mech. Wirkungsgrad)<br />
Indizieren, Schleppen des Motors, Abschaltversuch, Extrapolationsmethode<br />
Kraftstoffe<br />
Normkraftstoffe für Otto- <strong>und</strong> Dieselmotoren, Zündverhalten, Luftbedarf<br />
Kennzahlen der Verbrennungsqualität<br />
Verbrennungsluftverhältnis, Luftverhältnis,<br />
Qualitätskennzahlen für den Ladungswechsel<br />
Liefergrad, Luftaufwand, Zweitaktgaswechsel rel. Gesamtladung, Spülgrad, Fanggrad, Gaswechsel:<br />
4-Takt / 2-Takt, Spülverfahren<br />
Gemischbildung <strong>und</strong> Verbrennung<br />
Dieselmotor, Ottomotor, Emissionsverhalten<br />
VKM II: Konstruktive Gestaltung <strong>und</strong> betriebliche Aspekte ausgewählter Bauteile<br />
28
<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>.-<strong>Ing</strong>. Holger Watter Flensburg University of Applied Sciences<br />
Vibrationen, Schwingungen, Bezeichnungen am Motor, Berechnung der Hauptabmessungen,<br />
Antriebskonzepte im Vergleich, Motorgestell / Motorgehäuse, Zylinderdeckel / Zylinderkopf,<br />
Laufbuchse, Kolben, Kolbenbolzen, Kolbenringe, Pleuelstange, Kreuzkopf, Gleitschuh, Kurbelwelle,<br />
Lager<br />
VKM III: Ausgewählte Subsysteme; Zusammenwirken Schiff-Propeller-Motor<br />
Aufladeverfahren, Teillastbetrieb, Ladungswechsel, dynamische Vorgänge, Optimierung des<br />
Zweitaktgaswechsels, Gaswechselorgane, Anlassorgane, Umsteuerorgane, Einspritzsysteme,<br />
Regelung der Einspritzmenge, Verbrennung im Dieselmotor, Gemischbildungsverfahren, Einfluss<br />
der Umgebungsbedingungen auf das Betriebsverhalten,<br />
Propulsion: Propellerkenndaten, Propellerfreifahrtsdiagramm, propulsionsverbessernde<br />
Maßnahmen, Schleppwiderstand des Schiffes, Wellensysteme, Einfluss auf die Propellerkennlinie,<br />
Kavitation am Propeller, Wellenleitung, Getriebe,<br />
Subsysteme: Kühlung, Schmierung, Wärmerückgewinnung, Schwingungen / Lagerung von<br />
Motoren, Wartung, Betrieb <strong>und</strong> Instandhaltungen, Notschaltungen.<br />
A 2.5 Arbeitsmaschinen <strong>und</strong> Anlagen / Treatment and Machines (1997 – 2004 <strong>und</strong><br />
ab 2010)<br />
AMA I Kreiselpumpen<br />
Strömungstechnische Gr<strong>und</strong>lagen (Bernoulli, Impuls, Energie), Pumpen- / Eulerhauptgleichung<br />
für Strömungsmaschinen, <strong>Dr</strong>osselkurve, Strömungsdreiecke, Dimensionslosekennzahlen<br />
(spez. <strong>Dr</strong>ehzahl), Laufradgeometrie <strong>und</strong> deren Einfluss auf Betriebsparameter, Kenndaten<br />
<strong>und</strong> Kennfelder von Kreiselpumpen, Anlagenkennlinie / Pumpenkennlinie, Anpassung der<br />
Pumpe an die Anlage, Reihenschaltung / Parallelschaltung von Pumpen, Kavitation (NPSH)<br />
Rohrleitungssysteme<br />
Kennzeichnung, Symbole, <strong>Dr</strong>uckverluste (Anlagenkennlinie), Rauhigkeit, Verlustbeiwerte,<br />
Verzweigte Systeme <strong>und</strong> deren Einfluss auf das Betriebsverhalten, Förderung viskoser Flüssigkeiten<br />
(Schweröl)<br />
AMA II: Verdrängerpumpen<br />
Bauarten (Kolbenpumpe, Exzenterschneckenpumpe, Rootspumpe etc.), Symbole gem. DIN<br />
2481 (Wärmekraftanlagen) <strong>und</strong> DIN 24300 (Hydraulik), Betriebsverhalten von<br />
Verdrängerpumpen, Anlagen- <strong>und</strong> Pumpenkennlinie, p-V-Diagramm, Windkessel, Verluste<br />
(dynamische Einflüsse, Beschleunigungsverluste u.a.)<br />
Verdichter<br />
Bauarten (Hubkolberverdichter etc.), Thermodynamische Zustandsänderungen, Schadraum,<br />
Liefergrad, Mehrstufige Verdichtung, Gasgemische, Feuchte Luft, Kondensatausfall<br />
AMA III: Kälteanlagen<br />
Kompressionskälteanlagen, Absorptionskälteanlagen, linkslaufender Carnot-Prozess (lg p-h-<br />
Diagramm), Unterkühlung <strong>und</strong> Überhitzung des Kältemittels, Einstufige <strong>und</strong> mehrstufige Anlagen,<br />
Marktgängige Kältemittel <strong>und</strong> Alternativkältemittel, Ausgeführte Anlagen, Thermoexpansionsventil,<br />
Störungsbeispiele, Rückverflüssigungsanlagen auf Gastankern<br />
Klimaanlagen<br />
Bau- <strong>und</strong> Betriebsarten, Behaglichkeitsgebiete, Zustandänderungen der feuchten Luft (h-x-<br />
Diagramm), Sommer- <strong>und</strong> Winterbetrieb<br />
Reinigungs- <strong>und</strong> Aufbereitungsanlagen (Trennverfahren):<br />
Separatoren, Entöler, Frischwassererzeuger, Kläranlagen, Filter (Rückspül- Automatikfilter),<br />
Ultrafiltration, Umkehrosmose<br />
Hydraulische Anlagen, Ruderanlagen,<br />
Sicherheitsanlagen, Gr<strong>und</strong>lagen Brandabwehr / Brandverhütung, Brandmelder, Feuerlöschanlagen<br />
(bauliche Anforderungen), Halon-Ersatzstoffe, Inertgas-Anlagen<br />
Wärmeaustauscher<br />
Wartung, Betrieb <strong>und</strong> Instandhaltung<br />
29
<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>.-<strong>Ing</strong>. Holger Watter Flensburg University of Applied Sciences<br />
A 2.6 Schiffsbetriebsstoffe / Operational media (1997 – 2003 <strong>und</strong> ab 2010)<br />
Kraft- <strong>und</strong> Schmierstoffe<br />
Erdölaufbereitung (Destillation, Raffination),<br />
Physikalische <strong>und</strong> chemische Eigenschaften: Dichte, Specific-Gravity, API-Grad, Zähigkeit<br />
(Viskosität) / Viskositätindex VI / VP-Verhalten, Neutralisationszahl NZ / TAN (Niedertemperaturkorrosion,<br />
Verlackung der Laufbuchse), Total-Base-Number TBN, Verseifungszahl VZ,<br />
Aschegehalt, Verkokungsneigung, Flammpunkt / Brennpunkt, Pourpoint / Stockpunkt,<br />
Gr<strong>und</strong>lagen der Verbrennung: Gemischbildung, Verbrennung / Verbrennungsrechnung, Heizwert,<br />
Zündverhalten, Nieder- / Hochtemperaturkorrosion, Schifffahrtbrennstoffe, Brennstoffaufbereitung:<br />
Oxidation / chem. Instabilität, Mikrobiologischer Befall, Brennstoffmischung<br />
(Blending)<br />
Schmierstoffe: Gr<strong>und</strong>lagen der Tribologie, Alterung der Schmierstoffen, Additive, Konditionierung<br />
von Schmierölen für spezielle Einsatzgebiete.<br />
Kesselwasserpflege:<br />
Wasser-Gr<strong>und</strong>lagen, Inhaltstoffe des Wassers<br />
Wasseraufbereitung: Filtration, Flockung, Entsäuerung, Enteisung <strong>und</strong> Entmanganung, Ionenaustauscher,<br />
Enthärtung, Entcarbonisierung, Entsalzung, Entgasung, Alkalisierung, Antischaummittel,<br />
Filmbildner,<br />
Betriebliche Sonderprobleme: Kesselkonservierung, Belagbildung <strong>und</strong> Korrosion, Chem. Reinigung<br />
von Kesselanlagen, UVV, Wasseruntersuchung, Motorkühlwasserpflege<br />
A 2.7 Betriebsführung, Überwachung, Instandhaltung / Monitoring and Maintenance<br />
(2000 – 2004)<br />
Fächerübergreifendes Seminar zu den Lehrinhalten aus allen technischen Fachgebieten.<br />
Die Technische Betriebsführung, Überwachung, Instandhaltung wird anhand ausgewählter<br />
exemplarischer Anlagen aufgearbeitet.<br />
A 2.8 Laboratorium für Anlagentechnik / Labor für Betriebsstoffprüfung (2003)<br />
Bestimmung der Dichte einer Flüssigkeit (Kerosin), Bestimmung des Wasserstoffgehaltes im<br />
Kerosin über den Siedeverlauf, Bestimmung des Brenn- <strong>und</strong> Heizwertes von Kerosin <strong>und</strong><br />
Heizöl, Bestimmung der dynamischen Viskosität von Newton´schen <strong>und</strong> Nicht- Newton´schen<br />
Flüssigkeiten, Bestimmung der kinematischen Viskosität von Mineralölgemischen bei verschiedenen<br />
Temperaturen, Bestimmung des Flamm- <strong>und</strong> Brennpunktes im offenen Tiegel<br />
(nach Cleveland), Bestimmung des Flammpunktes von Kerosin im geschlossenen Tiegel nach<br />
Abel-Pensky, Bestimmung des Wassergehaltes von Schmierölen mit dem C-Aquameter, Bestimmung<br />
des Wassergehaltes von Schmierölen nach der Xylol-Methode, Bestimmung des<br />
Tropfpunktes von Schmierfett, Bestimmung der Neutralisationszahl NZ eines Altöles,, Bestimmung<br />
des Cloud- <strong>und</strong> Pourpoints von Dieselkraftstoffen, Bestimmung des Grenzwertes<br />
der Filtrierbarkeit von Dieselkraftstoffen<br />
A 2.9 Fluidtechnik & Labor Hydraulik <strong>und</strong> Pneumatik / Laboratory of Fluid Power<br />
Systems (seit Sept. 2003)<br />
1. Einführung, Gr<strong>und</strong>lagen der Fluidmechanik, hydraulisches<br />
Gr<strong>und</strong>prinzip, Schaltsymbole,<br />
2. Eigenschaften der <strong>Dr</strong>uckflüssigkeiten,<br />
3. Konstruktionselemente der Hydraulik <strong>und</strong> Pneumatik<br />
(Pumpen, Ventile, Rohrleitungen, Zylinder, Schwenkmotoren,<br />
Hydraulikgetriebe <strong>und</strong> Wandler sowie sonstiges Zubehör)<br />
4. Steuerungstechn. Betrachtungen, Automation (Vernetzung,<br />
Bussysteme),<br />
5. Regelungstechn. Betrachtungen, Zeitverhalten, dyn. Verhalten,<br />
Modellierung<br />
6. Monitoring <strong>und</strong> Diagnose,<br />
7. Projektierungsbeispiele <strong>und</strong> begleitende Laborübungen.<br />
Das Laboratorium verfügt über die nachfolgenden Prüfstände<br />
1.20 Hydraulische Achse mit Wegmeßsystem,<br />
30
<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>.-<strong>Ing</strong>. Holger Watter Flensburg University of Applied Sciences<br />
1.21 Hydraulische Achse mit Wegmeßsystem (Lastdruck)<br />
1.30 Ermittlung der Stellkräfte an Axialkolbenmaschinen<br />
1.40 Vergleichende Untersuchungen an Servo- <strong>und</strong> Proportionalventilen<br />
1.41 Widerstandsverhalten von Ventilen<br />
1.42 Bestimmung der Leckölverluste an Ventilen<br />
1.50 Funktionsverhalten von Blasen- <strong>und</strong> Kolbenspeichern<br />
1.60 Wegabhängige Folgesteuerung / Hydraulischer Spindelvorschub<br />
2.30 Pneumatische Positionierung mit Wegmesssystem<br />
2.40 Messung an Pneumatik-Ventilen (Widerstandsverhalten)<br />
2.51 Vergleichsmessung an Pneumatik- Schalldämpfern unterschiedlicher Bauart<br />
3.00 Untersuchung von modernen Software-Tools<br />
A.2.10.1 Innovative <strong>und</strong> nachhaltige Energieversorgung (Thermische Verfahren) /<br />
Renewable Energy Systems<br />
Solarthermische Wärmeerzeugung (Solarzellen), solarthermische<br />
Stromerzeugung (Dish/Stirling), Geothermische<br />
Anlagen <strong>und</strong> oberflächennahe Erdwärme, Wärmepumpen,<br />
energetische Nutzung von Biomasse (therm. Verwertung,<br />
thermo-chemische Umwandlung (Vergasung, Pyrolyse,<br />
Verkohlung), physikalisch-chemische Umwandlung (Pflanzenöl<br />
� Treibstoffe <strong>und</strong> Schmierstoffe), bio-chem. Umwandlung<br />
(Gärung, Biogas).<br />
A 2.10.2 Projekt 1: Regenerative Energiesysteme<br />
Auszug aus der Prüfungsordnung:<br />
§ 5 (1) Ziff. 6: Projekt<br />
Das Projekt ist eine fächerübergreifende Lehrveranstaltungsart<br />
mit Anwesenheitspflicht, die die<br />
Studierenden unter der Moderation der Lehrenden<br />
in Gruppenarbeit gestalten.<br />
§ 21: Projekt 1: 5 CP – 150 Std. (3 SWS + 1 SWS Projektmanagement)<br />
Projekt 2 / Studienarbeit: 10 CP – 250 Std.<br />
§ 26<br />
(1) Projekte haben fächerübergreifende Aufgabenstellungen, die die Studierenden<br />
Anwendung von fachlichen <strong>und</strong> organisatorischen Problemlösungsmethoden anwendungsorientiert<br />
bearbeiten sollen. Im Verlaufe des Projektes sollen die Studierenden<br />
Aufgabenstellungen <strong>und</strong> praxisnah lösen lernen. Projekte werden während eines Semesters<br />
studienbegleitend durchgeführt.<br />
(2) Die Studierenden müssen im Hauptstudium mindestens an einem Projekt teilnehmen.<br />
Eine erfolgreiche Teilnahme setzt voraus, dass die oder der Studierende Projektes<br />
nachweist, dass sie oder er in der Lage ist, in einem Team Aufgabenstellungen fächerübergreifend<br />
<strong>und</strong> anwendungsorientiert zu lösen; jede oder jeder Studierende hat<br />
dabei nach § 11 Absatz 3 Nummer 3 oder 4 zu erbringen. Für die erfolgreiche Teilnahme<br />
Studiennachweis erteilt.<br />
(3) Die Studierenden haben eine Studienarbeit zu erbringen oder an einem Projekt<br />
Für die jeweils erbrachte Prüfungsleistung wird ein <strong>Leistungs</strong>nachweis erteilt.<br />
31
<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>.-<strong>Ing</strong>. Holger Watter Flensburg University of Applied Sciences<br />
A 2.10.3 Mastermodul: Nachhaltige Energiesysteme<br />
Auszug aus der Modulbeschreibung:<br />
Fachlich-inhaltliche <strong>und</strong> methodische Kompetenzen<br />
� Die Studierenden haben einen Überblick über das Angebot der nachhaltigen Energiequellen<br />
Sonne, Wind, Wasserkraft, Gezeiten, Erdwärme <strong>und</strong> nachwachsende Rohstoffe <strong>und</strong><br />
sind in der Lage, die räumliche <strong>und</strong> zeitliche Angebotscharakteristik zu ermitteln <strong>und</strong> die<br />
Folgen dieser Angebotscharakteristik auf die technischen Einsatzmöglichkeiten abzuschätzen.<br />
� Die Studierenden können den potentiellen Beitrag einzelner nachhaltiger Energiequellen<br />
unter Berücksichtigung technischer, wirtschaftlicher, politischer <strong>und</strong> ökologischer Randbedingungen<br />
beurteilen.<br />
� Die Studierenden können verschiedene Konzepte zur Befriedigung einer gegebenen Versorgungsaufgabe<br />
mit konventionellen <strong>und</strong> nachhaltigen Energiequellen unter Einbeziehung<br />
der technischen Möglichkeiten der Energiespeicherung <strong>und</strong> der Effizienzsteigerung<br />
des Energieeinsatzes konzipieren <strong>und</strong> bezüglich gegebener Ziele vergleichen.<br />
� Die Studierenden erwerben die methodische Kompetenz, Anlagen zur Bereitstellung<br />
elektrischer Energie <strong>und</strong> thermischer Energie aus nachhaltigen Energiequellen zu simulieren,<br />
rechnerisch auszulegen <strong>und</strong> hinsichtlich gegebener Ziele zu optimieren<br />
Sozial- <strong>und</strong> Selbstkompetenz<br />
� Die Studierenden sind in der Lage, sich Informationen sowohl zum Stand der Technik als<br />
auch zum Stand der Forschung <strong>und</strong> Entwicklung von Technologien zur Energiewandlung,<br />
Energiespeicherung <strong>und</strong> Energievermeidung zu beschaffen <strong>und</strong> diese Informationen zu<br />
bewerten <strong>und</strong> zu präsentieren.<br />
� Die Studierenden arbeiten in ausgewählten Projekten im Team, ihre Organisation- sowie<br />
Sozial- <strong>und</strong> Kommunikationsfähigkeiten werden dadurch geschult.<br />
Lerninhalte<br />
� Angebot nachhaltiger Energieträger: Energieumwandlungssysteme, mechanischelektische<br />
Systeme (z. B. Windenergie), Solarthermische Systeme, solarelektrische Systeme,<br />
thermische Systeme (z. B. Geothermie), biochemische Systeme (z. B. Biogasanlagen),<br />
Energiespeichersysteme, Energievermeidung, Energiemanagement<br />
� Labor: Das Labor hat Projektcharakter <strong>und</strong> wird mit unterschiedlichen Angeboten teilweise<br />
in Verbindung mit einer Exkursion angeboten. Die Projekte werden nach Möglichkeit in international<br />
zusammengesetzten Gruppen bearbeitet. Die Aufgabenstellung sollen selbständig,<br />
ingenieurgerecht bearbeitet werden.<br />
� Kompetenzen wie Analyse- <strong>und</strong> Bewertungsfähigkeiten, Recherchearbeiten <strong>und</strong> Kommunikations-<br />
<strong>und</strong> Präsentationsfähigkeiten werden dadurch geschult <strong>und</strong> reflektiert.<br />
32
<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>.-<strong>Ing</strong>. Holger Watter Flensburg University of Applied Sciences<br />
A2.11 Übungen am Schiffsmaschinensimulator (Ship Engine Simulator)<br />
Der Schiffsmaschinensimulator SES 4000 (Ship Engine Simulator) bildet die wesentlichen<br />
Komponenten des technischen Schiffsbetriebes aus ca. 30 Subsystemen sowie deren Dynamik<br />
ab:<br />
� Hauptmaschine (SULZER 5-RTA 84 C),<br />
� Hilfsmaschinensysteme,<br />
� Bordnetz mit Stromerzeugungs-, Verteilungs- <strong>und</strong> Verbrauchersystem,<br />
� Mess-, Regelungs-, Überwachungs- <strong>und</strong> Automatisierungstechnik.<br />
Einen Überblick über die Systemkreisläufe erhalten Sie über http://www.fh-flensburg.de/watter<br />
Alle entscheidenden Prozessvariablen werden visualisiert. Beim Simulationslauf wird unter anderem<br />
ein virtueller Großdieselmotor betrieben <strong>und</strong> dessen Thermodynamik detailliert mittels<br />
eines Echtzeit-Rechenmodells nachgebildet. Durch die Veränderung von<br />
� 1300 Festwertparametern <strong>und</strong> die Einbindung von<br />
� 450 Störungsübungen<br />
in technische Szenarien kann der routinierte Umgang mit Notfallsituationen sowie deren Auswirkungen<br />
auf andere Systeme exemplarisch untersucht werden. Durch die Vielzahl der Störungsbeispiele<br />
(Malfunction) <strong>und</strong> die Möglichkeit der Veränderungen von Festwertparametern<br />
(Parameter Overwrite) besitzt die Simulationsanlage eine hohe Flexibilität. Die Weiterbildungskurse<br />
an der Maschinensimulationsanlage werden daher in Abhängigkeit von der Zielgruppe<br />
k<strong>und</strong>enspezifisch zusammengestellt:<br />
� IMO-Engine-Room Simulator Model-Course,<br />
� Familiarizations-Course,<br />
� Trouble-Shooting / Störungsübungen,<br />
� Kennfeldsimulation <strong>und</strong> Parametervariationen.<br />
Der Simulator verfügt über 2 Bediener-Arbeitsplätze <strong>und</strong> einen Instruktor-Arbeitsplatz, die alle<br />
gleichberechtigt auf das gleiche Simulationsmodell zurückgreifen. Es ist also eine gemeinsame<br />
Interaktion möglich <strong>und</strong> notwendig. Die Seminarteilnehmerzahl ist daher auf max. 6 beschränkt.<br />
33
<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>.-<strong>Ing</strong>. Holger Watter Flensburg University of Applied Sciences<br />
A3 Company <strong>Prof</strong>ile<br />
A3.1 Hamburg University of Applied Science (HAW)<br />
As a major port international relations have always played an important role in Hamburg's way of life.<br />
Hamburg University of Applied Sciences reflects this international outlook. Of the 14,000 students who<br />
study here approximately 1,800 students come from outside Germany, representing over 100 nations<br />
from all over the world. Hamburg University of Applied Sciences is the third largest university of its<br />
kind in Germany and the second largest university in Hamburg. Its thirteen departments offer a large<br />
variety of modern and practice-oriented degree programmes.<br />
A3.1.1 Faculty of Engineering and Computer Science (TI)<br />
For more information’s click http://www.haw-hamburg.de<br />
The Faculty of Engineering and Computer Science is our largest site - almost forty percent of our<br />
12,015 students are enrolled here. Four department of Hamburg University of Applied Sciences make<br />
up this faculty, covering a wide range of fields.<br />
In the Department of Automotive and Aeronautical Engineering the students are taught the engineering<br />
and design of vehicles and aircraft with the help of modern computer and laboratory technology.<br />
The study majors include body design, aircraft design and lightweight structures. Close cooperation<br />
with the important companies in the automotive industry and the immediate vicinity of Hamburg's<br />
aircraft production site (AIRBUS) - the third largest in the world - guarantee practice-oriented and<br />
state-of-the-art degree programmes with excellent career possibilities.<br />
Studies in the Department of Mechanical Engineering and Production Management link the fields<br />
of engineering and management. They contain the core areas of mechanical engineering such as<br />
develop- ment, construction, computer science, design and manufacturing as well as the control and<br />
optimisation of processes. Knowledge acquired in lectures is applied and tested in 12 modern laboratories.<br />
A flexible building block system with numerous modules makes an individual study focus and<br />
with it a tailor-made degree programme possible.<br />
The Department of Information and Electrical Engineering offers degree programmes with study<br />
majors in communication, automation and information technologies. Laboratory work and placements<br />
in industry ensure the transfer of theory into practice and encourage students to work independently<br />
with course material. Degree programmes in English as well as trilingual European degree programmes<br />
and a »Joint College« with a partner university in Shanghai <strong>und</strong>erline the department's focus<br />
on an international outlook.<br />
In the Department of Computer Science it is the professors' knowledge of project work and working in<br />
project teams that define the teaching style. The degree programmes lay a solid fo<strong>und</strong>ation in hardware<br />
and software for the development of application processes. Through the interplay of theory and<br />
practice students learn to develop solutions with the customer in mind. Research projects - also in<br />
collaboration with industry - ensure that students are involved in new development and that these are<br />
also incorporated into teaching.<br />
http://www.haw-hamburg.de/ti<br />
A3.1.2 Hydraulic and Pneumatic Laboratory<br />
Just as humans get the suppleness of their movements, elegance and power from their muscles,<br />
nerves, brain, bones and blood, it is hydraulics and pneumatics with their control and regulatory technologies<br />
and mechatronic systems that give machines, working and traffic systems their speed,<br />
power, precision and dynamics.<br />
What is Fluid Power and what does it do?<br />
Fluid Power – hydraulics and pneumatics – transmits power and output for driving, controlling and<br />
moving. Unlike electrical power transmission engineering, it uses the physical characteristics of a fluid<br />
such as water, oil or air, to transmit power and output. We come across it in all aspects of our daily<br />
lives. Hardly any product is developed without the use of Fluid Power, and barely a machine or aircraft<br />
moves without it; we are just not aware of it most of the time.<br />
The dynamics of machines and plants is often the result of hydraulic and pneumatic power transmission<br />
and control technology. For linear and rotary movements, even lifting or lowering movements,<br />
acceleration requirements, transferring power or positioning and holding in position, hydraulic and<br />
pneumatic components are used in almost all areas of industry. In competition with other forms of<br />
power transmission engineering, the outstanding feature of hydraulics is their particularly high power<br />
34
<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>.-<strong>Ing</strong>. Holger Watter Flensburg University of Applied Sciences<br />
to size ratio, while pneumatics epitomise speed and compactness. Due to their cost efficiency and<br />
easy handling and assembly, they are unbeaten in a large number of applications.<br />
The low power-weight ratio and the high power-to-size ratio mean that hydraulics are predestined for<br />
mobile applications, such as in construction machinery, agricultural machinery and communal machines.<br />
They also allow the generation of high forces and torques at low speeds and rotational speeds<br />
in stationary applications, such as machine tools and plastics machinery. Braking procedures are easy<br />
to perform without causing wear and tear. The braking energy can easily be stored and fed back to the<br />
system as and when required. In combination with electronic regulation systems, positioning accuracies<br />
can be achieved that are the equal of any electrical drive. This enhances the performance of machines,<br />
increases customer benefits and allows the constant development of new applications.<br />
35<br />
Source: www.vdma.org/fluid<br />
A3.1.3 Institute of Ship Operation, Sea Transport and Simulation (ISSUS)<br />
ISSUS is a research and training facility of Hamburg University of Applied Sciences (HAW). ISSUS<br />
investigates in complex shipping problems extending over various specialist fields in marine engineering<br />
and ship operations research. For example, combustions engines, auxiliary engines and system<br />
engineering, dynamic and vibration analysis, petrol, oil and lubrications (POL), energy and material<br />
flow analysis (environmental and emission analysis), ships technology and maschinery operation,<br />
survey and maintenance (operation and training regarding STCW95 and ISM-Code). In view of the<br />
increasing requirements, the growing use of technology and the competitive pressure in maritime<br />
shipping, the human being and his working environment are a suitable starting point for scientific investigations.<br />
Research and development at Hamburg University of Applied Sciences are dialogoriented:<br />
co-operation with shipping practice and with maritime industry, as well as exchanges with<br />
political decision makers form part of this dialog. For research and training activities HAW equipment<br />
vary from real equipment to a ship engine simulator.<br />
A3.2 Flensburg University of Applied Sciences (FUAS)<br />
Way up north – and way up in research and teaching Flensburg University of Applied Sciences<br />
(FUAS) currently provides nearly four thousand students in thirteen bachelor and seven master degree<br />
programmes in an innovative and practical learning environment. A walk through our modern<br />
campus will show you what university rankings repeatedly have confirmed – whether engineering or<br />
management, our university will provide you with an ideal study setting in every one of our departments.<br />
We boast clear and simple structures with a wide range of study courses, small seminar<br />
groups and excellently equipped labs and testing facilities at FUAS. Our regular technology and<br />
knowledge transfer with business as well as our own on-campus competence centres provides the<br />
best possible conditions for a future career. Innovative courses such as Biotechnology and Process<br />
Engineering or International Technical Communication affirm FUAS’s excellent reputation both at<br />
home and abroad. Following numerous technology and knowledge transfer projects, FUAS now<br />
boasts several special areas of competence, e.g. the fields of study Hospital Management and Energy<br />
and Environmental Management.<br />
To name a few examples, we have the Institute of Ship Operations Research (Institut für Schiffsbetriebsforschung)<br />
soon to be renamed as the Institute of Nautical Sciences and Maritime Technologies<br />
Institute (Institut für Nautik <strong>und</strong> Maritime Technologien), the Schleswig-Holstein CEwind e.G. Wind<br />
Energy Competence Centre (Kompetenzzentrum Windenergie Schleswig-Holstein), and the new Maritime<br />
Centre, which houses an entire ship’s engine control room simulator as well as six state of the art<br />
ship’s navigation and command simulators. Energy engineering has long since played a major role at<br />
FUAS; however, maritime sciences obviously also take an increasing important position in the university's<br />
range of subjects, in view of the university's regional backgro<strong>und</strong>. There is good reason for the<br />
excellent reputation that nautical specialists and maritime engineers from Flensburg enjoy in their future<br />
field of activity.<br />
Co-operation agreements have been reached with some 60 universities worldwide. Practically all<br />
courses of study are accredited, and confer internationally recognised Bachelor and Master degrees.<br />
FUAS can guarantee to equip its students with both professional and practical competences for a<br />
broad variety of tomorrow’s world challenges.<br />
FUAS has achieved another milestone in its future development as a training location by setting up its<br />
own university Maritime Centre. One of Europe's largest and most state-of-the-art simulator centres,<br />
the new building has six ship's bridges, thirty-three training and seminar rooms, a ship's engine room
<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>.-<strong>Ing</strong>. Holger Watter Flensburg University of Applied Sciences<br />
simulator, a ship security trainer, and a variety of computer-based teaching stations, some with 3D<br />
animation.<br />
After a construction phase of a year and a half, the 6.4 million Euro Centre was finally opened in May<br />
2011. The Centre provides 1,200 square metres of floor space that combine training areas once at<br />
separate locations, creating valuable synergy effects. As an example, you will find not only teaching<br />
events in our University of Applied Sciences' Marine Technology and Maritime Traffic, Nautical Science<br />
and Logistics bachelor's degree courses and System Engineering and Wind Engineering master's<br />
degree courses, but also the courses given by the Maritime Vocational College (Fachschule für<br />
Seefahrt). In addition, you will also find further training programmes held by the Kiel Canal maritime<br />
pilots' association. The Maritime Centre also provides further training and seminar opportunities for<br />
companies.<br />
Our motivation in concentrating our know-how and capability in maritime research and technology in<br />
one place came as a reaction to constantly increasing demand on the employment market with its<br />
enormous requirement for highly qualified nautical personnel. Maritime shipping is the global leader in<br />
terms of economic and ecological performance, with costs and emissions lower than competing transportation<br />
systems by several orders of magnitude.<br />
By operating the Maritime Centre, we at FUAS have taken on a teaching obligation to apply our scientific<br />
expertise for the future of shipping while addressing current and future challenges. This also<br />
means providing support in finding solutions to issues in study and final projects, and maintaining a<br />
broad international competence network of industrial players and associations.<br />
Our activities focus on energy efficiency, emission reductions, and safe, environmentally so<strong>und</strong> maritime<br />
operations. In addition to learning about engineering and technological topics and how they fit<br />
into context in bridge and engine room operations, we place very high priority on our students completely<br />
appreciating the importance of responsibility in dealing with complex systems in real-life applications<br />
at high sea.<br />
Safety First is one of the f<strong>und</strong>amental principles in protecting material values such as investment<br />
goods, but especially also human health and safety. In opening our Maritime Centre, we have taken a<br />
decisive step towards qualifying new academic generations of specialists while enhancing northern<br />
Germany's position as a location for learning and the region's role in developing innovative mobility<br />
concepts.<br />
36<br />
www.fh-flensburg.de<br />
http://www.fh-flensburg.de/watter<br />
A.3.2.1 Institute of Ship Operations Research (ISF) /Institute of Nautical Science<br />
and Maritime Technology – INMT<br />
The Institute of Ship Operations Research (ISF) /Institute of Nautical Science and Maritime<br />
Technology – INMT - is a research and training facility of FUAS. The INMT investigates in complex<br />
shipping problems extending over various specialist fields in marine engineering and ship operations<br />
research. For example, combustion engines, auxiliary engines and system engineering, dynamic and<br />
vibration analysis, petrol, oil and lubrications (POL), energy and material flow analysis (environmental<br />
and emission analysis), ships technology and machinery operation, survey and maintenance (operation<br />
and training regarding STCW95 and ISM-Code). In view of the increasing requirements, the growing<br />
use of technology and the competitive pressure in maritime shipping, the human being and its<br />
working environment are a suitable starting point for scientific investigations. Research and development<br />
at FUAS are dialog-oriented: co-operation with shipping companies and with maritime industry,<br />
as well as exchanges with political decision makers form part of this dialog. For research and training<br />
activities FUAS equipment vary from real equipment to a ship engine simulator and ship handling<br />
simulators.<br />
www.fh-flensburg.de/mz<br />
www.fh-flensburg.de/inmt<br />
www.fh-flensburg.de/isf
<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>.-<strong>Ing</strong>. Holger Watter Flensburg University of Applied Sciences<br />
A.3.2.2 Institute of Engine Technology and Systems<br />
The Institute of Engine Technology and Systems Engineering is a facility of the Faculty of Technology.<br />
It provides testing facilities and laboratory equipment needed for system <strong>und</strong>erstanding in<br />
different fields of study of the University. Some examples of broad and complex application areas are:<br />
mechanical engineering, electrical power engineering, regenerative energy systems, energy and environmental<br />
management, technology and maritime transport, nautical science. The system links and<br />
cooperation between the individual system components can be shown clearly and practical.<br />
37<br />
www.fh-flensburg.de/ima
<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>.-<strong>Ing</strong>. Holger Watter Flensburg University of Applied Sciences<br />
A4 Projekte / Projects<br />
Lernprojekte im Diplomstudiengang - Wahlpflichtmodul<br />
“Innovative Energieversorgung”:<br />
[1] Auslegung- <strong>und</strong> Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen<br />
einer solarthermischen Anlage (2005)<br />
[2] Autarke Energieversorgung einer Hochseeyacht<br />
(2005)<br />
[3] Marktübersicht Holzpelletsheizung (2005)<br />
[4] Betriebserfahrungen mit einer solartherm. Anlage zur<br />
Brauchwassererwärmung <strong>und</strong> Rücklauftemperaturanhebung<br />
(2006)<br />
[5] Auslegung- <strong>und</strong> Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen<br />
einer Kleinstwindkraftanlage´(2007)<br />
[6] Energie- <strong>und</strong> CO2-Bilanz einer Erdwärmepumpe<br />
(2007)<br />
[7] Umwandlung von Biomasse (Verfahrensparameter,<br />
Effizienz, Produktausbeute (2008)<br />
Lernprojekte im Diplomstudiengang – Projekt 1 „Regenerative<br />
Energiesysteme“:<br />
[8] Simulation des Ertrages einer solartherm. Anlage<br />
<strong>und</strong> Optimierung der Anlagenregelung unter<br />
wirtschaftl. <strong>und</strong> ökologischen Aspekten: Eine<br />
solartherm. Anlage soll hinsichtlich des energetischen<br />
<strong>und</strong> wirtschaftlichen Ertrages simuliert <strong>und</strong> die Auswirkungen<br />
unterschiedlicher regelungstechnischer<br />
Konzepte untersucht werden (2006).<br />
[9] Prognostizierung von realistischen Jahresarbeitszahlen<br />
von Erdwärmepumpen: In Broschüren<br />
wird oft mit <strong>Leistungs</strong>zahlen von 3 bis 5 geworben.<br />
Welche Betriebsparameter müssen dazu eingehalten<br />
werden? Wie realistisch sind diese Werte im Jahresmittel?<br />
Welche tatsächlichen Jahresarbeitszahlen<br />
sind realistisch? Welche Normen zur Dimensionierung<br />
gibt es dazu? Die Betriebswerte sind anhand<br />
von Jahresverbrauchsabrechnungen zu evaluieren<br />
(2007).<br />
[10] Versuchskonzeption für einen Stirling-Motor: Es<br />
steht ein Stirling-Motor zur Verfügung. Der Versuchsstand<br />
soll für den Lehrbetrieb aufgebaut werden: (1)<br />
Dokumentation der Betriebs- <strong>und</strong> Konstruktionsparameter,<br />
(2) Recherche zu Einsatzmöglichkeiten in<br />
der Energietechnik (z.B. Dish-Stirling,<br />
Abwärmenutzung....), (3) Versuchskonzeption, (4)<br />
Web-Präsentation für den Bereich "Energie- <strong>und</strong> Anlagentechnik"<br />
(2007).<br />
[11] Konzeption eines Blockheizkraftwerk für das<br />
Data-Center in der Maschinenhalle der HAW: (1)<br />
Aufnahme der erforderlichen Spezifikationsdaten<br />
(kann von der Bauabteilung geliefert werden: Notstromkapazität,<br />
Kältebedarf, Heizkosten Maschinenhalle),<br />
(2) Marktrecherche, (3) Festlegung der erforderlichen<br />
Eckdaten / Grobauslegung (4) Web-<br />
Präsentation für den Studiengang "Energie- <strong>und</strong> Anlagentechnik"<br />
(2008).<br />
[12] Konzeption eines Mobilen Labors für Erneuerbare<br />
Energie: Die Ausstattung der Fakultät im Bereich Erneuerbare<br />
Energie ist veraltet <strong>und</strong> unzureichend. Ziel<br />
dieses Vorhabens ist es, den aktuellen Stand der<br />
Technik im Bereich erneuerbare Energie abzubilden<br />
<strong>und</strong> auf dieser Gr<strong>und</strong>lage Lehre <strong>und</strong> Forschung in<br />
diesem Bereich weiter zu entwickeln. Um Diskussion<br />
im Bereich der Erneuerbaren Energie nachhaltig voranzutreiben,<br />
wird ein mobiles Labor für Erneuerbare<br />
Energien als Containerlösung vorgeschlagen. Ziel ist<br />
es, den Container möglichst autark hinsichtlich Strom<br />
<strong>und</strong> Wärme betreiben zu können. Langzeit- <strong>und</strong><br />
Echtzeitdaten sollen via Internet den Studierenden<br />
zur Verfügung gestellt werden. Mit dem Mobilitätskonzept<br />
sollen Messe- <strong>und</strong> Werbeauftritte der Fakultät<br />
in der Außenwirkung verbessert werden. Kurzfristig<br />
soll durch die Planung <strong>und</strong> Projektierung, langfris-<br />
38<br />
tig durch Ausarbeitung der energetischen Optimierungspotential,<br />
die Lehre unterstützt werden (2008).<br />
[13] Umwandlung von Biomasse: In der aktuellen Diskussion<br />
nimmt die stoffliche Umwandlung von Biomasse<br />
in feste, flüssige oder gasförmige Energieträger<br />
breiten Raum ein. Im Rahmen des Projektes sind<br />
daher die nachfolgenden Themenkomplexe zu untersuchen<br />
<strong>und</strong> zu bewerten: (1) Biogas / Fermentation<br />
(2) Biokraftstoffe (BtL - Biomass to Liquid) (3) Vergasung<br />
<strong>und</strong> Pyrolyse. Dabei sollte die nachfolgende<br />
Grobstruktur z.B. für ausgewählte Referenzanlagen<br />
angewendet <strong>und</strong> inhaltlich gefüllt werden: (a) Verfahrensbeschreibung<br />
(b) physikalisch-chemische Gr<strong>und</strong>lagen<br />
(c) Betriebsparameter (<strong>Dr</strong>uck, Temperatur,<br />
Verweildauer) (d) Stoffströme <strong>und</strong> Energiebilanzen<br />
(e) Problembereiche / Risiken (f) Marktrecherche (zu<br />
Anbietern <strong>und</strong> ggf. Referenzanlagen) (g) Zusammenfassung/Bewertung<br />
(h) Quellen- <strong>und</strong> Literaturhinweise<br />
(2008).<br />
[14] Entwicklung <strong>und</strong> Konstruktion von Versuchsständen<br />
zum Thema erneuerbare Energie: Für einen<br />
exemplarischen Bereich zum Thema Erneuerbare<br />
Energie ist ein Versuchsstand zu entwickeln. Dabei<br />
ist insbesondere auf die folgenden Punkte einzugehen<br />
(1) Zielsetzung des Versuches (2) Konzeption<br />
des Versuchsstandes (3) Dimensionierung <strong>und</strong> Kostenschätzung<br />
für den Versuchsstand.<br />
[15] Konstuktion einer Kleinstwindkraftanlage: Für<br />
eine Demonstrationsanlage ist ein geeignetes Schaufelprofil<br />
auszuwählen, eine Demonstrationsanlage mit<br />
80-cm-Schaufellänge zu konstruieren, eine <strong>Leistungs</strong>prognose<br />
für mittlere Windgeschwindigkeiten<br />
von 3…5m/s abzugeben <strong>und</strong> Konstruktionszeichnungen<br />
in CAD anzufertigen sowie Fertigungspläne<br />
zu erstellen.<br />
[16] Holzvergaserprüfstand (2008): Für einen vorhandenen<br />
Holzvergaser-Pkw ist die vorhandene Ausrüstung<br />
ingenieurgerecht zu analysieren <strong>und</strong> zu bewerten.<br />
Dazu ist das System zunächst fachgerecht hinsichtlich<br />
thermochemischer Umsetzung, Energiebilanz,<br />
<strong>und</strong> Prozessführung darzustellen. Aus der vorhandenen<br />
Konfiguration sind Empfehlung für einen<br />
neu zu konzipierenden Aufbau abzuleiten <strong>und</strong> ein Vorentwurf<br />
zu erstellen.<br />
[17] Wavestar (2008): Das Systeme WAVESTAR<br />
(http://www.wavestarenergy.com/) ist hinsichtlich seiner<br />
Energieeffizienz zu bewerten. Ausgehend von einer<br />
Wellenhöhe von 1m sind die <strong>Leistungs</strong>potentiale der<br />
vorhandenen Pilotanlage zu prognostizieren. Es ist<br />
zu prüfen, ob die Anlage auf den Labormaßstab<br />
herunterskaliert werden kann. Hierzu ist eine Vorstudie<br />
(Berechnung <strong>und</strong> Grobentwurf) zu erstellen.<br />
[18] Biogas-Campus (2008): Am Campus Berliner Tor<br />
arbeiten ca. 160 <strong>Prof</strong>. <strong>und</strong> etwa die gleiche Anzahl an<br />
Mitarbeiter in Lehre <strong>und</strong> Verwaltung (plus Hochschulverwaltung),<br />
es studieren ca. 5000 Studierende am<br />
Standort Berliner Tor. Es fallen entsprechende Mengen<br />
an Abortwasser <strong>und</strong> Reste aus dem Mensabetrieb<br />
an. Es ist eine Machbarkeitsstudie für eine Biogasanlage<br />
zur Stromerzeugung für den Standort zu<br />
erstellen. Dazu sind die Stoffströme zu bilanzieren<br />
<strong>und</strong> möglichst exakt abzuschätzen. Die daraus resultierende<br />
Biogas- <strong>und</strong> Energiemengen sind darzustellen<br />
<strong>und</strong> bewerten. Für die motorische Verbrennung<br />
sind geeignete Motorenanbieter auszuwählen (kleine<br />
Marktübersicht) <strong>und</strong> die elektrischen <strong>und</strong> thermischen<br />
Erträge zu prognostizieren.<br />
[19] Osmosekraftwerk (2008): Ein Osmosekraftwerk<br />
(Salzgradientenkraftwerk) ist ein Kraftwerk, das den<br />
Konzentrationsun-terschied des Salzgehaltes zwischen<br />
Süßwasser <strong>und</strong> Meerwasser nutzt. Für eine<br />
Machbarkeitsstudie sind die physikalischen Wirkme-
<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>.-<strong>Ing</strong>. Holger Watter Flensburg University of Applied Sciences<br />
chanismen <strong>und</strong> die <strong>Leistungs</strong>potentiale darzustellen<br />
(Literaturrecherche) <strong>und</strong> zu bewerten<br />
(Überschlagsrechnungen Stoff- <strong>und</strong> Energieströmen).<br />
Darauf aufbauend ist eine Konzeptstudie für einen<br />
Versuchsstand zu erstellen (Werkstoffe, Materialien,<br />
Prüfstandsausstattung, geometrische Abmessungen,<br />
ggf. Prüfstandsvarianten). Die Konzeptstudie soll inhaltlich<br />
<strong>und</strong> formal wissenschaftlichen Ansprüchen<br />
genügen <strong>und</strong> Gr<strong>und</strong>lage für die Detailplanung sein.<br />
Lernprojekte im Masterstudiengang “Innovative Energieversorgung”:<br />
[20] Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen <strong>und</strong> Dimensionierung<br />
einer solartherm. Anlage für einen Anwendungsfall<br />
(2007)<br />
Bachelor-Projekte<br />
[21] Regenerative Versorgung des Campusbades:<br />
Energiebilanzen <strong>und</strong> Versorgungspotentiale (BP,<br />
2011)<br />
[22] Regenerative Trinkwasserversorgung: Im Rahmen<br />
des Projektes sind die Optionen zu einer dezentralen<br />
Trinkwasserversorgung in Mangelgebieten auf Basis<br />
regenerativer Energiesysteme zu untersuchen, quantitativ<br />
zu bewerten <strong>und</strong> Lösungsoptionen vorzuschlagen.<br />
Dazu sind die verfügbaren Energie- <strong>und</strong> Wasserquellen<br />
systematisch zu erfassen <strong>und</strong> mit Hilfe<br />
von Überschlagrechnungen hinsichtlich der Angebots-<br />
<strong>und</strong> Nutzungspotentiale zu bewerten. Exemplarisch<br />
ist dabei auf die Trinkwasserversorgung eines<br />
39<br />
[23]<br />
Dorfes mit 200 Personen in einer Wassermangelregion<br />
in Afghanistan zu fokussieren <strong>und</strong> die Machbarkeit<br />
<strong>und</strong> Zweckmäßigkeit der nachfolgenden Systeme<br />
ausführlicher darzustellen: (1) <strong>Dr</strong>uckluftbetriebene<br />
Gr<strong>und</strong>wasserpumpe (Antrieb über Savonius-Rotor<br />
inkl. Darstellung des jahreszeitlichen Windangebotes<br />
<strong>und</strong> der Wirkungsgradpotentiale); (2)Luftentfeuchter<br />
(entweder über Kompression oder mittels Salzsole;<br />
Energiezufuhr über Solarkollektor/Photovoltaik[evt.<br />
mit Konzentrator inkl. jahres- <strong>und</strong> tageszeitlichen<br />
Sonnenenergie, –leistungsangebot <strong>und</strong> Wandlungsverlusten.<br />
Master-Projekte<br />
[24] Lilley, S.P.: CFD-Untersuchungen an einem<br />
FLETTNER-Rotor (MP, 2011): Für einen FLETT-<br />
NER-Rotor sind die Widerstands- <strong>und</strong> Auftriebsbeiwerte<br />
in Abhängigkeit von der Anström- <strong>und</strong> der Umfangsgeschwindigkeit<br />
mittels CFD zu ermitteln <strong>und</strong> zu<br />
bewerten. Der Einfluss der Oberflächenrauigkeit sowie<br />
die optimale Abhängigkeit der <strong>Dr</strong>ehzahl von den<br />
Anströmverhältnissen sind zu untersuchen. Die<br />
prognostizierten Kräfte sind mit Literaturwerten <strong>und</strong><br />
Messwerten zu vergleichen. Es ist eine Ertragsprognose<br />
für den Modellversuch am Strömungskanal im<br />
Maschinenlabor <strong>und</strong> für ein real ausgeführtes Schiff<br />
in Form von Polardiagrammen oder als Kennfelddatenblatt<br />
abzugeben. Handlungsanweisung für die<br />
Konstruktion <strong>und</strong> die Betrieb sind abzuleiten.<br />
A5 Studien- <strong>und</strong> Diplomarbeiten / Bachelor- and Master Theses<br />
[25] Obst, Christian: Implementation einer Lernsoftware<br />
zur computerunterstützten Ausbildung am<br />
Beispiel des Themenkomplexes „Brennstoffsysteme<br />
u. Brennstoffaufbereitung (D, 1997): International,<br />
verbindliche Übereinkommen zielen daher in jüngster<br />
Zeit besonders auf die Aus- <strong>und</strong> Weiterbildung von Seeleuten<br />
(STCW) sowie die Einführung eines Systems zur<br />
Überwachung von betriebsinternen Abläufen <strong>und</strong> Ausbildungsstandards<br />
(ISM) ab. Insbesondere das STCW-<br />
Abkommen empfiehlt dazu u.a. den „erprobten“<br />
Simulatorbetrieb (vgl. STCW Kap. I/12). Ziel dieser Arbeit<br />
war es daher, ein Lernprogramm zu entwickeln, das<br />
in Bezug auf das Brennstoffsystem sowohl für Ausbildungseinrichtungen<br />
(Fachschule, Fachhochschule) als<br />
auch für den Betreiber eines Schiffes im Sinne der o.g.<br />
Rechtsnormen zum Einsatz kommen könnte.<br />
[26] Klesper, Lukas: Analyse der Schmierölstandzeiten<br />
auf einer Schnellfähre (D, 1998): Im Rahmen<br />
dieser Arbeit sollen die Betriebsbedingungen eines speziell<br />
entwickelten Schmieröls in einem schnellaufenden<br />
Dieselmotor vom Typ MTU 20 V 1163 TB 73, der als<br />
Hauptantrieb für eine Doppelrumpf-Schnellfähre dient,<br />
untersucht werden. Dabei ist insbesondere die Historie<br />
der bisher aufgetretenen, betrieblichen Probleme umfassend<br />
darzustellen <strong>und</strong> die Schmierölbelastung hinsichtlich<br />
konstruktiver, chemischer <strong>und</strong> motorspezifischer<br />
Einflussgrößen zu analysieren. Die Arbeit wurde in Zusammenarbeit<br />
<strong>und</strong> für die Firma BP Marine, Hamburg,<br />
erstellt. Da die Arbeit unternehmensinterne <strong>und</strong> marketing-strategische<br />
Daten enthält, wird von einer Veröffentlichung<br />
über die Hochschulbibliothek abgesehen.<br />
[27] Marquardt, Bernd: Einsatz der Brennstoffzelle auf<br />
Handelsschiffen: Aktueller Stand, Chancen <strong>und</strong> Perspektiven<br />
(D, 1999): In jüngster Zeit wurde die Entwicklung<br />
der Brennstoffzelle insbesondere für den Kraftfahrtzeug-<br />
<strong>und</strong> den militärischen Bereich besonders forciert.<br />
Wegen des günstigen Wirkungsgrade (55 bis 65 %, zukünftig<br />
auch mehr) <strong>und</strong> den geringe Stickoxidemissionen<br />
könnte diese Neuentwicklung auch für den Schiffsbetrieb<br />
interessant sein. Besonders in Hinblick auf verschärfte<br />
Umweltauflagen in Sondergebieten <strong>und</strong> Hafengebühren,<br />
die sich an den Schadstoffemissionen orientieren, könnte<br />
sich hier eine interessante Zukunftsperspektive anbahnen.<br />
Es ist zu untersuchen, unter welchen Bedingungen<br />
sich der Einsatz betriebswirtschaftlich rentieren<br />
würde (Entwicklung der Brennstoffpreise, staatliche Auflagen<br />
... ) <strong>und</strong> welcher Brennstoffzellentyp für den Bordeinsatz<br />
(auch unter logistischen Gesichtspunkten) sinnvoll<br />
erscheint (z.B. auf LNG-Tankern).<br />
[28] Geberbauer, Thomas: Evaluation von Verfahren zur<br />
Messung der Strömungsgeschwindigkeit im Abgaskanal<br />
von Schiffsmotoren (D, 2000): Nach MARPOL<br />
73/78 Annex VI werden erstmals Grenzwerte für Abgasemissionen<br />
von Schiffsdieselmotoren definiert. Die Einhaltung<br />
dieser Grenzwerte soll u.a. durch die Klassifikationsgesellschaften<br />
überwacht <strong>und</strong> bescheinigt werden.<br />
Dazu stehen verschiedene Meßmethoden zur Verfügung.<br />
Aufwendige Laborverfahren sind wegen der engen<br />
räumlichen <strong>und</strong> zeitlichen Gegebenheiten an Bord eines<br />
Seeschiffes aus Sicht einer Klassifikationsgesellschaft<br />
nicht praktikabel. Gesucht werden daher Meßverfahren,<br />
die für die Bordpraxis geeignet sind (einfacher, schneller<br />
Auf- <strong>und</strong> Abbau, hinreichend genau). Die verfügbaren<br />
Meßmethoden sind aus dieser Sichtweise <strong>und</strong> durch<br />
verschiedene chemische <strong>und</strong> physikalische Effekte (fehlerbehaftete<br />
Umrechnung Vol.-%� Masse-%, pulsierende<br />
<strong>und</strong> unsymmetrische Strömungsprofile, Bestimmung<br />
einer repräsentativen Abgasprobe ...) unterschiedlich<br />
geeignet sowie die anschließende Interpretation mit stochastischen<br />
<strong>und</strong> systematischen Fehlern behaftet. Es<br />
sollen anwendungsorientierte Meßverfahren vorgestellt,<br />
untersucht <strong>und</strong> bewertet werden. Die Diplomarbeit wird<br />
fachlich vom GERMANISCHEN LLOYD (Research and<br />
Advanced Engineering Division - Mechanical Engineering<br />
Department) unterstützt.<br />
[29] Springer, Jörn: Exemplarische Untersuchung<br />
von Schäden an Schiffsdieselmotoren (D, 2001): In<br />
jüngster Zeit kam es zu einer nicht unbeträchtlichen<br />
Häufung von Gr<strong>und</strong>lagerschäden an 2-Takt-<br />
Schiffsdieselmotoren. Die Lagerschäden führten zum
<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>.-<strong>Ing</strong>. Holger Watter Flensburg University of Applied Sciences<br />
Totalausfall der Hauptmaschine; zum Teil bereits nach<br />
relativ kurzen Betriebsphasen. Es sind 40 Lagerschäden<br />
eines Motortyps für eine Reederei exemplarisch zu untersuchen.<br />
Dabei soll das verfügbare Datenmaterial<br />
(Schadensbilder, <strong>Dr</strong>ehschwingungsrechnung, Zapfenverlagerungsbahnberechnung<br />
u.a.) gesichtet, untersucht<br />
<strong>und</strong> bewertet werden. Insbesondere die betrieblichen<br />
Aspekte sind im Rahmen einer Mitfahrt zu verifizieren.<br />
[30] Schuchardt, Robert: Untersuchung über die<br />
Wechselwirkung zwischen Brenngas, Schmieröl <strong>und</strong><br />
Lagern bei Gasmotoren (D, 2001): Erd-, Deponie-,<br />
Klär- <strong>und</strong> andere Brenngase können in Blockheizkraftwerken<br />
(BHKW) durch Gasmotoren einer energetischen<br />
Verwertung zugeführt werden. Diese Brenngase<br />
unterliegen dabei z.T. beträchtlichen Schwankungen<br />
in der Gaszusammensetzung. In Abhängigkeit von<br />
der Gaszusammensetzung <strong>und</strong> dem Verbrennungsvorgang<br />
(Motorbelastung etc.) entstehen giftige, korrosive<br />
<strong>und</strong> reaktionsfreudige chemische Verbindungen. Im<br />
Rahmen dieser Arbeit sollen die Wechselwirkungen zwischen<br />
Brenngas, Schmieröl <strong>und</strong> Lagern untersucht, bewertet<br />
<strong>und</strong> dargestellt werden. Die Arbeit wird von der<br />
Firma DEUTZ AG (namentlich Herrn <strong>Dr</strong>.-<strong>Ing</strong>. Dirk Postel)<br />
unterstützt.<br />
[31] Försterling, Guido: Erstellung eines Öko-<br />
Controlling-Systems für den Bau <strong>und</strong> Betrieb seegehender<br />
Handelsschiffe (Zweit-Korrektur, D 2001): Am<br />
Beispiel des MS CAP FINISTERRE ist für die Firma<br />
COLUMBUS SHIPMANAGEMENT GmbH ein Öko-<br />
Controlling-System zu entwerfen. Dabei sind die besonderen<br />
Bedingungen der internationalen Seeschifffahrt<br />
(MARPOL, Green Award, Tripartite Agreement o.ä.) zu<br />
berücksichtigen <strong>und</strong> die in der Industrie eingeführten<br />
Werkzeuge des Öko-Controllings exemplarisch auf das<br />
Propulsionssystem zu übertragen.<br />
[32] Winter, Jens: Ein Beitrag zur geplanten Instandhaltung<br />
(PMS) gem. ISM-Code am Beispiel eines 1450<br />
TEU-Schiffes (D, 2001/2002): Im Rahmen der international<br />
verbindlichen Vorschriften des ISM-Codes (International<br />
Safety Management Code) wird eine vorausschauende,<br />
geplante Instandhaltung gefordert <strong>und</strong> ein<br />
entsprechendes Sicherungssystem vorgeschrieben<br />
(PMS = Planned Maintenance System). Durch akkreditierte<br />
Stellen (Klassifikationsgesellschaften) kann dieses<br />
System geprüft, bescheinigt <strong>und</strong> zertifiziert werden. Für<br />
eine mittelständische Reederei ist am Beispiel eines<br />
1450 TEU-Schiffes, ein praktikabler Umsetzungsvorschlag<br />
zu erarbeiten <strong>und</strong> mit der zuständigen Klassifikationsgesellschaft<br />
abzustimmen. Die Arbeit wird vom<br />
DNV (Det Norske Veritas) unterstützt.<br />
[33] Lorentzen, Dirk: Volumenreduktion vergorenen<br />
Biomassesubstrats aus Biogasanlagen (D,<br />
2001/2002): Aufgr<strong>und</strong> der besonderen Situation in der<br />
Seeschifffahrt <strong>und</strong> den betriebstechnischen Erfahrungen<br />
finden Schiffsingenieure traditionell gute Beschäftigungsmöglichkeiten<br />
auch in der verfahrenstechnischen<br />
Industrie. Durch die aktuellen politischen Vorgaben<br />
(EEG = Erneuerbarer-Energie-Gesetz) zeigen sich derzeitig<br />
Anwendungs- <strong>und</strong> Innovationsschübe in Bezug auf<br />
Biogasanlagen. Die Behandlung der Biomassen (Transport,<br />
Entsorgung, Veredelung etc.) stellt dabei ein besonderes<br />
Problem dar. Es ist der aktuelle 'Stand der<br />
Technik' für die Volumenreduktion von Biomasse darzustellen,<br />
zu erörtern <strong>und</strong> zu bewerten.<br />
[34] Engelken, Florian: Ein Beitrag zur Auslegung von<br />
Schmierölsystemen zur Gewährleistung eines sicheren<br />
Motorenbetriebes auf Seeschiffen (D, 2002): Der<br />
GERMANISCHE LLOYD stellt als Klassifikationsgesellschaft<br />
zunehmend fest, dass die Konstruktionsabteilungen<br />
der Werften <strong>und</strong> Zulieferindustrie ihre Bauteile immer<br />
dichter an die Belastungsgrenzen<br />
'herandimensionieren'. Ziel dieser Arbeit ist es, am Beispiel<br />
des Schmierölsystems die derzeitigen Erfahrungen<br />
40<br />
<strong>und</strong> die Konstruktionspraxis mit den Anforderungen der<br />
Hersteller sowie mit den Erfordernissen <strong>und</strong> Erfahrungen<br />
einer Klassifikationsgesellschaft zu vergleichen, darzustellen<br />
<strong>und</strong> zu bewerten. Die Arbeit wird fachlich <strong>und</strong><br />
personell vom Germanischen Lloyd unterstützt <strong>und</strong> gefördert.<br />
[35] Kühne, Manuel: Ein Beitrag zur Berechnung<br />
von Ladungswechselvorgängen bei 4-Takt-<br />
Schiffsdieselmotoren (D, 2002): Der Ladungswechsel<br />
von 4-Takt-Motoren kann durch eine geeignete<br />
Saugrohrabstimmung optimiert werden: Durch die<br />
abwärtsgerichtete Kolbenbewegung wird eine<br />
Unterdruckwelle indiziert, deren Laufzeit im Saugrohr<br />
durch die Schallgeschwindigkeit a <strong>und</strong> die<br />
Saugrohrlänge l gegeben ist. Die austretende<br />
Unterdruckwelle erzeugt dabei wiederrum eine<br />
Überdruckwelle am Saugrohraustritt, die ebenfalls mit<br />
der Schallgeschwindigkeit a nun jedoch in Richtung<br />
Brennraum läuft. Durch geeignete Abstimmung der<br />
Ventilöffnungszeiten <strong>und</strong> der Saugrohrlänge, läßt sich so<br />
eine optimierte Frischladungsmenge erzeugen. Die<br />
Parameter der <strong>Dr</strong>uckwelle (Wellenlänge, Laufzeit,<br />
Amplitute) können mit Hilfe von Differentialgleichungen<br />
beschrieben werden. Es ist eine Literaturrecherche<br />
sowie ein Überblick zu den analytischen <strong>und</strong><br />
numerischen Verfahren zur Berechnung der<br />
dynamischen Vorgänge beim Ladungwechsel zu<br />
erstellen. Zusätzlich soll ein praktikabler Vorschlag zur<br />
Visualisierung dieser Vorgänge im Rahmen der Lehre<br />
vorgelegt werden (Software- oder Simulations-Tools).<br />
[36] Strödeke, Daniel: Eine Machbarkeitsstudie zur<br />
Application eines Brennstoffzellensystems unter<br />
besonderer Berücksichtigung der<br />
Brenngaserzeugung an Bord einer Mega-Yacht (D,<br />
2002): Brennstoffzellensysteme haben die Phase der<br />
Laborerprobung verlassen <strong>und</strong> werden z.Zt. in zahlreichen<br />
Feldversuchen untersucht. Vereinzelt drängen<br />
kommerzielle Systeme auf den Markt (Pkw, Hausfeuerungsanlagen,<br />
stationäre BHKW’s, militärische Anwendungen).<br />
Im Bereich der Mega-Yachten sind Ansätze erkennbar,<br />
die eine Applikation an Bord sinnvoll erscheinen<br />
lassen (Emissionsforderungen, Statussymbole). Für<br />
eine gegebene Schiffspezifikation <strong>und</strong> –konstruktion ist<br />
eine Machbarkeitsstudie zu erstellen. Dabei ist der<br />
Stand der Technik zu evaluieren, ein sinnvolles Brennstoffzellensystem<br />
auszuwählen <strong>und</strong> die Applikationsanforderungen<br />
zu spezifizieren (u.a. räumliche, betriebliche,<br />
sicherheitstechnische Anforderungen, Seebetrieb,<br />
Hafenbetrieb etc.). Die Arbeit wird von der Firma<br />
BLOHM + VOSS (Schiffsneubau) unterstützt.<br />
[37] Wesselhöft, Maren: A Fuel Cell Auxiliary Power<br />
Supply Unit on Board the Cruise Ship Class MV RA-<br />
DIANCE OF THE SEAS (D, 2002): In recent years, fuel<br />
cell (FC) systems have become more and more sophisticated.<br />
The number of successful field projects is increasing,<br />
power densities are improving and novel materials<br />
are being researched. Mobile applications in the<br />
automotive sector are approaching serial production and<br />
the maritime industry has seen its first project in form of<br />
a fuel cell powered submarine. Fuel cell plants for merchant<br />
ships, however, have not yet gone beyond the<br />
theoretical stage at which their application is only generally<br />
possible. The levels of power required are so high<br />
that they have not yet been attained, not even in stationary<br />
plants. This report aims at describing the state of the<br />
art potential for marine fuel cell applications, as well as<br />
system deficiencies and research requirements. General<br />
applicability of FC systems is discussed and several solutions<br />
for the integration of a fuel cell auxiliary power<br />
supply unit on board the cruise vessels of the “Radiance<br />
of the Seas” Class are proposed. This report is promoted<br />
and supported by DNV (Det Norske Veritas, Classifica-
<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>.-<strong>Ing</strong>. Holger Watter Flensburg University of Applied Sciences<br />
tion Society, Oslo) and Jos. L. Meyer GmbH (Papenburg,<br />
Shipbuilder).<br />
[38] Baumann: Kalibrierung eines Rechenmodells zur<br />
Bestimmung des Axialschubes an<br />
Turboladerrotoren (D, 2002): Der Axialschub ist ein<br />
wichtiger Parameter für die Lagerauslegung an Turboladern.<br />
Da eine unmittelbare Messung aufwendig ist, wird<br />
der Axialschub anhand gemessener <strong>Dr</strong>ücke auf der Basis<br />
einer Kräftebilanz am Rotor berechnet. Die hierzu erforderliche<br />
Subtraktion verschiedener Einzelkräfte bedingt<br />
eine große Rechenunsicherheit, so dass eine Kalibrierung<br />
des Rechenmodells erforderlich ist. Im Rahmen<br />
der dargestellten Problematik ergeben sich folgende<br />
Teilaufgaben der Diplomarbeit: (1) Unmittelbare Messung<br />
des Axialschubes mit Hilfe einer Kraftmessdose,<br />
(2) Messung der zugehörigen <strong>Dr</strong>ücke in den Radseitenräumen<br />
sowie vor <strong>und</strong> nach den Läufern, (3) Ermittlung<br />
von Kalibrierungsfaktoren anhand des Vergleichs zwischen<br />
Messung <strong>und</strong> Rechnung. Die Arbeit wird von der<br />
Firma MAN B&W DIESEL AG (MBD Turbocharger,<br />
Augsburg) unterstützt.<br />
[39] Schaade, Burghart: Untersuchung einer Triebraumexplosion<br />
sowie die nautische, technische <strong>und</strong> juristische<br />
Bewertung der Folgeschäden am Beispiel eines<br />
Vielzweckfrachters (D, 2002): Auf dem Containerschiff<br />
EMIL NOLDE der Reederei BELUGA (Bremen) ist<br />
es zu einer Triebraumexplosion bei einem mittelschnelllaufenden<br />
4-Takt-Dieselmotor vom Typ MAK gekommen.<br />
Im Rahmen der Diplomarbeit ist eine Schadensanalyse<br />
durchzuführen. Dazu ist die Schadenshistorie<br />
sowie alle verfügbaren Unterlagen zu sichten <strong>und</strong> zusammenfassend<br />
zu bewerten. Die Arbeit wird fachlich<br />
von der BELUGA-Reederei <strong>und</strong> der Firma SCHALLER-<br />
AUTOMATION unterstützt.<br />
[40] Vielhaber, Marcus: Monitoring <strong>und</strong> Diagnose von<br />
<strong>Dr</strong>ehschwingungen auf einem Feeder-Container-<br />
Schiff (D, 2003/2004): In der Fachliteratur wird immer<br />
wieder von Schäden durch <strong>Dr</strong>ehschwingungen berichtet.<br />
Diese Schäden haben in letzter Zeit zugenommen. Zum<br />
einen wird aus Kostengründen immer dichter an die Belastungsgrenzen<br />
herandimensioniert, zum anderen wird<br />
das System durch unterschiedlichste Schwingungserregungen<br />
komplexer belastet (Motor, Propeller, Wellengenerator/Bordnetz,<br />
Eigenfrequenzen der Regelkreise,<br />
dyn. Belastungen durch Schaltvorgänge etc.). Durch die<br />
Überwachung der <strong>Dr</strong>ehschwingungen, bietet sich die<br />
Möglichkeit Veränderungen im Systemverhalten frühzeitig<br />
zu erkenne <strong>und</strong> durch geeignete Maßnahmen Schäden<br />
zu vermeiden. Es ist ein solches Monitoring <strong>und</strong> Diagnose<br />
System (MDS) in einem konkreten Anwendungsfall<br />
(MS HELGALAND, Baunr. 1160 der Sietas-Werft, MAK<br />
9M43) in den technischen Schiffsbetrieb zu integrieren.<br />
Dazu soll der Anlagenzustand beschrieben (<strong>Dr</strong>ehschwingungsrechnung,<br />
Systemverhalten, Historie), das<br />
Analysesystem implementiert (Einbauplanungen, Inbetriebnahme<br />
des Systems, Messwerterfassung, Betriebsdatenanalyse)<br />
sowie Schlussfolgerungen <strong>und</strong><br />
Handlungsempfehlungen abgeleitet (Schiffsbetrieb,<br />
Schiffsbesetzung, Klassifikation etc.) werden. Die Arbeit<br />
wird unterstützt durch die PETRA HEINRICH KG MS „HEL-<br />
GA“ GMBH & CO KG (Jork) <strong>und</strong> die VULKAN KUPPLUNGS-<br />
UND GETRIEBEBAU GMBH & CO KG (www.vulkan24com)<br />
unterstützt.<br />
[41] Barth, Frederic: Modellbildung <strong>und</strong> dynamisches<br />
Verhalten eines Zugdrachens für Schiffe (D,<br />
2004): Im Rahmen des BMBF/AIF-Projektes SKYSAIL<br />
soll die Produktentwicklung eines Zugdrachens für Schiffe<br />
zur Einsparung von Kraftstoffverbrauch <strong>und</strong> Schadstoffemissionen<br />
unterstützt werden. Dazu ist u.a. die<br />
Entwicklung eines dynamischen Modells Schiff-Seil-<br />
<strong>Dr</strong>achen sowie die regelungstechnische Beschreibung<br />
dieses Systems geplant. Durch die Arbeit ist der Stand<br />
des Wissens praktisch <strong>und</strong> theoretisch zu beschreiben<br />
41<br />
(Literaturrecherche, Erkenntnisse aus dem Kite-Sport).<br />
Darauf aufbauend ist ein dynamisches Modell für ein<br />
exemplarisches <strong>Dr</strong>achenprofil (Geometrie, Flugparameter<br />
etc) zu erstellen sowie eine Soll-Trajektorie zu beschreiben.<br />
Das Modell ist so zu beschreiben, dass es<br />
problemlos in das entwickelte 3-Körper-Modell implementiert<br />
<strong>und</strong> als Gr<strong>und</strong>lage für den Entwurf eines optimalen<br />
Zustandsreglers genutzt werden kann. Die Arbeit<br />
wird durch die Firma SkySail (vgl. www.skysail.de) unterstützt.<br />
[42] Korth, Robert: Regelungstechnische Betrachtungen<br />
des Systems „Schiff mit Zugdrachen“<br />
(D, 2004): Im Rahmen des BMBF/AIF-Projektes<br />
SKYSAIL soll die Produktentwicklung eines Zugdrachens<br />
für Schiffe zur Einsparung von Kraftstoffverbrauch<br />
<strong>und</strong> Schadstoffemissionen unterstützt werden. Dazu ist<br />
u.a. die Entwicklung eines dynamischen Modells Schiff-<br />
Seil-<strong>Dr</strong>achen sowie die regelungstechnische Beschreibung<br />
dieses Systems geplant. Durch die vorzulegende<br />
Arbeit ist der Stand des Wissens praktisch <strong>und</strong> theoretisch<br />
zu beschreiben (Literaturrecherche, Stand des<br />
Wissens <strong>und</strong> der Technik, Erkenntnisse aus dem Kite-<br />
Sport) sowie Empfehlungen zum Regelerentwurf abzuleiten.<br />
Die Arbeit wird durch die Firma SkySail (vgl.<br />
www.skysails.de) unterstützt.<br />
[43] Schweinberger, Henning: Entwicklung einer Prüfvorrichtung<br />
zur Untersuchung des Verschleißverhaltens<br />
von Dichtungswerkstoffen (D, 2004): Die Firma<br />
HATLAPA (vgl. http://www.hatlapa.de) ist ein mittelständisches<br />
Unternehmen <strong>und</strong> als Zulieferer im Bereich<br />
Schiffszubehör (Decksmaschinen, Kompressoren, Rudermaschinen)<br />
seit 85 Jahren weltweit sehr erfolgreich<br />
tätig. Bis zum Jahr 2001 hat HATLAPA ausschliesslich<br />
hydraulische Tauchkolbenrudermaschinen hergestellt.<br />
Durch die Übernahme einer bewährten Konstruktion einer<br />
hydraulischen <strong>Dr</strong>ehflügelrudermaschine konnte die<br />
Produktpalette erweitert werden. Im ersten Schritt wurde<br />
ein Prototyp nach vorhandenem Design gebaut <strong>und</strong> getestet.<br />
Es stellte sich heraus, dass das vorhandene Dichtungskonzept<br />
technisch nicht ausreichend war. Darauf<br />
hin wurden unterschiedliche Dichtungskonzepte (Geometrie,<br />
Material) entwickelt <strong>und</strong> ersten erfolgreichen<br />
Tests unterzogen. Inzwischen wurden mehrere <strong>Dr</strong>ehflügelrudermaschinen<br />
verkauft. Da es im Unternehmen, bei<br />
der Erprobung der fertigen Produkte nur zu einem ersten<br />
Werkstest kommt, fehlen derzeit Ergebnisse zur Dauerfestigkeit<br />
der ausgewählten Materialien. Im Rahmen dieser<br />
Diplomarbeit soll daher eine Prüfvorrichtung konstruiert<br />
<strong>und</strong> gebaut werden die es ermöglicht, erste Langzeituntersuchungen<br />
für verschiedene Dichtungswerkstoffe<br />
durchzuführen. Dabei sollen nach einer Untersuchung<br />
der vorhandenen Dichtungskomplexität verschiedene<br />
Möglichkeiten von Testverfahren betrachtet <strong>und</strong> dokumentiert<br />
werden. Durch die zeitliche Begrenzung der<br />
Diplomarbeit soll dann in Zusammenarbeit mit der<br />
HATLAPA Konstruktion <strong>und</strong> Fertigung ein geeignetes<br />
Testverfahren ausgewählt <strong>und</strong> die Prüfvorrichtung konstruiert<br />
<strong>und</strong> gebaut werden. Durch die geringe Anzahl<br />
von Wettbewerbern im Weltmarkt soll diese Diplomarbeit<br />
unveröffentlicht bleiben.<br />
[44] Maurer, Bernd: Methodische Untersuchung<br />
von Lenkkonzepten für Flurförderzeuge (S, 2005):<br />
Die Flurförderzeuge der Unterkategorie Hubwagen <strong>und</strong><br />
radunterstützte Stapler der Jungheinrich AG lassen sich<br />
in Mitgänger- <strong>und</strong> Mitfahrerfahrzeuge unterteilen. Bei<br />
den Mitgängerfahrzeugen wird die zum Lenken erforderliche<br />
Kraft vom Bediener manuell über eine Deichsel<br />
aufgebracht. Die Mitfahrerfahrzeuge haben bis auf die<br />
Hubwagen eine elektrische Lenkung. Das Ziel dieser<br />
Studienarbeit ist es, mithilfe des methodischen<br />
Konstruierens ein Lenkkonzept für oben genannte Flurförderzeuge<br />
zu entwickeln. Das bestehende Antriebskonzept<br />
sowie die jeweiligen Fahrwerkskonfigurationen
<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>.-<strong>Ing</strong>. Holger Watter Flensburg University of Applied Sciences<br />
sind nicht zu verändern. Zur Lösungsfindung soll ein<br />
breites Spektrum von Wirkprinzipien erarbeitet <strong>und</strong> bewertet<br />
werden. Die favorisierte Variante soll mechanisch<br />
ausgestaltet werden.<br />
[45] Platz, Niels: Entwicklung einer Dauertestvorrichtung<br />
zur Prüfung von Deichseln (D, 2005): Im Rahmen<br />
von Entwicklungsprojekten sind Lebensdauernachweise<br />
für alle Deichselkomponenten der Flurförderfahrzeuge<br />
der Firma JUNGHEINRICH AG erforderlich. Es ist<br />
eine Vorrichtung zu entwickeln, die vorgegebene Deichselbeanspruchungen<br />
simulieren kann. Dazu ist die nachfolgende<br />
Vorgehensweise zweckmäßig: Ermittlung der<br />
Lenkkräfte im Betrieb, Ermittlung der Deichsel- Antriebsbewegung<br />
im VDI-Spiel (fest vorgegebenes Fahrspiel),<br />
Ermittlung der Kräfte im Rangierspiel LKW, Festlegung<br />
der Randbedingungen für Kräfte <strong>und</strong> Bewegungen (Winkel<br />
Zyklen etc), Ideenfindung für Lösungsansätze, Skizzieren<br />
von Lösungen, finden der „Ideallösung“ Konstruktion,<br />
Planung <strong>und</strong> Berechnung. Die Vorrichtung soll<br />
möglichst für alle Deichselfahrzeuge der Junior-Linie anpassbar<br />
sein.<br />
[46] Bodenstedt, Christian: Dimensionierung von Bugankerkettenstauraum<br />
(D, 2005): Die Dimensionierung des<br />
Kettenkastens eines Schiffes liegt im großen Interesse<br />
der Reeder, Werften <strong>und</strong> letztlich der Klassifikation. Insbesondere<br />
interessiert die Frage der Berechnung des<br />
mindestens erforderlichen Stauraumes <strong>und</strong> des darüber<br />
anzurechnenden Freiraumes für den Staukegel!. Eine<br />
Universalformel, in der der erforderliche Stauraum vom<br />
Kettendurchmesser sowie von der Kettenlänge abhängig<br />
ist, wäre die sinnvollste Alternative. Zwei derartige Formeln<br />
sind bekannt. Gefordert wird nach Möglichkeit eine<br />
allgemein gültige Universalformel für Bugankerkästen,<br />
basierend auf den Kettendurchmesser, den Gütegrad<br />
der Kette <strong>und</strong> der geometrischen Formel des Kettenkastenstauraumes.<br />
Die Arbeit wird von der Normenstelle für<br />
Schiffs- <strong>und</strong> Meerestechnik (www.nsmt.din.de) unterstützt.<br />
[47] Schultz, Daniel: Hydraulische<br />
Antriebsvarianten einer Tiefziehpresse (D, 2005): Für<br />
eine gegebene Hydraulikpresse mit „Eilgang ab“, „Arbeitszyklus“<br />
<strong>und</strong> „Eilgang auf“ sind verschieden Antriebskonzepte<br />
zu entwickeln. Die Varianten sind miteinander<br />
zu vergleichen. Dabei sind die Antriebstechnologie<br />
<strong>und</strong> deren Machbarkeit zu betrachten. Speziell interessieren<br />
die zu erreichenden Stößelgeschwindigkeiten<br />
<strong>und</strong> als besonderer Gesichtspunkt ist der Wirkungsgrad<br />
von abgegriffener Leistung am Stößel zu installierter<br />
Leistung zu betrachten. Um dieses zu ermöglichen erfolgen<br />
sämtliche Betrachtungen an einer definierten<br />
Ausgangsmaschine <strong>und</strong> bei drei festgelegten Referenzhüben.<br />
Die einzelnen Konzepte sind ebenfalls kostenmäßig<br />
zu erfassen <strong>und</strong> zu vergleichen. Es werden nur<br />
der reine Stößelantrieb <strong>und</strong> die Versorgung betrachtet.<br />
Die daraus resultierende Neukonzeption ist zu dimensionieren.<br />
Die Diplomarbeit wird von der Firma MÜLLER<br />
WEINGARTEN unterstützt.<br />
[48] Schanz, Niels-Gunnar: Versuchsmanagement zur<br />
Standzeitbestimmung eines Filtercoalescerelementes<br />
in einer Kraftstoffpflegeanlage für<br />
Schifffahrtsdestillatbrennstoffe (D, 2005): Für eine<br />
Kraftstoffpflegeanlage für Schifffahrtsbrennstoffe (Destillat)<br />
ist ein Versuchsstand zu entwickeln, mit dem die Beladungskapazität<br />
<strong>und</strong> das zeitliche Verhalten eines Filter-Coalescerelements<br />
bestimmt werden kann. Die Zugabe<br />
von Dispersionen eines Teststaubes, Wasser <strong>und</strong><br />
Destillatkraftstoff soll möglich sein. Die Arbeit wird von<br />
der Firma NFV (Norddeutsche Filter Vertriebs GmbH,<br />
www.nfv-gmbh.de) unterstützt.<br />
[49] Soldat, Florian: Entwurf einer neuen Getriebekasten-Generation<br />
unter Einsatz von FEM (D,<br />
2005): Die Firma HATLAPA ist ein mittelständisches<br />
Unternehmen <strong>und</strong> als Zulieferer im Bereich Schiffszube-<br />
42<br />
hör seit mehr als 85 Jahren weltweit sehr erfolgreich tätig.<br />
Das Produktprogramm umfasst Rudermaschinen,<br />
Kompressoren <strong>und</strong> Decksmaschinen (Winden) für stählerne<br />
Seeschiffe. In den 80er Jahren wurde erstmals eine<br />
Standardisierung bei den Decksmaschinen durchgeführt.<br />
Dabei wurde unter anderem eine Getriebekasten-<br />
Baureihe entwickelt, die auch heute noch eingesetzt<br />
wird. Vor dem Hintergr<strong>und</strong> neuer Regeln der Klassifikationsgesellschaften<br />
<strong>und</strong> der Weiterentwicklung im Bereich<br />
der Fertigungsmöglichkeiten <strong>und</strong> der Berechnungsmethoden<br />
ist es erforderlich die alte Baureihe abzulösen.<br />
Das Ziel der Diplomarbeit ist es unter Einsatz<br />
von FEM einen Entwurf für neue Getriebekasten-<br />
Baureihe zu entwickeln. Dabei sollen konstruktive <strong>und</strong><br />
fertigungstechnische Gesichtspunkte, sowie das Gesamtgewicht<br />
<strong>und</strong> die Montagefre<strong>und</strong>lichkeit berücksichtigt<br />
werden. Durch die geringe Anzahl von Wettbewerbern<br />
im Weltmarkt soll diese Diplomarbeit unveröffentlicht<br />
bleiben.<br />
[50] Idrissi, Jamal: Projektierung <strong>und</strong> Konstruktion<br />
eines hydraulischen Prüfstandes für<br />
Elastomerkomponenten (D, 2005): Es ist ein Prüfstand<br />
für die Firma TRI.GUM (http://www.trigum.de/) zu projektieren<br />
<strong>und</strong> konstruieren, der den nachfolgend aufgezählten<br />
Randbedingungen entspricht: Zur Projekteierung gehören<br />
die entsprechenden <strong>Leistungs</strong>auslegungen <strong>und</strong><br />
Auswahl des Hydraulikaggregates, der Zylinder sowie alle<br />
notwendigen maschinenbautechnischen <strong>und</strong> statischen<br />
Berechnungen. Der Anschlussadapter soll der<br />
vorhandenen Universalprüfmaschine entsprechen, um<br />
Prüfstückaufnahmen universell einsetzen zu können. Für<br />
das Elektroprojekt müssen die entsprechenden Randparameter<br />
zusammengestellt werden <strong>und</strong> Angebote eingeholt<br />
<strong>und</strong> über eine Bewertungsmatrix miteinander verglichen<br />
werden. Zur Konstruktion gehört die Erstellung eines<br />
entsprechenden Zeichnungsverzeichnisses, Die 3-d<br />
Modellierung der einzelnen Baugruppen <strong>und</strong> die Erstellung<br />
der vollständigen Werkstattzeichnungen mit entsprechenden<br />
Stücklisten. Ebenfalls zum <strong>Leistungs</strong>umfang<br />
gehört die Erstellung der technischen Dokumentation<br />
<strong>und</strong> die Vorbereitung der CE- Kennzeichnung des<br />
Prüfstandes.<br />
[51] Seyer, Stefan: Automatische Pulverförderung<br />
(D, 2005): In der Zigarettenindustrie besteht generelles<br />
Interesse, pulverförmige Zusatzstoffe in Zigaretten<br />
zu verarbeiten. Für die Beschickung einer Pulverdosierung<br />
ist eine Fördereinrichtung erforderlich. Die Aufgabe<br />
der Fördereinrichtung besteht darin, dass Pulver aus einem<br />
Vorratsbehälter zu fördern, gegebenenfalls aufzubereiten<br />
<strong>und</strong> der Pulverdosierung kontrolliert zu zuführen.<br />
Dabei ist eine gleichmäßige Zufuhr auf die gesamte<br />
Breite der Pulverdosierung erforderlich. Für die konkrete<br />
Aufgabe soll eine vorhandene Pulverdosiereinheit verwendet<br />
werden. Als pulverförmigen Zusatzstoff wird ein<br />
PE-Pulver verwendet. Dabei ist zu beachten, dass die<br />
Zusatzstoffe nicht über eine maximale Temperatur hinaus<br />
beansprucht werden. Es soll eine bestehende Fördereinrichtung<br />
ermittelt <strong>und</strong> ausgesucht werden. Nach<br />
Auswahl einer geeigneten Fördereinrichtung ist diese<br />
konstruktiv an Vorratsbehälter <strong>und</strong> Pulverdosierung anzubinden.<br />
Dazu sind Recherchen <strong>und</strong> konstruktive Überlegungen<br />
notwendig. Bei der Förderung von Staub <strong>und</strong><br />
Pulver besteht erhöhte Explosionsgefahr. In diesem Zusammenhang<br />
sind die geltenden DIN Vorschriften <strong>und</strong><br />
Sicherheitsbestimmungen zu ermitteln <strong>und</strong> beachten.<br />
Die Arbeit wird fachlich von der Firma HAUNI AG unterstützt.<br />
[52] Päper, Marcus: Beurteilung von verfahrenstechnischer<br />
Anlagen zum Ballast-Wasser-<br />
Behandlung (Treatment), (S, 2005): Seeschiffe benötigen<br />
für eine stabile Schwimmlage <strong>und</strong> aus Festigkeitsgründen<br />
Ballastwasser. Dabei hat sich gezeigt, dass u.a.<br />
auch Kleinstmeerestiere mit verschifft werden, die dann
<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>.-<strong>Ing</strong>. Holger Watter Flensburg University of Applied Sciences<br />
in ihrem neuen Lebensraum das Ökosystem schädigen<br />
können (u.a. durch explosionsartige Vermehrung, Verdrängung<br />
anderer Lebewesen usw.). Durch die Internationale<br />
Schifffahrtsorganisation IMO wurden daher Richtlinien<br />
zum „Ballast-Water-Management“ entwickelt um<br />
derartige Schädigungen zu vermeiden. Verfahrenstechnische<br />
Anlagen zur Behandlung des Ballastwassers sind<br />
z.Zt. in der Entwicklung: 1. Mechanische Trennverfahren<br />
(Filtration, Separation), 2. Physikalische Trennverfahren<br />
(Sterilisation durch Ozonung, UV-Bestrahlung, Elektrische<br />
<strong>und</strong> Wärmebehandlung), 3. Chemische Verfahren<br />
(Biozide) <strong>und</strong> Kombinationen. Es sind die verschiedenen<br />
Behandlungsmethoden hinsichtlich Effizienz, Chancen<br />
<strong>und</strong> Risiken zu vergleichen <strong>und</strong> Handlungsempfehlungen<br />
abzuleiten. Die Arbeit würde fachlich unterstützt<br />
durch den GERMANISCHEN LLOYD (www.glgroup.com)<br />
<strong>und</strong> die Normenstelle für Schiffs- <strong>und</strong> Meerestechnik<br />
(http://www.nsmt.din.de/).<br />
[53] Bestmann, Boris: Entwicklung eines Simulationsmodells<br />
für eine hydraulische<br />
Positioniervorrichtung (S, 2005): Für eine vereinfachte<br />
hydraulische Positioniervorrichtung ist ein Simulationsmodell<br />
in MATLAB SIMULINK zu entwerfen <strong>und</strong> zu evaluieren.<br />
Dabei ist besonderen Wert auf die Darstellung<br />
der physikalischen Gr<strong>und</strong>lagen, der Bezug zu Datenblättern<br />
aus der Praxis (z.B. von Herstellerfirmen) <strong>und</strong> die<br />
Nachvollziehbarkeit der Modellbildung zu legen, da das<br />
Modell im Rahmen der anwendungsorientierten Lehre<br />
zur Einführung in die Thematik der dynamischen Vorgänge<br />
genutzt werden soll. Das Modell sollte die nachfolgenden<br />
Komponenten berücksichtigen:<br />
Verdrängerpumpe (inkl. Ungleichförmigkeitsgrad/Pulsation),<br />
statisches <strong>und</strong> dynamisches Verhalten<br />
des <strong>Dr</strong>uckhalteventils sowie des Proportionalventils<br />
(inkl. geschl. Regelkreis), exemplarische Rohrleitungen,<br />
Differentialzylinder.<br />
[54] Marra, Mike: Betriebserfahrungen <strong>und</strong> Handlungsempfehlungen<br />
für die dieselmotorische Verbrennung<br />
von schwefelarmen Rückstandsbrennstoffen an<br />
Bord von Seeschiffen in Sondergebieten (D, 2005):<br />
In der Vergangenheit haben sich Motorenhersteller,<br />
Zulieferfirmen, Schiffsbetreiber <strong>und</strong> Schmieröllieferanten<br />
auf die dieselmotorische Verbrennung von Rückstandsbrennstoffen<br />
mit relativ hohem Schwefelgehalt eingestellt.<br />
Hier hat sich z.Zt. ein bewährtes tribologisches<br />
System eingestellt. Durch administrative Vorgaben (Gesetze<br />
<strong>und</strong> Verordnungen) werden jedoch zukünftig auch<br />
schwefelarme Brennstoffe eingesetzt werden müssen.<br />
Hier kam es in der Vergangenheit bereits bei schnelllaufenden,<br />
hochbelasteten Dieselmotoren z.B. zur<br />
Laufbuchsenverlackung. Im Rahmen der Arbeit sind die<br />
bisherigen Problemfelder, Erfahrungen <strong>und</strong> Erwartungen<br />
der o.g. Beteiligten mit schwefelarmen Brennstoffen aufzuzeichnen<br />
<strong>und</strong> für den Motorenbetreiber im Sinne einer<br />
Handlungsempfehlung aufzuarbeiten. Dabei sind insbesondere<br />
anlagentechnische (2-Takt versus 4-Takt, Anforderungen<br />
an das Lagerungs- <strong>und</strong> Aufbereitungssystem)<br />
<strong>und</strong> betriebstechnische Belange zu berücksichtigen<br />
(BN-Abbau, Brennstoffeigenschaften, Einfluss der<br />
Provinienzen, Überwachungs- <strong>und</strong><br />
Monitoringsmöglichkeiten....). Die Arbeit wird fachlich<br />
von der Firma DEUTSCHE BP AG – Geschäftsbereich<br />
Marine (www.bpmarine.com) unterstützt.<br />
[55] Sezer, Nilgün: <strong>Dr</strong>uckluftmanagement: Analyse<br />
<strong>und</strong> Optimierung der Energiesysteme bei der<br />
Thyssen Krupp Fahrtreppen (S, 2005): Auf dem Fertigungsgelände<br />
der Thyssen Krupp Fahrtreppen GmbH<br />
stehen Gebäude der Baujahre 1909 bis 2001. Dementsprechend<br />
unterschiedlich ausgeführt sind die Arten der<br />
Ausführungen <strong>und</strong> Ausstattungen der Gebäude einschließlich<br />
ihrer Energiemedienzuführungen <strong>und</strong> der Betrieb<br />
der unterschiedlichen Anlagen (Stromversorgung,<br />
<strong>Dr</strong>uckluft, Warmwasser, Heizung, Gas, Isolierung etc.).<br />
43<br />
Die Studienarbeit umfasst: Aufnahme bzw. Aktualisierung<br />
<strong>und</strong> Darstellung der vorhandenen Energie <strong>und</strong> Verbrauchsdaten,<br />
Findung von Optimierungslösungen I Einsparpotentialen<br />
der verschiedenen Energiesysteme, Gespräche<br />
mit Lieferanten I externen Unternehmen zur Erarbeitung<br />
von Angeboten für die Umsetzungen der ermittelten<br />
Energieeinsparlösungen einschließlich deren<br />
Vergleiche, Erarbeitung von Kosten I Nutzen-<br />
Rechnungen, Berechnen von Amortisationszeiten, Darstellung<br />
von Einsparungspotentialen einschließlich Investitionsrechnungen.<br />
Das Ergebnis der Studienarbeit<br />
soll ein für die Umsetzung geeignetes Konzept für den<br />
oben genannten Bereich darstellen. Auf Gr<strong>und</strong> der<br />
Komplexität dieses Themas wird davon ausgegangen,<br />
dass die vollständige Erledigung dieser Studienarbeit in<br />
der avisierten Zeit nicht realisierbar ist. Deshalb wird erwartet,<br />
dass die IST-Analyse für alle o.g. Bereiche angefertigt<br />
<strong>und</strong> exemplarisch mindestem für ein Energiemedium<br />
ein durchgängiges <strong>und</strong> erschöpfendes Konzept erstellt<br />
wird.<br />
[56] Maurer, Bernd: Konzeptfindung <strong>und</strong> Konstruktion<br />
einer Vorderradaufhängung für einen<br />
Elektro-Gegengewichtsstapler (D, 2005): Das Ziel<br />
dieser Arbeit ist die Entwicklung einer Vorderradaufhängung<br />
für das Funktionsmuster eines Elektro-<br />
Gegengewichtsstaplers bis zur Erstellung der Fertigungszeichnungen.<br />
Da es sich um ein Vorentwicklungsprojekt<br />
handelt, sollen einfache zu fertigende oder handelsübliche<br />
Bauteile verwendet werden. Die Lösung<br />
muss nicht kostenoptimal ausgeführt sein. Die Position<br />
des Hubgerüstes am Fahrzeugrahmen soll beibehalten<br />
werden.<br />
[57] Kaya, Edat; Radtke, Jan: Spezifikation, Projektierung<br />
<strong>und</strong> Dimensionierung von hydraulischen<br />
Prüfständen (S, 2005): Im Rahmen dieser Studienarbeit<br />
wird die Spezifikation, Projektierung <strong>und</strong> Dimensionierung<br />
von hydraulischen Prüfständen erläutert. Es wird<br />
die Konzipierung eines hydraulischen Labors demonstriert.<br />
Dabei werden die Gr<strong>und</strong>lagen eines Hydrauliklabors<br />
vom räumlichen Aufbau bis hin zu den Prüfständen<br />
des Labors besprochen. Dazu gehören die Planung <strong>und</strong><br />
die Möglichkeiten des Laboraufbaus, wie zum Beispiel<br />
die Bestimmung der Aggregate zur Versorgung der<br />
Prüfstände oder auch die verschiedenen Verschraubungssysteme.<br />
Zur besseren Darstellung wird der Aufbau<br />
des „MAHA Fluid Power Teaching and Research<br />
Laboratory“ (benannt nach dem ehemaligen <strong>Prof</strong>essor<br />
<strong>und</strong> Gründer der Stiftung für Ölhydraulik OTTO MAHA)<br />
an der Purdue University in West Lafayette, Indiana,<br />
USA als Beispiel erläutert. Diese Versuchshalle soll für<br />
unterschiedliche vorhandene hydraulische Prüfstände<br />
geplant werden. Die Prüfstände für dieses Labor sind<br />
von der Technischen Universität Hamburg-Harburg<br />
übernommen worden. Zusätzlich werden für die Prüfstände<br />
die konstruktiven Maßnahmen für den Transport<br />
erarbeitet.<br />
[58] Marcus Franke, Christian Protze: Auswahl <strong>und</strong> konstruktive<br />
Implementierung einer Seilwinde für ein<br />
Zugdrachen-System in den Rumpf eines vorhandenen<br />
Schiffes (S, 2005): Die Firma SkySails GmbH &<br />
Co. KG in Hamburg entwickelt ein System, mit dem man<br />
bis zu 50% dieser Kosten sparen könnte. Die Idee: ein<br />
großer Zugdrache, ähnlich einem <strong>Dr</strong>achen beim Kite-<br />
Surfen, zieht das gesamte Schiff über eine Kunststoffseil<br />
hinter sich her. Zurzeit hat SkySails zwei Prototypen<br />
verschiedener Größe in der Erprobung, der dritte, die<br />
VOGELSAND, befindet sich noch in der Werft in Hamburg-Harburg.<br />
Für das Schiff wird noch am Konzept für<br />
den Umbau geplant. Mit Hilfe einer Marktrecherche <strong>und</strong><br />
einem Auswahlverfahren soll eine Winde, Winsch oder<br />
Kombination von beiden gef<strong>und</strong>en werden, die alle im<br />
Lastenheft von SkySails geforderten Eigenschaften erfüllt.
<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>.-<strong>Ing</strong>. Holger Watter Flensburg University of Applied Sciences<br />
[59] Reher, Heiko: Berechnung <strong>und</strong> Auslegung eines<br />
Systems zur Minimierung des Kontaminationsrisikos<br />
zwischen Thermalöl <strong>und</strong> Kühlwasser (D, 2006): Darstellung<br />
des Ist-Zustandes der Gesamtanlage, sowie des<br />
Anlagensystems mit Kontaminationsrisiko zwischen<br />
Kühlwasser <strong>und</strong> Thermalöl. Beschreibung der theoretisch<br />
<strong>und</strong> praktischen Möglichkeiten zur Einbindung eines<br />
Sicherheitssystems. Hauptplanung des gewählten<br />
Sicherheitssystems (Detail Engineering). Die Arbeit wird<br />
von der Firma KEYNES unterstützt,<br />
www.keynesgmbh.de<br />
[60] Busche, Christoph: Berechnung von <strong>Dr</strong>uckverlusten<br />
in Überlaufsystemen (S, 2006): Die Abteilung<br />
NSP des GERMANISCHEN LLOYDS (www.glgroup.com)<br />
beschäftigt sich unter Anderem mit der Auslegung<br />
von Brennstoff- sowie Ballastwassertanks. Die<br />
Tanks sind mit Überlaufsystemen verschiedener Arten<br />
ausgestattet. In den Rohrleitungen dieser Überlaufsysteme<br />
kommt es durch Rohreibung (auch parallel geschaltete<br />
Rohre, d.h. iterative Berechnung)<strong>und</strong> statischer<br />
Höhe zu <strong>Dr</strong>uckverlusten, die bestimmt <strong>und</strong> mit<br />
dem Tankauslegungsdruck verglichen werden müssen.<br />
Ziel der Arbeit ist es, ein Programm zur Berechnung dieser<br />
<strong>Dr</strong>uckverluste zu entwerfen, um den Arbeitsprozess<br />
zu verbessern. Dazu müssen alle Teilstücke der Rohrleitungen<br />
<strong>und</strong> Einbauten in das Programm aufgenommen<br />
werden können <strong>und</strong> dann das Ergebnis in geeigneten<br />
Art dargestellt werden.<br />
[61] Kannengießer, Sebastian; Lührs, Ove; / Konstruktion,<br />
Inbetriebnahme <strong>und</strong> Optimierung einer pneumatische<br />
Achspositionierung mit Wegmesssystem (S,<br />
2005): Pneumatische Linearantriebe mit Lageregelungen<br />
kommen bei verschiedenen Produktionsprozessen<br />
zur Anwendung. Dabei werden Werkzeuge oder Werkstücke<br />
durch einen Regelalgorithmus auf vorab festgelegte<br />
Positionen geführt. Der derzeitige Versuchsaufbau<br />
ist DOS-basiert <strong>und</strong> soll durch eine moderne Steuerung<br />
ersetzt werden. Die Steuerungshard- <strong>und</strong> –software ist<br />
bereits verfügbar. Eine ingenieurgerechte, praxisnahe<br />
Umsetzung soll erarbeitet werden. Kenntnisse <strong>und</strong> der<br />
Pneumatik sowie Steuerungstechnik sind von Vorteil.<br />
[62] Welle, Matthias: Untersuchung von Verfahren<br />
zur Ballastwasseraufbereitung (D, 2006): Durch das<br />
Ballastwasser von Seeschiffen kann es zur Verschleppung<br />
von Mikroorganismen kommen, die im Ökosystem<br />
zu beträchtlichen Schädigungen führen können. Die Internationale<br />
Schifffahrtsorganisation der UNO (IMO) hat<br />
deshalb ein internationales Übereinkommen formuliert,<br />
wonach bis 2009 auf den Schiffen Anlagen zur Ballastwasserbehandlung<br />
zu installieren sind. Aufgr<strong>und</strong> dieses<br />
Übereinkommens sind die Richtlinie <strong>und</strong> Normen zu<br />
analysieren, sowie eine Machbarkeitsstudie zur ökonomischen,<br />
ökologischen <strong>und</strong> technischen Umsetzung einer<br />
Ballastwasserbehandlungsanlage zu erstellen. Die<br />
Arbeit wird von der Firma NFV, Norderstedt, fachlich unterstützt<br />
(www.nfv-gmbh.de).<br />
[63] Kaya, Edat Arslan: Development and design of a<br />
laboratory test rig for complex hydrostatic multimotor<br />
transmission (D, 2006) : The aim of this thesis is<br />
the development of a laboratory test rig for novel hydrostatic<br />
transmissions band on multimotor drive structures.<br />
The test rig should allow measurements on different<br />
transmissions including power split drives. The goal of<br />
this work is to propose different solutions for the planned<br />
new test rig and to select the most suitable one after a<br />
comprehensive comparrison. The test rig uses a diesel<br />
engine as prime mover and a secondary controlled positive<br />
displacement machine as load unit. Within this thesis<br />
the following tasks need to be completed: Development<br />
of different test rig solutions and selection of the<br />
most suitable one, System analysis and component selection<br />
of all parts including sensors, Design of all mechanical<br />
custom made parts, Manual for test rig assem-<br />
44<br />
bly. The results of this work will be presented within a<br />
collequium at the MAHA Fluid Power Research Center.<br />
The thesis will be supervised by <strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>.-<strong>Ing</strong>. Monika<br />
Ivantysynova <strong>und</strong> <strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>.-<strong>Ing</strong>. Holger Watter. All<br />
knowledge and results gained from this research work<br />
and information resources made accessible by the<br />
MAHA Fluid Power Research Center are confidential.<br />
The results belongs to the MAHA Fluid Power Research<br />
Center and are neither available to a third party, nor to<br />
be used in any commercial form without given permission.<br />
All rights and intellectual property remain at the<br />
MAHA Fluid Power Research Center.<br />
[64] Hinners, Frank: Optimierung der sek<strong>und</strong>ären <strong>Dr</strong>uck-<br />
<strong>und</strong> Kavitationsabsicherung von Großhydraulikbaggern<br />
(D, 2006): Im Hydraulikschaltkreis von Großbaggern<br />
ist es in der Vergangenheit wiederholt zu Schäden<br />
an den <strong>Dr</strong>uckbegrenzungsventilen <strong>und</strong> den Anti-<br />
Kavitationsventilen (Nachsaugventilen) gekommen. In<br />
der vorliegenden Arbeit sind diese Schäden zu untersuchen<br />
<strong>und</strong> Optimierungspotentiale herauszuarbeiten. Dazu<br />
sind die Schadensfälle zu beschreiben (Schadensbild)<br />
<strong>und</strong> zu analysieren. Als methodische Ansätze sind<br />
die Fehlerbaumanalyse (FTA = Fault Tree Analysis), die<br />
Fehlermöglichkeits- <strong>und</strong> Einflussanalyse (FMEA =<br />
Failure Mode and Effect Analysis) sowie der Einsatz von<br />
Simulationswerkzeugen denkbar. Die Arbeit wird von der<br />
Firma TEREX O&K (www.terex-ok.de) fachlich unterstützt.<br />
[65] Douangla, Thomas: Konzeptionierung <strong>und</strong> Dimensionierung<br />
einer Absorptionskälteanlage (D,<br />
2006): Für einen Kühlcontainer als Zwischenlager für<br />
Früchte <strong>und</strong> Obst in warmen Regionen ist eine Absorptionskälteanlage<br />
zu konzeptionieren <strong>und</strong> zu dimensionieren.<br />
Dabei ist Anlagenentwurf weitgehend mit regenerativen<br />
Komponenten zu entwerfen. Nach Möglichkeit sind<br />
auf dem Markt verfügbare Komponenten zu verwenden.<br />
Das Anlagenkonzept ist rechnerisch zu evaluieren <strong>und</strong><br />
die geometrischen Dimensionen sowie die Stoffströme<br />
<strong>und</strong> Wärmemengen abzuschätzen.<br />
Conceptual design and dimensioning of an absorption<br />
chiller for third world countries.<br />
The assigned task consists in designing and dimensioning<br />
an absorption chiller for a 20 feet reefer container.<br />
The container should be used as an intermediate storage<br />
facility for subsistence crops and vaccines in warm<br />
regions. The results of this research proof that with renewable<br />
energies, perishable foodstuff can be chilled in<br />
a reefer container at a temperature of 5 °Celsius. The<br />
choosen area for the experiment is the village named<br />
Bangang (Mbouda) in Cameroon, where the temperature<br />
of the surro<strong>und</strong>ing approaches 40 °Celsius. The following<br />
renewable energy sources where used: solar energy,<br />
biomass and water. Meanwhile the solar energy is taped<br />
from the solar thermal collectors when the solar radiations<br />
are high, the biomass made up especially of wood<br />
(wood is ab<strong>und</strong>ant and economically priced in this region<br />
of Cameroon) is available for night and low-temperature<br />
periods. These two input energy forms provide enough<br />
heat (12 kW) for the boiler incorporated in the absorption<br />
chiller. Therefore the solar collectors with an area of<br />
about 30 m² and a 15 kW woodburner are simultaneously<br />
and separately used as thermal power plants. Water<br />
is been used to cool down the heat load of the condenser<br />
at the temperature of about 23 °Celsius. Given<br />
the current case of the plants at Bangang, the water is<br />
been conducted from a stream which flows almost regularly<br />
the whole year. Furthermore it’s foreseen that this<br />
stream is also used to power the pumps of the device<br />
with electrical energy. This contribution in electrical energy<br />
takes advantage of a small hydroelectric power
<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>.-<strong>Ing</strong>. Holger Watter Flensburg University of Applied Sciences<br />
plant installed by the NGO named ACREST since 2004<br />
on the gro<strong>und</strong> of the site for the profit of the populations.The<br />
output energy form is the produced cold in the<br />
container with a load which approximates 8 kW. Thanks<br />
to the ammonia gas existing in the evaporator of the<br />
chiller, the entire heat load of the container is absorbed<br />
and used for the absorptionprocess. The results of calculations<br />
convince that the type of refrigeration chosen<br />
so far is not only technically applicable on the site of<br />
Bangang with the forms of energy mentioned. Based on<br />
the technical aspect, it can be assumed that the renewable<br />
energies can deprive remote communities from<br />
classical energy dependence. The population of the targeted<br />
areas are actually not in the position to overcome<br />
the bonds of the public energy suppliers. In the frame<br />
work of this thesis, the economical aspect of the project<br />
is not studied. However, with the steady increase in<br />
course of classical energy forms, the renewable energies<br />
sector can be given more attention in the near future.<br />
http://africanetworking.de/SuccessguideThomas.htm<br />
http://www.vkii.org/index.php?option=com_content&task<br />
=view&id=58&Itemid=1<br />
[66] Boguhn, Alexander: Analyse <strong>und</strong> Auswertung der<br />
Stoffströme im Maschinenraum eines Containerschiffes<br />
hinsichtlich wirtschaftlicher <strong>und</strong> umwelttechnischer<br />
Aspekte (D, 2006): An Bord von Schiffen,<br />
kommt es im Maschinenraum zu Abfallprodukten insbesondere<br />
Ölschlämmen aus der Schwerölseparation,<br />
Schmutz- <strong>und</strong> Altölabfällen, sowie dem sog. Bilgewasser.<br />
Aufgabe der Diplomarbeit ist die Analyse der Stoffströme<br />
im Maschinenraum am Beispiel eines Containerschiffes<br />
(Schiffsname / BauNr.). Die Arbeit soll aufzeigen,<br />
wie die Verbrauchsstoffe (Brennstoffe, Schmier-,<br />
Hydraulik-, Wärmeübertragungsöl, Kühlmittel, etc.) derzeit<br />
auf einem Containerschiff der neueren Generation<br />
gehandhabt werden. Insbesondere die Sammlung, Aufbewahrung<br />
<strong>und</strong> Entsorgung der Ölschlammabfälle, der<br />
Schmutzöle, Lecköle u.a. sollen hinsichtlich wirtschaftlicher<br />
<strong>und</strong> umwelttechnischer Betrachtung untersucht<br />
werden. Die Einleitungen in die Bilge, deren Zusammensetzung<br />
als schwer vorhersagbar gilt, sollen analysiert<br />
werden. Aus der Untersuchung heraus sollen gegebenenfalls<br />
Ideen bzw. Lösungsmöglichkeiten zur Verbesserung<br />
der Zusammensetzung des Bilgewassers bezogen<br />
auf nachgeschaltete Entölertechniken unter Betrachtung<br />
wirtschaftlicher Aspekte entstehen. Andere<br />
Abfälle der Schifffahrt wie Grau- <strong>und</strong> Schwarzwasser,<br />
Ballastwasser, Abgase, Lebensmittelabfälle, sonstiger<br />
Müll etc. sollen nicht in die Betrachtung dieser Arbeit einfließen.<br />
Die Arbeit wird durch die Firmen Alfa Laval Mid<br />
Europe sowie der Nordseewerke GmbH betreut <strong>und</strong> unterstützt.<br />
Da die Arbeit unternehmensinterne Informationen<br />
beinhaltet wird von einer Veröffentlichung der Arbeit<br />
abgesehen.<br />
[67] Bestmann, Boris: Lenkung von Flurförderzeugen<br />
ohne aktive Änderung der Laufrichtung gelenkter<br />
Räder (D, 2006): Die STILL GmbH entwickelt <strong>und</strong><br />
produziert in ihrem Werk in Hamburg Gegengewichtsgabelstapler.<br />
Gegengewichtsgabelstapler verfügen, in Abhängigkeit<br />
von den vorgesehenen Einsatzbedingungen,<br />
über eine Vielzahl von Varianten bezüglich des Antriebes<br />
<strong>und</strong> der Lenkung des Fahrzeuges. Der Antrieb der<br />
Gegengewichtsgabelstapler der STILL GmbH erfolgt<br />
vorwiegend durch Elektromotoren in der Vorderachse.<br />
Die Lenkung erfolgt im Allgemeinen durch die aktive Änderung<br />
der Laufrichtung der Räder der Hinterachse.<br />
Diese Art der Lenkung erfordert hydraulische Lenkaktuatoren<br />
sowie eine Vielzahl an hydraulischen, mechanischen<br />
<strong>und</strong> elektrischen Bauteilen zur Übertragung des<br />
Lenksignals <strong>und</strong> der Lenkkräfte vom Lenkrad zu den gelenkten<br />
Rädern. Der anzufertigenden Diplomarbeit liegt<br />
45<br />
daher die Idee zu Gr<strong>und</strong>e, die Lenkung eines Gabelstaplers<br />
ohne die aktive Änderung der Laufrichtung eines<br />
oder mehrerer Räder gegenüber der Fahrzeuglängsachse<br />
zu bewirken.<br />
SS 2007<br />
[68] Schwartau; Jan-Hinrich: Modernisierung <strong>und</strong> Inbetriebnahme<br />
eines hydraulischen<br />
Positioniervorrichtung (S, 2007): Für eine gegebene<br />
hydraulische Achse (bestehend aus Zylinder, Wegeventilen<br />
<strong>und</strong> Wegmesssystem) ist eine neue, PC-basierende<br />
Ansteuerung zu entwerfen <strong>und</strong> in Betrieb zu nehmen.<br />
Die Ansteuerung soll durch LabVIEW erfolgen, dies ist<br />
ein graphisches Programmiersystem von NATIONAL<br />
INSTRUMENTS (http://www.ni.com/). Das Akronym steht<br />
für "Laboratory Virtual Instrument Engineering<br />
Workbench". Haupt-Anwendungsgebiete von LabVIEW<br />
sind die Mess- <strong>und</strong> Automatisierungstechnik. Die Programmierung<br />
erfolgt mit einer graphischen Programmiersprache<br />
genannt "G", nach dem Datenfluss-Modell.<br />
Durch diese Besonderheit eignet sich LabVIEW besonders<br />
gut zur Datenerfassung <strong>und</strong> -Verarbeitung.<br />
LabVIEW-Programme werden als Virtuelle Instrumente<br />
oder einfach VIs bezeichnet. Sie bestehen aus zwei<br />
Komponenten: das Frontpanel enthält die Benutzerschnittstelle,<br />
das Blockdiagramm den graphischen Programmcode.<br />
Dieser wird nicht von einem Interpreter abgearbeitet,<br />
sondern compiliert. Dadurch ist die Performance<br />
vergleichbar mit der anderer Hochsprachen. Bei<br />
dem Versuchsstand sind folgende Randbedingungen zu<br />
beachten: Erfassung der Position der Achse durch den<br />
PC, Erfassung von Betriebsdrücken, Volumenstrom, Öltemperatur<br />
<strong>und</strong> entstehenden Kräften durch den PC,<br />
Speicherung der erfassten Daten in einer Datei zur späteren<br />
Verarbeitung. Zum Versuchsaufbau <strong>und</strong> zum Betrieb<br />
der Anlage ist eine Dokumentation anzufertigen.<br />
[69] Franz, Oliver: Optimierung der Kreuzgelenke<br />
<strong>und</strong> Konzeption der dazugehörigen Montageprozesse<br />
im Rahmen eines neuen PKW Lenksäulenprojektes<br />
(D, 2007): Im Rahmen eines neuen PKW Lenksäulenprojektes<br />
(gemeinsame Plattform Chrysler/ Mercedes)<br />
sollen Optimierungsmöglichkeiten für die Kreuzgelenkverbindungen<br />
<strong>und</strong> deren Montageprozesse erarbeitet<br />
<strong>und</strong> bewertet werden. Zwecks Kostensenkung des<br />
aktuellen Prozesses <strong>und</strong> um alternative Fertigungsverfahren<br />
zur Herstellung der Lagersitze in den Kreuzgelenken<br />
in Betracht ziehen zu können, sind die Lagersitze<br />
hinsichtlich ihrer konstruktiven Auslegung zu untersuchen.<br />
Hierzu soll durch Versuchsreihen ermittelt werden,<br />
welche maximale Toleranz für die Lagersitze unter Beachtung<br />
der bestehenden Qualitätsanforderungen (Lastenheftanforderungen)<br />
an die Lenksäulen möglich ist.<br />
Um ein Konzept für ein optimiertes Montagesystem im<br />
Rahmen des neuen Projektes zu erarbeiten, ist der Ist-<br />
Zustand des jetzigen Verfahrens aufzunehmen <strong>und</strong> zu<br />
analysieren. Anhand der Ist-Analyse soll aufgezeigt werden,<br />
welche Optimierungsmöglichkeiten hinsichtlich<br />
Taktzeit, Kosten <strong>und</strong> ggf. Funktion bestehen. Aus den<br />
gewonnenen Erkenntnissen sind verschiedene Montagekonzepte<br />
zu entwickeln <strong>und</strong> zu bewerten. Anhand der<br />
Bewertungen ist ein optimales Konzept zu wählen, welches<br />
dem Planungsteam der DaimlerChrysler AG Hilfestellung<br />
<strong>und</strong> Planungssicherheit vor der Produkteinführung<br />
geben soll.<br />
[70] Radtke, Jan: Entwurf für den Umbau einer DOLMAR-<br />
Motoreinheit zu einer Betonsäge (D, 2007): DOLMAR<br />
als bekannter Hersteller für handgehaltene Motorgeräte<br />
wie Sägen <strong>und</strong> Trennschneidgeräte möchte sein Produktprogramm<br />
im Bereich Beton-Bearbeitung ausweiten.<br />
Auf dem Markt befinden sich bereits Betonsägen, diese<br />
basieren auf Serienmotoreinheiten mit Änderungen, um<br />
die Produkte an die rauhen Umgebungsbedingungen<br />
des Betonsägens anzupassen. Ziel dieser Arbeit ist das<br />
Aufzuzeigen der Machbarkeit zur Umsetzung einer Betonsäge<br />
mit einer Motoreinheit aus dem DOLMAR-
<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>.-<strong>Ing</strong>. Holger Watter Flensburg University of Applied Sciences<br />
Produktprogramm. Erstellung einer Analyse des Marktes,<br />
der Anpassungen der Wettbewerbsprodukte <strong>und</strong> die<br />
Vor- <strong>und</strong> Nachteile sind darzustellen. Im Umgang mit der<br />
Betonsäge eignen sie sich Erfahrungen an. Daraufhin ist<br />
die Auswahl für eine geeignete Motoreinheit aus dem<br />
DOLMAR-Produktprogramm zu treffen <strong>und</strong> das notwendige<br />
Änderungspotential ist zu definieren, die konstruktiven<br />
Lösungen sind vorzubereiten. Hierzu sind folgende<br />
Arbeitsschritte durchzuführen: Marktrecherche, Erprobung<br />
bestehender Betonsägen, Aufbau eines Erprobungsträgers<br />
auf einer PS-7900 <strong>und</strong> Durchführung von<br />
Schneid- <strong>und</strong> Verdreckungsversuchen, Analyse der Versuche,<br />
Auswahl eines Antriebs aus dem DOLMAR-<br />
Motorenprogramm, Definition des Änderungsumfangs,<br />
Entwurfskonstruktion, Aufbau eines Anschauungsprototypen.<br />
[71] Lührs, Ove: Marktanalyse <strong>und</strong> Erprobung eines<br />
durch GPS Satelliten gesteuerten Lenksystems für<br />
Traktoren (D, 2007): Zu Gewährleistung eines effektiven<br />
Maschineneinsatzes werden moderne Landmaschinen<br />
weg- <strong>und</strong> ertragsabhängig gesteuert. Dabei haben<br />
sich im wesentlichen zwei Steuerungskonzepte herausgebildet<br />
(1) die D-GPS Bahnführung (2) die "kantengeführte"<br />
Bahnregelung . Ziel der vorliegenden Arbeit ist<br />
es, ein DGPS-geführtes System hinsichtlich der Feldtauglichkeit<br />
<strong>und</strong> Marktreife zu überprüfen. Dazu soll das<br />
satellitengesteuerten Lenksystems TRUPATH der Firma<br />
TOPCON-SAUER-DANFOSS (TSD) in einen Traktor<br />
implementiert <strong>und</strong> kommerziell im Feldversuch<br />
eingesetzt werden. Hier sind insbesondere die<br />
Funktion, Bedienung <strong>und</strong> Vorteile für den Anwender zu<br />
erörtern <strong>und</strong> zu untersuchen. Es sind Vorschläge für zukünftige<br />
Entwicklungen, insbesondere unter Berücksichtigung<br />
des europäischen Marktes, zu unterbreiten <strong>und</strong><br />
durch eine Marktanalyse zu belegen. Die Arbeit wird<br />
fachlich durch die Firma SAUER-DANFOSS<br />
(http://www.sauer-danfoss.de/) unterstützt.<br />
[72] Floßbach, Anja: Vibration Weld Test for Hydraulic<br />
Pipes (S, 2007): WILLIAMS F1 has been running hydraulic<br />
tube assemblies with welded end fittings for more<br />
than eight years. However, during the Malaysian Grand<br />
Prix of March 2006 one assembly failed causing the loss<br />
of hydraulic fluid, and the premature retirement of the car<br />
from the race. Following the failure in Malaysia, WIL-<br />
LIAMS decided to use flexible pipes in the start term to<br />
avoid repetition of the same problem. Unfortunately,<br />
flexible pipes are heavier and we wish to save weight,<br />
the outer-diameter is bigger and the bend radius is larger,<br />
which makes the parts harder to package. The primary<br />
concern is to evaluate as many different end fittings<br />
and joining techniques as possible. The design parameter<br />
altered on the end fittings is the design of the<br />
spigot – internal or external. Essentially this means the<br />
spigot is joined to either the inside or outside of the tube.<br />
A number of different joining methods can be employed<br />
to attach the spigot to the tube. These might include, TIG<br />
(Tungsten Inert Gas) welding, EBW (Electron Beam<br />
Welding), Induction welding, Vacuum brazing or mechanical<br />
swaging. For each different design there will be<br />
a number of test samples manufactured. The investigations<br />
are supported by www.williamsf1.com<br />
[73] Simic, Zivorad: Projektierung <strong>und</strong> Dimensionierung<br />
eines <strong>Dr</strong>uckluftspeicherkraftwerks für einen Windpark<br />
(D, 2007): Der fluktuierende Charakter der Einspeisung<br />
aus Windenergieanlagen in Verbindung mit der<br />
prognostizierten hohen Anlagendichte führt zu absehbaren<br />
Problemen bei der Integration in das System der<br />
elektrischen Energieversorgung. Diese betreffen einerseits<br />
den Betrieb der zum Abtransport der lastfern erzeugten<br />
elektrischen Energie benötigten Übertragungsnetze,<br />
deren Belastbarkeitsgrenzen bei hohem Windenergieaufkommen<br />
bereits heute überschritten werden<br />
können. Andererseits verursachen die relativ unsicher<br />
prognostizierbaren Einspeisungen einen hohen Bedarf<br />
46<br />
an Regelleistung <strong>und</strong> –arbeit, die zum allzeitigen Ausgleich<br />
des systemweiten Gleichgewichts von Erzeugung<br />
<strong>und</strong> Nachfrage benötigt werden. Zum <strong>Dr</strong>itten erfordert<br />
die vom Primärenergieangebot Wind abhängige Erzeugung<br />
die Besicherung durch konventionelle „Schattenkraftwerke“<br />
in windschwachen Zeiten. Mögliche<br />
Abhilfemaßnahmen sehen heute zum einen signifikante<br />
Netzverstärkungen, zum anderen Erzeugungsmanagement,<br />
d. h. Abschaltung der Windenergieanlagen<br />
bei unzulässigen Belastungsfällen, vor. Beide Maßnahmen<br />
verursachen zusätzliche Kosten <strong>und</strong> stoßen sowohl<br />
hinsichtlich ihrer Umsetzbarkeit wie auch ihrer Akzeptanz<br />
an Grenzen. Alternativ könnte zukünftig der<br />
energiewirtschaftliche Nutzen <strong>und</strong> die Systemintegration<br />
von Windenergieanlagen durch Speichertechnologien<br />
gefördert werden. Diese ermöglichen es, die fluktuierende<br />
Erzeugung elektrischer Energie aus Windenergie von<br />
der Netzeinspeisung zeitlich zu entkoppeln <strong>und</strong> ihr so<br />
den Charakter eines kontinuierlich <strong>und</strong> geplant einsetzbaren<br />
Kraftwerks zu geben. Für diesen Zweck erscheinen<br />
<strong>Dr</strong>uckluftspeicher (CAES - Compressed Air Energy<br />
Storage) besonders geeignet. Ihre Kosten bewegen sich<br />
im gleichen Bereich wie die von Pumpspeicherkraftwerken.<br />
Im Gegensatz zu diesen benötigen sie zur Speicherung<br />
Kavernen oder Aquiferstrukturen, die in Europa an<br />
allen windstarken Standorten in ausreichender Zahl vorhanden<br />
sind. Ein entsprechendes Kraftwerk ist bereits<br />
seit 1978 in Huntorf (Niedersachsen) in Betrieb. Mögliche<br />
technische Weiterentwicklungen werden derzeit im<br />
Rahmen des von der EU geförderten Projektes „AA-<br />
CAES: Advanced adiabatic compressed air energy storage“<br />
untersucht (vgl. z.B. http://www.iaew.rwthaachen.de)<br />
. Im der vorliegenden Arbeit ist für ein idealisiertes<br />
Lastprofil ein <strong>Dr</strong>uckluftspeicher zu entwerfen <strong>und</strong><br />
zu dimensionieren. Dabei sind folgende Randbedingungen<br />
zu beachten <strong>und</strong> für die Dimensionierung heranzuziehen:<br />
10 Windkraftanlagen a 5 MW; Lastschwankungen<br />
+/- 20 %, die innerhalb von 10 Minuten auszuregeln<br />
sind. Es ist von einem idealisierten Lastprofil auszugehen.<br />
Für die Anlage soll im Inselbetrieb betrieben werden<br />
(Beispiel: Insel oder Hallig). Für das <strong>Dr</strong>uckluftspeicherkraftwerk<br />
sind die folgenden Anlagenkomponenten<br />
zu dimensionieren: Verdichterstation, Kraftwerkskomponenten<br />
(Brennkammer, Turbine), Rohrleitungen, die<br />
Verwendung eines natürlichen Speichers ist zu prüfen,<br />
alternativ ist die Speicherung in <strong>Dr</strong>uckluftbehältern zu<br />
prüfen.<br />
WS 2007<br />
[74] Burfeind, Jan: Methodisches Konstruieren einer<br />
Abstandführung für eine Folienbeschichtungsmaschine<br />
(D, 2007): Die Firma MASCHINENFABRIK MAX<br />
KROENERT GmbH & Co KG stellt Beschichtungsanlagen<br />
für Papiere <strong>und</strong> Folien her. Oft werden diese Beschichtungsmassen<br />
durch 2 Walzen dosiert, die in ihren<br />
Lagersteinen einen genau festgelegten Abstand voneinander<br />
haben. Dieser Abstand definiert die Beschichtungsstärke<br />
<strong>und</strong> liegt bei etwa 10 bis 100 Mikrometern.<br />
Bisher wurden die Lagersteine hydraulisch zusammengefahren,<br />
mit einen manuell einstellbaren Anschlag dazwischen.<br />
Heutzutage wünschen die K<strong>und</strong>en jedoch<br />
häufigere Produktwechsel mit unterschiedlichen Abständen.<br />
Weiterhin möchte man, um Beschichtungsmasse<br />
zu sparen, diesen Abstand genauer reproduzieren können.<br />
Und zuletzt hätte man gerne eine automatische<br />
Regelung des Abstandes in Abhängigkeit von der tatsächlich<br />
aufgetragenen Beschichtungsstärke. Für die<br />
Abstandsregelung der Walzen sind methodisch verschiedene<br />
Konstruktionsentwürfe zu erstellen <strong>und</strong> zu<br />
bewerten. Es ist eine Empfehlung für eine Variante abzugeben<br />
<strong>und</strong> im Detail zu konstruieren. Die Arbeit wird<br />
fachlich durch die Firma MASCHINENFABRIK MAX<br />
KROENERT GmbH & Co KG (www.kroenert.de) unterstützt.
<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>.-<strong>Ing</strong>. Holger Watter Flensburg University of Applied Sciences<br />
[75] Ercan, Kenan: Entwicklung <strong>und</strong> Implementierung<br />
eines Software-Tools zur planmäßigen Instandhaltung<br />
von Schiffsmaschinenanlagen (D, 2007): Zur<br />
Standardisierung der Service Berichte soll ein „vereinfachtes<br />
Werkzeug" mit dem Ziel entwickelt werden, häufige<br />
Service-Tätigkeiten in abgestimmter Reihenfolge als<br />
Vorlage zu entwickeln. Diese Vorlage soll folgende<br />
Hauptkriterien erfüllen: Vereinfachte bzw. standardisierte<br />
Service-Berichte in englischer Sprache, schnelleres<br />
schreiben durch Textfeldfunktionen sowie automatische<br />
<strong>und</strong> übersichtliche Darstellung der benötigten Verbrauchsmaterialien/Ersatzteile.<br />
Dazu sollen folgende<br />
Einzelschritte bearbeitet werden: Mitarbeit in den verschiedenen<br />
Bereichen des „Field Service“, Erstellen<br />
kompletter Service Berichte <strong>und</strong> Pflege der Ablage, Erstellen<br />
eines „Reporting-Tools“, Beschreibung des „Reporting-Tools“<br />
für den „Field Service“. Die einzelnen<br />
Teilschritte sind systematisch <strong>und</strong> vollständig zu dokumentieren.<br />
Die Arbeit wird fachlich <strong>und</strong> inhaltlich durch<br />
die Firma WÄRTSILÄ CORPORATION unterstützt <strong>und</strong><br />
ist vertraulich zu behandeln. Die Wärtsilä Corporation<br />
entwickelt, produziert, vertreibt <strong>und</strong> wartet Gas-/ Dieselmotoren<br />
für Schiffe <strong>und</strong> stationäre Anlagen. Zum Produktumfang<br />
gehören neben den 4-Takt WÄRTSILÄ Motoren<br />
u.a. SULZER Zweitakt Motoren sowie LIPS Propulsionsanlagen.<br />
Die Wärtsilä Deutschland GmbH wurde<br />
1982 als Service Netzwerkstation gegründet <strong>und</strong> seit<br />
dem Zusammenschlüssen mit „New Sulzer Diesel“ 1997<br />
<strong>und</strong> John Crane Lips 2003 werden hier gesamte Antriebsstränge<br />
servicetechnisch betreut.<br />
[76] Bennholdt-Thomsen, Daniel: Entwicklung eines<br />
Einzelbeleuchtungsmessplatzes für Solarzellen im<br />
Photovoltaik-Modul (S, 2007): Die SolarWorld AG hat<br />
sich in nur wenigen Jahren vom einstigen Handelsunternehmen<br />
zu einem Solarkonzern mit integriertem solaren<br />
Wertschöpfungsprozess - vom Rohstoff über den Wafer,<br />
die Zelle, das Modul bis hin zur fertigen, hochwertigen<br />
Solarstromanlage - entwickelt. Im Rahmen der Studienarbeit<br />
soll für die SolarWorld-Tochterfirma DEUTSCHE<br />
SOLAR AG, ein Messplatz entwickelt werden, mit dem<br />
einzelne Zellen aus Photovoltaik-Modulen charakterisiert<br />
<strong>und</strong> hinsichtlich ihrer <strong>Leistungs</strong>daten überprüft werden<br />
können. Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung eines<br />
Einzelbleuchtungsmessplatzes (EBM) mit dem festgestellt<br />
werden kann, welche Zellen bei <strong>Leistungs</strong>einbußen<br />
eines Moduls fehlerhaft sind <strong>und</strong> um die Suche nach Defekten<br />
in Form von Rissen oder mech. Beschädigungen<br />
zu vereinfachen. Als Indikator für die Fehler sollen die<br />
Leerlaufspannungen der einzelnen Zellen gemessen<br />
<strong>und</strong> verglichen werden. Für den Messplatz sind die notwendigen<br />
Eckdaten zu spezifizieren (Lichtquelle, spektrale<br />
Eigenschaften, Geometrie der Solar Wafer…), der<br />
Versuchsaufbau ist zu projektieren <strong>und</strong> zu konstruieren.<br />
Anschließend soll die Anlage aufgebaut, getestet <strong>und</strong><br />
evaluiert werden. Die Arbeit wird fachlich durch die Firma<br />
DEUTSCHE SOLAR AG unterstützt,<br />
www.deutschesolar.de.<br />
[77] Päper, Marcus: Planung, Auslegung <strong>und</strong> Konstruktion<br />
einer Pilotanlage für die Ballastwasseraufbereitung<br />
(D, 2007): Das internationale Übereinkommen zur<br />
Behandlung von Ballastwasser mit verfahrenstechnischen<br />
Anlagen wird ab dem Jahr 2009 für einen Teil der<br />
über 45.000 Schiffe großen See-Handelsflotte in Kraft<br />
treten. Zukünftig sollen dann die Milliarden Tonnen Ballastwasser,<br />
die derzeit jährlich von Schiffen aufgenommen<br />
<strong>und</strong> später wieder abgegeben werden, so behandelt<br />
werden, dass durch die Verschleppung keine Schäden<br />
mehr an fremden Ökosystemen entstehen können.<br />
Der Schwerpunkt der Arbeit liegt darin, eine betriebsbereite<br />
Pilotanlage für die Aufarbeitung von Ballastwasser<br />
zu entwickeln <strong>und</strong> zu konstruieren. Basierend auf einer<br />
Einarbeitungszeit in das Thema soll sich die Ausarbeitung<br />
zunächst mit der methodischen Vorgehensweise<br />
zur Anlagenplanung <strong>und</strong> Konstruktion beschäftigen. Pa-<br />
47<br />
rallel zur nachfolgenden Auslegung <strong>und</strong> Berechnung der<br />
einzelnen Anlagenkomponenten <strong>und</strong> Bauteilen erfolgt<br />
die Modellierung/Visualisierung in einem 3-D CAD-<br />
Programm, mit anschließender Erstellung der notwendigen<br />
Fertigungs- <strong>und</strong> Montagezeichnung mit Stücklisten.<br />
Wenn möglich soll Im weiteren Rahmen der Diplomarbeit<br />
die zeitgleiche Herstellung <strong>und</strong> Montage der Anlage<br />
betreut <strong>und</strong> die landseitigen Tests am Aufstellungsstandort<br />
vorbereitet werden. Die Arbeit wird fachlich betreut<br />
von der Firma MAHLE NFV GmbH, Hamburg<br />
(www.nfv-gmbh.de).<br />
SS 2008<br />
[78] Pohlmann, Fritz: Entwicklung eines Simulationsmodells<br />
für den hydr. Kreislauf von Gabelstablern (D,<br />
2007): Zum Heben <strong>und</strong> Neigen der Gabel, in der Lenkung<br />
<strong>und</strong> dem Lüfter kommen beim Gabelstapler hydraulische<br />
Aktoren zum Einsatz. Diese bilden ein komplexes<br />
hydraulisch-mechanisches System <strong>und</strong> müssen sehr<br />
genau aufeinander abgestimmt sein. Bei Still kommen<br />
für die Simulation solcher Systeme die Programme<br />
DSHplus <strong>und</strong> Matlab/Simulink zum Einsatz anhand derer<br />
die Hydraulik eines Staplers ausreichend realitätsnah<br />
abgebildet werden kann. Um den Wärmehaushalt eines<br />
Systems im Vorfeld abschätzen zu können soll in einer<br />
Studien-/Diplomarbeit ein DSHplus-Modell der Hydraulik<br />
im Stapler aufgebaut werden das die thermischen Eigenschaften<br />
der einzelnen Komponenten abbildet. Eine<br />
Bauteilbibliothek für solche Komponenten ist vorhanden.<br />
Komponenten die nicht als Bauteil existieren müssen<br />
entsprechend modelliert werden, z.B. durch die Modifikation<br />
des c++-Codes bestehender Bauteile. Durch abgleichende<br />
Messungen am Gerät soll das thermische<br />
Modell der Hydraulik verifiziert werden.<br />
[79] Insel, Johannes; Jacobsen, Johannes: Berechnungen<br />
<strong>und</strong> Versuche am STIRLING-Motor VIEBACH<br />
ST05G: Beim STIRLING-Motor wird extern eingebrachte<br />
Wärme in mechanische Energie umgesetzt. Deshalb<br />
wird dieser Motortyp wiederholt für regenerative Energieprojekte<br />
eingesetzt (Pumpenantrieb in <strong>Dr</strong>itte-Welt-<br />
Staaten, Dish-Stirling-Prozess zur solaren Stromerzeugung,<br />
als Kombiprozess für Hausfeuerungsanlagen<br />
usw.) Wegen seiner Laufruhe wurden auch schon militärische<br />
Einsatzgebiete erforscht. Anhand des HAW-<br />
Versuchsmotors VIEBACH ST05G sollen die theoretische<br />
praktischen Erfahrungen studiengerecht für einen<br />
Prüfstandsversuch aufgearbeitet werden. Dazu sind Optimierungspotentiale<br />
herauszuarbeiten <strong>und</strong> Vorschläge<br />
zum Ausbau des Versuchsstandes zu entwickeln. Die<br />
Arbeit baut auf Ergebnissen eines Studienprojektes<br />
(Projekt 1) auf.<br />
[80] Schulze, Martin; Safenreiter, Max: Simulationsberechnungen<br />
zur Rückwirkung von Erdwärmepumpen<br />
auf das Erdreich (S, 2008): Erdwärme wird in der aktuellen<br />
Diskussion zur CO2-Minimierung als nachhaltige<br />
Ressource zur Wärmeversorgung von Haushalten angesehen.<br />
Hierbei wird im Allgemeinen oberflächennahe<br />
Erdwärme mittels einer Wärmepumpe genutzt <strong>und</strong> zur<br />
Raumklimatisierung nutzbar gemacht. Um alle Optimierungspotentiale<br />
ausnutzen zu können sind die Rückwirkungen<br />
auf das Erdreich durch Simulationsrechnungen<br />
zu untersuchen. Es sind die täglichen <strong>und</strong> jahreszeitlichen<br />
Schwankungen des Wärmeangebotes mit zu berücksichtigen.<br />
Dabei soll vorzugsweise das Softwarepaket<br />
COMSOL Multiphysics (http://www.comsol.de/) genutzt<br />
werden. Durch die Wahl geeigneter Randbedingungen<br />
sind hier relativ schnell Lösungen möglich.<br />
Gr<strong>und</strong>kenntnisse in COMSOL Multiphysics wären hilfreich,<br />
sind aber nicht zwingend notwendig. Es ist ein geeignetes<br />
Modell für einen Erdwärmekollektor zu entwerfen,<br />
die Modellparameter sind zu recherchieren <strong>und</strong> das<br />
Modell anhand geeigneter Sonderfälle zu evaluieren;<br />
ggf. kann noch ein Ausblick auf die Implementierung der<br />
Anlagentechnik in MATLAB/SIMULINK gegeben werden.
<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>.-<strong>Ing</strong>. Holger Watter Flensburg University of Applied Sciences<br />
[81] Silkenath, André: Analyse von Lagerhaltungskonzepten<br />
einer Seereederei (D, 2006): Backro<strong>und</strong>:<br />
Seagoing vessels are nowadays highly complex systems.<br />
For planned and unscheduled maintenance and<br />
repairs the shipboard personnel require a huge variety of<br />
spares. These are either kept as store on board or they<br />
may be purchased and supplied by the shorebased administration<br />
of the shipping company on a case to case<br />
basis if and when required. Additionally it is not uncommon<br />
that a service engineer may bring along spare parts<br />
if arranged for. In this scenario the classification rules,<br />
requesting a certain amount of mandatory spare stock<br />
kept on board, have to be taken into account as well.<br />
Task: 1.) The first goal of the thesis shall be to define<br />
the two extreme scenarios (0 pct. vs. 100 pct. stock<br />
keeping) and to estimate the cost (mainly: spare part<br />
purchase, off-hire, transportation) involved to maintain<br />
the vessel seaworthy whilst keeping the required stock<br />
level. 2.) The second goal shall be to analyse whether<br />
there is any theoretical optimum between both extreme<br />
positions. 3.) The third goal shall be to analyse a defined<br />
group of vessels (preferably: two groups of tankers,<br />
e.g.: product vs. crude) for a recent period (probably:<br />
2004) and to determine where CSM stands in between<br />
both extreme cases (http://www.csm-d.com/). Approach:<br />
General conditions to be considered are (a) the trade of<br />
the vessel (b)supplying restrictions (e.g.: US) (c) budget<br />
restrictions (d) stock keeping restrictions of major suppliers<br />
worldwide leading to long delivery times of vital components<br />
(e.g.: camshafts, cylinder liners etc.).<br />
[82] Kreik, Sergej / Korkmaz, Filit / Schwemer, Hagen /<br />
Reyels, Daniel: Entwicklung eines Simulationsmodells<br />
für eine pneumatische Achspositionierung (S,<br />
2007): Mit dem Software-Tool MATLAB-SIMULINK ist<br />
ein Simulationsmodell für eine pneumatische Achspositionierung<br />
zu entwickeln. Dabei sind die folgenden Komponenten<br />
zu berücksichtigen: Verdichter, <strong>Dr</strong>uckluftspeicher,<br />
Filtereinheit, Proportionalventil, allgemeiner PID-<br />
Regler, Pneumatikzylinder sowie Zu- <strong>und</strong> Ableitungen.<br />
Die Eckdaten sind aus exemplarischen Datenblättern<br />
von Komponentenherstellern zu entnehmen. Bei der Dokumentation<br />
ist der Bezug zu den Datenblättern, die<br />
Modellbildung <strong>und</strong> die SIMULINK-Implementation so<br />
darzustellen, dass die Vorgehensweise für Studierende<br />
der Bachelor-Studiengänge leicht verständlich nachvollziehbar<br />
ist.<br />
WS 2008/09<br />
[83] Jahnke, Björn: Auswahl <strong>und</strong> Dimensionierung einer<br />
Ballastwasseranlage gem. IMO-Regularien für ein<br />
Containerschiff (S, 2007): Für einen Containerschiffsneubau<br />
(2800 TEU, Baunummer ....Fahrtgebiet ....) ist<br />
ein Ballastwasseraufbereitungsanlage auszuwählen <strong>und</strong><br />
zu dimensionieren. Dazu sind die schiffsspezifischen Anforderungen<br />
darzustellen sowie eine, in Vorarbeiten bereits<br />
erstellte Bewertungsmatrix auf 5 bis 6 Kriterien zu<br />
untersuchen <strong>und</strong> zu spezifizieren. Bei der Auswahl ist<br />
eine kurze Marktübersicht <strong>und</strong> Bewertung der Anbieter<br />
vorzulegen <strong>und</strong> zu begründen. Anschließend sollen die<br />
Eckdaten der ausgewählten Anlage konkretisiert werden.<br />
[84] Bennholdt-Thomsen: Modifizierung des Antriebsstranges<br />
einer Exzenterschneckenpumpe (D, 2007):<br />
Ausgeführte Exzenterschneckenpumpe werden z.Zt.<br />
über eine Kardanwelle angetrieben. Der Fertigungsaufwand<br />
für derartige Antriebe ist relativ aufwendig. Es sind<br />
alternative Antriebs- <strong>und</strong> Übertragungskonzepte zu untersuchen.<br />
Dabei sind die Vor- <strong>und</strong> Nachteile der Antriebskonzepte<br />
gegenüber zu stellen <strong>und</strong> zu bewerten.<br />
Das neue Konzept soll konstruktiv ausführlich untersucht<br />
werden (Kinematik, Dimensionierung, Konstruktions-<br />
<strong>und</strong> Fertigungszeichnungen). Die Arbeit wird fachlich<br />
durch die Firma BORNEMANN GmbH unterstützt;<br />
http://bornemann.com/deutsch/index.htm<br />
48<br />
[85] Kremer, Bastian: Untersuchung eines 4-Takt-<br />
Walzendrehschiebermotors für Motorgeräte (D,<br />
2008): In einer vorausgegangenen Arbeit wurde ein<br />
Viertaktmotor mit Walzendrehschieber für Motorgeräte<br />
ausgelegt <strong>und</strong> als Prototyp gefertigt. Der Motor ist als<br />
Antrieb für Motorsensen <strong>und</strong> Heckenscheren vorgesehen,<br />
seine spezifische Leistung sollte etwa 35 bis 40<br />
kW/l betragen. Im Rahmen dieses Projektes soll, aufbauend<br />
auf dem vorhandenen Prototyp, untersucht werden,<br />
inwieweit durch Änderungen des Prototyps Verbesserungen<br />
im <strong>Dr</strong>ehschieberbereich <strong>und</strong> der <strong>Leistungs</strong>ausbeute<br />
erzielt werden können. Hierbei sollen insbesondere<br />
die Materialpaarung von <strong>Dr</strong>ehschieber <strong>und</strong> Zylinderkopf,<br />
die Abdichtung des <strong>Dr</strong>ehschiebers <strong>und</strong> sowie<br />
der Steuerzeiten untersucht werden.<br />
[86] Grüß, Arno: Entwicklung eines Schwingungsprüfstandes<br />
für Schaltschränke incl. Rahmenkonstruktion<br />
in Windkraftanlagen (D, 2008): Windkraftanlagen<br />
sind aufgr<strong>und</strong> ihrer Konstruktion schwingungsfähige<br />
Bauwerke. Durch die Turbulenz des Windes wird die<br />
Gondel der Anlage im unteren Frequenzbereich bis zu<br />
ca. 10 Hz mit mehr oder weniger großen Amplituden angeregt.<br />
In der Gondel sind neben den relativ massiven<br />
Komponenten des Triebstrangs auch Schaltschränke mit<br />
elektronischen Steuerungen untergebracht. Durch die<br />
Entwicklung eines Schwingungsprüfstands soll die<br />
Schwingungsfähigkeit <strong>und</strong> -festigkeit der Schränke, der<br />
Aufnahmen bzw. Rahmenkonstruktionen derselben <strong>und</strong><br />
auch der elektronischen Komponenten sichergestellt<br />
werde. Die Aufgabe soll mit einer Recherche der relevanten<br />
Normen für Windkraftanlagen <strong>und</strong> Schwingungsprüfungen<br />
für elektrotechnische Komponenten beginnen.<br />
Über eine Auswertung von Messergebnissen ausgeführter<br />
Windkraftanlagen ist der Schwingungsbereich in Frequenz<br />
<strong>und</strong> Amplitude festzulegen. Anschließend sind eine<br />
konzeptionelle Untersuchung <strong>und</strong> eine Auswahl eines<br />
geeigneten Prüfverfahrens durchzuführen. In der Detaillierung<br />
soll eine Konstruktion des Prüfstands auf Basis<br />
des ausgewählten Verfahrens erfolgen. Die Fertigung<br />
des Prüfstands wird mit der Unterstützung eines geeigneten<br />
Lieferanten in Verantwortung der Fa. NORDEX<br />
durchgeführt. www.nordex-online.com/de. Im Rahmen<br />
der Diplomarbeit ist abschließend an einem Beispiel die<br />
Funktionsfähigkeit <strong>und</strong> Praxisnähe der Prüfung zu dokumentieren.<br />
[87] Beck, Walter: Entwicklung eines LKW-<br />
Beladungskonzeptes für fahrerlose Transportsysteme<br />
[FTS] (D, 2008): LKW <strong>und</strong> Container werden derzeit<br />
mit Gabelstaplern beladen. Durch diese Art der Beladung<br />
entstehen einerseits hohe laufende Kosten, andererseits<br />
gibt es immer wieder Unfälle an Mensch <strong>und</strong><br />
Ware durch Unachtsamkeit der Fahrer. Durch den standardmäßigen<br />
Einsatz von stets des gleichen Transportgutes<br />
(Europaletten) bei der Beladung von LKW <strong>und</strong><br />
Containern (Europaletten) besteht die Möglichkeit ein<br />
neues Transportkonzept, dass der Fahrerlosen Transportsysteme<br />
(FTS), auf diese Transportproblematik anzuwenden.<br />
FTS werden derzeit in der Firmeninternen<br />
Logistik aller großen Firmen <strong>und</strong> Marken eingesetzt. Innerhalb<br />
der FTS gibt es die drei Hauptgruppen:(1) Gabelfahrzeuge<br />
für den Transport von Europaletten (2)<br />
Schlepper zum Ziehen von Anhängern (3) Fahrzeuge<br />
mit speziell für den Einzelfall konstruiertem Lastmittel.<br />
Bisher fahren FTS eher selten im Außenbereich <strong>und</strong><br />
noch nicht in LKW. Ziel dieser Diplomarbeit soll es sein,<br />
auf Gr<strong>und</strong>lage einer Marktstudie ein Konzept zu erstellen,<br />
dass die Beladung von LKW <strong>und</strong> Containern ermöglicht,<br />
dies beinhaltet auch interdisziplinäres Denken hinsichtlich<br />
der besonderen Probleme dieser Transportaufgabe<br />
wie die Absicherung des Fahrzeuges beim Auffahren<br />
auf den LKW (ist ein LKW da, ist er richtig positioniert,<br />
Niveauunterschiede zwischen LKW <strong>und</strong> Rampe,<br />
Navigation in dem LKW). Die Arbeit wird fachlich durch
<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>.-<strong>Ing</strong>. Holger Watter Flensburg University of Applied Sciences<br />
die Firma E&K Automation unterstützt (www.ekautomation.com).<br />
[88] Reyels, Daniel: Konstruktion eines einachsigen<br />
Nachführungssystems für Photovoltaik- Anlagen (D,<br />
2008): Für eine Photovoltaik-Anlage ist ein einachsiges<br />
Nachführungssystem zu entwickeln <strong>und</strong> ein Konstruktionsentwurf<br />
zu erstellen. Dazu soll zunächst eine Marktanalyse<br />
durchgeführt <strong>und</strong> darauf aufbauend eine eigene<br />
Nachführung weiterentwickelt werden. Im Vordergr<strong>und</strong><br />
steht dabei die Untersuchung <strong>und</strong> Auswahl der optimalen<br />
Nachführungsart unter besonderer Berücksichtigung<br />
des Antriebs- <strong>und</strong> unter Verwendung des vorhandenen<br />
Steuerkonzeptes. Es sind die Flächennutzungsbedingungen<br />
hinsichtlich der gegenseitigen<br />
Verschattung zu optimieren, hierbei liegt der Schwerpunkt<br />
auf dem Flächennutzungsgrad. Der Ertrag kann<br />
hierbei nur qualitativ berücksichtigt werden. Die Konstruktion<br />
soll in Solarparks in Südeuropa großflächig<br />
eingesetzt werden. Die Aufnahme von gerahmten Solarmodulen<br />
nach IEC 61730 muss gewährleistet sein.<br />
Gegenüber der Nachführung ETATRACK 1500 sollen<br />
Materialeinsatz <strong>und</strong> Herstellkosten reduziert werden. Die<br />
Arbeit wird fachlich von der Firma BERNT LORENTZ<br />
GmbH & Co. KG - www.lorentz.de – unterstützt.<br />
[89] Schulz, Christoph: Ein Beitrag zur Berechnung der<br />
Wärmeübertragungseigenschaften in einem Erdwärmekollektor<br />
(D, 2008): Die Wärmeübertragungseigenschaften<br />
eines Erdwärmekollektors bestimmt die<br />
<strong>Leistungs</strong>zahl <strong>und</strong> das Betriebsverhalten von<br />
Erdwärmepumepen. Es ist ein mathematisches Modell<br />
für die Berechnung der Wärmeübertragungseigenschaften<br />
als finites Differenzenverfahren zu entwickeln. Dabei<br />
ist besonderen Wert auf die Nachvollziehbarkeit der Modellbildung<br />
<strong>und</strong> der Modellevaluation zu legen. Es sind<br />
plausible <strong>und</strong> nachvollziehbare Randbedingungen eines<br />
exemplarischen Sonderfalls zu wählen.<br />
[90] Küchler, Marco; Wolf, Sebastian: Planung <strong>und</strong> Projektierung<br />
des Pumpenaggregats im Labor für Hydraulik<br />
<strong>und</strong> Pneumatik (S, 2008): Die Pumpenaggregate<br />
des Labors haben den technischen Stand von 1983 <strong>und</strong><br />
sollen durch moderne, energieeffiziente Konzepte ersetzt<br />
werden. Hierzu sind ein Konzeptentwurf zu erstellen<br />
<strong>und</strong> ein Lösungsvorschlag zu erarbeiten. Es sind folgende<br />
Teilaufgaben zu bearbeiten: (1) Erfassung des<br />
Ist-Standes (Bauraum, Peripherie), (2) Spezifikation des<br />
Soll-Standes (Komponentenauswahl, Preisanfrage, Variantenauswahl;<br />
(3) Regelkonzepte <strong>und</strong> Sensorspezifikationen<br />
(Messgeräteauswahl, SPS-<br />
Programmierungsvorschlag, Regelkonzepte; (4) Marktanalyse<br />
(Herstellerauswahl, Nutzwertanalyse; (5)<br />
Konzeptentwurf´(Übersichtsmodell in SolidWorks, Stücklisten)<br />
[91] Mittelheuser, Markus: Entwicklung eines Nachführungssystems<br />
für eine Photovoltaikanlage für den<br />
nordamerikanschen Raum (D, 2008): Die Effektivtät<br />
der PV-Module kann durch das Nachführen des Sonnenverlaufs<br />
mit beeinflusst werden. Im Rahmen der Arbeit<br />
soll ein Nachführungssystem für PV-Module für BP-<br />
Solar in Californien/ USA entwickelt werden. Die Bearbeitung<br />
erfolgt im Rahmen eines Projekt der Fa. BERNT<br />
LORENTZ GMBH & CO. KG; www.lorentz.de. Dabei<br />
sind folgende Punkte zu berücksichtigen: Analysieren<br />
der bereits aufgestellten Produktanforderungen, Weiterentwickeln<br />
<strong>und</strong> Anpassen von bereits vorhandenen Konzepten,<br />
Auswählen einer geeigneten Lösung, Auslegen<br />
der Hauptkomponenten insbesondere mit Hinblick auf<br />
die Erdbebenstandsicherheit, Gestalten der Komponenten<br />
in CAD, Erstellen von Fertigungsunterlagen.<br />
[92] Czechanowski, Paul: Entwicklung von<br />
schockgedämpften Klimageräten für die Fregatten<br />
F125 der Deutschen Marine: Auf Schiffen kommt es<br />
aufgr<strong>und</strong> des Schiffsbetriebes(Seegang, Maschinenlauf)<br />
zu ständigen Vibrationsbelastungen der verbauten Geräte.<br />
In dieser Arbeit werden für die Fregatten F125 der<br />
49<br />
Deutschen Marine schockgedämpfte Klimageräte entwickelt.<br />
Diese Geräte müssen sowohl den äußeren Belastungen<br />
standhalten, dürfen dabei aber ,zum Schutz von<br />
anderen Geräten <strong>und</strong> der Schiffstruktur, ihrerseits möglichst<br />
keine Schwingungen auf das Schiff übertragen.<br />
Für die Belastungskennwerte werden hierbei die Bauvorschriften<br />
der B<strong>und</strong>eswehr für Schiffe BV 0240 zugr<strong>und</strong>e<br />
gelegt. Neben den konstruktiven Tätigkeiten ist<br />
eine Vergleichsberechnung anzufertigen, die die Kosten<br />
für die Eigenfertigung der Klimageräte <strong>und</strong> handelsüblicher<br />
Beschaffung, mit den notwendigen Anpassungen,<br />
gegenüberstellt. Diese Arbeit wird durch die Firma<br />
Imtech Schiffbau/Dockbau (www.imtech.de) unterstützt.<br />
SS 2009<br />
[93] Wilhelm, Andreas: Energetische Verwertung von<br />
Stroh (S, 2007): Für einen landwirtschaftlichen Betrieb<br />
sind die Verwertungsmöglichkeiten für Stroh zu untersuchen.<br />
Der Betrieb verfügt über 400 Hektar Fläche, der<br />
Strohertrag beträgt 5 bis 8 Tonnen Biomasse pro Hektar.<br />
Aufgr<strong>und</strong> der Lage (Flatzeby/Winderatt) ist eine externe<br />
thermische Verwertung vermutlich ausgeschlossen. Angedacht<br />
sind u.a. die Vermarktung von Strohpellets,<br />
Strohvergasung, Verstromung via ORC-Prozess oder<br />
Biogaserzeugung. Für die Varianten sind Machbarkeitsstudien<br />
(<strong>und</strong> sofern möglich Kostenschätzungen) sowie<br />
Handlungsempfehlungen für den Betrieb zu entwickeln.<br />
Dabei sind jeweils die Marktsituation sowie Chancen <strong>und</strong><br />
Risiken darzustellen <strong>und</strong> zu bewerten.<br />
[94] Buchholz, Michael: Konzepterstellung für einen<br />
Zwischenlagen Wechsler (S, 2008): Das Schienenwechselsystem<br />
„Stahlberg Roensch“ verlegt mit einem<br />
Arbeitszug neue Schienen, während die alten Schienen<br />
neben oder im Gleis abgelegt werden. Anschließend<br />
müssen die sog. Zwischenlagen gewechselt werden.<br />
Zwischenlagen, im Weiteren ZW genannt, sind elastische<br />
Platten, die zwischen Schiene <strong>und</strong> Schwelle gelegt<br />
werden, um eine elastischere Lagerung zu gewährleisten.<br />
Den Vorgang des ZW- Wechsels gilt es zu optimieren,<br />
denn bisher erfolgte der ZW- Wechsel in diskreten<br />
Schritten etwa mit Hilfe eines Baggers oder des sog.<br />
„Mammut- Gerätes“ zum Anheben der Schienen. Mit<br />
beiden Geräten wird die Schiene immer nur an einer<br />
Stelle angehoben <strong>und</strong> viele Arbeiter müssen in<br />
unergonomischer Haltung die Zwischenlagen wechseln.<br />
Danach muss das Gerät weiterbewegt werden <strong>und</strong> der<br />
Arbeitsgang beginnt von Neuem. Nach dem ZW Wechsel<br />
wird die Schiene verschweißt, neutralisiert <strong>und</strong> wieder<br />
verschraubt. Es soll ein Gerät, der „ZW- Wechsler“,<br />
konstruiert werden. Der ZW- Wechsler soll über einen<br />
eigenen Antrieb verfügen <strong>und</strong> einen kontinuierlichen<br />
Wechsel der ZW in ergonomischer Sitzposition mit weniger<br />
Arbeitern als bisher ermöglichen. Gr<strong>und</strong>lage dieses<br />
Gerätes soll eine bereits konstruierte <strong>und</strong> in Versuchen<br />
getestete Vorrichtung sein, die sogenannte Schienenraupe.<br />
Sie ermöglicht es die Schiene zu heben <strong>und</strong><br />
gleichzeitig entlang der Schiene zu fahren. Die Arbeit<br />
wird fachlich durch die Firma STAHLBERG ROENSCH<br />
in Hamburg-Rönneburg unterstützt.<br />
[95] Vorwerk, Georg-Thilo: Untersuchung der Anforderungen<br />
an die Schiffsbetriebstechnik bei der Installation<br />
von Großaquarien an Bord von Megayachten (D,<br />
2008): Zur Zeit befindet sich eine Megayacht in der Projektierung,<br />
welche mehrere Großaquarien an Bord vorsieht.<br />
Das größte dieser Aquarien soll in zylindrischer<br />
Form über mehrere Decks ein Gesamtvolumen von<br />
65m3 fassen bei einem projektierten Gesamtgewicht von<br />
ca. 100 to. Aquarien in dieser Dimension stellen besondere<br />
Anforderungen an den Schiffsentwurf <strong>und</strong> an die<br />
Schiffsbetriebstechnik <strong>und</strong> Schiffssicherheit. Diese sollen<br />
im Rahmen dieser Diplomarbeit herausgearbeitet<br />
werden. Bspw.: Anforderungen an die Schiffsintegration,<br />
Anforderungen abgeleitet aus Behörden <strong>und</strong> Klasseanforderungen<br />
bzw. welche sind anwendbar? Auswirkungen<br />
auf einzelne schiffsbetriebstechnische Systeme
<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>.-<strong>Ing</strong>. Holger Watter Flensburg University of Applied Sciences<br />
(Ballastsystem, Lenzsysteme, Wasseraufbereitung,<br />
etc.). Spezielle Anforderungen für den Betrieb von Aquarien<br />
bspw. Sicherstellung gleichbleibender Wassertemperatur<br />
in diesen Dimensionen Anforderungen an das<br />
Aquarium bei unterschiedlichen Krängungswinkeln. Die<br />
Arbeit wird fachlich unterstützt durch BLOHM+VOSS<br />
SHIPYARDS GMBH, http://www.blohmvoss.com/<br />
[96] Jahnke, Björn: Vergleichende Untersuchung einer<br />
navalisierten 350kW-MCFC mit einer Schiffsmotorenanlage<br />
(D, 2008): Der Schiffbau steht vor der Herausforderung<br />
weitere Energiesparmöglichkeiten zu entwickeln<br />
<strong>und</strong> einzuführen. Hierfür stellt auch die Brennstoffzellentechnologie<br />
eine Option dar. Um den Nutzen<br />
<strong>und</strong> auch den Aufwand eines Brennstoffzellenstromaggregates<br />
im Vergleich zu heutigen Dieselmotor-<br />
Aggregaten bewerten zu können soll ein Systemvergleich<br />
durchgeführt werden. Für die zu erstellende Arbeit<br />
ist zunächst die Energiebilanz eines 350-kW-MCFC-<br />
Brennstoffzellensystems von MTU mit XTL als Brennstoff<br />
aufzustellen. Die Bilanz soll vom Bunkertank bis zur<br />
Sammelschieneneinspeisung alle Energieumwandlungen<br />
erfassen <strong>und</strong> auch die Emissionen (Schadstoff <strong>und</strong><br />
Geräusch) ermitteln. Im zweiten Teil der Arbeit ist ein<br />
Dieselmotoraggregat zu entwerfen, das den gleichen<br />
Wirkungsgrad hat <strong>und</strong> mit Sek<strong>und</strong>ärmaßnahmen die<br />
gleichen Emissionswerte wie die BZ-Anlage erreicht. Die<br />
beiden Systeme sind dann physikalisch <strong>und</strong> qualitativ<br />
ökonomisch zu vergleichen. Dazu gehören Abmessungen,<br />
Gewichte <strong>und</strong> Verbräuche sowie Wartungsaufwände.<br />
Die Ergebnisse sind auch grafisch in einem Generalplan<br />
darzustellen. Die Arbeit wird fachlich durch die<br />
Firma TKMS Blohm + Voss Nordseewerke GmbH unterstützt.;<br />
http://www.thyssenkrupp-marinesystems.de.<br />
[97] Schwartau, Jan-Hinrich: Wechselwirkungen beim<br />
Umstellvorgang von Schweröl- auf Destillatbetrieb<br />
an Bord von Seeschiffen (D, 2008): Internationale<br />
Ubereinkünfte verlangen zukünftig die Reduzierung des<br />
Schwefelgehalte in Schifffahrtsbrennstoffen. Die Umstellung<br />
von Schweröl- auf Destillatbetrieb stellt dabei eine<br />
mögliche Option dar. Im Rahmen der Arbeit sollen konstruktive<br />
<strong>und</strong> betriebliche Probleme dargestellt <strong>und</strong> bewertet<br />
werden. Es sind Prognosewerkzeuge zu entwickeln,<br />
die einen langfristigen, zuverlässigen Schiffsbetrieb<br />
gewährleisten (Vorschriftenlage, betriebliche Aspekte,<br />
Kenngrößen, Berechnungsmöglichkeiten). Die<br />
Arbeit wird fachlich vom GERMANISCHEN LLYOD,<br />
www.gl-group.com, unterstützt.<br />
[98] Tollknäpper, Kai: Strömungstechnische Optimierung<br />
der Ventilplatten- <strong>und</strong> Blockgeometrie einer Axialkolbenpumpe<br />
(D, 2008): Hydrostatische Einheiten stellen<br />
einen wesentlichen Baustein der Fahrantriebe im Bereich<br />
der Mobilhydraulik dar. Neue Entwicklungen <strong>und</strong><br />
Optimierungen von hydraulischen Fahrantrieben, Teilsystemen<br />
oder auch einzelnen Komponenten erfordern<br />
den Einsatz moderner Simulationswerkzeuge, u.a. um<br />
Testkapazitäten einzusparen. Ein Werkzeug, um im Detail<br />
physikalische Effekte im Verdrängerraum zu simulieren,<br />
ist CFD (Computational Fluid Dynamic). Die Ventilplatte<br />
ist das zentrale Umsteuerelement in Schrägscheibeneinheiten,<br />
wobei der <strong>Dr</strong>uckverlauf im<br />
Verdrängerraum <strong>und</strong> die Kavitationsneigung durch die<br />
Ventilplattengeometrie beeinflusst wird. Ziel dieser Arbeit<br />
ist es, mittels CFD-Strömungssimulation Kavitation im<br />
Bereich der Umsteuerung für unterschiedliche Betriebsbedingungen<br />
<strong>und</strong> Geometrien zu simulieren. Weiterhin<br />
sollen generelle Optimierungsansätze an einem speziellen<br />
Pumpenmodell entwickelt <strong>und</strong> getestet werden, wobei<br />
auch volumetrischer Wirkungsgrad sowie Verstellkräfte<br />
zu berücksichtigen sind. Die Arbeit wird fachlich<br />
von der Firma SAUER-DANFOSS unterstützt;<br />
www.sauer-danfoss.com<br />
[99] Schwemer, Hagen: Automatische Wirkungsgradmessung<br />
(D, 2008): Aufgr<strong>und</strong> der Flexibilität <strong>und</strong> der<br />
hohen <strong>Leistungs</strong>dichte hat die Bedeutung hydraulischer<br />
50<br />
Fahrantriebe in den letzten Jahren weiter zugenommen.<br />
Vielfältige Vorteile führten zu einer starken Verbreitung<br />
dieser Systeme, die hauptsächlich in Baumaschinen <strong>und</strong><br />
selbstfahrenden landwirtschaftlichen Fahrzeugen (Erntemaschinen)<br />
eingesetzt werden. Der hydraulische<br />
Fahrantrieb besteht im Wesentlichen aus zwei Axialkolbenmaschinen<br />
– einer Hydraulikpumpe <strong>und</strong> einem Hydraulikmotor.<br />
Die Pumpe wandelt die mechanische Leistung<br />
in hydraulische <strong>und</strong> der Motor die hydraulische<br />
Leistung wieder zurück in mechanische. Neue Entwicklungen<br />
von gesamten Antriebssystemen oder Teilsystemen<br />
werden umfangreichen Funktionstests unterzogen.<br />
Diese haben das Ziel, die in der Entwurfsphase gesetzten<br />
bzw. prognostizierten Kenngrößen zu überprüfen.<br />
Ein wichtiger Teil dieser Prüfungen, gerade in der heutigen<br />
Zeit, stellt die exakte Untersuchung der Wirkungsgrade<br />
von Pumpen <strong>und</strong> Motoren dar. Für die Bestimmung<br />
der Wirkungsgrade von hydrostatischen Antrieben<br />
sind konstante Betriebsbedingungen unbedingte Voraussetzung.<br />
Für die Vermessung eines kompletten<br />
Kennfeldes, müssen die Parameter Systemdruck, <strong>Dr</strong>ehzahl,<br />
Fördervolumen, Temperatur sowie Pumpen bzw.<br />
Motorbetrieb variiert werden. In Summe kommen hier<br />
etwa 1.000 Messpunkte zusammen. Um einen Messpunkt<br />
im „Eingeschwungenen“ Zustand zu ermitteln vergehen<br />
heute bei manuellem Betrieb etwa 5 bis 10 Minuten.<br />
Da in Zukunft die Wirkungsgradmessung in einem<br />
weitestgehend automatisierten Prüfablauf stattfinden<br />
soll, müssen die Prüfstandstechnik (SPS Software Programmierbare<br />
Steuerung) <strong>und</strong> die Messtechnik miteinander<br />
Kommunizieren. Ziel dieser Diplomarbeit ist es,<br />
die vorhandenen Komponenten (Prüfstandssteuerung,<br />
Messtechnik, hydraulischer Lastkreis, ...) zu analysieren,<br />
ein Konzept zum automatischen Betrieb eines Prüfstands<br />
zu erstellen <strong>und</strong> hierauf basierend Änderungen in<br />
die jeweiligen Programme (SPS; IMC) einfließen zu lassen,<br />
um einen automatischen oder zumindest teilautomatischen<br />
Prüfbetrieb durchführen zu können. Die<br />
rechtlichen <strong>und</strong> administrativen Rahmenbedingungen<br />
regelt der derzeit gültige Diplomandenvertrag der Firma<br />
Sauer-Danfoss; http://www.sauer-danfoss.de.<br />
[100] Marhabe, Saad: Methodische Entwicklung eines<br />
Kurvenscheibengetriebes für Klemmsysteme in<br />
PKW Sicherheitslenksäulen (D, 2008): Die Lenksäule<br />
eines Pkw’s überträgt die Lenkbewegung (<strong>Dr</strong>ehwinkel,<br />
<strong>Dr</strong>ehmoment) vom Lenkrad zum Lenkgetriebe. Das<br />
Lenkrad lässt sich manuell innerhalb des Bewegungsraumes,<br />
der sich durch die Einstellwege aus der<br />
K0-Lage ergibt, in jede beliebige Position stufenlos einstellen.<br />
Das Klemm- <strong>und</strong> Verstellsystem wird manuell<br />
durch eine Rotationsbewegung des Klemmhebels der<br />
sog. Klemmvorrichtung ent- bzw. verriegelt. Die neu zu<br />
entwickelnde Klemmvorrichtung wandelt die Handhebelenergie,<br />
die über den Auslösehebel ein <strong>Dr</strong>ehmoment auf<br />
der Klemmbolzenachse erzeugt in einen axialen<br />
Klemmhub <strong>und</strong> einer axialen Klemmkraft. Im Fall eines<br />
Crashs darf bei verriegelter Klemmvorrichtung das<br />
Klemm- <strong>und</strong> Verstellsystem nicht durchrutschen. Der<br />
Knieaufprallbereich muss frei von Verletzungsrisiken<br />
sein. Die Arbeit wird fachlich durch das MERCEDES-<br />
BENZ-Werk Hamburg unterstützt.<br />
[101] Jacobsen, Johannes: Entwicklung eines Konzepts<br />
zur Zwischenlagerung der Rotorwelle im Bereich des<br />
Statorpakets im Unterwassermotor (D, 2008): Die<br />
Firma FLOWSERVE ist ein weltweit agierender Konzern<br />
mit ca. 14000 Mitarbeitern <strong>und</strong> Hauptsitz in Irving/Texas<br />
(www.flowserve.de). FLOWSERVE produziert in drei<br />
Hauptgeschäftsbereichen Pumpen, Ventile <strong>und</strong> Armaturen.<br />
Am Standort Hamburg entwickelt <strong>und</strong> fertigt<br />
FLOWSERVE u. a. Unterwasserpumpen <strong>und</strong> – motoren<br />
der Marke PLEUGER. Diese Aggregate werden für verschiedenste<br />
Verwendungszwecke eingesetzt <strong>und</strong> werden<br />
daher in einer <strong>Leistungs</strong>spanne von 4,5 kW bis in<br />
den Bereich einiger MW angeboten. Die entsprechenden
<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>.-<strong>Ing</strong>. Holger Watter Flensburg University of Applied Sciences<br />
Motordurchmesser reichen von 4“ bis zu 30“. Die Stabilität<br />
<strong>und</strong> eine hohe Laufruhe der einzelnen Motoren werden<br />
erlangt, indem sie so ausgelegt <strong>und</strong> in ihrer Länge<br />
begrenzt werden, dass die Eigenfrequenzen über der<br />
Betriebsfrequenz liegen. Für hohe Leistungen führt dies<br />
zum Hintereinanderschalten mehrerer Motoren mit Zwischengehäusen<br />
<strong>und</strong> Kupplungen. Die Verbindung von<br />
zwei Motoren ist relativ aufwendig, daher soll ein Konzept<br />
zur Zwischenlagerung eines Rotors im Paketbereich<br />
entworfen werden, um längere Motoren mit höheren<br />
Leistungen auch ohne Zwischengehäuse <strong>und</strong> Kupplung<br />
bauen zu können. Die Aufgabenstellung umfasst im<br />
Einzelnen: Ausführliche Literatur- <strong>und</strong> Patentrecherche,<br />
Überblick der Umgebungsbedingungen <strong>und</strong> speziellen<br />
Anforderungen an die Lagerstelle, Entwicklung mehrerer<br />
Konzepte für die Umsetzung einer Zwischenlagerung,<br />
Darstellung <strong>und</strong> alternative Abwägung von den<br />
einzelnen Konzepten, besonders eine kritische Betrachtung<br />
der Umsetzbarkeit; Erarbeitung <strong>und</strong> konstruktiver<br />
Entwurf einer Endlösung; Dokumentation der Arbeit. Die<br />
vollständige, detaillierte Konstruktion der Zwischenlagerung<br />
ist im Rahmen dieser Diplomarbeit nicht erforderlich.<br />
[102] Unguraitys,Thomas: Aufbau <strong>und</strong> Inbetriebnahme<br />
eines Versuchsstandes für einen<br />
Latentwärmespeicher (S, 2008): Latentwärmespeicher<br />
bieten die Möglichkeit bei geringem Speichervolumen<br />
<strong>und</strong> kleinen Temperaturdifferenzen relativ große Wärmemengen<br />
zu speichern. Dabei wird ausgenutzt, dass<br />
während der Speicherung im Material eine Phasenumwandlung<br />
stattfindet. Die Energie also in Form von Phasenumwandlungsenergie<br />
gespeichert wird. Diese Materialien<br />
werden als PCM (Phase - Change - Material) bezeichnet.<br />
Bisher werden überwiegend Eisspeicher genutzt,<br />
um Wärme einzuspeichern. Dafür braucht es immer<br />
Kältemaschinen, die zusätzlich Temperaturen von<br />
deutlich unter 0°C liefern, um Eis zu herzustellen. Als<br />
Raumklimatisierung eingesetzt, erzeugen sie Kälte, die<br />
gar nicht gebraucht wird <strong>und</strong> die Kältemaschinen arbeiten<br />
mit vergleichsweise schlechtem Wirkungsgrad. Werden<br />
passende Paraffine als PCMs benutzt, so findet der<br />
Phasenwechsel auf einem Temperaturniveau nahe der<br />
gewünschten Vorlauftemperaturen statt. Die tagsüber<br />
anfallende Wärme wird im Paraffin gespeichert <strong>und</strong> in<br />
den kühleren Nachtst<strong>und</strong>en wieder abgegeben, dadurch<br />
kann gerade zu Spitzenlastzeiten der Energiebedarf der<br />
Kältemaschine gesenkt werden. Im Rahmen eines Forschungsauftrages<br />
vom B<strong>und</strong>esministerium für Wirtschaft<br />
<strong>und</strong> Technologie, sollen in Kooperation mit dem Fraunhofer<br />
Institut für Solare Energiesysteme zwei Speichertechnologien<br />
entwickelt <strong>und</strong> untersucht werden. Diese<br />
Speicher sollen Paraffin als PCM nutzen <strong>und</strong> nach Fertigstellung<br />
miteinander <strong>und</strong> mit einem Eisspeicher verglichen<br />
werden. Das Fraunhofer-Institut baut einen sogenannten<br />
PCS - Speicher (Phase - Change- Slurry), wo<br />
das Speichermaterial mikroverkapselt im Wasser vorliegt<br />
<strong>und</strong> durch das Kältesystem gepumpt werden kann. Bei<br />
dem von Imtech gebauten Speicher befindet sich das<br />
Paraffin in vakuumverschweißten Graphitverb<strong>und</strong>platten<br />
<strong>und</strong> wird im Behälter von Wasser umströmt. In der Studienarbeit<br />
ist ein Versuchsstand für einen wasserdurchströmten<br />
PCM-Latentwärmespeicher aufzubauen <strong>und</strong> in<br />
Betrieb zu nehmen. Dabei sind die nachfolgenden<br />
Randbedingungen zugr<strong>und</strong>e zu legen: (1) Aufbau des<br />
Speichers: Der aus Einzelteilen bestehende Behälter ist<br />
aufzubauen <strong>und</strong> abzudichten (2) Strömungsverteilung:<br />
Vor dem Bestücken des Wärmespeichers ist die Strömungsverteilung<br />
zu prüfen (Sichtprüfung) <strong>und</strong> gegebenenfalls<br />
zu verbessern. (3) Bestücken des Speichers:<br />
Ändern der Speichergeometrie für das erste Bestücken<br />
mit bei Imtech vorhandenen RT20 PCM-Platten. Die Bestückung<br />
des Speichers mit möglichst geringem Plattenabstand<br />
für einen möglichst großen PCM Anteil im Speicher.<br />
(4) Versuchsstand: Die Messstation ist an den<br />
51<br />
Speicher anzuschließen. Es ist ein hydraulisches Konzept<br />
für das Umstellen von Warm- auf Kaltwasser des<br />
Primärkreises zu entwickeln. Zusätzliche Temperatursensoren<br />
für Wand- <strong>und</strong> Umgebungstemperaturen anbringen.<br />
(5) Messstation mit <strong>Dr</strong>ucksensoren erweitern:<br />
Den Messrechner zur Datenerfassung einrichten. Die<br />
Arbeiten an dem Wärmespeicher enden mit den ersten<br />
Versuchsreihen, die eine Auswertung der Messdaten<br />
ermöglichen. Fachlich wird die Studienarbeit durch die<br />
Firma IMTECH (www.imtech.de) in Person von Dipl.-<br />
<strong>Ing</strong>. Peter Thiel unterstützt.<br />
[103] v. Melle, Vincent: Abstimmung der Aufladung für<br />
leistungsgesteigerte Marine-Motoren der Baureihe<br />
2000CR unter Berücksichtigung der Emissionsgesetzgebung<br />
US EPA Tier 2 (D, 2008): Im Rahmen der<br />
Serienentwicklung bei der MTU Friedrichshafen werden<br />
derzeit u.a. Marine-Hochleistungsmotoren der Baureihe<br />
2000 Common-Rail abgestimmt. Ziel des Gesamtprojektes<br />
ist, diese Motoren gegenüber ihren Vorgängern in<br />
der Leistung zu steigern <strong>und</strong> hinsichtlich ihres<br />
Transientverhaltens deutlich zu verbessern. Dies betrifft<br />
Motoren mit 8, 10, 12 <strong>und</strong> 16 Zylindern <strong>und</strong> einer Zylinderleistung<br />
von bis zu 121 kW. Nachdem in der Anfangsphase<br />
des Projektes entsprechende Auflade- <strong>und</strong><br />
Verbrennungskonzepte erarbeitet, bewertet <strong>und</strong> an einem<br />
Einzylindermotor in der Vorentwicklung untersucht<br />
worden sind, besteht das Ziel der Serienentwicklung nun<br />
darin, diese Potenziale am Vollmotor umzusetzen. Dazu<br />
sind einerseits Versuche zur optimalen Auswahl der vorgeschlagenen<br />
Bauteile (z.B. Aufladegruppe) durchzuführen,<br />
als auch alle zur Verfügung stehenden Möglichkeiten<br />
bei der Bedatung der Motorkennfelder <strong>und</strong> der Regler<br />
auszunutzen. Im Anschluss an die Abstimmung müssen<br />
die zur Zertifizierung benötigten Daten am Prüfstand<br />
gemessen <strong>und</strong> entsprechend zur Einreichung bei der<br />
EPA aufbereitet werden. Die Aufgabenstellung umfasst<br />
im Detail (Vollmotor: 8V 2000 CR): Theoretische Aufarbeitung<br />
der hinsichtlich <strong>Leistungs</strong>steigerung /<br />
Transientverhalten / Emissionsgrenzwerte notwendigen<br />
Weiterentwicklung der Motorenbaureihe, Vorbereitung<br />
<strong>und</strong> Betreuung der Vollmotorversuche, Erprobung der<br />
unterschiedlichen Aufladungsvarianten am Vollmotor,<br />
Ermittlung der optimalen Schaltpunkte der Abgasturbolader<br />
<strong>und</strong> Schaltung der Wastegate Ventile, Auswertung/Analyse<br />
<strong>und</strong> Dokumentation der Messergebnisse,<br />
Abstimmung auf Emissionsgrenzen der US Gesetzgebung<br />
EPA Tier 2 (wenn zeitlich im Rahmen), Vorbereitung<br />
der entsprechenden Daten zur Einreichung bei der<br />
EPA (wenn zeitlich im Rahmen). Die Arbeit wird fachlich<br />
durch die Firma MTU-Friedrichshafen GmbH - Abt. TKV,<br />
http://www.mtu-online.com/ - unterstützt.<br />
[104] Floßbach, Anja: Optimisation of an F1 Gearbox Oil<br />
System (D, 2008): Formel-1-Fahrzeuge sind bei Kurvenfahrten<br />
großen Beschleunigungskräften (bis 5g) ausgesetzt.<br />
Dies hat auch Rückwirkungen auf die Betriebsstoffsysteme.<br />
So kann es im Getriebeölkreislauf zu einer<br />
starken Absenkung des Öldruckes kommen, weil kein<br />
ausreichender Pumpenzufluss gewährleistet ist. Der Getriebeölkreislauf<br />
ist daher so zu modifizieren, dass derartige<br />
<strong>Dr</strong>uckschwankungen <strong>und</strong> Betriebszustände sicher<br />
vermieden werden. Es ist das modifizierte System zu<br />
beschreiben sowie eine Pumpe zu entwickeln, die auf<br />
diesen Kreislauf abgestimmt ist. Die Arbeit wird fachlich<br />
durch die Firma Williams F1 www.williamsf1.com <strong>und</strong> ist<br />
vertraulich zu behandeln.<br />
[105] Stenzel, Jonas: Vergleich <strong>und</strong> Modifikation von<br />
Methoden zur Turbulenzberechnung an Windenergieanlagen<br />
unter Berücksichtigung der Nachlaufströmung<br />
<strong>und</strong> der Umgebungsturbulenz (D, 2008):<br />
Die Berechnung der Turbulenzbelastung wird in Form<br />
von Gutachten zertifizierter Stellen ausgeführt. Die Berechnungsmethode<br />
für die einzelne WEA hängt von dem<br />
Stand der Normung für die durchgeführte Gesamtzertifizierung<br />
ab. Die „Richtlinie für Windenergieanlagen; Ein-
<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>.-<strong>Ing</strong>. Holger Watter Flensburg University of Applied Sciences<br />
wirkungen <strong>und</strong> Standsicherheitsnachweise für Turm <strong>und</strong><br />
Gründung“ vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt)<br />
aus dem Jahr 1995 hat erstmalig Grenzwerte (Design<br />
Values) <strong>und</strong> ein Verfahren vorgeschlagen, um die effektiven<br />
Turbulenzen zu bewerten. In einer Neuauflage im<br />
Jahr 2004 wird eine Berechnungsmethode vorgestellt,<br />
<strong>und</strong> weiter auf die DIN 61400-1 (Edition 2) „Sicherheitsanforderungen<br />
für Windenergieanlagen“ aus dem Jahr<br />
1999 verwiesen. Die derzeitigen Turbulenzberechnungen<br />
werden überwiegend nach DIBt 2004 in Verbindung<br />
mit DIN 61400 Edition 2 durchgeführt, da die meisten<br />
Anlagen nach diesen Normen zertifiziert worden sind.<br />
Mit der neusten Normung DIN 61400-1 (Edition 3) aus<br />
dem Jahr 2006 wird ein erweitertes Verfahren zur Turbulenzberechnung<br />
vorgestellt, welches bisher allerdings<br />
noch keine Anwendung gef<strong>und</strong>en hat. Ziel der Diplomarbeit<br />
ist es, turbulenzberechnungen mit den verschiedenen<br />
Methoden für einen Standort durchzuführen <strong>und</strong><br />
in ihrer Eignung zu bewerten. Da die bisherigen Berechnungsmethoden<br />
sehr vereinfacht sind, werden darauf<br />
aufbauend Wege zur Optimierung entwickelt. Dabei<br />
werden spezifische Werte für die WEA <strong>und</strong> die Windbedingungen,<br />
sowie empirisch ermittelte Turbulenzmodelle<br />
berücksichtigt. Des Weiteren werden Verfahren zur Bestimmung<br />
der Umgebungsturbulenz vorgestellt <strong>und</strong> ausgearbeitet,<br />
die im Anschluss mit dem CFD- Programm<br />
Fluent <strong>und</strong> den am Messmast ermittelten Werten verglichen<br />
werden. Die Arbeit wird fachlich durch den TÜV<br />
NORD unterstützt; www.tuev-nord.de.<br />
SS 2009<br />
[106] Freytag, Jörn; Thom, Kai: Erstellung eines<br />
STIRLING-Handmotors <strong>und</strong> ingenieurgerechte Analyse<br />
(S, 2009): Der STIRLING-Motor wird in der Diskussion<br />
um die Potentiale der Erneuerbaren Energien immer<br />
wieder neu diskutiert (Biomasse, Sonnenkraftwerke<br />
u.a.). Für den Lehrbetrieb ist daher ein STIRLING-<br />
Modell zu erstellen <strong>und</strong> ingenieurgerecht zu bewerten.<br />
Durch das Labor für Hydraulik <strong>und</strong> Pneumatik wird die<br />
Bauanleitung bereitgestellt 1 <strong>und</strong> der praktische Aufbau<br />
von zwei Motoren unterstützt. Der Motor ist nach den<br />
vorliegenden Plänen aufzubauen <strong>und</strong> in Betrieb zu nehmen.<br />
Zusätzlich ist eine angemessene, ingenieurgerechte<br />
Analyse zu erstellen <strong>und</strong> zu dokumentieren (Thermodynamik,<br />
Kinematik, Optimierungspotentiale <strong>und</strong> Verbesserungsvorschläge).<br />
[107] Dierks, Joachim: Konzepterstellung für Fahrwerk<br />
<strong>und</strong> Antrieb eines 25t-Schleppers (D, 2009): In verschiedenen<br />
Logistikbereichen werden elektrisch betriebene<br />
Schlepper als Zugfahrzeuge für mehrgliedrige Anhängerzüge<br />
verwendet. In der schweren Klasse bis 25t<br />
Anhängelast ist neben vereinzelten Sonderbauten vornehmlich<br />
ein Anbieter am Markt. Die Firma Jungheinrich<br />
AG plant, mit einem Schlepper in diesem Marktsegment<br />
teilzuhaben. Für die Entwicklung ist es dabei von entscheidender<br />
Bedeutung, einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen.<br />
Hierzu ist es notwendig, die K<strong>und</strong>enanforderungen<br />
zu analysieren <strong>und</strong> mit den Realisierungsmöglichkeiten<br />
abzugleichen. In dieser Diplomarbeit, die sich<br />
vornehmlich auf die Auswahl passender Komponenten<br />
<strong>und</strong> deren sinnvoller Anordnung im Sinne eines Fahrzeugkonzepts<br />
bezieht, sollen entsprechende Konzeptvorschläge<br />
für einen 25t-Schlepper entwickelt <strong>und</strong> bewertet<br />
werden. Hierzu sind in der Hauptsache folgende<br />
Arbeitspunkte zu erledigen: (1) Zusammenstellung der<br />
wesentlichen K<strong>und</strong>enanforderungen (2) Konzept eines<br />
25-t Schleppers, also Anordnung der wesentlichen Bauelemente<br />
(Achsen, Batterie, Fahrerkabine) <strong>und</strong> Abhängigkeit<br />
von den Anforderungen der K<strong>und</strong>en. (3) Auswahl<br />
passender Komponenten mit Spezifikation, Bewertungs-<br />
1 Viebach, Dieter: Der Stirlingmotor einfach erklärt <strong>und</strong> leicht<br />
gebaut, Ökobuch Verlag, Staufen bei Freiburg, 1998 (7. Aufl.<br />
2008).<br />
52<br />
kriterien (technisch / kommerziell), Nachweise (Berechnung,<br />
Tests, QFD) für folgende Hauptkomponenten:<br />
Bremsen, Achsen, Lenkung (Systemdesign, Hydraulik<br />
oder andere Hilfskraft), Kabine (Lagerung, Entkoppelung,<br />
Ergonomie), Fahrwerkskonzept: notwendige Komponenten,<br />
Dimensionierung, Abstimmung, Simulation,<br />
Optimierung auf ein zu definierendes Ziel der Fahrwerksabstimmung,<br />
Nachweise (i.S. von Planung),<br />
Bremssystem: Systemdesign, Dimensionierung, Nachweise<br />
(Testplanung). (4) Elemente <strong>und</strong> Möglichkeiten<br />
einer Baukastensystematik für kleinere <strong>und</strong> höhere Tonnagen<br />
(z.B. 10t/30t). Die Verwendung von Serienkomponenten,<br />
wenn möglich, aus dem Jungheinrich Konzern<br />
bieten Vorteile in Kosten <strong>und</strong> Service. Relevante Normen<br />
sind bei der Konzepterstellung zu berücksichtigen.<br />
Die Arbeit wird in Zusammenarbeit mit der Jungheinrich<br />
AG (www.jungheinrich.de), Lüneburg durchgeführt.<br />
[108] Klein, Ulrich: Vergleich, Modifikation <strong>und</strong> Bewertung<br />
von Spülluftvorlagemotoren (D, 2009): Zur Verringerung<br />
der Abgasemissionen bei handgehaltenen Motorgeräten<br />
werden derzeit branchenweit Motoren mit Spülluftvorlage<br />
eingesetzt. Hierbei gibt es derzeit zwei Bauformen,<br />
reedvalvegesteuerte <strong>und</strong> kolbengesteuerte Systeme.<br />
Während die konventionellen Motoren hinsichtlich<br />
ihrer reproduzierbaren Einstellbarkeit der Abgasemissionen,<br />
ihrem Verhalten unter Serienproduktionsgesichtspunkten<br />
<strong>und</strong> ihrem Langzeitverhalten hinlänglich untersucht<br />
wurden, ist das Verhalten der Spülluftvorlagemotoren<br />
dahingehend weniger bekannt. Auf Basis von vorhandenen<br />
Spülluftvorlagemotoren ist zu untersuchen,<br />
inwieweit sich die beiden Bauformen beim Betrieb unter<br />
durch die Serienproduktion abgedeckten verschiedenen<br />
Betriebsweisen <strong>und</strong> Einstellgrenzen verhalten <strong>und</strong> unterscheiden.<br />
Hierbei sind folgende Arbeiten durchzuführen:<br />
(1) Markt- <strong>und</strong> Technikrecherche verfügbarer Spülluftvorlagemotoren<br />
für handgehaltene Motorgeräte (Katalog-,<br />
Datenbank- <strong>und</strong> Internetrecherche, Patentrecherche);<br />
(2) Auswahl der zu untersuchenden Modelle einschließlich<br />
des Dolmar-Prototyps; (3) Analyse, Test <strong>und</strong><br />
Bewertung der vorhandenen Systeme im Originalzustand<br />
<strong>und</strong> unter Umgehung des Spülluftvorlagesystems;<br />
(4) Betrieb <strong>und</strong> Vergleich der Systeme unter serienproduktionstypischen<br />
Grenzfällen, Ermittlung der Motorparameter<br />
<strong>und</strong> Darstellung der Unterschiede zwischen den<br />
Systemen; (5) Ermittlung von Verbesserungsmöglichkeiten,<br />
Entwurf <strong>und</strong> Konstruktion der Modifikationen, Test<br />
<strong>und</strong> Bewertung; (6) Dokumentation aller durchgeführten<br />
Arbeiten (Fotos, Meßdaten, Berechnungen, Diagramme);<br />
(7) Analyse <strong>und</strong> Bewertung der Ergebnisse. Die<br />
Arbeit wird fachlich von der Firma DOLMAR unterstützt.<br />
[109] Matic, Oliver: Untersuchung <strong>und</strong> Optimierung einer<br />
Kraftstoffaufbereitungsanlage (D 2008): Kraftstoffe<br />
bedürfen in der Schiffahrt einer Vorbehandlung, da diese<br />
mit Sedimenten, Bakterien <strong>und</strong> vor allem Wasser belastet<br />
sind. Um eine hohe Qualität des Kraftstoffes zu gewährleisten<br />
<strong>und</strong> somit eventuelle Motorschäden <strong>und</strong><br />
Verschlammung zu vermeiden, durchläuft der Kraftstoff<br />
zunächst eine so genannte Kraftstoffpflegeanlage. Diese<br />
Filtration- <strong>und</strong> Separationsanlagen können, in Abhängigkeit<br />
von dem verwendeten Verfahren, sehr kostspielig<br />
sein. Daher ist es wichtig eine Erkenntnis über die Effektivität<br />
einer Anlage zu erlangen. In Zusammenarbeit mit<br />
dem Unternehmen MAHLE NFV GmbH (www.nfvgmbh.de)<br />
soll, im Rahmen einer Diplomarbeit, die bestehende<br />
Kraftstoffpflegeanlage „FTS 1200“ optimiert<br />
<strong>und</strong> beurteilt werden. Hierbei soll explizit eine Teflon-<br />
Membran betrachtet werden, welche in Verbindung mit<br />
einem Coaleszer die 2. Separationsstufe darstellt. Die<br />
Aufgabe besteht darin, die Integration einer Teflon-<br />
Membran konstruktiv zu verbessern <strong>und</strong> daraufhin die<br />
Effektivität dieser Membran empirisch zu ermitteln. Hierzu<br />
wird ein Versuchsstand konzipiert <strong>und</strong> die Anlage<br />
mehreren Separationsversuchen unterzogen. Der Restgehalt,<br />
des im Kraftstoff befindlichen Wassers, wird an-
<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>.-<strong>Ing</strong>. Holger Watter Flensburg University of Applied Sciences<br />
hand der Karl-Fischer-Titration ermittelt. Die Versuchsdaten<br />
<strong>und</strong> Ergebnisse werden dokumentiert <strong>und</strong> ausgewertet.<br />
Abschließend wird beurteilt, ob sich der Einsatz<br />
einer solchen Membran funktional rentiert.<br />
[110] Gutschmidt, Benjamin; Rehder, Jan; Schrooten,<br />
Marc: Versuchsmodifikation Servo- <strong>und</strong><br />
Proportionalventil (S, 2009): Der Laborversuch „Ventilkennlinie<br />
Servo- <strong>und</strong> Proportionalventil“ ist neu zu konzipieren.<br />
Die Arbeit soll als Projekt 2 durchgeführt werden<br />
(§26 PO 2000). Projekte haben fächerübergreifende<br />
Aufgabenstellungen, die die Studierenden in Teams unter<br />
Anwendung von fachlichen <strong>und</strong> organisatorischen<br />
Problemlösungsmethoden anwendungsorientiert bearbeiten<br />
sollen. Im Verlaufe des Projektes sollen die Studierenden<br />
Aufgabenstellungen gemeinsam <strong>und</strong> praxisnah<br />
lösen lernen. Projekte werden während eines Semesters<br />
studienbegleitend durchgeführt.Im gemeinsamen<br />
Teil ist festzustellen, wie die Zielvorgaben des Laborbetreibers<br />
für den Lehrbetrieb optimal aufbereitet<br />
werden können. Der Lösungsvorschlag soll systematisch<br />
erarbeiten, dargestellt <strong>und</strong> bewertet werden. Das Ergebnis<br />
dieser Bewertung wird im konstruktiven Teil der Arbeit<br />
dokumentiert. Die Aufgabenstellung ist so auf 3 Studierende<br />
zu verteilen, dass drei in sich geschlossene,<br />
(fast) unabhängige Aufgabenstellungen entstehen. Dadurch<br />
soll eine unabhängige Bearbeitung der Teilaufgaben<br />
möglich sein, sodass einzelne Dokumentationsteile<br />
vorgelegt werden können <strong>und</strong> die Einzelleistungen erkennbar<br />
bleiben: (1) Der Versuch soll so aufbereitet<br />
werden, dass die Steuerung <strong>und</strong> Messwerterfassung mit<br />
einem PC erfolgen kann (LabView). Die Messwerterfassung<br />
<strong>und</strong> Datenübergabe muss abgestimmt sein. (2) Der<br />
Versuchsstand ist hydraulisch so zu durchdenken <strong>und</strong><br />
aufzubauen, dass die o.g. Anforderungen erfüllt werden<br />
können. Es sind Vorschläge für die Messwertanordnung<br />
<strong>und</strong> die Messbereiche zu definieren. (3) Der Versuchsstand<br />
ist mechanisch/konstruktiv so zu entwerfen, dass<br />
die o.g. Anforderungen im Labor HuP erfolgen kann. Es<br />
ist eine Kostenkalkulation für die noch zu beschaffenden<br />
Messgeräte <strong>und</strong> Anlagenteile zu erstellen, sowie eine<br />
„Laboranweisung“ für die studentische Versuche zu erstellen.<br />
[111] Trömel, Olaf: Untersuchung dynamischer Belastungen<br />
am Blattverstellsystem einer Windenergieanlage,<br />
sowie Entwicklung einer Modellierungssystematik<br />
(D, 2009): Die Komponenten einer Windenergieanlage<br />
werden während ihrer 20 jährigen Lebensdauer dynamischen<br />
Wechselbeanspruchungen <strong>und</strong> Extrembelastungen<br />
ausgesetzt. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit<br />
soll die Auslegung des Blattverstellgetriebes<br />
(Pitchgetriebe) unter Berücksichtigung der von REpower<br />
getroffenen Lastannahmen dargestellt <strong>und</strong> bewertet<br />
werden. Hierzu wird die Messkampagne an einer<br />
REpower MD70 hinsichtlich auslegungsrelevanter Belastungen<br />
<strong>und</strong> kinematischer Kenngrößen untersucht. Die<br />
Messresultate sind mit Simulationsergebnissen der Lastensimulationssoftware<br />
Flex5 <strong>und</strong> den Auslegungslasten<br />
abzugleichen, um die Verifizierung der Auslegung zu erhalten.<br />
Darüber hinaus soll die Messstrategie überprüft<br />
<strong>und</strong> zur Validierung von zukünftigen Blattverstellsystemen<br />
entwickelt werden. Anhand der gewonnenen Erkenntnisse<br />
der Messdatenauswertung soll eine Modellierungssystematik<br />
abgeleitet werden. Auf Basis dieser<br />
Systematik soll mit der Software Samcef ein Mehrkörpersystem<br />
des Blattverstellgetriebes erstellt <strong>und</strong> simuliert<br />
werden.Die Arbeit wird fachlich durch die Firma<br />
REpower Systems AG (www.repower.de) unterstützt.<br />
[112] Eilers, Jens: Wirkungsgrad- <strong>und</strong> Verlustuntersuchung<br />
einer digitalen Radialkolbenpumpe (D, 2009):<br />
Die Elektrifizierung mobiler Arbeitsmaschinen erlaubt<br />
den Einsatz von neuartigen Steuerungsprinzipien für<br />
hydrostatische Verdrängereinheiten. Hierzu soll im<br />
Rahmen der Arbeit eine digitale Radialkolbenpumpe<br />
(DDP) betrachtet werden. Bei dieser Pumpe werden die<br />
53<br />
Verdrängerräume über schnellschaltende Ventile individuell<br />
mit den <strong>Dr</strong>uckleitungen verb<strong>und</strong>en. Hierdurch kann<br />
eine Verbesserung im Wirkungsgrad verglichen mit<br />
Standard-Axialkolbeneinheiten erreicht werden, da die<br />
Verdrängerräume jeweils voll ausgenutzt werden können.<br />
Ziel der Arbeit ist die Entwicklung eines Konzeptes<br />
zur experimentellen Wirkungsgrad- <strong>und</strong> Verlustuntersuchung<br />
der DDP. Hierbei soll das Verlustverhalten in Abhängigkeit<br />
der Steuerungsstrategie analysiert werden<br />
sowie das Triebwerk. Folgende Punkte sind auszuführen:<br />
Konzeptentwicklung für den gesamten Betriebsbereich<br />
unter Berücksichtigung der Teilwirkungsgrade sowie<br />
dem Vergleich zu heutigen Einheiten, Umsetzung<br />
des Konzeptes auf dem Prüfstand, Auswertung von Ergebnissen,<br />
Modellbildung der DDP Verluste für weitere<br />
Berechnungen. Die Arbeit wird fachlich von der Firma<br />
SAUER DANFOSS (http://www.sauer-danfoss.de) unterstützt.<br />
WS 2009/2010<br />
[113] Vogt, Dennis: Zwischenkammerabdichtung Flossenstabilisator<br />
(D, 2009): Aufgabe: Konstruktion einer Flossenschaftabdichtung<br />
mit vollständiger Trennung des Ölkreislaufes<br />
vom umgebenden Seewasser mit dem Ziel der<br />
dauerhaften Wasserreinhaltung. Hintergr<strong>und</strong>: Flossenstabilisatoren<br />
werden für Seeschiffe zur Dämpfung der<br />
seegangsbedingten Rollbewegung eingesetzt. Die Anlagen<br />
sind hydraulisch angetrieben <strong>und</strong> im Unterwasserbereich<br />
der Schiffe eingebaut. Der permanente Kontakt mit<br />
Seewasser erfordert eine entsprechende Abdichtung gegen<br />
dieses Medium. Anforderungen: Zur Sicherstellung<br />
der dauerhaften Abdichtung gegen Seewasser <strong>und</strong> zur<br />
vollständigen <strong>und</strong> sicheren Verhinderung von Ölaustritt –<br />
gerade unter dem Aspekt der allgemein gestiegenen Umweltanforderungen<br />
– soll die derzeitige Abdichtungskonstruktion<br />
modifiziert werden. Durch ein geeignetes Medium<br />
in einer Zwischenkammer soll die vollständige Trennung<br />
der Medien Hydrauliköl <strong>und</strong> Seewasser erreicht werden.<br />
Die permanente Zustandsüberwachung soll durch<br />
Beobachtung des Zwischenmediums erreicht werden.<br />
Konstruktiv sind insbesondere die Definition der Schnittstellen<br />
zwischen den vorgesehenen Medien, die Integration<br />
der Zwischenkammer sowie die Zuführung <strong>und</strong> Überwachung<br />
des Zwischenmediums zu bearbeiten. Die<br />
gr<strong>und</strong>sätzliche Gestaltung des Stabilisators <strong>und</strong> seiner<br />
Hauptbauteile soll nach Möglichkeit erhalten bleiben, sodass<br />
auch Nachrüstungen denkbar sind. Durchführung:<br />
Die Bearbeitung erfolgt als konstruktive Diplomarbeit. Ein<br />
PC-Arbeitsplatz mit CADSystem Pro/Engineer im Bereich<br />
der Konstruktion Stabilisatoren <strong>und</strong> Ruderanlagen steht<br />
zur Verfügung. Zur methodischen Vorgehensweise ist zunächst<br />
eine Lösungsmatrix zu erarbeiten. Die Bewertung<br />
<strong>und</strong> Gewichtung der einzelnen Lösungsvorschläge soll in<br />
enger Abstimmung mit der Konstruktion Flossenstabilisatoren<br />
erfolgen, um die umfassende Berücksichtigung praxisrelevanter<br />
Randbedingungen sicherzustellen. Unterlagen:<br />
Die Diplomarbeit soll in schriftlicher Form dokumentiert<br />
werden <strong>und</strong> neben der Lösungsmatrix die gewählte<br />
Lösung durch einen konstruktiven Entwurf mit zugehörigen<br />
Recherchen, Analysen, Berechnungen <strong>und</strong> Beschreibungen<br />
darstellen. Die Arbeit wird fachlich von der Firma<br />
BLOHM + VOSS INDUSTRIES GmbH (www.bvindustrie.de)<br />
unterstützt.<br />
[114] Balecke, Tobias: Umsetzung des Alterungsverfahrens<br />
zur Überprüfung der Dauerhaltbarkeit von Katalysatoren<br />
für Ottomotoren auf dem Motorprüfstand<br />
nach der EURO 5/6 Abgasgesetzgebung (D, 2009): In<br />
der Arbeit geht es um ein spezielles Alterungsverfahren<br />
für Katalysatoren. Dabei soll ein Katalysator auf dem<br />
Motorprüfstand hergestellt werden, der eine Laufleistung<br />
von 160000km im Fahrzeug entspricht. Zweck solcher<br />
Katalysatoren ist die Überprüfung der Dauerhaltbarkeit.<br />
D.h. diese Kat`s müssen mit der Laufleistung den NEFZ<br />
- Abgastest mit festgelegten Verschlechterungsfaktoren<br />
zu den Grenzwerten immer noch bestehen. Da zur Her-
<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>.-<strong>Ing</strong>. Holger Watter Flensburg University of Applied Sciences<br />
stellung solcher Kat`s mehrere Verfahren angewendet<br />
werden, ist 2008 ein Verfahren von der Europäischen<br />
Union in einem Amtsblatt verfasst. Dieses Verfahren<br />
kombiniert die Versuchsdaten vom Fahrzeug mit denen<br />
vom Prüfstand um die entsprechende Alterungszeit zu<br />
errechnen. Dabei wird einmal ein Standardstraßenzyklus<br />
mit dem Fahrzeug auf einem Rollenprüfstand <strong>und</strong> ein<br />
Standardprüfstandszyklus auf dem Motorprüfstand abgefahren.<br />
Die Temperaturen in dem Katalysator werden<br />
dabei jeweils aufgezeichnet <strong>und</strong> später in der Gleichung<br />
zur Bestimmung der Alterungszeit(AZP) eingesetzt. Zu<br />
Beginn der Alterung werden noch zwei Abgastest`s als<br />
Eingangswerte durchgeführt. Während <strong>und</strong> nach der Alterung<br />
finden weitere Abgastests zur Beurteilung des<br />
Katalterns statt. Letztendlich wird der gealterte Katalysator<br />
mit einem im Fahrzeug real gealteren 160000km Katalysator<br />
verglichen <strong>und</strong> bewertet. Da dieses Alterungsverfahren<br />
für die EURO 5 <strong>und</strong> EURO 6 Abgasgesetzgebung<br />
von der EU festgelegt <strong>und</strong> somit anerkannt ist,<br />
stellt es für die heutige Fahrzeugentwicklung ein gültiges<br />
Alterungsverfahren für Katalysatoren dar.Ziel der Arbeit<br />
ist es dieses Verfahren mit einer aktuellen Motorbaureihe<br />
durchzuführen <strong>und</strong> gegenüber anderen Verfahren zu<br />
bewerten.Die Arbeit wird fachlich von der Firma IAV<br />
GmbH (www.iav.de) unterstützt.<br />
[115] Küchler, Marco: Entwicklung einer elektromechanischen<br />
Rudermaschine (D, 2009): In einer Diplomarbeit<br />
aus dem Jahr 2008 wurde deutlich, dass eine<br />
Ausführung einer elektro-mechanischen Rudermaschine<br />
durchaus sinnvoll erscheint. Es handelt sich hierbei<br />
um konventionelle elektro-hydraulische Rudermaschinen,<br />
bei denen über elektrische Motoren Hydraulikpumpen<br />
angetrieben werden, um die nachgeschalteten<br />
hydraulischen Aktuatoren zu betreiben. (1) Auf der<br />
Gr<strong>und</strong>lage der o.a. Diplomarbeit soll eine elektromechanische<br />
Rudermaschine entwickelt werden. (2)<br />
Die neue Rudermaschine soll als Entwurf auf Basis der<br />
vorhandenen Vorschriften der Klassifikationsgesellschaften<br />
entwickelt werden. (3) Der Schwerpunkt der<br />
Untersuchungen <strong>und</strong> der konstruktiven Auslegungen<br />
soll im Bereich der Kraftübertragung von der Antriebseinheit<br />
zum Ruderschaft liegen, dabei sollen auch erste<br />
Abschätzungen über die möglichen Varianten einer<br />
Typenreihe erarbeitet werden. (4) Als Konstruktionswerkzeuge<br />
stehen SolidWorks <strong>und</strong> MathCAD zur Verfügung.<br />
Die Arbeit wird fachlich von der Firma<br />
HATLAPA (www.hatlapa.de) unterstützt. HATLAPA ist<br />
einer der führenden Rudermaschinenhersteller auf der<br />
Welt. Das Rudermaschinenprogramm umfasst die<br />
Tauchkolben-, die <strong>Dr</strong>ehflügel- <strong>und</strong> die Differentialzylinder-Rudermaschinen<br />
in unterschiedlichen Größen, unterschiedlichen<br />
Ausführungen, für unterschiedliche<br />
Schiffstypen.<br />
SS 2010<br />
[116] Oliver.Scheidt: Machbarkeitsstudie für ein Gegenwindfahrrad<br />
(S, 2010): Ein Gegenwindfahrrad nutzt den<br />
Fahrtwind für den Vortrieb aus. Die generelle Machbarkeit<br />
wurde bereits mit verschiedenen Studien bewiesen<br />
<strong>und</strong> umgesetzt. Regelmäßig findet dazu die „Aeolus<br />
Race“ in Den Helder in den Niederlanden statt beim dem<br />
Hochschulteams aus Europa gegeneiander antreten. Im<br />
Rahmen der vorliegenden Arbeit soll dazu ein Benchmark<br />
der bisher vorgestellten Konzepte recherchiert<br />
werden. Darauf aufbauend sind zunächst die Energiepotentiale<br />
zu bilanzieren <strong>und</strong> zu bewerten sowie konstruktive<br />
Konzepte zu entwickeln. Es ist das optimale Konzept<br />
auszuwählen <strong>und</strong> im Rahmen einer Vorstudie zu<br />
präzisieren.<br />
[117] Gutschmidt, Benjamin: Entwicklung eines Konzeptes<br />
für die analytische Berechnung von Antriebssträngen<br />
<strong>und</strong> Überprüfung von vorliegenden Lösungsansätzen<br />
zu dessen vollständiger Umsetzung<br />
(D, 2010): Die Firma ZAE (www.zae.de) fertigt Schneckengetriebe,<br />
Kegelradgetriebe, Getriebemotoren,<br />
54<br />
Stirnräder, Schneckenradsätze <strong>und</strong> Sondergetriebe.<br />
Große Teile der Getriebeberechnung sollen in speziellen<br />
Tools bearbeitet werden. Dazu sollen folgende Arbeitspakete<br />
bearbeitet werden: Beschreibung des<br />
Ist-Zustandes bei ZAE <strong>und</strong> Stand der Entwicklung,<br />
Analyse der Teilaufgaben zur Auslegung <strong>und</strong> Nachrechnung<br />
von Antriebssträngen unter Berücksichtigung<br />
vorhandener Normen, Wege zur allgemeingültigen<br />
Definition eines Antriebsstranges zum Zweck der Berechnung,<br />
Beschreibung der Berechnungsziele <strong>und</strong><br />
einer zweckmäßigen Ergebnisdarstellung, Erstellung<br />
eines Pflichtenheftes für die Berechnungssoftware,<br />
Test <strong>und</strong> Beurteilung bereits verfügbarer Softwarelösungen<br />
(KISSsoft, MDesign, Workbench), Feststellung<br />
der Defizite gegenüber den Vorgaben aus dem Pflichtenheft,<br />
Abstimmungen mit dem Softwarehersteller zur<br />
Erreichung der Ziele, Erstellung eines Zeit- <strong>und</strong> Kostenplanes.<br />
[118] Waetjen, Markus; Schindler, Fabian: Überprüfung<br />
eines Verfahrens zur Überwachung von Wärmetauschern<br />
(S, 2009): Im Rahmen der Entwicklung eines<br />
Verfahrens zur betrieblichen Überwachung des<br />
Wärmeübertragungsverhaltens von Wärmetauschern<br />
soll ein Simulationsprogramm erstellt werden, mit dem<br />
ein vorliegendes Berechnungsmodel überprüft werden<br />
kann. Als Modellierungssprachen sind vorzugasweise<br />
Modellika, MathLab Simulink, Delphi oder C++ zu verwenden.<br />
Als Datenbasis soll auf Versuchsergebnisse<br />
zurückgegriffen werden, die am Ladeluftkühler eines<br />
Deutz Schiffsmotors gewonnen wurden. Folgende<br />
Teilaufgaben sollten im Programm berücksichtigt werden:<br />
(1) Überprüfung des Berechnungsmodells unter<br />
Verwendung der Versuchsergebnisse (2) Skizzierung<br />
<strong>und</strong> Programmierung eines Überwachungssystems für<br />
Ladeluftkühler mit: (a) die Bewertung des k-Wertes (b)<br />
Berücksichtigung der Kondensation von Wasser soweit<br />
möglich (c) Konzeption einer Konfigurationsschnittstelle<br />
zur Verarbeitung von Messwerten (d) Benutzerschnittstelle.<br />
[119] Weber, Melanie: Entwicklung eines pneumatischen<br />
Wagenhebers für schwere Nutzfahrzeuge (B, 2009):<br />
Für schwere Nutzfahrzeuge (>18 t Gesamtgewicht) ist<br />
ein neuartiger pneumatischer Wagenheber zu entwickeln.<br />
Dazu ist zunächst der Stand des Wissens <strong>und</strong><br />
der Technik mit Hilfe einer Patentrecherche zu ermitteln.<br />
Anschließend ist auf Gr<strong>und</strong>lage einer genauen<br />
Spezifikation (Gewicht, Energieversorgung, Kraftangriffspunkte,<br />
<strong>Leistungs</strong>daten usw.) mit Hilfe von Kreativmethoden<br />
ein optimiertes Konzept zu entwickeln <strong>und</strong><br />
ein konstruktiver Entwurf in einem CAD-Modell zu erstellen.<br />
Die Prototypenentwicklung ist je nach Projektfortschritt<br />
vorzubereiten. Die Arbeit wird fachlich durch<br />
die Firma DAIMLER MERCEDES BENZ WERK Hamburg<br />
(www.daimler.com) <strong>und</strong> Firma Vibracoustic Hamburg<br />
(www.vibracoustic.de) unterstützt.<br />
[120] Rottmann, Johannes: Untersuchung von dynamischen<br />
Lastwechselvorgängen an einem Brennwertkessel<br />
für ein Mehrfamilienhaus: Lastwechselvorgänge<br />
<strong>und</strong> Teillastbeanspruchungen führen zu erheblichen<br />
Verlusten bei der Wärmeerzeugung. Für ein<br />
gegebenes Mehrfamilienhaus sind diese Lastwechselvorgänge<br />
zu analyieren <strong>und</strong> in Modelica darzustellen.<br />
Modelica ist eine objektorientierte Beschreibungssprache<br />
für physikalische Modelle, sie ist 1997 im Programmiersprachenstandard<br />
1.0 erschienen. Ein in<br />
Modelica formuliertes, physikalisches Modell wird von<br />
einem Modelica-Translator in ein mathematisches Modell<br />
übersetzt <strong>und</strong> mittels eines Lösungsalgorithmus<br />
gelöst. Anhand der vorliegenden Messdaten des Hauses<br />
ist das regelungstechnische Konzeption sowie die<br />
feuerungstechnische Wärmeerzeugung im Zeitverhalten<br />
darzustellen <strong>und</strong> zu bewerten. Es ist eine Bewertung<br />
zur Einarbeitung <strong>und</strong> Umsetzung in Modelica abzugeben.<br />
Informationen zu Modelica finden sich unten:
<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>.-<strong>Ing</strong>. Holger Watter Flensburg University of Applied Sciences<br />
http://de.wikipedia.org/wiki/Modelica <strong>und</strong><br />
http://www.modelica.org<br />
[121] Ruschhaupt, Kai: Evaluation einer Kleinwindenergieanlage<br />
(D, 2010): Für eine installierte Kleinwindenergieanlage<br />
sind die Herstellerangaben zu analysieren<br />
<strong>und</strong> im Betrieb an diesem Standort zu evaluieren. Es<br />
sind Möglichkeiten für Optimierungsansätze aufzuzeigen.<br />
Schwerpunkte sind: 1. Die Analyse der Herstellerangaben<br />
der KWEA <strong>und</strong> der vorhandenen Ausstattung<br />
2. Die Erarbeitung einer Ausstattungs- <strong>und</strong> Anschlussempfehlung<br />
für die Wind- <strong>und</strong> Betriebsdatendiagnose.<br />
Die empfohlene Messausstattung wird durch den Anlagenbetreiber<br />
beschafft <strong>und</strong> bereitgestellt. 3. Die Auswertung<br />
der Wind- <strong>und</strong> Betriebsdaten <strong>und</strong> eine Ertragsprognose<br />
4. Empfehlung für mechanische <strong>und</strong> elektrische<br />
Optimierungsmöglichkeiten. Die Arbeit wird fachlich<br />
durch die Müllverbrennungsanlage Stellinger Moor unterstützt.<br />
[122] Schüler, Torsten: Entwicklung <strong>und</strong> Optimierung<br />
eines Nachführungssystems für eine<br />
Photovoltaikanlage (D, 2009): Es soll ein einachsiges<br />
Nachführsystem für eine Photovoltaikanlage entwickelt<br />
<strong>und</strong> optimiert werden. Die Entwicklung erfolgt in einem<br />
Projekt der Fa. LORENTZ GmbH & Co. KG. Bei diesem<br />
Nachführsystem soll eine neuartige Rahmenkonstruktion<br />
entworfen werden, welche im Hinblick auf die Anforderungen<br />
des K<strong>und</strong>en <strong>und</strong> der Wirtschaftlichkeit entwickelt<br />
<strong>und</strong> optimiert werden soll. Ziele der Entwicklung <strong>und</strong> Optimierung:<br />
Auslegung für eine Modulfläche von 15-30m²,<br />
gleichmäßige Auslastung der Bauteilprofile, einfache<br />
Fertigungsverfahren, niedrige Produktionskosten, Montagemöglichkeit<br />
aller gängigen PV-Modulgrößen, niedriges<br />
Gewicht, einfache Montage, kompakte Bauteile,<br />
Auswahl eines geeigneten Antriebkonzeptes, Erstellen<br />
einer Installationsanleitung. Zur Entwicklung werden folgende<br />
Arbeitsschritte durchgeführt: (1) Entwickeln <strong>und</strong><br />
Analysieren möglicher Lösungskonzepte (2) Auswählen<br />
einer geeigneten Lösung unter Berücksichtigung der Anforderungen<br />
(3) Auslegen der Bauteilkomponenten (4)<br />
Gestalten der Komponenten in CAD (5) Erstellen von<br />
Fertigungszeichnungen (5) Bau <strong>und</strong> Erprobung eines<br />
Prototypen. Die Arbeit wird fachlich von der Firma<br />
BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG - www.lorentz.de –<br />
unterstützt.<br />
[123] Lemke, David: Entwicklung <strong>und</strong> Optimierung eines<br />
Nachführungssystems für Photovoltaikmodule (D,<br />
2010): Im Rahmen diese Arbeit soll ein Nachführungssystem<br />
für Photovoltaik-Module entwickelt <strong>und</strong> optimiert<br />
werden. Ein Lösungskonzept wird unter Berücksichtigung<br />
der Anforderungsliste analysiert <strong>und</strong> erarbeitet,<br />
dabei sind wissenschaftliche Methoden zur Optimierungsstrategie<br />
anzuwenden <strong>und</strong> die Lösungsansätze<br />
zu bewerten. Die Fertigungs-, Transport- <strong>und</strong> Installationskosten<br />
sind dabei im Besonderen zu berücksichtigen.<br />
Abschließend sind die Bauteilkomponenten ausgelegt<br />
<strong>und</strong> zu berechnet sowie mit dem CAD-<br />
Programm SolidWorks zu gestaltet. Die Prototypenfertigung<br />
wird betreut <strong>und</strong> abschließend der Prototyp erprobt<br />
<strong>und</strong> gegebenenfalls optimiert. Die Arbeit wird<br />
fachlich durch die Firma Lorentz GmbH unterstützt<br />
(www.lorentz.de).<br />
[124] Düpjan, Matthias: Konzeptionierung <strong>und</strong> Auslegung<br />
eines High Flow Pneumatikprüfstandes für<br />
Fluggeräte (D, 2010): Ziel der Diplomarbeit ist eine<br />
Lastenhefterstellung, um die bestehende Produktpalette<br />
von Hawker Pacific Aerospace auf High Flow Pneumatik<br />
Geräte zu erweitern. Es soll ein neuer Teststand<br />
angeschafft werden mit dem gemäss den gesetzlichen<br />
Anforderungen <strong>und</strong> Bestimmungen getestet werden<br />
kann <strong>und</strong> der für zukünftige Produkte, neuer Flugzeugmuster,<br />
schnell <strong>und</strong> einfach modifizierbar ist. Spezifikation:<br />
Ermitteln eines geeigneten PN – Spektrum,<br />
Feststellen der Anforderungen, Buendeln von PN -<br />
Clustern die sich sinnvollerweise gruppiert aufbauen<br />
55<br />
lassen, Betriebsmittelinvest abschätzen, Konstruktionsvorschläge<br />
fuer Adaptionen unter Beruecksichtigung<br />
von aktuellen Normen <strong>und</strong> Richtlinien (<strong>Dr</strong>uckgeräterichtlinie,<br />
etc), Abwägung, welchen Umfang die Anlage<br />
haben soll. Sofern es rentabel ist sog. Heissgeräte<br />
zu ueberholen, ist die Infrastruktur (Engergie- <strong>und</strong> Luftversorgung)<br />
zu ueberpruefen <strong>und</strong> ein Invest abzuschätzen.<br />
Auswahl einer geeigneten Steuerung der Anlage.<br />
Hierbei sind Anforderungen mit Konzepten von<br />
Lufthansa Technik in Hamburg zu vergleichen, um als<br />
Ziel moeglichst eine Pruefeinrichtung in Anlehnung an<br />
eine bereits bestehende Anlage in Hamburg zu konzipieren.<br />
Dies garantiert die gleiche Capability, einfachere<br />
Adaptionen <strong>und</strong> analoges Training der Bediener.<br />
Konzeption der Anlage unter Beruecksichtigung von<br />
moeglichen Erweiterungsscenarien <strong>und</strong> Ergonomie.<br />
Realisierungsvorschlag <strong>und</strong> Auswahl geeigneter Hersteller<br />
unter Beruecksichtung von Erfahrungen <strong>und</strong><br />
Know How aus Hamburg zugeschnitten auf Hawker<br />
Pacific Aerospace. Abstimmen des Phase-In-<br />
Vorgangs, Erstellen von Trainingsplänen fuer Mechaniker.<br />
Die Arbeit wird fachlich von der Firma Hawker<br />
Pacific Aerospace (11240 Sherman Way Sun Valley,<br />
CA. 91352-4942 USA, www.hawker.com) unterstützt.<br />
WS 2010/2011<br />
[125] Berg, Sören: Clean North Sea Shipping (CNSS):<br />
Zusammenstellung <strong>und</strong> Beurteilung von gas- <strong>und</strong><br />
partikelförmigen Emission aus Schiffsdieselmotoren<br />
(M, 2010): Internationale Organisationen <strong>und</strong> Verwaltungen,<br />
einschließlich der Verwaltung der Freien <strong>und</strong><br />
Hansestadt Hamburg, sind sehr daran interessiert, die<br />
Luftverschmutzung von Schiffen zu verhindern, während<br />
diese ihre Häfen besuchen. Aus diesem Gr<strong>und</strong> wurde<br />
ein international agierendes „Clean North Sea Shipping“<br />
(CNSS) Projekt initiiert. Ziel dieses Großprojektes ist die<br />
Reduzierung der Luftverschmutzung <strong>und</strong> Treibhausgas-<br />
Emissionen von Schiffen. Aufgabe soll hierbei die Untersuchung<br />
von Technologien zur Emissionsminderung für<br />
den Betrieb von Schiffen sowie die Implementierung einer<br />
Infrastruktur für die Versorgung von effizienteren <strong>und</strong><br />
saubereren Kraftstoffen für Schiffe sein. Als ein Teilprojekt<br />
des CNSS sollen im Rahmen einer Masterarbeit die<br />
Abgas- <strong>und</strong> Partikelemissionen von Schiffsmotoren zusammengestellt<br />
<strong>und</strong> charakterisiert werden. Insbesondere<br />
soll hierbei der Einfluss von Be-triebsbedingungen<br />
<strong>und</strong> der Motor-Parameter sowie der Heizöl Qualität untersucht<br />
werden. Das Ziel dieser Arbeit ist eine detaillierte<br />
Literaturrecherche der Partikelemissionen in der Seeschifffahrt<br />
sowie eine Auflistung <strong>und</strong> Bewertung der jeweils<br />
verwendeten <strong>und</strong> verfügbaren messtechnischen<br />
Möglichkeiten. Insbesondere sollen in dieser Arbeit alternative<br />
Messtechniken für Partikelemissionen aufgezeigt<br />
werden, welche eine detaillierte Beurteilung von<br />
Partikelemissionen ermöglichen. Denn insbesondere innerhalb<br />
von Ballungszentren gewinnt die Beurteilung der<br />
Partikelgrößenverteilung an Wichtigkeit. Die Ergebnisse<br />
dieser Arbeit sollen die Basis für spätere Messkampagnen<br />
an Bord ausgewählter Kreuzfahrtschiffe im Hamburg<br />
Cruise Terminal bilden. Die so erzielten Ergebnisse können<br />
die Basis für "Emissionsfaktoren" für die weitere<br />
Beurteilung des Potentials alternativer Technologien im<br />
Vergleich mit der herkömmlichen Schiffsdieseln beim<br />
Betrieb mit Destillat oder schwerem Heizöl bilden. Die<br />
Arbeit wird fachlich vom GL unterstützt.<br />
[126] Hoops, Alexander: Entwicklung eines Hydraulikodometriemodell<br />
für eine Minimalhydraulik (B, 2011):<br />
Die Herausforderungen in der Entwicklung von zukünftiger<br />
Lagertechnik für industriell orientierte Länder stützen<br />
sich im Wesentlichen auf die Pfeiler der Erhöhung der<br />
Produktivität <strong>und</strong> der Steigerung der Arbeitssicherheit.<br />
Eine Möglichkeit den beiden häufig konträren Pfeilern in<br />
der Entwicklung gerecht zu werden, ist die Einführung<br />
von Automatisierungsstrecken. Der Fokus dieser Auto-
<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>.-<strong>Ing</strong>. Holger Watter Flensburg University of Applied Sciences<br />
matisierungsstrecken liegt in der Informationsaufbereitung<br />
<strong>und</strong> in der gezielten Manipulation. Im Rahmen der<br />
Bachelorthesis zur Entwicklung eines Hydraulikodometriemodells<br />
für Gegengewichtsstapler liegt der<br />
Fokus auf der Informationsaufbereitung. Die Bachelorthesis<br />
soll als Ausgangspunkt für eine teilautomatische<br />
Einlagerung von Waren in Regale dienen. Gleichzeitig<br />
soll sie das Systemverständnis in der Interaktion von unterschiedlichen<br />
Teilsystemen (Komponenten) fördern<br />
<strong>und</strong> perspektivische Konzeptuntersuchungen auf topologischer<br />
Ebene ermöglichen. Ausgangspunkt: Der Einlagerungsprozess<br />
von Waren in Regale bietet auf Gr<strong>und</strong><br />
seiner Komplexität viel Raum für Optimierungen, welche<br />
die Produktivität <strong>und</strong> die Arbeitssicherheit steigern können.<br />
Am Beispiel einer Einlagerung von Waren in Regalhöhen<br />
größer 5m kann deutlich gemacht werden,<br />
dass bei zunehmender Packungsdichte der Regale die<br />
Arbeitssicherheit oder die Produktivität - auch bei geübten<br />
Fahrern - leidet, da die Sichtverhältnisse auf Gr<strong>und</strong><br />
des großen Winkels sehr beschränkt sind. Ein geeignetes<br />
Fahrerassistenzsystem soll hier Abhilfe schaffen. In<br />
der Lagertechnik existieren bereits mobile Transportroboter<br />
wie der FMX autonom, die Waren in Regale bis zu<br />
8,5m vollautomatisch einlagern. Eine genaue Hubhöhenmessung<br />
ist bei diesen Höhen unerlässlich, um<br />
wechselnden Belastungen <strong>und</strong> Elastizitäten im Hubgerüst<br />
Rechnung zu tragen. Eine direkte Übertragung von<br />
bestehender Technologie auf Gegengewichtsstapler<br />
lässt sich auf Gr<strong>und</strong> von hohen Robustheitsanforderungen<br />
nicht bewerkstelligen. Derzeit bietet die Firma STILL<br />
keine Lösungen zur Hubhöhenmessung im Bereich der<br />
Gegengewichtsstapler an. Eine zuverlässige Hubhöhenmessung<br />
ist die Basis weiterer Automatisierungsentwicklungen<br />
<strong>und</strong> bestimmt damit den nächsten Entwicklungsschritt.<br />
Wie aktuelle Untersuchungen zeigen,<br />
ist es sinnvoll die Hubhöhe direkt mittels Längen/Wegmessung<br />
aufzunehmen <strong>und</strong> zur lokalen Verifikation<br />
<strong>und</strong> Stützung der Wegmessung das vorhandene<br />
hydraulische System zu integrieren. Aufgabenstellung:<br />
Im Rahmen der Bachelorthesis soll ein<br />
Hydraulikodometriemodell für eine Minimalhydraulik des<br />
RX-70 25 Gegengewichtsstaplers der Firma STILLentworfen<br />
werden. Dieses Hydraulikodometriemodell soll in<br />
Form von kennfeldgesteuerten Differenzengleichungen<br />
abbildbar sein <strong>und</strong> basieren auf einem Simulationsmodell<br />
welches in Modelica realisiert wird. Mit Hilfe des<br />
Hydraulikodometriemodells soll es ferner möglich sein,<br />
Aussagen über die lokalen Verfahrwege der Hydraulikzylinder<br />
machen zu können. Zur Vertrauensanalyse des<br />
Hydraulikodometriemodells sollen im Rahmen der Bachelorarbeit<br />
Fehlerabschätzungen einbezogen werden.<br />
Die Bachelorarbeit gliedert sich im Wesentlichen in die<br />
folgenden Schritte: Einarbeitung in die Modellierung mit<br />
Dymola, Erstellung eines Minimalhydraulikmodells in<br />
Dymola, Topologieuntersuchungen am Minimalhydraulikmodell,<br />
- Erstellen eines Sensormodell, Untersuchung<br />
des Sensormodells mit der Zielstellung der Bewertung<br />
der Aussagefähigkeit, Modifikationen <strong>und</strong> Tests, Demonstration<br />
der Funktion, Die Dokumentation beinhaltet<br />
folgende Punkte: Modellbeschreibung / Simulationstechnik,<br />
Analyse der gegebenen Situation (Hydrauliksystem),<br />
Erläuterung der verwendeten Methoden.<br />
FH Flensburg, WS 2010/11:<br />
[127] Dürrleder, Veronika: Maßnahmen zur Energieeinsparung<br />
<strong>und</strong> Betriebskostenminderung bei elektrischen<br />
Hilfsmaschinen (D, 2010): Nach einem mehrmonatigen<br />
Einbruch des Ölpreises in 2008 hat sich dieser zwischenzeitlich<br />
stabilisiert <strong>und</strong> steigt langsam wieder an. Es ist daher<br />
damit zu rechnen, dass Möglichkeiten zur Kraftstoffeinsparung<br />
für K<strong>und</strong>en der FSG in den kommenden Jahren<br />
wieder an Bedeutung gewinnen werden. Somit wird auch<br />
der Bedarf der FSG weiter wachsen, ihren K<strong>und</strong>en immer<br />
bessere, sich selbst amortisierende Lösungen zum Kraft-<br />
56<br />
stoffsparen anbieten zu können. Während unterschiedliche<br />
alte <strong>und</strong> neue Ideen zur Kraftstoffeinsparung in Antriebssystemen<br />
in den letzten Jahren bereits mehrfach im<br />
Rahmen von Diplomarbeiten untersucht <strong>und</strong> weiterentwickelt<br />
wurden, sind auf dem Gebiet der elektrischen Hilfsmaschinen<br />
nur vereinzelte <strong>und</strong> thematisch begrenzte Anstrengungen<br />
dieser Art unternommen worden. Bislang<br />
werden elektrische Verbraucher <strong>und</strong> Systeme eher mit<br />
Blick auf die Erfüllung der technischen Mindestanforderungen<br />
<strong>und</strong> einen minimalen Preis ausgewählt. Von Seiten der<br />
FSG besteht Interesse, den FSG-K<strong>und</strong>en bei gleichbleibenden<br />
technischen Anforderungen energetisch effektivere<br />
Lösungen anbieten zu können. Hierdurch ließe sich gleichzeitig<br />
der Kraftstoffverbrauch zur Erzeugung der elektrischen<br />
Energie senken <strong>und</strong> die zu installierende elektrische<br />
Leistung <strong>und</strong> die Größe der dafür benötigten Anlagen begrenzen.<br />
Aus den oben getroffenen Aussagen wurden folgende<br />
Teilaufgaben für eine Diplomarbeit abgeleitet: Literaturrecherche,<br />
Auswertung von Werftunterlagen zur Erstellung<br />
einer Energiebilanz von mehreren FSG-Schiffen, Selektion<br />
der bezüglich des Krafstoffverbrauchs bedeutsamsten<br />
elektrischen Verbraucher, Selektion der für die zu installierende<br />
Leistung bedeutsamsten elektrischen Verbraucher,<br />
Bestimmung der Effektivität bestehender, ausgesuchter<br />
E-Verbraucher, Suche nach effektiveren E-<br />
Verbrauchern (Wirkungsgrade <strong>und</strong> Preise), Untersuchung<br />
des Einsatzes von Frequenz-Umrichtern für einzelne große<br />
Verbraucher (wie z.B. Seekühlwasserpumpen) bei realistischen<br />
Betriebsprofilen. Hierzu liegt bereits eine Diplomarbeit<br />
aus dem Jahr 2003 bei der FSG vor, dessen Ergebnisse<br />
einbezogen werden sollten. Optional: Untersuchungen<br />
eines begrenztem Gleitfrequenzbetriebs (z.B. 100%-85%).<br />
Hierbei soll das Hauptbordnetz Verbraucher, welche diese<br />
Gleitfrequenz nicht vertragen, über einen oder mehrere<br />
kleine Frequenz-Umrichter mit nachgeschalteten (Festfrequenz-)netzen<br />
versorgen. Bewertung der untersuchten<br />
Lösungen hinsichtlich der Auswirkungen auf Investitionskosten,<br />
Verfügbarkeit, Raumbedarf Wartungsaufwand,<br />
Komplexität etc. Die Arbeit wird fachliche durch die Flensburger<br />
Schiffbaugesellschaft (http://www.fsg-ship.de) unterstützt.<br />
[128] Reschke, Veit: Erstellung eines Kosten-<br />
Simulationsmodells für Kühlwassersysteme (D,<br />
2010): In der Arbeit soll ein Berechnungsmodell für die<br />
Bewertung von Life Cycle Costs versus Investitionskosten<br />
der Kühlwassersysteme erstellt werden. Es soll ein<br />
strömungstechnisches <strong>und</strong> thermodynamisches Simulationsmodell<br />
für Kühlwassersysteme mit drehzahlgeregelten<br />
Pumpen erstellt werden. Begonnen werden soll mit<br />
den Seekühlwassersystem. Sofern im Rahmen der Arbeit<br />
noch möglich, soll das Modell auf die Frischkühlwassersysteme<br />
erweitert werden. Die Arbeit wird fachlich<br />
durch die FSG (http://www.fsg-ship.de/) unterstützt.<br />
[129] Köcher, Stefan: Einfluss neuer Sicherheits- <strong>und</strong><br />
Umweltvorschriften auf den Energieverbrauch <strong>und</strong><br />
die CO2-Emissionen der Schifffahrt (D, 2010): Arbeitsziele:<br />
1. Gr<strong>und</strong>sätzlich muss unterschieden werden<br />
zwischen Einflüssen auf das Design <strong>und</strong> daraus folgende<br />
eventuelle negative Effekte auf den EEDI einerseits<br />
<strong>und</strong> erhöhte Emissionen während des Betriebes. 2. Einflüsse<br />
auf den EEDI können sich auch auf die Betriebsemissionen<br />
auswirken. 3. Analyse der IMO-Resolutionen<br />
<strong>und</strong> Circular Letters seit 2000 ( http://www.IMO.org <strong>und</strong><br />
Unterstützung der Recherche durch VdR möglich). Zu<br />
betrachten sind unter anderem Bauvorschriften für<br />
Bulker <strong>und</strong> Tanker, zusätzlicher Stahlbedarf nach den<br />
'Common Structure Rules', Bauvorschriften 'Safe Return<br />
to home' für Passagierschiffe, Ballastwasserbehandlungsanlagen,<br />
Annex VI, zulässige NOx-Emissionen,<br />
Umstellungsprozesse beim Ein- <strong>und</strong> Ausfahren aus<br />
Emission Control Areas, Korrelation der verschiedenen<br />
SEEMP-Maßnahmen, freiwillige Maßnahmen wie Entschwefelungsanlagen<br />
<strong>und</strong> Katalysatoren sonstige energierelevante<br />
Vorschriften. 4. Analyse der derzeitigen
<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>.-<strong>Ing</strong>. Holger Watter Flensburg University of Applied Sciences<br />
Entwicklungen bei IMO <strong>und</strong> erwartetes Inkrafttreten (Ballastwasser,<br />
EEDI, Recycling(?)). 5. Der EEDI für Containerschiffe,<br />
Bulker <strong>und</strong> Tanker wird auf der Basis der<br />
Neubauten der letzten 10 Jahre ermittelt. Analyse der<br />
Anteile der Schiffe am EEDI-Ergebnis, die schon schärfere<br />
Anforderungen im Hinblichk auf Umweltschutz <strong>und</strong><br />
Sicherheit erfüllen(z.B. Annex VI <strong>und</strong> Common<br />
Structural Rules). Bewertung hinsichtlich Relevanz der<br />
Baseline (Unterstützung der Datenrecherche durch VdR<br />
<strong>und</strong> <strong>Dr</strong>. Krapp möglich). 6. Qualitative Einordnung der<br />
Effekte in Klassen von 0 (kein Einfluss) bis 5 (sehr großer<br />
Einfluss 7. Quantitative Abschätzung der mit 4 <strong>und</strong><br />
5 bewerteten Effekte (Auch aufgr<strong>und</strong> von diesbezüglichen<br />
Submissions zu MEPC). 8. Zusammenfassender<br />
Bericht. Die Arbeit wird fachlich vom VDR<br />
www.reederverband.de unterstützt.<br />
[130] Klöttschen, Gregor: Schadensanalyse von Zylinderkopfschäden<br />
eines Hilfsdiesel (D, 2010): Für zwei aktuelle<br />
Schadenfälle von Hilfsdieseln im Bereich des Zylinderkopfes<br />
ist eine Schadensanalyse durchzuführen:<br />
Literaturrecherche, Schadendatenbanken, CIMAC, Service<br />
Bulletins etc. Aus der Historie sind weiter Schäden<br />
bekannt die es zu erfassen <strong>und</strong> zu klassifizieren gilt in<br />
einer Excel Datei als Gr<strong>und</strong>lage für eine spätere FMEA<br />
Schadenanalytik. Eingrenzung der möglichen Ursachen,<br />
Kostenerfassung, Bef<strong>und</strong>ung der Teile in Zusammenarbeit<br />
mit der Hochschule im Werkstofflabor, Toleranzen,<br />
Bauteilversagen. Es sind eigene Gedanken zu diesem<br />
Thema zu entwickeln <strong>und</strong> Vorschläge zu Vermeidung<br />
dieser Probleme zu entwickeln. Zusammen mit dem Engine<br />
Operation Department ist eine Anweisung an Bord<br />
zur Schadensvermeidung bzw. Schadensfrüherkennung<br />
zu erstellen. Die Arbeit wird fachlich von der Firma NSB<br />
– www.reederei-nsb.com – unterstützt.<br />
SS 2010:<br />
[131] Beutler, Daniel: Untersuchung <strong>und</strong> Gegenüberstellung<br />
zweier möglicher Feuerungstechniken sowie<br />
zweier möglicher Kesseltypen zur thermischen Verwertung<br />
von Sonnenblumenschalen (D, 2010): In der<br />
Archer Daniels Midland Company (ADM) Europa<br />
(www.adm.com), werden Ölsaaten zu Lebensmittelölen<br />
<strong>und</strong> -fetten verarbeitet, die Gr<strong>und</strong>lage für Speiseöle <strong>und</strong><br />
Streichfette sind. Bei der Verarbeitung der Produkte fallen<br />
Nebenprodukte an (hauptsächlich Schalen der Saat),<br />
die für eine Weiterverarbeitung nicht mehr in Frage<br />
kommen. Für die Produktion benötigen die verarbeitenden<br />
Anlagen <strong>und</strong> Maschinen hauptsächlich Prozessdampf<br />
aber auch Strom, dass ein Kraftwerk am Standort<br />
zur Verfügung stellt. Dieses Kraftwerk verwendet häufig<br />
Gasturbinen <strong>und</strong> Gasbrenner, die mit städtischem Gas<br />
betrieben werden, um die Kesselanlagen zu befeuern.<br />
Um Gaskosten einzusparen kam die Überlegung auf,<br />
das Nebenprodukt der Ölsaaten als primären Brennstoff<br />
einzusetzen. Ziel dieser Arbeit ist nun, dass häufig anfallende<br />
Nebenprodukt Sonnenblumenschale als Primärenergie<br />
zur Dampferzeugung möglichst effizient einzusetzen.<br />
Dazu werden 2 unterschiedliche Feuerungstechniken<br />
sowie Kesselbauarten untersucht <strong>und</strong> gegenübergestellt.<br />
Vorrangig untersucht werden, der Verbrennungsprozess,<br />
die Bauart der Kessel <strong>und</strong> die Feuerungstechniken.Aufgr<strong>und</strong><br />
der Anwendung bei ADM wird<br />
ein kombiniertes System aus Wasserrohr <strong>und</strong><br />
Abhitzekessel <strong>und</strong> ein reiner Wasserrohrkessel untersucht<br />
<strong>und</strong> gegenübergestellt, sowie die zwei unterschiedlichen<br />
Feuerungstechniken Brennkammer <strong>und</strong><br />
Rostfeuerung.<br />
[132] Blaschke, Melanie: Auswirkungen <strong>und</strong> Folgen der<br />
geltenden MARPOL-Umweltrichtlinien für Motor- <strong>und</strong><br />
Maschinenanlagen <strong>und</strong> deren Betrieb in der Seeschifffahrt<br />
(BEng, 2010): Im Rahmen der Bachelor-Thesis sollen<br />
die von der IMO festgelegten MARPOL-Richtlinie hinsichtlich<br />
ihrer Auswirkungen auf den Schiffsmaschinenbetrieb<br />
untersucht <strong>und</strong> dargestellt werden. Es wird der bishe-<br />
57<br />
rige Stand der Technik zur Erfüllung der Regularien (z.B.<br />
NOx <strong>und</strong> SOx Emissionen) aufgezeigt sowie neue technische<br />
Entwicklungen, um auch die zukünftig in Kraft tretenden<br />
Vorschriften zur Reduzierung von Schadstoffemissionen<br />
einhalten zu können. Ein besonderer Schwerpunkt der<br />
Arbeit behandelt das Reconditioning (Aufarbeitung) von<br />
Einspritzequipment (Einspritzdüsen <strong>und</strong> –pumpen) auf<br />
EIAPP zertifizierten Motoren (Engine International Air Pollution<br />
Prevention). Hierbei liegt das Augenmerk hauptsächlich<br />
im Bereich der 4-Takt Einspritztechnik. Zunächst soll<br />
der Reconditioning-Prozess beispielhaft an einem Motortyp<br />
beschrieben <strong>und</strong> die Vor- <strong>und</strong> Nachteile sowie mögliche<br />
Gefahren dieser Aufarbeitung aufgezeigt werden. Ziel ist<br />
es, Maße <strong>und</strong> Toleranzen für eine qualitativ hochwertige<br />
Reconditionierung der Elemente zu definieren <strong>und</strong> diese<br />
Werte dem Injection-Workshop bereit zu stellen. Diese<br />
Werte sollen in naher Zukunft nach Rücksprache mit den<br />
Klassifikationsgesellschaften auch als „Allowable<br />
Adjustments“ in das Technical File aufgenommen werden.<br />
Die Arbeit wird fachlich von der Firma WÄRTSILÄ<br />
(http://www.wartsila.com) unterstützt.<br />
WS 2011/12:<br />
[133] Ketzler, E.: Flottenmanagementsysteme/Software:<br />
Benchmarkingsystem für seegehende Schiffe (D,<br />
2011): "Identifizierung wesentlicher <strong>Leistungs</strong>parameter<br />
für den Schiffsbetrieb <strong>und</strong> exemplarische Umsetzung eines<br />
automatisierten Bewertungsverfahrens": Gegenwärtig<br />
existieren verschiedene Ansätze, die Effizienz des<br />
Schiffsbetriebes hinsichtlich des Energieverbrauchs, der<br />
Umweltbelastung <strong>und</strong> der nachhaltigen Nutzung eines<br />
Schiffes auf Basis von ausgewählten <strong>Leistungs</strong>kennzahlen<br />
(KPI) zu bewerten <strong>und</strong> somit vergleichbar zu machen.<br />
Ziel der Arbeit ist es, eine Übersicht über die zur<br />
Zeit bekannten Verfahren zu liefern <strong>und</strong> ausgewählte<br />
Kennzahlen exemplarisch anzuwenden. Im Rahmen der<br />
Arbeit sollen die verschiedenen Ansätze gegenübergestellt<br />
<strong>und</strong> verglichen werden. Weiterhin soll eine exemplarische<br />
Umsetzung eines ausgewogenen Bewertungsverfahrens<br />
unter Berücksichtigung der Bedürfnisse einer<br />
klassischen Trampreederei in Software erfolgen. Hierfür<br />
steht eine umfangreiche Datenbasis zur Verfügung. Das<br />
Programm soll auf Basis täglich an Bord gesammelter<br />
Maschinendaten eine normierte Aussage über die Effizienz<br />
eines seegehenden Schiffes hinsichtlich Energieverbrauch/<br />
Leistung, Umweltbelastung <strong>und</strong>/oder Nachhaltigkeit<br />
erlauben. Nach Abschluss der Arbeit wird das<br />
Bewertungsverfahren in der Reederei zur täglichen Anwendung<br />
kommen. Die Arbeit wird in Zusammenarbeit<br />
mit der Reederei Thomas Schulte in Hamburg erfolgen.<br />
Anforderungen: Sie stehen am Ende Ihres Studiums <strong>und</strong><br />
besitzen gr<strong>und</strong>legende Programmierkenntnisse in wenigstens<br />
einer objektorientierten Programmiersprache.<br />
Idealerweise haben Sie im Rahmen Ihres Studiums bereits<br />
erste praktische Erfahrungen an Bord seegehender<br />
Schiffe gesammelt. Wir erwarten von Ihnen ein hohes<br />
Maß an Selbständigkeit <strong>und</strong> die Fähigkeit zum eigenverantwortlichen<br />
Arbeiten. Fachbereiche: <strong>Ing</strong>enieurwesen,<br />
Maschinenbau (insbesondere Schiffbau, Schiffsbetriebstechnik),<br />
Elektrotechnik. Ansprechpartner: Herberg Engineering<br />
GmbH, Jan Herberg, Ruhrstrasse 90, 22761<br />
Hamburg, bewerbung(at)herberg-engineering.com,<br />
http://www.fleettracker.de<br />
[134] Martens, Thomas: Entwicklung eines Anlagen- <strong>und</strong><br />
Betriebskonzepts für eine Rauchgasentschwefelungsanlage<br />
an Bord von Seeschiffen (M, 2011): Aufgr<strong>und</strong><br />
nationaler <strong>und</strong> internationaler Vorschriften werden<br />
an die Emissionswerte von Seeschiffen immer höhere<br />
Anforderungen gestellt. Verschiedene Anlagen- <strong>und</strong> Betriebskonzepte<br />
befinden sich derzeitig in der Entwicklung<br />
<strong>und</strong> Erprobung. Für ein neu entwickeltes, trockenes<br />
Rauchgasentschwefelungsverfahren ist ein geeignetes<br />
Anlagen- <strong>und</strong> Betriebskonzept für Seeschiffe zu entwi-
<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>.-<strong>Ing</strong>. Holger Watter Flensburg University of Applied Sciences<br />
ckeln. Dabei sind die Besonderheiten der Seeschifffahrt<br />
(Bauvolumen, Gewicht, Stabilität, Sicherheit etc.) zu berücksichtigen.<br />
Es ist daher ein intensiver Dialog mit dem<br />
Systemlieferanten, dem Motorenhersteller, der Klassifikationsgesellschaft,<br />
den flaggenstaatlichen Einrichtungen<br />
<strong>und</strong> der projektverantwortlichen Werft zu führen.<br />
Anhand eines exemplarischen Schiffes ist der Themenkomplex<br />
so aufzuarbeiten, dass das Anlagenkonzept<br />
von allen Beteiligten mitgetragen werden kann. Dazu<br />
sind insbesondere der Stand der Technik sowie die Erfahrungen<br />
aus Pilotprojekten (TUHH, TIMBUS u.a.) darzustellen,<br />
für das gegebene Schiff, die Energie- <strong>und</strong><br />
Massenströme quantitativ zu erfassen, ein Lastenheft<br />
basierend auf den Anforderungen der o.g. beteiligten<br />
Partner aufzustellen, ein Anlagenkonzept unter Berücksichtigung<br />
dieser Forderungen zu entwickeln, für dieses<br />
Anlagenkonzept eine Risikoanalyse (FMEA, Not- <strong>und</strong><br />
Ausfallszenarien, Fehlerbaumanalyse, Voll- <strong>und</strong> Teillastbetrieb<br />
o.ä.) durchzuführen sowie ein Steuerungs-,<br />
Überwachungs- <strong>und</strong> Betriebskonzept zu entwerfen. Sofern<br />
zeitlich machbar, sind Rückwirkungen auf die Energieeinsparung<br />
durch die potentiale der Wärmerückgewinnung<br />
(„Multistream“, Taupunktabsenkung….) in die<br />
Bewertung mit einzubeziehen. Die Arbeit wird fachlich<br />
durch die Firmen COUPLE SYSTEMS (www.couplesystems.de/index.php/dryegcs-en.html)<br />
<strong>und</strong> die<br />
FLENSBURGER SCHIFFBAUGESELLSCHAFT<br />
(www.fsg-ship.de) unterstützt.<br />
[135] Koser, Dominic: Bewertung <strong>und</strong> Empfehlungen für<br />
Biegeradien von Hydraulikleitungen (D., FH Frankfurt,<br />
2011): Auf einem Industrieunternehmen werden<br />
seit mehreren Jahren Hydraulikrohre mit einer Werkzeugmaschine<br />
im Rotationszug-Verfahren gebogen. Es<br />
hat sich gezeigt, dass bei <strong>Dr</strong>ücken über 200 bar gem.<br />
den einschlägigen Regeln <strong>und</strong> Normen zu kleine Biegeradien<br />
hergestellt werden. Durch die Arbeit sind zukünftige<br />
Unternehmensentscheidungen vorzubereiten. Dazu<br />
sind Recherchen <strong>und</strong> Berechnungen der einschlägigen<br />
Fachliteratur <strong>und</strong> Vorschriften zu gebogenen Rohren<br />
mit hohen Betriebsdrücken durchzuführen. Die fertigungstechnischen<br />
Optionen zur Rohrfertigung für <strong>Dr</strong>ücke<br />
über 200 bar sind zu prüfen <strong>und</strong> zu bewerten sowie<br />
Handlungsempfehlungen abzuleiten. Die Arbeit wird<br />
fachlich durch die Firma SITAS - www.sietas-werft.de –<br />
unterstützt.<br />
[136] Voß, Christian: Schadensanalyse von Zylinderkopfschäden<br />
eines Hilfsdiesel (D, 2011): Für zwei aktuelle<br />
Schadenfälle von Hilfsdieseln im Bereich des Zylinderkopfes<br />
ist eine Schadensanalyse durchzuführen: Literaturrecherche,<br />
Schadendatenbanken, CIMAC, Service<br />
Bulletins etc. Aus der Historie sind weiter Schäden bekannt,<br />
die es zu erfassen <strong>und</strong> zu klassifizieren gilt (in<br />
einer Excel Datei als Gr<strong>und</strong>lage für eine spätere FMEA<br />
Schadenanalytik). Eingrenzung der möglichen Ursachen,<br />
Kostenerfassung, Bef<strong>und</strong>ung der Teile in Zusammenarbeit<br />
mit der Hochschule im Werkstofflabor,<br />
Toleranzen, Bauteilversagen. Es sind eigene Gedanken<br />
zu diesem Thema zu entwickeln <strong>und</strong> Vorschläge zu<br />
Vermeidung dieser Probleme zu entwerfen. Zusammen<br />
mit dem Engine Operation Department ist eine Anweisung<br />
an Bord zur Schadensvermeidung bzw. Schadensfrüherkennung<br />
zu erstellen. Die Arbeit wird fachlich<br />
von der Firma NSB – www.reederei-nsb.com – unterstützt.<br />
[137] Bublitz, Carsten: Minimierungspotentiale der Abgasemissionen<br />
eines Kreuzfahrtschiffes (B, 2011):<br />
In den kommenden Jahren wird es in der Seeschifffahrt<br />
zu erheblichen Verschärfungen im Bereich Abgasgrenzwerte<br />
für Schiffsdieselmotoren kommen. Hierbei<br />
wird der Fokus zunächst auf den SOx- <strong>und</strong> NOx-<br />
Emissionen liegen. Nach dem heutigen Stand der<br />
Technik lassen sich bereits verschiedene Verfahren realisieren,<br />
um den Schadstoffausstoß der Dieselmotoren<br />
58<br />
inner- <strong>und</strong>/oder außermotorisch zu verringern. Am Beispiel<br />
eines Kreuzfahrtschiffes sind Lösungs- <strong>und</strong> Umsetzungsstrategien<br />
zur Verringerung der Abgasemissionen<br />
zu erarbeiten. Diese Einzelmaßnahmen sollen<br />
aufgezählt, beschrieben <strong>und</strong> in Bezug auf Effektivität,<br />
Aufwand <strong>und</strong> Kosten hin verglichen werden. Dabei soll<br />
auch herausgearbeitet werden, ob sich diese Lösungen<br />
nur für einen Neubau eignen, oder ob auch Nachrüstmöglichkeiten<br />
bestehen. Der aktuelle Stand bei den<br />
Abgasemissionen eines Bestandsschiffes wird über die<br />
Brennstoffverbräuche erfasst <strong>und</strong> dann mit konkreten<br />
Maßnahmen beispielhaft das Einsparpotential im NOx-<br />
<strong>und</strong> SOx-Ausstoß ermittelt. Abschließend soll gr<strong>und</strong>sätzlich<br />
beurteilt werden, ob damit künftige Grenzwerte<br />
eingehalten werden können <strong>und</strong> ob die Maßnahmen mit<br />
einem vertretbaren Kostenaufwand umzusetzen sind<br />
(wenn Daten verfügbar). Zu beachten sind hier auch die<br />
in Zukunft steigenden Brennstoffkosten sowie die<br />
Brennstoffverfügbarkeit. Die Arbeit wird fachlich durch<br />
die Firma HAPAG LLOYD KREUZFAHRTEN<br />
(www.hlkf.de) unterstützt.<br />
[138] Goldberg, Thomas: Anforderungen <strong>und</strong> Maßnahmen<br />
zur Einhaltung von Abwassergrenzwerten auf<br />
einem Kreuzfahrtschiff (B, 2011): Bestehende Abwasserbehandlungsanlagen<br />
kommen wegen der zunehmenden<br />
Schiffs- <strong>und</strong> Passagiergröße sowie wegen<br />
der steigenden Umweltanforderungen an ihre <strong>Leistungs</strong>grenzen.<br />
Anlagenkonzepte aus dem Landbereich<br />
sind wegen der räumlichen Anforderungen nicht einfach<br />
übertragbar. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, den<br />
Stand der Technik <strong>und</strong> der Vorschriften am Beispiel der<br />
MS EUROPA aufzuarbeiten, Entwicklungstendenzen<br />
<strong>und</strong> Lösungsmöglichkeiten sowie Handlungsoptionen<br />
für die Umrüstung oder betriebliche Konzepte abzuleiten.<br />
Dazu ist (1) die bestehende Anlagenkonfiguration<br />
der MS EUROPA zu beschreiben (2) zukünftige internationale,<br />
regionale <strong>und</strong> nationale Anforderungen für das<br />
gegebene Fahrtprofil übersichtlich aufzuarbeiten (z.B. in<br />
Tabellenform). (3) Aus den Anforderungen ist für die<br />
MS EUROPA ein Zielsystem mit Hilfe der Nutzwertanalyse<br />
im Dialog mit der Reederei zu erarbeiten. (4)<br />
Marktverfügbare Anlagenkonzepte sind anhand dieses<br />
Zielsystems zu bewerten <strong>und</strong> auf Realisierbarkeit zu<br />
prüfen. Die Arbeit wird fachlich durch die Firma HAPAG<br />
LLOYD KREUZFAHRTEN (www.hlkf.de) unterstützt.<br />
[139] Pätzold, Christian: Erprobung einer alternativen<br />
<strong>Dr</strong>ehwerkssteuerung eines Groß-Hydraulikbaggers<br />
(B, 2011): Im Zuge der vorliegenden Arbeit soll an einem<br />
(speziell für Versuche eingerichteten) Testbagger<br />
ein Umbau auf eine neue <strong>Dr</strong>ehwerkssteuerung mit allen<br />
dazu nötigen Anpassungen <strong>und</strong> Veränderungen durchgeführt<br />
<strong>und</strong> dokumentiert werden. Dazu sind die Testanforderungen<br />
zu spezifizieren, die Messanforderungen<br />
<strong>und</strong> -prozeduren festzulegen sowie geeignete Testbedingungen<br />
zu definieren <strong>und</strong> zu bewerten. Die Versuche<br />
sollen an die Betriebsbedingungen aus dem Feld<br />
angelehnt <strong>und</strong> reproduzierbare Ergebnisse liefern.<br />
Nach Fertigstellung ist ein Soll-Ist-Vergleich zwischen<br />
den Planzielen <strong>und</strong> den Ergebnissen der Betriebsversuche<br />
durchzuführen. Die Arbeit wird fachlich durch die<br />
Firma CATERPILLAR GLOBAL MINING,<br />
https://mining.cat.com, unterstützt.<br />
[140] Metzner, Frithjo: Untersuchung von Einflussfaktoren<br />
auf den Base-Zahl-Verbrauch bei Zylinderschmieröl<br />
(B, 2011): Durch die Umstellung der Schifffahrtsbrennstoffe<br />
auf niedrigschweflige Kraft- <strong>und</strong><br />
Brennstoffe, ist ein neues, optimiertes, motor- <strong>und</strong> fahrprofilspezifische<br />
Gleichgewicht zu finden. Anhand von<br />
Daten, der Lukoil Marine Lubricants Ltd., soll zunächst<br />
eine Formel (weiter)entwickelt werden mit der eine<br />
Aussage über den Rückgang der Baenzahl im Zylinderschmieröl<br />
von 2-Takt-Dieselmotoren möglich ist. Des<br />
weiteren soll untersucht werden, welche Faktoren eine
<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>.-<strong>Ing</strong>. Holger Watter Flensburg University of Applied Sciences<br />
Rolle spielen bei diesem Rückgang. Zum einen sind die<br />
bereits bekannten Faktoren, wie Schwefelgehalt des<br />
Brennstoffes <strong>und</strong> Wasser zu untersuchen. Zum anderen<br />
soll ein Augenmerk auf bisher nicht beachtete Faktoren<br />
gelegt werden. Zu diesen Faktoren gehören der<br />
Vanadiumgehalt im Brennstoff <strong>und</strong> die Belastung des<br />
Motors. Die Arbeit wird fachlich durch die Firma<br />
LUKOIL MARINE LUBRICATANTS unterstützt;<br />
www.lukoilmarine.com.<br />
[141] Klawon, Wiebke: Konzeption <strong>und</strong> Planung einer<br />
Wasserstoffeinspeisestation für das Erdgasnetz (B,<br />
2011): Im Rahmen der Diskussion um die „erneuerbaren“<br />
Energien <strong>und</strong> die Zwischenspeicherung von Energieüberschüssen<br />
(z.B. aus Windparks) wird die Einspeisung<br />
von regenerativ erzeugtem Wasserstoff in das<br />
Erdgasnetz diskutiert. Mit der vorliegenden Arbeit soll<br />
im Rahmen einer Konzeptstudie eine derartige Anlage<br />
geplant <strong>und</strong> die Auswirkungen auf das Erdgasnetz abgeschätzt<br />
werden. Dazu sollen die Besonderheiten des<br />
Wasserstoffgases sowie die Rückwirkungen auf die Anlagenkomponenten<br />
mit den gesetzlichen <strong>und</strong> technischen<br />
Anforderungen beschrieben <strong>und</strong> die Auswirkungen<br />
insbesondere auf Volumen- oder Mengenmeßeinrichtungen,<br />
Anlagen zur <strong>Dr</strong>uckanpassung <strong>und</strong> Zumischung<br />
etc. erörtert werden. Die Sek<strong>und</strong>ärwirkungen<br />
für das Erdgasnetz, die Erdgasleitung, die Gasdruckregel-<br />
<strong>und</strong> Messanlagen sowie die Verdichterstationen<br />
sind zu bewerten. Die Arbeit wird fachlich durch die<br />
Firma OPEN GRID EUROPE (www.open-grideurope.com)<br />
unterstützt.<br />
SS 2012:<br />
[142] Ziebarth, Anna: Machbarkeitsstudie für ein Pumpspeicherkraftwerk<br />
(B, 2011): Im Bereich Tarbek (PLZ<br />
24919) <strong>und</strong> Damsdorf (PLZ 23824) der „Holsteinischen<br />
Schweiz“ wird großflächig Kies abgebaut (insgesamt<br />
auf mehreren h<strong>und</strong>ert Hektar). Aufgr<strong>und</strong> des Geländeprofils<br />
liegen Höhenunterschiede von ca. 12 m zwischen<br />
OK Gelände <strong>und</strong> dem Gr<strong>und</strong>wasserspiegel vor.<br />
Wegen des Ausbaus der erneuerbaren Energien besteht<br />
in Schleswig-Holstein ein sehr großer Bedarf,<br />
Energiespitzen zu speichern <strong>und</strong> bei Bedarf wieder bereitzustellen.<br />
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit, ist<br />
das Geländeprofil hinsichtlich dieser Nutzungsmöglichkeit<br />
zu untersuchen, <strong>Leistungs</strong>-, Energie- <strong>und</strong> Wirkungsgradprognosen<br />
für ein Pumpspeicherkraftwerk zu<br />
erstellen, Kostenschätzungen für den Investitions- <strong>und</strong><br />
Betriebsaufwand abzugeben sowie eine Marktrecherche<br />
zu potentiellen Anlagenbauern zu erarbeiten.<br />
[143] Ackermann, Stefan: Aufbau <strong>und</strong> Modellierung eines<br />
integrierten Prüfstands für eine Anlage zur solaren<br />
Kühlung (M, 2011, Akademie für Erneuerbare Energien,<br />
Lüchow): Ziel der Arbeit ist es, einen Prüfstand<br />
für eine Anlage zur solaren Kühlung aufzubauen. Der<br />
Fokus liegt dabei darauf, den Prüfstand mit Mess-,<br />
Steuerungs- <strong>und</strong> Regelungstechnik auszustatten. Diese<br />
Aufgabe beinhaltet die Auswahl <strong>und</strong> die Installation von<br />
Sensoren, die Konzeptionierung <strong>und</strong> Programmierung<br />
einer Benutzeroberfläche zur Beobachtung der Anlagenparameter<br />
sowie die Definition <strong>und</strong> Umsetzung der<br />
Steuerungslogik <strong>und</strong> der Datenspeicherung. Zusätzlich<br />
soll im Rahmen des Projekts eine Wetterstation zur<br />
Aufzeichnung von Einstrahlungs-, Temperatur- <strong>und</strong><br />
Winddaten installiert werden. Unter Einsatz der Methode<br />
der statistischen Versuchsplanung (DoE) sollen Experimente<br />
definiert, durchgeführt <strong>und</strong> dokumentiert<br />
werden. Nach Analyse der gemessenen <strong>und</strong> durch Simulation<br />
errechneten Ergebnisse soll die Anlage anhand<br />
eines Modells gegen diese Ergebnisse validiert<br />
<strong>und</strong> optimiert werden. Die Arbeit wird fachlich durch die<br />
Firma GE GLOBAL RESEARCH<br />
(www.research.ge.com) unterstützt.<br />
59<br />
[144] Penkalla, John: Validierung von Ölschlammdaten<br />
zur Hafenstaatkontrolle (Sludge-Projekt); (B, 2011):<br />
Bei der Überprüfung von Seeschiffen in den Häfen (Port<br />
State Control) werden die Maschinentagebücher auch<br />
auf korrekte Angaben hinsichtlich der Entsorgung von<br />
Ölschlamm (sludge) kontrolliert. Bisher geht man davon<br />
aus, dass bei dem Betrieb von Seeschiffen mit Schwerölbetrieb<br />
Ölschlamm in der Größenordnung von 1% der<br />
Gesamtverbrauchsmenge an Schweröl anfällt (1% Regel)<br />
<strong>und</strong> entsprechend entsorgt werden muss. Bei der<br />
Port State Control wurden bei der Überprüfung der<br />
Schiffe Statistiken aufgebaut, die es nun ermöglichen,<br />
die 1% Regel zu überprüfen <strong>und</strong> ggf. zu korrigieren.<br />
Dier Statistiken wurden dem ISF an der FH Flensburg<br />
vom BSH für eine entsprechende Auswertung zur Verfügung<br />
gestellt. Das Projekt wäre geeignet, im Rahmen<br />
einer Bachelorarbeit für das Fachgebiet Schiffbetriebstechnik<br />
ausgewertet zu werden. Dabei soll insbesondere<br />
die bisher zugr<strong>und</strong>e liegende 1% Regel auf ihre<br />
Stichhaltigkeit überprüft werden. Weiterhin wäre zu untersuchen,<br />
welche Einflussfaktoren (Ölqualität, Wassergehalt,<br />
Seperatortyp etc.) bei der Bildung von sludge<br />
eine Rolle spielen <strong>und</strong> in welcher Hinsicht die anfallenden<br />
Mengen davon beeinflusst sein könnten. Die endgültige<br />
Formulierung der Aufgabe sollte ein ausgewiesener<br />
Schiffsingenieur unter Berücksichtigung der bisher<br />
vom BSH zur Verfügung gestellten Datenbasis vornehmen.<br />
[145] Hatecke, Markus: Modifikation eines Mono-Rail-<br />
Kranes (B, 2012): Im Schiffsbetrieb werden Einschienen-Krananlagen<br />
als Proviantkrane zur Versorgung des<br />
Schiffes mit notwendigen Ersatzteilen <strong>und</strong> Lebensmitteln<br />
eingesetzt. Sie haben deshalb einen hohen Stellenwert<br />
für den zuverlässigen <strong>und</strong> sicheren Schiffsbetrieb.<br />
In der Reederei NSB hat sich ein Krantyp, im Vergleich<br />
zu anderen Mono-Rail-Kranen als besonders<br />
wartungsanfällig <strong>und</strong> damit kostenintensiv im Unterhalt<br />
herausgestellt. Im Rahmen dieser Bachelorarbeit sollen<br />
die typischen Schäden am Kran analysiert werden <strong>und</strong><br />
auf Basis der daraus erkennbaren Ergebnisse Modifikationen<br />
entwickelt werden. Besonderer Wert wird dabei<br />
auf die Praxisnähe gelegt. Ziel der Thesis ist es konkrete<br />
Konstruktionszeichnungen <strong>und</strong> einen Plan, wie bei<br />
der Einführung der Modifikationen am sinnvollsten vorgegangen<br />
wird, zu erstellen. Fachlich wird die Arbeit<br />
von der Reederei NSB unterstützt.<br />
[146] Peschel, Leonie S.: Development of a forecasting<br />
tool for a ship equipped with a FLETTNER auxiliary<br />
propulsion system (B, 2011): WindAgain<br />
(www.windagain.com) is a developer of fuel and emissions<br />
reduction technologies for the global shipping industry,<br />
the Collapsible Flettner Rotor (CFR), is a spinning<br />
hollow metal column installed on a ship´s deck that<br />
converts wind power into forward thrust, roughly perpendicular<br />
to the direction of the wind, by harnessing<br />
the Magnus Effect, which allows ocean-going vessels to<br />
save up to 20-25% in fuel costs. Payback for an owner<br />
is expected to be 3 to 5 years depending on vessel<br />
type, size and oil price. WindAgain´s strategy is to develop<br />
complementary eco-efficiency technologies that<br />
meet impending environmental legislation, and contribute<br />
to alleviating the 75% latent inefficiency that exists<br />
within the shipping industry. In this bachelor thesis an<br />
EXCEL-based forecast tool has to be developed. Based<br />
on ship data, shipping route, meteorological data (wind<br />
speed, direction) and FLETTNER data (Rotor dimension<br />
Angular velocity of the rotor) the following results<br />
has to be calculated and evaluated: Wind force and direction,<br />
contribution to propulsion efficiency and fuel<br />
savings. The calculations should base on statistical<br />
weather data; a correlation with routing data should be<br />
implemented to aim a one year prediction. The documentation<br />
should be in English language and handle<br />
confidentially. WindAgain PTE LTD will support the
<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>.-<strong>Ing</strong>. Holger Watter Flensburg University of Applied Sciences<br />
Bachelor thesis by technical data, meteorological data,<br />
ship and performance data, comments and advice.<br />
[147] Uhlmann, Georg: Analyse von Plattenwärmetauschern<br />
mit OpenModellica <strong>und</strong> SimForge (D,<br />
2012): Software-Tools gehören zu den Standardwerkzeugen<br />
der <strong>Ing</strong>enieurwissenschaften. Wie bei allen<br />
Produktionsprozessen werden schnelle <strong>und</strong> kostengünstige<br />
Lösungen auch für diesen Bereich gesucht.<br />
Am Beispiel von Wärmeübertragern sind alternative Berechnungsverfahren<br />
mit verschiedenen Softwarewerkzeugen<br />
hinischtlich Adaption, Rechenqualität <strong>und</strong> Anwendbarkeit<br />
zu untersuchen. Modelica ist eine objektorientierte<br />
Beschreibungssprache für physikalische Modelle,<br />
sie ist 1997 im Programmiersprachenstandard 1.0<br />
erschienen. Ein in Modelica formuliertes, physikalisches<br />
Modell wird von einem Modelica-Translator in ein mathematisches<br />
Modell übersetzt <strong>und</strong> mittels eines Lösungsalgorithmus<br />
gelöst. Sie wird ergänzt durch<br />
SimForge, einem componentenorientierte , physikalische,<br />
graphische <strong>und</strong> textuelle Open Source Modelleditor.<br />
Ein Nachteil ist hier die unzureichende Dokumentation<br />
<strong>und</strong> die Qualitätssicherung. Es sind daher der Rechenprozess<br />
<strong>und</strong> die Ergebnisse auf Plausibilität zu<br />
prüfen <strong>und</strong> Handlungsempfehlungen für zukünftige Arbeiten<br />
abzuleiten.<br />
[148] Lehmköster, Ansgar: Projektierung <strong>und</strong> Umrüstung<br />
eines Fischkutters auf einen effizienten dieselelektrischen<br />
Antrieb (B, 2012): Die nationale Fischerei<br />
sieht sich einem zunehmenden Kosten- <strong>und</strong> Vorschriftendruck<br />
ausgesetzt. Gesucht werden technische<br />
Lösungen um die Wettbewerbsfähigkeit der Branche zu<br />
erhalten. Hier liegt der Schwerpunkt im Bereich der<br />
Energieeinsparung <strong>und</strong> Emissionsminderung. Mit der<br />
vorliegenden Arbeit sollen zunächst die<br />
Randbedingungen der Branche strukturiert dargestellt<br />
<strong>und</strong> am Beispiel eines konkreten Schiffes<br />
Lösungsmöglichkeiten abgeleitet werden<br />
(Emissionsgrenzwerte, <strong>Leistungs</strong>begrenzungen,<br />
Betriebsprofile, Energieeffizienz). Als mögliche Option<br />
wurde der dieselelektrische Antrieb identifiziert (wegen<br />
der Lastkollektive <strong>und</strong> Momentencharakteristik). Im<br />
Rahmen der Arbeit soll deshalb ein erprobtes Konzept<br />
aus der Binnenschifffahrt auf ein modernes<br />
Fischereifahrzeug (5 Jahre im Betrieb) übertragen<br />
werden, es sind konstruktive <strong>und</strong> betriebliche<br />
Handlungsempfehlungen für den Betreiber abzuleiten.<br />
Dazu besteht die Möglichkeit zur Mitfahrt auf dem<br />
Binnenschiff (mit dem dieselelektrischen Konzept) <strong>und</strong><br />
dem umzurüstenden Fischkutter. Zur Einarbeitung <strong>und</strong><br />
bei der Bereitstellung von Betriebsdaten wird die Arbeit<br />
fachlich unterstützt durch die Firma TORQUE MARINE<br />
IPS (www.torquemarine.de), die Firma DGS - Diesel-<br />
<strong>und</strong> Getriebeservice GmbH (www.dgs-mainz.com) , die<br />
Firma PLANUNGSGESELLSCHAFT FÜR ELEKTRO-<br />
MESS-STEUER REGELUNGSTECHNIK<br />
(www.magnussen.de) <strong>und</strong> den Fischereischutzverband<br />
Schleswig-Holstein.<br />
[149] Scheil, Tobials: Komponentenauslegung eines<br />
Kabellegers gemäß technischer Anforderungen von<br />
Offshore-Windparkprojekten in der Nordsee (B,<br />
2012): Motivation für die Arbeit ist die aktuelle Entwicklung,<br />
der sich im Bau <strong>und</strong> in der Planung befindenden<br />
Windparks in der Nordsee <strong>und</strong> der daraus resultierende<br />
Bedarf an Kabel verlegenden Schiffen für den Netzanschluss.<br />
Behandelt werden soll die notwendige<br />
Ausrüstung eines Schiffes, sodass möglichst der<br />
gesamten Netzintegrationsprozess abgedeckt werden<br />
kann: Von der Anlandung zur Umspannplattform bis hin<br />
zu der Innerparkverkabelung der Windkraftanlagen.<br />
Besondere Schwerpunkte bilden die Dimensionierung,<br />
Anordnung <strong>und</strong> Interaktion der erforderlichen<br />
Komponenten, die Parametrierung <strong>und</strong> Einbindung in<br />
das System „Schiff“ sowie eine Optimierung der<br />
60<br />
Schnittstellen zum Windpark <strong>und</strong> der Prozesskette. Die<br />
Arbeit wird fachlich durch die FLENSBURGER-<br />
SCHIFFBAUGESELLSCHAFT (www.fsg-ship.de)<br />
unterstützt.<br />
[150] Machau, Jörn: Umsetzung der internationalen Vorschriften<br />
zur Energie- <strong>und</strong> Ressourceneinsparung<br />
am Beispiel ein Containerschiffes (B, 2012): Die Internationale<br />
Schifffahrtsorganisation IMO schreibt ab<br />
Januar 2013 verbindliche Maßnahmen zur Energieeinsparung<br />
<strong>und</strong> Emissionsminderung auf Seeschiffen vor<br />
(vgl. MAPOL Annex VI, SEEMP = Ship Energy Efficiency<br />
Management Plan). Für eine mittelständische<br />
Reederei sind an einem konkreten Beispiel Maßnahmen-<br />
<strong>und</strong> Umsetzungsvorschläge zum EEOI (Energy<br />
Efficiency Operational Indicator), dem SEEMP sowie<br />
den IMO-Vorgaben (MEPC.1/Circ.683,<br />
MEPC.1/Circ.684) abzuleiten. Dazu sind die Vorgaben<br />
strukturiert zu analysieren <strong>und</strong> mit Hilfe der Nutzwertanalyse<br />
Lösungsoptionen für den konkreten Anwendungsfall<br />
zu erarbeiten. Der Maßnahmen- <strong>und</strong> Zielkatalog<br />
ist mit der Reederei abzustimmen. Der Abstimmungsprozess<br />
<strong>und</strong> die Lösungsfindung sind angemessen<br />
zu dokumentieren. Die Arbeit wird fachlich durch<br />
die Reederei JOHS. THODE GmbH & Co.KG<br />
(www.johs-thode.de) unterstützt.<br />
[151] Thorbian, <strong>Dr</strong>eyer: Erarbeitung eines web-basierten<br />
Lernkurses für Sicherheits- <strong>und</strong> Notfallmaßnahmen<br />
(B, 2012): Seit Juli 2004 sind für Schiffe <strong>und</strong> Hafenanlagen<br />
weltweit umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen in<br />
Kraft, die von der Seeschifffahrtsorganisation IMO nach<br />
den Terroranschlägen vom 11. September 2001auf Initiative<br />
der USA erarbeitet wurden (ISPS-Code). In<br />
Deutschland nimmt das BSH die administrativen Aufgaben<br />
für Seeschiffe unter deutscher Flagge wahr. Diese<br />
Sicherheitsmaßnahmen finden Anwendung auf<br />
Fahrgastschiffe sowie Frachtschiffe mit einer Tonnage<br />
ab 500 BRZ in internationaler Fahrt. Der "Safety and<br />
Security"-Trainer der FH Flensburg ist speziell auf<br />
Sicherheitsaspekte zugeschnitten ist. Das Konzept<br />
deckt alle Aspekte der Sicherheit ab. So stellt das System<br />
als 2-D-Version die Entwicklung <strong>und</strong> Kombination<br />
von simulierten Katastrophenszenarien, technischen<br />
Störungen <strong>und</strong> sich daraus ergebenden Folgereaktionen<br />
für Einzel- oder Teamschulungen zur Verfügung.<br />
Zugang zu allen Decks über eine detaillierte grafische<br />
Darstellung, vollfunktionsfähige schiffstechnische Systeme<br />
<strong>und</strong> Kommunikationsmöglichkeiten wie an Bord<br />
eines realen Schiffes zeichnen die Funktionalität des<br />
Simulators aus – <strong>und</strong> das in Echtzeit. Der "Safety and<br />
Security"-Trainer kann für Team- oder für Einzelschulungen<br />
konfiguriert werden. Im Teammodus üben die<br />
Teilnehmer alle auf ein <strong>und</strong> demselben Schiff, so dass<br />
Kommunikation, Interaktionen <strong>und</strong> Entscheidungen in<br />
einer Notsituation wirksam trainiert werden können. Alternativ<br />
dazu können Teilnehmer individuell <strong>und</strong> mit eigenen<br />
Übungen auf ihrem Schiff ihre Fähigkeiten schulen.<br />
Zu dem Konzept gehört außerdem die gesamte<br />
notwendige Dokumentation (z.B. Kursunterlagen, Katastrophenpläne,<br />
Ausbilderschulungskurse). Im Rahmen<br />
der Aufgabenstellung ist ein web-basierter Kursus zu<br />
entwickeln, in dem die erforderlichen Lerninhalte aufbereitet<br />
<strong>und</strong> vermittelt werden (der IMO-Model-Course ist<br />
in der Bibliothek verfügbar). Das Autorensystem soll<br />
flexibel <strong>und</strong> einfach in der redaktionellen Überarbeitung<br />
sein (im einfachsten Fall kann daher mit Textverarbeitungssoftware<br />
gearbeitet werden). Der Web-Space wird<br />
unter www.fh-flensburg.de/watter zur Verfügung gestellt.<br />
Die Bedienung soll einfach <strong>und</strong> interaktiv erfolgen.<br />
Kontrollfragen <strong>und</strong> Phasen zur Ergebnissicherung<br />
sind einzuarbeiten. Abschließend sollen drei bis fünf<br />
Szenarien entwickelt werden, die so zu dokumentieren<br />
sind, dass die Studierenden im Selbststudium die<br />
Übungen am Simulator abarbeiten können.
<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>.-<strong>Ing</strong>. Holger Watter Flensburg University of Applied Sciences<br />
WS 2012/13:<br />
[152] Beckenkamp, A.C.: Optimierung der Vorwärmer im<br />
Dieselgeneratoren- <strong>und</strong> Separationskreislaufs (B,<br />
2012): Durch die Schmierölwartung <strong>und</strong> -pflege werden<br />
zukünftige Schäden <strong>und</strong> Kosten wesentlich mitbestimmt.<br />
Eine notwendige Vorraussetzung für gute<br />
Schmierölqualität ist ein effizienter Separationskreislauf<br />
mit funktionierendem Vorwärmer. Zweck der vorliegenden<br />
Arbeit ist, den derzeitigen Zustand der Vorwärmer<br />
in der Flotte zu ermitteln, Problemursachen zu lokalisieren<br />
<strong>und</strong> Lösungsansätze zu entwickeln, die aus finanziellen<br />
<strong>und</strong> betrieblichen Gesichtspunkten geeignet sind.<br />
Die Arbeit wird fachlich durch die Firma NSB Niederelbe<br />
Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG<br />
(www.reederei-nsb.com) unterstützt.<br />
[153] Schwarz, Franz: Untersuchung der lüftungstechnischen<br />
Anlage auf einem Forschungsschiff (B,<br />
2012): Das Forschungsschiff POLARSTERN wird von<br />
der Reederei LAEISZ betrieben <strong>und</strong> bereedert<br />
(http://www.laeisz.de/flotte/forschung/polarstern.html).<br />
Die Raumluftklimaanlage <strong>und</strong> die lüftungstechnische<br />
Anlage ist 1982 für weltweite Fahrt unter höchsten Ansprüchen<br />
ausgelegt <strong>und</strong> dimensioniert worden. Zur<br />
Vorbereitung der Projektierung eines Nachfolgeschiffes<br />
ist eine Stärken-Schwächen-Analyse für diese Komponenten<br />
vorzunehmen. Dazu ist, die derzeitige Anlage zu<br />
beschreiben, Erfahrungen <strong>und</strong> Verbesserungsvorschläge<br />
abzuleiten sowie der aktuelle Stand der Vorschriften<br />
<strong>und</strong> Dimensionierungsvorgaben darzulegen. Einen besonderen<br />
Schwerpunkt soll hier die Maschinenraumbelüftung<br />
unter arktischen <strong>und</strong> subtropischen Bedingungen<br />
darstellen. Es sind Handlungsempfehlungen für<br />
den neuen Entwurf abzuleiten <strong>und</strong> hinsichtlich der Umsetzbarkeit<br />
zu bewerten. Die Arbeit wird fachlich durch<br />
die Reederei LAEISZ unterstützt.<br />
[154] Johannsen, Nussel: Machbarkeitsstudie für ein<br />
Windpumpensystem in einem Wohngebiet (MP,<br />
2012): Die Gemeinde Tarp plant im Neubaugebiet<br />
Schellenpark die Einbindung einer Seenstruktur. Im<br />
Rahmen des Planungsprozesses hat sich herausgestellt,<br />
dass aufgr<strong>und</strong> des Niederschlagangebotes, der<br />
Lage des Gr<strong>und</strong>wasserspiegels <strong>und</strong> der Verdunstungsraten<br />
hydraulischen Hebevorrrichtungen notwendig sein<br />
werden. Im Rahmen der Arbeit ist der hydraulische<br />
<strong>Leistungs</strong>bedarf <strong>und</strong> das Windenergieangebot über den<br />
Jahresgang darzustellen <strong>und</strong> quantitativ zu bewerten,<br />
die Eck- <strong>und</strong> Konstruktionsdaten des Windpumpensystems<br />
sind festzulegen <strong>und</strong> eine Marktrecherche durchzuführen,<br />
sowie Handlungsempfehlungen für die Gemeinde<br />
abzuleiten. Die Arbeit wird fachlich durch das<br />
Bauamt des Amtes Oeversee <strong>und</strong> das Planungsbüro<br />
INGENIEURGESELLSCHAFT NORD (IGN).<br />
[155] Kovalenko, Evgenij: Ein Beitrag zur Implementierung<br />
eines Wartungs- <strong>und</strong> Optimierungsplanes für<br />
den Schiffsbetrieb (B, 2012): Durch internationale<br />
Vorschriften (SOLAS, ISM, STCW, MEPC etc.) <strong>und</strong> betriebswirtschaftliche<br />
Zwänge (Vorgaben des Charterers,<br />
Marketing-Aspekte u.a.) steigen die Anforderungen an<br />
den sicheren, zuverlässigen, energieeffizienten <strong>und</strong><br />
umweltfre<strong>und</strong>lichen Schiffsbetrieb. Für den Nachweis,<br />
die Kontrolle <strong>und</strong> als Gr<strong>und</strong>lage für ständige Verbesserungen<br />
ist eine geeignete Dokumentation mit Entscheidungshilfen<br />
notwendig. Für ein exemplarisches Schiff<br />
ist daher ein elektronisch basierter Wartungs- <strong>und</strong> Performanceplan<br />
zu erstellen. Dazu sind die Vorgaben der<br />
Vorschriften <strong>und</strong> die betrieblichen Notwendigkeiten darzustellen,<br />
sowie geeignete Werkzeuge <strong>und</strong> Entscheidungsstrategien<br />
zu entwickeln. Dabei ist besonderen<br />
Wert auf die Darstellung des Produktentwicklungsprozesses<br />
2 sowie der einzelnen Entwicklungsphasen zu<br />
2 http://de.wikipedia.org/wiki/Produktentwicklung<br />
61<br />
legen. Die Arbeit wird fachlich durch das HAMBURGER<br />
INGENIEURKONTOR FÜR SCHIFFSTECHNIK,<br />
www.his-hh.de, unterstützt.<br />
[156] Böcker, Phillipp: Erfahrungen <strong>und</strong> Regelungsbedarfe<br />
zur Einführung von Gas als Schiffsbrennstoff (B,<br />
2012): Die Seeschifffahrt sieht sich einem zunehmenden<br />
gesellschaftlichen <strong>Dr</strong>uck zu Emissionsminderung<br />
ausgesetzt. Dabei könnte Gas als Schiffsbrennstoff eine<br />
mögliche, zukünftige Option darstellen. Dazu überarbeitet<br />
die IMO z.Zt. den IGF-Code (vgl. BLG17/8).<br />
Verschiedene Klassifikationsvorschriften haben dazu<br />
parallele Aktivitäten entwickelt. Die Normenstelle für<br />
Schiffs- <strong>und</strong> Meerestechnik (NSMT) plant ein Normungsprojekt<br />
in dieser Sache. Zur Vorbereitung des<br />
Workshops ist: (1) der aktuelle Stand des Wissens- <strong>und</strong><br />
der Technik darzustellen <strong>und</strong> zu bewerten sowie (2)<br />
Schlussfolgerungen für das Normungsprojekt zu ziehen<br />
<strong>und</strong> Handlungsempfehlungen abzuleiten. Die Arbeit<br />
wird fachlich durch die Normenstelle für Schiffs- <strong>und</strong><br />
Meerestechnik unterstützt: http://www.nsmt.din.de<br />
[157] Schumacher; Stephan. Implementierung des Umweltzeichens<br />
„Blauer Engel“ auf einem Luxus-<br />
Kreuzfahrtschiff; (B, 2012): Durch die Vergabe des<br />
Umweltzeichens für den umweltschonenden Schiffsbetrieb<br />
(RAL-UZ 110) sollen die durch ein Seeschiff hervorgerufenen<br />
Emissionen <strong>und</strong> Einträge von Schadstoffen<br />
in die Meeresumwelt reduziert werden. Um dieses<br />
Ziel zu erreichen, werden hohe Ansprüche an das Reedereimanagement,<br />
an die Schiffsausstattung sowie<br />
hauptsächlich an den Bordbetrieb <strong>und</strong> die Schiffstechnik<br />
gestellt: www.blauer-engel.de. Die Unternehmen der<br />
HANSA TREUHAND-Gruppe sind in verschiedenen<br />
Geschäftsfeldern der Schifffahrt tätig. U.a. werden die<br />
Rahsegel-Kreuzfahrtschiffe SEA CLOUD I <strong>und</strong> II durch<br />
das Unternehmen betrieben <strong>und</strong> bereedert:<br />
www.seacloud.com. Im Rahmen der Arbeit soll der Ist-<br />
Zustandes der Schiffe SEA CLOUD <strong>und</strong> SEA CLOUD II<br />
erfasst werden, die Implementierung der Umweltzeichen<br />
„umweltfre<strong>und</strong>liches Schiffsdesign“ (RAL-UZ 141)<br />
<strong>und</strong> „umweltschonender Schiffsbetrieb“ (RAL-UZ 110)<br />
ist zu prüfen <strong>und</strong> vorzubereiten. Geeignete Kennzahlen<br />
<strong>und</strong> Benchmark-Systeme sind zu entwickeln. Es sind<br />
betriebliche <strong>und</strong> konstruktive Handlungsoption <strong>und</strong> -<br />
empfehlungen zur Effizienzsteigerung <strong>und</strong> zur Ressourcenschonung<br />
abzuleiten, sowie mit einer Nutzwertanalyse<br />
zu bewerten. Für die Recherchearbeit ist ein<br />
Bordbesuch geplant. Die Arbeit wird fachlich durch die<br />
Firma HANSA SHIPPING GmbH & Co. KG unterstützt:<br />
www.hansashipping.de<br />
[158] Rösch, Frederik: Energieeinsparpotentiale durch<br />
Umrüstung eines Containerschiffes auf LED-<br />
Lampen (B, 2012): Die Energieeffizienz auf Handelsschiffen<br />
gewinnt zunehmend an Bedeutung. Am Beispiel<br />
eines Containerschiffes soll in direkter Zusammenarbeit<br />
mit einer Hamburger Reederei in einer Projekt-<br />
oder Abschlussarbeit das Energie-Einsparpotential<br />
mittels Einsatz von LED analysiert werden. Dabei soll<br />
einerseits der Energieverbrauch an sich, andererseits<br />
aber auch der Aufwand, den eine Umrüstung auch mit<br />
Blick auf alle notwendigen technischen Veränderungen<br />
mit sich bringen würde, untersucht werden. Des Weiteren<br />
soll dem Nutzen der Energieeinsparung die entstehenden<br />
Kosten gegenübergestellt werden. In einer<br />
Prognose ist der Effekt des Einsatzes von LED in einem<br />
vergleichbaren Neubau zu diskutieren. Die Arbeit wird<br />
fachlich vom DNV-Germany unterstützt: www.dnv.de<br />
[159] Last, Emanuel: Evaluation von Ölschlammdaten an<br />
Bord von Seeschiffen (B, 2012): Bei der Überprüfung<br />
von Seeschiffen in den Häfen (Port State Control) werden<br />
die Maschinentagebücher auch auf korrekte Angaben<br />
hinsichtlich der Entsorgung von Ölschlamm<br />
(sludge) kontrolliert. Bisher geht man davon aus, dass<br />
bei dem Betrieb von Seeschiffen mit Schwerölbetrieb<br />
Ölschlamm in der Größenordnung von 1% der Gesamt-
<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>.-<strong>Ing</strong>. Holger Watter Flensburg University of Applied Sciences<br />
verbrauchsmenge an Schweröl anfällt (1% Regel) <strong>und</strong><br />
entsprechend entsorgt werden muss. Bei der Port State<br />
Control wurden bei der Überprüfung der Schiffe Statistiken<br />
aufgebaut, die es nun ermöglichen, die 1% Regel<br />
zu überprüfen <strong>und</strong> ggf. zu korrigieren. Dier Statistiken<br />
wurden der FH Flensburg vom BSH für eine entsprechende<br />
Auswertung zur Verfügung gestellt, Teile der<br />
Datensätze wurden einer Anfangsevaluation unterzogen.<br />
Aufbauend auf dieser Evaluation <strong>und</strong> zusätzlichen<br />
Datensätzen, sowie Recherchen insbesondere zur<br />
Provinienz <strong>und</strong> zum Raffinerieprozess soll im Rahmen<br />
einer Abschlussarbeit die sogenannte “1%-Regel“ auf<br />
Stichhaltigkeit überprüft werden. Es sind die Einflussfaktoren<br />
(Herkunft, Raffinationsprozess, Ölqualität,<br />
Wassergehalt, Seperatortyp etc.) auf die Schlammmengen<br />
<strong>und</strong> –zusammensetzung evaluiert werden. Die<br />
Arbeit wird fachlich vom BSH unterstützt.<br />
[160] Röll, Hendrik: Dimensionierung, Minimierung des<br />
Raumbedarfes <strong>und</strong> des Energiebedarfes einer Ballastwasserbehandlungsanlage<br />
(MP, 2012): Aufgr<strong>und</strong><br />
internationaler Vorschriften <strong>und</strong> den daraus resultierenden<br />
Marktperspektiven fördert die WTSH (Wirtschaftsförderung<br />
<strong>und</strong> Technologietransfer Schleswig-Holstein<br />
GmbH) das Projekt CAVIPURE zur Entwicklung einer<br />
Ballastwasserbehandlungsanlage. Neben der FH<br />
Flensburg sind Unternehmungen aus Schleswig-<br />
Holstein beteiligt. Im derzeitigen Projektstatus ist eine<br />
50m³/h-Anlage entwickelt <strong>und</strong> erprobt worden. Die Projektplanung,<br />
Markterfordernisse <strong>und</strong> Erfahrungen aus<br />
der SMM 2012 zeigen die Notwendigkeit zur Entwicklung<br />
einer containerisierten, geometrisch <strong>und</strong> energetisch<br />
optimierten 200m³/h-Anlage. In der Projektarbeit<br />
ist (1) der aktuelle Stand darzustellen <strong>und</strong> zu bewerten,<br />
(2) eine 200m³/h-Anlage konstruktiv zu entwickeln sowie<br />
geometrische <strong>und</strong> energetische Einsparpotentiale<br />
zu analysieren. Es sind Handlungsempfehlungen für die<br />
Projektpartner abzuleiten.<br />
[161] Schade, Jan: Technische Potentialanalyse eines<br />
nano-BHKW anhand eines Bestandshauses (B,<br />
2012): Der Begriff nano-BHKW wird hier für Block-<br />
Heizkraftwerk verwendet, die eine maximale elektrische<br />
Leistung von 2,5kW aufweisen: Es soll eine technische<br />
Analyse durchgeführt werden, die zum Ziel hat zu ermitteln,<br />
welchen Beitrag ein nano-BHKW leisten kann, um<br />
ein Bestandshaus mit Energie zu versorgen. Das zu betrachtende<br />
exemplarische Haus wird von 4 Personen<br />
bewohnt <strong>und</strong> weist somit einen dynamischen Energiebedarf<br />
auf. Bei dem verwendeten nano-BHKW handelt<br />
es sich um einen Eigenentwurf, der während des Praktikums<br />
erarbeitet wurde/wird. Die Herausforderung bei<br />
der gestellten Aufgabe besteht darin, die im Haus auftretenden<br />
Energieströme zu ermitteln. Hierfür müssen<br />
die Wärmeverbräuche anhand der vorliegenden Brennstoffverbräuche<br />
der letzten Jahre, sowie der baulichen<br />
Eigenschaften des Hauses dargestellt werden. Durch<br />
Abgleich der vorhandenen Daten mit Datenmaterial des<br />
DWD (Temperaturverläufen, GTZ) wird ein möglichst<br />
genauer Verlauf der Wärmenachfrage erstellt. Anhand<br />
von Messungen der größten elektrischen Verbraucher<br />
<strong>und</strong> eine Befragung der Bewohner hinsichtlich des Benutzungsverhalten,<br />
sowie einer Abschätzung der restlichen<br />
elektrischen Verbräuche, soll ein detaillierter Verlauf<br />
der Nachfrage nach elektrischer Energie ermittelt<br />
werden. Auf Gr<strong>und</strong>lage dieses Datenmaterials wird eine<br />
Analyse durchgeführt, wie es möglich sein soll, einen<br />
größtmöglichen Teil der im Haus nachgefragten Energien<br />
mit Hilfe des genannten nano-BHKW selbst zu erzeugen.<br />
Ob das BHKW Strom-oder Wärmegeführt gefahren<br />
werden kann? Welche Größe eines Pufferspeicher<br />
sinnvoll ist? Ob das BHKW ausreicht die Wärme<br />
zu liefern oder ob ein zusätzlicher Brenner nötig ist. Die<br />
Arbeit wird fachlich durch die Firma KRAFT-WÄRME-<br />
KONZEPTE GmbH (KWKon GmbH, www.kwkon.com)<br />
unterstützt.<br />
62<br />
[162] Jessen, Christine: Risikobewertung von Rohrleitungen<br />
mit Fokus auf Offshore Pipelines (B, 2012):<br />
Ziel der Arbeit ist es, das bereits bestehende Risikokonzept<br />
des Germanischen Lloyds mit den aktuellen<br />
Regularien <strong>und</strong> weiteren der Literatur entnommenen<br />
Risikomodellen zu vergleichen. Des Weiteren soll untersucht<br />
werden in wie weit die Restlebensdauer für die<br />
Abschätzung der Fehlerwahrscheinlichkeit einer Rohrleitung<br />
herangezogen werden kann. Hierzu ist zunächst<br />
eine Literaturrecherche zu den aktuelle Regelwerken<br />
(API; ASME, NACE, DNV) anzufertigen. Die Risikobewertung<br />
von Rohrleitung erfolgt i.a. mit Computerprogrammen.<br />
Basierend auf einer Recherche der am Markt<br />
angebotenen Programme sollen weitere Risikobewertungsmethoden<br />
identifiziert werden. Diese sollen kurz<br />
zusammenfassend dargestellt werden. Im zweiten Teil<br />
der Arbeit soll der Einfluss der Restlebensdauer auf die<br />
Fehlerwahrscheinlichkeit untersucht werden. Bei den<br />
vom Germanischen Lloyd bewerteten über 80 Rohrleitungen<br />
sollen die „Remaining Life Time“ <strong>und</strong> die mit der<br />
Index-Prozedur ermittelten Ausfallwahrscheinlichkeiten<br />
verglichen werden. Die Arbeit wird fachlich durch den<br />
Germanischen Lloyd (http://www.gl-group.com) betreut.<br />
[163]