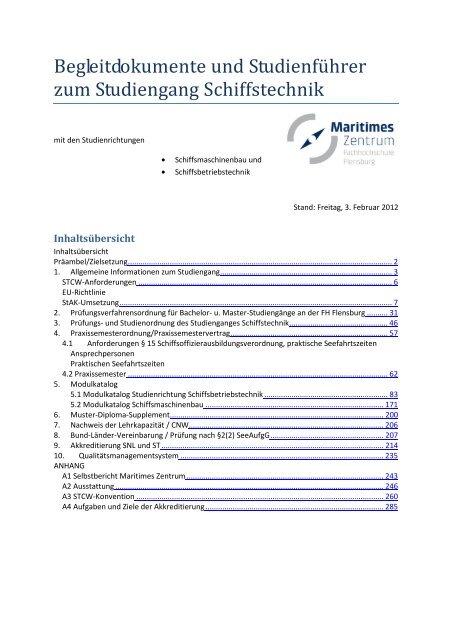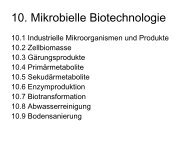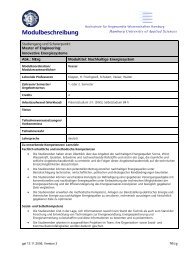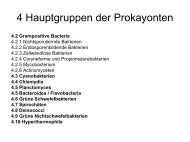Begleitdokumente und Studienführer zum Studiengang Schiffstechnik
Begleitdokumente und Studienführer zum Studiengang Schiffstechnik
Begleitdokumente und Studienführer zum Studiengang Schiffstechnik
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Begleitdokumente</strong> <strong>und</strong> <strong>Studienführer</strong><br />
<strong>zum</strong> <strong>Studiengang</strong> <strong>Schiffstechnik</strong><br />
mit den Studienrichtungen<br />
• Schiffsmaschinenbau <strong>und</strong><br />
• Schiffsbetriebstechnik<br />
Stand: Freitag, 3. Februar 2012<br />
Inhaltsübersicht<br />
Inhaltsübersicht<br />
Präambel/Zielsetzung .............................................................................................................................. 2<br />
1. Allgemeine Informationen <strong>zum</strong> <strong>Studiengang</strong> .................................................................................. 3<br />
STCW-Anforderungen ......................................................................................................................... 6<br />
EU-Richtlinie<br />
StAK-Umsetzung .................................................................................................................................. 7<br />
2. Prüfungsverfahrensordnung für Bachelor- u. Master-Studiengänge an der FH Flensburg .......... 31<br />
3. Prüfungs- <strong>und</strong> Studienordnung des <strong>Studiengang</strong>es <strong>Schiffstechnik</strong> ............................................... 46<br />
4. Praxissemesterordnung/Praxissemestervertrag ........................................................................... 57<br />
4.1 Anforderungen § 15 Schiffsoffizierausbildungsverordnung, praktische Seefahrtszeiten<br />
Ansprechpersonen<br />
Praktischen Seefahrtszeiten<br />
4.2 Praxissemester ............................................................................................................................ 62<br />
5. Modulkatalog<br />
5.1 Modulkatalog Studienrichtung Schiffsbetriebstechnik ........................................................... 83<br />
5.2 Modulkatalog Schiffsmaschinenbau ..................................................................................... 171<br />
6. Muster-Diploma-Supplement...................................................................................................... 200<br />
7. Nachweis der Lehrkapazität / CNW ............................................................................................. 206<br />
8. B<strong>und</strong>-Länder-Vereinbarung / Prüfung nach §2(2) SeeAufgG ...................................................... 207<br />
9. Akkreditierung SNL <strong>und</strong> ST .......................................................................................................... 214<br />
10. Qualitätsmanagementsystem ................................................................................................. 235<br />
ANHANG<br />
A1 Selbstbericht Maritimes Zentrum .............................................................................................. 243<br />
A2 Ausstattung ................................................................................................................................ 246<br />
A3 STCW-Konvention ...................................................................................................................... 260<br />
A4 Aufgaben <strong>und</strong> Ziele der Akkreditierung ..................................................................................... 285
Präambel/Zielsetzung<br />
Die vorliegende Dokumentation fasst alle relevanten Informationen <strong>und</strong> Dokumente <strong>zum</strong><br />
<strong>Studiengang</strong> „<strong>Schiffstechnik</strong>“ (mit den Vertiefungsrichtungen Schiffsmaschinenbau <strong>und</strong><br />
Schiffsbetriebstechnik) zusammen.<br />
Wegen der Komplexität der internationalen, europäischen, nationalen <strong>und</strong> hochschulrechtlichen<br />
Vorgaben im Seefahrtsbildungswesen soll es der internen <strong>und</strong> externen Kommunikation dienen. Es<br />
soll einen Überblick über die wesentlichen Rechtsdokumente <strong>und</strong> deren Verknüpfungen geben.<br />
Es unterliegt nicht dem Berichtigungswesen.<br />
1. Allgemeine Informationen <strong>zum</strong> <strong>Studiengang</strong><br />
http://www.fh-flensburg.de/fhfl/schiffstechnik.html<br />
Vgl. Anhang:<br />
Maritimes Zentrum www.fh-flensburg.de/mz<br />
Ausstattung www.fh-flensburg.de/ima
<strong>Schiffstechnik</strong> :: Fachhochschule Flensburg<br />
Fachhochschule Flensburg<br />
University of Applied Sciences Flensburg<br />
Kanzleistrasse 91-93<br />
D-24943 Flensburg<br />
Germany<br />
Telefon: +49 (0)461 805 01<br />
Telefax: +49 (0)461 805 1300<br />
URI:http://www.fh-flensburg.de/<br />
Online-Einschreibung<br />
Hier gelangen sie zur Online-Einschreibung.<br />
Change language<br />
Kurzinfos<br />
Zulassungsvoraussetzungen<br />
Schwerpunkt Schiffsbetriebstechnik<br />
Allgemeine Hochschulreife (Abitur) oder Fachhochschulreife. Abschluss einer<br />
Schiffsmechanikerausbildung oder Abschluss in einem anerkannten metall- oder<br />
elektrotechnischen Ausbildungsberuf <strong>und</strong> 12 Monate Fahrzeit als Fachkraft des<br />
Maschinendienstes oder Ausbildung als Technischer Offiziersassistent (18 Monate) oder<br />
Werkstattpraktikum (6 Monate) für das Praktikumsmodell.<br />
Schwerpunkt Schiffsmaschinenbau<br />
Allgemeine Hochschulreife oder Fachhochschulreife.<br />
Bewerbungsfristen:<br />
Bewerbungsfrist für das Wintersemester ist der 15. Juli des jeweiligen Jahres oder für das<br />
erste Praxissemester (Praktikumsmodell) im Sommersemester der 15. Januar des jeweiligen<br />
Jahres.<br />
Studiendauer<br />
Das Studium dauert für jeden der beiden Schwerpunkte 7 Semester.<br />
Studienabschlüsse:<br />
Schwerpunkt Schiffsmaschinenbau<br />
„Bachelor of Engineering“<br />
Schwerpunkt Schiffsbetriebstechnik<br />
„Bachelor of Engineering“ <strong>und</strong> Befähigungszeugnis als „Technischer Wachoffizier“ auf<br />
Schiffen aller Art <strong>und</strong> Größe<br />
Dokumente <strong>zum</strong> Download:<br />
• Flyer <strong>Schiffstechnik</strong> Schwerpunkt Schifffsbetriebstechnik als PDF-Download<br />
• Flyer <strong>Schiffstechnik</strong> Schwerpunkt Schiffsmaschinenbau als PDF-Download<br />
Kontakt<br />
http://www.fh-flensburg.de/fhfl/schiffstechnik.html<br />
Seite 1 von 3<br />
14.11.2011
<strong>Schiffstechnik</strong> :: Fachhochschule Flensburg<br />
Fachliche Studienberatung:<br />
Prof. Dr.-Ing. Holger Watter<br />
Telefon: +49 (0)461 805-1339<br />
Allgemeine Studienberatung:<br />
Nadine Heubeck<br />
Studienberatung Seefahrtstudiengänge an der Fachhochschule Flensburg<br />
Telefon: +49 (0)461 805-1523<br />
Telefax: +49 (0)461 805-1300<br />
Sprechzeiten<br />
Beratungstermine nur nach vorheriger Absprache!<br />
Praktikantenbörse FH / MLP<br />
Sie suchen ein Praktikum - oder die Möglichkeit, Ihre Bachelor-/Masterarbeit in einem<br />
Unternehmen zu schreiben? Dann klicken Sie hier.<br />
<strong>Schiffstechnik</strong><br />
Der <strong>Studiengang</strong> <strong>Schiffstechnik</strong> stellt eine Weiterführung des <strong>Studiengang</strong>es<br />
Schiffsbetriebstechnik/Schiffsbetrieb dar. Der ehemalige Diplomstudiengang wird in einen<br />
Bachelor- <strong>Studiengang</strong> überführt <strong>und</strong> erweitert um den Schwerpunkt Schiffsmaschinenbau.<br />
Schwerpunkt Schiffsbetriebstechnik<br />
Ziel des Studiums ist es, die Befähigung zu einer auf wissenschaftlicher Gr<strong>und</strong>lage<br />
beruhenden, selbständigen Tätigkeit als technischer Wachoffizier <strong>und</strong> später Leiter/Leiterin<br />
der Maschinenanlage zu erwerben.<br />
Mit dem Abschluss des Studiums der Schiffsbetriebstechnik erfüllen die Studierenden die<br />
Voraussetzungen nach § 15 SchOffzAusbV zur Erteilung des Befähigungszeugnisses <strong>zum</strong><br />
technischen Schiffsoffizier.<br />
Flensburger Schiffsingenieure/ Schiffsingenieurinnen haben in der Wirtschaft einen sehr<br />
guten Ruf <strong>und</strong> damit zurzeit hervorragende Chancen auf dem Arbeitsmarkt.<br />
Das Berufsfeld der Flensburger Schiffsbetriebstechnik- Ingenieure <strong>und</strong> – Ingenieurinnen<br />
lässt sich beispielhaft wie folgt beschreiben:<br />
technischer Wachoffizier <strong>und</strong> später Leiter/Leiterin der Maschinenanlage auf Seeschiffen in<br />
weltweiter Fahrt, Ingenieur/in für Offshore- Anlagen, Reedereiinspektionen, maritime<br />
Zulieferindustrie, Werften, Energie-Versorgungsunternehmen, Kraftwerke, Raffinerien,<br />
Chemiebetriebe, Betriebs- <strong>und</strong> Vertriebsingenieur/in, Sachverständige in<br />
Klassifikationsgesellschaften oder Technische Überwachungsvereine,<br />
Berufsgenossenschaften, Havarie- <strong>und</strong> Versicherungsbüros.<br />
http://www.fh-flensburg.de/fhfl/schiffstechnik.html<br />
Seite 2 von 3<br />
14.11.2011
<strong>Schiffstechnik</strong> :: Fachhochschule Flensburg<br />
Schwerpunkt Schiffsmaschinenbau<br />
Schon seit längerem ist an der FH Flensburg <strong>und</strong> mit Vertretern der Industrie über die-<br />
Einführung eines <strong>Studiengang</strong>es Schiffsmaschinenbau mit konstruktivem Schwerpunkt <strong>und</strong><br />
großem Praxisbezug diskutiert worden.<br />
Dieser <strong>Studiengang</strong> wird eingerichtet, um auch Studenten, die sich mit dem maritimen<br />
Umfeld verb<strong>und</strong>en fühlen, jedoch nicht unbedingt zur See fahren wollen oder die<br />
ges<strong>und</strong>heitlichen Voraussetzungen nicht erfüllen, ein Studium zur Aufnahme eines Berufes<br />
im maritimen Sektor zu ermöglichen.<br />
Die Berufsfelder von Absolventen dieses <strong>Studiengang</strong>es liegen hauptsächlich in Werften,<br />
Klassifikationsgesellschaften <strong>und</strong> bei maritimen Zulieferern, als Bauaufsicht,<br />
Sachverständige oder Konstruktionsingenieure in der Anlagentechnik wie <strong>zum</strong> Beispiel Kälte-<br />
, Pumpen- oder Frischwassererzeuger-anlagen.<br />
Auch hier bestehen zurzeit hervorragende Aussichten auf dem Arbeitsmarkt.<br />
Zulassungsvoraussetzungen <strong>und</strong> Curriculum<br />
Für beide Schwerpunkte ist die Allgemeine Hochschul- oder die Fachhochschulreife generelle<br />
Zugangsvoraussetzung.<br />
Für den Schwerpunkt „Schiffsmaschinenbau“ ist bisher kein Praktikum vorgesehen.<br />
Vor Beginn des Studiums im Schwerpunkt „Schiffsbetriebstechnik“ ist der erfolgreiche<br />
Abschluss einer Schiffsmechanikerausbildung oder der erfolgreiche Abschluss in einem<br />
anerkannten Beruf der Metall- oder Elektrotechnik <strong>und</strong> 12 Monate Fahrzeit als Fachkraft des<br />
Maschinendienstes auf Schiffen oder der erfolgreiche Abschluss einer Ausbildung als<br />
Technischer Offiziersassistent von 18 Monaten Dauer oder ein Praktikum in der<br />
Metallbearbeitung von 6 Monaten Dauer (Praktikumsmodell) nachzuweisen.<br />
Eine Liste der anerkannten Berufe der Metall- oder Elektrotechnik finden Sie auf den Seiten<br />
des B<strong>und</strong>esamtes für Seeschifffahrt <strong>und</strong> Hydrographie unter der Adresse www.bsh.de,<br />
Informationen zur Schiffsmechanikerausbildung erhalten Sie bei der Berufsbildungsstelle<br />
Seeschifffahrt in Bremen unter der Anschrift www.berufsbildung-see.de. Angaben über das<br />
Curriculum finden Sie in den Informationsbroschüren als pdf - Datei im Downloadbereich.<br />
http://www.fh-flensburg.de/fhfl/schiffstechnik.html<br />
Seite 3 von 3<br />
14.11.2011
STCW-Anforderungen<br />
http://www.imo.org/about/conventions/listofconventions/pages/international-convention-onstandards-of-training,-certification-and-watchkeeping-for-seafarers-%28stcw%29.aspx<br />
EU-Richtlinie<br />
Änderung der Richtlinie 2008/106/EG des Europäischen Parlaments <strong>und</strong> des Rates<br />
über Mindestanforderungen für die Ausbildung von Seeleuten:<br />
http://www.b<strong>und</strong>esrat.de/cln_161/SharedDocs/Drucksachen/2011/0501-600/544-<br />
11,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/544-11.pdf<br />
StAK-Umsetzung<br />
Umsetzungvorschlag der Ständigen Arbeitsgemeinschaft der Küstenländer (StAK)<br />
(vgl. Anhang)
Function: Marine engineering at the operational level<br />
Table A-III/1 <strong>und</strong> A-III/2<br />
Column 1 Column 2 HS Wismar (Warnemünde) FH Flensburg HS Bremerhaven<br />
Competence Knowledge, <strong>und</strong>erstanding and<br />
proficiency<br />
Maintain a safe<br />
engineering<br />
watch<br />
Thorough knowledge of Principles<br />
to be observed in keeping an<br />
engineering watch, including:<br />
.1 duties associated with taking<br />
over and accepting a watch<br />
.2 routine duties <strong>und</strong>ertaken during<br />
a watch<br />
.3 maintenance of the machinery<br />
space logs and the significance<br />
of the readings taken<br />
.4 duties associated with handing<br />
over a watch<br />
Safety and emergency procedures;<br />
change-over of remote/automatic to<br />
local control of all systems<br />
Safety precautions to be observed<br />
during a watch and immediate<br />
actions to be taken in the event of<br />
fire or accident, with particular<br />
reference to oil systems<br />
Technische Betriebsführung<br />
Komplexer Schiffsbetrieb<br />
Schiffsautomatisierung<br />
Komplexer Schiffsbetrieb<br />
Schiffsmaschinenanlagen<br />
Branschutz<br />
Technische Betriebsführung<br />
Kenntnisse <strong>und</strong> Fähigkeiten für die<br />
Betriebsführungsebene werden in<br />
der praktischen Seefahrtszeit<br />
angelegt (Training Record Book,<br />
Sicherheitslehrgang, Lehrpläne der<br />
Schiffsmechanikausbildung) <strong>und</strong><br />
durch theoretische Kenntnisse im<br />
Studium anlagenspezifisch vertieft.<br />
Überwachung Schiffsbetrieb<br />
(Maschinenraumsimulator)<br />
Sicherheitslehrgang,<br />
Bordeinweisung<br />
Praktische Ausbildung<br />
Personalführung (Vorschriften etc.)<br />
Übungen am<br />
Schiffsmaschinensimulator<br />
Automation<br />
Übungen am<br />
Schiffsmaschinensimulator<br />
Brandschutzausbildung<br />
Sicherheitslehrgang<br />
Praktische Ausbildung<br />
1
Column 1 Column 2 HS Wismar (Warnemünde) FH Flensburg HS Bremerhaven<br />
Competence Knowledge, <strong>und</strong>erstanding and<br />
proficiency<br />
Maintain a safe<br />
engineering<br />
watch<br />
(continued)<br />
Use English in<br />
written and<br />
oral form<br />
Use internal<br />
communication<br />
systems<br />
Engine-room resource management<br />
Knowledge of engine-room resource<br />
management principles, including:<br />
.1 allocation, assignment, and<br />
prioritization of resources<br />
.2 effective communication<br />
.3 assertiveness and leadership<br />
.4 obtaining and maintaining<br />
situational awareness<br />
.5 Consideration of team<br />
experience<br />
Adequate knowledge of the English<br />
language to enable the officer to use<br />
engineering publications and to<br />
perform engineering duties<br />
Operation of all internal<br />
communication systems on board<br />
Technische Betriebsführung<br />
Maritime Kommunikation<br />
Personalführung/Sicherheit<br />
Personalführung/Sicherheit<br />
Technische Betriebsführung<br />
Projektwoche<br />
Maritime Kommunikation<br />
Komplexer Schiffsbetrieb<br />
Projektwoche<br />
Betriebsorganisation:<br />
- Instandhaltung<br />
- Personalführung<br />
- Überwachung Schiffsbetrieb<br />
- Englisch<br />
Anlagenspezifische Kenntnisse:<br />
- Betriebsstoffe<br />
- Arbeitsmaschinen<br />
- Anlagentechnik<br />
- Elektrische Anlagen<br />
- Elektrische Maschinen<br />
- Dampfanlagen<br />
- Verbrennungskraftmaschinen<br />
Personalführung/Sicherheit<br />
Instandhaltung<br />
Anlagenspezifische<br />
Ausbildungsfächer<br />
- Englisch Maritimes Englisch<br />
- Bordausbildung<br />
- Sicherheitslehrgang<br />
Praktische Ausbildung<br />
Sicherheitslehrgang<br />
Leittechnik<br />
2
Column 1 Column 2 HS Wismar (Warnemünde) FH Flensburg HS Bremerhaven<br />
Competence Knowledge, <strong>und</strong>erstanding and<br />
proficiency<br />
Operate main<br />
and auxiliary<br />
machinery and<br />
associated<br />
control systems<br />
Basic construction and operation<br />
principles of machinery systems,<br />
including:<br />
.1 marine diesel engine<br />
.2 marine steam turbine<br />
.3 marine gas turbine<br />
.4 marine boiler<br />
.5 shafting installations, including<br />
propeller<br />
.6 other auxiliaries, including<br />
various pumps, air compressor,<br />
purifier, fresh water generator,<br />
heat exchanger, refrigeration,<br />
air-conditioning and ventilation<br />
systems<br />
.7 steering gear<br />
.8 automatic control systems<br />
.9 fluid flow and characteristics of<br />
lubricating oil, fuel oil and<br />
cooling systems<br />
.10 deck machinery<br />
Verbrennungsmotoren Turbinen<br />
Dampftechnik<br />
Schiffsmaschinenanlagen<br />
Arbeitsmaschinen<br />
Maritime Versorgungssysteme<br />
Kälte-, Klimatechnik<br />
Schiffsmaschinenanlagen<br />
Maritime Versorgungssysteme<br />
Schiffsautomatisierung<br />
Arbeitsmaschinen<br />
Maritime Versorgungssysteme<br />
Schiffsmaschinenanlagen<br />
Decksmaschinen<br />
Anlagenspezifische Kenntnisse:<br />
- Betriebsstoffe<br />
- Arbeitsmaschinen<br />
- Anlagentechnik<br />
- Elektrische Analagen<br />
- Dampfanlagen<br />
- Verbrennungskraftmaschinen<br />
- Überwachung Schiffsbetrieb<br />
- Wellenleitung, Kupplungen <strong>und</strong><br />
Getriebe<br />
- Gr<strong>und</strong>lagen Schiffbau<br />
- Strömungsmechanik<br />
- Leittechnik<br />
Verbrennungskraftmaschinen u.<br />
Anlagen<br />
Dampftechnik<br />
Arbeitsmaschinen<br />
Kältetechnik<br />
Automation<br />
Strömungslehre<br />
3
Column 1 Column 2 HS Wismar (Warnemünde) FH Flensburg HS Bremerhaven<br />
Competence Knowledge, <strong>und</strong>erstanding and<br />
proficiency<br />
Operate main<br />
and auxiliary<br />
machinery and<br />
associated<br />
control systems<br />
(continued)<br />
Safety and emergency procedures<br />
for operation of propulsion plant<br />
machinery, including control<br />
systems<br />
Preparation, operation, fault<br />
detection and necessary measures to<br />
prevent damage for the following<br />
machinery items and control<br />
systems:<br />
.1 main engine and associated<br />
auxiliaries<br />
.2 steam boiler and associated<br />
auxiliaries and steam systems<br />
.3 auxiliary prime movers and<br />
associated systems<br />
.4 other auxiliaries, including<br />
refrigeration, air-conditioning<br />
and ventilation systems<br />
Schiffsdieselmotoren <strong>und</strong> Anlagen<br />
Dampftechnik<br />
Verbrennungsmotoren/Turbinen<br />
Elektrische Maschinen<br />
Arbeitsmaschinen<br />
Schiffsmaschinenanlagen<br />
Anlagenspezifische Kenntnisse:<br />
- Betriebsstoffe<br />
- Arbeitsmaschinen<br />
- Anlagentechnik<br />
- Elektrische Anlagen,<br />
Mittelspannung<br />
- Elektrische Maschinen<br />
- Dampfanlagen<br />
- Verbrennungskraftmaschinen<br />
- Überwachung Schiffsbetrieb<br />
- Maschinendynamik<br />
Verbrennungskraftmaschinen u.<br />
Anlagen<br />
Dampftechnik<br />
Arbeitsmaschinen<br />
Kältetechnik<br />
Strömungslehre<br />
Automation<br />
4
Column 1 Column 2 HS Wismar (Warnemünde) FH Flensburg HS Bremerhaven<br />
Competence Knowledge, <strong>und</strong>erstanding and<br />
proficiency<br />
Operate fuel,<br />
lubrication,<br />
ballast and<br />
other pumping<br />
systems and<br />
associated<br />
control systems<br />
Operational characteristics of pumps<br />
and piping systems, including<br />
control systems<br />
Operation of pumping systems:<br />
.1 routine pumping operations<br />
.2 operation of bilge, ballast and<br />
cargo pumping systems<br />
Oily-water separators (or similar<br />
equipment) requirements and<br />
operation<br />
Function: Marine engineering at the management level<br />
Arbeitsmaschinen<br />
Arbeitsmaschinen<br />
Technische Betriebsführung<br />
Schiffsmaschinenanlagen<br />
Anlagenspezifische Kenntnisse:<br />
- Betriebsstoffe<br />
- Arbeitsmaschinen<br />
- Anlagentechnik<br />
- Elektrische Anlagen<br />
- Elektrische Maschinen<br />
- Dampfanlagen<br />
- Verbrennungskraftmaschinen<br />
- Überwachung Schiffsbetrieb<br />
Arbeitsmaschinen<br />
Betriebstoffe<br />
Strömungslehre<br />
Column 1 Column 2 HS Wismar (Warnemünde) HS Bremerhaven<br />
Competence Knowledge, <strong>und</strong>erstanding and<br />
Manage the<br />
operation of<br />
propulsion<br />
plant<br />
machinery<br />
Plan and<br />
schedule<br />
operations<br />
proficiency<br />
Design features, and operative<br />
mechanism of the following<br />
machinery and associated<br />
auxiliaries:<br />
.1 marine diesel engine<br />
.2 marine steam turbine<br />
.3 marine gas turbine<br />
.4 marine steam boiler<br />
Theoretical knowledge<br />
Thermodynamics and heat<br />
transmission<br />
Verbrennungsmotoren./Turbinen<br />
Dieselmotoren <strong>und</strong> Anlagen<br />
Dampftechnik<br />
Thermodynamik<br />
Anlagenspezifische Kenntnisse:<br />
- Betriebsstoffe<br />
- Arbeitsmaschinen<br />
- Anlagentechnik<br />
- Elektrische Anlagen<br />
- Dampfanlagen<br />
- Verbrennungskraftmaschinen<br />
- Überwachung Schiffsbetrieb<br />
- Maschinendynamik<br />
Fachkenntnisse:<br />
- Thermodynamik<br />
- Technische Mechanik<br />
Verbrennungskraftmaschinen u.<br />
Anlagen<br />
Maschinendynamik<br />
Dampftechnik<br />
Thermodynamik<br />
5
Column 1 Column 2 HS Wismar (Warnemünde) HS Bremerhaven<br />
Competence Knowledge, <strong>und</strong>erstanding and<br />
proficiency<br />
Mechanics and hydromechanics<br />
Propulsive characteristics of diesel<br />
engines, steam and gas turbines,<br />
including speed, output and fuel<br />
consumption<br />
Heat cycle, thermal efficiency and<br />
heat balance of the following:<br />
.1 marine diesel engine<br />
.2 marine steam turbine<br />
.3 marine gas turbine<br />
.4 marine steam boiler<br />
Refrigerators and refrigeration cycle<br />
Physical and chemical properties of<br />
fuels and lubricants<br />
Technology of materials<br />
Naval architecture and ship<br />
construction, including damage<br />
control<br />
Technische Mechanik<br />
Verbrennungsmotoren./Turbinen<br />
Dampftechnik<br />
Kälte-, Klimatechnik<br />
Chemie Gefahrstoffe<br />
Betriebsstoffe<br />
Werkstofftechnik<br />
Schiffbau/Schiffstheorie<br />
- Grdl. Werkstofftechnik<br />
- Dienst auf Tankschiffen<br />
- Schiffbau<br />
- Automatisierungstechnik/Leittechnik<br />
- Strömungsmechanik<br />
- Physik<br />
Anlagenspezifische Kenntnisse:<br />
- Instandhaltung<br />
- Betriebsstoffe<br />
- Arbeitsmaschinen<br />
- Anlagentechnik<br />
- Elektrische Anlagen<br />
- Elektrische Maschinen<br />
- Dampfanlagen<br />
- Verbrennungskraftmaschinen<br />
- Überwachung Schiffsbetrieb<br />
- Gr<strong>und</strong>lagen Schiffbau<br />
- Schiffssicherheit<br />
Technische Mechanik<br />
Strömungslehre<br />
Verbrennungskraftmaschinen u.<br />
Anlagen<br />
Dampftechnik<br />
Kältetechnik<br />
Betriebstoff /Gefahrstoffe<br />
Werkstofftechnik<br />
Schiffbau<br />
6
Column 1 Column 2 HS Wismar (Warnemünde) HS Bremerhaven<br />
Competence Knowledge, <strong>und</strong>erstanding and<br />
Operation,<br />
surveillance,<br />
performance<br />
assessment and<br />
maintaining<br />
safety of<br />
propulsion<br />
plant and<br />
auxiliary<br />
machinery<br />
Manage fuel,<br />
lubrication and<br />
ballast<br />
operations<br />
proficiency<br />
Practical knowledge<br />
Start up and shut down main<br />
propulsion and auxiliary machinery,<br />
including associated systems<br />
Operating limits of propulsion plant<br />
The efficient operation, surveillance,<br />
performance assessment and<br />
maintaining safety of propulsion<br />
plant and auxiliary machinery<br />
Functions and mechanism of<br />
automatic control for main engine<br />
Functions and mechanism of<br />
automatic control for auxiliary<br />
machinery including but not limited<br />
to:<br />
.1 generator distribution systems<br />
.2 steam boilers<br />
.3 oil purifier<br />
.4 refrigeration system<br />
.5 pumping and piping systems<br />
.6 steering gear system<br />
.7 cargo-handling equipment and<br />
deck machinery<br />
Operation and maintenance of<br />
machinery, including pumps and<br />
piping systems<br />
Technische Betriebsführung<br />
Komplexer Schiffsbetrieb<br />
Schiffsdieselmotoren <strong>und</strong> Anlagen<br />
Dampftechnik<br />
Schiffsmaschinenanlagen<br />
Automatisierungstechnik<br />
Schiffsautomatisierung<br />
Schiffsdieselmotoren <strong>und</strong> Anlagen<br />
Schiffsautomatisierung<br />
Technische Betriebsführung<br />
Komplexer Schiffsbetrieb<br />
Kenntnisse <strong>und</strong> Fähigkeiten für die<br />
Betriebsführungsebene werden in<br />
der praktischen Seefahrtszeit<br />
angelegt (Training Record Book,<br />
Sicherheitslehrgang, Lehrpläne der<br />
Schiffsmechanikausbildung) <strong>und</strong><br />
durch theoretische Kenntnisse im<br />
Studium anlagenspezifisch vertieft.<br />
Fachkenntnisse:<br />
- Thermodynamik<br />
- Technische Mechanik<br />
- Grlg. Werkstofftechnik<br />
- Dienst auf Tankschiffen<br />
- Schiffbau<br />
- Automatisierungstechnik/Leittechnik<br />
- Regelungstechnik<br />
Anlagenspezifische Kenntnisse:<br />
- Instandhaltung<br />
- Betriebsstoffe<br />
- Arbeitsmaschinen<br />
- Anlagentechnik<br />
- Elektrische Anlagenotechnik<br />
- Dampfanlagen<br />
- Verbrennungskraftmaschinen<br />
- Überwachung Schiffsbetrieb<br />
- Maschinendynamik<br />
- Arbeitsmaschinen<br />
- Anlagentechnik<br />
- Betriebsstoffe<br />
- Instandhaltung<br />
Praktische Ausbildung<br />
Übungen am<br />
Schiffsmaschinensimulator<br />
Theoretische Kenntnisse:<br />
Thermodynamik<br />
Techn. Mechanik,<br />
Maschinendynamik<br />
Verbrennungskraftmaschinen, Anl.<br />
Arbeitsmaschinen<br />
Instandhaltung<br />
Automation<br />
Verbrennungskraftmaschinen, Anl.<br />
Automation<br />
Arbeitsmaschinen<br />
Kältetechnik<br />
Arbeitmaschinen<br />
Instandhaltung<br />
Betriebstoffe<br />
Strömungslehre<br />
7
Function: Electrical, electronic and control engineering at the operational level<br />
Column 1 Column 2 HS Wismar (Warnemünde) HS Bremerhaven<br />
Competence Knowledge, <strong>und</strong>erstanding and<br />
Operate<br />
electrical,<br />
electronic and<br />
control systems<br />
proficiency<br />
Basic configuration and operation<br />
principles of the following electrical,<br />
electronic and control equipment:<br />
.1 electrical equipment:<br />
.a generator and distribution<br />
systems<br />
.b preparing, starting, paralleling<br />
and changing over generators<br />
.c electrical motors including<br />
starting methodologies<br />
.d high-voltage installations<br />
.e sequential control circuits and<br />
associated system devices<br />
.2 electronic equipment:<br />
.a characteristics of basic electronic<br />
circuit elements<br />
.b flowchart for automatic and<br />
control systems<br />
.c functions, characteristics and<br />
features of control systems for<br />
machinery items, including main<br />
propulsion plant operation<br />
control and steam boiler<br />
automatic controls<br />
.3 control systems:<br />
.a various automatic control<br />
methodologies and<br />
characteristics<br />
.b Proportional–Integral–<br />
Derivative (PID) control<br />
characteristics and associated<br />
system devices for process<br />
control<br />
Schiffselektrotechnik<br />
Schiffsautomatisierung<br />
Mess- <strong>und</strong> Regelungstechnik<br />
Schiffsautomatisierung<br />
Kenntnisse <strong>und</strong> Fähigkeiten für die<br />
Betriebsführungsebene werden in<br />
der praktischen Seefahrtszeit<br />
angelegt (Training Record Book,<br />
Sicherheitslehrgang, Lehrpläne der<br />
Schiffsmechanikausbildung) <strong>und</strong><br />
durch theoretische Kenntnisse im<br />
Studium anlagenspezifisch vertieft.<br />
Fachkenntnisse:<br />
- Elektrotechnik<br />
- Elektrische Anlagen<br />
- Automatisierungstechnik/Leittechnik<br />
- Überwachung Schiffsbetrieb<br />
- Elektrische Maschinen<br />
- Mittelspannung<br />
- Regelungstechnik<br />
Elektrotechnik<br />
Elektrische Maschinen u.<br />
Anlagen<br />
Leistungselektronik<br />
Automation<br />
Regelungstechnik, Meßtechnik<br />
8
Column 1 Column 2 HS Wismar (Warnemünde) HS Bremerhaven<br />
Competence Knowledge, <strong>und</strong>erstanding and<br />
Maintenance<br />
and repair of<br />
electrical and<br />
electronic<br />
equipment<br />
proficiency<br />
Safety requirements for working on<br />
shipboard electrical systems,<br />
including the safe isolation of<br />
electrical equipment required before<br />
personnel are permitted to work on<br />
such equipment<br />
Maintenance and repair of electrical<br />
system equipment, switchboards,<br />
electric motors, generator and DC<br />
electrical systems and equipment<br />
Detection of electric malfunction,<br />
location of faults and measures to<br />
prevent damage<br />
Construction and operation of<br />
electrical testing and measuring<br />
equipment<br />
Function and performance tests of<br />
the following equipment and their<br />
configuration:<br />
.1 monitoring systems<br />
.2 automatic control devices<br />
.3 protective devices<br />
The interpretation of electrical and<br />
simple electronic diagrams<br />
Schiffselektrotechnik<br />
El. Maschinen, Antriebe <strong>und</strong><br />
Leistungselektronik<br />
El. Maschinen <strong>und</strong> Anlagen<br />
Gr<strong>und</strong>lagen Elektrotechnik<br />
Elektronik<br />
Automatisierungstechnik<br />
Schiffsautomatisierung<br />
Gr<strong>und</strong>lagen Elektrotechnik<br />
Schiffselektrotechnik<br />
Kenntnisse <strong>und</strong> Fähigkeiten für die<br />
Betriebsführungsebene werden in<br />
der praktischen Seefahrtszeit<br />
angelegt (Training Record Book,<br />
Sicherheitslehrgang, Lehrpläne der<br />
Schiffsmechanikausbildung) <strong>und</strong><br />
durch theoretische Kenntnisse im<br />
Studium anlagenspezifisch vertieft.<br />
Fachkenntnisse:<br />
- Elektrotechnik/Messtechnik<br />
- Elektrische Anlagen<br />
- Regelungstechnuk<br />
- Automatisierungstechnik/Leittechnik<br />
- Elektrische Maschinen<br />
- Überwachung Schiffsbetrieb<br />
- Mittelspannung<br />
Elektrotechnik<br />
Elektrische Maschinen u. Anl.<br />
Meß- u. Regelungstechnik<br />
Automation<br />
Leistungselektronik<br />
9
Function: Electrical, electronic and control engineering at the management level<br />
Column 1 Column 2 HS Wismar (Warnemünde) HS Bremerhaven<br />
Competence Knowledge, <strong>und</strong>erstanding and<br />
Manage<br />
operation of<br />
electrical and<br />
electronic<br />
control<br />
equipment<br />
proficiency<br />
Theoretical knowledge<br />
Marine electrotechnology,<br />
electronics, power electronics,<br />
automatic control engineering and<br />
safety devices<br />
Design features and system<br />
configurations of automatic control<br />
equipment and safety devices for the<br />
following:<br />
.1 main engine<br />
.2 generator and distribution<br />
system<br />
.3 steam boiler<br />
Design features and system<br />
configurations of operational control<br />
equipment for electrical motors<br />
Design features of high-voltage<br />
installations<br />
Features of hydraulic and pneumatic<br />
control equipment<br />
Schiffsautomatisierung<br />
Schiffselektrotechnik<br />
Schiffsautomatisierung<br />
Maritime Versorgungssysteme<br />
Fachkenntnisse:<br />
- Elektrotechnik/Messtechnik<br />
- Elektrische Anlagen<br />
- Mittelspannung<br />
- Elektrische Maschinen<br />
- Regelungstechnik<br />
- Automatisierungstechnik/Leittechnik<br />
- Überwachung Schiffsbetrieb<br />
- Dampfanlagen<br />
- Arbeitsmaschinen<br />
- Anlagentechnik<br />
Elektrotechnik<br />
Elektrische Maschinen u. Anl.<br />
Meß- u. Regelungstechnik<br />
Automation<br />
Leistungselektronik<br />
Arbeitsmaschinen<br />
Verbrennungskraftmasch. u. Anl.<br />
Dampftechnik<br />
10
Column 1 Column 2 HS Wismar (Warnemünde) HS Bremerhaven<br />
Competence Knowledge, <strong>und</strong>erstanding and<br />
Manage<br />
trouble<br />
shooting<br />
restoration of<br />
electrical and<br />
electronic<br />
control<br />
equipment to<br />
operating<br />
condition<br />
proficiency<br />
Practical knowledge<br />
Troubleshooting of electrical and<br />
electronic control equipment<br />
Function test of electrical, electronic<br />
control equipment and safety devices<br />
Troubleshooting of monitoring<br />
systems<br />
Software version control<br />
Schiffselektrotechnik<br />
Schiffsautomatisierung<br />
Fachkenntnisse / Laborübungen:<br />
- Elektrotechnik<br />
- Elektrische Anlagen<br />
- Elektrische Maschinen<br />
- Regelungstechnik<br />
- Automatisierungstechnik/Leittechnik<br />
- Überwachung Schiffsbetrieb<br />
- Dampfanlagen<br />
- Arbeitsmaschinen<br />
- Anlagentechnik<br />
Praktische Ausbildung<br />
Simulatorübungen<br />
Laborübungen<br />
Automation<br />
11
Function: Maintenance and repair at the operational level<br />
Column 1 Column 2 HS Wismar (Warnemünde) HS Bremerhaven<br />
Competence Knowledge, <strong>und</strong>erstanding and<br />
Appropriate<br />
use of hand<br />
tools, machine<br />
tools and<br />
measuring<br />
instruments for<br />
fabrication and<br />
repair on board<br />
proficiency<br />
Characteristics and limitations of<br />
materials used in construction and<br />
repair of ships and equipment<br />
Characteristics and limitations of<br />
processes used for fabrication and<br />
repair<br />
Properties and parameters<br />
considered in the fabrication and<br />
repair of systems and components<br />
Methods for carrying out safe<br />
emergency/temporary repairs<br />
Safety measures to be taken to<br />
ensure a safe working environment<br />
and for using hand tools, machine<br />
tools and measuring instruments<br />
Use of hand tools, machine tools and<br />
measuring instruments<br />
Use of various types of sealants and<br />
packings<br />
Werkstofftechnik<br />
+ Metallausbildung (SM)<br />
Maschinenelemente<br />
Maschinenelemente<br />
Schiffsinstandhaltung<br />
Schiffsinstandhaltung<br />
+ Metallausbildung (SM)<br />
Kenntnisse <strong>und</strong> Fähigkeiten für die<br />
Betriebsführungsebene werden in<br />
der praktischen Seefahrtszeit<br />
angelegt (Training Record Book,<br />
Sicherheitslehrgang, Lehrpläne der<br />
Schiffsmechanikausbildung) <strong>und</strong><br />
durch theoretische Kenntnisse im<br />
Studium anlagenspezifisch vertieft.<br />
Anlagenspezifische Kenntnisse:<br />
- Betriebsstoffe<br />
- Arbeitsmaschinen<br />
- Anlagentechnik<br />
- Elektrische Anlagen<br />
- Elektrische Maschinen<br />
- Dampfanlagen<br />
- Verbrennungskraftmaschinen<br />
- Überwachung Schiffsbetrieb<br />
- Instandhaltung<br />
- Grlg. Werkstofftechnik<br />
Praktische Ausbildung<br />
Werkstofftechnik<br />
Konstruktionslehre<br />
Instandhaltung<br />
12
Column 1 Column 2 HS Wismar (Warnemünde) HS Bremerhaven<br />
Competence Knowledge, <strong>und</strong>erstanding and<br />
Maintenance<br />
and repair of<br />
shipboard<br />
machinery and<br />
equipment<br />
Maintenance<br />
and repair of<br />
shipboard<br />
machinery and<br />
equipment<br />
(continued)<br />
proficiency<br />
Safety measures to be taken for<br />
repair and maintenance, including<br />
the safe isolation of shipboard<br />
machinery and equipment required<br />
before personnel are permitted to<br />
work on such machinery or<br />
equipment<br />
Appropriate basic mechanical<br />
knowledge and skills<br />
Maintenance and repair, such as<br />
dismantling, adjustment and<br />
reassembling of machinery and<br />
equipment<br />
The use of appropriate specialized<br />
tools and measuring instruments<br />
Design characteristics and selection<br />
of materials in construction of<br />
equipment<br />
Interpretation of machinery drawings<br />
and handbooks<br />
The interpretation of piping,<br />
hydraulic and pneumatic diagrams<br />
Schiffsinstandhaltung<br />
Arbeitsmaschinen<br />
Schiffsmaschinenanlagen<br />
Schiffselektrotechnik<br />
Schiffsautomatisierung<br />
Metallausbildung (SM)<br />
Technische Betriebsführung<br />
Schiffsinstandhaltung<br />
Werkstofftechnik<br />
Technische Betriebsführung<br />
Schiffsinstandhaltung<br />
Maritime Versorgungssysteme<br />
- Bordpraktische Ausbildung<br />
Anlagenspezifische Kenntnisse:<br />
- Instandhaltung<br />
- Betriebsstoffe<br />
- Arbeitsmaschinen<br />
- Anlagentechnik<br />
- Elektrische Anlagen<br />
- Elektrische Maschinen<br />
- Dampfanlagen<br />
- Verbrennungskraftmaschinen<br />
- Überwachung Schiffsbetrieb<br />
- Technische Mechanik<br />
- Bordpraktische Ausbildung &<br />
- Instandhaltung<br />
Anlagenspezifische Kenntnisse:<br />
- Elektrotechnik/Messtechnik<br />
- Instandhaltung<br />
- Betriebsstoffe<br />
- Arbeitsmaschinen<br />
- Anlagentechnik<br />
- Elektrische Anlagen<br />
- Dampfanalgen<br />
- Verbrennungskraftmaschinen<br />
- Überwachung Schiffsbetrieb<br />
Praktische Ausbildung<br />
Instandhaltung<br />
Verbrennungskraftmaschinen<br />
Arbeitsmaschinen<br />
Dampfanlagen<br />
Elektrische Maschinen<br />
Automation<br />
Praktische Ausbildung<br />
Instandhaltung<br />
Verbrennungskraftmaschinen<br />
Arbeitsmaschinen<br />
Dampfanlagen<br />
Elektrische Maschinen<br />
Automation<br />
Werkstofftechnik<br />
Konstruktionslehre<br />
Instandhaltung<br />
Konstruktionslehre<br />
Arbeitsmaschinen<br />
Verbrennungskraftmaschinen u. Anl.<br />
13
Function: Maintenance and repair at the management level<br />
Column 1 Column 2 HS Wismar (Warnemünde) FH Flensburg HS Bremerhaven<br />
Competence Knowledge, <strong>und</strong>erstanding and<br />
Manage safe<br />
and effective<br />
maintenance<br />
and repair<br />
procedures<br />
Detect and<br />
identify the<br />
cause of<br />
machinery<br />
malfunctions<br />
and correct<br />
faults<br />
proficiency<br />
Theoretical knowledge<br />
Marine engineering practice<br />
Practical knowledge<br />
Manage safe and effective<br />
maintenance and repair procedures<br />
Planning maintenance, including<br />
statutory and class verifications<br />
Planning repairs<br />
Practical knowledge<br />
Detection of machinery malfunction,<br />
location of faults and action to<br />
prevent damage<br />
Inspection and adjustment of<br />
equipment<br />
Non-destructive examination<br />
Technische Betriebsführung<br />
Schiffsinstandhaltung<br />
Projektwoche<br />
Schiffsinstandhaltung<br />
Projektwoche<br />
Komplexer Schiffsbetrieb<br />
Schiffsdieselmotoren <strong>und</strong> Anlagen<br />
Dampftechnik<br />
Schiffsmaschinenanlagen n<br />
- Bordpraktische Ausbildung &<br />
- Instandhaltung<br />
Anlagenspezifische Kenntnisse:<br />
- Instandhaltung<br />
- Betriebsstoffe<br />
- Arbeitsmaschinen<br />
- Anlagentechnik<br />
- Elektrische Anlagen<br />
- Mittelspannung<br />
- Dampfanlagen<br />
- Verbrennungskraftmaschinen<br />
- Überwachung Schiffsbetrieb<br />
- Bordpraktische Ausbildung &<br />
- Instandhaltung<br />
Anlagenspezifische Kenntnisse:<br />
- Grlg. Werkstofftechnik<br />
- Instandhaltung<br />
- Arbeitsmaschinen<br />
- Anlagentechnik<br />
- Elektrische Anlagen<br />
- Dampfanlagen<br />
- Verbrennungskraftmaschinen<br />
- Überwachung Schiffsbetrieb<br />
Instandhaltung<br />
Praktische Ausbildung<br />
Betriebsführung / Arbeitsschutz<br />
Praktische Ausbildung<br />
Simulatorübungen<br />
Instandhaltung<br />
Werkstofftechnik<br />
Verbrennungskarftmaschinen<br />
Arbeitsmaschinen<br />
Dampftechnik<br />
Elektrische Maschinen<br />
14
Column 1 Column 2 HS Wismar (Warnemünde) FH Flensburg HS Bremerhaven<br />
Competence Knowledge, <strong>und</strong>erstanding and<br />
Ensure safe<br />
working<br />
practices<br />
proficiency<br />
Practical knowledge<br />
Safe working practices<br />
Technische Betriebsführung<br />
Projektwoche<br />
+ Metallbearbeitung (SM)<br />
- Bordpraktische Ausbildung &<br />
- Instandhaltung<br />
Anlagenspezifische Kenntnisse:<br />
- Betriebsstoffe<br />
- Arbeitsmaschinen<br />
- Anlagentechnik<br />
- Elektrische Anlagen<br />
- Elektrische Maschinen<br />
- Dampfanlagen<br />
- Verbrennungskraftmaschinen<br />
- Überwachung Schiffsbetrieb<br />
Praktische Ausbildung<br />
Instandhaltung<br />
Betriebsführung Arbeitsschutz<br />
15
Function: Controlling the operation of the ship and care for persons on board at the operational level<br />
Column 1 Column 2 HS Wismar (Warnemünde) FH Flensburg HS Bremerhaven<br />
Competence Knowledge, <strong>und</strong>erstanding and<br />
Ensure<br />
compliance<br />
with pollutionprevention<br />
requirements<br />
Maintain<br />
seaworthiness<br />
of the ship<br />
proficiency<br />
Prevention of pollution of the marine<br />
environment<br />
Knowledge of the precautions to be<br />
taken to prevent pollution of the<br />
marine environment<br />
Anti-pollution procedures and all<br />
associated equipment<br />
Importance of proactive measures to<br />
protect the marine environment<br />
Ship stability<br />
Working knowledge and application<br />
of stability, trim and stress tables,<br />
diagrams and stress-calculating<br />
equipment<br />
Understanding of the f<strong>und</strong>amentals<br />
of watertight integrity<br />
Understanding of f<strong>und</strong>amental<br />
actions to be taken in the event of<br />
partial loss of intact buoyancy<br />
Ship construction<br />
General knowledge of the principal<br />
structural members of a ship and the<br />
proper names for the various parts<br />
Seerecht<br />
Personalführung/Sicherheit<br />
Technische Betriebsführung<br />
Schiffsmaschinenanlagen<br />
- Anlagentechnik<br />
- Instandhaltung<br />
Anlagenspezifische Kenntnisse:<br />
- Betriebsstoffe<br />
- Arbeitsmaschinen<br />
- Anlagentechnik<br />
- Dampfanlagen<br />
- Verbrennungskraftmaschinen<br />
- Überwachung Schiffsbetrieb<br />
Schiffbau/Schiffstheorie - Schiffbau<br />
- Schiffsicherheit<br />
Seerecht<br />
Personalführung/Sicherheit<br />
Betriebsführung<br />
Schiffbau<br />
16
Column 1 Column 2 HS Wismar (Warnemünde) FH Flensburg HS Bremerhaven<br />
Competence Knowledge, <strong>und</strong>erstanding and<br />
Prevent, control<br />
and fight fires<br />
on board<br />
Operate<br />
life-saving<br />
appliances<br />
Apply medical<br />
first aid on<br />
board ship<br />
Monitor<br />
compliance<br />
with legislative<br />
requirements<br />
proficiency<br />
Fire prevention and fire-fighting<br />
appliances<br />
Ability to organize fire drills<br />
Knowledge of classes and chemistry<br />
of fire<br />
Knowledge of fire-fighting systems<br />
Action to be taken in the event of<br />
fire, including fires involving oil<br />
systems<br />
Life-saving<br />
Ability to organize abandon ship<br />
drills and knowledge of the<br />
operation of survival craft and rescue<br />
boats, their launching appliances and<br />
arrangements, and their equipment,<br />
including radio life-saving<br />
appliances, satellite EPIRBs,<br />
SARTs, immersion suits and thermal<br />
protective aids<br />
Medical aid<br />
Practical application of medical<br />
guides and advice by radio,<br />
including the ability to take effective<br />
action based on such knowledge in<br />
the case of accidents or illnesses that<br />
are likely to occur on board ship<br />
Basic working knowledge of the relevant<br />
IMO conventions concerning safety of<br />
life at sea and protection of the marine<br />
environment<br />
Brandschutz<br />
+ Basic safety<br />
Personalführung Sicherheit<br />
+ Basic safety<br />
- Bordpraktische Ausbildung,<br />
- Sicherheitslehrgang<br />
- Betriebsstoffe<br />
- Anlagentechnik<br />
- Überwachung Schiffsbetrieb<br />
Ship Security Trainer<br />
- Gefahrstoffe<br />
- Bordpraktische Ausbildung,<br />
- Sicherheitslehrgang<br />
Ges<strong>und</strong>heitspflege - Bordpraktische Ausbildung,<br />
- Sicherheitslehrgang<br />
- Ges<strong>und</strong>heitsfürsorge<br />
Seerecht<br />
Personalführung/Sicherheit<br />
- Betriebsstoffe<br />
- Anlagentechnik<br />
- Verbrennungskraftmaschinen<br />
Sicherheitslehrgang<br />
Brandschutz<br />
Gefahrstoffe<br />
Praktische Ausbildung<br />
Personalführung/Sicherheit<br />
Ges<strong>und</strong>heitslehrgang<br />
Seerecht<br />
Personalführung/Sicherheit<br />
17
Column 1 Column 2 HS Wismar (Warnemünde) FH Flensburg HS Bremerhaven<br />
Competence Knowledge, <strong>und</strong>erstanding and<br />
Application of<br />
leadership and<br />
teamworking<br />
skills<br />
proficiency<br />
Working knowledge of shipboard<br />
personnel management and training<br />
A knowledge of related international<br />
maritime conventions and<br />
recommendations, and national<br />
legislation<br />
Ability to apply task and workload<br />
management, including:<br />
.1 planning and co-ordination<br />
.2 personnel assignment<br />
.3 time and resource constraints<br />
.4 prioritization<br />
Knowledge and ability to apply<br />
effective resource management:<br />
.1 allocation, assignment, and<br />
prioritization of resources<br />
.2 effective communication on<br />
board and ashore<br />
.3 decisions reflect consideration of<br />
team experiences<br />
.4 assertiveness and leadership,<br />
including motivation<br />
.5 obtaining and maintaining<br />
situational awareness<br />
Knowledge and ability to apply<br />
decision-making techniques:<br />
.1 Situation and risk assessment<br />
.2 Identify and consider generated<br />
options<br />
.3 Selecting course of action<br />
.4 Evaluation of outcome<br />
effectiveness<br />
Soziologie/Psychologie<br />
Personalführung/Sicherheit<br />
Seerecht<br />
Personalführung/Sicherheit<br />
Personalführung/Sicherheit<br />
Technische Betriebsführung<br />
Personalführung/Sicherheit<br />
Maritime Kommunikation<br />
Technische Betriebsführung<br />
Personalführung/Sicherheit<br />
- Personalführung/ISPS<br />
- Instandhaltung<br />
- Überwachung Schiffsbetrieb<br />
Methoden- <strong>und</strong> Sozialkompetenzen<br />
werden gem. Akkreditierungsvorgaben<br />
in allen Fächern angelegt.<br />
Allg. Recht<br />
Seerecht<br />
Personalführung/Sicherheit<br />
Betriebsführung<br />
18
Column 1 Column 2 HS Wismar (Warnemünde) FH Flensburg HS Bremerhaven<br />
Competence Knowledge, <strong>und</strong>erstanding and<br />
Contribute to<br />
the safety of<br />
personnel and<br />
ship<br />
proficiency<br />
Knowledge of personal survival<br />
techniques<br />
Knowledge of fire prevention and<br />
ability to fight and extinguish fires<br />
Knowledge of elementary first aid<br />
Knowledge of personal safety and<br />
social responsibilities<br />
Personalführung/Sicherheit<br />
Brandschutz<br />
Ges<strong>und</strong>heitspflege<br />
Personlalführung/Sicherheit<br />
- Bordpraktische Ausbildung<br />
- Sicherheitslehrgang<br />
- Personalführung<br />
- Ges<strong>und</strong>heitsfürsorge<br />
- Instandhaltung<br />
- Überwachung Schiffsbetrieb<br />
Methoden- <strong>und</strong> Sozialkompetenzen<br />
werden gem. Akkreditierungsvorgaben<br />
in allen Fächern angelegt.<br />
Function: Controlling the operation of the ship and care for persons on board at the management level<br />
Praktische Ausbildung<br />
Sicherheitslehrgang<br />
Brandschutz<br />
Personalführung/Sicherheit<br />
Ges<strong>und</strong>heitslehrgang<br />
Column 1 Column 2 HS Wismar (Warnemünde) FH Flensburg HS Bremerhaven<br />
Competence Knowledge, <strong>und</strong>erstanding and<br />
Control trim,<br />
stability and<br />
stress<br />
proficiency<br />
Understanding of f<strong>und</strong>amental<br />
principles of ship construction and<br />
the theories and factors affecting<br />
trim and stability and measures<br />
necessary to preserve trim and<br />
stability<br />
Knowledge of the effect on trim and<br />
stability of a ship in the event of<br />
damage to and consequent flooding<br />
of a compartment and<br />
countermeasures to be taken<br />
Knowledge of IMO<br />
recommendations concerning ship<br />
stability<br />
Schiffbau/Schiffstheorie<br />
Schiffbau/Schifftheorie<br />
Seerecht<br />
- Schiffbau<br />
- Schiffsicherheit<br />
Schiffbau<br />
Seerecht<br />
19
Column 1 Column 2 HS Wismar (Warnemünde) FH Flensburg HS Bremerhaven<br />
Competence Knowledge, <strong>und</strong>erstanding and<br />
Monitor and<br />
control<br />
compliance<br />
with legislative<br />
requirements<br />
and measures<br />
to ensure safety<br />
of life at sea<br />
and protection<br />
of the marine<br />
environment<br />
proficiency<br />
Knowledge of relevant international<br />
maritime law embodied in<br />
international agreements and<br />
conventions<br />
Regard shall be paid especially to the<br />
following subjects:<br />
.1 certificates and other documents<br />
required to be carried on board<br />
ships by international<br />
conventions, how they may be<br />
obtained and the period of their<br />
legal validity<br />
.2 responsibilities <strong>und</strong>er the<br />
relevant requirements of the<br />
International Convention on<br />
Load Lines, 1966, as amended<br />
.3 responsibilities <strong>und</strong>er the<br />
relevant requirements of the<br />
International Convention for the<br />
Safety of Life at Sea, 1974, as<br />
amended<br />
.4 responsibilities <strong>und</strong>er the<br />
International Convention for the<br />
Prevention of Pollution from<br />
Ships, as amended<br />
Seerecht<br />
Personalführung/Sicherheit<br />
Technische Betriebsführung<br />
Schiffbau/Schiffstheorie<br />
Personalführung/Sicherheit<br />
Technische Betriebsführung<br />
Schiffsmaschinenanlagen<br />
- Bordpraktische Ausbildung<br />
- Gr<strong>und</strong>lagen Recht<br />
- Grlg. Schifffahrtsrecht<br />
- Anlagentechnik<br />
- Überwachung Schiffsbetrieb<br />
Anlagenspezifische Kenntnisse:<br />
- Betriebsstoffe<br />
- Arbeitsmaschinen<br />
- Anlagentechnik<br />
- Elektrische Anlagen<br />
- Dampfanlagen<br />
- Verbrennungskraftmaschinen<br />
Seerecht<br />
Personalführung/Sicherheit<br />
20
Column 1 Column 2 HS Wismar (Warnemünde) FH Flensburg HS Bremerhaven<br />
Competence Knowledge, <strong>und</strong>erstanding and<br />
Monitor and<br />
control<br />
compliance<br />
with legislative<br />
requirements<br />
and measures<br />
to ensure safety<br />
of life at sea<br />
and protection<br />
of the marine<br />
environment<br />
(continued)<br />
Maintain safety<br />
and security of<br />
the vessel,<br />
crew and<br />
passengers and<br />
the operational<br />
condition of<br />
life-saving,<br />
fire-fighting<br />
and other<br />
safety systems<br />
proficiency<br />
.5 maritime declarations of health<br />
and the requirements of the<br />
International Health Regulations<br />
.6 responsibilities <strong>und</strong>er<br />
international instruments<br />
affecting the safety of the ships,<br />
passengers, crew or cargo<br />
.7 methods and aids to prevent<br />
pollution of the environment by<br />
ships<br />
.8 knowledge of national<br />
legislation for implementing<br />
international agreements and<br />
conventions<br />
A thorough knowledge of life-saving<br />
appliance regulations (International<br />
Convention for the Safety of Life at<br />
Sea)<br />
Organization of fire and abandon<br />
ship drills<br />
Maintenance of operational<br />
condition of life-saving, fire-fighting<br />
and other safety systems<br />
Actions to be taken to protect and<br />
safeguard all persons on board in<br />
emergencies<br />
Actions to limit damage and salve<br />
the ship following fire, explosion,<br />
collision or gro<strong>und</strong>ing<br />
Ges<strong>und</strong>heitspflege<br />
Seerecht<br />
Personalführung<br />
Technische Betriebsführung<br />
Schiffsdieselmotoren <strong>und</strong> Anlagen<br />
Schiffsmaschinenanalgen<br />
Allgemeines Recht<br />
Seerecht<br />
Personalführung/Sicherheit<br />
Personalführung/Sicherheit<br />
Ges<strong>und</strong>heitsfürsorge<br />
Bordausbildung<br />
- Bordpraktische Ausbildung<br />
- Anlagentechnik<br />
- Überwachung Schiffsbetrieb<br />
- Ship Security Trainer (optional)<br />
Anlagenspezifische Kenntnisse:<br />
- Betriebsstoffe<br />
- Arbeitsmaschinen<br />
- Anlagentechnik<br />
- Elektrische Anlagen<br />
- Dampfanlagen<br />
- Verbrennungskraftmaschinen<br />
Ges<strong>und</strong>heitslehrgang<br />
Seerecht<br />
Allg. Recht<br />
Personalführung<br />
Betriebsführung<br />
Personalführung /Sicherheit<br />
Brandschutz<br />
Instandhaltung<br />
21
Column 1 Column 2 HS Wismar (Warnemünde) FH Flensburg HS Bremerhaven<br />
Competence Knowledge, <strong>und</strong>erstanding and<br />
Develop<br />
emergency and<br />
damage control<br />
plans and<br />
handle<br />
emergency<br />
situations<br />
proficiency<br />
Ship construction, including damage<br />
control<br />
Methods and aids for fire prevention,<br />
detection and extinction<br />
Functions and use of life-saving<br />
appliances<br />
Schiffbau/Schiffstheorie<br />
Personalführung/Sicherheit<br />
Personalführung Sicherheit<br />
+ Basic safety<br />
- Bordpraktische Ausbildung<br />
- Anlagentechnik<br />
- Überwachung Schiffsbetrieb<br />
- Ship Security Trainer (optional)<br />
- Schiffbau<br />
- Schiffsicherheit<br />
Anlagenspezifische Kenntnisse:<br />
- Betriebsstoffe<br />
- Arbeitsmaschinen<br />
- Anlagentechnik<br />
- Elektrische Anlagen<br />
- Dampfanlagen<br />
- Verbrennungskraftmaschinen<br />
Schiffbau<br />
Personalführung/Sicherheit<br />
Brandschutz<br />
Sicherheitslehrgang<br />
22
Column 1 Column 2 HS Wismar (Warnemünde) FH Flensburg HS Bremerhaven<br />
Competence Knowledge, <strong>und</strong>erstanding and<br />
Use leadership<br />
and managerial<br />
skills<br />
proficiency<br />
Knowledge of shipboard personnel<br />
management and training<br />
A knowledge of international<br />
maritime conventions and<br />
recommendations, and related<br />
national legislation<br />
Ability to apply task and workload<br />
management, including:<br />
.1 planning and co-ordination<br />
.2 personnel assignment<br />
.3 time and resource constraints<br />
.4 prioritization<br />
Knowledge and ability to apply<br />
effective resource management:<br />
.1 allocation, assignment, and<br />
prioritization of resources<br />
.2 effective communication on<br />
board and ashore<br />
.3 decisions reflect<br />
consideration of team experience<br />
.4 assertiveness and leadership,<br />
including motivation<br />
.5 obtaining and maintaining<br />
situation awareness<br />
Personalführung/Sicherheit<br />
Projektwoche<br />
Allgemeiner Recht<br />
Seerecht<br />
Personalführung/Sicherheit<br />
Technische Betriebsführung<br />
Personalführung/Sicherheit<br />
Maritime Kommunikation<br />
Technische Betriebsführung<br />
Komplexer Schiffsbetrieb<br />
- Bordpraktische Ausbildung &<br />
- Personalführung/ISPS<br />
- Instandhaltung<br />
- Überwachung Schiffsbetrieb<br />
Methoden- <strong>und</strong> Sozialkompetenzen<br />
werden gem. Akkreditierungsvorgaben<br />
in allen Fächern angelegt.<br />
Personalführung/Sicherhiet<br />
Allg. Recht<br />
Seerecht<br />
Betriebsführung<br />
Betriebswirtschaft<br />
23
Column 1 Column 2 HS Wismar (Warnemünde) FH Flensburg HS Bremerhaven<br />
Competence Knowledge, <strong>und</strong>erstanding and<br />
Use leadership<br />
and managerial<br />
skills<br />
(continued)<br />
proficiency<br />
Knowledge and ability to apply<br />
decision-making techniques:<br />
.1 situation and risk assessment<br />
.2 identify and generate options<br />
.3 select course of action<br />
.4 evaluation of outcome<br />
effectiveness<br />
Development, implementation, and<br />
oversight of standard operating<br />
procedures<br />
Personalführung/Sicherheit<br />
Maritime Kommunikation<br />
Technische Betriebsführung<br />
Komplexer Schiffsbetrieb<br />
Betriebsführung/Sicherheit<br />
Betriebsführung<br />
24
2. Prüfungsverfahrensordnung für Bachelor- u. Master-Studiengänge<br />
an der FH Flensburg<br />
http://www.fh-flensburg.de/satzung/a/PVO_2010.pdf
Prüfungsverfahrensordnung Fachhochschule Flensburg Seite 1 von 14<br />
Prüfungsverfahrensordnung (Satzung) für Bachelor- <strong>und</strong> Master-Studiengänge an der<br />
Fachhochschule Flensburg<br />
Aufgr<strong>und</strong> des § 52 Abs. 1, Satz 1 des Hochschulgesetzes (HSG) vom 28. Februar 2007 (GVOBl. Schl.-H.<br />
S. 184), zuletzt geändert durch Artikel 12 des Gesetzes zur Umsetzung der Europäischen Dienstleistungsrichtlinie<br />
vom 9. März 2010 (GVOBl. Schl.H. S. 356) wird nach Beschlussfassung durch den Senat<br />
der Fachhochschule Flensburg vom 15.12.2010 <strong>und</strong> nach Genehmigung des Präsidiums der Fachhochschule<br />
Flensburg vom 27.12.2010 folgende Satzung erlassen.<br />
Veröffentlicht: http://www.schleswig-holstein.de/cae/servlet/contentblob/990686/publicationFile/nachrichtenblatt1_2011.pdf<br />
§ 1<br />
Inhalt der Prüfungsverfahrensordnung<br />
Diese Prüfungsverfahrensordnung enthält für alle Bachelor- <strong>und</strong> Master-Studiengänge der Fachhochschule<br />
Flensburg mit Ausnahme des <strong>Studiengang</strong>s Master in Wind Engineering unmittelbar geltende<br />
fachübergreifende Bestimmungen für das Prüfungsverfahren.<br />
§ 2<br />
Art <strong>und</strong> Zweck der Bachelor- <strong>und</strong> Master-Prüfung<br />
(1) Die Bachelor-Prüfung bildet den berufsqualifizierenden Abschluss des Bachelor-<strong>Studiengang</strong>es.<br />
Durch die Bachelor-Prüfung wird festgestellt, ob die Kandidatin oder der Kandidat die für den<br />
Übergang in die Berufspraxis notwendigen gründlichen Fachkenntnisse erworben hat <strong>und</strong> die<br />
Fähigkeit besitzt, methodisch <strong>und</strong> selbstständig auf wissenschaftlicher Gr<strong>und</strong>lage zu arbeiten.<br />
(2) Die Master-Prüfung bildet einen weiteren berufsqualifizierenden postgradualen Abschluss des<br />
Master-<strong>Studiengang</strong>es. Durch die Master-Prüfung wird festgestellt, ob die Kandidatin oder der<br />
Kandidat die Zusammenhänge des Studienfachs überblickt, die Fähigkeit besitzt, wissenschaftliche<br />
Methoden <strong>und</strong> Erkenntnisse eigenständig anzuwenden <strong>und</strong> weiterzuentwickeln, sowie die<br />
für die Berufspraxis notwendigen gründlichen Fachkenntnisse erworben hat.<br />
§ 3<br />
Module <strong>und</strong> Lehrveranstaltungen<br />
(1) Das Studium ist modular aufgebaut. Ein Modul umfasst eine oder mehrere thematisch aufeinander<br />
bezogene Lehrveranstaltungen. Zu unterscheiden sind Pflicht- <strong>und</strong> Wahlpflichtmodule. Zusätzlich<br />
können Wahlmodule belegt werden. Die genauen Angaben bezüglich der einzelnen Fächer,<br />
der Modulstruktur, des St<strong>und</strong>enumfanges, der Prüfungsanforderungen, der Credit Points<br />
(CP, Leistungspunkte) <strong>und</strong> der Einbeziehung der Fächer bei der Bildung der Gesamtnote erfolgen<br />
in den für den jeweiligen <strong>Studiengang</strong> gültigen Prüfungs- <strong>und</strong> Studienordnungen (Modul- <strong>und</strong><br />
Prüfungsplan).<br />
(2) Pflichtmodule müssen die Studierenden nach Maßgabe der für den jeweiligen <strong>Studiengang</strong> gültigen<br />
Prüfungs- <strong>und</strong> Studienordnung erfolgreich abschließen.<br />
(3) Wahlpflichtmodule müssen von allen Studierenden in der im Studienplan vorgesehenen Anzahl<br />
ausgewählt <strong>und</strong> nach Maßgabe der für den jeweiligen <strong>Studiengang</strong> gültigen Prüfungs- <strong>und</strong> Studienordnung<br />
erfolgreich abgeschlossen werden. Wahlpflichtmodule können auch in Modulgruppen<br />
angeboten werden.<br />
(4) Wahlmodule kann die oder der Studierende zusätzlich zu den Pflicht- <strong>und</strong> Wahlpflichtmodulen<br />
aus dem gesamten Lehrangebot der Fachhochschule Flensburg auswählen. Nach Maßgabe der<br />
für den jeweiligen <strong>Studiengang</strong> gültigen Prüfungs- <strong>und</strong> Studienordnung können auch in diesen<br />
Modulen Prüfungen abgelegt werden.
Prüfungsverfahrensordnung Fachhochschule Flensburg Seite 2 von 14<br />
(5) Lehrveranstaltungen sind:<br />
Art der Lehrveranstaltung Definition<br />
1. Vorlesung Zusammenhängende Darstellung des Lehrstoffes<br />
2. Übung zur Vorlesung Verarbeitung <strong>und</strong> Vertiefung des Lehrstoffes in kleinen Gruppen<br />
3. Seminar Bearbeitung von Spezialgebieten mit von den Teilnehmerinnen<br />
<strong>und</strong> Teilnehmern selbstständig erarbeiteten Referaten<br />
<strong>und</strong>/oder Diskussionen in kleinen Gruppen<br />
4. Labor Erwerb <strong>und</strong> Vertiefung von Kenntnissen durch Bearbeitung<br />
praktischer experimenteller Aufgaben in kleinen Gruppen<br />
5. Projekt Entwurf <strong>und</strong> Realisierung von Lösungen zu praktischen Fragestellungen<br />
in Teamarbeit<br />
6. Workshop Moderierter Dialog in einer kleinen Gruppe, in der Aufgaben-<br />
7. Fern-Lehrveranstaltungen,<br />
virtuelle<br />
Lehrveranstaltungen<br />
stellungen erörtert <strong>und</strong> Lösungsansätze gef<strong>und</strong>en werden.<br />
Lehrveranstaltungsarten 1. – 6., Organisiert durch die elektronische<br />
Vernetzung von Lehrenden <strong>und</strong> Studierenden<br />
8. Exkursion Studienfahrt unter Leitung eines Mitglieds des Lehrkörpers<br />
9. Sonstige Lehrveranstaltungen<br />
Andere Arten als die unter den Ziffern 1. bis 8. Genannten<br />
Veröffentlicht: http://www.schleswig-holstein.de/cae/servlet/contentblob/990686/publicationFile/nachrichtenblatt1_2011.pdf<br />
§ 4<br />
Anwesenheitspflicht<br />
(1) Zur Erreichung der Ausbildungsziele wird von der Anwesenheit der Studierenden in allen Lehrveranstaltungen<br />
ausgegangen.<br />
(2) Anwesenheitspflicht besteht für die Teilnahme an Seminaren, Laboren, Projekten <strong>und</strong> Workshops.<br />
(3) Der für den <strong>Studiengang</strong> zuständige Fachbereichskonvent kann auch für weitere Lehrveranstaltungen<br />
Anwesenheitspflicht beschließen.<br />
§ 5<br />
Beschränkung der Teilnahme an Lehrveranstaltungen<br />
(1) Nach § 4 Abs. 5 HSG haben Studierende der Fachhochschule Flensburg gr<strong>und</strong>sätzlich das Recht<br />
auf freien Zugang zu allen Lehrveranstaltungen, sofern dieser nicht nach § 52 Abs. 11 HSG beschränkt<br />
ist.<br />
(2) In Veranstaltungen gemäß § 4 Abs. 2 soll die Zahl der Teilnehmenden 20 Personen nicht überschreiten.<br />
(3) Melden sich zu einer der in § 4 Abs. 2 genannten Veranstaltungen mehr Studierende <strong>und</strong> handelt<br />
es sich bei dieser Veranstaltung um ein Pflichtmodul, richtet der für den <strong>Studiengang</strong> zuständige<br />
Fachbereichskonvent Parallelveranstaltungen ein. Falls das Lehrdeputat der für diese Veranstaltungen<br />
zur Verfügung stehenden Lehrkräfte erschöpft ist, sind hierfür im Rahmen der vorhandenen<br />
Mittel <strong>und</strong> Möglichkeiten Lehrbeauftragte anzuwerben.<br />
(4) Kann der Lehrveranstaltungsbedarf bei Pflichtveranstaltungen nicht durch die in Abs. 3 genannten<br />
Maßnahmen ausgeglichen werden, haben die Studierenden Vorrang, für die diese Lehrveranstaltung<br />
in dem betreffenden Semester als Pflichtveranstaltung ausgewiesen ist. Dabei gehen<br />
die Studierenden vor, die im Regelstudienplan am weitesten fortgeschritten sind sowie Studierende,<br />
die bereits einmal von der Teilnahme ausgeschlossen wurden. Bei gleichberechtigten Be-
Prüfungsverfahrensordnung Fachhochschule Flensburg Seite 3 von 14<br />
werbungen entscheidet das Los. Ein Anspruch auf einen bestimmten Veranstaltungstermin oder<br />
Abhaltung durch eine bestimmte Hochschullehrerin oder einen bestimmten Hochschullehrer besteht<br />
nicht. Studierende, die nicht berücksichtigt wurden, sind auf das folgende Semester zu<br />
verweisen. Die Entscheidung trifft der zuständige Fachbereichskonvent.<br />
(5) Melden sich zu einer der in § 4 Abs. 2 genannten Veranstaltungen mehr Studierende <strong>und</strong> ist diese<br />
Veranstaltung Bestandteil eines Wahlpflichtmoduls, dann ist der Fachbereich verpflichtet, der<br />
oder dem Studierenden den Besuch eines anderen Wahlpflichtmoduls zu ermöglichen. Ein Anspruch<br />
der oder des Studierenden auf den Besuch eines bestimmten Wahlpflichtmoduls besteht<br />
nicht.<br />
(6) Melden sich zu einer der in § 4 Abs. 2 genannten Veranstaltungen mehr Studierende <strong>und</strong> ist diese<br />
Veranstaltung Bestandteil eines Wahlmoduls, dann ist der Fachbereich nicht verpflichtet, der<br />
oder dem Studierenden den Besuch eines anderen Wahlmoduls zu ermöglichen. Ein Anspruch<br />
der oder des Studierenden auf den Besuch eines Wahlmoduls besteht nicht.<br />
Veröffentlicht: http://www.schleswig-holstein.de/cae/servlet/contentblob/990686/publicationFile/nachrichtenblatt1_2011.pdf<br />
§ 6<br />
Prüfungen: Aufbau der Prüfungen, Prüfungszeitpunkte, Prüfungssprache<br />
(1) Die Bachelor- <strong>und</strong> die Master-Prüfung bestehen aus Studien begleitenden Prüfungen (§ 8) <strong>und</strong><br />
Studien abschließenden Prüfungen (§ 9). In den Prüfungs- <strong>und</strong> Studienordnungen der Studiengänge<br />
sind die Module sowie die entsprechenden Prüfungsanforderungen fachlich sowie zeitlich<br />
im Einzelnen geregelt.<br />
(2) Die Studierenden sollen die Prüfung in einem Prüfungsfach ablegen, wenn dieses Fach laut Modul-<br />
<strong>und</strong> Prüfungsplan abgeschlossen wird. Sie melden sich verbindlich zu den von der oder dem<br />
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses bestimmten Meldefristen.<br />
(3) Für jede Veranstaltung, die mit einer Prüfungsleistung abzuschließen ist, wird - soweit es die<br />
Form der Prüfung zulässt - ein Prüfungstermin am Ende des Semesters, in dem diese Veranstaltung<br />
stattgef<strong>und</strong>en hat, <strong>und</strong> zu Beginn <strong>und</strong> am Ende des folgenden Semesters festgelegt. Für jede<br />
Veranstaltung, die mit einer Studien- oder Prüfungsvorleistung abzuschließen ist, gibt die oder<br />
der Prüfungsberechtigte die Modalitäten der Wiederholbarkeit der Prüfung zu Beginn der<br />
Veranstaltung gegenüber den Studierenden <strong>und</strong> dem Prüfungsausschuss bekannt. Soweit es die<br />
Form der Prüfung zulässt, sind dabei pro Jahr mindestens zwei Termine vorzusehen.<br />
(4) Die Prüfungssprache ist Deutsch, sofern in den Prüfungs- <strong>und</strong> Studienordnungen der einzelnen<br />
Studiengänge nichts Anderes geregelt ist.<br />
(5) Für Bachelor-Studiengänge kann eine Orientierungsphase vorgesehen werden. Diese wird durch<br />
die Prüfungs- <strong>und</strong> Studienordnungen der entsprechenden Studiengänge geregelt.<br />
§ 7<br />
Allgemeine Prüfungsvoraussetzungen<br />
(1) Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung sind:<br />
1. eine gültige Immatrikulationsbescheinigung der Fachhochschule Flensburg <strong>und</strong><br />
2. eine form- <strong>und</strong> fristgerechte verbindliche Meldung zur Teilnahme an den Prüfungen.<br />
3. gegebenenfalls ein Nachweis über erforderliche Vorleistungen.<br />
(2) Über die Zulassung entscheidet die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses.<br />
(3) Die Zulassung zu einer Prüfung ist zu versagen, wenn die Unterlagen nicht vollständig sind.
Prüfungsverfahrensordnung Fachhochschule Flensburg Seite 4 von 14<br />
Veröffentlicht: http://www.schleswig-holstein.de/cae/servlet/contentblob/990686/publicationFile/nachrichtenblatt1_2011.pdf<br />
§ 8<br />
Studien begleitende Prüfungen<br />
(1) Studien begleitende Prüfungen sind Prüfungen, die in einem Zusammenhang zu den Lehrveranstaltungen<br />
gemäß Modul- <strong>und</strong> Prüfungsplan stehen <strong>und</strong> i.d.R. am Ende der Lehrveranstaltung zu<br />
absolvieren sind.<br />
(2) Studien begleitende Prüfungen werden als Prüfungsleistungen bezeichnet, wenn diese den benoteten<br />
Abschluss eines entsprechend der Prüfungs- <strong>und</strong> Studienordnung bezeichneten Fachgebietes<br />
darstellen. Prüfungsleistungen sind bei Nichtbestehen beschränkt wiederholbar.<br />
(3) Studien begleitende Prüfungen werden als Prüfungsvorleistungen bezeichnet, wenn ihre erfolgreiche<br />
Ableistung eine Voraussetzung für die Zulassung zu einer (übergeordneten) Prüfungsleistung<br />
(Abs. 2) ist. Prüfungsvorleistungen sind bei Nichtbestehen unbeschränkt wiederholbar.<br />
(4) Studien begleitende Prüfungen werden als Studienleistungen bezeichnet, wenn sie im Zusammenhang<br />
mit Lehrveranstaltungen zu erbringen sind, die nicht mit Prüfungen gemäß der Absätze<br />
2 <strong>und</strong> 3 abgeschlossen werden. Studienleistungen sind bei Nichtbestehen unbeschränkt wiederholbar.<br />
(5) Eine Kennzeichnung der einzelnen Prüfungsanforderungen im Sinne der Absätze 2 bis 4 erfolgt in<br />
den Prüfungsplänen der jeweiligen Prüfungs- <strong>und</strong> Studienordnungen.<br />
(6) Unabhängig von der in den Absätzen 2 bis 4 vorgenommenen Unterscheidungen hinsichtlich der<br />
Wiederholbarkeit können die Prüfungen nach folgenden Formen unterschieden werden:<br />
1. Klausuren (§ 11)<br />
2. Mündliche Prüfungen (§ 12)<br />
3. Sonstige Prüfungen (§ 13)<br />
§ 9<br />
Studien abschließende Prüfungen<br />
(1) Studien abschließende Prüfungen sind Prüfungen, die in der Regel am Ende des Studiums zu absolvieren<br />
sind.<br />
(2) Die abschließende Prüfung eines <strong>Studiengang</strong>es ist die Thesis (§20).<br />
§ 10<br />
Wiederholbarkeit von Studien begleitenden Prüfungen<br />
(1) Studien begleitende Prüfungsleistungen können bei Nichtbestehen zweimal wiederholt werden.<br />
Im Falle einer mit der Note „nicht ausreichend“ (5,0) bewerteten Prüfungsleistung kann diese in<br />
dem betreffenden Fach frühestens im nächsten Prüfungszeitraum wiederholt werden.<br />
(2) Ist eine Wiederholung nicht mehr möglich, ist eine Prüfung endgültig nicht bestanden.<br />
(3) Eine bestandene Prüfung kann nicht wiederholt werden.<br />
§ 11<br />
Klausuren, mündliche Nachprüfungen<br />
(1) In den Klausuren sollen die Kandidatinnen <strong>und</strong> Kandidaten nachweisen, dass sie in begrenzter<br />
Zeit mit begrenzten Hilfsmitteln mit den gängigen Methoden ihres Faches ein Problem erkennen<br />
<strong>und</strong> Wege zu einer Lösung nennen können. Die Klausuraufgaben werden von Prüfungsberechtig-
Prüfungsverfahrensordnung Fachhochschule Flensburg Seite 5 von 14<br />
ten (§ 16) gestellt. Die Klausuren sind von allen Kandidatinnen <strong>und</strong> Kandidaten des Faches <strong>und</strong><br />
des betreffenden Prüfungstermins gleichzeitig <strong>und</strong> unter Prüfungsbedingungen zu bearbeiten.<br />
(2) Die Dauer einer Klausur beträgt mindestens 60 Minuten, höchstens 180 Minuten.<br />
(3) Klausuren werden von einer oder einem Prüfungsberechtigten bewertet. Ist eine Arbeit mit<br />
„nicht ausreichend“ (5,0) beurteilt worden <strong>und</strong> handelt es sich um eine Prüfungsleistung, holt die<br />
oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses eine zweite Bewertung ein. Im Falle einer Wiederholungsprüfung<br />
ist die Klausur gr<strong>und</strong>sätzlich von zwei Prüfungsberechtigten zu bewerten.<br />
Weichen die Bewertungen voneinander ab, entscheidet der Prüfungsausschuss.<br />
(4) Studierende, deren Klausur bei einer zweiten Wiederholungsprüfung mit „nicht ausreichend“<br />
(5,0) bewertet wurde <strong>und</strong> die eine Prüfungsleistung ist, werden auf Antrag mündlich nachgeprüft,<br />
wenn in der Klausur mindestens 75 vom H<strong>und</strong>ert der für die Note „ausreichend“ (4,0) geforderten<br />
Leistung erbracht wurde. Die mündliche Nachprüfung erfolgt durch zwei Prüferinnen<br />
<strong>und</strong>/ oder Prüfer. Die Dauer der mündlichen Nachprüfung soll 15 Minuten umfassen. Prüfungsberechtigte<br />
sollen die Bewertenden der Klausur sein. Als Ergebnis der mündlichen Nachprüfung<br />
wird festgestellt, ob die Note im betreffenden Fach „ausreichend“ (4,0) oder „nicht ausreichend“<br />
(5,0) lautet. Die mündliche Nachprüfung muss im selben Prüfungszeitraum wie die Klausur<br />
durchgeführt werden.<br />
(5) Aus mehreren Teilleistungen zusammengesetzte Klausuren sind als einheitliche Leistung zu bewerten.<br />
(6) In begründeten Ausnahmefällen kann der Prüfungsausschuss anstelle der Klausur eine Prüfung<br />
entsprechend § 12 oder § 13 als Prüfungsform zulassen. Entsprechende Anträge sind binnen einer<br />
Frist von maximal vier Wochen nach Beginn der offiziellen Vorlesungszeit zu stellen.<br />
§ 12<br />
Mündliche Prüfungen<br />
(1) In einer mündlichen Prüfung sollen die Kandidatinnen <strong>und</strong> Kandidaten nachweisen, dass sie die<br />
Zusammenhänge des Prüfungsgebietes erkennen <strong>und</strong> spezielle Fragestellungen in diese Zusammenhänge<br />
einzuordnen vermögen. Durch eine mündliche Prüfung soll ferner festgestellt werden,<br />
ob die Kandidatinnen <strong>und</strong> Kandidaten über breites Gr<strong>und</strong>lagenwissen verfügen.<br />
(2) Die Dauer einer mündlichen Prüfung soll bei jeder Kandidatin oder jedem Kandidaten in der Regel<br />
30 Minuten, bei Gruppenprüfungen i.d.R. 15 Minuten umfassen. .<br />
(3) Mündliche Prüfungen werden vor mindestens zwei Prüferinnen <strong>und</strong>/oder Prüfern (Kollegialprüfung)<br />
oder vor einer Prüferin oder einem Prüfer in Gegenwart einer sachk<strong>und</strong>igen Beisitzerin oder<br />
eines sachk<strong>und</strong>igen Beisitzers als Gruppenprüfung oder als Einzelprüfung abgelegt. Hierbei<br />
wird jede Kandidatin <strong>und</strong> jeder Kandidat in einem Prüfungsfach gr<strong>und</strong>sätzlich nur von einer Prüferin<br />
oder einem Prüfer geprüft. Vor der Festsetzung der Note hört die Prüferin oder der Prüfer<br />
die anderen an einer Kollegialprüfung mitwirkenden Prüferinnen oder Prüfer oder die Beisitzerin<br />
oder den Beisitzer.<br />
(4) Die wesentlichen Gegenstände <strong>und</strong> Ergebnisse der mündlichen Prüfung sind in einem Protokoll<br />
festzuhalten. Das Gesamtergebnis ist der Kandidatin oder dem Kandidaten jeweils im Anschluss<br />
an die mündliche Prüfung bekannt zu geben.<br />
(5) Studierende, die sich der gleichen Prüfung in einem späteren Prüfungszeitraum unterziehen wollen,<br />
werden als Zuhörerinnen oder Zuhörer zugelassen, es sei denn, die Kandidatin oder der Kandidat<br />
widerspricht. Die Zulassung erstreckt sich jedoch nicht auf die Beratung <strong>und</strong> Bekanntgabe<br />
der Prüfungsergebnisse an die Kandidatin oder den Kandidaten.<br />
Veröffentlicht: http://www.schleswig-holstein.de/cae/servlet/contentblob/990686/publicationFile/nachrichtenblatt1_2011.pdf
Prüfungsverfahrensordnung Fachhochschule Flensburg Seite 6 von 14<br />
(6) In begründeten Ausnahmefällen kann der Prüfungsausschuss anstelle einer mündlichen Prüfung<br />
eine Prüfung entsprechend § 11 oder § 13 als Prüfungsform zulassen. Entsprechende Anträge<br />
sind binnen einer Frist von maximal vier Wochen nach Beginn der offiziellen Vorlesungszeit zu<br />
stellen.<br />
§ 13<br />
Sonstige Prüfungen<br />
(1) Sonstige Prüfungen können unter anderem Hausarbeiten, Referate, praktische Übungsleistungen,<br />
Fallstudien, Projekte, Entwürfe, Computerprogramme oder auch eine Kombination der genannten<br />
Formen sein. In den Prüfungs- <strong>und</strong> Studienordnungen der jeweiligen Studiengänge sind<br />
für Pflichtmodule gem. § 3 Abs. 2 bis zu drei mögliche Formen festzulegen.<br />
(2) Handelt es sich um ein Wahlpflichtmodul, ist zu Beginn der Vorlesungen jeden Semesters die<br />
konkrete Form der Prüfung von der oder dem betreffenden Prüfungsberechtigten gegenüber<br />
den Studierenden <strong>und</strong> dem Prüfungsausschuss bekannt zu geben.<br />
(3) Soweit die Form der sonstigen Prüfung <strong>und</strong> das Angebot der Lehrveranstaltung keine Wiederholung<br />
gemäß § 6 Abs. 3 ermöglichen, hat die Bekanntmachung der Wiederholungsmöglichkeit mit<br />
der Bekanntmachung der Form der Prüfung zu erfolgen.<br />
(4) In begründeten Ausnahmefällen kann der Prüfungsausschuss anstelle der sonstigen Prüfung eine<br />
Prüfung entsprechend § 11 oder § 12 als Prüfungsform zulassen. Entsprechende Anträge sind<br />
binnen einer Frist von maximal vier Wochen nach Beginn der offiziellen Vorlesungszeit zu stellen.<br />
§ 14<br />
Bewertung der Prüfungen, Bildung der Noten, Credit Points<br />
(1) Für eine Prüfung werden die Leistungen der einzelnen Kandidatinnen <strong>und</strong> Kandidaten bewertet.<br />
Arbeiten von Gruppen können für die einzelnen Kandidatinnen oder Kandidaten nur insoweit als<br />
Prüfung anerkannt werden, als die zu bewertenden individuellen Leistungen der einzelnen Kandidatinnen<br />
oder Kandidaten deutlich unterscheidbar <strong>und</strong> in sich verständlich sind. Die Abgrenzung<br />
muss aufgr<strong>und</strong> objektiver Kriterien erfolgen.<br />
(2) Prüfungen werden in der Regel von der oder dem Prüfungsberechtigten bewertet, in deren oder<br />
dessen Lehrveranstaltung Leistungen zu erbringen waren. Bestehen diese Leistungen aus mehreren<br />
Einzelleistungen, muss jede Einzelleistung mindestens ausreichend sein. Die Fachnote ergibt<br />
sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelleistungen, es sei denn, es ist in einem Fach etwas<br />
anderes gesondert ausgewiesen.<br />
(3) Für die Bewertung der Prüfungen sind folgende Noten zu verwenden:<br />
1 = Sehr gut = eine hervorragende Leistung;<br />
2 = Gut = eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen<br />
liegt;<br />
3 = Befriedigend = eine Leistung, die den durchschnittlichen Anforderungen genügt;<br />
4 = Ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen<br />
genügt;<br />
5 = Nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen ihrer erheblichen Mängel den Anforderungen<br />
nicht mehr genügt.<br />
(4) Bei der Ermittlung der Noten können die zugr<strong>und</strong>e liegenden Einzelbewertungen im Bewertungsbereich<br />
zwischen 1,0 <strong>und</strong> 4,0 zur besseren Differenzierung der tatsächlichen Leistungen um<br />
Veröffentlicht: http://www.schleswig-holstein.de/cae/servlet/contentblob/990686/publicationFile/nachrichtenblatt1_2011.pdf
Prüfungsverfahrensordnung Fachhochschule Flensburg Seite 7 von 14<br />
+/- 0,3 von den ganzen Zahlen abweichen. Dabei sind die Noten 0,7 4,3, 4,7 <strong>und</strong> 5,3 ausgeschlossen.<br />
(5) Werden Noten gemittelt, so lauten sie bei einem Durchschnitt<br />
von 1,0 bis 1,5 = Sehr gut,<br />
über 1,5 bis 2,5 = Gut,<br />
über 2,5 bis 3,5 = Befriedigend,<br />
über 3,5 bis 4,0 = Ausreichend,<br />
über 4,0 = Nicht ausreichend.<br />
Die Noten werden bis zur ersten Dezimalstelle nach dem Komma errechnet. Alle weiteren Stellen<br />
werden ohne R<strong>und</strong>ung gestrichen.<br />
(6) Die Übertragbarkeit <strong>und</strong> Anerkennung der Bewertung von Leistungen, die von Studierenden an<br />
Hochschulen außerhalb der B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland erbracht worden sind, werden durch<br />
den Prüfungsausschuss geregelt.<br />
(7) Das Ergebnis einer Prüfung wird, unter dem Vorbehalt der endgültigen Feststellung in der jeweiligen<br />
Sitzung des Prüfungsausschusses, vom Prüfungsausschuss unter Wahrung der datenschutzrechtlichen<br />
Vorschriften in hochschulüblicher Form bekannt gemacht.<br />
(8) Prüfungen sind innerhalb einer Frist von drei Wochen zu bewerten. Dies gilt nicht für die Bewertung<br />
der Abschlussarbeit (§ 22 Abs. 4).<br />
(9) Im Rahmen des European Credit Transfer Systems (ECTS) werden allen Studierenden Credit<br />
Points für die erfolgreich abgeschlossenen Pflicht- <strong>und</strong> Wahlpflichtmodule gutgeschrieben, die,<br />
unabhängig von der Bewertung der betreffenden Studien-, Prüfungs- oder Prüfungsvorleistung,<br />
den Arbeitsaufwand für jede einzelne Veranstaltung dokumentieren.<br />
§ 15<br />
Prüfungsausschuss, Organisation der Prüfungen<br />
(1) Für die Organisation der Prüfungen setzt die Hochschule einen Prüfungsausschuss ein. Seine Aufgaben<br />
bestimmen sich nach dieser Prüfungsverfahrensordnung sowie nach den Prüfungs- <strong>und</strong><br />
Studienordnungen der jeweiligen Studiengänge.<br />
(2) Dieser hat in der Regel nicht mehr als sieben Mitglieder. Die Amtszeit der Mitglieder beträgt drei<br />
Jahre. Für das studentische Mitglied beträgt die Amtszeit mindestens ein Jahr. Eine Wiederwahl<br />
der Mitglieder des Prüfungsausschusses ist zulässig.<br />
(3) Die oder der Vorsitzende, die Stellvertreterin oder der Stellvertreter sowie die weiteren Mitglieder<br />
<strong>und</strong> deren Stellvertreterinnen oder Stellvertreter des Prüfungsausschusses werden von den<br />
Fachbereichskonventen bestellt. Die Professorenschaft verfügt mindestens über die absolute<br />
Mehrheit der Stimmen <strong>und</strong> stellt die Vorsitzende oder den Vorsitzenden <strong>und</strong> die Stellvertreterin<br />
oder den Stellvertreter.<br />
(4) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn neben der oder dem Vorsitzenden oder der<br />
Stellvertreterin oder dem Stellvertreter <strong>und</strong> einem weiteren Mitglied der Professorenschaft mindestens<br />
zwei weitere stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. Er beschließt mit einfacher<br />
Mehrheit. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Das studentische Mitglied kann im<br />
Prüfungsausschuss nur bei der Erörterung gr<strong>und</strong>sätzlicher <strong>und</strong> organisatorischer Angelegenheiten<br />
mitwirken.<br />
(5) Der Prüfungsausschuss trifft alle Entscheidungen, die den organisatorischen Ablauf der Prüfungen<br />
betreffen.<br />
(6) Der Prüfungsausschuss kann die Erledigung seiner Aufgaben für alle Regelfälle auf die Vorsitzende<br />
oder den Vorsitzenden übertragen.<br />
Veröffentlicht: http://www.schleswig-holstein.de/cae/servlet/contentblob/990686/publicationFile/nachrichtenblatt1_2011.pdf
Prüfungsverfahrensordnung Fachhochschule Flensburg Seite 8 von 14<br />
(7) Der Prüfungsausschuss achtet auf die Einhaltung der Bestimmungen der Prüfungsverfahrens-<br />
sowie der Prüfungs- <strong>und</strong> Studienordnungen. Er berichtet regelmäßig den Fachbereichskonventen<br />
über die Entwicklung der Prüfungen <strong>und</strong> der Studienzeiten, gibt Anregungen <strong>und</strong> legt die Verteilung<br />
der Fachnoten <strong>und</strong> Gesamtnoten offen.<br />
(8) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnahme der Prüfungen beizuwohnen.<br />
(9) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht<br />
im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden zur Verschwiegenheit<br />
zu verpflichten.<br />
§ 16<br />
Prüfungsberechtigte <strong>und</strong> Beisitzerinnen oder Beisitzer<br />
(1) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüferinnen oder Prüfer (Prüfungsberechtigte) sowie Beisitzerinnen<br />
oder Beisitzer. Er kann die Bestellung der oder dem Vorsitzenden übertragen.<br />
(2) Zu Prüfungsberechtigten können bestellt werden:<br />
1. Professorinnen <strong>und</strong> Professoren,<br />
2. wissenschaftliche Mitarbeiterinnen <strong>und</strong> Mitarbeiter, Lehrbeauftragte <strong>und</strong> Lehrkräfte für besondere<br />
Aufgaben, die die Voraussetzungen des § 51 Abs. 3 HSG erfüllen.<br />
(3) Zu Beisitzerinnen oder Beisitzern kann bestellt werden, wer über die notwendige Sachkenntnis<br />
verfügt.<br />
(4) Prüfungsberechtigte handeln im Namen des Prüfungsausschusses. Sie sind bei der Beurteilung<br />
der Prüfungen nicht an Weisungen geb<strong>und</strong>en.<br />
(5) Für Prüfungsberechtigte <strong>und</strong> Beisitzerinnen oder Beisitzer gilt § 15 Abs. 9 entsprechend.<br />
§ 17<br />
Anrechnung von Prüfungen<br />
(1) Studien- <strong>und</strong> Prüfungsleistungen, die an inländischen oder anerkannten ausländischen Hochschulen<br />
erbracht worden sind, werden anerkannt, wenn sie gleichwertig sind. Dabei sind die von<br />
der Kultusministerkonferenz <strong>und</strong> Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzabkommen<br />
sowie Absprachen im Rahmen von Hochschulkooperationsvereinbarungen anzuwenden. Außerhalb<br />
von Hochschulen erworbene Kenntnisse <strong>und</strong> Fähigkeiten können auf ein Hochschulstudium<br />
angerechnet werden, wenn<br />
1. die für den Hochschulzugang geltenden Voraussetzungen erfüllt sind,<br />
2. die anzurechnenden Kenntnisse <strong>und</strong> Fähigkeiten den Studien- <strong>und</strong> Prüfungsleistungen, die<br />
sie ersetzen sollen, gleichwertig sind <strong>und</strong><br />
3. die Kriterien für die Anrechnung im Rahmen der Akkreditierung überprüft worden sind.<br />
Insgesamt dürfen nicht mehr als 50 % der Prüfungsleistungen angerechnet werden. In den Prüfungs-<br />
<strong>und</strong> Studienordnungen der jeweiligen Studiengänge regelt die Hochschule, unter welchen<br />
Voraussetzungen Kenntnisse <strong>und</strong> Fähigkeiten, die außerhalb von Hochschulen erworben wurden,<br />
ohne Einstufungsprüfung angerechnet werden. In Einzelfällen ist eine Einstufungsprüfung<br />
zulässig.<br />
Veröffentlicht: http://www.schleswig-holstein.de/cae/servlet/contentblob/990686/publicationFile/nachrichtenblatt1_2011.pdf
Prüfungsverfahrensordnung Fachhochschule Flensburg Seite 9 von 14<br />
(2) Werden Prüfungen angerechnet, sind an inländischen Hochschulen erbrachte Noten zu übernehmen.<br />
Für die Anrechnung von an ausländischen Hochschulen erbrachten Leistungen gilt § 14<br />
Abs. 8. Angerechnete Noten sind in die Berechnung der Gesamtnote zu übernehmen. Eine Kennzeichnung<br />
der Anrechnung im Zeugnis ist zulässig. Ebenso sind die erzielten Credit Points zu<br />
übernehmen.<br />
(3) Eine Thesis aus einem anderen <strong>Studiengang</strong> oder einer anderen Studienrichtung wird nicht anerkannt.<br />
(4) Bei Vorliegen der Voraussetzungen des Abs. 1 besteht ein Rechtsanspruch auf Anrechnung. Die<br />
Anrechnung von Prüfungen erfolgt durch den Prüfungsausschuss. Die Studierenden haben die für<br />
die Anrechnung erforderlichen Unterlagen vorzulegen. Zum Nachweis der fachlichen Gleichwertigkeit<br />
kann der Prüfungsausschuss Gutachten anfordern.<br />
§ 18<br />
Nachteilsausgleich bei Behinderung; Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß<br />
(1) Körperlich Beeinträchtigten oder Behinderten, die durch ein fachärztliches Zeugnis oder durch<br />
Vorlage des Schwerbehindertenausweises glaubhaft machen, dass sie nicht in der Lage sind, eine<br />
Prüfung oder eine für die Zulassung zur Prüfung zu erbringende Teilleistung ganz oder teilweise<br />
in der vorgesehenen Form abzulegen, kann die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses<br />
gestatten, eine gleichwertige Prüfung in einer anderen Form abzulegen oder die Bearbeitungszeit<br />
zu verlängern.<br />
(2) Eine Prüfung gilt als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet, wenn die Kandidatin oder der Kandidat<br />
nach erfolgter Anmeldung zu einem Prüfungstermin ohne triftige Gründe nicht erscheint oder<br />
wenn sie oder er nach Beginn der Prüfung ohne triftige Gründe von der Prüfung zurücktritt.<br />
Dasselbe gilt, wenn eine Prüfung nicht oder nicht fristgerecht abgegeben oder erbracht wird.<br />
(3) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe müssen dem Prüfungsausschuss<br />
unverzüglich - spätestens innerhalb von drei Werktagen (einschließlich Samstag) nach Eintritt<br />
des Gr<strong>und</strong>es oder nach der versäumten Prüfung - schriftlich angezeigt <strong>und</strong> glaubhaft gemacht<br />
werden. Zur Wahrung der Frist ist der Eingang beim Prüfungsamt erforderlich, die Abgabe<br />
bei der Post (Poststempel) genügt nicht. Bei Krankheit der Kandidatin oder des Kandidaten ist ein<br />
ärztliches <strong>und</strong> in Zweifelsfällen ein amtsärztliches Attest, aus dem die Prüfungsunfähigkeit hervorgeht,<br />
vorzulegen. Sollte diese Vorlage aus wichtigem Gr<strong>und</strong> nicht innerhalb der oben genannten<br />
Frist möglich sein, so ist das Prüfungsamt innerhalb der Frist in angemessener Weise darüber<br />
zu verständigen. Werden die Gründe für den Rücktritt oder das Versäumnis anerkannt, so wird<br />
dieser Versuch nicht als Prüfungsversuch gewertet.<br />
(4) Versucht die Kandidatin oder der Kandidat, das Ergebnis ihrer oder seiner Prüfung durch Täuschung<br />
oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die betreffende Prüfung<br />
als mit „nicht ausreichend" (5,0) bewertet. Die Bewertung „nicht ausreichend" (5,0) gilt<br />
auch dann, wenn die Täuschung erst nach Abschluss der Prüfung entdeckt wird. Eine Kandidatin<br />
oder ein Kandidat, die oder der vorsätzlich den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört, kann<br />
von den jeweiligen Prüfungsberechtigten oder der oder dem Aufsichtführenden von der weiteren<br />
Teilnahme an dieser Prüfung ausgeschlossen werden. In diesem Fall gilt die betreffende Prüfung<br />
als mit „nicht ausreichend" (5,0) bewertet.<br />
§ 19<br />
Verfahren bei Widersprüchen<br />
(1) Belastende Entscheidungen des Prüfungsausschusses oder seiner oder seines Vorsitzenden sind<br />
den Kandidatinnen oder Kandidaten schriftlich mitzuteilen, zu begründen <strong>und</strong> mit einer Rechtsbehelfsbelehrung<br />
zu versehen.<br />
Veröffentlicht: http://www.schleswig-holstein.de/cae/servlet/contentblob/990686/publicationFile/nachrichtenblatt1_2011.pdf
Prüfungsverfahrensordnung Fachhochschule Flensburg Seite 10 von 14<br />
(2) Gegen die Entscheidung der Prüfungsberechtigten, des Prüfungsausschusses <strong>und</strong> der oder des<br />
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses kann die Kandidatin oder der Kandidat innerhalb eines<br />
Monats nach Bekanntgabe der Entscheidung Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist schriftlich<br />
oder zur Niederschrift bei der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses ein-zulegen.<br />
Über den Widerspruch entscheidet der Prüfungsausschuss.<br />
(3) Gegen die Entscheidung des Prüfungsausschusses über den Widerspruch kann die Kandidatin<br />
oder der Kandidat innerhalb eines Monats nach Zustellung des Widerspruchsbescheides Klage<br />
vor dem Schleswig-Holsteinischen Verwaltungsgericht erheben.<br />
§ 20<br />
Umfang <strong>und</strong> Art der Bachelor- <strong>und</strong> Master-Prüfung, Thesis<br />
(1) Die Thesis beinhaltet die schriftliche Abschlussarbeit (§§ 21 – 23) <strong>und</strong>, soweit in den Prüfungs-<br />
<strong>und</strong> Studienordnungen des entsprechenden <strong>Studiengang</strong>s vorgesehen, ein Kolloquium (§24).<br />
(2) Umfang <strong>und</strong> andere Anforderungen an die Thesis werden in der Prüfungs- <strong>und</strong> Studienordnung<br />
des entsprechenden <strong>Studiengang</strong>s geregelt. § 14 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend.<br />
§ 21<br />
Abschlussarbeit<br />
(1) Die Abschlussarbeit ist eine das Bachelor-Studium abschließende Prüfungsarbeit. In der Abschlussarbeit<br />
sollen die Kandidatinnen <strong>und</strong> Kandidaten zeigen, dass sie in der Lage sind, ein Problem<br />
ihrer Fachrichtung selbstständig auf wissenschaftlicher Gr<strong>und</strong>lage methodisch zu bearbeiten.<br />
Die Master- Abschlussarbeit ist eine das Master-Studium abschließende Prüfungsarbeit. In der<br />
Master- Abschlussarbeit sollen die Kandidatinnen <strong>und</strong> Kandidaten zeigen, dass sie innerhalb einer<br />
vorgegebenen Frist ein Problem aus ihrem Fachgebiet selbstständig nach wissenschaftlichen<br />
Methoden bearbeiten können.<br />
(2) Die Bachelor- Abschlussarbeit wird in der Regel nach dem Berufspraktikum bearbeitet. Die Master-<br />
Abschlussarbeit ist in der Regel nach Abschluss aller Prüfungen des Master-Studiums zu bearbeiten.<br />
Ausnahmen davon regeln die Studien- <strong>und</strong> Prüfungsordnungen der jeweiligen Studiengänge.<br />
Die Prüfungs- <strong>und</strong> Studienordnungen der entsprechenden Studiengänge können vorsehen,<br />
dass für die Zulassung zur Abschlussarbeit Vorbedingungen erfüllt sein müssen.<br />
(3) Das Thema der Abschlussarbeit kann von jeder Professorin oder jedem Professor oder jeder anderen<br />
prüfungsberechtigten Person gestellt werden. Die zur Themenvergabe berechtigte Person<br />
muss in einem für den <strong>Studiengang</strong> relevanten Bereich an der Fachhochschule Flensburg tätig<br />
sein. Der Kandidatin oder dem Kandidaten ist Gelegenheit zu geben, für das Thema der Abschlussarbeit<br />
Vorschläge zu machen. Auf Antrag sorgt die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses<br />
dafür, dass eine Kandidatin oder ein Kandidat rechtzeitig ein Thema für eine Abschlussarbeit<br />
erhält.<br />
(4) Die Abschlussarbeit kann auch in Form einer Gruppenarbeit zugelassen werden, wenn der als<br />
Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag der einzelnen Kandidatinnen oder Kandidaten aufgr<strong>und</strong><br />
der Angabe von Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien, die eine eindeutige<br />
Abgrenzung ermöglichen, deutlich unterscheidbar <strong>und</strong> bewertbar ist <strong>und</strong> die Anforderungen<br />
nach Abs. 1 erfüllt.<br />
(5) Die Ausgabe des Themas der Abschlussarbeit erfolgt über die Vorsitzende oder den Vorsitzenden<br />
des Prüfungsausschusses. Mit der Ausgabe des Themas beginnt die Frist für die Bearbeitungszeit<br />
der Abschlussarbeit. Der Zeitpunkt der Ausgabe ist aktenk<strong>und</strong>ig zu machen.<br />
Veröffentlicht: http://www.schleswig-holstein.de/cae/servlet/contentblob/990686/publicationFile/nachrichtenblatt1_2011.pdf
Prüfungsverfahrensordnung Fachhochschule Flensburg Seite 11 von 14<br />
(6) Die reguläre Bearbeitungszeit für die Abschlussarbeit wird in den Prüfungs- <strong>und</strong> Studienordnungen<br />
der jeweiligen Studiengänge festgelegt. In begründeten Ausnahmefällen legt die oder der<br />
Vorsitzende des Prüfungsausschusses auf Vorschlag der Betreuerin oder des Betreuers die Bearbeitungszeit<br />
bei der Ausgabe des Themas fest. In beiden Fällen ist das Datum der spätesten Abgabe<br />
der Abschlussarbeit aktenk<strong>und</strong>ig zu machen. Thema <strong>und</strong> Aufgabenstellung der Abschlussarbeit<br />
müssen so gefasst sein, dass die zur Bearbeitung vorgegebene Frist eingehalten werden<br />
kann.<br />
(7) Das Thema der Abschlussarbeit kann nur einmal innerhalb einer in den Prüfungs- <strong>und</strong> Studienordnungen<br />
der jeweiligen Studiengänge festgelegten Frist zurückgegeben werden. Eine spätere<br />
Rückgabe des Themas wird als Nichtbearbeitung bewertet. Bei Nichtbearbeitung wird die Abschlussarbeit<br />
mit „nicht ausreichend" (5,0) bewertet.<br />
(8) In Ausnahmefällen kann der Prüfungsausschuss die Bearbeitungszeit auf Antrag um eine in den<br />
Prüfungs- <strong>und</strong> Studienordnungen der jeweiligen Studiengänge festgelegte Frist verlängern, sofern<br />
die oder der Studierende die Verlängerung nicht durch einen in ihrer oder seiner Person liegenden<br />
Gr<strong>und</strong> zu vertreten hat. Ein Antrag auf Verlängerung der Bearbeitungszeit sollte bis spätestens<br />
zu einer in den Prüfungs- <strong>und</strong> Studienordnungen der jeweiligen Studiengänge festgelegten<br />
Frist vor dem Abgabetermin der Abschlussarbeit gestellt werden. Bei krankheitsbedingten<br />
Verlängerungsanträgen ist unverzüglich ein ärztliches Attest einzureichen. In allen anderen Fällen<br />
ist dem Antrag eine f<strong>und</strong>ierte Stellungnahme der Betreuerin oder des Betreuers der Abschlussarbeit<br />
beizufügen, der zu entnehmen ist, aus welchen Gründen das in der festgesetzten Bearbeitungszeit<br />
erreichte Ergebnis für eine Bewertung der Abschlussarbeit nicht ausreichend ist.<br />
(9) Bei der Abgabe der Abschlussarbeit hat die Kandidatin oder der Kandidat schriftlich zu versichern,<br />
dass sie oder er ihre oder seine Prüfungsarbeit - bei einer Gruppenarbeit ihren oder seinen<br />
entsprechend gekennzeichneten Anteil der Prüfungsarbeit - selbstständig verfasst <strong>und</strong> keine<br />
anderen als die angegebenen Quellen <strong>und</strong> Hilfsmittel benutzt hat.<br />
§ 22<br />
Annahme <strong>und</strong> Bewertung der Abschlussarbeit<br />
(1) Die Abschlussarbeit ist fristgemäß bei der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses abzuliefern.<br />
Der Abgabezeitpunkt ist aktenk<strong>und</strong>ig zu machen. Wird die Abschlussarbeit verspätet abgegeben,<br />
so gilt sie als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet.<br />
(2) Die Abschlussarbeit ist in dreifacher Ausfertigung, soweit dies die Art der Arbeit zulässt, abzugeben<br />
oder - mit dem Poststempel spätestens des letzten Tages der Frist versehen - zu übersenden.<br />
Zusätzlich ist jedes Exemplar der Abschlussarbeit mit einem Datenträger, der die Abschlussarbeit<br />
in elektronischer Form enthält, zu versehen.<br />
(3) Die Abschlussarbeit ist von zwei prüfungsberechtigten Personen zu bewerten, darunter soll die<br />
Betreuerin oder der Betreuer der Abschlussarbeit sein. Können sich die Prüfungsberechtigten<br />
nicht auf eine Note einigen, entscheidet der Prüfungsausschuss.<br />
(4) Die Abschlussarbeit ist innerhalb einer Frist von sechs Wochen zu bewerten.<br />
§ 23<br />
Wiederholung der Abschlussarbeit<br />
Ist eine Abschlussarbeit mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet worden, kann die Anfertigung der<br />
Abschlussarbeit nur einmal wiederholt werden. Die Rückgabe des Themas im zweiten Versuch innerhalb<br />
der Bearbeitungszeit ist nur zulässig, wenn davon im ersten Versuch (§ 21 Abs. 7) kein Gebrauch<br />
gemacht worden ist.<br />
Veröffentlicht: http://www.schleswig-holstein.de/cae/servlet/contentblob/990686/publicationFile/nachrichtenblatt1_2011.pdf
Prüfungsverfahrensordnung Fachhochschule Flensburg Seite 12 von 14<br />
§ 24<br />
Kolloquium<br />
(1) Sofern die Prüfungs- <strong>und</strong> Studienordnung eines <strong>Studiengang</strong>es ein Kolloquium vorsieht, ist dieses<br />
eine Fächer übergreifende mündliche Prüfung, ausgehend vom Themenkreis der Abschlussarbeit.<br />
Die Kandidatin oder der Kandidat soll darin zeigen, dass sie oder er<br />
1. die Ergebnisse ihrer oder seiner Abschlussarbeit selbstständig erläutern <strong>und</strong> vertreten kann,<br />
2. darüber hinaus in der Lage ist, andere mit dem Thema der Abschlussarbeit zusammenhängende<br />
Probleme ihres oder seines <strong>Studiengang</strong>es zu erkennen <strong>und</strong> Lösungsmöglichkeiten<br />
aufzuzeigen <strong>und</strong><br />
3. bei ihrer oder seiner Abschlussarbeit gewonnene wissenschaftliche Erkenntnisse auf Sachverhalte<br />
aus dem Bereich ihrer oder seiner zukünftigen Berufstätigkeit anwenden kann.<br />
(2) Das Kolloquium soll von den Prüfungsberechtigten der Abschlussarbeit abgenommen werden.<br />
Die anwesenden Prüfungsberechtigten prüfen gleichberechtigt. Die Dauer des Kolloquiums ist in<br />
der jeweiligen für den <strong>Studiengang</strong> gültigen Prüfungs- <strong>und</strong> Studienordnung festgelegt. Die Note<br />
ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen. § 12 Abs. 5 findet entsprechend<br />
Anwendung.<br />
(3) Zulassungsvoraussetzung <strong>zum</strong> Kolloquium ist eine mit mindestens „ausreichend“ (4,0) bestandene<br />
Abschlussarbeit.<br />
(4) Ein Kolloquium kann im Falle des Nichtbestehens nur einmal wiederholt werden.<br />
(5) Das Kolloquium soll innerhalb von i.d.R. 14 Tagen nach der Bewertung der Abschlussarbeit<br />
durchgeführt werden.<br />
§ 25<br />
Bestehen der Bachelor- <strong>und</strong> Master-Prüfung, Bildung der Gesamtnote<br />
(1) Die Bachelor- <strong>und</strong> die Master-Prüfung sind jeweils bestanden, wenn<br />
1. in allen Prüfungsleistungen mindestens die Note „ausreichend“ (4,0) erzielt worden ist,<br />
2. die Thesis mit mindestens „ausreichend“ (4,0) bewertet worden ist,<br />
3. die erfolgreiche Teilnahme an den gemäß der jeweiligen Prüfungs- <strong>und</strong> Studienordnung geforderten<br />
Studien- <strong>und</strong> Prüfungsvorleistungen nachgewiesen ist.<br />
(2) Das Bestehen der Bachelor- <strong>und</strong> Master-Prüfung wird durch den Prüfungsausschuss festgestellt.<br />
(3) Die Gesamtnote der Bachelor- <strong>und</strong> Master-Prüfung wird ermittelt als gewichtetes, arithmetisches<br />
Mittel aus den Noten der Prüfungsleistungen, der Bachelor- oder Master- Thesis. Einzelheiten<br />
regeln die Prüfungs- <strong>und</strong> Studienordnungen der jeweiligen Studiengänge.<br />
(4) Credit Points <strong>und</strong> Noten sind getrennt auszuweisen.<br />
§ 26<br />
Zeugnis<br />
(1) Über die bestandene Bachelor- oder Master-Prüfung wird unverzüglich, möglichst innerhalb von<br />
sechs Wochen nach Abschluss der letzten Prüfungs- oder Studienleistung, ein Zeugnis ausgestellt.<br />
Es enthält den Namen des <strong>Studiengang</strong>es <strong>und</strong> die Noten der einzelnen Prüfungsleistungen.<br />
Als Datum des Zeugnisses ist der Tag anzugeben, an dem die letzte Prüfungs- oder Studienleistung<br />
erbracht worden ist.<br />
(2) Das Zeugnis über die bestandene Bachelor- oder Master-Prüfung enthält außerdem Thema <strong>und</strong><br />
Note der Thesis sowie die Gesamtnote.<br />
Veröffentlicht: http://www.schleswig-holstein.de/cae/servlet/contentblob/990686/publicationFile/nachrichtenblatt1_2011.pdf
Prüfungsverfahrensordnung Fachhochschule Flensburg Seite 13 von 14<br />
(3) Das Zeugnis über die bestandene Prüfung trägt die Unterschriften von der oder dem Vorsitzenden<br />
des Prüfungsausschusses sowie von der Dekanin oder dem Dekan.<br />
(4) Zusätzlich <strong>zum</strong> Zeugnis über eine bestandene Bachelor- oder Master-Prüfung erhält die Kandidatin<br />
oder der Kandidaten eine vollständige Aufstellung aller im Studium erbrachten Leistungen<br />
(Notenkonto). Die Noten der Wahlfächer können auf Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten<br />
in das Zeugnis aufgenommen werden. Das Ergebnis der Prüfung in diesen Fächern wird bei der<br />
Festsetzung der Gesamtnote nicht mit einbezogen.<br />
(5) Hat die Kandidatin oder der Kandidat die Bachelor- oder Master-Prüfung endgültig nicht bestanden,<br />
ist ihr oder ihm auf Antrag von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses eine<br />
Bescheinigung auszustellen, die die bisher erbrachten Leistungen enthält <strong>und</strong> den Vermerk, dass<br />
die Prüfung endgültig nicht bestanden ist.<br />
(6) Ausländischen Studierenden kann im Rahmen von Kooperationsprogrammen mit ausländischen<br />
Partnerhochschulen ein gesondertes Hochschulzertifikat ausgestellt werden. Ein Hochschulzertifikat<br />
bescheinigt die erfolgreiche Erbringung von Prüfungen im Rahmen eines in sich abgeschlossenen<br />
Studienprogramms. Die Bezeichnung <strong>und</strong> die Form des Hochschulzertifikates sowie die zu<br />
seiner Erlangung zu erbringenden Prüfungen sind in einer Kooperationsvereinbarung mit der<br />
ausländischen Partnerhochschule festzulegen.<br />
§ 27<br />
Urk<strong>und</strong>e<br />
(1) Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird der Kandidatin oder dem Kandidaten die Bachelor-Urk<strong>und</strong>e<br />
mit dem Datum des Zeugnisses ausgehändigt. Darin wird die Verleihung des Bachelor-Grades<br />
beurk<strong>und</strong>et. Im Falle des Master-Studiums wird der Kandidatin oder dem Kandidaten die Master-<br />
Urk<strong>und</strong>e mit dem Datum des Zeugnisses ausgehändigt. Darin wird die Verleihung des Master-<br />
Grades der Hochschule beurk<strong>und</strong>et.<br />
(2) Die Urk<strong>und</strong>e trägt die Unterschrift der Präsidentin oder des Präsidenten der Fachhochschule<br />
Flensburg <strong>und</strong> der oder des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses <strong>und</strong> ist mit dem Siegel der<br />
Fachhochschule versehen.<br />
(3) Der Urk<strong>und</strong>e über die Verleihung des akademischen Grades fügt die Hochschule ein Diploma-<br />
Supplement bei.<br />
§ 28<br />
Ungültigkeit der Bachelor- <strong>und</strong> Master-Prüfung<br />
(1) Hat die Kandidatin oder der Kandidat bei einer Prüfung getäuscht <strong>und</strong> wird diese Tatsache erst<br />
nach der Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so kann der Prüfungsausschuss nachträglich die<br />
Note für diejenigen Prüfungsleistungen, bei deren Erbringung die Kandidatin oder der Kandidat<br />
getäuscht hat, entsprechend berichtigen <strong>und</strong> die Bachelor- <strong>und</strong> Master Prüfung ganz oder teilweise<br />
für nicht bestanden erklären.<br />
(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass die Kandidatin<br />
oder der Kandidat hierüber täuschen wollte, <strong>und</strong> wird diese Tatsache erst nach der Aushändigung<br />
des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfung geheilt.<br />
Hat die Kandidatin oder der Kandidat die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, so entscheidet<br />
der Prüfungsausschuss unter Beachtung der allgemeinen verwaltungs-rechtlichen<br />
Gr<strong>und</strong>sätze über die Rücknahme von Verwaltungsakten.<br />
(3) Der Kandidatin oder dem Kandidaten ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu<br />
geben.<br />
Veröffentlicht: http://www.schleswig-holstein.de/cae/servlet/contentblob/990686/publicationFile/nachrichtenblatt1_2011.pdf
Prüfungsverfahrensordnung Fachhochschule Flensburg Seite 14 von 14<br />
(4) Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen <strong>und</strong> gegebenenfalls ein neues zu erteilen. Mit<br />
dem unrichtigen Prüfungszeugnis ist auch die Urk<strong>und</strong>e einzuziehen, wenn die Prüfung aufgr<strong>und</strong><br />
der Täuschungshandlung für „nicht bestanden“ erklärt wird. Eine Entscheidung nach Abs. 1 <strong>und</strong><br />
Abs. 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren ab dem Datum des Prüfungszeugnisses ausgeschlossen.<br />
§ 29<br />
Prüfungsakten<br />
Die Kandidatin oder der Kandidat kann ihre oder seine schriftlichen Prüfungsarbeiten <strong>und</strong> die dazugehörenden<br />
Bewertungen sowie die Prüfungsprotokolle einsehen. Die Prüfungsakten sind noch fünf<br />
Jahre nach Ablauf des Prüfungsjahres, in dem sie erstellt wurden, aufzubewahren, es sei denn, dass<br />
sie für ein noch nicht rechtskräftig abgeschlossenes Rechtsmittelverfahren benötigt werden. Eine<br />
Ausfertigung des Zeugnisses über die bestandene Bachelor- oder Master-Prüfung ist mindestens 50<br />
Jahre aufzubewahren.<br />
§ 30<br />
In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten<br />
(1) Diese Prüfungsverfahrensordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntgabe in Kraft.<br />
(2) Die Prüfungsverfahrensordnung vom 24.03.2006, zuletzt geändert durch Änderungssatzung vom<br />
18. März 2009, tritt am Tag nach der Bekanntgabe dieser Prüfungsverfahrensordnung außer<br />
Kraft.<br />
Flensburg, den 27.12.2010<br />
FACHHOCHSCHULE FLENSBURG<br />
Der Präsident –<br />
Prof. Dr. Herbert Zickfeld<br />
Veröffentlicht: http://www.schleswig-holstein.de/cae/servlet/contentblob/990686/publicationFile/nachrichtenblatt1_2011.pdf
3. Prüfungs- <strong>und</strong> Studienordnung des <strong>Studiengang</strong>es <strong>Schiffstechnik</strong><br />
http://www.fh-flensburg.de/satzung/b/spo_schiffst_ba_03022011.pdf<br />
Quelle: BBS
Prüfungs- <strong>und</strong> Studienordnung<br />
(Satzung) des Fachbereichs Technik für den Bachelor-<strong>Studiengang</strong><br />
<strong>Schiffstechnik</strong> an der Fachhochschule Flensburg vom 3. Februar 2011<br />
(1) Aufgr<strong>und</strong> des § 52 Abs. 1, Satz 1 des Hochschulgesetzes (HSG) vom 28. Februar 2007 (GVOBl. Schl.-<br />
H. S. 184), zuletzt geändert durch Artikel 12 des Gesetzes zur Umsetzung der Europäischen<br />
Dienstleistungsrichtlinie vom 9. März 2010 (GVOBl. Schl.H. S. 356) wird nach Beschlussfassung durch<br />
den Konvent des Fachbereichs Technik vom 12. Januar 2011 <strong>und</strong> nach Genehmigung des Präsidiums<br />
der Fachhochschule Flensburg vom 3. Februar 2011 folgende Satzung erlassen.<br />
(2) Diese Prüfungs- <strong>und</strong> Studienordnung bezieht sich auf die fächerübergreifenden Bestimmungen der<br />
Prüfungsverfahrensordnung (PVO) der Fachhochschule Flensburg.<br />
§ 1<br />
Studienablauf <strong>und</strong> Studienziel<br />
(1) Das Studium gliedert sich in die Studienrichtungen Schiffsmaschinenbau <strong>und</strong> Schiffsbetriebstechnik. In<br />
der Studienrichtung Schiffsmaschinenbau müssen in den ersten sechs Semestern die fachspezifischen<br />
Module belegt werden. Das siebte Semester beinhaltet ein Berufspraktikum <strong>und</strong> dient der Anfertigung<br />
der Bachelor-Thesis.<br />
In der Studienrichtung Schiffsbetriebstechnik beinhaltet das erste Studiensemester das erste Berufspraktikum.<br />
In den nachfolgenden sechs Semestern müssen die fachspezifischen Module belegt <strong>und</strong> am<br />
Ende des siebten Studiensemesters die Bachelor-Thesis angefertigt werden. Die fachlichen Inhalte der<br />
Module erfüllen die Rahmenordnungen für Fachhochschulen des Ständigen Arbeitskreises der Küstenländer<br />
für das Seefahrtbildungswesen (StAK). Das achte Semester beinhaltet das zweite Berufspraktikum.<br />
(2) Ziel des Bachelor-<strong>Studiengang</strong>s <strong>Schiffstechnik</strong> ist es, die Befähigung zu einer auf wissenschaftlicher<br />
Gr<strong>und</strong>lage beruhenden Tätigkeit im Berufsfeld Schiffsmaschinenbau oder Schiffsbetriebstechnik zu<br />
erwerben.<br />
(3) Mit dem Abschluss des Studiums in der Studienrichtung Schiffsbetriebstechnik erfüllt die oder der<br />
Studierende die hochschulseitigen Voraussetzungen zur Erteilung des Befähigungszeugnisses für den<br />
technischen Dienst als Wachoffizier mit den in der Schiffsoffiziers-Ausbildungsverordnung<br />
(SchOffzausbV) - in der jeweils geltenden Fassung - festgelegten Befugnissen.<br />
§ 2<br />
Abschluss<br />
(1) Aufgr<strong>und</strong> der bestandenen Bachelorprüfung wird der folgende Hochschulgrad verliehen:<br />
Bachelor of Engineering (abgekürzt B.Eng.)<br />
(2) Der Bachelorabschluss ist der erste Berufsqualifizierende Abschluss.<br />
§ 3<br />
Regelstudienzeit, Orientierungsphase, Studienvolumen<br />
(1) Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich der Bachelorprüfung <strong>und</strong> der jeweiligen Berufspraktika für<br />
den Schiffsmaschinenbau sieben Semester, für die Schiffsbetriebstechnik acht Semester. Näheres zu<br />
den Berufspraktika wird in der Praktikumsordnung <strong>zum</strong> Bachelor-<strong>Studiengang</strong> <strong>Schiffstechnik</strong> geregelt.<br />
(2) In der Studienrichtung Schiffsbetriebstechnik ersetzen eine abgeschlossene Ausbildung zur Schiffsmechanikerin/Schiffsmechaniker<br />
oder der Abschluss einer Berufsausbildung in der Metall- oder Elektrotechnik<br />
<strong>und</strong> eine Seefahrtszeit von 12 Monaten im Maschinendienst oder eine Ausbildung als Technische<br />
Offiziersassistentin/Technischer Offiziersassistent (TOA) die Berufspraktika.<br />
(3) Das Studium enthält eine einjährige Orientierungsphase, beginnend mit dem ersten Theoriesemester. In<br />
der Studienrichtung Schiffsmaschinenbau stellen die Prüfungsleistungen des ersten Studiensemesters<br />
die Orientierungsprüfung dar, in der Studienrichtung Schiffsbetriebstechnik die Prüfungsleistungen des<br />
zweiten Studiensemesters. Ist die Orientierungsprüfung nicht innerhalb der Orientierungsphase abge-<br />
1
schlossen, wird eine Studienberatung empfohlen. Ist die Orientierungsprüfung nicht erfolgreich abgeschlossen,<br />
darf in beiden Studienrichtungen an Prüfungen ab dem vierten Theoriesemester nicht teilgenommen<br />
werden.<br />
(4) In der Studienrichtung Schiffsmaschinenbau beträgt das Studienvolumen 147 Semesterwochenst<strong>und</strong>en<br />
<strong>und</strong> 210 Kreditpunkte (CP) einschließlich des Berufspraktikums, in der Studienrichtung Schiffsbetriebstechnik<br />
142 Semesterwochenst<strong>und</strong>en <strong>und</strong> 240 Kreditpunkte einschließlich der beiden Praxissemester.<br />
§ 4<br />
Module <strong>und</strong> Prüfungen<br />
(1) Die folgenden Tabellen zeigen die Modul- <strong>und</strong> Prüfungspläne für die jeweilige Studienrichtung.<br />
(2) Die Übertragbarkeit <strong>und</strong> Anerkennung der erlangten Noten regelt § 14 Absatz 6 der PVO. Die<br />
Zuordnung der CP zu den einzelnen Modulen ist den nachstehenden Tabellen zu entnehmen.<br />
(3) In den nachfolgenden Tabellen werden die hier erläuterten Abkürzungen verwendet:<br />
Art der Veranstaltung Art der Prüfung<br />
V Vorlesung PL Prüfungsleistung<br />
Ü Übung SL Studienleistung<br />
L Labor OP Orientierungsprüfung<br />
P Projekt<br />
Umfang der Veranstaltung Form der Prüfung<br />
SWS Semesterwochenst<strong>und</strong>en K (n) Klausur (St<strong>und</strong>en)<br />
CP Credit Points HA Hausaufgabe<br />
Arb Schriftliche Ausarbeitung<br />
Vort Vortrag, Referat<br />
MP Mündliche Prüfung<br />
SP Sonstige Prüfung<br />
PÜ Praktische Übungsleistung<br />
Modul- <strong>und</strong> Prüfungsplan im Bachelor- <strong>Studiengang</strong> – Studienrichtung Schiffsmaschinenbau<br />
1. Studiensemester (1. Theoriesemester) Schiffsmaschinenbau<br />
Modul Lehrveranstaltung Prüfung<br />
Art SWS CP Art Form (Umfang) Vorbedingungen<br />
Mathematik 1 Mathematik 1 V/Ü 4 5 PL K(2) keine<br />
Physik Physik V 4 5 PL K(2) Keine<br />
Elektrotechnik 1, Elektrotechnik 1, V 4 5 PL K(2) Keine<br />
Messtechnik Messtechnik<br />
Technische Technische Mechanik V/Ü 4 5<br />
Mechanik 1 1.1<br />
1) Zusammen mit Technische Keine<br />
Mechanik 1.2<br />
Gr<strong>und</strong>lagen der<br />
Werkstofftechnik<br />
Werkstofftechnik 1 V 2<br />
5 2)<br />
Zusammen mit<br />
Werkstofftechnik 2<br />
Keine<br />
Werkstofftechnik 1 L 2 erforderlich für Anerken-<br />
Keine<br />
Labor<br />
nung Gr<strong>und</strong>lagen der<br />
Werkstofftechnik<br />
Englisch Englisch 1 V 2 2 SL SP: K(1), Arb,<br />
Vort<br />
Keine<br />
Wirtschaft Gr<strong>und</strong>lagen BWL V 2 3 SL SP: K(1), Arb,<br />
Vort<br />
keine<br />
Module des 1. Studiensemesters 24 30 3 PL, 2 SL<br />
Hinweise: 1) Anrechnung erst nach Bestehen der Prüfungsleistung Technische Mechanik 1.2<br />
2) Anrechnung erst nach Bestehen der Prüfungsleistung Werkstofftechnik 2<br />
2
2. Studiensemester (2. Theoriesemester) Schiffsmaschinenbau<br />
Modul Lehrveranstaltung Prüfung<br />
Art SWS CP Art Form (Umfang) Vorbedingungen<br />
Informatik Informatik V/Ü 4 5 SL SP:<br />
Vort<br />
K(2), Arb, Keine<br />
Mathematik 2 Mathematik 2.1 V/Ü 4 5 1) Zusammen mit Mathematik<br />
2.2<br />
Keine<br />
Elektrotechnik 2 Elektrotechnik 2 V 2<br />
PL K(2) Keine<br />
Elektrotechnik 2 L 2 5 Erforderlich für Anerken-<br />
Keine<br />
Labor<br />
nung Elektrotechnik 2<br />
Technische Technische Mechanik V/Ü 4 5 PL K(2) Keine<br />
Mechanik 1 1.2<br />
Thermodynamik Thermodynamik 1 V 2 3 2) Zusammen mit Thermodynamik<br />
2<br />
Keine<br />
Gr<strong>und</strong>lagen der Werkstofftechnik 2 V 2 3 PL K(2) Keine<br />
Werkstofftechnik<br />
Englisch Englisch 2 V 2 2 SL SP:<br />
Vort<br />
K(1), Arb, Keine<br />
Recht 1 Gr<strong>und</strong>lagen Recht V 2 2 SL SP:<br />
Vort<br />
K(1), Arb, Keine<br />
Alle Module des 2. Studiensemesters 24 30 3 PL, 3 SL<br />
Hinweise: 1) Anrechnung erst nach Bestehen der Prüfungsleistung Mathematik 2.2<br />
2) Anrechnung erst nach Bestehen der Prüfungsleistung Thermodynamik 2<br />
3. Studiensemester (3. Theoriesemester) Schiffsmaschinenbau<br />
Modul Lehrveranstaltung Prüfung<br />
Art SWS CP Art Form Vorbedingungen<br />
Mathematik 2 Mathematik 2.2 V/Ü 4 5 PL K(2) Keine<br />
CA- Methoden der CA- Methoden, V 1<br />
Konstruktionstechnik<br />
Konstruktionstechnik<br />
5 1)<br />
SL SP: K(2), Arb,<br />
Keine<br />
CA- Methoden, L 3<br />
Vort<br />
Erforderlich für Anerken-<br />
Keine<br />
Konstruktionstechnik<br />
nung CA- Methoden der<br />
Labor<br />
Konstruktionstechnik<br />
Technische Technische Mechanik V/Ü 4 5 PL K(2) Keine<br />
Mechanik 2 2<br />
Thermodynamik Thermodynamik 2 V/L 4 5 PL K(2) Keine<br />
Elektrische Elektrische<br />
V 2 3 Zusammen mit Elektrische Keine<br />
Maschinen Maschinen 1<br />
Maschinen 2<br />
Schiffbau Einrichtung <strong>und</strong> Aus- V 2 2 SL SP: K(1), HA, Arb, Keine<br />
rüstung von Schiffen<br />
Vort<br />
Qualitäts-<br />
Qualitäts-<br />
V 2 3 SL K(2) Keine<br />
Management Management<br />
Betriebstechnik Instandhaltung V 1 1 SL SP: Arb, Vort Keine<br />
Instandhaltung Labor L 3 2 2) Erforderlich für Anerkennung<br />
Instandhaltung<br />
Keine<br />
Alle Module des 3. Studiensemesters 26 31 3 PL, 4 SL<br />
Hinweise: 1) Anrechnung erst nach Bestehen der Studienleistung CA- Methoden der Konstruktionstechnik<br />
2) Anerkennung erst nach Bestehen der Studienleistung Instandhaltung<br />
3
4.Studiensemester (4. Theoriesemester) Schiffsmaschinenbau<br />
Modul Lehrveranstaltung Prüfung<br />
Art SWS CP Art Form Vorbedingungen<br />
Maschinenelemente<br />
Maschinenelemente V/Ü 4 5 PL K(2) OP<br />
Regelungstechnik Regelungstechnik V/L 4 5 PL SP: K(2), Arb,Vort OP<br />
Schiffbau Strömungslehre V/Ü 2 3 SL K(1) OP<br />
Gr<strong>und</strong>lagen Schiffbau V 2 3 PL K(1) OP<br />
Schiffssicherheit V 2 3 SL K(1) OP<br />
Arbeitsmaschinen Arbeitsmaschinen 1 V 4 4 1) Zusammen mit Arbeitsmaschinen<br />
2<br />
OP<br />
Dampfanlagen Dampfanlagen 1 V 2 2 2) Zusammen mit Dampfanlagen<br />
2<br />
OP<br />
Elektrische Elektr. Maschinen 2 V 2 3 PL K(2) OP<br />
Maschinen Elektrische<br />
L 2 2<br />
Maschinen 2 Labor<br />
3) erforderlich für Anerken-<br />
OP<br />
nung Elektrische<br />
Maschinen 2<br />
Alle Module des 4. Studiensemesters 24 30 4 PL, 2 SL<br />
Hinweise: 1) Anrechnung erst nach Bestehen der Prüfungsleistung Arbeitsmaschinen 2<br />
2) Anrechnung erst nach Bestehen der Prüfungsleistung Dampfanlagen 2<br />
3) Anrechnung erst nach Bestehen der Prüfungsleistung Elektrische Maschinen 2<br />
5. Studiensemester (5. Theoriesemester) Schiffsmaschinenbau<br />
Modul Lehrveranstaltung Prüfung<br />
Art SWS CP Art Form Vorbedingungen<br />
Betriebsstoffe Betriebsstoffe V/L 4 4 PL K(2) OP<br />
Arbeitsmaschinen Arbeitsmaschinen 2 V 2 2 PL K(2) OP<br />
Arbeitsmaschinen 2 L 1 2 erforderlich für Anerken-<br />
OP<br />
Labor<br />
nung Arbeitsmaschinen 2<br />
Automatisierungstechnik<br />
Leittechnik V 4 4 PL K(2) OP<br />
Konstruktion & Methodische<br />
V 2<br />
SP: K(2), Arb,<br />
Berechnung Konstruktion<br />
L 2 10 PL Vort<br />
OP<br />
FEM V 2<br />
L 2<br />
Betreutes<br />
Betreutes<br />
L 4 5 SL SP: HA, Arb, Vort OP<br />
Projektlabor Projektlabor<br />
Dampfanlagen Dampfanlagen 2 V/Ü<br />
2 3 1)<br />
Dampfanlagen 2<br />
PL K(2)<br />
Erforderlich für<br />
OP<br />
OP<br />
Labor<br />
Anerkennung<br />
Dampfanlagen 2<br />
Alle Module des 5. Studiensemesters 25 30 5 PL, 1 SL<br />
Hinweise: 1) Anrechnung erst nach Bestehen der Prüfungsleistung Dampfanlagen 2<br />
4
6. Studiensemester (6. Theoriesemester) Schiffsmaschinenbau<br />
Modul Lehrveranstaltung Prüfung<br />
Art SWS CP Art Form Vorbedingungen<br />
VerbrennungsVerbrennungs- V 4 5 PL K(2) OP<br />
kraftmaschinen 1 kraftmaschinen 1<br />
Maschinendynamik V/L 2 3 PL SP: K(2), Arb,<br />
OP<br />
Antriebssysteme Wellen/Kupplungen/<br />
Getriebe<br />
V/Ü 2 2 Vort<br />
OP<br />
Schiffsbetrieb Überwachung des<br />
Schiffsbetriebes<br />
Ü/L 4 4 SL SP: PÜ, MP OP<br />
Elektrische<br />
Anlagen<br />
Elektrische Anlagen V 2 5 PL K(1,5) OP<br />
Elektrische Anlagen L 2 erforderlich für<br />
OP<br />
Labor<br />
Anerkennung Elektrische<br />
Anlagen<br />
<strong>Schiffstechnik</strong> Anlagentechnik V 2 2 SL K(1,5) OP<br />
Schiffsfertigung V 2 6 Zusammen mit<br />
Maschinenraumgestaltung<br />
OP<br />
Maschinenraum- V 2 SL SP: K(2), Arb, OP<br />
gestaltung<br />
Vort<br />
Recht 2 Wirtschaftsrecht V 2 2 SL SP: K(1), Arb,<br />
Vort<br />
OP<br />
Alle Module des 6. Studiensemesters 24 29 3 PL, 4SL<br />
7. Studiensemester (berufspraktisches Semester) Schiffsmaschinenbau<br />
Modul Lehrveranstaltung Prüfung<br />
Art CP Art Form Vorbedingungen<br />
Berufspraktikum Projekt 18 SL Dauer Berufsprak-<br />
tikum 3 Monate<br />
Schließt mit einem<br />
Praktikumsbericht<br />
als Prüfung ab<br />
Bachelor-Thesis u. Kolloquium 12 PL 1)<br />
Dauer Thesis<br />
2 Monate<br />
Dauer Kolloquium<br />
45 Min.<br />
Alle Module des 7. Studiensemesters 30 1 PL, 1 SL<br />
Hinweise: 1) Das bestandene Kolloquium ist erforderlich für die Anerkennung der Thesis.<br />
2) s. §6 Abs. 1 <strong>und</strong> Praktikumsordnung<br />
3) s. §7 Abs. 1<br />
2)<br />
3)<br />
5
Modul- <strong>und</strong> Prüfungsplan im Bachelor- <strong>Studiengang</strong> – Studienrichtung Schiffsbetriebstechnik<br />
1. Studiensemester (1. berufspraktisches Semester) Schiffsbetriebstechnik<br />
Modul Lehrveranstaltung Prüfung<br />
Dauer CP Art Form(Umfang) Vorbedingungen<br />
Berufspraktikum Berufspraktikum 1 26 Wochen 30 SL SP: Arb. (gemäß<br />
Praxissemesterordnung)<br />
Module des 1. Studiensemesters 30 1 SL<br />
2. Studiensemester (1. Theoriesemester) Schiffsbetriebstechnik<br />
Modul Lehrveranstaltung Prüfung<br />
Art SWS CP Art Form (Umfang) Vorbedingungen<br />
Mathematik 1 Mathematik 1 V/Ü 4 5 PL K(2) keine<br />
Physik Physik V 4 5 PL K(2) Keine<br />
Elektrotechnik 1, Elektrotechnik 1, V 4 5 PL K(2) Keine<br />
Messtechnik Messtechnik<br />
Technische Technische Mechanik V/Ü 4 5<br />
Mechanik 1 1.1<br />
1) Zusammen mit Technische Keine<br />
Mechanik 1.2<br />
Gr<strong>und</strong>lagen der<br />
Werkstofftechnik<br />
Werkstofftechnik 1 V 2<br />
5 2)<br />
Zusammen mit<br />
Werkstofftechnik 2<br />
Keine<br />
Werkstofftechnik 1 L 2 erforderlich für Anerken-<br />
Keine<br />
Labor<br />
nung Gr<strong>und</strong>lagen der<br />
Werkstofftechnik<br />
Englisch Englisch 1 V 2 2 SL SP: K(1), Arb,<br />
Vort<br />
Keine<br />
Wirtschaft Gr<strong>und</strong>lagen BWL V 2 3 SL SP: K(1), Arb,<br />
Vort<br />
keine<br />
Module des 2. Studiensemesters 24 30 3 PL, 2 SL<br />
Hinweise: 1) Anrechnung erst nach Bestehen der Prüfungsleistung Technische Mechanik 1.2<br />
2) Anrechnung erst nach Bestehen der Prüfungsleistung Werkstofftechnik 2<br />
3. Studiensemester (2. Theoriesemester) Schiffsbetriebstechnik<br />
Modul Lehrveranstaltung Prüfung<br />
Art SWS CP Art Form (Umfang) Vorbedingungen<br />
Informatik Informatik V/Ü 4 5 SL SP:<br />
Votr<br />
K(2), Arb, Keine<br />
Mathematik 2 Mathematik 2.1 V/Ü 4 5 1) Zusammen mit Mathematik<br />
2.2<br />
Keine<br />
Elektrotechnik 2 Elektrotechnik 2 V 2<br />
PL K(2) Keine<br />
Elektrotechnik 2 L 2 5 erforderlich für Anerken-<br />
Keine<br />
Labor<br />
nung Elektrotechnik<br />
Technische Technische<br />
V/Ü 4 5 PL K(2) Keine<br />
Mechanik 1 Mechanik 1.2<br />
Thermodynamik Thermodynamik 1 V 2 3 2) Zusammen mit Thermodynamik<br />
2<br />
Keine<br />
Gr<strong>und</strong>lagen der<br />
Werkstofftechnik<br />
Werkstofftechnik 2 V 2 3 PL K(2) Keine<br />
Englisch Englisch 2 V 2 2 SL SP:<br />
Vort<br />
K(1), Arb, Keine<br />
Recht Gr<strong>und</strong>lagen Recht V 2 2 SL SP:<br />
Vort<br />
K(1), Arb, keine<br />
Alle Module des 3. Studiensemesters 24 30 3 PL, 3 SL<br />
Hinweise: 1) Anrechnung erst nach Bestehen der Prüfungsleistung Mathematik 2.2<br />
2) Anrechnung erst nach Bestehen der Prüfungsleistung Thermodynamik 2<br />
6
4 . Studiensemester (3. Theoriesemester) Schiffsbetriebstechnik<br />
Modul Lehrveranstaltung Prüfung<br />
Art SWS CP Art Form (Umfang) Vorbedingungen<br />
Mathematik 2 Mathematik 2.2 V/Ü 4 5 PL K(2) Keine<br />
Thermodynamik Thermodynamik 2 V/L 4 5 PL K(2) Keine<br />
Recht Gr<strong>und</strong>lagen<br />
V 2 2 SL SP: K(1), Arb, Keine<br />
Schifffahrtsrecht<br />
Vort<br />
Betriebstechnik Instandhaltung V 1 1 SL SP: Arb, Vort Keine<br />
Instandhaltung Labor L 3 2 1) Erforderlich für Anerkennung<br />
Instandhaltung<br />
Keine<br />
Elektrische Elektrische<br />
V 2 3 Zusammen mit Elektrische Keine<br />
Maschinen Maschinen 1<br />
Maschinen 2<br />
Personalfürsorge Personalführung /<br />
ISPS<br />
V/Ü 4 5 PL SP: K(2), HA, Arb Keine<br />
Tankschifffahrt Dienst auf<br />
V 2 3 SL SP: K(1), Arb, Keine<br />
Tankschiffen<br />
Betriebsstoffe Betriebsstoffe V/L 4 4 PL K(2) Keine<br />
Alle Module des 4. Studiensemesters 26 30 4 PL, 3 SL<br />
Vort<br />
Hinweise: 1) Anerkennung erst nach Bestehen der Studienleistung Instandhaltung<br />
5. Studiensemester (4. Theoriesemester) Schiffsbetriebstechnik<br />
Modul Lehrveranstaltung Prüfung<br />
Art SWS CP Art Form Vorbedingungen<br />
Maschinenelemente<br />
Maschinenelemente V/Ü 4 5 PL K(2) OP<br />
Regelungstechnik Regelungstechnik V/L 4 5 PL SP: K(2), Arb,Vort OP<br />
Arbeitsmaschinen Arbeitsmaschinen 1 V 4 4 Zusammen mit Arbeitsma-<br />
OP<br />
Verbrennungskraftmaschinen<br />
Verbrennungskraft-<br />
maschinen 1<br />
schinen 2<br />
V 4 4 Zusammen mit Verbren-<br />
nungskraftmaschinen 2<br />
Schiffbau Strömungslehre V/Ü 2 3 SL K(1) OP<br />
Gr<strong>und</strong>lagen Schiffbau V 2 3 PL K(1) OP<br />
Dampfanlagen Dampfanlagen 1 V 2 2 Zusammen mit<br />
OP<br />
Dampfanlagen 2<br />
Elektrische Elektr. Maschinen 2 V 2 3 PL K(2)<br />
Maschinen Elektrische<br />
L 2 2<br />
Maschinen 2 Labor<br />
1) erforderlich für Anerken-<br />
OP<br />
nung Elektrische Maschinen<br />
2<br />
Alle Module des 5. Studiensemesters 26 31 4 PL, 1 SL<br />
Hinweise: 1) Anrechnung erst nach Bestehen der Prüfungsleistung Elektrische Maschinen 2<br />
OP<br />
7
6. Studiensemester (5. Theoriesemester) Schiffsbetriebstechnik<br />
Modul Lehrveranstaltung Prüfung<br />
Art SWS CP Art Form Vorbedingungen<br />
Gefahrstoffe Gefahrstoffe V 2 2 PL K(1) OP<br />
Arbeitsmaschinen Arbeitsmaschinen 2 V 2 2 PL K(2) OP<br />
Arbeitsmaschinen 2 L 1 2 Erforderlich für Anerken-<br />
OP<br />
Labor<br />
nung Arbeitsmaschinen 2<br />
Anlagentechnik Anlagentechnik V 2 3 SL K(1,5) OP<br />
Anlagentechnik Labor L 1 Erforderlich für Anerkennung<br />
Anlagentechnik<br />
OP<br />
Verbrennungs- Verbrennungskraft- V 4 5 PL K(2) OP<br />
kraftmaschinen maschinen 2<br />
Verbrennungskraft- L 2 2 Erforderlich für Anerken-<br />
OP<br />
Maschinen 2 Labor<br />
nung Verbrennungskraftmaschinen<br />
2<br />
Automatisierungstechnik<br />
Leittechnik V 4 4 PL K(2) OP<br />
Personalfürsorge Ges<strong>und</strong>heitsfürsorge V/Ü 4 4 SL SP: K(2), Arb, OP<br />
Schiffbau Schiffssicherheit V 2 3 SL<br />
Vort, HA<br />
K(1) OP<br />
Dampfanlagen Dampfanlagen 2 V/Ü<br />
2 3 1)<br />
Dampfanlagen 2<br />
PL K(2)<br />
Erforderlich für<br />
OP<br />
OP<br />
Labor<br />
Anerkennung<br />
Dampfanlagen 2<br />
Alle Module des 6. Studiensemesters 26 30 5 PL, 3SL<br />
Hinweise: 1) Anrechnung erst nach Bestehen der Prüfungsleistung Dampfanlagen 2<br />
7. Studiensemester (6. Theoriesemester) Schiffsbetriebstechnik<br />
Modul Lehrveranstaltung Prüfung<br />
Art SWS CP Art Form Vorbedingungen<br />
Antriebssysteme Maschinendynamik V/L 2 3 PL SP:K(2), Arb, Vort OP<br />
Wellen/Kupplungen/<br />
Getriebe<br />
V/Ü 2 2<br />
Automatisierungs- Leittechnik Labor L 2 2<br />
technik<br />
1) Erforderlich für Anerken-<br />
OP<br />
nung Leittechnik<br />
Elektrische Mittelspannung V/L 2 4 PL K(2) OP<br />
Anlagen<br />
Elektrische Anlagen V 2<br />
Elektrische Anlagen L 2 2<br />
Labor<br />
2) Erforderlich für Anerken-<br />
OP<br />
nung Elektrische Anlagen<br />
Schiffsbetrieb Überwachung<br />
Schiffsbetrieb<br />
Ü/L 4 4 SL SP: PÜ 3) <strong>und</strong> MP 3) OP<br />
Bachelor-Thesis u. Kolloquium 12 PL 4)<br />
Dauer Thesis:<br />
2 Monate<br />
Kolloquium<br />
(45 Min.)<br />
Alle Module des 7. Studiensemesters 16 29 3 PL, 1SL<br />
Hinweise: 1) Anerkennung erst nach Bestehen der Prüfungsleistung Leittechnik<br />
2) Anrechnung erst nach Bestehen der Prüfungsleistung Elektrische Anlagen<br />
3)<br />
Praktischer <strong>und</strong> mündlicher Teil der Abschlussprüfungen gemäß §2 Abs. 2 Seeaufgabengesetz.<br />
4) Das bestandene Kolloquium ist erforderlich für die Anerkennung der Thesis.<br />
5) s. §7 Abs. 2<br />
8. Studiensemester (2. berufspraktisches Semester) Schiffsbetriebstechnik<br />
Modul Lehrveranstaltung Prüfung<br />
Dauer CP Art Form(Umfang) Vorbedingungen<br />
Berufspraktikum Berufspraktikum 2 26 Wochen 30 SL SP: Arb. (gemäß<br />
Praxissemesterordnung)<br />
Module des 8. Studiensemesters 30 1 SL<br />
5)<br />
8
§ 5<br />
Prüfungssprache<br />
Die Prüfungssprache ist in der Regel deutsch (§ 6 Abs. 4 PVO).<br />
§ 6<br />
Berufspraktikum<br />
(1) In der Studienrichtung Schiffsmaschinenbau wird <strong>zum</strong> Berufspraktikum zugelassen, wer alle Prüfungs-<br />
<strong>und</strong> Studienleistungen aus dem ersten, zweiten <strong>und</strong> dritten Semester komplett, sowie weitere 50 Kreditpunkte<br />
(CP) erbracht hat.<br />
(2) Für die Studienrichtung Schiffsbetriebstechnik gelten für die berufspraktische Ausbildung die<br />
Mindestanforderungen der Schiffsoffizier-Ausbildungsverordnung in der jeweils geltenden Fassung.<br />
(3) Näheres zu den Berufspraktika wird in der Praktikumsordnung oder der Praxissemesterordnung <strong>zum</strong><br />
Bachelor-<strong>Studiengang</strong> <strong>Schiffstechnik</strong> geregelt.<br />
§ 7<br />
Thesis<br />
(1) In der Studienrichtung Schiffsmaschinenbau kann die Zulassung zur Thesis frühestens drei Monate<br />
nach dem bescheinigten Beginn des Berufspraktikums erfolgen.<br />
(2) In der Studienrichtung Schiffsbetriebstechnik wird zur Thesis zugelassen, wer die vorgeschriebenen<br />
Prüfungs- <strong>und</strong> Studienleistungen des zweiten bis fünften Studiensemesters erbracht <strong>und</strong> das erste<br />
berufspraktische Semester erfolgreich abgeschlossen hat.<br />
(3) Die Bearbeitungszeit der Thesis beträgt in der Regel zwei Monate (§ 21 Absatz 6, PVO).<br />
(4) Das Thema der Thesis kann nur innerhalb der ersten vier Wochen nach Ausgabe zurückgegeben<br />
werden (§ 21 Absatz 7, PVO).<br />
(5) Die Bearbeitungszeit der Thesis kann um maximal vier Wochen verlängert werden. Ein Antrag auf<br />
Verlängerung ist spätestens 14 Tage vor dem Abgabetermin dem Prüfungsausschuss vorzulegen (§ 21<br />
Absatz 8, PVO).<br />
§ 8<br />
Kolloquium<br />
(1) Im Bachelor-<strong>Studiengang</strong> <strong>Schiffstechnik</strong> ist ein Kolloquium im Zusammenhang mit der Thesis vorgesehen<br />
(§ 24 Absatz 1, PVO).<br />
(2) Das Kolloquium dauert 45 Minuten je Kandidatin oder Kandidat (§ 24 Absatz 2, PVO).<br />
§ 9<br />
Bildung der Gesamtnote<br />
Die Gesamtnote errechnet sich aus den gewichteten Einzelnoten der Prüfungsleistungen sowie der<br />
Bachelor-Thesis, die sich zu 70 % aus der Note für die Arbeit <strong>und</strong> zu 30 % aus der Note für das Kolloquium<br />
errechnet. Dabei ist das Gewicht eines Moduls auf der Basis von Kreditpunkten bestimmt: Kreditpunkte<br />
eines Moduls dividiert durch die Summe der Kreditpunkte aller in die Gesamtnote eingehenden Module (§ 25<br />
Absatz 3 PVO).<br />
9
§ 10<br />
In-Kraft-Treten, Übergangsbestimmungen<br />
(1) Diese Prüfungs- <strong>und</strong> Studienordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntgabe in Kraft.<br />
(2) Sie gilt erstmals für alle Studierenden, die <strong>zum</strong> Sommersemester 2010 das Studium im Bachelor-<br />
<strong>Studiengang</strong> <strong>Schiffstechnik</strong> an der Fachhochschule Flensburg aufgenommen haben.<br />
(3) Ein Anspruch auf das Lehrangebot sowie die Prüfungen besteht nur im Rahmen der semesterweisen<br />
Einführung dieser Prüfungs- <strong>und</strong> Studienordnung.<br />
(4) Die Aufnahme <strong>zum</strong> Studium in der Studienrichtung Schiffsmaschinenbau erfolgt gr<strong>und</strong>sätzlich im<br />
Wintersemester. Für die Studienrichtung Schiffsbetriebstechnik erfolgt die Aufnahme im<br />
Sommersemester zur Ableistung des 1. Berufspraktischen Semesters. Zur Aufnahme des Studiums im<br />
Wintersemester <strong>und</strong> damit <strong>zum</strong> 2. Studiensemester wird nur zugelassen, wer den erfolgreichen<br />
Abschluss des ersten berufspraktischen Semesters nachweisen kann.<br />
(5) Die Veranstaltungen nach der bisherigen Prüfungs- <strong>und</strong> Studienordnung vom 06.02.2008 laufen parallel<br />
zur Einführung dieser Prüfungs- <strong>und</strong> Studienordnung aus.<br />
(6) Die Prüfungen nach der bisherigen Prüfungs- <strong>und</strong> Studienordnung vom 06.02.2008 für die<br />
Studienrichtung Schiffsbetriebstechnik werden letztmalig im Prüfungszeitraum Sommersemester 2013-II<br />
angeboten. Für die Studienrichtung Schiffsmaschinenbau werden die Prüfungen letztmalig im<br />
Prüfungszeitraum WS 2012/13-II angeboten.<br />
(7) Die bisherige Prüfungs- <strong>und</strong> Studienordnung vom 06.02.2008 läuft am 31.08.2014 aus.<br />
(8) Für Studierende, die ihr Studium an der Fachhochschule Flensburg in einem höheren Fachsemester<br />
aufnehmen, entscheidet der Prüfungsausschuss im Einvernehmen mit den Studierenden nach deren<br />
Leistungsstand darüber, ob diese Prüfungs- <strong>und</strong> Studienordnung oder die bisherige vom 06.02.2008 im<br />
Bachelor-<strong>Studiengang</strong> <strong>Schiffstechnik</strong> anzuwenden ist.<br />
Ausgefertigt:<br />
Flensburg, 3. Februar 2011<br />
FACHHOCHSCHULE FLENSBURG<br />
Fachbereich Technik<br />
- Der Dekan -<br />
gez. Prof. Dr. Helmut Erdmann<br />
10
4. Praxissemesterordnung/Praxissemestervertrag<br />
4.1 Anforderungen § 15 Schiffsoffizierausbildungsverordnung,<br />
praktische Seefahrtszeiten<br />
Ansprechpersonen<br />
o für die Studienberatung/das Praxissemester:<br />
Studienberatung Seefahrt, Nadine Katharina Heubeck M.A.<br />
Fachhochschule Flensburg, Kanzleistrasse 91-93, 24943 Flensburg<br />
Telefon: 0461-8051523, Telefax: 0461-8051300<br />
Aktuelle Praxissemesterordnung <strong>und</strong> Studienordnung <strong>zum</strong> <strong>Studiengang</strong> finden Sie auf der o.g. Web-Seite der<br />
FH.<br />
o für die Anerkennung der Seefahrtszeiten<br />
� das B<strong>und</strong>esamt für Seeschiffahrt <strong>und</strong> Hydrographie (BSH):<br />
http://www.bsh.de/de/Schifffahrt/Berufsschifffahrt/Zeugnisse_fuer_Seeleute/index.jsp<br />
für Seiteneinsteiger:<br />
http://www.bsh.de/de/Schifffahrt/Berufsschifffahrt/Zeugnisse_fuer_Seeleute/Befaehigungszeugnis_Seitenei<br />
nsteiger.jsp<br />
falls Sie Seefahrtszeiten von der B<strong>und</strong>esmarine nachweisen können auch<br />
http://www.bsh.de/de/Antraege/Seeleute/Marine/index.jsp<br />
artur.roth[at]bsh.de <strong>und</strong> michaela.schlage[at]bsh.de, Tel.: 04031907124<br />
� die Berufsbildungsstelle Seeschifffahrt (BBS):<br />
http://www.berufsbildung-see.de/techwo.html<br />
Holger Jäde, Geschäftsführer<br />
Berufsbildungsstelle Seeschiffahrt e.V.<br />
Breitenweg 57, 28195 Bremen<br />
Tel. +49 421 17367-11<br />
Fax. +49 421 17367-15<br />
E-Mail: jaede[at]berufsbildung-see.de<br />
Zu den Anforderungen der Praxisanteile sowie als kompetente Beratungsstelle.<br />
o für die Beratung im Berufsfeld<br />
� Verband Deutscher Reeder (VDR): http://www.reederverband.de/index.php?kat=294&kat2=316&id=742<br />
<strong>und</strong> für den Maschinendienst: http://www.reederverband.de/index.php?kat=294&kat2=316&id=651<br />
Runa Jörgens<br />
Ausbildung & Schiffsbesetzung<br />
VDR - Verband Deutscher Reeder<br />
Esplanade 6, 20354 Hamburg<br />
Tel: +49 (40) 350 97 252<br />
joergens[at]reederverband.de<br />
www.reederverband.de<br />
Zu den Ausbildungsreedereien <strong>und</strong> beruflichen Perspektiven.<br />
� Heuerstelle der Argentur für Arbeit:<br />
Susann Marohl<br />
Zentrale Heuerstelle Hamburg<br />
Fachvermittlung für Seeleute<br />
Berufsberatung für Seeschifffahrt<br />
Nagelsweg 9, D-20097 Hamburg<br />
Tel: +49(0)40 / 2485-1319/1313; Fax: 2485-1335<br />
E-Mail: Hamburg.Heuerstelle[at]arbeitsagentur.de<br />
Zu den Ausbildungsreedereien <strong>und</strong> als kompetente Beratungsstelle.
Praktischen Seefahrtszeiten<br />
§15 Schiffsoffizierausbildungsverordnung:
VDR - Verband Deutscher Reeder<br />
Über den Verband<br />
Ausbildung<br />
Berufe an Bord<br />
Berufe an Land<br />
Veranstaltungen<br />
Mitglieder<br />
Statistik<br />
Deutsche Seeschifffahrt<br />
Geschichte<br />
Presse<br />
Kontakt<br />
Home<br />
Suchbegriff eingeben<br />
Impressum<br />
Mitgliederbereich<br />
Ausbildung - Berufe an Bord<br />
Der Einsatz an Bord ist einzigartig: Die Führungskräfte eines modernen Seeschiffs leiten<br />
einen eigenständigen Betriebsteil, der sich außerhalb des eigenen Landes befindet <strong>und</strong> der<br />
hohe Werte repräsentiert. Dieser Betrieb verlangt es, Mitarbeiter, die aus verschiedenen<br />
Ländern <strong>und</strong> unterschiedlichen Kulturkreisen stammen, zu motivieren <strong>und</strong> zu einem Team zu<br />
formen.<br />
Es ist eine Herausforderung, Motorenanlagen zu betreiben, die genug Energie erzeugen<br />
können, um eine Kleinstadt zu versorgen. Das komplexe technische System, das an Bord<br />
eines Schiffes zu finden ist, ist einzigartig. Technische Schiffsoffiziere beherrschen dieses<br />
System <strong>und</strong> kontrollieren es.<br />
Es macht Freude, Schiffe zu fahren <strong>und</strong> sie durch vielbefahrene anspruchsvolle <strong>und</strong> schöne<br />
Seegebiete zu navigieren. Nautische Schiffsoffiziere sorgen für eine sichere <strong>und</strong> effiziente<br />
Passage.<br />
Wie wird man technischer Schiffsoffizier <strong>und</strong> wie Leiter der Maschinenanlage?<br />
Was macht ein nautischer Schiffsoffizier noch, <strong>und</strong> wie wird man Kapitän?<br />
Im folgenden stellen wir Ihnen die unterschiedlichen Wege <strong>zum</strong> Kapitän <strong>und</strong> <strong>zum</strong> Chief, dem<br />
Leiter der Maschinenanlage, vor. Es sind Wege über eine Berufsausbildung, über den Besuch<br />
einer Berufsfachschule, direkt über ein Studium, es sind Seiteneinstiegswege.<br />
Frauen zur See!<br />
Eine reine Männerdomäne ist die Seefahrt seit langem nicht mehr. Heute sind Frauen sehr<br />
erfolgreich als Schiffsmechanikerinnen, als nautische <strong>und</strong> technische Schiffsoffizierinnen <strong>und</strong><br />
als Kapitäne tätig. An den deutschen Seefahrtschulen werden derzeit so viele junge Frauen<br />
ausgebildet wie nie zuvor. Alle Tätigkeiten an Bord können von Frauen <strong>und</strong> Männern in<br />
gleicher Weise ausgeführt werden. Denn für die technische <strong>und</strong> nautische Ausbildung <strong>und</strong> die<br />
Aufgaben als Schiffsoffizier an Bord braucht es weit mehr als bloße Muskelkraft.<br />
Wir hoffen, Ihr Interesse an einer Tätigkeit in der Seeschifffahrt geweckt zu haben!<br />
Bei offenen Fragen stehen wir natürlich zur Verfügung. Gerne schicken wir Ihnen auch unser<br />
Informationsmaterial, in dem alle Wege ausführlich beschrieben sind.<br />
Sie erreichen uns zu den üblichen Geschäftszeiten unter:<br />
Telefon: 040/350 97-0<br />
Fax 040/350 97-211<br />
oder am besten E-Mail berufe.see@reederverband.de<br />
Das schwarze Brett<br />
Neuigkeiten aus der Welt der Seefahrtausbildung<br />
Gr<strong>und</strong>lagen für angehende Seeleute<br />
Informationen, die den Erstkontakt mit der Schifffahrt erleichtern<br />
Das Ferienfahrer-Programm<br />
Ein fesselnder Einblick in den Schiffsbetrieb für Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler<br />
[Download des Infotextes als PDF]<br />
Ausbildungsberuf Schiffsmechanikerin / Schiffsmechaniker<br />
Der richtige Einstieg für Haupt- oder Realschüler sowie Schulabgänger mit Fachhochschule<br />
oder Abitur<br />
Von der technischen Schiffsoffizierin zur Leiterin der Maschinenanlage<br />
Manager des technischen Schiffsbetriebs<br />
Vom nautischen Schiffsoffizier <strong>zum</strong> Kapitän<br />
Manager des nautischen Schiffsbetriebs<br />
Viele Wege führen nach See<br />
Die Einstiegswege in die Seeschifffahrt auf einen Blick<br />
Adressbuch<br />
Partner in der maritimen Ausbildungslandschaft<br />
© Verband Deutscher Reeder - Esplanade 6 - 20354 Hamburg<br />
http://www.reederverband.de/index.php?kat=294&kat2=316<br />
VDR Aktuell<br />
Seite 1 von 1<br />
14.11.2011<br />
14.11.2011
Ausbildung Seefahrt Berufsbildungsstelle Seeschiffahrt Schiffsmechaniker Berufsau...<br />
Suchen<br />
Startseite<br />
Aufgaben der BBS<br />
1954-heute<br />
Los !<br />
Allgemeine Informationen<br />
Schiffsmechaniker/-in<br />
Nautischer Wachoffizier/<br />
Kapitän<br />
Technischer Wachoffizier/<br />
Leiter Maschinenanlage<br />
Seediensttauglichkeitsuntersuchung<br />
Sicherheits-<br />
Befähigungsnachweise<br />
Seemannsschule<br />
Prüfungen aktuell<br />
Fachschulen/Fachhochschulen<br />
Downloadbereich<br />
Aktuelles<br />
Termine<br />
Begabtenförderung<br />
Tipps für Bewerbungen<br />
Schiffstypen<br />
Linksammlung<br />
Logbuch<br />
English<br />
Kontakt/Impressum<br />
++++++ Seefahrt ist Meer ++++++ Karrieren in der Seeschifffahrt ++++++ Der Weg vom Schiffsmechaniker <strong>zum</strong> Lei<br />
x<br />
.<br />
Senden Sie uns Ihre Erfahrungen, Ihre Erlebnisse,<br />
Geschichten oder Kurioses von Bord,<br />
Ihre Anregungen, Vorschläge, Fragen <strong>und</strong> Mitteilungen:<br />
Unser Logbuch steht Ihnen hier als Forum zur Verfügung.<br />
Wir freuen uns auf Ihre Beiträge. Schauen Sie mal rein... >>><br />
28195 Bremen, Breitenweg 57, E-Mail Info@Berufsbildung-See.de<br />
Für eine fehlerfreie Darstellung der Seiten sind die aktuellen Versionen des "Internet-Explorer", "Google Chrome" oder "Mozilla Firefox" ab Vers. 3.0.1 erforderlich<br />
http://www.berufsbildung-see.de/<br />
Seite 1 von 2<br />
14.11.2011
Seefahrtschulen<br />
Schifffahrt Meeresdaten Meeresnutzung Produkte Anträge Das BSH<br />
Seefahrtschulen<br />
• Befähigungszeugnisse, -nachweise <strong>und</strong> Seefunkzeugnisse unmittelbar nach dem Erwerb des Abschlusszeugnisses an einer<br />
Seefahrtschule:<br />
◦ Antragsformular nautische Ausbildungsgänge<br />
◦ Antragsformular technische Ausbildungsgänge<br />
■ nähere Informationen für Seiteneinsteiger (Metall- oder Eletrotechnikerberuf zzgl. Seefahrtzeit im Maschinendienst)<br />
◦ Antragsformular Ausbildungsgänge für den Dienst auf Fischereifahrzeugen<br />
• Gebühren:<br />
◦ Informationen zu den Gebühren <strong>und</strong> den Vordruck für die Einzugsermächtigung finden Sie hier.<br />
• Eidesstattliche Versicherung/Antrag auf Ersatzausfertigungen bei Verlust eines Befähigungszeugnisses:<br />
◦ Antragsformular Ersatzausstellung<br />
• Das BSH ist für die Erteilung <strong>und</strong> Gültigkeitsverlängerung aller nautischen <strong>und</strong> technischen Befähigungszeugnisse zuständig.<br />
Dies gilt nicht für die Erstausstellung nautisch <strong>und</strong> technischer Befähigungszeugnisse von Absolventen der nach dem Recht Mecklenburg-Vorpommerns<br />
eingerichteten seefahrtbezogenen Ausbildungsstätten. Hier ist weiterhin das Seemannsamt Rostock zuständig. Die Zuständigkeit für die<br />
Gültigkeitsverlängerung sowie Erteilung nautischer <strong>und</strong> technischer Befähigungzeugnisse, die abweichend vom regulären Ausbildungsgang erworben<br />
werden, verbleibt beim BSH.<br />
Für weitere Fragen stehen Ihnen gerne unsere Mitarbeiter zur Verfügung.<br />
© 2011 B<strong>und</strong>esamt für Seeschifffahrt <strong>und</strong> Hydrographie<br />
Seite 1 von 1<br />
Suche<br />
Wenn Sie Informationen zu<br />
bestimmten Begriffen<br />
suchen, können Sie sich<br />
hier alle Seiten anzeigen<br />
lassen, die diese Begriffe<br />
enthalten.<br />
Bitte geben Sie Ihre<br />
Suchbegriffe ein<br />
Verknüpfung der Begriffe<br />
mit<br />
<strong>und</strong> oder<br />
Suche starten<br />
Druckversion<br />
Kontakt<br />
Seite drucken<br />
Wenn Sie noch Fragen<br />
haben, wenden Sie sich<br />
bitte an Zeugnisse,<br />
Telefon 040 3190 - 7125<br />
Links<br />
Mehr dazu auf<br />
www.bsh.de:<br />
Zeugnisse für Seeleute<br />
English Version<br />
go...<br />
Aktualisiert am:<br />
06.06.2011 09:45:50<br />
Druckversion Home • English Version • Kontakt • Hilfe • Barrierefreiheit • Informationsfreiheitsgesetz • Impressum<br />
http://www.bsh.de/de/Antraege/Seeleute/Seefahrtschulen/index.jsp<br />
14.11.2011
4.2 Praxissemester<br />
Schiffsmaschinenbau<br />
http://www.fh-flensburg.de/satzung/b/po_bp_schiffst_smb_ba_03052011.pdf<br />
Schiffsbetriebstechnik<br />
???
Anhang:<br />
Anforderungen an das Vorpraktikum für den <strong>Studiengang</strong> <strong>Schiffstechnik</strong>;<br />
Schwerpunkt Schiffsbetriebstechnik<br />
Der Zeitumfang beträgt 26 Wochen, davon für die Zulassung erforderlich sind<br />
mindestens 14 Wochen.<br />
Leistungsumfang:<br />
Metallbearbeitung<br />
Manuelle Umformtechniken<br />
Sägen<br />
Feilen 6 Wochen<br />
Reiben<br />
Schleifen<br />
Gewindeschneiden<br />
Maschinelle Umformtechniken min 12 Wochen 3<br />
Bedienen der Maschinen<br />
Bohren, Senken, Reiben<br />
Drehen<br />
Schleifen<br />
Fräsen<br />
4 Wochen<br />
Trenn- <strong>und</strong> Fügetechniken 2 Wochen<br />
Reparaturbetrieb (einschließlich Elektroarbeit) min 14 Wochen<br />
Gesamtdauer mindestens 26 Wochen<br />
Metallbearbeitung gemäß<br />
• Training Record Book § 2.2 gesamter Abschnitt ME<br />
• Zeitrichtwert der Richtlinie zur Ausbildung technischer Schiffsoffiziere<br />
3 Gemäß TOA Richtlinie <strong>und</strong> Training Record Book / Technische Offiziere<br />
4
Präambel<br />
ENTWURF 28.12.2010<br />
Fachhochschule Flensburg<br />
Flensburg University of Applied Sciences<br />
Praxissemesterordnung<br />
des <strong>Studiengang</strong>s <strong>Schiffstechnik</strong> /<br />
Schwerpunkt Schiffsbetriebstechnik<br />
Die Praxissemesterordnung regelt die Anforderungen an die praktische<br />
Ausbildung <strong>und</strong> Seefahrtzeit, soweit diese gemäß § 15 Abs. 1c der<br />
Schiffsoffizier-Ausbildungsverordnung (SchOffzAusbV) in der jeweils<br />
geltenden Fassung in der Form von Praxissemestern durchgeführt wird.<br />
Sie orientiert sich an den Richtlinien des B<strong>und</strong>esministeriums für Verkehr,<br />
Bau <strong>und</strong> Stadtentwicklung (BMVBS) für die praktischen Ausbildung <strong>und</strong><br />
Seefahrtzeit als technischer Offiziersassistent in der jeweils geltenden<br />
Fassung.<br />
In Hinblick auf die Gleichstellung von Mann <strong>und</strong> Frau gelten die folgenden<br />
Vorschriften gleichermaßen für beide Geschlechter, sofern<br />
geschlechtsspezifische Wortformen verwenden werden.<br />
1 Gr<strong>und</strong>sätze <strong>und</strong> Ziele<br />
1.1 Der Bachelor-<strong>Studiengang</strong> <strong>Schiffstechnik</strong> / Schwerpunkt<br />
Schiffsbetriebstechnik umfasst sechs Theoriesemester <strong>und</strong> ein in zwei<br />
Abschnitte gegliedertes Berufspraktikum (zwei Praxissemester). Die<br />
Praxissemester dienen dem Erwerb von Fertigkeiten, die für eine spätere<br />
Ausübung des Berufes eines technischen Schiffsoffiziers benötigt werden.<br />
In ihnen werden die durch internationale <strong>und</strong> nationale Vorschriften<br />
festgelegten praktischen Ausbildungsinhalte erlernt, die für die Erteilung<br />
des Befähigungszeugnisses Voraussetzung sind.<br />
1.2 Ziel des ersten Praxissemesters ist es, das Berufsfeld Schiff <strong>und</strong><br />
<strong>Schiffstechnik</strong> kennenzulernen. Dabei sollen möglichst viele<br />
berufspraktische Erfahrungen <strong>und</strong> damit verb<strong>und</strong>ene Fertigkeiten<br />
gewonnen werden, die den Hintergr<strong>und</strong> für die sich anschließende<br />
theoretische Ausbildung bilden.<br />
1.3 Ziel des zweiten Praxissemesters ist es, das bisher erworbene<br />
theoretische Wissen in der Praxis anzuwenden. Es soll insbesondere mit<br />
den Aufgaben eines technischen Wachoffiziers vertraut machen. Das<br />
zweite Praxissemester ist in der Regel im 8. Fachsemester zu absolvieren.
ENTWURF 28.12.2010<br />
1.4 Die Ausbildungsinhalte sind entsprechend den o.a. Richtlinien zu erfüllen.<br />
Sie werden in dem von der StAK (Ständige Arbeitsgemeinschaft der<br />
Küstenländer für das Seefahrtbildungswesen) beschlossenen <strong>und</strong> vom<br />
BMVBS oder der von ihm beauftragten Stelle anerkannten On Board<br />
Training Record Book for Engineer Cadets (TRB) dokumentiert. Das<br />
vollständige Berufspraktikum ist Bestandteil des Hochschulstudiums<br />
entsprechend den Bestimmungen des schleswig-holsteinischen<br />
Hochschulrechts.<br />
2 Praxissemestervertrag<br />
Zwischen der/dem Studierenden, der Fachhochschule Flensburg <strong>und</strong> der<br />
Praxisstelle wird der als Anhang dieser Praxissemesterordnung beigefügte<br />
Praxissemestervertrag geschlossen.<br />
3 Praxisstellen<br />
3.1 Beide Praxissemester sind auf Schiffen zu absolvieren, die für die<br />
Ausbildungsziele der Praxissemester geeignet sind. Der für die Betreuung<br />
des Praktikanten vorgesehene technische Schiffsoffizier soll in der Regel<br />
Inhaber eines deutschen Befähigungszeugnisses sein. Inhaber eines<br />
ausländischen Befähigungszeugnisses kommen für die Betreuung in<br />
Betracht, wenn die sprachliche Verständigung uneingeschränkt gegeben<br />
ist.<br />
3.2 Studierende werden als Praktikant/in gemustert <strong>und</strong> sind nicht auf die<br />
gemäß Schiffsbesatzungszeugnis erforderliche Besatzung anzurechnen.<br />
3.3 Die Studierenden sind während der Praxissemester über die See-Berufsgenossenschaft<br />
oder dem P&I-Club des Reeders gegen Unfall versichert.<br />
Sie genießen ferner den Schutz der studentischen Krankenversicherung.<br />
Für die Absicherung der über die Leistungen der Krankenversicherung<br />
hinaus gehenden Risiken einer Krankheit im Ausland ist die Praxisstelle<br />
zuständig. Die Kosten dafür trägt die Praxisstelle.<br />
4 Erstes Praxissemester<br />
4.1 Das erste Praxissemester soll das erste Fachsemester sein. Näheres<br />
regelt die Prüfungs- <strong>und</strong> Studienordnung für den Bachelor-<strong>Studiengang</strong><br />
<strong>Schiffstechnik</strong> / Schwerpunkt Schiffsbetriebstechnik. Über eine<br />
Anrechnung vor Beginn des Studiums absolvierter Seefahrtzeiten<br />
entscheidet die/der Praxissemesterbeauftragte der Fachhochschule<br />
Flensburg im Benehmen mit dem BMVBS oder der von ihm bestimmten<br />
Stelle.<br />
4.2 Die Dauer beträgt 26 Wochen. Diese Zeit soll zusammenhängend an Bord<br />
verbracht werden.
ENTWURF 28.12.2010<br />
4.3 Vor Beginn des Praxissemesters sind die allgemeinen Voraussetzungen<br />
für eine Erwerbstätigkeit in der deutschen Seeschifffahrt zu erfüllen. Dazu<br />
gehören der Nachweis der Seediensttauglichkeit, der Besitz eines<br />
Seefahrtbuches <strong>und</strong> die Einführungsausbildung für Seeleute gemäß Teil<br />
A-VI/1 Abs. 1 des STCW-Codes (Sicherheitsgr<strong>und</strong>lehrgang). Darüber<br />
hinaus muss ein sechsmonatiges Metallgr<strong>und</strong>praktikum nachgewiesen<br />
werden.<br />
4.4 Die Ausbildungs- <strong>und</strong> Tätigkeitsbereiche sind in Tabelle 1 im Anhang<br />
aufgeführt. Die Zeitrichtwerte sind in Absprache mit dem betreuenden<br />
technischen Offizier anteilig im ersten oder zweiten Praxissemester zu<br />
erfüllen.<br />
5 Zweites Praxissemester<br />
5.1 Das zweite Praxissemester findet in der Regel im 8. Fachsemester statt.<br />
Näheres regelt die Prüfungs- <strong>und</strong> Studienordnung für den Bachelor-<br />
<strong>Studiengang</strong> <strong>Schiffstechnik</strong> / Schwerpunkt Schiffsbetriebstechnik.<br />
5.2 Ziffer 4.2 gilt entsprechend.<br />
5.3 Ziffer 4.4 gilt entsprechend.<br />
6 Aufgaben der Studierenden<br />
6.1 Die Studierenden suchen sich eine Praxisstelle.<br />
6.2 Die Studierenden haben die Erfüllung der Ausbildungsinhalte unter<br />
Anleitung <strong>und</strong> Kontrolle des sie an Bord betreuenden Offiziers<br />
nachzuweisen. Die Dokumentation erfolgt durch eine entsprechende<br />
Bestätigung im Training Record Book.<br />
6.3 Nach Ablauf jedes Praxissemesters ist ein Praxissemesterbericht<br />
anzufertigen, der eine Beschreibung des Schiffes <strong>und</strong> der Reisen, eine<br />
zusammenfassende Darstellung der Erfahrungen <strong>und</strong> eine abschließende<br />
Wertung des jeweiligen Praxissemesters enthält.<br />
6.4 Für die Absicherung eines ausreichenden Versicherungsschutzes gegen<br />
Unfall während der Freizeit im Ausland sind die Studierenden<br />
verantwortlich.<br />
7 Aufgaben der Hochschule<br />
7.1 Die Hochschule unterstützt die Studierenden bei der Suche nach einer<br />
geeigneten Praxisstelle. Sie benennt bei Bedarf geeignete Reedereien <strong>und</strong><br />
Schiffe.<br />
7.2 Zur Organisation, Betreuung <strong>und</strong> Anerkennung der Praxissemester<br />
ernennt die Hochschule einen Praxissemesterbeauftragten.
ENTWURF 28.12.2010<br />
7.3 Praktikumsverträge <strong>und</strong> sonstige benötigte Unterlagen werden der/dem<br />
Studierenden von der Hochschule rechtzeitig vor Beginn des<br />
Praxissemesters ausgehändigt.<br />
7.4 Die Hochschule erkennt ordnungsgemäß absolvierte Praxissemester an<br />
<strong>und</strong> stellt hierüber eine Bescheinigung aus. Sie gewährt dem BMVBS oder<br />
der von ihm beauftragten Stelle Einblick in die Praktikumsunterlagen.<br />
8 Aufgaben der Praxisstelle<br />
8.1 Die Praxisstelle bestimmt einen an Bord befindlichen technischen<br />
Schiffsoffizier (Betreuer), der für die Betreuung der/des Studierenden<br />
verantwortlich ist. Dieser achtet auf die ordnungsgemäße Durchführung<br />
des Praxissemesters entsprechend den Richtlinien des BMVBS dieser<br />
Praxissemesterordnung <strong>und</strong> dem Training Record Book.<br />
8.2 Die Praxisstelle versichert die Studierenden gegen Krankheit im Ausland<br />
<strong>und</strong> trägt die Kosten für die gesetzliche Unfallversicherung für die Dauer<br />
der Praxissemester.<br />
8.3 Der/dem Studierenden ist an Bord freie Unterkunft <strong>und</strong> Verpflegung zu<br />
gewähren.<br />
8.4 Falls die Reise der/des Studierenden im Ausland beginnt <strong>und</strong>/oder endet,<br />
trägt die Praxisstelle die Reisekosten.<br />
8.5 Nach Beendigung jedes Praxissemesters sind die abgeleisteten<br />
Ausbildungsinhalte vom Betreuer <strong>und</strong> vom Kapitän zu bescheinigen.<br />
9 Anerkennung der Praxissemester<br />
9.1 Voraussetzungen für die Anerkennung eines jeden Praxissemesters durch<br />
die Hochschule sind:<br />
� Vorlage des Praxissemestervertrages,<br />
� Vorlage einer Bescheinigung des Ausbildungsbetriebes über die<br />
Durchführung des Praxissemesters mit Angaben über den zeitlichen<br />
Umfang,<br />
� Vorlage des Praxissemesterberichts <strong>und</strong> des Training Record Books.<br />
9.2 Die/der Praxissemesterbeauftragte kann in Fällen, in denen die<br />
Voraussetzungen für die Anerkennung nicht ausreichend erfüllt sind, die<br />
Anerkennung von der Erfüllung von Auflagen abhängig machen.<br />
9.3 Die Praxissemester werden durch folgende Ausbildungen, bzw. Tätigkeiten<br />
ersetzt:<br />
� die Berufsausbildung <strong>zum</strong> Schiffsmechaniker,<br />
� die praktische Ausbildung <strong>und</strong> Seefahrtzeit <strong>zum</strong> Offiziersassistenten<br />
(TOA),<br />
� die bisherigen Befähigungszeugnisse CMA/CMAW oder CT/CTW.
ENTWURF 28.12.2010<br />
Vom BMVBS oder der von ihm beauftragten Stelle als ausreichend <strong>und</strong><br />
einschlägig anerkannte Seefahrtzeiten können ganz oder teilweise<br />
angerechnet werden.
ENTWURF 28.12.2010<br />
Anhang: - Tabelle 1 - TRB 2.2: Training tasks and area of operation / Ausbildungs- <strong>und</strong><br />
Tätigkeitsbereiche<br />
Training tasks<br />
Ausbildungs- <strong>und</strong> Tätigkeitsbereiche<br />
ME Metal working<br />
Metallbearbeitung<br />
ME 1 Metal working at a training shop/experience in different areas<br />
Metallbearbeitung in einer Lehrwerkstatt/einer überbetrieblichen<br />
Ausbildungsstätte<br />
ME 2 Improvisation work during daily routine ship operation<br />
Improvisationsarbeiten im laufenden Schiffsbetrieb<br />
ME 3 Metal working during daily routine ship operation<br />
Metallbearbeitung im laufenden Schiffsbetrieb<br />
US Marine Engineering at the support level<br />
Schiffsbetriebstechnik auf der Unterstützungsebene<br />
US 1 Carry out a watch routine<br />
Gehen einer Maschinenwache<br />
US 2 Operate boiler/heat transmission system<br />
Betrieb der Dampferzeuger-/Wärmeübertragungsanlagen<br />
US 3 Operate emergency equipment and apply emergency procedures<br />
Betrieb von Noteinrichtungen <strong>und</strong> Anwendung von Notfallverfahren<br />
BS Marine engineering at the operational level<br />
Schiffsbetriebstechnik auf Betriebsebene<br />
BS 1 Use of hand tools, electrical and electronic measuring and testing<br />
equipment for fault finding, maintenance and repair operations<br />
Gebrauch von Werkzeugen, elektrischen <strong>und</strong> elektronischen<br />
Mess- <strong>und</strong> Prüfgeräten für das Aufdecken von Fehlerquellen,<br />
Wartungs- <strong>und</strong> Reparaturbetrieb<br />
BS 2 Maintaining a safe engineering watch<br />
Aufrechterhaltung einer sicheren Maschinenwache<br />
BS 3 Use English in written and oral form<br />
Anwendung der englischen Sprache in Wort <strong>und</strong> Schrift<br />
BS 4 Operate main and auxiliary machinery and associated control<br />
systems<br />
Betrieb der Haupt- <strong>und</strong> Hilfsmaschinen <strong>und</strong> der damit verb<strong>und</strong>enen<br />
Kontrollsysteme<br />
BS 5 Operate pumping systems and associated control systems<br />
Betrieb der Pumpen- <strong>und</strong> der damit verb<strong>und</strong>enen<br />
Überwachungssysteme<br />
BE Electrical, electronic and control engineering at the<br />
operational level<br />
Elektrotechnik, Elektronik <strong>und</strong> Leittechnik auf Betriebsebene<br />
BE 1 Operate alternators, generators and control systems<br />
Betrieb von Generatoren <strong>und</strong> deren Kontrollsystemen<br />
BI Maintenance and repair at the operational level<br />
Wartung <strong>und</strong> Instandsetzung auf Betriebsebene<br />
BI 1 Maintain marine engineering systems including control systems<br />
Instandhaltung schiffstechnischer Systeme einschließlich deren<br />
Kontrollsysteme<br />
BK Controlling the operation of the ship and care for persons on<br />
Board at the operational level<br />
Überwachung des Schiffsbetriebes <strong>und</strong> Fürsorge für<br />
Personen an Bord auf Betriebsebene<br />
BK 1 Ensure compliance with pollution-prevention requirements to the<br />
marine environment<br />
Gewährleistung der Einhaltung der Vorschriften zur Verhütung<br />
von Meeresverschmutzung<br />
BK 2 Maintain seaworthiness of the ship<br />
Aufrechterhaltung der Seetüchtigkeit des Schiffes<br />
Standard time values<br />
Zeitrichtwerte<br />
at least 14 weeks total<br />
14 Wochen insgesamt<br />
at least 7 weeks/280hrs<br />
mindestens 7 Wochen/280<br />
St<strong>und</strong>en<br />
at least 1 week<br />
mindestens 1 Woche<br />
at least 6 weeks<br />
mindestens 6 Wochen<br />
at least 26 weeks<br />
mindestens 26 Wochen<br />
at least 18 weeks<br />
mindestens 18 Wochen<br />
at least 2 weeks<br />
mindestens 2 Wochen<br />
at least 6 weeks<br />
mindestens 6 Wochen<br />
at least 11 weeks total<br />
11 Wochen insgesamt<br />
at least 4 weeks<br />
mindestens 4 Wochen<br />
at least 3 weeks<br />
mindestens 3 Wochen<br />
continuously<br />
ständig<br />
at least 2 weeks<br />
mindestens 2 Wochen<br />
at least 2 weeks<br />
mindestens 2 Wochen<br />
at least 5 weeeks<br />
mindestens 5 Wochen<br />
at least 5 weeks<br />
mindestens 5 Wochen<br />
at least 9 weeks<br />
mindestens 9 Wochen<br />
at least 9 weeksmindestens<br />
9 Wochen<br />
at least 3 weeks<br />
mindestens 3 Wochen<br />
continuously<br />
ständig<br />
continuously<br />
ständig
ENTWURF 28.12.2010<br />
BK 3 Prevent, control and fight fires onboard<br />
Verhütung, Eindämmung der Ausbreitung <strong>und</strong> Bekämpfung von<br />
Bränden an Bord<br />
BK 4 Operate lifesaving appliances<br />
Einsatz von Rettungsmitteln<br />
BK 5 Monitor compliance with legislative requirements<br />
Überwachung der Einhaltung der rechtlichen Vorschriften<br />
At cadet’s own disposal (training <strong>und</strong>er Section VI/I of the<br />
Annex to the STCW Code [basic safety training]/consolidating<br />
skills and competences in the separate training and operational<br />
areas)<br />
Zur freien Verfügung (Ausbildung gemäß Regel VI/I der Anlage<br />
<strong>zum</strong> STCW-Übereinkommen<br />
[Sicherheitsgr<strong>und</strong>ausbildung]/Festigung der Kenntnisse <strong>und</strong><br />
Fertigkeiten in den einzelnen Ausbildungs- <strong>und</strong><br />
Tätigkeitsbereichen)<br />
Total time<br />
Gesamtdauer<br />
at least 1 week<br />
mindestens 1 Woche<br />
at least 1 week<br />
mindestens 1 Woche<br />
at least 1 week<br />
mindestens 1 Woche<br />
10 weeks<br />
10 Wochen<br />
at least 78 weeks<br />
mindestens 78 Wochen
Zwischen<br />
1.<br />
2.<br />
<strong>und</strong><br />
3.<br />
Praxissemestervertrag<br />
Fachhochschule Flensburg<br />
Flensburg University of Applied Sciences<br />
(genaue Bezeichnung, Anschrift, Telefon; nachfolgend Praxisstelle genannt)<br />
der Fachhochschule Flensburg<br />
(Familienname, Vorname, ggf. Geburtsname; nachfolgend Studierende/r genannt)<br />
geboren am in<br />
wohnhaft in<br />
wird folgender Vertrag geschlossen:<br />
§ 1<br />
Allgemeines<br />
Im Bachelor-<strong>Studiengang</strong> <strong>Schiffstechnik</strong> / Schwerpunkt Schiffsbetriebstechnik des<br />
Fachbereichs Technik der Fachhochschule Flensburg wird das Berufspraktikum in zwei<br />
Abschnitten (zwei Praxissemester) durchgeführt. Die dafür geltende Praxissemesterordnung<br />
ist Bestandteil dieses Vertrages.
§ 2<br />
Pflichten der Vertragspartner<br />
(1) Die Praxisstelle verpflichtet sich,<br />
1. den/die Studierende/n in der Zeit vom bis unter<br />
Beachtung der in § 1 genannten Vorschriften auszubilden <strong>und</strong> ihn in dieser Zeit<br />
gemäß § 7 Seemannsgesetz als Praktikanten mustern zu lassen. Sie/er wird<br />
überzählig zur Schiffsbesatzung nach Schiffsbesatzungszeugnis gefahren.<br />
2. eine/n Ausbildungsbetreuer/in entsprechend Abschnitt 8.1 der<br />
Praxissemesterordnung / § 4 zu bestimmen,<br />
3. den Praxissemesterbericht zu prüfen <strong>und</strong> gegenzuzeichnen,<br />
4. der Hochschule schriftlich mitzuteilen, ob nach dem Urteil der Praxisstelle das<br />
Praxissemester mit oder ohne Erfolg absolviert wurde; sowie der/dem<br />
Studierenden auf Wunsch ein Zeugnis auszustellen,<br />
5. den/die Studierende/n gegen Krankheit im Ausland ausreichend zu versichern.<br />
Die Praxisstelle trägt ferner die Kosten für die gesetzliche Unfallversicherung<br />
bei der See-Berufsgenossenschaft oder dem zuständigen P&I-Club. Die<br />
Reederei unterrichtet den/die Studierende/n über die Höhe der<br />
Versicherungssumme.<br />
6. dem/der Studierenden freie Unterkunft <strong>und</strong> Verpflegung an Bord zu gewähren,<br />
7. nach Anerkennung des ersten Praxissemesters die nachgewiesenen Kosten für<br />
- den Nachweis der Seediensttauglichkeit<br />
- das Seefahrtbuch<br />
- den Sicherheitsgr<strong>und</strong>lehrgang<br />
zu erstatten,<br />
8. die Kosten für die An- <strong>und</strong> Rückreise zu <strong>und</strong> von ausländischen Häfen zu<br />
übernehmen. Sollte die/der Studierende das Praktikum vorzeitig abbrechen,<br />
muss sie/er für die Kosten der Rückreise selbst aufkommen.<br />
(2) Die/der Studierende verpflichtet sich, sich dem Ausbildungszweck entsprechend zu<br />
verhalten, insbesondere<br />
1. die gebotenen Ausbildungsmöglichkeiten wahrzunehmen,<br />
2. die im Rahmen der Ausbildungs- <strong>und</strong> Tätigkeitsbereiche (siehe<br />
Praxissemesterordnung) übertragenen Ausbildungsinhalte sorgfältig<br />
auszuführen,<br />
3. den im Rahmen der Ausbildung erteilten Anordnungen der Praxisstelle<br />
nachzukommen,<br />
4. die geltenden Ordnungen, insbesondere Arbeitsordnungen <strong>und</strong><br />
Unfallverhütungsvorschriften zu beachten,<br />
5. über Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsgeheimnisse Stillschweigen zu wahren,<br />
6. Tätigkeits- <strong>und</strong> Ausbildungsberichte (Training Record Book), sowie am Ende<br />
des Praxissemesters den Praxissemesterbericht zu schreiben,<br />
7. Fehlzeiten mit der Praxisstelle abzustimmen <strong>und</strong> nachzuholen,<br />
8. für einen ausreichenden Versicherungsschutz gegen Unfall während der<br />
Freizeit im Ausland zu sorgen.
(3) Die Fachhochschule Flensburg verpflichtet sich, ihren in der Praxissemesterordnung<br />
festgelegten Aufgaben nachzukommen.<br />
§ 3<br />
Kostenerstattung <strong>und</strong> Vergütungsansprüche<br />
Dieser Vertrag begründet für die Praxisstelle keinen Anspruch auf Erstattung von Kosten, die<br />
bei der Erfüllung des Vertrages entstehen.<br />
Der/dem Studierenden steht ein Rechtsanspruch auf Vergütung durch die Praxisstelle nicht<br />
zu. Eine Vergütung kann unter Beachtung der sozialversicherungsrechtlichen Regelungen<br />
vereinbart werden.<br />
§ 4<br />
Ausbildungsbetreuer<br />
Die Praxisstelle benennt den technischen Schiffsoffizier:<br />
____________________________________________<br />
(Name)<br />
als Ausbildungsbetreuer/in (Betreuer) für die Ausbildung der/des Studierenden. Diese/r<br />
kontrolliert <strong>und</strong> bescheinigt auch die ordnungsgemäße Erfüllung der im Rahmen des Training<br />
Record Book (Praxissemesterordnung 1.4) geforderten Aufgaben.<br />
§ 5<br />
Fehlzeiten<br />
Während der Vertragsdauer steht der/dem Studierenden kein Erholungsurlaub zu. Die<br />
Praxisstelle kann eine kurzfristige Freistellung aus persönlichen Gründen gewähren.<br />
Fehlzeiten sind nachzuholen.<br />
§ 6<br />
Versicherungsschutz<br />
(1) Die/der Studierende ist während der Praxissemester über die See-<br />
Berufsgenossenschaft bzw. den P&I-Club gegen Unfall im In- <strong>und</strong> Ausland versichert.<br />
Die Kosten dafür trägt die Praxisstelle.<br />
(2) Die studentische Krankenversicherung bleibt während des Praxissemesters wirksam.<br />
Für darüber hinaus gehende Risiken der Krankheit im Ausland ist die Praxisstelle<br />
zuständig.
§ 7<br />
Kündigung des Vertrages<br />
Der Vertrag kann von allen Vertragsparteien aus wichtigem Gr<strong>und</strong> ohne Einhaltung einer<br />
Frist vorzeitig gekündigt werden.<br />
Die Kündigung erfolgt durch eine einseitige schriftliche Erklärung gegenüber den anderen<br />
Vertragspartnern. Die Hochschule ist vor der Kündigung anzuhören.<br />
§ 8<br />
Vertragsausfertigungen<br />
Dieser Vertrag wird in drei gleich lautenden Ausfertigungen unterzeichnet. Jeder<br />
Vertragspartner erhält eine Ausfertigung.<br />
§ 9<br />
Sonstige Vereinbarungen<br />
Alle sonstigen vertraglichen Vereinbarungen bedürfen der Schriftform.<br />
§ 10<br />
Gültigkeit<br />
Dieser Vertrag gilt nur in Verbindung mit der Immatrikulation der/des Studierenden.<br />
Praxisstelle<br />
_________________<br />
Ort, Datum<br />
___________________<br />
_<br />
Unterschrift<br />
Anlage: Praxissemesterordnung<br />
Fachhochschule<br />
Flensburg<br />
_________________<br />
Ort, Datum<br />
___________________<br />
__<br />
Unterschrift<br />
Studierende/r<br />
________________<br />
Ort, Datum<br />
_________________<br />
__<br />
Unterschrift
Fachhochschule Flensburg<br />
Flensburg University of Applied Sciences<br />
<strong>Schiffstechnik</strong> // Schiffsbetriebstechnik (B.Eng.)<br />
Praxis-Seefahrtzeit<br />
(nach § 15 Schiffsoffizier-Ausbildungsverordnung)<br />
Matrikelnummer Nachname Vorname<br />
Ausbildung – Seefahrtzeit<br />
Dauer<br />
Bitte zutreffendes ankreuzen!!<br />
Wochen Tag(e)<br />
Ausbildung <strong>zum</strong> Schiffsmechaniker oder - -<br />
Von der Berufsbildungsstelle Seeschifahrt e.V. bescheinigte praktische<br />
Ausbildung <strong>und</strong> Seefahrtzeit (TOA) mindestens 52 Wochen für die Anerkennung<br />
des Bordpraktikums 1 <strong>und</strong> 78 Wochen für die Anerkennung des Bordpraktikums<br />
2 oder<br />
- -<br />
Nachweis einer Ausbildung in einem Metall oder Elektroberuf <strong>und</strong> 12 Monate<br />
Seefahrtzeit im Maschinendienst oder<br />
- -<br />
Abschluss der Seefahrtschule mit dem TWO oder<br />
Vom B<strong>und</strong>esamt für Seeschifffahrt <strong>und</strong> Hydrographie (BSH) anerkannte<br />
Seefahrtzeit oder<br />
Von einer „schiffsbetriebstechnischen“ Hochschule anerkannte Seefahrtzeit als<br />
Praxissemester-Studierender<br />
oder<br />
Nachweis eines 6-monatigen Praktikums in einem metallverarbeitenden<br />
Ausbildungsbetrieb <strong>und</strong><br />
Im <strong>Studiengang</strong> „<strong>Schiffstechnik</strong> // Schiffsbetriebstechnik“ (SBT) anerkannte<br />
Seefahrtzeit - Praxissemester-Studierender (PS)<br />
Schiff 1: (Schiffsname)<br />
Schiff 2: (Schiffsname)<br />
Schiff 3: (Schiffsname)<br />
Schiff 4: (Schiffsname)<br />
- -<br />
Summe 78<br />
Ablauf der Anerkennung der Seefahrtzeit<br />
1. Nachweis der Seefahrtzeit beim Praxissemesterbeauftragten abgeben.<br />
2. Überprüfung der Unterlagen durch den Praxissemesterbeauftragten<br />
3. Antrag zur Anerkennung der Studienleistung Berufspraktikum 1 . Das kann zu jedem<br />
Prüfungszeitraum geschehen zusammen mit der Klausuranmeldung. Studenten mit<br />
Schiffsmechanikerbrief, abgeschlossenem TOA oder TWO können sich gleichzeitig<br />
auch schon für das Berufspraktikum 2 anmelden.<br />
4. Nach Anerkennung <strong>und</strong> Eintragung erscheint die Studienleistung als teilgenommen im<br />
Notenkonto.<br />
Ablauf der Anerkennung der Seefahrtzeit bei Praxissemesterstudierenden<br />
1. Praxissemesterunterlagen (Nachweis von mind. 26 Wochen) beim<br />
Praxissemesterbeauftragten abgeben.<br />
2. Überprüfung der Unterlagen durch den Praxissemesterbeauftragten<br />
3. Antrag zur Anerkennung der Studienleistung Berufspraktikum 1. Das kann zu jedem<br />
Prüfungszeitraum geschehen zusammen mit der Klausuranmeldung.<br />
4. Der Praxissemesterbeauftragte erkennt das Bordpraktikum an, wenn mindestens 26<br />
Wochen gefahren wurden <strong>und</strong> wenn die Unterlagen inhaltlich korrekt sind.<br />
5. Nach Anerkennung <strong>und</strong> Eintragung erscheint die Studienleistung als teilgenommen im<br />
Notenkonto.<br />
Das gleiche wiederholt sich für die Anerkennung des zweiten Bordpraktikums<br />
Erledigt am<br />
Erledigt am<br />
Nach der Anerkennung durch den Praxissemesterbeauftragten bitte bei Frau Heubeck abgeben
Anerkennung der Seefahrtzeit<br />
Berufspraktikum (Abschnitte 1 <strong>und</strong> 2) Meldung an das Prüfungsamt<br />
(Termin)<br />
Bordpraktikum 1<br />
Bordpraktikum 2<br />
Nur für Praxissemesterstudierende!!!<br />
Unterschrift des<br />
Praxissemesterbeauftragten<br />
Berichte vollständig (ja/nein)<br />
Schiff 1: (Schiffsname)<br />
Schiff 2: (Schiffsname)<br />
Schiff 3: (Schiffsname)<br />
Schiff 4: (Schiffsname)<br />
Praxissemesterbericht / Seefahrtzeitbericht entspr. Anforderung (ja/nein)<br />
Schiff 1: (Schiffsname)<br />
Schiff 2: (Schiffsname)<br />
Schiff 3: (Schiffsname)<br />
Schiff 4: (Schiffsname)<br />
Technische Berichte (Ausarbeitungen: 2-4 Seiten // 1 Bericht für jede Woche an Bord<br />
1 27<br />
2 28<br />
3 29<br />
4 30<br />
5 31<br />
6 32<br />
7 33<br />
8 34<br />
9 35<br />
10 36<br />
11 37<br />
12 38<br />
13 39<br />
14 40<br />
15 41<br />
16 42<br />
17 43<br />
18 44<br />
19 45<br />
20 46<br />
21 47<br />
22 48<br />
23 49<br />
24 50<br />
25 51<br />
26 52<br />
TRB entspr. Anforderung (ja/nein)<br />
Die Dokumentation der praktischen Ausbildung / Seefahrtzeit<br />
erfüllt die STCW-Anforderungen.<br />
Flensburg, den<br />
______________________________<br />
Prof. Dr.-Ing. Holger Watter<br />
Praxissemesterbeauftragter<br />
Nach der Anerkennung durch den Praxissemesterbeauftragten bitte bei Frau Heubeck abgeben
Praktikumsordnung<br />
im Bachelor-<strong>Studiengang</strong> <strong>Schiffstechnik</strong> Studienrichtung Schiffsmaschinenbau<br />
an der Fachhochschule Flensburg vom 3. Mai 2011<br />
§ 1<br />
Allgemeines<br />
(1) In dem Bachelor-<strong>Studiengang</strong> <strong>Schiffstechnik</strong> Studienrichtung Schiffsmaschinenbau der<br />
Fachhochschule Flensburg ist ein Berufspraktikum eingebettet. Es wird von der Hochschule<br />
vorbereitet, begleitet <strong>und</strong> nachbereitet.<br />
(2) Alle Studierenden, die ein Berufspraktikum ableisten müssen, sind verpflichtet, sich rechtzeitig<br />
selbst nach besten Kräften <strong>und</strong> in enger Absprache mit der Hochschule um einen geeigneten<br />
Praxisplatz zu bemühen.<br />
(3) Die Hochschule ist bestrebt, durch Absprachen oder Rahmenvereinbarungen mit geeigneten<br />
Unternehmen oder Institutionen soweit möglich die rechtzeitige Bereitstellung von Praxisplätzen<br />
zu sichern.<br />
(4) Das Berufspraktikum soll durch einen Vertrag geregelt werden.<br />
§ 2<br />
Ausbildungsziele<br />
(1) Ziel des Berufspraktikums ist das Heranführen an ingenieurmäßige Tätigkeiten durch praktische,<br />
wenn möglich projektbezogene, Mitarbeit in vielfältigen betrieblichen Aufgaben <strong>und</strong> Verantwortungsbereichen<br />
der Ingenieurin oder des Ingenieurs. Dadurch soll eine enge Verbindung<br />
zwischen Studium <strong>und</strong> Berufspraxis hergestellt werden. Nach Möglichkeit sollen die Studierenden<br />
dabei Einblick in betriebliche Abläufe vom Auftragseingang bis zur Ablieferung kennen<br />
lernen, wobei den Schnittstellen zwischen den verschiedenen Betriebsbereichen besonderes<br />
Gewicht beigemessen werden sollte. Nicht der Erwerb von Fertigkeiten oder Detailwissen sollte<br />
im Vordergr<strong>und</strong> stehen, sondern das Erfassen von betrieblichen Zusammenhängen.<br />
(2) Berufspraktika im Ausland sind, soweit die in Abs. 1 genannten Ziele des Studiums dabei verfolgt<br />
werden können, besonders geeignet, die berufliche Entwicklung der Studierenden zu<br />
fördern <strong>und</strong> werden daher von der Hochschule nach Kräften unterstützt.<br />
§ 3<br />
Dauer<br />
Das Berufspraktikum ist im Umfang von drei Monaten (18 CP) abzuleisten. Etwaige Urlaubs- <strong>und</strong><br />
Fehlzeiten werden hierbei nicht mitgerechnet.<br />
1
§ 4<br />
Meldung <strong>und</strong> Zulassung<br />
(1) Das Berufspraktikum ist entsprechend der Prüfungs- <strong>und</strong> Studienordnung im siebenten<br />
Semester vorgesehen.<br />
(2) Zum Berufspraktikum wird zugelassen, wer alle Prüfungs- <strong>und</strong> Studienleistungen aus dem<br />
ersten, zweiten <strong>und</strong> dritten Semester komplett sowie weitere 50 Leistungspunkte (CP) erbracht<br />
hat <strong>und</strong> einen Praktikumsplatz nachweist.<br />
(3) Das Verfahren zur Meldung <strong>und</strong> Zulassung wird durch die Dekanin oder den Dekan geregelt.<br />
§ 5<br />
Durchführung<br />
(1) Das Berufspraktikum wird in enger Zusammenarbeit der Hochschule mit geeigneten Praxisstellen<br />
so durchgeführt, dass ein möglichst hohes Maß an Kenntnissen <strong>und</strong> Fertigkeiten<br />
erworben werden kann.<br />
(2) Die Betreuung der Studierenden am Praxisplatz soll durch eine feste oder einen festen, von der<br />
Praxisstelle benannte Betreuerin oder benannten Betreuer erfolgen, die oder der eine angemessene<br />
Ausbildung in einer einschlägigen Fachrichtung haben sollte <strong>und</strong> hauptberuflich in der<br />
Praxisstelle tätig ist. Diese Betreuerin oder dieser Betreuer hat die Aufgabe, die Einweisung der<br />
Studentin oder des Studenten in ihre oder seine Arbeitsgebiete <strong>und</strong> Aufgaben zu regeln <strong>und</strong> zu<br />
überwachen. Sie oder er soll als Kontaktperson für Beratungen zur Verfügung stehen <strong>und</strong> durch<br />
regelmäßige Anleitungsgespräche den Lernprozess unterstützen.<br />
(3) Darüber hinaus ordnet auch die Hochschule der Studentin oder dem Studenten im Berufspraktikum<br />
eine Hochschullehrerin oder einen Hochschullehrer zur Betreuung zu. Diese oder dieser<br />
soll die fachliche Betreuung der Studentin oder des Studenten ergänzen <strong>und</strong> im engen Kontakt<br />
mit der Betreuerin oder dem Betreuer der Praxisstelle eventuell auftretenden Schwierigkeiten<br />
entgegenwirken.<br />
(4) Die Praxisstelle verpflichtet sich mit der Bereitstellung eines Praxisplatzes:<br />
1. die Studentin oder den Studenten für die Dauer des Berufspraktikums entsprechend § 2 in<br />
geeigneter Weise auszubilden,<br />
2. der Studentin oder dem Studenten, soweit sie oder er gewähltes Mitglied eines der<br />
Selbstverwaltungsgremien der Hochschule ist, durch Freistellung die Teilnahme an Veranstaltungen<br />
dieser Gremien zu ermöglichen, soweit sie/er eine schriftliche Einladung hierzu<br />
vorlegt,<br />
3. der Studentin oder dem Studenten ein Zeugnis oder eine Bescheinigung auszustellen, die<br />
Angaben über den zeitlichen Umfang <strong>und</strong> die Inhalte der berufspraktischen Tätigkeiten<br />
sowie den Erfolg der Ausbildung enthält.<br />
(5) Die Hochschule verpflichtet sich mit der Feststellung der Eignung eines Praxisplatzes, die<br />
Praxisstelle in der Erfüllung ihrer Pflichten aus dem eingegangenen Ausbildungsverhältnis<br />
beratend <strong>und</strong> organisatorisch zu unterstützen.<br />
(6) Die Studentin oder der Student verpflichtet sich mit der Annahme eines Praxisplatzes:<br />
1. die gebotenen Ausbildungsmöglichkeiten wahrzunehmen,<br />
2. die übertragenen Aufgaben sorgfältig auszuführen,<br />
3. den Anordnungen der Praxisstelle <strong>und</strong> der von ihr beauftragten Personen nachzukommen,<br />
4. die für die Praxisstelle geltenden Ordnungen, insbesondere Arbeitsordnungen <strong>und</strong><br />
Unfallverhütungsvorschriften sowie Vorschriften über die Schweigepflicht, zu beachten,<br />
2
5. die Praxisstelle während des Berufspraktikums nicht ohne Zustimmung der Hochschule zu<br />
wechseln.<br />
(7) Pflichtverletzungen der Studentin oder des Studenten können je nach Schwere die Anerkennung<br />
als Studienleistung nach § 9 verhindern. Hierüber entscheidet der Prüfungsausschuss.<br />
§ 6<br />
Praktische Tätigkeiten<br />
Praktische Tätigkeiten im Berufspraktikum sind vorzugsweise:<br />
1. Mitarbeit an regelmäßig wiederkehrenden betrieblichen Aufgaben, zu deren Behandlung<br />
ingenieurwissenschaftliche Hilfsmittel <strong>und</strong> Verfahren erforderlich sind,<br />
2. Mitarbeit an fest umrissenen, konkreten Einzelprojekten in der gewählten berufstypischen<br />
Umgebung.<br />
§ 7<br />
Inhalte der Begleitstudien<br />
Bestandteil des Berufspraktikums ist ein von der Hochschule durchgeführtes Begleitstudium. Es<br />
besteht aus einem Einführungsseminar <strong>und</strong> einem Abschlussbericht.<br />
1. Einführungsseminar:<br />
Das Einführungsseminar soll den Studierenden Informationen über Arbeits- <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitsschutz<br />
sowie Sicherheitsfragen liefern. Weiterhin sollen Fragen über die Aufnahme <strong>und</strong><br />
Durchführung des Berufspraktikums beispielsweise Bewerbung, Arbeitsverträge, Unfallverhütungsvorschriften<br />
<strong>und</strong> Ähnliches behandelt werden. Die Studierenden werden über den<br />
Rechtsstatus während des Berufspraktikums aufgeklärt.<br />
2. Abschlussbericht:<br />
Der Abschlussbericht soll Angaben <strong>zum</strong> Unternehmen, in dem das Praktikum absolviert<br />
wurde (Anschrift, Aufgabenbereich, Personal, etc.), zur Dauer des Praktikums, zur Art der<br />
Einarbeitung <strong>und</strong> Betreuung zu den übertragenen Aufgaben <strong>und</strong> den hierfür benötigten<br />
Qualifikationen sowie eine Beschreibung der Projekte, an denen mitgearbeitet wurde,<br />
enthalten. Abschließend ist der Erfolg des Praktikums für das Studium bzw. für das spätere<br />
Berufsleben kritisch zu bewerten.<br />
§ 8<br />
Status der/des Studierenden an der Praxisstelle<br />
Während des Berufspraktikums, das Bestandteil des Studiums ist, bleibt die Studentin oder der<br />
Student an der Fachhochschule Flensburg immatrikuliert mit allen Rechten <strong>und</strong> Pflichten einer/eines<br />
ordentlichen Studierenden. Sie oder er ist keine Praktikantin oder kein Praktikant im Sinne des<br />
Berufsbildungsgesetzes <strong>und</strong> unterliegt an der Praxisstelle weder dem Betriebsverfassungsgesetz<br />
noch dem Personalvertretungsgesetz. Andererseits ist die Studentin oder der Student an die Ordnungen<br />
ihrer oder seiner Praxisstelle geb<strong>und</strong>en.<br />
3
§ 9<br />
Anerkennung als Studienleistung<br />
Für die Anerkennung des Berufspraktikums als Studienleistung sind erforderlich:<br />
1. die Teilnahme am Einführungsseminar <strong>zum</strong> Berufspraktikum,<br />
2. ein von der Betreuerin / von dem Betreuer der Hochschule anerkannter Abschlussbericht<br />
gemäß § 7,<br />
3. die Vorlage eines Zeugnisses oder einer Bescheinigung der Praxisstelle gemäß § 5 Abs. 4.<br />
§ 10<br />
Ausnahmeregelung<br />
(1) Für den Fall, dass ein zeitlich begrenzter Engpass bei der Bereitstellung von Praxisplätzen auftritt,<br />
kann die zeitliche Einordnung des Berufspraktikums in den Studienablauf vorübergehend<br />
geändert werden.<br />
(2) In Einzelfällen kann das Berufspraktikum auch an der Hochschule im Rahmen von Projekten<br />
der angewandten Forschung <strong>und</strong> des Technologietransfers durchgeführt werden.<br />
§ 11<br />
Schlussbestimmung<br />
Diese Praktikumsordnung ist Bestandteil der Prüfungs- <strong>und</strong> Studienordnung (Satzung) für den<br />
Bachelor-<strong>Studiengang</strong> <strong>Schiffstechnik</strong> Studienrichtung Schiffsmaschinenbau der Fachhochschule<br />
Flensburg, genehmigt vom Konvent des Fachbereichs Technik am 9. Februar 2011 <strong>und</strong> des<br />
Präsidiums der Fachhochschule Flensburg am 29. April 2011.<br />
Ausgefertigt:<br />
Flensburg, 3. Mai 2011<br />
FACHHOCHSCHULE FLENSBURG<br />
Fachbereich Technik<br />
- Der Dekan -<br />
gez. Prof. Dr. Helmut Erdmann<br />
4
Fachhochschule Flensburg<br />
Fachbereich Technik Kanzleistraße 91-93<br />
24943 Flensburg<br />
Testate <strong>zum</strong> Berufspraktikum<br />
im Bachelor-<strong>Studiengang</strong> ...........................................<br />
Hinweise<br />
a) Dieser Testatbogen wird mit dem Teilnahmetestat nach dem Einführungsseminar vom betreuenden Professor<br />
ausgegeben.<br />
b) Für die Eintragung der weiteren Testate hat die/der Studierende selbst zu sorgen.<br />
c) Das Berufspraktikum darf nach §6, Abs. 1 nur dann begonnen werden, wenn alle Studien- <strong>und</strong><br />
Prüfungsleistungen des 1., 2. <strong>und</strong> 3. Studiensemesters vollständig <strong>und</strong> weitere 50 Kreditpunkte (CP, ECTS)<br />
erbracht wurden. Hierzu ist ein aktuelles Notenkonto als Nachweis vorzulegen.<br />
d) Die Durchführung des Berufspraktikums muss von der betreuenden Firma bestätigt werden, gegebenenfalls durch<br />
ein beigefügtes Zeugnis der Firma.<br />
e) Die erfolgreiche Teilnahme am Abschlussseminar wird nur bestätigt, wenn die Testate unter Punkt 1. <strong>und</strong> 2.<br />
vorhanden sind <strong>und</strong> der Praktikumsbericht beim der/dem betreuenden Professorin / Professor abgegeben wurden.<br />
f) Dieser Testatbogen ist von der/dem Studierenden sorgfältig aufzubewahren, da ohne diesen Testatbogen keine<br />
Zulassung zur Bachelorthesis erfolgen kann. (Nach §7, Abs. 1 kann die Zulassung zur Bachelorthesis frühestens<br />
drei Monate nach dem bescheinigten Beginn des Berufspraktikums erfolgen.)<br />
g) Nach betätigter Teilnahme am Abschlussseminar ist der Testatbogen zur Erfassung im Prüfungsamt abzugeben!
5. Modulkatalog<br />
5.1 Modulkatalog Studienrichtung Schiffsbetriebstechnik<br />
5.2 Modulkatalog Schiffsmaschinenbau
5. Modulkatalog<br />
<strong>Schiffstechnik</strong><br />
Modulkatalog <strong>Schiffstechnik</strong> (B. Eng.)<br />
Modulkatalog Schwerpunkt Schiffsbetriebstechnik<br />
Stand Dienstag, 15. November 2011<br />
Inhalt<br />
M 1 Berufspraktikum ................................................................................................................................. 3<br />
M 2 Mathematik 1 ..................................................................................................................................... 4<br />
M 3 Physik ................................................................................................................................................ 5<br />
M 4 Elektrotechnik 1, Messtechnik ........................................................................................................... 6<br />
M 5 Technische Mechanik 1 ..................................................................................................................... 7<br />
V 5.1 Technische Mechanik 1.1 .......................................................................................................... 7<br />
V 5.2 Technische Mechanik 1.2 .......................................................................................................... 8<br />
M 6 Gr<strong>und</strong>lagen der Werkstofftechnik .................................................................................................... 10<br />
V 6.1 Werkstofftechnik 1 ................................................................................................................... 10<br />
V 6.2 Werkstofftechnik 1 Labor ......................................................................................................... 12<br />
V 6.3 Werkstofftechnik 2 ................................................................................................................... 13<br />
M 7 Englisch ........................................................................................................................................... 14<br />
V 7.1 Englisch 1 ................................................................................................................................ 15<br />
V 7.2 Englisch 2 ................................................................................................................................ 16<br />
M 8 Wirtschaft ......................................................................................................................................... 17<br />
M 9 Informatik ......................................................................................................................................... 18<br />
M 10 Mathematik 2 ............................................................................................................................... 20<br />
V 10.1 Mathematik 2. 1 ................................................................................................................... 20<br />
V 10.2 Mathematik 2. 2 ................................................................................................................... 21<br />
M 11 Elektrotechnik 2 .......................................................................................................................... 22<br />
V 11.1 Elektrotechnik 2 ................................................................................................................... 23<br />
V 11.2 Elektrotechnik 2 Labor ......................................................................................................... 24<br />
M 12 Thermodynamik ........................................................................................................................... 25<br />
V 12.1 Thermodynamik 1 ................................................................................................................ 26<br />
V 12.2 Thermodynamik 2 ................................................................................................................ 27<br />
M 13 Recht ........................................................................................................................................... 28<br />
V 13.1 Gr<strong>und</strong>lagen Recht................................................................................................................ 29<br />
V 13.1 Gr<strong>und</strong>lagen Schifffahrtsrecht ............................................................................................... 30<br />
M 14 Betriebstechnik ............................................................................................................................ 31<br />
V 14.1 Instandhaltung ..................................................................................................................... 32<br />
V 14.2 Instandhaltung Labor ........................................................................................................... 33<br />
M 15 Elektrische Maschinen ................................................................................................................. 35<br />
V 15.1 Elektrische Maschinen 1 ...................................................................................................... 36<br />
V 15.2 Elektrische Maschinen 2 ...................................................................................................... 37<br />
V 15.3 Elektrische Maschinen Labor .............................................................................................. 38<br />
M 16 Personalfürsorge ......................................................................................................................... 39<br />
V 16.1 Personalführung .................................................................................................................. 40<br />
V 16.2 Ges<strong>und</strong>heitsfürsorge ........................................................................................................... 42<br />
M 17 Tankschifffahrt ............................................................................................................................. 43<br />
1
M 18 Betriebsstoffe ............................................................................................................................... 44<br />
M 19 Maschinenelemente .................................................................................................................... 47<br />
M 20 Regelungstechnik ........................................................................................................................ 48<br />
M 21 Arbeitsmaschinen ........................................................................................................................ 49<br />
V 21.1 Arbeitsmaschinen 1 ............................................................................................................. 50<br />
V 21.2 Arbeitsmaschinen 2 ............................................................................................................. 52<br />
V 21.3 Arbeitsmaschinen Labor ...................................................................................................... 54<br />
M 22 Verbrennungskraftmaschinen...................................................................................................... 55<br />
V 22.1 Verbrennungskraftmaschinen 1 ........................................................................................... 56<br />
V 22.2 Verbrennungskraftmaschinen 2 ........................................................................................... 57<br />
V 22.3 Verbrennungskraftmaschinen 2 Labor ................................................................................ 58<br />
M 23 Schiffbau ...................................................................................................................................... 59<br />
V 23.1 Strömungslehre ................................................................................................................... 59<br />
V 23.2 Schiffbau .............................................................................................................................. 60<br />
V 23.3 Schiffssicherheit................................................................................................................... 61<br />
M 24 Dampfanlagen ............................................................................................................................. 62<br />
V 24.1 Dampfanlagen 1 .................................................................................................................. 63<br />
V 24.2 Dampfanlagen 2 .................................................................................................................. 64<br />
V 24.3 Dampfanlagen Labor ........................................................................................................... 65<br />
M 25 Gefahrstoffe ................................................................................................................................. 67<br />
M 26 Anlagentechnik ............................................................................................................................ 68<br />
V 26.1 Anlagentechnik .................................................................................................................... 69<br />
V 26.2 Anlagentechnik Labor .......................................................................................................... 71<br />
M 27 Automatisierungstechnik ............................................................................................................. 72<br />
V 27.1 Leittechnik ............................................................................................................................ 73<br />
V 27.2 Leittechnik Labor ................................................................................................................. 74<br />
M 28 Antriebssysteme .......................................................................................................................... 75<br />
V 28.1 Maschinendynamik .............................................................................................................. 76<br />
V 28.2 Wellen/Kupplungen/Getriebe ............................................................................................... 77<br />
M 29 Elektrische Anlagen ..................................................................................................................... 79<br />
V 29.1 Mittelspannung .................................................................................................................... 80<br />
V 29.2 Elektrische Anlagen ............................................................................................................. 80<br />
V 29.3 Elektrische Anlagen Labor ................................................................................................... 82<br />
M 30 Schiffsbetrieb ............................................................................................................................... 83<br />
M 31 Bachelor Thesis ........................................................................................................................... 86<br />
M 32 Berufspraktikum ........................................................................................................................... 87<br />
2
M 1 Berufspraktikum<br />
Modulkennziffer 1<br />
Modulname Berufspraktikum<br />
Modultyp Pflichtmodul<br />
Position im Studienverlauf 1. Fachsemester<br />
Angebotsrhythmus Beginn jedes Sommersemesters<br />
Modulbeauftragter Prof. Dr.-Ing. Holger Watter<br />
Dozentinnen / Dozenten Prof. Dr.-Ing. Holger Watter<br />
Semesterwochenst<strong>und</strong>en<br />
Workload (Zeitst<strong>und</strong>en) Präsenz: 750 Selbststudium: 150<br />
ECTS-Leistungspunkte (CP) 30<br />
Sprache Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />
Lehr- <strong>und</strong> Lernformen<br />
Prüfung (Form, Dauer) Studienleistung (SL): Dauer 26 Wochen ( Praktikumsbericht,<br />
Training Record Book)<br />
Teilnahmevoraussetzungen Metallpraktikum <strong>und</strong> Praxissemestervertrag<br />
Kompetenzziele fachlich-inhaltliche Kompetenzen<br />
Die Studierenden sind in der Lage,<br />
� die wesentlichen Bauelemente eines Schiffskörpers zu<br />
benennen<br />
� die wesentlichen schiffstechnischen Anlagen <strong>und</strong> Einrichtungen<br />
<strong>zum</strong> Betrieb eines Schiffes zu benennen<br />
� Basisaufgaben gemäß dem TRB auszuführen <strong>und</strong> zu<br />
dokumentieren<br />
� Die einschlägigen Sicherheitsvorschriften zu benennen <strong>und</strong> bei<br />
der Ausübung aller Tätigkeiten an Bord sowie während des<br />
Aufenthaltes auf dem Schiff anzuwenden.<br />
Schlüsselkompetenzen<br />
Die Studierenden sind in der Lage, sich in die gesellschaftlichen,<br />
kulturellen <strong>und</strong> funktionalen Organisationsstrukturen an Bord<br />
einzugliedern <strong>und</strong> die Zusammenarbeit aktiv mitgestalten. Sie<br />
erwerben interkulturelle Kompetenz <strong>und</strong> Internationale<br />
Kooperationsfähigkeit sowie Integrationsfähigkeit.<br />
Inhalte � Die im TRB aufgeführten einleitenden Ausbildungsinhalte <strong>und</strong><br />
Tätigkeiten<br />
STCW - Bezug � Fachpraktische Anforderungen gem. Tab. A-III/1 <strong>und</strong> A-III/ des<br />
STCW-Übereinkommens i.V. mit § 15<br />
Schiffsoffizierausbildungsverordnung<br />
Literatur � BSH (Hrsg): „On Board Training Record Book for Engineer<br />
Cadets “ (TRB)<br />
� BSH (Hrsg): „IMO – Standard – Redewendungen in der<br />
Seeschifffahrt“<br />
� Kropp/Peters/Wand: „Leben <strong>und</strong> Arbeiten an Bord“<br />
3
Name:<br />
Unterschrift: Datum:<br />
M 2 Mathematik 1<br />
Modulkennziffer 2<br />
Modulname Mathematik 1<br />
Modultyp Pflichtmodul<br />
zugeordnete Veranstaltung V 2.1. : Mathematik 1<br />
Position im Studienverlauf 2. Fachsemester<br />
Angebotsrhythmus Beginn jedes Wintersemesters<br />
Modulbeauftragter Prof. Dr. rer. nat. Götz Hofmann<br />
Dozentinnen / Dozenten Prof. Dr. rer. nat. Götz Hofmann<br />
Semesterwochenst<strong>und</strong>en 4<br />
Workload (Zeitst<strong>und</strong>en) Präsenz: 60 Selbststudium: 90<br />
ECTS-Leistungspunkte (CP) 5<br />
Sprache Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />
Lehr- <strong>und</strong> Lernformen Vorlesung / Übung<br />
Prüfung (Form, Dauer) Prüfungsleistung (PL):<br />
1 Klausur, 120 Minuten<br />
Teilnahmevoraussetzungen keine<br />
Kompetenzziele fachlich-inhaltliche Kompetenzen<br />
Die Studierenden sind in der Lage,<br />
� die Gr<strong>und</strong>lagen der Rechenverfahren zu beherrschen.<br />
� Formalismen in bekannten Situationen anzuwenden. Darüber<br />
hinaus werden erste Anwendungen der erlernten Techniken<br />
vermittelt.<br />
Schlüsselkompetenzen<br />
Die Studierenden sind in der Lage,<br />
� Analytisch zu denken.<br />
� Erworbenes Wissen später praktisch umzusetzen<br />
� Die Studierenden bekommen technische Kompetenz<br />
vermittelt.<br />
Inhalte 1. Aussagen, Mengen<br />
2. Zahlen (bis einschl. komplexe Zahlen)<br />
3. Vektoren<br />
4. Matrizen (lin. Gl’Systeme, Determinanten, Eigenwerte)<br />
5. Funktionen (Stetigkeit, Differenzierbarkeit)<br />
6. Integrale<br />
STCW - Bezug entfällt<br />
Literatur Leupold u.a. , Ingenieurmathematik, Bd. I <strong>und</strong> II<br />
Name:<br />
Formelsammlung (z.B. Papula)<br />
4
Unterschrift: Datum:<br />
M 3 Physik<br />
Modulkennziffer 3<br />
Modulname Physik<br />
Modultyp Pflichtmodul<br />
zugeordnete Veranstaltung V 3.1. : Physik<br />
Position im Studienverlauf 2. Fachsemester<br />
Angebotsrhythmus Beginn jedes Wintersemesters<br />
Modulbeauftragter Prof. Dr. rer. nat. Stephan Schaefer<br />
Dozentinnen / Dozenten Prof. Dr. rer. nat. Lothar Machon<br />
Prof. Dr. rer. nat. Stephan H. Schaefer<br />
Semesterwochenst<strong>und</strong>en 4<br />
Workload (Zeitst<strong>und</strong>en) Präsenz: 60 Selbststudium: 90<br />
ECTS-Leistungspunkte (CP) 5<br />
Sprache Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />
Lehr- <strong>und</strong> Lernformen Vorlesung<br />
Prüfung (Form, Dauer) Prüfungsleistung (PL):<br />
1 Klausur, 120 Minuten<br />
Teilnahmevoraussetzungen keine<br />
Kompetenzziele fachlich-inhaltliche Kompetenzen<br />
Die Studierenden<br />
� beherrschen die für den Ingenieursberuf wichtigsten<br />
physikalischen Techniken.<br />
Schlüsselkompetenzen<br />
Die Studierenden sind in der Lage,<br />
� naturwissenschaftliche Probleme zu analysieren <strong>und</strong> zu<br />
lösen.<br />
� Sie können Strukturen erfassen <strong>und</strong> die erlernten<br />
Denkweisen <strong>und</strong> Techniken in verschiedenen technischen<br />
<strong>und</strong> naturwissenschaftlichen Zusammenhängen verknüpfen<br />
<strong>und</strong> anwenden.<br />
Inhalte 1. Gr<strong>und</strong>lagen der Stat<br />
2. Schwingungen <strong>und</strong> Wellen<br />
3. Felder: Gravitationsfeld, elektrostatisches Feld,<br />
elektromagnetisches Feld<br />
4. Elektromagnetische Strahlung: Optik, Wechselwirkung<br />
Strahlung – Materie<br />
5. Atom- <strong>und</strong> Festkörperphysik<br />
STCW - Bezug entfällt<br />
Literatur Hering / Martin / Stohrer: Physik für Ingenieure, Lindner: Physik für<br />
Ingenieure, Lindner: Physikalische Aufgaben<br />
5
Stöcker: Taschenbuch der Physik, Hütte (Hrsg. Czichos): Die<br />
Gr<strong>und</strong>lagen der Ingenieurswissenschaften<br />
Name:<br />
Unterschrift: Datum:<br />
M 4 Elektrotechnik 1, Messtechnik<br />
Modulkennziffer 4<br />
Modulname Elektrotechnik 1, Messtechnik<br />
Modultyp Pflichtmodul<br />
Zugeordnete Veranstaltung V 4.1: Elektrotechnik 1, Messtechnik<br />
Position im Studienverlauf 2. Fachsemester<br />
Angebotsrhythmus Beginn jedes Wintersemester<br />
Modulbeauftragter Prof. Dr.-Ing. Klaus-Dieter Kruse<br />
Dozentinnen / Dozenten Prof. Dr.-Ing. Klaus-Dieter Kruse<br />
Semesterwochenst<strong>und</strong>en 4<br />
Workload (Zeitst<strong>und</strong>en) Präsenz: 60 Selbststudium: 90<br />
ECTS-Leistungspunkte (CP) 5<br />
Sprache Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />
Lehr- <strong>und</strong> Lernformen Vorlesung<br />
Prüfung (Form, Dauer) Prüfungsleistung (PL):<br />
1 Klausur, 120 Minuten<br />
Teilnahmevoraussetzungen keine<br />
Kompetenzziele fachlich-inhaltliche Kompetenzen<br />
� Die Studierendenbeherrschen die für einen Ingenieur<br />
wichtigen Techniken des Messens elektrischer <strong>und</strong><br />
nichtelektrischer Größen sowie der Auswertung von<br />
Messergebnissen.<br />
� Netzwerkanalyse <strong>und</strong> die Vermittlung von Kenntnissen<br />
über magnetische Felder <strong>und</strong> ihre Anwendung in der<br />
Technik sind Lehr- <strong>und</strong> Lernziele im Fach Elektrotechnik<br />
Schlüsselkompetenzen<br />
� Die Studierenden sind in der Lage Probleme zu lösen.<br />
� Sie bekommen die Fähigkeit zu erfolgreichem <strong>und</strong><br />
zielgerichtetem Handeln.<br />
� Die Studierenden erlangen die Fähigkeit fächerübergreifend<br />
zu denken <strong>und</strong> interdisziplinär zu kommunizieren.<br />
Inhalte Elektrotechnik:<br />
Gr<strong>und</strong>gesetze des Gleichstromkreises<br />
Das magnetische Feld<br />
Messtechnik:<br />
Fehlertheorie<br />
Gerätetechnik<br />
Sensorik<br />
STCW - Bezug Fachpraktische <strong>und</strong> fachtheoretische Anforderungen gem. Tab.<br />
A-III/1 <strong>und</strong> A-III/2 Übereinkommens.<br />
6
Literatur Elektrotechnik:<br />
Moeller Gr<strong>und</strong>lagen der Elektrotechnik 19.Aufl.<br />
Flegel, Birnstiel, Nerreter Elektrotechnik f.d. Maschinenbauer<br />
Messtechnik:<br />
Schrüfer Elektrische Messtechnik<br />
Bantel Messgeräte- Praxis<br />
Name:<br />
Unterschrift: Datum:<br />
M 5 Technische Mechanik 1<br />
Modulkennziffer 5<br />
Modulname Technische Mechanik 1<br />
Modultyp Pflichtmodul<br />
Position im Studienverlauf 2. <strong>und</strong> 3. Fachsemester<br />
Angebotsrhythmus Beginn jedes Wintersemester<br />
Beginn jedes Sommersemester<br />
Modulbeauftragter Prof. Dr.-Ing. Steffen Kluge<br />
Dozentinnen / Dozenten Prof. Dr.-Ing. Steffen Kluge<br />
Semesterwochenst<strong>und</strong>en 8<br />
Workload (Zeitst<strong>und</strong>en) Präsenz: 120 Selbststudium: 180<br />
ECTS-Leistungspunkte (CP) 10<br />
Sprache Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />
Lehr- <strong>und</strong> Lernformen 2x Vorlesung<br />
Prüfung (Form, Dauer) Prüfungsleistung (PL)<br />
1 Klausur, 120 Minuten<br />
Teilnahmevoraussetzungen keine<br />
Kompetenzziele siehe Tabellen V 5.1 <strong>und</strong> V 5.2<br />
zugeordnete Veranstaltungen V 5.1: Technische Mechanik 1.1<br />
V 5.2: Technische Mechanik 1.2<br />
Beschreibung der Veranstaltungen siehe Tabellen V 5.1 <strong>und</strong> V 5.2<br />
Name:<br />
Unterschrift: Datum:<br />
V 5.1 Technische Mechanik 1.1<br />
Modul 5 Technische Mechanik 1<br />
zugehörige Veranstaltung V 5.1. Technische Mechanik 1.1<br />
Dozentinnen / Dozenten Prof. Dr.-Ing. Steffen Kluge<br />
Position im Studienverlauf 2. Fachsemester<br />
Angebotsrhythmus Beginn jedes Wintersemester<br />
Semesterwochenst<strong>und</strong>en 4<br />
7
Workload (Zeitst<strong>und</strong>en) Präsenz: 60 Selbststudium: 90<br />
ECTS-Leistungspunkte (CP) 5<br />
Sprache Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />
Lehr- <strong>und</strong> Lernformen Vorlesung<br />
Prüfung (Form, Dauer) Zusammen mit technische Mechanik 1.2<br />
Teilnahmevoraussetzungen keine<br />
Kompetenzziele fachlich-inhaltliche Kompetenzen<br />
Gr<strong>und</strong>lagen der Technischen Mechanik I: Einführung <strong>und</strong><br />
Überblick über die Teilgebiete der Technischen Mechanik (Statik<br />
starrer Körper, Statik elastischer Körper, Festigkeitslehre,<br />
Kinematik, Kinetik).<br />
Schlüsselkompetenzen<br />
Förderung der methodischen Kompetenz, der sozialen Kompetenz<br />
<strong>und</strong> der persönlichen Selbstkompetenz der Studierenden.<br />
Inhalte 1. Axiome, Prinzipien <strong>und</strong> Konventionen der Mechanik<br />
2. Ebene <strong>und</strong> räumliche Kraftsysteme<br />
3. Schwerpunkt-Betrachtungen<br />
4. Schnittprinzip der Mechanik<br />
5. Lagrerreaktionen<br />
Ebene Tragewerke<br />
Räumliche Tragwerke<br />
Mehrteilige Tragwerke<br />
6. Schnittgrößen<br />
Gerader Balken<br />
Rahmen <strong>und</strong> Bögen<br />
Räumliche Tragwerke<br />
7. Seile <strong>und</strong> Ketten<br />
8. Haftung <strong>und</strong> Reibung<br />
STCW - Bezug entfällt<br />
Literatur [1] Göldner/Holzweissig: Leitfaden der Technischen Mechanik,<br />
Fachbuchverlag Leipzig<br />
[2] Gross/Hauger/Schnell: Technische Mechanik, Bde. 1-3<br />
Springer-Verlag<br />
[3] Dankert/Dankert: Technische Mechanik, Teubner-Verlag<br />
[4] Papula: Mathematik für Ingenieure <strong>und</strong> Naturwissen-schaftler,<br />
Vieweg-Verlag<br />
Name:<br />
Unterschrift: Datum:<br />
V 5.2 Technische Mechanik 1.2<br />
Modul 5 Technische Mechanik 1<br />
zugehörige Veranstaltung V 5.2 Technische Mechanik 1.2<br />
8
Dozentinnen / Dozenten Prof. Dr.-Ing. Steffen Kluge<br />
Position im Studienverlauf 3. Fachsemester<br />
Angebotsrhythmus Beginn jedes Sommersemester<br />
Semesterwochenst<strong>und</strong>en 4<br />
Workload (Zeitst<strong>und</strong>en) Präsenz: 60 Selbststudium: 90<br />
ECTS-Leistungspunkte (CP) 5<br />
Sprache Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />
Lehr- <strong>und</strong> Lernformen Vorlesung<br />
Prüfung (Form, Dauer) Prüfungsleistung (PL):<br />
Klausur (120 Minuten) oder sonstige Prüfungsleistung<br />
Teilnahmevoraussetzungen Mathematische Gr<strong>und</strong>lagen: Vektoren, Funktionen, Differential-<br />
<strong>und</strong> Integralrechnung,<br />
Gr<strong>und</strong>lagen der Technischen Mechanik I, insbesondere Statik<br />
starrer Körper.<br />
Kompetenzziele fachlich-inhaltliche Kompetenzen<br />
Gr<strong>und</strong>lagen der Technischen Mechanik II, Teilgebiete: Elastostatik<br />
<strong>und</strong> Festigkeitslehre.<br />
Schlüsselkompetenzen<br />
Förderung der methodischen Kompetenz, der sozialen Kompetenz<br />
<strong>und</strong> der persönlichen Selbstkompetenz der Studierenden.<br />
Inhalte 1. Gr<strong>und</strong>lagen der Festigkeitslehre<br />
2. Zug <strong>und</strong> Druck in Stäben.<br />
3. Biegung.<br />
4. Querkraftschub.<br />
5. Torsion prismatischer Stäbe.<br />
6. Spannungen in dünnwandigen Druckbehältern.<br />
7. Rotationssymmetrische Spannungszustände.<br />
8 Einführung in die Stabilitätstheorie <strong>und</strong> in die Knickung von<br />
Stäben<br />
9. Werkstoffermüdung <strong>und</strong> Schwingfestigkeit<br />
STCW - Bezug entfällt<br />
Literatur [1] Göldner/Holzweissig: Leitfaden der Technischen Mechanik,<br />
Fachbuchverlag Leipzig<br />
[2] Gross/Hauger/Schnell: Technische Mechanik, Bde. 1-3<br />
Springer-Verlag<br />
[3] Dankert/Dankert: Technische Mechanik, Teubner-Verlag<br />
[4] Papula: Mathematik für Ingenieure <strong>und</strong> Naturwissen-schaftler,<br />
Vieweg-Verlag<br />
Name:<br />
Unterschrift: Datum:<br />
9
M 6 Gr<strong>und</strong>lagen der Werkstofftechnik<br />
Modulkennziffer 6<br />
Modulname Gr<strong>und</strong>lagen der Werkstofftechnik<br />
Modultyp Pflichtmodul<br />
Position im Studienverlauf 2. <strong>und</strong> 3. Fachsemester<br />
Angebotsrhythmus Beginn jedes Wintersemester<br />
Beginn jedes Sommersemester<br />
Modulbeauftragter Prof. Dr.-Ing. Michael Dahms<br />
Dozentinnen / Dozenten Prof. Dr. Michael Dahms<br />
Prof. Dr. rer.nat. Lothar Machon<br />
Semesterwochenst<strong>und</strong>en 6<br />
Workload (Zeitst<strong>und</strong>en) Präsenz: 90 Selbststudium: 150<br />
ECTS-Leistungspunkte (CP) 8<br />
Sprache Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />
Lehr- <strong>und</strong> Lernformen 2x Vorlesung, 1x Labor<br />
Prüfung (Form, Dauer) Prüfungsleistung (PL)<br />
1 Klausur, 120 Minuten<br />
Teilnahmevoraussetzungen keine<br />
Kompetenzziele siehe Tabellen V 6.1, V 6.2 <strong>und</strong> V 6.3<br />
zugeordnete Veranstaltungen V 6.1: Werkstofftechnik 1<br />
V 6.2: Werkstofftechnik 1 Labor<br />
V 6.3: Werkstofftechnik 2<br />
Beschreibung der Veranstaltungen siehe Tabellen V 6.1, V 6.2 <strong>und</strong> V 6.3<br />
Name:<br />
Unterschrift: Datum:<br />
V 6.1 Werkstofftechnik 1<br />
Modul 6 Gr<strong>und</strong>lagen der Werkstofftechnik<br />
zugehörige Veranstaltung V 6.1. Werkstofftechnik 1<br />
Dozentinnen / Dozenten Prof. Dr.-Ing. Michael Dahms<br />
Position im Studienverlauf 2. Fachsemester<br />
Angebotsrhythmus Beginn jedes Wintersemester<br />
Semesterwochenst<strong>und</strong>en 2<br />
Workload (Zeitst<strong>und</strong>en) Präsenz: 30 Selbststudium: 45<br />
ECTS-Leistungspunkte (CP) 2,5<br />
Sprache Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />
Lehr- <strong>und</strong> Lernformen Vorlesung<br />
Prüfung (Form, Dauer) Zusammen mit Werkstofftechnik 2<br />
Teilnahmevoraussetzungen keine<br />
Kompetenzziele fachlich-inhaltliche Kompetenzen<br />
Die Studierenden sind in der Lage,<br />
gezielt Werkstoffe auszuwählen als auch verwendete Werkstoffe<br />
10
ewerten zu können.<br />
Außerdem sollen sie in der Lage, sein die Veränderung von<br />
Werkstoffeigenschaften bei Verarbeitung <strong>und</strong> Betrieb zu verstehen<br />
<strong>und</strong> so mit Zulieferern, Kollegen <strong>und</strong> K<strong>und</strong>en f<strong>und</strong>iert<br />
kommunizieren zu können.<br />
Weiterhin sollen sie in der Lage sein abzuschätzen, was die<br />
Beanspruchungsbedingungen an einem Werkstoff für Folgen<br />
haben können.<br />
Schlüsselkompetenzen<br />
Die Studierenden sind in der Lage,<br />
� Problemlösungsorientiert <strong>und</strong><br />
� anwendungsorientiert zu handeln.<br />
� Sie bekommen Gr<strong>und</strong>lagenwissen vermittelt.<br />
� Geschult wird ebenfalls die Fähigkeit zur Selbstorganisation.<br />
Inhalte � Atomaufbau, physikalische Eigenschaften<br />
� Kristallstruktur, Gitterfehler<br />
� Verformung, Festigkeit<br />
� Zähigkeit<br />
� Ermüdung<br />
� Thermisch aktivierte Prozesse<br />
� Zustandsdiagramme<br />
� Korrosion<br />
� Stahlherstellung<br />
� Fe-C-Diagramm, Perlit, Martensit<br />
� Bainit, ZTU-Diagramme<br />
� Wärmebehandlungsverfahren der Stähle<br />
� Systematik der Stähle<br />
� Stähle für besondere Anwendungen (z.B. Baustähle, Rost-<br />
<strong>und</strong> säurebeständige Stähle, Vergütungsstähle)<br />
STCW - Bezug Gr<strong>und</strong>lagenanforderungen gem. Tab. A-III/1 <strong>und</strong> A-III/2<br />
Übereinkommens.<br />
Literatur Bargel/Schulze: Werkstoffk<strong>und</strong>e<br />
Weißbach: Werkstoffk<strong>und</strong>e <strong>und</strong> Werkstoffprüfung<br />
Name:<br />
Unterschrift: Datum:<br />
11
V 6.2 Werkstofftechnik 1 Labor<br />
Modul 6 Gr<strong>und</strong>lagen der Werkstofftechnik<br />
zugehörige Veranstaltung V 6.2. Werkstofftechnik 1 Labor<br />
Dozentinnen / Dozenten Prof. Dr.-Ing. Michael Dahms<br />
Position im Studienverlauf 2. Fachsemester<br />
Angebotsrhythmus Beginn jedes Wintersemester<br />
Semesterwochenst<strong>und</strong>en 2<br />
Workload (Zeitst<strong>und</strong>en) Präsenz: 30 Selbststudium: 45<br />
ECTS-Leistungspunkte (CP) 2,5<br />
Sprache Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />
Lehr- <strong>und</strong> Lernformen Labor<br />
Prüfung (Form, Dauer) Erforderlich für Anerkennung Gr<strong>und</strong>lagen der Werkstofftechnik<br />
Teilnahmevoraussetzungen keine<br />
Kompetenzziele fachlich-inhaltliche Kompetenzen<br />
Die Studierenden sind in der Lage,<br />
gezielt Werkstoffe auszuwählen als auch verwendete Werkstoffe<br />
bewerten zu können.<br />
Außerdem sollen sie in der Lage, sein die Veränderung von<br />
Werkstoffeigenschaften bei Verarbeitung <strong>und</strong> Betrieb zu verstehen<br />
<strong>und</strong> so mit Zulieferern, Kollegen <strong>und</strong> K<strong>und</strong>en f<strong>und</strong>iert<br />
kommunizieren zu können.<br />
Weiterhin sollen sie in der Lage sein abzuschätzen, was die<br />
Beanspruchungsbedingungen an einem Werkstoff für Folgen<br />
haben können.<br />
Schlüsselkompetenzen<br />
Die Studierenden sind in der Lage,<br />
Inhalte � Zugversuch<br />
� Problemlösungsorientiert <strong>und</strong><br />
� anwendungsorientiert zu handeln.<br />
� Die Studierenden lernen sich selbst zu organisieren <strong>und</strong> im<br />
Team zu arbeiten<br />
� Härteprüfung<br />
� Kerbschlagbiegeversuch<br />
� Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung (Ultraschall,<br />
Magnetrißprüfung)<br />
� Wärmebehandlung von Stahlverformung + Rekristallisation<br />
� Metallographie<br />
� Werkstoffanalytik<br />
STCW - Bezug entfällt<br />
Literatur Bargel/Schulze: Werkstoffk<strong>und</strong>e<br />
Weißbach: Werkstoffk<strong>und</strong>e <strong>und</strong> Werkstoffprüfung<br />
Name:<br />
Unterschrift: Datum:<br />
12
V 6.3 Werkstofftechnik 2<br />
Modul 6 Gr<strong>und</strong>lagen der Werkstofftechnik<br />
zugehörige Veranstaltung V 6.3. Werkstofftechnik 2<br />
Dozentinnen / Dozenten Prof. Dr.-Ing. Michael Dahms<br />
Position im Studienverlauf 3. Fachsemester<br />
Angebotsrhythmus Beginn jedes Sommersemester<br />
Semesterwochenst<strong>und</strong>en 2<br />
Workload (Zeitst<strong>und</strong>en) Präsenz: 45 Selbststudium: 45<br />
ECTS-Leistungspunkte (CP) 3<br />
Sprache Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />
Lehr- <strong>und</strong> Lernformen Vorlesung<br />
Prüfung (Form, Dauer) Prüfungsleistung (PL)<br />
1 Klausur, 120 Minuten<br />
Teilnahmevoraussetzungen keine<br />
Kompetenzziele Die Studierenden sind in der Lage,<br />
gezielt Werkstoffe auszuwählen als auch verwendete Werkstoffe<br />
bewerten zu können.<br />
Außerdem sollen sie in der Lage, sein die Veränderung von<br />
Werkstoffeigenschaften bei Verarbeitung <strong>und</strong> Betrieb zu verstehen<br />
<strong>und</strong> so mit Zulieferern, Kollegen <strong>und</strong> K<strong>und</strong>en f<strong>und</strong>iert<br />
kommunizieren zu können.<br />
Weiterhin sollen sie in der Lage sein abzuschätzen, was die<br />
Beanspruchungsbedingungen an einem Werkstoff für Folgen<br />
haben können.<br />
Schlüsselkompetenzen<br />
Die Studierenden sind in der Lage,<br />
� Problemlösungsorientiert <strong>und</strong><br />
� anwendungsorientiert zu handeln.<br />
Inhalte � Schweißen von Stahl<br />
� Sie erlernen ebenfalls erfolgreich <strong>und</strong> zielgerichtet zu<br />
handeln.<br />
� Die Studierenden lernen fächerübergreifend zu denken.<br />
� Gusseisen<br />
� Aluminium <strong>und</strong> Aluminiumlegierungen<br />
� Kupfer <strong>und</strong> Kupferlegierungen<br />
� Nickel <strong>und</strong> Nickellegierungen<br />
� Titan <strong>und</strong> Titanlegierungen<br />
� Oxidkeramik, Nichtoxidkeramik<br />
� Halbleiter, Glas, Kohlenstoff<br />
� Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung<br />
� Polymere Werkstoffe<br />
� Verb<strong>und</strong>werkstoffe<br />
13
STCW - Bezug Gr<strong>und</strong>lagen Anforderungen gem. Tab. A-III/1 <strong>und</strong> A-III/2<br />
Übereinkommens.<br />
Literatur Bargel/Schulze: Werkstoffk<strong>und</strong>e<br />
Weißbach: Werkstoffk<strong>und</strong>e <strong>und</strong> Werkstoffprüfung<br />
Name:<br />
Unterschrift: Datum:<br />
M 7 Englisch<br />
Modulkennziffer 7<br />
Modulname Englisch<br />
Modultyp Pflichtmodul<br />
Position im Studienverlauf 2. <strong>und</strong> 3. Fachsemester<br />
Angebotsrhythmus Beginn jedes Wintersemester<br />
Beginn jedes Sommersemester<br />
Modulbeauftragter Prof. Dr. Peter Baumgartner<br />
Dozentinnen / Dozenten Prof. Dr. Peter Baumgartner<br />
Semesterwochenst<strong>und</strong>en 4<br />
Workload (Zeitst<strong>und</strong>en) Präsenz: 60 Selbststudium: 60<br />
ECTS-Leistungspunkte (CP) 4<br />
Sprache Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />
Lehr- <strong>und</strong> Lernformen 2x Vorlesung<br />
Prüfung (Form, Dauer) Studienleistung (SL)<br />
2 Klausuren je 60 Minuten, 2 schriftliche Ausarbeitungen, 2<br />
Vorträge<br />
Teilnahmevoraussetzungen keine<br />
Kompetenzziele fachlich-inhaltliche Kompetenzen<br />
Die Studierenden sind in der Lage,<br />
� einfache Texte aus dem Bereich Maschinenbau <strong>und</strong><br />
Elektrotechnik zu verstehen<br />
� berufstypische Vertragstexte zu verstehen<br />
� mit typischen kommunikativen Situationen (Telefon, Anfragen,<br />
Reklamationen usw.) umzugehen<br />
� aus Betriebs- <strong>und</strong> Wartungshandbüchern die erforderlichen<br />
Informationen zu gewinnen<br />
� technische Berichte zu verfassen<br />
� technische Sachverhalte zu formulieren<br />
Schlüsselkompetenzen<br />
Die Studierenden sind in der Lage,<br />
� in interkulturellen, naturwissenschaftlichen <strong>und</strong> technischen<br />
Kontexten sprachlich zu handeln<br />
� rezeptiv wie produktiv mit berufstypischen mündlichen <strong>und</strong><br />
schriftlichen Kommunikationssituationen umzugehen<br />
� mit den berufsspezifischen Textsorten (Betriebs- <strong>und</strong><br />
14
zugeordnete Veranstaltungen V 7.1: Englisch 1<br />
V 7.2: Englisch 2<br />
Beschreibung der Veranstaltungen siehe Tabellen V 7.1 <strong>und</strong> V 7.2<br />
Name:<br />
Unterschrift: Datum:<br />
V 7.1 Englisch 1<br />
Modul 7 Englisch<br />
zugehörige Veranstaltung V 7.1. Englisch 1<br />
Wartungshandbuch, technischer Bericht, Schadensbericht<br />
usw.) umzugehen<br />
� berufsspezifische kommunikative Situationen zu bewältigen<br />
Dozentinnen / Dozenten Prof. Dr. Peter Baumgartner<br />
Position im Studienverlauf 2. Fachsemester<br />
Angebotsrhythmus Beginn jedes Wintersemester<br />
Semesterwochenst<strong>und</strong>en 2<br />
Workload (Zeitst<strong>und</strong>en) Präsenz: 30 Selbststudium: 30<br />
ECTS-Leistungspunkte (CP) 2<br />
Sprache Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />
Lehr- <strong>und</strong> Lernformen Vorlesung<br />
Prüfung (Form, Dauer) Studienleistung (SL)<br />
1 Klausur, 60 Minuten, 1 schriftliche Ausarbeitung, 1 Vortrag<br />
Teilnahmevoraussetzungen keine<br />
Kompetenzziele fachlich-inhaltliche Kompetenzen:<br />
Die Studierenden sind in der Lage,<br />
� einfache Texte aus dem Bereich Maschinenbau <strong>und</strong><br />
Elektrotechnik zu verstehen<br />
� berufstypische Vertragstexte zu verstehen<br />
� mit typischen kommunikativen Situationen (Telefon,<br />
Anfragen, Reklamationen usw.) umzugehen<br />
Schlüsselkompetenzen:<br />
Die Studierenden sind in der Lage,<br />
� in interkulturellen, naturwissenschaftlichen <strong>und</strong> technischen<br />
Kontexten sprachlich zu handeln<br />
� rezeptiv wie produktiv mit berufstypischen mündlichen <strong>und</strong><br />
schriftlichen Kommunikationssituationen umzugehen<br />
Inhalte � Einführung in den <strong>zum</strong> Verstehen technischer<br />
Textsorten erforderlichen allgemeinen Wortschatz<br />
� Einführung in die allgemein technische Terminologie<br />
einschlägiger technischer Gebiete<br />
15
� Fachsprachliche Phraseologie, Fügungen,<br />
Wendungen, Kollokationen<br />
� Analyse von Vertragstexten<br />
� Behandlung ausgewählter Themenkreise:<br />
Unternehmen; Tests <strong>und</strong> Prüfungen; Werkstoffe;<br />
Abhängigkeit; Aufwand; Wartung <strong>und</strong><br />
Instandsetzung; Geräte, Anlagen usw.<br />
STCW - Bezug Kommunikationsanforderungen gem. Tab. A-III/1 <strong>und</strong> A-III/2<br />
Übereinkommens.<br />
Literatur Kraus: Wörterbuch <strong>und</strong> Satzlexikon. Gemeinsprachlicher<br />
Wortschatz in technisch-wissenschaftlichen Texten.<br />
Baumgartner / Kraus: Phraseological Dictionary. General<br />
Vocabulary in Technical and Scientific Texts<br />
Skript mit adaptierten Texten aus Fachbüchern,<br />
Dokumentation, Fachzeitschriften <strong>und</strong> Internet<br />
Name:<br />
Unterschrift: Datum:<br />
V 7.2 Englisch 2<br />
Modul 7 Englisch<br />
zugehörige Veranstaltung V 7.2. Englisch 2<br />
Dozentinnen / Dozenten Prof. Dr. Peter Baumgartner<br />
Position im Studienverlauf 3. Fachsemester<br />
Angebotsrhythmus Beginn jedes Sommersemester<br />
Semesterwochenst<strong>und</strong>en 2<br />
Workload (Zeitst<strong>und</strong>en) Präsenz: 30 Selbststudium: 30<br />
ECTS-Leistungspunkte (CP) 2<br />
Sprache Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />
Lehr- <strong>und</strong> Lernformen Vorlesung<br />
Prüfung (Form, Dauer) Studienleistung (SL)<br />
1 Klausur, 60 Minuten, 1 schriftliche Ausarbeitung, 1 Vortrag<br />
Teilnahmevoraussetzungen keine<br />
Kompetenzziele fachlich-inhaltliche Kompetenzen:<br />
Die Studierenden sind in der Lage,<br />
� aus Betriebs- <strong>und</strong> Wartungshandbüchern die erforderlichen<br />
Informationen zu gewinnen<br />
� technische Berichte zu verfassen<br />
� technische Sachverhalte zu formulieren<br />
Schlüsselkompetenzen:<br />
Die Studierenden sind in der Lage,<br />
� mit den berufsspezifischen Textsorten (Betriebs- <strong>und</strong><br />
Wartungshandbuch, technischer Bericht, Schadensbericht usw)<br />
umzugehen<br />
16
� berufsspezifische kommunikative Situationen zu bewältigen<br />
� mit den erlernten Sprachkenntnissen international zu<br />
kooperieren.<br />
Inhalte � Kontrolliertes Formulieren von technischen Sachverhalten<br />
� Übungen <strong>zum</strong> einfachen <strong>und</strong> korrekten Umsetzen von<br />
technischen Sachverhalten in Sprache<br />
� Übersetzen von Originaltexten<br />
� Abfassen von technischen Berichten<br />
� Technische Kommunikation <strong>und</strong> Korrespondenz: complaints,<br />
damage reports, technical reports, want ads, invitation to<br />
seminar usw.<br />
STCW - Bezug Kommunikationsanforderungen gem. Tab. A-III/1 <strong>und</strong> A-III/2<br />
Übereinkommens.<br />
Literatur Kraus: Wörterbuch <strong>und</strong> Satzlexikon. Gemeinsprachlicher<br />
Wortschatz in technisch-wissenschaftlichen Texten.<br />
Baumgartner / Kraus: Phraseological Dictionary. General<br />
Vocabulary in Technical and Scientific Texts.<br />
Skript mit adaptierten Texten aus Fachbüchern,<br />
Dokumentation, Fachzeitschriften <strong>und</strong> Internet<br />
Name:<br />
Unterschrift: Datum:<br />
M 8 Wirtschaft<br />
Modulkennziffer 8<br />
Modulname Wirtschaft<br />
Modultyp Pflichtmodul<br />
zugehörige Veranstaltung V 8.1 Gr<strong>und</strong>lagen BWL<br />
Position im Studienverlauf 2. Fachsemester<br />
Angebotsrhythmus Beginn jedes Wintersemester<br />
Modulbeauftragter Dr. oec., Dipl.- Wirtsch. Christian Czogalla<br />
Dozentinnen / Dozenten Dr. oec., Dipl.- Wirtsch. Christian Czogalla<br />
Semesterwochenst<strong>und</strong>en 2<br />
Workload (Zeitst<strong>und</strong>en) Präsenz: 30 Selbststudium: 60<br />
ECTS-Leistungspunkte (CP) 3<br />
Sprache Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />
Lehr- <strong>und</strong> Lernformen Vorlesung<br />
Prüfung (Form, Dauer) Studienleistung (SL)<br />
1 Klausufr, 60 Minuten oder 1 Vortrag/Referat oder<br />
1 schriftliche Ausarbeitung<br />
Teilnahmevoraussetzungen keine<br />
Kompetenzziele fachlich-inhaltliche Kompetenzen<br />
Die Studierenden sind in der Lage,<br />
� Wichtige ökonomische Termini <strong>und</strong> Zusammenhänge zu<br />
verstehen;<br />
17
� Unternehmerische Zielgrößen mit Hilfe ausgewählter<br />
Instrumente der Erfolgsrechnung zu berechnen<br />
Schlüsselkompetenzen<br />
Die Studierenden sind in der Lage, gr<strong>und</strong>legende ökonomische<br />
Probleme zu erkennen <strong>und</strong> zu analysieren. Sie beherrschen<br />
wichtige Instrumente der Erfolgskontrolle.<br />
Sie erlernen Problemlösungsfertigkeiten <strong>und</strong> Informationen zu<br />
gewinnen <strong>und</strong> diese zu verarbeiten.<br />
Inhalte 1) Einführung in die Wirtschaftswissenschaften<br />
- ökonomische Gr<strong>und</strong>begriffe<br />
- das Unternehmen im volkswirtschaftlichen<br />
Zusammenhang<br />
2) Unternehmen <strong>und</strong> Märkte<br />
- betriebswirtschaftliche Kategorien (Kosten, Gewinn,<br />
Rentabilität, Produktivität)<br />
- Angebots- <strong>und</strong> Nachfrageverhalten<br />
- Preismechanismus <strong>und</strong> Gleichgewicht auf den Märkten<br />
3) Ziele unternehmerischer Aktivitäten <strong>und</strong> das<br />
Informationssystem ihrer Erfolgskontrolle<br />
- ROI-Baum<br />
- Kurzfristige Erfolgsrechnung mittels Deckungsbeiträgen<br />
- Break-Even-Analyse<br />
- Investitionsrechenverfahren<br />
- Strategische Konzepte der Erfolgsmessung<br />
(z.B. Portfolio-Analyse)<br />
STCW - Bezug entfällt<br />
Literatur Scheck/Scheck, Wirtschaftliches Gr<strong>und</strong>wissen für Ingenieure,<br />
Wöhe, Einführung in die Allgemeine Betriebswirt.-lehre,<br />
Czogalla, Materialsammlung zur Vorlesung<br />
Name:<br />
Unterschrift: Datum:<br />
M 9 Informatik<br />
Modulkennziffer 9<br />
Modulname Informatik<br />
Modultyp Pflichtmodul<br />
zugeordnete Veranstaltung V 9.1.: Informatik<br />
Position im Studienverlauf 3. Fachsemester<br />
Angebotsrhythmus Beginn jedes Sommersemesters<br />
Modulbeauftragter Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Tepper<br />
Dozentinnen / Dozenten Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Tepper<br />
Semesterwochenst<strong>und</strong>en 4<br />
18
Workload (Zeitst<strong>und</strong>en) Präsenz: 60 Selbststudium: 90<br />
ECTS-Leistungspunkte (CP) 5<br />
Sprache Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />
Lehr- <strong>und</strong> Lernformen Vorlesung / Übung<br />
Prüfung (Form, Dauer) Studienleistung (SL):<br />
Testat nach erfolgreicher Bearbeitung aller Übungsaufgaben<br />
Teilnahmevoraussetzungen keine<br />
Kompetenzziele fachlich-inhaltliche Kompetenzen:<br />
Die Studierenden sind in der Lage, Systeme zu erkennen <strong>und</strong> zu<br />
modularisieren, sowie Abläufe zu analysieren <strong>und</strong> in Algorithmen<br />
zu beschreiben. Sie lernen in Systemen, Strukturen <strong>und</strong> Abläufen<br />
zu denken <strong>und</strong> die erlernten Denkweisen <strong>und</strong> Techniken in<br />
Programme umzusetzen.<br />
Schlüsselkompetenzen:<br />
Die Studierenden sind in der Lage, gr<strong>und</strong>legende Prinzipien der<br />
Informatik <strong>und</strong> die Funktionsweise digitaler Informationssysteme<br />
zu verstehen. Sie sind befähigt, an interdisziplinären<br />
Fachgesprächen aktiv teilzunehmen.<br />
Inhalte � Rechner & Programmiersprachen<br />
� Zahlensysteme<br />
� Basisoperationen der Digitaltechnik<br />
� Entwicklungsumgebung zur Programmentwicklung<br />
� Variablen <strong>und</strong> elementare Datentypen<br />
� Ein- <strong>und</strong> Ausgaben<br />
� Ausdrücke <strong>und</strong> Operatoren<br />
� Anweisungen <strong>und</strong> Verzweigungen<br />
Schleifen<br />
� Funktionen, Parameter, lokale Variablen<br />
� Übersicht zur objektorientierten Programmierung<br />
STCW - Bezug entfällt<br />
Literatur RRZN Hannover, Einführung in die EDV , Hannover 2003<br />
RRZN Hannover, Java 2 - Einführung … , Hannover 2004<br />
E.-W. Dieterich, Java 2, Oldenburg Verlag. München 2001<br />
Freier Download: Handbuch der Java-Programmierung<br />
Name:<br />
Unterschrift: Datum:<br />
19
M 10 Mathematik 2<br />
Modulkennziffer 10<br />
Modulname Mathematik 2<br />
Modultyp Pflichtmodul<br />
Position im Studienverlauf 3. <strong>und</strong> 4. Fachsemester<br />
Angebotsrhythmus Beginn jedes Sommersemester<br />
Beginn jedes Wintersemester<br />
Modulbeauftragter Prof. Dr. rer. nat. Götz Hofmann<br />
Dozentinnen / Dozenten Prof. Dr. rer. nat. Götz Hofmann<br />
Semesterwochenst<strong>und</strong>en 8<br />
Workload (Zeitst<strong>und</strong>en) Präsenz: 120 Selbststudium: 180<br />
ECTS-Leistungspunkte (CP) 10<br />
Sprache Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />
Lehr- <strong>und</strong> Lernformen 2x Vorlesung <strong>und</strong> Übung<br />
Prüfung (Form, Dauer) Prüfungsleistung (PL):<br />
1 Klausur, 120 Minuten<br />
Teilnahmevoraussetzungen keine<br />
Kompetenzziele fachlich-inhaltliche Kompetenzen<br />
Die Studierenden sind in der Lage,<br />
� Die in Mathematik I erlernten Techniken werden <strong>zum</strong> Lösen<br />
anwendungsnaher Probleme eingesetzt<br />
Schlüsselkompetenzen<br />
� Die Fähigkeit der Studierenden zur Abstraktion an<br />
komplexeren mathematischen Verfahren wird geschult.<br />
zugeordnete Veranstaltungen V 10.1: Mathematik 2.1<br />
V 10.2: Mathematik 2.2<br />
Beschreibung der Veranstaltungen siehe Tabellen V 10.1 <strong>und</strong> V 10.2<br />
Name:<br />
Unterschrift: Datum:<br />
V 10.1 Mathematik 2. 1<br />
Modul 10 Mathematik 2<br />
zugehörige Veranstaltung V 10.1 Mathematik 2. 1<br />
Dozentinnen / Dozenten Prof. Dr. rer. nat. Götz Hofmann<br />
Position im Studienverlauf 3. Fachsemester<br />
Angebotsrhythmus Beginn jedes Sommersemester<br />
Semesterwochenst<strong>und</strong>en 4<br />
Workload (Zeitst<strong>und</strong>en) Präsenz: 60 Selbststudium: 90<br />
ECTS-Leistungspunkte (CP) 5<br />
Sprache Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />
Lehr- <strong>und</strong> Lernformen Vorlesung / Übung<br />
20
Prüfung (Form, Dauer) Zusammen mit Mathematik 2.2<br />
Teilnahmevoraussetzungen keine<br />
Kompetenzziele fachlich-inhaltliche Kompetenzen<br />
Die Studierenden sind in der Lage,<br />
� Die in Mathematik I erlernten Techniken werden <strong>zum</strong> Lösen<br />
anwendungsnaher Probleme eingesetzt.<br />
Schlüsselkompetenzen<br />
Die Studierenden sind in der Lage,<br />
� Probleme zu lösen<br />
� Darüber hinaus wird die Fähigkeit zur Abstraktion an<br />
komplexeren mathematischen Verfahren geschult.<br />
Inhalte 1. Fehlerrechnung<br />
2. ausgewählte numerische Verfahren<br />
3. gewöhnliche Differentialgleichungen<br />
4. Fourier- <strong>und</strong> Laplace-Transformation<br />
STCW - Bezug entfällt<br />
Literatur Leupold u.a. , Ingenieurmathematik, Bd I, II<br />
Formelsammlung (z.B. Papula)<br />
Name:<br />
Unterschrift: Datum:<br />
V 10.2 Mathematik 2. 2<br />
Modul 10 Mathematik 2<br />
zugehörige Veranstaltung V 10.2 Mathematik 2. 2<br />
Dozentinnen / Dozenten Prof. Dr. rer. nat. Götz Hofmann<br />
Position im Studienverlauf 4. Fachsemester<br />
Angebotsrhythmus Beginn jedes Wintersemester<br />
Semesterwochenst<strong>und</strong>en 4<br />
Workload (Zeitst<strong>und</strong>en) Präsenz: 60 Selbststudium: 90<br />
ECTS-Leistungspunkte (CP) 5<br />
Sprache Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />
Lehr- <strong>und</strong> Lernformen Vorlesung / Übung<br />
Prüfung (Form, Dauer) Prüfungsleistung (PL):<br />
1 Klausur, 120 Minuten<br />
Teilnahmevoraussetzungen keine<br />
Kompetenzziele fachlich-inhaltliche Kompetenzen<br />
Die Studierenden sind in der Lage,<br />
� Die in Mathematik I erlernten Techniken werden <strong>zum</strong> Lösen<br />
anwendungsnaher Probleme eingesetzt. Darüber hinaus wird<br />
die Fähigkeit zur Abstraktion an komplexeren<br />
mathematischen Verfahren geschult.<br />
Schlüsselkompetenzen<br />
21
Die Studierenden sind in der Lage,<br />
� Probleme zu lösen<br />
� Darüber hinaus wird die Fähigkeit zur Abstraktion an<br />
komplexeren mathematischen Verfahren geschult.<br />
Inhalte 1. Kombinatorik<br />
2. elementare Wahrscheinlichkeiten<br />
3. Wahrscheinlichkeitsverteilungen<br />
STCW - Bezug entfällt<br />
Literatur Leupold u.a. , Ingenieurmathematik, Bd I, II<br />
Formelsammlung (z.B. Papula)<br />
Name:<br />
Unterschrift: Datum:<br />
M 11 Elektrotechnik 2<br />
Modulkennziffer 4<br />
Modulname Elektrotechnik 2<br />
Modultyp Pflichtmodul<br />
Position im Studienverlauf 3. Fachsemester<br />
Angebotsrhythmus Beginn jedes Sommersemester<br />
Modulbeauftragter Prof. Dr.-Ing. Klaus-Dieter Kruse<br />
Dozentinnen / Dozenten Prof. Dr.-Ing. Klaus-Dieter Kruse<br />
Semesterwochenst<strong>und</strong>en 4<br />
Workload (Zeitst<strong>und</strong>en) Präsenz: 60 Selbststudium: 90<br />
ECTS-Leistungspunkte (CP) 5<br />
Sprache Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />
Lehr- <strong>und</strong> Lernformen 1x Vorlesung, 1x Labor<br />
Prüfung (Form, Dauer) 1 Klausuren a 120 Minuten<br />
Teilnahmevoraussetzungen keine<br />
Kompetenzziele fachlich-inhaltliche Kompetenzen<br />
Die Studierenden sind in der Lage,<br />
� siehe Tabellen V 11.1, V 11.2<br />
Schlüsselkompetenzen<br />
Die Studierenden sind in der Lage,<br />
� siehe Tabellen V 11.1, V 11.2<br />
zugeordnete Veranstaltungen V 11.1: Elektrotechnik 2<br />
V 11.2: Elektrotechnik 2 Labor<br />
Beschreibung der Veranstaltungen siehe Tabellen V 11.1, V 11.2<br />
Name:<br />
Unterschrift: Datum:<br />
22
V 11.1 Elektrotechnik 2<br />
Modul 11 Elektrotechnik 2<br />
zugehörige Veranstaltung V 11.1 Elektrotechnik 2<br />
Dozentinnen / Dozenten Prof. Dr.-Ing. Klaus-Dieter Kruse<br />
Position im Studienverlauf 3. Fachsemester<br />
Angebotsrhythmus Beginn jedes Sommersemester<br />
Semesterwochenst<strong>und</strong>en 2<br />
Workload (Zeitst<strong>und</strong>en) Präsenz: 30 Selbststudium: 45<br />
ECTS-Leistungspunkte (CP) 2,5<br />
Sprache Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />
Lehr- <strong>und</strong> Lernformen Vorlesung<br />
Prüfung (Form, Dauer) Prüfungsleistung (PL):<br />
1 Klausur, 120 Minuten<br />
Teilnahmevoraussetzungen keine<br />
Kompetenzziele fachlich-inhaltliche Kompetenzen<br />
Die Studierenden<br />
� erlernen die gr<strong>und</strong>legenden Phänomene der Elektrotechnik,<br />
ihre mathematische Beschreibung <strong>und</strong> Anwendungsbeispiele<br />
aus der beruflichen Praxis.<br />
Schlüsselkompetenzen<br />
Die Studierenden sind in der Lage,<br />
� Probleme zu lösen,<br />
� Erfolgreich <strong>und</strong> zielgerichtet zu handeln.<br />
� Des Weiteren erlangen Sie die Befähigung zu lebenslangem<br />
selbständigem Lernen.<br />
� Fächerübergreifendes Denken wir erlernt.<br />
Inhalte Elektrisches Feld<br />
Wechselstromtechnik<br />
STCW - Bezug Fachpraktische <strong>und</strong> fachtheoretische Anforderungen zu Wartung,<br />
Betrieb <strong>und</strong> Instandhaltung gem. Tab. A-III/1 <strong>und</strong> A-III/2<br />
Übereinkommens.<br />
Literatur Moeller Gr<strong>und</strong>lagen der Elektrotechnik 19.Aufl.<br />
Flegel, Birnstiel, Nerreter Elektrotechnik f.d. Maschinenbauer<br />
Name:<br />
Unterschrift: Datum:<br />
23
V 11.2 Elektrotechnik 2 Labor<br />
Modul 11 Elektrotechnik<br />
zugehörige Veranstaltung V 11.2 Elektrotechnik 2 Labor<br />
Dozentinnen / Dozenten Prof. Dr.-Ing. Klaus-Dieter Kruse<br />
Position im Studienverlauf 3. Fachsemester<br />
Angebotsrhythmus Beginn jedes Sommersemester<br />
Semesterwochenst<strong>und</strong>en 2<br />
Workload (Zeitst<strong>und</strong>en) Präsenz: 30 Selbststudium: 45<br />
ECTS-Leistungspunkte (CP) 2,5<br />
Sprache Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />
Lehr- <strong>und</strong> Lernformen Labor<br />
Prüfung (Form, Dauer) Erforderlich für Anerkennung der Elektrotechnik<br />
Teilnahmevoraussetzungen keine<br />
Kompetenzziele fachlich-inhaltliche Kompetenzen<br />
� Vertieft werden die in den Vorlesungen Elektrotechnik 1 <strong>und</strong><br />
Elektrotechnik 2 vermittelten Kenntnisse durch eigenständig<br />
durchgeführte Laborübungen zu den wichtigsten<br />
Themenstellungen.<br />
Schlüsselkompetenzen<br />
Die Studierenden sind in der Lage,<br />
� anwendungsorientiert zu handeln<br />
� im Team zu arbeiten <strong>und</strong> Probleme gemeinsam zu lösen.<br />
� Die Fähigkeit zur interdisziplinären Kommunikation wir<br />
erweitert.<br />
Inhalte Verhalten von Kondensator <strong>und</strong> Induktivität<br />
Oszilloskopmesstechnik<br />
Messung nichtelektrischer Größen<br />
Elektrische Netzwerke<br />
Messbereichserweiterung<br />
Wechselstromschaltungen<br />
STCW - Bezug Fachpraktische <strong>und</strong> fachtheoretische Anforderungen zu Wartung,<br />
Betrieb <strong>und</strong> Instandhaltung gem. Tab. A-III/1 <strong>und</strong> A-III/2<br />
Übereinkommens.<br />
Literatur Moeller Gr<strong>und</strong>lagen der Elektrotechnik 19.Aufl.<br />
Flegel, Birnstiel, Nerreter Elektrotechnik f.d. Maschinenbauer<br />
Name:<br />
Unterschrift: Datum:<br />
24
M 12 Thermodynamik<br />
Modulkennziffer 12<br />
Modulname Thermodynamik<br />
Modultyp Pflichtmodul<br />
Position im Studienverlauf 3. <strong>und</strong> 4. Fachsemester<br />
Angebotsrhythmus Beginn jedes Sommersemester<br />
Beginn jedes Wintersemester<br />
Modulbeauftragter Prof. Dr.-Ing. Ilja Tuschy<br />
Dozentinnen / Dozenten Prof. Dr.-Ing. Ilja Tuschy<br />
Semesterwochenst<strong>und</strong>en 6<br />
Workload (Zeitst<strong>und</strong>en) Präsenz: 90 Selbststudium: 150<br />
ECTS-Leistungspunkte (CP) 8<br />
Sprache Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />
Lehr- <strong>und</strong> Lernformen 1x Vorlesung<br />
1x Vorlesung <strong>und</strong> Übung<br />
Prüfung (Form, Dauer) Prüfungsleistung (PL):<br />
1 Klausur, 120 Minuten<br />
Teilnahmevoraussetzungen keine<br />
Kompetenzziele Siehe Veranstaltungen<br />
zugeordnete Veranstaltungen V 12.1: Thermodynamik 1<br />
V 12.2: Thermodynamik 2<br />
Beschreibung der Veranstaltungen siehe Tabellen V 12.1 <strong>und</strong> V 12.2<br />
Name:<br />
Unterschrift: Datum:<br />
25
V 12.1 Thermodynamik 1<br />
Modul 12 Thermodynamik<br />
zugehörige Veranstaltung V 12.1 Thermodynamik 1<br />
Dozentinnen / Dozenten Prof. Dr.-Ing. Ilja Tuschy<br />
Position im Studienverlauf 3. Fachsemester<br />
Angebotsrhythmus Beginn jedes Sommersemester<br />
Semesterwochenst<strong>und</strong>en 2<br />
Workload (Zeitst<strong>und</strong>en) Präsenz: 30 Selbststudium: 60<br />
ECTS-Leistungspunkte (CP) 3<br />
Sprache Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />
Lehr- <strong>und</strong> Lernformen Vorlesung<br />
Prüfung (Form, Dauer) Zusammen mit Thermodynamik 2<br />
Teilnahmevoraussetzungen keine<br />
Kompetenzziele fachlich-inhaltliche Kompetenzen<br />
� Die Studierenden kennen die elementaren Begriffe der<br />
Thermodynamik sowie die gr<strong>und</strong>legenden<br />
thermodynamischen Gesetze über Energieumwandlungen<br />
<strong>und</strong> Stoffverhalten.<br />
� Sie erkennen thermodynamische Prozesse in für den<br />
Energietechniker relevanten technischen Anlagen. Die<br />
Studierenden sind in der Lage, solche Prozesse mit Hilfe<br />
der thermodynamischen Methodik zu beschreiben, formal<br />
zu fassen <strong>und</strong> problemgerecht zu berechnen.<br />
Schlüsselkompetenzen<br />
� Sie lernen bei der Lösung technischer Aufgaben<br />
selbständig analytisch <strong>und</strong> zielgerichtet vorzugehen.<br />
� Die Problemlösungsfähigkeit der Studierenden wird<br />
geschult.<br />
� Die Fähigkeit erfolgreich <strong>und</strong> zielbewusst zu agieren wird<br />
ausgebaut.<br />
� Sie erlangen die Fähigkeit zu lebenslangem<br />
eigenständigem Lernen.<br />
Inhalte 1. Gr<strong>und</strong>begriffe der Thermodynamik<br />
2. Thermisches Zustandsverhalten<br />
3. Erster Hauptsatz<br />
4. Kalorische Zustandsgleichungen<br />
STCW - Bezug entfällt<br />
Literatur Baehr: Thermodynamik<br />
Cerbe/Hoffmann: Einführung in die Thermodynamik<br />
Cengel/Boles: Thermodynamics, An Engineering Approach<br />
Name:<br />
Unterschrift: Datum:<br />
26
V 12.2 Thermodynamik 2<br />
Modul 12 Thermodynamik<br />
zugehörige Veranstaltung V 12.2 Thermodynamik II<br />
Dozentinnen / Dozenten Prof. Dr.-Ing. Ilja Tuschy<br />
Position im Studienverlauf 4. Fachsemester<br />
Angebotsrhythmus Beginn jedes Wintersemester<br />
Semesterwochenst<strong>und</strong>en 4<br />
Workload (Zeitst<strong>und</strong>en) Präsenz: 60 Selbststudium: 90<br />
ECTS-Leistungspunkte (CP) 5<br />
Sprache Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />
Lehr- <strong>und</strong> Lernformen Vorlesung / Übung<br />
Prüfung (Form, Dauer) Prüfungsleistung (PL):<br />
1 Klausur, 120 Minuten<br />
Teilnahmevoraussetzungen keine<br />
Kompetenzziele fachlich-inhaltliche Kompetenzen<br />
� Die Studierenden lernen die thermodynamischen Gesetze<br />
zur Behandlung konkreter technischer Fragestellungen<br />
kennen.<br />
� Sie kennen verschiedene praktische Anwendungen der<br />
Thermodynamik der Technik. Die Studierenden sind in der<br />
Lage, solche Anwendungen mit Hilfe der<br />
thermodynamischen Methodik zu beschreiben, formal zu<br />
fassen <strong>und</strong> problemgerecht zu berechnen.<br />
Schlüsselkompetenzen<br />
� Sie lernen technische Aufgaben zu analysieren <strong>und</strong> zu<br />
abstrahieren. Darüber hinaus erkennen Sie die<br />
Notwendigkeit, sich in für sie neue Fragestellungen soweit<br />
einzuarbeiten, dass sie selbständig zur Lösung auftretender<br />
Probleme kommen.<br />
� Die Fähigkeit erfolgreich <strong>und</strong> zielbewusst zu agieren wird<br />
ausgebaut.<br />
� Sie erlangen die Fähigkeit zu lebenslangem<br />
eigenständigem Lernen.<br />
Inhalte 5. Einfache Prozesse<br />
6. Kreisprozesse<br />
7. Zweiter Hauptsatz <strong>und</strong> Entropie<br />
8. Anwendungen des zweiten Hauptsatzes<br />
9. Gr<strong>und</strong>züge der Wärmeübertragung<br />
10. Einfache Verbrennungsrechnung<br />
11. Vergleichsprozesse technischer Anlagen<br />
12. Feuchte Luft<br />
STCW - Bezug entfällt<br />
Literatur Baehr: Thermodynamik<br />
27
Cerbe/Hoffmann: Einführung in die Thermodynamik<br />
Cengel/Boles: Thermodynamics, An Engineering Approach<br />
Name:<br />
Unterschrift: Datum:<br />
M 13 Recht<br />
Modulkennziffer 13<br />
Modulname Recht<br />
Modultyp Pflichtmodul<br />
Position im Studienverlauf 3. <strong>und</strong> 4. Fachsemester<br />
Angebotsrhythmus Beginn jedes Wintersemester<br />
Beginn jedes Sommersemester<br />
Modulbeauftragter Prof. Sander Limant, LL.M.<br />
Dozentinnen / Dozenten Prof. Sander Limant, LL.M.; Rechtsanwältin Ilka Albers (LA),<br />
Rechtsanwalt Stefan Prinzler (LA)<br />
Semesterwochenst<strong>und</strong>en 4<br />
Workload (Zeitst<strong>und</strong>en) Präsenz: 60 Selbststudium: 60<br />
ECTS-Leistungspunkte (CP) 4<br />
Sprache Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />
Lehr- <strong>und</strong> Lernformen 2x Vorlesung<br />
Prüfung (Form, Dauer) Studienleistung (SL)<br />
2 Klausuren je 60 Minuten, 2 schriftliche Ausarbeitungen, 2<br />
Vorträge<br />
Teilnahmevoraussetzungen keine<br />
Kompetenzziele siehe Tabellen V 13.1, V 13.2<br />
zugeordnete Veranstaltungen V 13.1: Gr<strong>und</strong>lagen Recht<br />
V 13.2: Schifffahrtsrecht<br />
Beschreibung der Veranstaltungen siehe Tabellen V 13.1, V 13.2<br />
Name:<br />
Unterschrift: Datum:<br />
28
V 13.1 Gr<strong>und</strong>lagen Recht<br />
Modul M 13 Recht<br />
zugehörige Veranstaltung V 13.1 Gr<strong>und</strong>lagen Recht<br />
Dozentinnen / Dozenten Rechtsanwältin Ilka Albers (LA), Rechtsanwalt Stefan Prinzler (LA)<br />
Position im Studienverlauf 3. Fachsemester<br />
Angebotsrhythmus Beginn jedes Sommersemester<br />
Semesterwochenst<strong>und</strong>en 2<br />
Workload (Zeitst<strong>und</strong>en) Präsenz: 30 Selbststudium: 30<br />
ECTS-Leistungspunkte (CP) 2<br />
Sprache Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />
Lehr- <strong>und</strong> Lernformen Vorlesung<br />
Prüfung (Form, Dauer) Studienleistung (SL):<br />
1 Klausur, 60 Minuten oder 1 Vortrag/Referat oder<br />
1 schriftliche Ausarbeitung<br />
Teilnahmevoraussetzungen keine<br />
Kompetenzziele fachlich-inhaltliche Kompetenzen<br />
Die Studierenden sind in der Lage,<br />
die wesentlichen Gr<strong>und</strong>züge des deutschen Rechtssystems<br />
insbesondere im Zusammenhang mit vertragsrechtlichen Aspekten<br />
einzuschätzen.<br />
Schlüsselkompetenzen<br />
Die Studierenden sind in der Lage,<br />
bei rechtlichen Fragestellungen eine erste grobe Analyse <strong>und</strong><br />
Bewertung vorzunehmen, um anschließend einschätzen zu<br />
können, welches Fachwissen zu akquirieren ist. Sie sind in der<br />
Lage Informationen zu gewinnen <strong>und</strong> zu verarbeiten.<br />
Die Studierenden bekommen eine erste juristische Kompetenz<br />
vermittelt, auf welche im weiteren Verlauf aufgebaut werden kann.<br />
Inhalte In der Lehrveranstaltung werden Gr<strong>und</strong>kenntnisse des deutschen<br />
Rechtssystems, überwiegend im Zivilrecht, vermittelt. Inhalte sind<br />
z.B. Anspruchsaufbau, Geschäftsfähigkeit, Willenserklärung,<br />
Zustandekommen von Verträgen, Vertragstypen im Einzelnen<br />
(Kaufvertrag, Werkvertrag, Arbeitsvertrag). Daneben werden<br />
Gr<strong>und</strong>lagen des Deliktsrechts, des Sachenrechts, des<br />
Familienrechts <strong>und</strong> des Strafrechts erläutert.<br />
STCW - Bezug entfällt<br />
Literatur BGB<br />
HGB<br />
Name:<br />
Unterschrift: Datum:<br />
29
V 13.1 Gr<strong>und</strong>lagen Schifffahrtsrecht<br />
Modul M 13 Recht<br />
zugehörige Veranstaltung V 13.1 Gr<strong>und</strong>lagen Schifffahrtsrecht<br />
Dozentinnen / Dozenten Prof. Sander Limant, LL.M.<br />
Position im Studienverlauf 4. Fachsemester<br />
Angebotsrhythmus Beginn jedes Wintersemester<br />
Semesterwochenst<strong>und</strong>en 2<br />
Workload (Zeitst<strong>und</strong>en) Präsenz: 30 Selbststudium: 30<br />
ECTS-Leistungspunkte (CP) 2<br />
Sprache Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />
Lehr- <strong>und</strong> Lernformen Vorlesung<br />
Prüfung (Form, Dauer) Studienleistung (SL):<br />
1 Klausur, 60 Minuten oder 1 Vortrag/Referat oder<br />
1 schriftliche Ausarbeitung<br />
Teilnahmevoraussetzungen keine<br />
Kompetenzziele fachlich-inhaltliche Kompetenzen<br />
Die Studierenden sind in der Lage,<br />
� mit den SOLAS-Vorschriften zu arbeiten.<br />
� Sicherheitsdienste an Bord zu erarbeiten <strong>und</strong><br />
durchzuführen.<br />
� Audits, Besichtigungen <strong>und</strong> Hafenstaatenkontrollen<br />
vorzubereiten.<br />
� mit dem Seemannsgesetz zu arbeiten. Sie kennen<br />
insbesondere die Rechtsstellung des Kapitäns, der<br />
Schiffsoffiziere, der sonstigen Angestellten <strong>und</strong> der<br />
Schiffsleute.<br />
� Pflichten <strong>und</strong> Rechte des Kapitäns <strong>und</strong> der Besatzung in<br />
Bezug auf Dienstleistung, Arbeitsschutz, Freizeit,<br />
Krankenfürsorge <strong>und</strong> Urlaub.<br />
� Regelungen über die ordentliche <strong>und</strong> außerordentliche<br />
Kündigung.<br />
� systematisch mit den MARPOL-Vorschriften zu arbeiten.<br />
� Vorschriften dem STCW zuzuordnen.<br />
� die Ausbildung <strong>und</strong> Weiterbildung der<br />
Besatzungsmitglieder im Sinne der Bestimmungen der<br />
STCW vorzubereiten <strong>und</strong> in ihrem Fachgebiet<br />
durchzuführen.<br />
Schlüsselkompetenzen<br />
Die Studierenden sind in der Lage,<br />
� fächerübergreifend zu denken<br />
� Ihre Konfliktlösungsfähigkeit wird geschult.<br />
� Die juristische Kompetenz wird weiter ausgebaut.<br />
Inhalte SOLAS-Gliederung; Amendments, Codes,<br />
insbesondere ISM-Code.<br />
30
Seemannsgesetz<br />
Marpol<br />
STCW<br />
STCW - Bezug entfällt<br />
Literatur Sakautzky/Geitmann Arbeits- <strong>und</strong> Sozialrecht SBG<br />
Schiffssicherheitshandbuch<br />
Name:<br />
Unterschrift: Datum:<br />
M 14 Betriebstechnik<br />
Einschlägige Gesetzestexte<br />
Modulkennziffer 14<br />
Modulname Betriebstechnik<br />
Modultyp Pflichtmodul<br />
Position im Studienverlauf 4.Fachsemester<br />
Angebotsrhythmus Beginn jedes Wintersemester<br />
Modulbeauftragter Prof. Dr.-Ing. Holger Watter<br />
Dozentinnen / Dozenten Prof. Dr.-Ing. Holger Watter<br />
Semesterwochenst<strong>und</strong>en 4<br />
Workload (Zeitst<strong>und</strong>en) Präsenz: 60 Selbststudium: 30<br />
ECTS-Leistungspunkte (CP) 3<br />
Sprache Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />
Lehr- <strong>und</strong> Lernformen 1 Vorlesung<br />
1 Labor<br />
Prüfung (Form, Dauer) Studienleistung (SL):<br />
Sonstige Prüfung: Schriftliche Ausarbeitung <strong>und</strong> Vortrag<br />
Teilnahmevoraussetzungen Orientierungsprüfung für Veranstaltungen ab Semester 5<br />
Kompetenzziele fachlich-inhaltliche Kompetenzen<br />
Die Studierenden sind in der Lage,<br />
� alle für den Vortrieb <strong>und</strong> die Energieversorgung vorhandenen<br />
Kraftmaschinen einschließlich der zu deren Betrieb<br />
erforderlichen Hilfs- <strong>und</strong> Leiteinrichtungen sowie der <strong>zum</strong><br />
Betrieb des Schiffes <strong>und</strong> der Behandlung der Ladung<br />
erforderlichen Einrichtungen in Betrieb zu setzen, zu bedienen<br />
<strong>und</strong> zu überwachen<br />
� einen sicheren Wachbetrieb zu planen, organisieren <strong>und</strong><br />
durchzuführen<br />
� Störungen <strong>und</strong> Schäden durch geeignete Maßnahmen zu<br />
vermeiden <strong>und</strong> verhüten<br />
� geeignete Erst- <strong>und</strong> Folgemaßnahmen bei Störungen<br />
einzuleiten<br />
� die Instandhaltung für alle Anlagen, Elemente, technischen<br />
Einrichtungen <strong>und</strong> Ausrüstungen zu planen, zu organisieren<br />
31
<strong>und</strong> durchzuführen<br />
Schlüsselkompetenzen<br />
Die Studierenden sind in der Lage, durch die Analyse von<br />
Messdaten, eine geplante Instandhaltung <strong>und</strong> Versorgung der<br />
Einrichtungen zu gewährleisten.<br />
Sie erlangen die Befähigung erfolgreich <strong>und</strong> zielbewusst zu<br />
handeln.<br />
zugeordnete Veranstaltungen V 14.1: Instandhaltung<br />
V 14.2: Instandhaltung Labor<br />
Beschreibung der Veranstaltungen siehe Tabellen V 14.1 <strong>und</strong> V 14.2<br />
Name:<br />
Unterschrift: Datum:<br />
V 14.1 Instandhaltung<br />
Modul 14 Betriebstechnik<br />
zugehörige Veranstaltung V 14.1 Instandhaltung<br />
Dozentinnen / Dozenten Prof. Dr.-Ing. Holger Watter<br />
Position im Studienverlauf 4. Fachsemester<br />
Angebotsrhythmus Beginn jedes Wintersemester<br />
Semesterwochenst<strong>und</strong>en 1<br />
Workload (Zeitst<strong>und</strong>en) Präsenz: 15 Selbststudium: 15<br />
ECTS-Leistungspunkte (CP) 1<br />
Sprache Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />
Lehr- <strong>und</strong> Lernformen Vorlesung<br />
Prüfung (Form, Dauer) Studienleistung (SL):<br />
Sonstige Prüfung: Schriftliche Ausarbeitung <strong>und</strong> Vortrag<br />
Teilnahmevoraussetzungen keine<br />
Kompetenzziele fachlich-inhaltliche Kompetenzen<br />
Die Studierenden verfügen über gr<strong>und</strong>legende <strong>und</strong> fachspezifische<br />
Kenntnisse, um<br />
� mit geeigneten Verfahren <strong>und</strong> Methoden Prüfungen <strong>und</strong><br />
Fehlersuche an Anlagen, Elementen, technischen<br />
Einrichtungen <strong>und</strong> Ausrüstungen durchzuführen<br />
� geeignete Strategien zur Instandhaltung der Anlagen,<br />
Elemente, technischen Einrichtungen <strong>und</strong> Ausrüstungen zu<br />
planen <strong>und</strong> organisieren<br />
� Verschleißverhalten ausgewählter Anlagen, Elemente,<br />
technische Einrichtungen <strong>und</strong> Ausrüstungen<br />
� Verbesserungsvorschläge zu entwickeln.<br />
Schlüsselkompetenzen<br />
Die Studierenden sind in der Lage, den Verschleißzustand <strong>und</strong> die<br />
32
Nutzungsfähigkeit technischer Einrichtungen zu beurteilen.<br />
Die Studierenden sind in der Lage, die physikalischen Ursachen<br />
des Verschleißverhaltens zu erfassen <strong>und</strong><br />
Verbesserungsmöglichkeiten zu entwickeln.<br />
Inhalte � Gr<strong>und</strong>lagen der Instandhaltungstechnik<br />
� Methoden <strong>und</strong> Verfahren zur Prüfung <strong>und</strong> systematischen<br />
Fehlersuche an Anlagen, Elementen, technischen<br />
Einrichtungen <strong>und</strong> Ausrüstungen<br />
� Methoden <strong>und</strong> Verfahren zur Diagnose an Anlagen, Elementen,<br />
technischen Einrichtungen <strong>und</strong> Ausrüstungen<br />
� Unfallverhütungsvorschriften <strong>und</strong> deren Anwendung<br />
STCW - Bezug Fachpraktische <strong>und</strong> fachtheoretische Anforderungen zu Wartung,<br />
Betrieb <strong>und</strong> Instandhaltung gem. Tab. A-III/1 <strong>und</strong> A-III/2<br />
Übereinkommens.<br />
Literatur Meier- Peter/Bernhardt: „Handbuch Schiffsbetriebstechnik“<br />
Eichler: „Instandhaltungstechnik“<br />
DIN 25448: Fehlermöglichkeitseinflußanalyse (FMEA)<br />
DIN 25424: Fehlerbaumanalyse <strong>und</strong> -fortpflanzungsgesetz<br />
VDI – Richtlinien 3822 – Blatt 1 - 4: „Schadensanalysen“<br />
Name:<br />
Unterschrift: Datum:<br />
V 14.2 Instandhaltung Labor<br />
Modul 14 Betriebstechnik<br />
zugehörige Veranstaltung V 14.2 Instandhaltung Labor<br />
Dozentinnen / Dozenten Prof. Dr.-Ing. Holger Watter; Dipl.-Ing. Tove Möller<br />
Position im Studienverlauf 4. Fachsemester<br />
Angebotsrhythmus Beginn jedes Wintersemester<br />
Semesterwochenst<strong>und</strong>en 3<br />
Workload (Zeitst<strong>und</strong>en) Präsenz: 45 Selbststudium: 15<br />
ECTS-Leistungspunkte (CP) 2<br />
Sprache Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />
Lehr- <strong>und</strong> Lernformen Labor<br />
Prüfung (Form, Dauer) Erforderlich für Anerkennung Instandhaltung<br />
Teilnahmevoraussetzungen Keine<br />
Kompetenzziele fachlich-inhaltliche Kompetenzen<br />
Die Studierenden verfügen über Fertigkeiten <strong>und</strong> Kenntnisse, um<br />
� an ausgewählten Bauteilen Verschleißmessungen durchführen<br />
zu können<br />
� für die Messungen das jeweils geeignete Verfahren<br />
auszuwählen <strong>und</strong> sicher anwenden zu können<br />
� Messergebnis beurteilen zu können<br />
� Vorschläge für Instandhaltungsmaßnahmen unterbreiten zu<br />
können<br />
� Instandhaltungsmaßnahmen unter Beachtung der<br />
33
einschlägigen Sicherheitsvorschriften durchführen zu können.<br />
Schlüsselkompetenzen<br />
Die Studierenden sind in der Lage, diagnostisch Messergebnisse<br />
direkt oder indirekt dem jeweiligen Prozess zuzuordnen <strong>und</strong> das<br />
Verschleißverhalten technischer Einrichtungen zu beurteilen.<br />
Die Studierenden sind in der Lage, die Instandhaltung der<br />
technischen Einrichtungen zu planen, durchzuführen <strong>und</strong><br />
Verbesserungsmöglichkeiten zu erkennen. Die Arbeit im Labor<br />
erhöht die Teamfähigkeit<br />
Inhalte � Analoges <strong>und</strong> elektrisches Messen thermischer, mechanischer<br />
<strong>und</strong> elektrischer Größen<br />
� Störungen, Schäden <strong>und</strong> den Mechanismen der Entstehung<br />
� Zuordnung von Störungen <strong>und</strong> Schäden zu den Prozessen<br />
STCW - Bezug Fachpraktische <strong>und</strong> fachtheoretische Anforderungen zu Wartung,<br />
Betrieb <strong>und</strong> Instandhaltung gem. Tab. A-III/1 <strong>und</strong> A-III/2<br />
Übereinkommens.<br />
Literatur Meier-Peter/Bernhardt: „Handbuch Schiffsbetriebstechnik“<br />
Bartz: „Schäden an geschmierten Maschinenelementen“<br />
Bartz: „Überwachung von Maschinen“<br />
Name:<br />
Unterschrift: Datum:<br />
Fächerübergreifendes Seminar zu den Lehrinhalten aus allen technischen Fachgebieten. Die<br />
Technische Betriebsführung, Überwachung, Instandhaltung wird anhand ausgewählter exemplarischer<br />
Anlagen aufgearbeitet.<br />
1. Instandhaltungsplanung: Vorschriften (STCW, §3 Schiffsicherheitsgesetz, ISM-Code, Planned<br />
Maintenance System - PMS), Gr<strong>und</strong>lagen der Instandhaltung (DIN 31051)<br />
2. Schadensanalyse: Ablauf der Schadensanalyse (VDI 3822, Blatt 1), Schäden durch<br />
mechanische Beanspruchungen (VDI 3822 Blatt 2), Schäden durch Korrosion in wässrigen<br />
Medien (VDI 3822 Blatt 3), Schäden durch thermische Beanspruchungen (VDI 3822 Blatt 4),<br />
Schäden durch tribologische Beanspruchungen (VDI 3822 Blatt 5)<br />
3. Nutzwertanalyse: Die Nutzwertanalyse (NWA; auch Punktwertverfahren,<br />
Punktbewertungsverfahren oder Scoring-Modell genannt) gehört zu den quantitativen nichtmonetären<br />
Analysemethoden der Entscheidungstheorie. ZANGEMEISTER 1 als einer der frühen<br />
deutschen Vertreter definiert sie als eine „Analyse einer Menge komplexer Handlungsalternativen<br />
mit dem Zweck, die Elemente dieser Menge entsprechend den Präferenzen des<br />
Entscheidungsträgers bezüglich eines multidimensionalen Zielsystems zu ordnen. Die Abbildung<br />
der Ordnung erfolgt durch die Angabe der Nutzwerte (Gesamtwerte) der Alternativen.“ Eine NWA<br />
wird häufig erstellt, wenn „weiche“ – also in Geldwert oder Zahlen nicht darstellbare – Kriterien<br />
vorliegen, anhand derer zwischen verschiedenen Alternativen eine Entscheidung gefällt werden<br />
muss. Anwendungsbeispiel: Nutzweranalyse internationaler Umweltvorschriften.<br />
4. Exemplarische Beispiele (Dichtungen, Gleitlager, Wälzlager, Kolben, Kolbenringe, Laufbuchse,<br />
Zylinderdeckel, Ventile <strong>und</strong> Ventiltrieb, Kurbelwelle, Verbrennung <strong>und</strong> Einspritzung, Getriebe,<br />
Korrosion in Kessel <strong>und</strong> Rohrleitungen, Simulationsuntersuchungen, Schwingungsanalyse,<br />
Analyse von Abriebpartikeln, Endoskopie….), Verbindungstechnik/Schraubenverbindungen,<br />
Sensortechnik (Druck-, Temp.-, Kraft- <strong>und</strong> Drehmomentmessung <strong>und</strong> –kalibrierung).<br />
5. Drehschwingungsanalyse: Torsionsschwingungen, Schwingungsdifferentialgleichung der freien<br />
<strong>und</strong> erzwungenen Schwingung, Lösung durch numerische Simulationsrechnung, vereinfachter 3-<br />
1 Auszug aus: http://de.wikipedia.org/wiki/Nutzwertanalyse<br />
34
Massen-Schwinger, vereinfachtes Motormodell (Anlaufzeitkonstante), Getriebeübersetzung <strong>und</strong><br />
Getriebeschäden, dynamisches Übertragungsverhalten, Ersatzmodellbildung 2-<br />
Massenschwinger, Schwingungsdifferentialgleichung des Maschinensatzes, erzwungene<br />
Schwingungen <strong>und</strong> kritische Drehzahlen, verfeinertes Motormodell<br />
6. Instandhaltungslabor (Dipl.-Ing. Tove Möller):<br />
5.1 Kontrolle der Kurbelwangenatmung, (Kurbelwangenatmung am Deutz VM 545, 6<br />
Zylinder),<br />
5.2 Untersuchung einer Kraftstoffeinspritzpumpe (Bestimmung von Förderbeginn, -ende, -<br />
menge <strong>und</strong> Nockenform)<br />
5.3 Demontage <strong>und</strong> Montage eines Turboladers (Turbolader von ABB, VTR 354)<br />
5.4 Verschleißmessungen an den Hauptbauteilen eines Triebwerks (Verschleißmessungen<br />
an Laufbuchsen, Kolben <strong>und</strong> Kolbenringen)<br />
5.5 CBT: http://www.fh-flensburg.de/watter/IMA/CBT-Maschinensimulation_UNITEST.pdf<br />
Literaturempfehlung:<br />
[1] Bartz et al: Frühdiagnose von Schäden an Maschinen <strong>und</strong> Maschinenanlagen – Moderne<br />
Verfahren zur Diagnose <strong>und</strong> Analyse, Expert-Verlag, Ehningen bei Böblingen, 1988.<br />
[2] Bartz et al: Schäden an geschmierten Maschinenelementen: Gleitlager, Wälzlager, Zahnräder,<br />
Expert-Verlag, Ehningen bei Böblingen, 1992.<br />
[3] Broichhausen, J.: Schadensanalyse – Analyse <strong>und</strong> Vermeidung von Schäden in Konstruktion,<br />
Fertigung <strong>und</strong> Betrieb, Hanser-Verlag, München, Wien, 1985.<br />
[4] www.fachwissen-dichtungstechnik.de (Stand 2010).<br />
[5] VDMA-Schadensatlas Dichtungstechnik & Lehrunterlagen<br />
[6] VDI 3822: Schadensanalyse (Blatt 1 bis 5)<br />
Vgl. auch Lehrunterlagen: Betriebsstoffe, Arbeitsmaschinen <strong>und</strong> Anlagen,<br />
Schiffsmaschinensimulation unter www.fh-flensburg.de/watter/lehre.htm<br />
M 15 Elektrische Maschinen<br />
Modulkennziffer 15<br />
Modulname Elektrische Maschinen<br />
Modultyp Pflichtmodul<br />
Position im Studienverlauf 4. <strong>und</strong> 5. Fachsemester<br />
Angebotsrhythmus Beginn jedes Wintersemester<br />
Modulbeauftragter Prof. Dr.-Ing. Joachim Berg<br />
Dozentinnen / Dozenten Prof. Dr.-Ing. Joachim Berg<br />
Semesterwochenst<strong>und</strong>en 6<br />
Workload (Zeitst<strong>und</strong>en) Präsenz: 90 Selbststudium: 150<br />
ECTS-Leistungspunkte (CP) 8<br />
Sprache Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />
Lehr- <strong>und</strong> Lernformen 1x Vorlesung, 1x Labor<br />
Prüfung (Form, Dauer) 1 Klausuren a 120 Minuten<br />
Teilnahmevoraussetzungen keine<br />
Kompetenzziele fachlich-inhaltliche Kompetenzen<br />
Die Studierenden sind in der Lage,<br />
� siehe Tabellen V 15.1, V 15.2, V 15.3<br />
Schlüsselkompetenzen<br />
Die Studierenden sind in der Lage,<br />
35
� siehe Tabellen V 15.1, V 15.2, V 15.3<br />
zugeordnete Veranstaltungen V 15.1: Elektrische Maschinen 1<br />
V 15.2: Elektrische Maschinen 2<br />
V 15.3: Elektrische Maschinen Labor<br />
Beschreibung der Veranstaltungen siehe Tabellen V 15.1, V 15.2, V 15.3<br />
Name:<br />
Unterschrift: Datum:<br />
V 15.1 Elektrische Maschinen 1<br />
Modul 15 Elektrische Maschinen<br />
zugehörige Veranstaltung V 15.1 Elektrische Maschinen 1<br />
Dozentinnen / Dozenten Prof. Dr.-Ing. Joachim Berg<br />
Position im Studienverlauf 4. Fachsemester<br />
Angebotsrhythmus Beginn jedes Wintersemester<br />
Semesterwochenst<strong>und</strong>en 2<br />
Workload (Zeitst<strong>und</strong>en) Präsenz: 30 Selbststudium: 60<br />
ECTS-Leistungspunkte (CP) 3<br />
Sprache Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />
Lehr- <strong>und</strong> Lernformen Vorlesung<br />
Prüfung (Form, Dauer) Zusammen mit Elektrische Maschinen 2<br />
Teilnahmevoraussetzungen keine<br />
Kompetenzziele fachlich-inhaltliche Kompetenzen<br />
� Ausreichende Kenntnisse über Aufbau <strong>und</strong> Betrieb der auf<br />
Schiffen eingesetzten elektrischen Maschinen, deren<br />
Kennlinien <strong>und</strong> Betriebsverhalten.<br />
� Ausreichende Kenntnisse über Schalt- <strong>und</strong> Stromlaufpläne<br />
für die auf Schiffen eingesetzten elektrischen Maschinen.<br />
� Ausreichende Kenntnisse über die geltenden<br />
Sicherheitsvorschriften sowie geeigneter Maßnahmen zur<br />
Schadenverhütung<br />
Schlüsselkompetenzen<br />
� Technische Kompetenz<br />
� Fähigkeit analytisch zu denken<br />
� Problemlösungsfähigkeit<br />
Inhalte 1. Aufbau <strong>und</strong> Betrieb von elektrischen Maschinen<br />
2. Normung, BG- Vorschriften, Bauform <strong>und</strong> Schutzarten3.<br />
Transformatoren, Bauformen <strong>und</strong> Betriebsverhalten<br />
4. Gleichstrommaschinen: Bauform <strong>und</strong> Betriebsverhalten.<br />
5. Betriebsstörungen an Transformatoren <strong>und</strong><br />
Gleichstrommaschinen<br />
36
6. Messungen elektrischer Grössen an Transformatoren <strong>und</strong><br />
Gleichstrommaschinen<br />
7. Drehstrom-Asynchronmaschine: Bauformen <strong>und</strong><br />
Betriebsverhalten<br />
8. Drehstrom-Synchrommaschinen: Bauform <strong>und</strong><br />
Betriebsverhalten3. Betriebsstörungen an<br />
Drehstrommaschinen<br />
9. Messung elektrischer Grössen an Drehstrommaschinen<br />
STCW - Bezug Fachpraktische <strong>und</strong> fachtheoretische Anforderungen zu<br />
Wartung, Betrieb <strong>und</strong> Instandhaltung gem. Tab. A-III/1 <strong>und</strong> A-<br />
III/2 Übereinkommens.<br />
Literatur: Heuck/Dettmann: Elektrische Energieversorgung<br />
Fischer: Elektrische Maschinen<br />
Flosdorf/Hilgarth: Elektrische Energieverteilung<br />
Bödefeld/Sequenz: Elektrische Maschinen<br />
Heier: Windkraftanlagen<br />
Weißgerber: Elektrotechnik für Ingenieure, Band 1+2<br />
Laborskripte: IEES<br />
Name:<br />
Unterschrift: Datum:<br />
V 15.2 Elektrische Maschinen 2<br />
Modul 15 Elektrische Maschinen<br />
zugehörige Veranstaltung V 15.2 Elektrische Maschinen 2<br />
Dozentinnen / Dozenten Prof. Dr.-Ing. Joachim Berg<br />
Position im Studienverlauf 5. Fachsemester<br />
Angebotsrhythmus Beginn jedes Wintersemester<br />
Semesterwochenst<strong>und</strong>en 3<br />
Workload (Zeitst<strong>und</strong>en) Präsenz: 30 Selbststudium: 60<br />
ECTS-Leistungspunkte (CP) 3<br />
Sprache Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />
Lehr- <strong>und</strong> Lernformen Vorlesung<br />
Prüfung (Form, Dauer) Prüfungsleistung (PL):<br />
1 Klausur, 120 Minuten<br />
Teilnahmevoraussetzungen keine<br />
Kompetenzziele fachlich-inhaltliche Kompetenzen<br />
� Ausreichende Kenntnisse über Aufbau <strong>und</strong> Betrieb der auf<br />
Schiffen eingesetzten elektrischen Maschinen, deren<br />
Kennlinien <strong>und</strong> Betriebsverhalten.<br />
� Ausreichende Kenntnisse über Schalt- <strong>und</strong> Stromlaufpläne<br />
für die auf Schiffen eingesetzten elektrischen Maschinen.<br />
� Ausreichende Kenntnisse über die geltenden<br />
Sicherheitsvorschriften sowie geeigneter Maßnahmen zur<br />
Schadenverhütung<br />
37
Schlüsselkompetenzen<br />
� Technische Kompetenz<br />
� Fähigkeit analytisch zu denken<br />
� Problemlösungsfähigkeit<br />
Inhalte 1. Aufbau <strong>und</strong> Betrieb von elektrischen Maschinen<br />
2. Normung, BG- Vorschriften, Bauform <strong>und</strong> Schutzarten3.<br />
Transformatoren, Bauformen <strong>und</strong> Betriebsverhalten<br />
4. Gleichstrommaschinen: Bauform <strong>und</strong> Betriebsverhalten.<br />
5. Betriebsstörungen an Transformatoren <strong>und</strong><br />
Gleichstrommaschinen<br />
6. Messungen elektrischer Grössen an Transformatoren <strong>und</strong><br />
Gleichstrommaschinen<br />
7. Drehstrom-Asynchronmaschine: Bauformen <strong>und</strong><br />
Betriebsverhalten<br />
8. Drehstrom-Synchrommaschinen: Bauform <strong>und</strong><br />
Betriebsverhalten3. Betriebsstörungen an<br />
Drehstrommaschinen<br />
9. Messung elektrischer Grössen an Drehstrommaschinen<br />
STCW - Bezug Fachpraktische <strong>und</strong> fachtheoretische Anforderungen zu<br />
Wartung, Betrieb <strong>und</strong> Instandhaltung gem. Tab. A-III/1 <strong>und</strong> A-<br />
III/2 Übereinkommens.<br />
Literatur: Heuck/Dettmann: Elektrische Energieversorgung<br />
Fischer: Elektrische Maschinen<br />
Flosdorf/Hilgarth: Elektrische Energieverteilung<br />
Bödefeld/Sequenz: Elektrische Maschinen<br />
Heier: Windkraftanlagen<br />
Weißgerber: Elektrotechnik für Ingenieure, Band 1+2<br />
Laborskripte: IEES<br />
Name:<br />
Unterschrift: Datum:<br />
V 15.3 Elektrische Maschinen Labor<br />
Modul 15 Elektrische Maschinen<br />
zugehörige Veranstaltung V 15.3 Elektrische Maschinen Labor<br />
Dozentinnen / Dozenten Prof. Dr.-Ing. Joachim Berg<br />
Position im Studienverlauf 5. Fachsemester<br />
Angebotsrhythmus Beginn jedes Wintersemester<br />
Semesterwochenst<strong>und</strong>en 2<br />
Workload (Zeitst<strong>und</strong>en) Präsenz: 30 Selbststudium: 30<br />
ECTS-Leistungspunkte (CP) 2<br />
Sprache Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />
Lehr- <strong>und</strong> Lernformen Labor<br />
38
Prüfung (Form, Dauer) Erforderlich für Anerkennung elektrische Maschinen<br />
Teilnahmevoraussetzungen Keine<br />
Kompetenzziele fachlich-inhaltliche Kompetenzen<br />
� Ausreichende Kenntnisse <strong>und</strong> Fertigkeiten über den Betrieb<br />
der auf Schiffen eingesetzten elektrischen Maschinen<br />
� Ausreichende Kenntnisse <strong>und</strong> Fertigkeiten, um mittels<br />
Schalt- <strong>und</strong> Stromlaufplänen Fehler <strong>und</strong> Betriebsstörungen<br />
an elektrischen Maschinen auf Schiffen erkennen <strong>und</strong> unter<br />
Beachtung der Geltenden Sicherheitsvorschriften<br />
beseitigen zu können<br />
Schlüsselkompetenzen<br />
� Technische Kompetenz<br />
� Fähigkeit analytisch zu denken<br />
� Problemlösungsfähigkeit<br />
Inhalte 1. Betriebsverhalten <strong>und</strong> Kennlienien von Gleistrommotoren<br />
2. Betriebsverhalten von Transformatoren3. Betriebsverhalten<br />
<strong>und</strong> Kennlinien von Drehstrommotoren<br />
4. Synchronisation von Drehstromgeneratoren in elektrischen<br />
Netzen.<br />
STCW - Bezug Fachpraktische <strong>und</strong> fachtheoretische Anforderungen zu<br />
Wartung, Betrieb <strong>und</strong> Instandhaltung gem. Tab. A-III/1 <strong>und</strong> A-<br />
III/2 Übereinkommens.<br />
Literatur: Heuck/Dettmann: Elektrische Energieversorgung<br />
Fischer: Elektrische Maschinen<br />
Flosdorf/Hilgarth: Elektrische Energieverteilung<br />
Bödefeld/Sequenz: Elektrische Maschinen<br />
Heier: Windkraftanlagen<br />
Weißgerber: Elektrotechnik für Ingenieure, Band 1+2<br />
Laborskripte: IEES<br />
Name:<br />
Unterschrift: Datum:<br />
M 16 Personalfürsorge<br />
Modulkennziffer 16<br />
Modulname Personalfürsorge<br />
Modultyp Pflichtmodul<br />
Position im Studienverlauf 4. <strong>und</strong> 6. Fachsemester<br />
Angebotsrhythmus Beginn jedes Wintersemester<br />
Modulbeauftragter<br />
Dozentinnen / Dozenten<br />
Semesterwochenst<strong>und</strong>en 8<br />
Workload (Zeitst<strong>und</strong>en) Präsenz: 120 Selbststudium: 180<br />
ECTS-Leistungspunkte (CP) 10<br />
Sprache Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />
39
Lehr- <strong>und</strong> Lernformen 2x Vorlesung<br />
Prüfung (Form, Dauer) Prüfungsleistung (PL): Sonstige Prüfung (SP):<br />
1 Klausur, 120 Minuten, Schriftliche Ausarbeitung, Hausaufgabe<br />
Studienleistung (SL): Sonstige Prüfung :<br />
1 Klausur, 60 Minuten, schriftliche Ausarbeitung, Vortrag<br />
Teilnahmevoraussetzungen Orientierungsprüfung für Teilnahme an Ges<strong>und</strong>heitsfürsorge<br />
Kompetenzziele<br />
zugeordnete Veranstaltungen V 16.1: Personalführung / ISPS<br />
V 16.2: Ges<strong>und</strong>heitsfürsorge<br />
Beschreibung der Veranstaltungen siehe Tabellen V 16.1 <strong>und</strong> V 16.2<br />
Name:<br />
Unterschrift: Datum:<br />
V 16.1 Personalführung<br />
Modul M 16 Personalfürsorge<br />
zugehörige Veranstaltung V 16.1 Personalführung / ISPS<br />
Dozentinnen / Dozenten<br />
Position im Studienverlauf 4. Fachsemester<br />
Angebotsrhythmus Beginn jedes Wintersemester<br />
Semesterwochenst<strong>und</strong>en 4<br />
Workload (Zeitst<strong>und</strong>en) Präsenz: 60 Selbststudium: 90<br />
ECTS-Leistungspunkte (CP) 5<br />
Sprache Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />
Lehr- <strong>und</strong> Lernformen Vorlesung<br />
Prüfung (Form, Dauer) Prüfungsleistung (PL):<br />
1 Klausur, 120 Minuten oder<br />
1 Hausaufgabe oder 1 schriftliche Ausarbeitung<br />
Teilnahmevoraussetzungen keine<br />
Kompetenzziele fachlich-inhaltliche Kompetenzen<br />
Die Studierenden sind in der Lage,<br />
� Personal unter besonderer Berücksichtigung der Arbeits- <strong>und</strong><br />
Lebensbedingungen an Bord von Seeschiffen zu führen<br />
� Mitarbeiter an Bord von Seeschiffen in Notsituationen<br />
Orientierung <strong>und</strong> Führung zu geben<br />
� seemännischen Nachwuchs unter Anwendung der Prinzipien<br />
der beruflichen Bildung <strong>und</strong> Ausbildung an Bord von<br />
Seeschiffen auszubilden<br />
� Mitarbeiter an Bord von Seeschiffen zu beurteilen <strong>und</strong> in ihrer<br />
Leistungsfähigkeit zu entwickeln<br />
Schlüsselkompetenzen<br />
Die Studierenden sind in der Lage,<br />
� Mitarbeiter erfolgreich zu motivieren <strong>und</strong> zu führen sowie die<br />
Potenziale von Mitarbeitern zu erkennen <strong>und</strong> zu fördern<br />
40
Inhalte Kenntnis der einschlägigen internationalen Übereinkommen<br />
(insbesondere STCW)<br />
Erwerb von Gr<strong>und</strong>kenntnissen auf Teilgebieten der Berufs- <strong>und</strong><br />
Arbeitspädagogik nach der Ausbilder-Eignungsverordnung<br />
Allgemeine Gr<strong>und</strong>lagen der Berufsausbildung in der Seeschifffahrt<br />
Planung <strong>und</strong> Durchführung der Berufsausbildung an Bord <strong>und</strong> an<br />
Land<br />
Führung von Mitarbeitern im allgemeinen <strong>und</strong> bei multikulturellen<br />
Besatzungen im besonderen<br />
Führungsstile, Disziplinarmaßnahmen<br />
Führung von Menschen in Notfällen<br />
Personalbeurteilung<br />
Adäquates Konfliktverhalten <strong>und</strong> Konfliktlösungsstrategien<br />
Maßnahmen bei Alkoholmissbrauch <strong>und</strong> anderen Suchtverhalten<br />
Herstellen <strong>und</strong> Erhalten von Bordhygiene <strong>und</strong> einer humanen<br />
Arbeitsumgebung<br />
Anforderungen <strong>und</strong> Maßnahmen zur Umsetzung des ISPS-Codes<br />
(Safety and Security)<br />
STCW - Bezug Fachpraktische <strong>und</strong> fachtheoretische Anforderungen zu Wartung,<br />
Betrieb <strong>und</strong> Instandhaltung gem. Tab. A-III/1 <strong>und</strong> A-III/2<br />
Übereinkommens.<br />
Literatur Schager, Bengt; Human Error in the Maritime Industry - How to<br />
Understand, Detect and Cope o.V., 2008 ISBN 978-91-633-2064-4<br />
Name:<br />
Unterschrift: Datum:<br />
Matthews, G., Davies, R.D., Westerman, J. & Stammers, R.B.;<br />
Human Performance: Cognition, Stress and Individual Differences<br />
Psychology Press, UK, 2000<br />
Reason, James; Human Error<br />
Cambridge University Press, UK, 1990<br />
41
V 16.2 Ges<strong>und</strong>heitsfürsorge<br />
Modul M 16 Personalfürsorge<br />
zugehörige Veranstaltung V 16.2 Ges<strong>und</strong>heitsfürsorge<br />
Dozentinnen / Dozenten Dr. med. Gerhard Steinort (LA)<br />
Position im Studienverlauf 6. Fachsemester<br />
Angebotsrhythmus Beginn jedes Wintersemester<br />
Semesterwochenst<strong>und</strong>en 4<br />
Workload (Zeitst<strong>und</strong>en) Präsenz: 60 Selbststudium: 90<br />
ECTS-Leistungspunkte (CP) 5<br />
Sprache Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />
Lehr- <strong>und</strong> Lernformen Vorlesung , Übung, Praktikum<br />
Prüfung (Form, Dauer) Studienleistung (SL):<br />
1 Klausur, 120 Minuten oder 1 Vortrag/Referat oder<br />
1 schriftliche Ausarbeitung oder 1 Hausaufgabe<br />
Teilnahmevoraussetzungen keine<br />
Kompetenzziele fachlich-inhaltliche Kompetenzen<br />
Die Studierenden sind in der Lage,<br />
� medizinische Problemsituationen zu erkennen <strong>und</strong> zu<br />
gewichten.<br />
� die Versorgung von Kranken <strong>und</strong> Verletzten auf See zu<br />
organisieren.<br />
� den funkärztlichen Beratungskontakt zu organisieren.<br />
� in medizinischen Notfallsituationen entschlossen zu handeln,<br />
z.B. Reanimation.<br />
Schlüsselkompetenzen<br />
Die Studierenden sind in der Lage,<br />
� fächerübergreifend zu denken.<br />
� Und verfügen über Gesellschaftliches <strong>und</strong> ethisches<br />
Verantwortungsbewusstsein.<br />
Inhalte 1. Funktionelle Anatomie des menschlichen Körpers<br />
2. Erhebung einer wegweisenden Anamnese<br />
3. Erhebung einfacher medizinischer Bef<strong>und</strong>e<br />
4. Allgemeine Kenntnisse über Behandlung, Pflege <strong>und</strong><br />
Betreuung von Kranken/Verletzten<br />
5. Maßnahmen der erweiterten Ersten Hilfe<br />
6. Gr<strong>und</strong>kenntnisse über Arzneimittel in der Bordapotheke<br />
7. Gr<strong>und</strong>kenntnisse über wichtige bzw. häufige Erkrankungen<br />
bzw. Verletzungen<br />
STCW - Bezug „Leadership Skills“ <strong>und</strong> Notfallsituationen gem. Tab. A-III/1 <strong>und</strong> A-<br />
III/2 Übereinkommens.<br />
Literatur See-Berufsgenossenschaft (Hrsg.): Anleitung zur Krankenfürsorge<br />
auf Kauffahrteischiffen, Leitfaden für Kapitäne <strong>und</strong> Schiffsoffiziere;<br />
Verlag Carl W. Dingwort, 5., neu bearbeitete <strong>und</strong> ergänzte<br />
42
Auflage, Hamburg 2007<br />
Name:<br />
Unterschrift: Datum:<br />
M 17 Tankschifffahrt<br />
Modulkennziffer 17<br />
Modulname Tankschifffahrt<br />
Modultyp Pflichtmodul<br />
zugehörige Veranstaltung V 17.1 Dienst auf Tankschiffen<br />
Dozentinnen / Dozenten N.N.<br />
Position im Studienverlauf 4. Fachsemester<br />
Angebotsrhythmus Beginn jedes Wintersemester<br />
Semesterwochenst<strong>und</strong>en 2<br />
Workload (Zeitst<strong>und</strong>en) Präsenz: 30 Selbststudium: 60<br />
ECTS-Leistungspunkte (CP) 3<br />
Sprache Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />
Lehr- <strong>und</strong> Lernformen Vorlesung <strong>und</strong> Übung<br />
Prüfung (Form, Dauer) Studienleistung:<br />
1 Klausur, 60 Minuten oder<br />
1 Vortrag/Referat oder 1 schriftliche Ausarbeitung<br />
Teilnahmevoraussetzungen erfolgreiche Orientierungsprüfung<br />
Kompetenzziele fachlich-inhaltliche Kompetenzen<br />
Die Studierenden sind in der Lage,<br />
� Vorschriften für den sicheren Betrieb von Tankern<br />
anzuwenden,<br />
� Tankertypen <strong>und</strong> ihre Ladungen zu klassifizieren,<br />
� Ladungseigenschaften <strong>und</strong> damit verb<strong>und</strong>ene<br />
Sicherheitsrisiken zu beurteilen,<br />
� konstruktive Unterschiede <strong>und</strong> Ausstattungsmerkmale von<br />
Tankern zu erläutern,<br />
� Lade- <strong>und</strong> Löschoperationen entsprechend den<br />
Verfahrensanweisungen durchzuführen,<br />
� Ladetanks zu reinigen, Ladungsrückstände vorschriftsmäßig<br />
zu entsorgen <strong>und</strong> den Verbleib der Rückstände zu<br />
dokumentieren,<br />
� mit unterschiedlichen Maßnahmen die Tankatmosphäre zu<br />
überwachen,<br />
� die Einhaltung aller allgemeinen Sicherheitsmaßnahmen zu<br />
überprüfen,<br />
� die Gr<strong>und</strong>sätze für Wartungs- <strong>und</strong> Instandhaltungsarbeiten<br />
auf Tankern zu berücksichtigen,<br />
� tankerspezifische Notfallmaßnahmen zu organisieren.<br />
Schlüsselkompetenz<br />
Die Studierenden sind in der Lage,<br />
43
� sicherheitsorientiert <strong>und</strong> umweltbewusst zu denken.<br />
Inhalte Bauart, Auslegung <strong>und</strong> Ausrüstung von Öl-, Gas- <strong>und</strong><br />
Chemikalientankern, Gr<strong>und</strong>sätze der Beladung <strong>und</strong> des<br />
Ladungsumschlags.<br />
Eigenschaften der Tankladungen, Toxizität, Gefahren <strong>und</strong><br />
Gefahrenabwehr. Sicherheitsausrüstung <strong>und</strong> Schutz des<br />
Personals, Verhütung der Verschmutzung des Meeres <strong>und</strong> der<br />
Luft.<br />
(Einführungsqualifikation für Tankschiffe nach STCW-Code)<br />
STCW - Bezug Fachpraktische <strong>und</strong> fachtheoretische Anforderungen zu Wartung,<br />
Betrieb <strong>und</strong> Instandhaltung gem. Tab. A-III/1 <strong>und</strong> A-III/2<br />
Übereinkommens.<br />
Literatur IMO (Hrsg.): IMO Model Course 1.01; Tanker Familiarization, 2000<br />
Edition<br />
Huber,M.: Tanker Operations: A Handbook for the Person-in-<br />
Charge (PIC), 4 th Edition 2001<br />
Oil record book<br />
Name:<br />
Unterschrift: Datum:<br />
M 18 Betriebsstoffe<br />
Modulkennziffer 18<br />
Modulname Betriebsstoffe<br />
Modultyp Pflichtmodul<br />
zugehörige Veranstaltung V 18.1 Betriebsstoffe<br />
Dozentinnen / Dozenten Prof. Dr.-Ing. Holger Watter<br />
Position im Studienverlauf 5. Fachsemester<br />
Angebotsrhythmus Beginn jedes Sommersemester<br />
Semesterwochenst<strong>und</strong>en 4<br />
Workload (Zeitst<strong>und</strong>en) Präsenz: 60 Selbststudium: 60<br />
ECTS-Leistungspunkte (CP) 4<br />
Sprache Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />
Lehr- <strong>und</strong> Lernformen Vorlesung <strong>und</strong> Übung<br />
Prüfung (Form, Dauer) Prüfungsleistung (PL):<br />
1 Klausur, 120 Minuten<br />
Teilnahmevoraussetzungen<br />
Kompetenzziele fachlich-inhaltliche Kompetenzen<br />
Die Studierenden sind in der Lage,<br />
� Geeignete Verfahren zur Messung relevanter chemischer <strong>und</strong><br />
physikalischer Eigenschaften von Betriebsstoffen auszuwählen<br />
<strong>und</strong> anzuwenden<br />
� technologische Anforderungen an die chemischen <strong>und</strong><br />
44
physikalischen Eigenschaften der Betriebsstoffe zu beurteilen<br />
Schlüsselkompetenzen<br />
Die Studierenden sind in der Lage, auf Gr<strong>und</strong> von Messdaten <strong>und</strong><br />
Kenngrößen die Verwendbarkeit der Betriebsstoffe für die<br />
technischen Einrichtungen beurteilen zu können.<br />
Inhalte � Betriebsstoffe für den Kraft- <strong>und</strong> Arbeitsmaschinen<br />
(Kühlwasser, Schmierstoffe, Kraftstoffe, Kesselwasser,<br />
Verbrennungsluft, Abgase) sowie deren Richt- <strong>und</strong> Grenzwerte<br />
� Betriebsstoffe für das Schiff (Brauchwasser, Schwarz- <strong>und</strong><br />
Grauwasser, Raumluft, Ballastwasser) <strong>und</strong> deren Grenzwerte<br />
� Kenngrößen der Betriebsstoffe, Meßverfahren <strong>und</strong> –methoden<br />
nach Norm.<br />
STCW - Bezug Fachpraktische <strong>und</strong> fachtheoretische Anforderungen zu Wartung,<br />
Betrieb <strong>und</strong> Instandhaltung gem. Tab. A-III/1 <strong>und</strong> A-III/2<br />
Übereinkommens.<br />
Literatur Meier-Peter/Bernhardt: „Handbuch Schiffsbetriebstechnik“<br />
Name:<br />
Unterschrift: Datum:<br />
1. Kraft- <strong>und</strong> Schmierstoffe<br />
1.1 Gr<strong>und</strong>lagen der organischen Chemie: betriebliche Eigenschaften der Paraffine, Olefine, Napthene,<br />
Aromate, Substitute, funktionelle Gruppen, Derivate, Polymerisation.<br />
1.2 Erdölaufbereitung: Einfluss von Provenienz <strong>und</strong> Destillation/Raffination auf Schifffahrtsbrennstoffe;<br />
Destillationsverfahren, Siedekurve; Produkteigenschaften von Benzin, Diesel, Bitume, Asphaltene,<br />
Maltene, Mizellen, Spurenelemente<br />
1.3 Physikalische, chemische <strong>und</strong> technologische Eigenschaften der Kraft- <strong>und</strong> Schmierstoffe<br />
1.3.1. Physikalische Eigenschaften: Farbe (ISO 2049), Dichte (DIN 51 757), Specific-Gravity,<br />
API-Grad, Dichte-Temperatur- <strong>und</strong> Dichte-Druckverhalten (Kompressibilität K = 14.000bar)<br />
1.3.2. Viskosität (DIN 51 562): Zähigkeit (Viskosität) / Viskositätindex VI , Viskositäts-Temperatur-<br />
<strong>und</strong> Viskositätsdruckverhalten, Viskositätsmessung<br />
1.3.3. Trübungspunkt (Cloud point) (ISO 3015), Stockpunkt (Pourpoint) (ISO 3016),<br />
Flammpunkt/Brennpunkt (ISO 2592), Verdampfungsverlust (DIN 51 581),<br />
1.3.4. Fette: Scheinbare Viskosität, Fließverhalten, Gehalt an Feststoffen <strong>und</strong> Festschmierstoffen<br />
(DIN 51 831), Tropfpunkt (ISO 2176), Penetration (ISO 2137);<br />
1.3.5. Chemische Eigenschaften: Asche bzw. Oxidasche, Sulfatasche, Asphaltengehalt (DIN 51<br />
595), Verkokungsneigung (DIN 51 352), Oxidations- <strong>und</strong> Alterungsbeständigkeit (DIN 51 554),<br />
Hochtemperaturkorrosion (HTK), Asphaltgehalt, Verkokungsneigung CCR, Alterung,<br />
„Insolubes“ (unlösliche Bestandteile), Wassergehalt, Salzgehalt, Anillinpunkt;<br />
1.3.6. Neutralisation von Säuren: Neutralisationszahl NZ / TAN (DIN 51 558), (Total-)Base-Number<br />
(T)BN/ Basenzahl (ISO 3771), Verseifungszahl VZ (DIN 51 559), Titrationsverfahren,<br />
Massenwirkungsgesetz<br />
1.3.7. Technologische Eigenschaften: Wasserabscheidevermögen (DIN 51 589),<br />
Luftabscheidevermögen (DIN 51 381), Rostschutzverhalten (gegenüber Stahl) (DIN 51 585),<br />
Korrosionsschutzverhalten (gegenüber Kupfer) (DIN 51 759), Freß- <strong>und</strong><br />
Verschleißschutzverhalten (Vierkugelapparat) (DIN 51 350), Verschleißverhalten<br />
(Flügelzellenpumpe) (DIN 51 389), Freß- <strong>und</strong> Verschleißschutzverhalten (FZG-<br />
Verspannungsprüfstand) (DIN 51 354), Scherstabilität (DIN 51 382)<br />
1.4 Schifffahrtsbrennstoffe: ISO 8217, MDO, MGO, DMx, RMx, IFO; mögliche Betriebsstörungen <strong>und</strong><br />
Problemfelder, DNV Training Video: Marine Fuel Management (Brennstoffübernahme, repräsentative<br />
Probe, Bunker Delivery Report), Gefährdungsbeurteilung (MSDS = Material Safety Data Sheets –<br />
Health, Safety and Environmental Data)<br />
45
1.4.1. Mischungsregeln für Betriebsstoffe, Unverträglichkeit, Tüpfelprobe, Umstellen HFO – MDO,<br />
Homogenisator, Zeitverlauf der Mischung (Ballastwasser, Umstellvorgang auf niedrigen<br />
Schwefelgehalt etc.) – Simulation in MATLAB SIMULINK <strong>und</strong> in EXCEL.<br />
1.4.2. Verbrennungs- <strong>und</strong> Zündeigenschaften: Gemischbildung, Verbrennung /<br />
Verbrennungsrechnung, Heizwert, Zündverhalten, CCAI, CII, Ölnebel/Triebraumexplosion,<br />
Explosionsgefahr im Tankraum<br />
1.4.3. Ausgewählte Betriebsstörungen: Niedertemperaturkorrosion (NTK), Laufbuchsenverlackung,<br />
Hochtemperaturkorrosion (HTK), mikrobiologischer Befall<br />
1.5 Schmierstoffe:<br />
1.5.1. Gr<strong>und</strong>lagen der Tribologie (Reibung & Verschleiß, Stribek-Kurve, Passungsrost),<br />
Gleitlagerbelastung, SOMMERFELD-Zahl, Gr<strong>und</strong>lagen der Additivierung: Alkylgruppe,<br />
Alkanole, Glykole, Phenole, Alkanale, ein- <strong>und</strong> mehrwertige Alkansäuren (Carbonsäuren),<br />
aromatische Säuren, Ester, Seife, Substitute <strong>und</strong> funktionelle Gruppen<br />
1.5.2. Mineralölbasische Schmierstoffe: Anforderungen, Raffination,<br />
1.5.3. Synthetische Schmierstoffe: Einsatzbereiche, Sorten, Eigenschaften<br />
1.5.4. Biologisch-schnell-abbaubare Schmierstoffe (LLINCWA): Eigenschaften, Einsatzbereiche<br />
1.5.5. Additivierung: Detergentien, Dispersantien, Antioxidantien, Verschleißschutzadditive, EP/AW-<br />
Additive, Friction-Modifier, Korrosionsschutzadditive, VI-Verbesserer, Anti-Schaum-Additive,<br />
Stockpunkt- <strong>und</strong> Pourpoint-Verbesserer<br />
1.5.6. Normung (SAE, API, ISO VG, ….) <strong>und</strong> Schmieröluntersuchungen; Wassergehalt im Schmieröl<br />
2. Wasserpflege:<br />
2.1 Wasserarten <strong>und</strong> -eigenschaften: Härte, pH-Wert, Säuren- <strong>und</strong> Basenkonstante,<br />
Säurekapazität, Löslichkeit von Salzen, Löslichkeit von Gips (Kesselstein, Kalk-<br />
Kohlensäuregleichgewicht), Kieselsäure, Organische Verunreinigungen (Fett, Öl), Löslichkeit von<br />
Gasen, elektr. Leitfähigkeit, Wassereigenschaften bei Verdampfung <strong>und</strong> Umkehrosmose.<br />
2.2 Kesselwasser: Einfluss von Verunreinigungen, Wasserqualität, Anforderungen an das Kessel-<br />
<strong>und</strong> Speisewasser, Wasseranalyse, Wasseraufbereitung <strong>und</strong> Konditionierung: Filtration,<br />
Flockung, Entsäuerung, Enteisung <strong>und</strong> Entmanganung, Ionenaustauscher, Enthärtung,<br />
Entcarbonisierung, Entsalzung, Entgasung, Alkalisierung, Antischaummittel, Filmbildner,<br />
Störungsbeseitigung.<br />
2.3 Motorkühlwasserpflege<br />
2.4 Einführung in die Elektrochemie: Ionisierungsenergie, Elektronennegativität,<br />
Reaktionsenthalphie, Standardbildungsenthalphie, GIBBsche Energie, elektrochemisches<br />
Potential, elektrochemische Spannungsreihe, galvanische Zelle. Akkumulatorenflüssigkeit:<br />
Bleiakkumulatoren, NiCd-Batterien, Li-Ion-Akku, Gefährdungen durch Batterieflüssigkeiten,<br />
technische Anforderungen (GL Kap. 3 Abschn. 2).<br />
2.5 Korrosion: VAN’T HOFFsches Reaktionsgesetz, Einfluss der Temperatur auf den<br />
Korrosionsvorgang, Wasserstoff-/Säurekorrosion, Sauerstoffkorrosion/Stillstandskorrosion,<br />
Redoxreaktionen, On-Load-Korrosion, Heißdampfoxidation (Magnetit-Schicht),<br />
Spannungsrißkorrosion, Erosion, Korrosion durch galvanische Ströme/elektrochemische<br />
Spannungsreihe<br />
2.6 Ausblick: Galvanische Zelle (Batterie, Brennstoffzelle <strong>und</strong> Elektrolyse);<br />
Brennstoffzellensysteme: Energieumsetzung, Wirkungsgrad, Potentiale.<br />
Labor:<br />
1. Öllabor (Dipl.-Ing. Blawatt; Tel. 1263; Gebäude B; Raum B225): Versuch 1: Herstellung von<br />
Biodiesel; Bestimmung freier Fettsäuren in Pflanzenölen, Vergleich der Viskosität von Dieselöl,<br />
Biodiesel <strong>und</strong> Pflanzenöl; Versuch 2: Abhängigkeit der Viskosität von Scherkräften bei Motoren- <strong>und</strong><br />
Getriebeölen (Newtonsche <strong>und</strong> Nichtnewtonsche Flüssigkeiten); Versuch 3: Bestimmung des<br />
Schwefelgehalts im Schweröl.<br />
2. Labor Kielseng 15a (Frau Nissen; Tel. 0461-48089714): Versuch 1: Flammpunkt, Brennpunkt,<br />
Selbstentzündung; Versuch 2: Dichte-Temperatur-Abhängigkeit; Versuch 3: Wassergehalt in Öl.<br />
Wasserlabor (Dipl.-Ing. Stert; Tel. 1281, Gebäude B; Raum B213): Versuch 1: Bestimmung des gelösten<br />
Sauerstoffes (Iodometrische Titration); Versuch 2: Bestimmung der Carbonathärte; Versuch 3:<br />
Bestimmung der Gesamthärte; Versuch 4: Säure-Base-Titrationen.<br />
46
M 19 Maschinenelemente<br />
Modulkennziffer M 19<br />
Modulname Maschinenelemente<br />
Modultyp Pflichtmodul<br />
zugehörige<br />
Veranstaltung<br />
V 19.1 Maschinenelemente<br />
Modulverantwortlicher / Dozent Prof. Dr.-Ing. Joachim Schneider<br />
Position im Studienverlauf 5. Fachsemester<br />
Angebotsrhythmus jeweils Sommersemester<br />
Semesterwochenst<strong>und</strong>en 4 SWS (+ 2 SWS fakultativ)<br />
Workload (Zeitst<strong>und</strong>en) Präsenz: 60 Selbststudium: 90<br />
ECTS-Leistungspunkte (CP) 5<br />
Sprache Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />
Lehr- <strong>und</strong> Lernformen Vorlesung (4 SWS) <strong>und</strong> Übung (2 SWS)<br />
Prüfung (Form, Dauer) Prüfungsleistung (PL):<br />
Klausur (120 Minuten) oder sonstige Prüfungsleistung<br />
Teilnahmevoraussetzungen Orientierungsprüfung für Veranstaltungen ab Semester 5<br />
Kompetenzziele fachlich-inhaltliche Kompetenzen<br />
Kenntnisse über die Gr<strong>und</strong>lagen des Aufbaus <strong>und</strong> der Funktion<br />
sowie des Entwurfs <strong>und</strong> des Festigkeitsnachweises<br />
ausgewählter Maschinen-<strong>und</strong> Anlagenelemente<br />
Schlüsselkompetenzen<br />
Förderung der methodischen Kompetenz, der sozialen<br />
Kompetenz <strong>und</strong> der persönlichen Selbstkompetenz der<br />
Studierenden<br />
Inhalte 1. Überblick über Aufbau <strong>und</strong> Funktion von Maschinen- <strong>und</strong><br />
Anlagenelementen<br />
2. Gr<strong>und</strong>lagen der Berechnung <strong>und</strong> Gestaltung:<br />
Festigkeitsnachweis <strong>und</strong> Gestaltfestigkeit<br />
3. Entwurf <strong>und</strong> Berechnungen von Maschinenelementen:<br />
Schweißverbindungen<br />
Klebeverbindungen<br />
Schraubenverbindungen<br />
Stifte <strong>und</strong> Bolzen<br />
Achsen <strong>und</strong> Wellen<br />
Welle-Nabe-Verbindungen<br />
4. Überblick über Federverbindungen, Kupplungen, Lager <strong>und</strong><br />
Getriebe<br />
5. Dichtungstechnik<br />
6. Reibung, Schmierung, Verschleiß<br />
7. Ausgewählte Elemente des Konstruktiven Apparate- <strong>und</strong><br />
Anlagenbaues<br />
STCW - Bezug entfällt<br />
47
Literatur [1] Gross, Hauger, Schnell: Technische Mechanik, Springer<br />
Verlag<br />
[2] Läpple: Einführung in die Festigkeitslehre, Vieweg <strong>und</strong><br />
Teubner-Verlag<br />
[3] Steinhilper/Röper: Maschinen- <strong>und</strong> Konstruktions-elemente,<br />
Springer-Verlag<br />
[4] Schlecht B.: Maschinenelemente, Pearson-Studium<br />
[5] Roloff/Matek: Maschinenelemente <strong>und</strong> Tabellen, Vieweg-<br />
Verlag<br />
[6] Haberhauer / Bodenstein: Maschinenelemente, Pearson<br />
Studium<br />
Name:<br />
Unterschrift: Datum:<br />
M 20 Regelungstechnik<br />
Modulkennziffer 20<br />
Modulname Regelungstechnik<br />
Modultyp Pflichtmodul<br />
Position im Studienverlauf 5. Fachsemester<br />
Angebotsrhythmus Beginn jedes Wintersemesters<br />
Modulbeauftragter Prof. Dr.-Ing. Jochen Wendiggensen<br />
Dozentinnen / Dozenten Prof. Dr.-Ing. Jochen Wendiggensen<br />
Semesterwochenst<strong>und</strong>en 4<br />
Workload (Zeitst<strong>und</strong>en) Präsenz: 60 Selbststudium: 90<br />
ECTS-Leistungspunkte (CP) 5<br />
Sprache Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />
Lehr- <strong>und</strong> Lernformen Vorlesung<br />
Prüfung (Form, Dauer) Prüfungsleistung (PL): Klausur, 120 Minuten<br />
Teilnahmevoraussetzungen Orientierungsprüfung<br />
Kompetenzziele fachlich-inhaltliche Kompetenzen<br />
� Die Studierenden kennen die wichtigsten industriellen<br />
Messverfahren für Prozesszustandsgrößen <strong>und</strong> können für<br />
jedes Verfahren Messgenauigkeit <strong>und</strong> Fehler abschätzen.<br />
� Sie können einfache Verknüpfungssteuerungen entwerfen<br />
<strong>und</strong> Arbeitsabläufe in Ablaufsteuerungen organisieren.<br />
� Die Studierenden kennen alle linearen Regelkreisglieder <strong>und</strong><br />
können damit Wirkungspläne erstellen <strong>und</strong> berechnen.<br />
� Sie sind in der Lage Regelkreise experimentell zu<br />
untersuchen <strong>und</strong> Einstellregeln anzuwenden.<br />
Inhalte 1. Einführung in die Messtechnik<br />
2. Ausgewählte Messprinzipien <strong>und</strong> Methoden für<br />
3. Temperatur <strong>und</strong> Druck<br />
4. Ausgewählte Messprinzipien <strong>und</strong> Methoden für Niveau<br />
48
<strong>und</strong> Durchfluss<br />
5. Einführung in die Steuerungstechnik<br />
6. Boolsche Algebra <strong>und</strong> Schaltfunktionen<br />
7. Realisierung von Schaltfunktionen <strong>und</strong> deren<br />
Vereinfachung<br />
8. Ablaufsteuerungen<br />
9. Einführung in die Regelungstechnik<br />
10. Übertragungsglieder<br />
11. Das dynamische Verhalten<br />
12. Regelkreisglieder <strong>und</strong> Streckenverhalten<br />
13. Der PID-Regler <strong>und</strong> ableitbare Typen<br />
14. Einstellregeln, Optimierung, experimentelle Analyse<br />
15. Aufgabendarstellung in der Prozessleittechnik<br />
STCW - Bezug Fachpraktische <strong>und</strong> fachtheoretische Anforderungen zu Wartung,<br />
Betrieb <strong>und</strong> Instandhaltung gem. Tab. A-III/1 <strong>und</strong> A-III/2<br />
Übereinkommens.<br />
Literatur Skript, Folien (Powerpoint, PDF), Tafel, Arbeits- <strong>und</strong> Übungsblätter<br />
M. Reuter: Regelungstechnik für Ingenieure<br />
H. Unbehauen: Regelungstechnik I <strong>und</strong> II<br />
Schneider: Regelungstechnik für Maschinenbauer<br />
Grötsch: SPS 1<br />
Wellenreuther, Zastrow: Automatisieren mit SPS<br />
Föllinger: Regelungstechnik<br />
Bergmann: Automatisierungs- <strong>und</strong> Prozessleittechnik<br />
Name:<br />
Unterschrift: Datum:<br />
M 21 Arbeitsmaschinen<br />
Modulkennziffer 21<br />
Modulname Arbeitsmaschinen<br />
Modultyp Pflichtmodul<br />
Position im Studienverlauf 5. <strong>und</strong> 6. Fachsemester<br />
Angebotsrhythmus Beginn jedes Sommersemester<br />
Beginn jedes Wintersemester<br />
Modulbeauftragter Prof. Dr.-Ing. Holger Watter<br />
Dozentinnen / Dozenten Prof. Dr.-Ing. Holger Watter; Dipl.-Ing. Tove Möller<br />
Semesterwochenst<strong>und</strong>en 7<br />
Workload (Zeitst<strong>und</strong>en) Präsenz: 120 Selbststudium: 120<br />
ECTS-Leistungspunkte (CP) 8<br />
Sprache Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />
Lehr- <strong>und</strong> Lernformen 2x Vorlesung<br />
1x Labor<br />
Prüfung (Form, Dauer) Prüfungsleistung (PL):<br />
1 Klausur, 120 Minuten<br />
49
Teilnahmevoraussetzungen Orientierungsprüfung<br />
Kompetenzziele fachlich-inhaltliche Kompetenzen<br />
Die Studierenden sind in der Lage,<br />
� die Arbeitsmaschinen nach ihrer inneren Wirkweise sowie<br />
deren äußeren Merkmalen abzugrenzen<br />
� den Aufbau, die Hauptbauteile sowie die innere Wirkweise der<br />
Maschinen zu beschreiben<br />
� das Betriebsverhalten der Arbeitsmaschinen in Kennfeldern<br />
darzustellen<br />
� zielgerichtet <strong>und</strong> sicher mit den Kennfelder der<br />
Arbeitsmaschinen umzugehen<br />
� vorgeschriebene Sicherheitseinrichtungen für die<br />
Arbeitsmaschinen <strong>und</strong> deren Wirkweise zu benennen.<br />
Schlüsselkompetenzen<br />
Die Studierenden sind in der Lage, für den jeweiligen<br />
Anwendungsfall die geeignete Arbeitsmaschinen auszuwählen <strong>und</strong><br />
das Betriebsverhalten von Arbeitsmaschine mit Anlage zu<br />
beurteilen.<br />
zugeordnete Veranstaltungen V 21.1: Arbeitsmaschinen 1<br />
V 21.2: Arbeitsmaschinen 2<br />
V 21.3: Arbeitsmaschinen 2 Labor<br />
Beschreibung der Veranstaltungen siehe Tabellen V 21.1 <strong>und</strong> V 21.2 <strong>und</strong> V 21.3<br />
Name:<br />
Unterschrift: Datum:<br />
V 21.1 Arbeitsmaschinen 1<br />
Modulkennziffer 21<br />
Zugehörige Veranstaltung V 21.1 Arbeitsmaschinen 1<br />
Dozentinnen/Dozenten Prof. Dr.-Ing. Holger Watter<br />
Position im Studienverlauf 5. Fachsemester<br />
Angebotsrhythmus Beginn jedes Sommersemester<br />
Semesterwochenst<strong>und</strong>en 4<br />
Workload (Zeitst<strong>und</strong>en) Präsenz: 60 Selbststudium: 60<br />
ECTS-Leistungspunkte (CP) 4<br />
Sprache Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />
Lehr- <strong>und</strong> Lernformen Vorlesung<br />
Prüfung (Form, Dauer) Zusammen mit Arbeitsmaschinen 2<br />
Teilnahmevoraussetzungen Orientierungsprüfung<br />
Kompetenzziele fachlich-inhaltliche Kompetenzen<br />
Die Studierenden sind in der Lage,<br />
� aus Werftunterlagen die Auslegungsparameter Förderhöhe<br />
<strong>und</strong> Förderstrom für Arbeitsmaschinen zu ermitteln<br />
� für die Auslegungsparameter die geeignete Arbeitsmaschine<br />
einschließlich der Leistungsdaten <strong>und</strong> Abmessungen<br />
50
auszuwählen<br />
� Arbeitsmaschinen <strong>und</strong> Anlagen in Betrieb zu nehmen <strong>und</strong><br />
sicher zu betreiben.<br />
Schlüsselkompetenzen<br />
Die Studierenden sind in der Lage, das Betriebsverhalten von<br />
Arbeitsmaschinen zu beurteilen, Störungen rechtzeitig zu<br />
erkennen <strong>und</strong> geeignete Gegenmaßnahmen einzuleiten. Sie<br />
erwerben hierdurch Problemlösungsfertigkeiten.<br />
Inhalte � Aufbau <strong>und</strong> Funktion der Verdränger- <strong>und</strong><br />
Strömungsarbeitsmaschinen<br />
� Zusammenwirken von Arbeitsmaschinen <strong>und</strong> Anlagen<br />
� Inbetriebnahme <strong>und</strong> Regelungen bei Verdränger- <strong>und</strong><br />
Strömungsarbeitsmaschinen<br />
� Störungen, Schäden <strong>und</strong> Instandhaltung von<br />
Arbeitsmaschinen<br />
STCW - Bezug Fachpraktische <strong>und</strong> fachtheoretische Anforderungen zu<br />
Wartung, Betrieb <strong>und</strong> Instandhaltung gem. Tab. A-III/1 <strong>und</strong> A-<br />
III/2 Übereinkommens.<br />
Literatur Meier-Peter/Bernhardt: „Handbuch Schiffsbetriebstechnik“<br />
Name:<br />
Unterschrift: Datum:<br />
1. Kreiselpumpen<br />
1.1 Strömungstechnische Gr<strong>und</strong>lagen (Bernoulli, Energie), Übungen<br />
1.2 Einführung Pumpen, Impulssatz, Übung<br />
1.3 Strömungs- <strong>und</strong> Geschwindigkeitsdreiecke, Übungsbeispiel<br />
1.4 Pumpen- / Eulerhauptgleichung für Strömungsmaschinen, Drosselkurve/Pumpenkennfeld,<br />
Übungen Hauptgleichung <strong>und</strong> Strömungsdreiecke<br />
1.5 Ähnlichkeitsgesetze <strong>und</strong> dimensionslose Kennzahlen (spez. Drehzahl), Laufradgeometrie,<br />
Übungen<br />
1.6 Bauformen, Laufradgeometrie, Betriebsparameter, Übungen<br />
1.7 Saugverhalten, Kavitation, NPSH, Übungen<br />
1.8 Kenndaten <strong>und</strong> Kennfelder von Kreiselpumpen, Anlagenkennlinie / Pumpenkennlinie, Anpassung<br />
der Pumpe an die Anlage, Reihenschaltung / Parallelschaltung von Pumpen, frequenzgeregelte<br />
Pumpen, Übungen<br />
1.9 Labor (Dipl.-Ing. Tove Möller)<br />
1.9.1 Untersuchung von Kreiselpumpen, NPSH-Kreiselpumpe<br />
1.9.2 Untersuchungen an Wasserturbinen (Francisturbine): Bestimmung des optimalen<br />
Betriebspunktes bezogen auf Volumenstrom <strong>und</strong> Fallhöhe<br />
1.10 Semesterarbeit: Simulationsuntersuchungen von dyn. Vorgängen in<br />
Rohrleitungssystemen.<br />
2. Rohrleitungssysteme<br />
2.1 Kennzeichnung, Symbole, Dimensionierung (Festigkeit, Kesselformel, Vergleichsspannung,<br />
MOHRscher Spannungskreis; strömungstechnische Dimensionierung (REYNOLDs-Zahl,<br />
Widerstände von Einbauten <strong>und</strong> geraden Rohren, Druckverluste (Anlagenkennlinie), Rauigkeit,<br />
Verlustbeiwerte, verzweigte Systeme <strong>und</strong> deren Einfluss auf das Betriebsverhalten, Korrosion<br />
durch galvanische Ströme/elektrochemische Spannungsreihe<br />
2.2 Förderung viskoser Flüssigkeiten (Schweröl), Förderung von Flüssigkeits-Gas-Gemischen<br />
(Abwasseranlage)<br />
51
2.3 Schwingungen <strong>und</strong> Resonanz: Fluiddynamik bei Gasen <strong>und</strong> Flüssigkeiten (Joukowsky-Stoß),<br />
Schwingungen von Platten <strong>und</strong> Rohrleitungen (Axialschwingungen, Biegeschwingungen,<br />
mathematische Beschreibung von Schwingungen, Lösung der Schwingungsdgl., Dämpfung),<br />
2.4 Labor (Dipl.-Ing. Tove Möller)<br />
2.4.1 Rohrströmungen: Strömungsuntersuchungen in Rohrleitungsanlagen<br />
(Widerstandsbeiwerte für Bögen, Winkel, glattes <strong>und</strong> raues Rohr <strong>und</strong> Aufnahme einer<br />
Ventilkennlinie)<br />
2.4.2 Krafteinwirkung auf umströmte Körper (Messungen im Windkanal: Widerstandsbeiwerte<br />
div. geometrischer Körper, Widerstands- <strong>und</strong> Auftriebskraft eines Tragflügelprofils,<br />
Magnuseffekt)<br />
V 21.2 Arbeitsmaschinen 2<br />
Modulkennziffer 21<br />
Zugehörige Veranstaltung V 21.2 Arbeitsmaschinen 2<br />
Dozentinnen/Dozenten Prof. Dr.-Ing. Holger Watter<br />
Position im Studienverlauf 6. Fachsemester<br />
Angebotsrhythmus Beginn jedes Wintersemester<br />
Semesterwochenst<strong>und</strong>en 2<br />
Workload (Zeitst<strong>und</strong>en) Präsenz: 30 Selbststudium: 30<br />
ECTS-Leistungspunkte (CP) 2<br />
Sprache Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />
Lehr- <strong>und</strong> Lernformen Vorlesung<br />
Prüfung (Form, Dauer) Prüfungsleistung (PL):<br />
1 Klausur, 120 Minuten<br />
Teilnahmevoraussetzungen Orientierungsprüfung<br />
Kompetenzziele fachlich-inhaltliche Kompetenzen<br />
Die Studierenden sind in der Lage,<br />
� Sonstige, für den Betrieb von Schiffen erforderlichen<br />
Arbeitsmaschinen <strong>und</strong> Systeme zu benennen<br />
� Aufbau, Funktionsweise <strong>und</strong> Auslegungsparameter für diese<br />
Arbeitsmaschinen <strong>und</strong> Systeme zu benennen<br />
� das Betriebsverhalten dieser Arbeitsmaschinen <strong>und</strong> Systeme<br />
in entsprechenden Kennfeldern darzustellen.<br />
Schlüsselkompetenzen<br />
Die Studierenden sind in der Lage, Gegenseitige<br />
Wechselwirkungen in komplexen Systemen zu erfassen <strong>und</strong><br />
übergreifend zu handeln. Sie erlernen zielorientiertes Handeln.<br />
Inhalte � Gr<strong>und</strong>lagen der Pneumatik <strong>und</strong> Hydraulik<br />
� Decksmaschinen <strong>und</strong> Rudermaschinen<br />
STCW - Bezug Fachpraktische <strong>und</strong> fachtheoretische Anforderungen zu<br />
Wartung, Betrieb <strong>und</strong> Instandhaltung gem. Tab. A-III/1 <strong>und</strong> A-<br />
III/2 Übereinkommens.<br />
Literatur � Meier-Peter/Bernhardt: „Handbuch Schiffsbetriebstechnik“<br />
� Sulzer: „Kreiselpumpenhandbuch“<br />
� KSB: „Lexikon der Pumpentechnik“<br />
� Boge: „Druckluft- Kompendium“<br />
52
Name:<br />
Unterschrift: Datum:<br />
3. Verdrängerpumpen <strong>und</strong> Hydraulik<br />
3.1 Bauarten (Kolbenpumpe, Exzenterschneckenpumpe, Rootspumpe etc.), Symbole gem. DIN 2481<br />
(Wärmekraftanlagen) <strong>und</strong> DIN 24300 (Hydraulik),<br />
3.2 Betriebsverhalten von Verdrängerpumpen, Anlagen- <strong>und</strong> Pumpenkennlinie, p-V-Diagramm,<br />
Windkessel, Verluste (dynamische Einflüsse, Beschleunigungsverluste u.a.)<br />
3.3 Hydraulische Anlagen: Trägheitswirkung, Kompressibilität, Leckverluste,<br />
3.4 Hydraulische Komponenten: Ventile <strong>und</strong> Zubehör, Funktionsanalyse<br />
3.5 Hydraulische Steuerungen <strong>und</strong> Regelungskonzepte: Konstant-Stromschaltung, Konstantdruck-<br />
Schaltung (Druckabschneidung, Druckregelung, Nullhubregelung, Load-Sensing (Last-<br />
Druckmeldesystem), Leistungsregelung,<br />
3.6 Seegangskompensation; Sek<strong>und</strong>ärregelung<br />
3.7 Beispielhafte Hydrauliksysteme: Bugstrahler, Ruderanlage, Verstellpropelleranlage,<br />
Störungsbeispiele (Hydraulische Verblockung, Fehlerbaumanalyse nach DIN 40.700, DNV-<br />
Casualty Information)<br />
3.8 Labor (Dipl.-Ing. Tove Möller)<br />
3.8.1 Untersuchungen an einem Hydraulikstand (Aufbau zweier Schaltungen <strong>und</strong> Fehlersuche)<br />
4. Verdichter <strong>und</strong> Pneumatik<br />
4.1 Bauarten (Hubkolberverdichter etc.),<br />
4.2 Thermodynamische Zustandsänderungen <strong>und</strong> Kennfelder; Beispiele: Kolbenverdichter,<br />
Turboverdichter<br />
4.3 Massenbilanz, Liefergrad, Schadraum,<br />
4.4 Gasgemische, Feuchte Luft, Kondensatausfall<br />
4.5 mehrstufige Verdichtung,<br />
4.6 Pneumatische Elemente, Ventilbauarten, Betriebscharakteristik, Blendengleichung<br />
4.7 Beispielhafte Druckluftsysteme: Anlassluft, Steuerluft, Störungsbeispiele (DNV-Casualty<br />
Information)<br />
4.8 Labor (Dipl.-Ing. Tove Möller)<br />
4.8.1 Untersuchungen an einem Axialventilator (Ermittlung von<br />
Anlagen- <strong>und</strong> Ventilatorkennlinien,<br />
Geschwindigkeitsdreiecke, Aufnahme eines<br />
Strömungsprofils)<br />
4.8.2 Untersuchungen an einem Hubkolbenverdichter (p-V-<br />
Diagramme, Ermittlung von Wirkungs-, Füllungs-, <strong>und</strong><br />
Liefergrad)<br />
4.8.3 CBT: http://www.fh-flensburg.de/watter/IMA/CBT-<br />
Maschinensimulation_UNITEST.pdf<br />
� C.P.Propeller Installation<br />
� Fixed Delivery Pump Steering Gear Inst.<br />
� Variable Delivery Pump Steering Gear<br />
� Marine Pumps<br />
53
V 21.3 Arbeitsmaschinen Labor<br />
Modulkennziffer 21<br />
Zugehörige Veranstaltung V 21.3 Arbeitsmaschinen Labor<br />
Dozentinnen/Dozenten Prof. Dr.-Ing. Holger Watter; Dipl.-Ing. Tove Möller<br />
Position im Studienverlauf 6. Fachsemester<br />
Angebotsrhythmus Beginn jedes Wintersemester<br />
Semesterwochenst<strong>und</strong>en 1<br />
Workload (Zeitst<strong>und</strong>en) Präsenz: 30 Selbststudium: 30<br />
ECTS-Leistungspunkte (CP) 2<br />
Sprache Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />
Lehr- <strong>und</strong> Lernformen Labor<br />
Prüfung (Form, Dauer) Erforderlich für Anerkennung Anlagentechnik<br />
Teilnahmevoraussetzungen Orientierungsprüfung<br />
Kompetenzziele fachlich-inhaltliche Kompetenzen<br />
Die Studierenden sind in der Lage,<br />
� Geräte <strong>und</strong> Verfahren zur Messung des statischen <strong>und</strong><br />
dynamischen Betriebsverhaltens von Arbeitsmaschinen zu<br />
benennen<br />
� für die jeweilige Messung das geeignete Verfahren <strong>und</strong><br />
Geräte auszuwählen <strong>und</strong> sicher anzuwenden<br />
� die Messergebnisse in entsprechenden Kennfeldern<br />
darzustellen.<br />
� geeignete Meßverfahren auszuwählen <strong>und</strong> das Betriebs-<br />
sowie das Regelverhalten von Arbeitsmaschinen beurteilen<br />
zu können.<br />
Schlüsselkompetenzen<br />
Die Studierenden sind in der Lage,<br />
� Teamfähigkeit <strong>und</strong><br />
� Promlemlösungsfertigkeiten zu demonstrieren.<br />
Inhalte � Messung thermischer, mechanischer <strong>und</strong> elektrischer Größen<br />
� Analoge <strong>und</strong> digitale Meßverfahren, AD/DA – Wandler<br />
Messfehler <strong>und</strong> Fehlerfortpflanzungsgesetze<br />
STCW - Bezug Fachpraktische <strong>und</strong> fachtheoretische Anforderungen zu<br />
Wartung, Betrieb <strong>und</strong> Instandhaltung gem. Tab. A-III/1 <strong>und</strong> A-<br />
III/2 Übereinkommens.<br />
Literatur<br />
Name:<br />
Unterschrift: Datum:<br />
54
M 22 Verbrennungskraftmaschinen<br />
Modulkennziffer 22<br />
Modulname Verbrennungskraftmaschinen<br />
Modultyp Pflichtmodul<br />
Position im Studienverlauf 5. <strong>und</strong> 6. Fachsemester<br />
Angebotsrhythmus Beginn jedes Sommersemester<br />
Beginn jedes Wintersemester<br />
Modulbeauftragter Prof. Dr.-Ing. Peter Boy<br />
Dozentinnen / Dozenten Prof. Dr.-Ing. Peter Boy<br />
Semesterwochenst<strong>und</strong>en 10<br />
Workload (Zeitst<strong>und</strong>en) Präsenz: 150 Selbststudium: 150<br />
ECTS-Leistungspunkte (CP) 11<br />
Sprache Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />
Lehr- <strong>und</strong> Lernformen 2x Vorlesung, Übungen<br />
1x Labor<br />
Prüfung (Form, Dauer) Prüfungsleistung (PL):<br />
1 Klausur, 120 Minuten<br />
Teilnahmevoraussetzungen Orientierungsprüfung<br />
Kompetenzziele fachlich-inhaltliche Kompetenzen<br />
Die Studierenden sind in der Lage, die Wirkungsweise einer<br />
Verbrennungskraftmaschine zu erkennen <strong>und</strong> die Einflüsse auf<br />
den Schiffsantrieb sowie den Schiffsbetrieb allgemein zu<br />
beurteilen. Die Kenntnis der Funktion von einzelnen<br />
Komponenten, deren Wirkungsweise <strong>und</strong> ihr Zusammenspiel sind<br />
für die Beurteilung des Betriebsverhaltens erforderlich <strong>und</strong> stehen<br />
im Vordergr<strong>und</strong> der Wissensvermittlung<br />
Schlüsselkompetenzen<br />
Die Studierenden sind in der Lage, Zusammenhänge zu begreifen<br />
<strong>und</strong> daraus Schlüsse zu ziehen, die sie wiederum auch in die Lage<br />
versetzen, nicht nur Schiffsmotorenanlagen zu fahren, sondern<br />
auch präventiv Schäden zu vermeiden bzw. bei auftretenden<br />
Fehlern, geeignete Maßnahmen zur Minimierung von Schäden zu<br />
ergreifen.<br />
zugeordnete Veranstaltungen V 22.1: Verbrennungskraftmaschinen 1<br />
V 22.2: Verbrennungskraftmaschinen 2<br />
V 22.3: Verbrennungskraftmaschinen 2 Labor<br />
Beschreibung der Veranstaltungen siehe Tabellen V 22.1 <strong>und</strong> V 22.2 <strong>und</strong> V 22.3<br />
Name:<br />
Unterschrift: Datum:<br />
55
V 22.1 Verbrennungskraftmaschinen 1<br />
Modul 22 Verbrennungskraftmaschinen<br />
zugehörige Veranstaltung V 22.1 Verbrennungskraftmaschinen 1<br />
Dozentinnen / Dozenten Prof. Dr.-Ing. Peter Boy<br />
Position im Studienverlauf 5. Fachsemester<br />
Angebotsrhythmus Beginn jedes Wintersemester<br />
Semesterwochenst<strong>und</strong>en 4<br />
Workload (Zeitst<strong>und</strong>en) Präsenz: 60 Selbststudium: 60<br />
ECTS-Leistungspunkte (CP) 4<br />
Sprache Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />
Lehr- <strong>und</strong> Lernformen Vorlesung<br />
Prüfung (Form, Dauer) Zusammen mit Verbrennungskraftmaschinen 2<br />
Teilnahmevoraussetzungen Orientierungsprüfung<br />
Kompetenzziele fachlich-inhaltliche Kompetenzen<br />
Die Studierenden sind in der Lage, die Gr<strong>und</strong>lagen von<br />
Verbrennungskraftmaschinen zu erfassen. Sie können<br />
thermodynamische <strong>und</strong> mechanische Abhängigkeiten erkennen<br />
<strong>und</strong> die Wirkungsweise von Schiffsmotoren erklären.<br />
Schlüsselkompetenzen<br />
Die Studierenden sind in der Lage, Prozesse, Entwicklungen,<br />
Funktionen <strong>und</strong> Probleme von Verbrennungskraftmaschinen<br />
beurteilen. Planungs- <strong>und</strong> Problemlösungsfertigkeiten sowie<br />
Anwendungsorientierung werden vermittelt.<br />
.<br />
Inhalte 1. Gr<strong>und</strong>lagen von Dieselmotoren <strong>und</strong> Gasturbinen, Klassifizierung<br />
<strong>und</strong> Einordnung,<br />
2. Betriebstoffe für Dieselmotoren <strong>und</strong> Gasturbinen, Anwendung<br />
3. Energieumwandlung, ideale <strong>und</strong> reale Arbeitsverfahren- <strong>und</strong><br />
prozesse<br />
4. Leistungen <strong>und</strong> Kenngrößen<br />
4. Gaswechsel von 2 <strong>und</strong> 4 Takt Motoren<br />
5. Einspritzung, Zündverzug <strong>und</strong> Verbrennung<br />
6. Emissionen, Entstehung <strong>und</strong> Vermeidung von Schademissionen<br />
STCW - Bezug Fachpraktische <strong>und</strong> fachtheoretische Anforderungen zu Wartung,<br />
Betrieb <strong>und</strong> Instandhaltung gem. Tab. A-III/1 <strong>und</strong> A-III/2<br />
Übereinkommens.<br />
Literatur Bernhardt, Meier-Peter; Handbuch Schiffsbetriebstechnik<br />
Mollenhauer; Handbuch Dieselmotoren<br />
Van Basshuysen; Handbuch Verbrennungsmotor<br />
Name:<br />
Unterschrift: Datum:<br />
56
V 22.2 Verbrennungskraftmaschinen 2<br />
Modul 18 Kraftmaschinen<br />
zugehörige Veranstaltung V 18.2 Verbrennungskraftmaschinen 2<br />
Dozentinnen / Dozenten Prof. Dr.-Ing. Peter Boy<br />
Position im Studienverlauf 6. Fachsemester<br />
Angebotsrhythmus Beginn jedes Wintersemester<br />
Semesterwochenst<strong>und</strong>en 4<br />
Workload (Zeitst<strong>und</strong>en) Präsenz: 60 Selbststudium: 60<br />
ECTS-Leistungspunkte (CP) 5<br />
Sprache Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />
Lehr- <strong>und</strong> Lernformen Vorlesung<br />
Prüfung (Form, Dauer) Prüfungsleistung (PL):<br />
1 Klausur, 120 Minuten<br />
Teilnahmevoraussetzungen Orientierungsprüfung<br />
Kompetenzziele fachlich-inhaltliche Kompetenzen<br />
Die Studierenden sind in der Lage, das Betriebsverhalten von<br />
Schiffsmotoren <strong>und</strong> Schiffsgasturbinen zu beurteilen <strong>und</strong><br />
Maßnahmen zu ergreifen, die für einen sicheren<br />
Schiffsmaschinenbetrieb erforderlich sind.<br />
Schlüsselkompetenzen<br />
Die Studierenden sind in der Lage, Zusammenhänge zu erkennen,<br />
die für einen sicheren Schiffsbetrieb erforderlich sind.<br />
Inhalte 1. Aufladung von Dieselmotoren<br />
2. Instandhaltung von Verbrennungskraftmaschinen <strong>und</strong> Anlagen<br />
3. Betriebsverhalten von Schiffsmotoren<br />
4. Motorkomponenten, Wirkungsweise <strong>und</strong> typische Schäden <strong>und</strong><br />
Probleme. Neue Entwicklungen<br />
5. Zusammenwirken Motor-Schiff<br />
6. Gasturbinenanlagen, Aufbau <strong>und</strong> Wirkungsweise<br />
7. Betrieb von Schiffsgasturbinenanlagen<br />
STCW - Bezug Fachpraktische <strong>und</strong> fachtheoretische Anforderungen zu Wartung,<br />
Betrieb <strong>und</strong> Instandhaltung gem. Tab. A-III/1 <strong>und</strong> A-III/2<br />
Übereinkommens.<br />
Literatur Bernhardt, Meier-Peter; Handbuch Schiffsbetriebstechnik<br />
Mollenhauer; Handbuch Dieselmotoren<br />
Van Basshuysen; Handbuch Verbrennungsmotor<br />
Moeck; Schiffsmaschinenbetrieb<br />
Name:<br />
Unterschrift: Datum:<br />
57
V 22.3 Verbrennungskraftmaschinen 2 Labor<br />
Modul 22 Kraftmaschinen<br />
zugehörige Veranstaltung V 22.3 Verbrennungskraftmaschinen 2 Labor<br />
Dozentinnen / Dozenten Prof. Dr.-Ing. Peter Boy; Dipl.-Ing. Tove Möller<br />
Position im Studienverlauf 6. Fachsemester<br />
Angebotsrhythmus Beginn jedes Wintersemester<br />
Semesterwochenst<strong>und</strong>en 2<br />
Workload (Zeitst<strong>und</strong>en) Präsenz: 30 Selbststudium: 30<br />
ECTS-Leistungspunkte (CP) 2<br />
Sprache Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />
Lehr- <strong>und</strong> Lernformen Labor<br />
Prüfung (Form, Dauer) Erforderlich für die Anerkennung Verbrennungskraftmaschinen 2<br />
Teilnahmevoraussetzungen Orientierungsprüfung<br />
Kompetenzziele fachlich-inhaltliche Kompetenzen<br />
Die Studierenden sind in der Lage,<br />
� Messungen an Verbrennungskraftmaschinen<br />
durchzuführen, Betriebswerte aufzunehmen, auszuwerten<br />
<strong>und</strong> zu beurteilen.<br />
� geeignete Messprinzipien zur Erfassung typischer<br />
Betriebswerte anzuwenden, um den Betriebszustand einer<br />
Antriebsmaschine beurteilen zu können.<br />
Schlüsselkompetenzen<br />
Die Studierenden sind in der Lage,<br />
� erlerntes Wissen anzuwenden.<br />
Inhalte 1. Betriebsverhalten von Dieselmotoren, Aufnahme des<br />
Verbrauchskennfeldes, Zylinderdruckmessung, Ermittlung der<br />
Heizgesetze, Leistungsermittlung<br />
2. Ladungswechsel <strong>und</strong> Aufladung von Dieselmotoren, Ermittlung<br />
der Wärmebilanz, Erfassung <strong>und</strong> Beurteilung von<br />
Motorbetriebsdaten<br />
3. Betriebsverhalten von Gasturbinen, Aufnahme des<br />
Betriebskennfeldes<br />
STCW - Bezug Fachpraktische <strong>und</strong> fachtheoretische Anforderungen zu Wartung,<br />
Betrieb <strong>und</strong> Instandhaltung gem. Tab. A-III/1 <strong>und</strong> A-III/2<br />
Übereinkommens.<br />
Literatur Kuratle; Messen an Verbrennungsmotoren<br />
Name:<br />
Unterschrift: Datum:<br />
58
M 23 Schiffbau<br />
Modulkennziffer 23<br />
Modulname Schiffbau<br />
Modultyp Pflichtmodul<br />
Position im Studienverlauf 5. <strong>und</strong> 6. Fachsemester<br />
Angebotsrhythmus Beginn jedes Sommersemester<br />
Beginn jedes Wintersemester<br />
Modulbeauftragter<br />
Dozentinnen / Dozenten<br />
Semesterwochenst<strong>und</strong>en 6<br />
Workload (Zeitst<strong>und</strong>en) Präsenz: 150 Selbststudium: 120<br />
ECTS-Leistungspunkte (CP) 9<br />
Sprache Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />
Lehr- <strong>und</strong> Lernformen 3x Vorlesung, Übungen<br />
Prüfung (Form, Dauer) 1 Prüfungsleistung (PL):1 Klausur, 60 Minuten<br />
2 Studienleistungen (SL): 2 Klausuren, 60 Minuten<br />
Teilnahmevoraussetzungen Orientierungsprüfung<br />
Kompetenzziele fachlich-inhaltliche Kompetenzen<br />
Schlüsselkompetenzen<br />
zugeordnete Veranstaltungen V 23.1: Strömungslehre<br />
V 23.2: Gr<strong>und</strong>lagen Schiffbau<br />
V 23.3: Schiffssicherheit<br />
Beschreibung der Veranstaltungen siehe Tabellen V 23.1 <strong>und</strong> V 23.2 <strong>und</strong> V 23.3<br />
Name:<br />
Unterschrift: Datum:<br />
V 23.1 Strömungslehre<br />
Modul 23 Schiffbau<br />
zugehörige Veranstaltung V 23.1 Strömungslehre<br />
Dozentinnen / Dozenten Dr. van Radecke<br />
Position im Studienverlauf 5. Fachsemester<br />
Angebotsrhythmus Beginn jedes Sommersemester<br />
Semesterwochenst<strong>und</strong>en 2<br />
Workload (Zeitst<strong>und</strong>en) Präsenz: 30 Selbststudium: 60<br />
ECTS-Leistungspunkte (CP) 3<br />
Sprache Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />
Lehr- <strong>und</strong> Lernformen Vorlesung<br />
Prüfung (Form, Dauer) Studienleistung (SL): 1 Klausur, 60 Minuten<br />
Teilnahmevoraussetzungen Orientierungsprüfung<br />
59
Kompetenzziele fachlich-inhaltliche Kompetenzen<br />
Schlüsselkompetenzen<br />
�<br />
Inhalte<br />
STCW - Bezug Fachpraktische <strong>und</strong> fachtheoretische Anforderungen zu Wartung,<br />
Betrieb <strong>und</strong> Instandhaltung gem. Tab. A-III/1 <strong>und</strong> A-III/2<br />
Übereinkommens.<br />
Literatur<br />
Name:<br />
Unterschrift: Datum:<br />
V 23.2 Schiffbau<br />
Modul 23 Schiffbau<br />
zugehörige Veranstaltung V 23.2 Gr<strong>und</strong>lagen Schiffbau<br />
Dozentinnen / Dozenten<br />
Position im Studienverlauf 5. Fachsemester<br />
Angebotsrhythmus Beginn jedes Sommersemester<br />
Semesterwochenst<strong>und</strong>en 2<br />
Workload (Zeitst<strong>und</strong>en) Präsenz: 30 Selbststudium: 60<br />
ECTS-Leistungspunkte (CP) 3<br />
Sprache Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />
Lehr- <strong>und</strong> Lernformen Vorlesung<br />
Prüfung (Form, Dauer) Prüfungsleistung (PL): 1Klausur, 60 Minuten<br />
Teilnahmevoraussetzungen Orientierungsprüfung<br />
Kompetenzziele fachlich-inhaltliche Kompetenzen<br />
Die Studierenden verfügen über gr<strong>und</strong>legende Kenntnisse des<br />
Schiffbaus, um die Seetüchtigkeit <strong>und</strong> Sicherheit eines Schiffes zu<br />
gewährleisten <strong>und</strong> die Schwimmfähigkeit beurteilen zu können.<br />
Schlüsselkompetenzen<br />
� . /.<br />
Inhalte Werkstoffe.<br />
Hydromechanik <strong>und</strong> -dynamik (Auftrieb),<br />
Schwimmfähigkeit <strong>und</strong> Stabilität.<br />
Gr<strong>und</strong>kenntnisse des Schiffbaus <strong>und</strong> der Schiffsverbände sowie<br />
der korrekten Bezeichnungen der verschiedenen Teile.<br />
Fertigkeiten im Lesen von Zeichnungen <strong>und</strong> Plänen,<br />
- Linienriss, Spantriss, Hauptspant, Generalplan,<br />
Einrichtung <strong>und</strong> Ausrüstung<br />
- Schiffselemente. Entwurfsziele.<br />
- Schiffstypen<br />
- Klassifikation<br />
- Freibordabkommen (Freibordberechnung)<br />
- Schiffsvermessung (Messbrief: BRZ, NRZ))<br />
60
- Wartung <strong>und</strong> Instandsetzung im Schiffsbetrieb, Korrosionsschutz,<br />
Kräne, Hebezeuge<br />
- stark beanspruchte Schiffsverbände in Bezug auf Festigkeit<br />
(Ermüdung) <strong>und</strong> Korrosion (A. 866)<br />
- Bau- <strong>und</strong> Reparaturaufsicht.<br />
Werftabläufe, Aufgaben der Versuchsanstalten,<br />
Schiffswiderstand <strong>und</strong> Propulsion,<br />
Propellertheorie, Schuberzeuger, Propellerauswahl.<br />
Propellererregte Schwingungen (Vibration)<br />
STCW - Bezug Fachpraktische <strong>und</strong> fachtheoretische Anforderungen zu Wartung,<br />
Betrieb <strong>und</strong> Instandhaltung gem. Tab. A-III/1 <strong>und</strong> A-III/2<br />
Übereinkommens.<br />
Literatur VDSM (Hrsg.): <strong>Schiffstechnik</strong> <strong>und</strong> Schiffbautechnologie<br />
R. Schmitz (Script): Schiffbauk<strong>und</strong>e für Nautiker.<br />
Meier-Peter/ Bernhard (Hrsg.): Handbuch der<br />
Schiffsbetriebstechnik.<br />
EXPO 2000, EXPO am Meer (Hrsg.): Leidenschaft Schiffbau.<br />
Name:<br />
Unterschrift: Datum:<br />
V 23.3 Schiffssicherheit<br />
Modul 23 Schiffbau<br />
zugehörige Veranstaltung V 23.3 Schiffssicherheit<br />
Dozentinnen / Dozenten<br />
Position im Studienverlauf 6. Fachsemester<br />
Angebotsrhythmus Beginn jedes Wintersemester<br />
Semesterwochenst<strong>und</strong>en 2<br />
Workload (Zeitst<strong>und</strong>en) Präsenz: 30 Selbststudium: 60<br />
ECTS-Leistungspunkte (CP) 3<br />
Sprache Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />
Lehr- <strong>und</strong> Lernformen<br />
Prüfung (Form, Dauer) Studienleistung (SL): 1 Klausur, 60 Minuten<br />
Teilnahmevoraussetzungen Orientierungsprüfung<br />
Kompetenzziele fachlich-inhaltliche Kompetenzen<br />
Schlüsselkompetenzen<br />
�<br />
Inhalte<br />
STCW - Bezug Fachpraktische <strong>und</strong> fachtheoretische Anforderungen zu Wartung,<br />
Betrieb <strong>und</strong> Instandhaltung gem. Tab. A-III/1 <strong>und</strong> A-III/2<br />
Übereinkommens.<br />
Literatur<br />
61
Name:<br />
Unterschrift: Datum:<br />
M 24 Dampfanlagen<br />
Modulkennziffer 24<br />
Modulname Dampfanlagen<br />
Modultyp Pflichtmodul<br />
Position im Studienverlauf 5. <strong>und</strong> 6. Fachsemester<br />
Angebotsrhythmus Beginn jedes Sommersemester<br />
Beginn jedes Wintersemester<br />
Modulbeauftragter Prof. Dr.-Ing. Ilja Tuschy<br />
Dozentinnen / Dozenten Prof. Dr.-Ing. Ilja Tuschy<br />
Semesterwochenst<strong>und</strong>en 4<br />
Workload (Zeitst<strong>und</strong>en) Präsenz: 60 Selbststudium: 60<br />
ECTS-Leistungspunkte (CP) 4<br />
Sprache Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />
Lehr- <strong>und</strong> Lernformen 2x Vorlesung<br />
Prüfung (Form, Dauer) Prüfungsleistung (PL):<br />
1 Klausur, 120 Minuten<br />
Teilnahmevoraussetzungen Orientierungsprüfung für Veranstaltungen ab Semester 4<br />
Kompetenzziele Siehe Veranstaltungen<br />
zugeordnete Veranstaltungen V 24.1: Dampfanlagen 1<br />
V 24.2: Dampfanlagen 2<br />
Beschreibung der Veranstaltungen siehe Tabellen V 24.1 <strong>und</strong> V 24.2<br />
Name:<br />
Unterschrift: Datum:<br />
62
V 24.1 Dampfanlagen 1<br />
Modul 24 Dampfanlagen<br />
zugehörige Veranstaltung V 24.1 Dampfanlagen 1<br />
Dozentinnen / Dozenten Prof. Dr.-Ing. Ilja Tuschy<br />
Position im Studienverlauf 5. Fachsemester<br />
Angebotsrhythmus Beginn jedes Wintersemester<br />
Semesterwochenst<strong>und</strong>en 2<br />
Workload (Zeitst<strong>und</strong>en) Präsenz: 30 Selbststudium: 30<br />
ECTS-Leistungspunkte (CP) 2<br />
Sprache Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />
Lehr- <strong>und</strong> Lernformen Vorlesung<br />
Prüfung (Form, Dauer) Zusammen mit Dampfanlagen II<br />
Teilnahmevoraussetzungen Keine<br />
Kompetenzziele fachlich-inhaltliche Kompetenzen<br />
Die Studierenden können rechnerisch sicher mit dem<br />
Arbeitsmedium Wasser/Dampf umgehen <strong>und</strong> beherrschen die<br />
gängigen Berechnungsverfahren für Dampfanlagen. Sie kennen<br />
den Aufbau <strong>und</strong> die Wirkungsweise von Dampfkraftanlagen <strong>und</strong><br />
können entsprechende Anlagen technisch bewerten. Sie sind in<br />
der Lage Verbesserungspotenziale für bestehende Anlagen zu<br />
benennen <strong>und</strong> diese quantitativ <strong>und</strong> qualitativ anzuschätzen.<br />
Schlüsselkompetenzen<br />
Die Studierenden können sich in für Sie neue<br />
Anlagenkonfigurationen einfinden <strong>und</strong> erkennen Dampfanlagen als<br />
ein Beispiel von Ingenieursarbeit, in der verschiedene<br />
Fachdisziplinen zusammenfinden.<br />
Inhalte 1. Historische Entwicklung von Dampfanlagen<br />
2. Darstellung von Dampfanlagen in Symbolen<br />
3. Rechnerischer Umgang mit dem Arbeitsmedium Wasser/Dampf<br />
4. Aufbau von Dampfkraftprozessen<br />
5. Weiterentwicklung von Dampfkraftprozessen<br />
6. Kraft-Wärme-Kopplung in Dampfanlagen<br />
7. Anlagenbetrieb von Dampfkraftprozessen<br />
STCW-Anforderungen: Fachpraktische <strong>und</strong> fachtheoretische Anforderungen zu Wartung,<br />
Betrieb <strong>und</strong> Instandhaltung gem. Tab. A-III/1 <strong>und</strong> A-III/2<br />
Übereinkommens.<br />
Literatur Bohn (Hrsg): Handbuchreihe Energie: Konzeption <strong>und</strong> Aufbau von<br />
Dampfkraftwerken<br />
Strauß: Kraftwerkstechnik<br />
VGB: VGB Powertech (Zeitschrift)<br />
VDI: BWK (Zeitschrift)<br />
Name:<br />
Unterschrift: Datum:<br />
63
V 24.2 Dampfanlagen 2<br />
Modul 24 Dampf<br />
zugehörige Veranstaltung V 24.2 Dampfanlagen 2<br />
Dozentinnen / Dozenten Prof. Dr.-Ing. Holger Watter<br />
Prof. Dr.-Ing. Michael Thiemke<br />
Position im Studienverlauf 6. Fachsemester<br />
Angebotsrhythmus Beginn jedes Sommersemester<br />
Semesterwochenst<strong>und</strong>en 2<br />
Workload (Zeitst<strong>und</strong>en) Präsenz: 30 Selbststudium: 30<br />
ECTS-Leistungspunkte (CP) 2<br />
Sprache Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />
Lehr- <strong>und</strong> Lernformen Vorlesung<br />
Prüfung (Form, Dauer) Prüfungsleistung (PL):<br />
1 Klausur, 120 Minuten<br />
Teilnahmevoraussetzungen Orientierungsprüfung<br />
Kompetenzziele fachlich-inhaltliche Kompetenzen<br />
Die Studierenden kennen Aufbau <strong>und</strong> Wirkungsweise der<br />
wichtigsten Einzelkomponenten von Dampfanlagen in der Praxis.<br />
Sie sind in der Lage für unterschiedliche Anwendungen passende<br />
Bauarten einzelner Komponenten auszuwählen, <strong>und</strong> können die<br />
entsprechenden Komponenten ingenieurmäßig beschreiben <strong>und</strong><br />
berechnen, wobei sie die Anforderungen der Gesamtanlage im<br />
Auge behalten Auf dieser Basis sind Sie in der Lage die<br />
Zweckmäßigkeit <strong>und</strong> den technischen Stand von Komponenten in<br />
komplexen Anlagen zu beurteilen.<br />
Schlüsselkompetenzen<br />
Die Studenten können dadurch mit Fachleuten der angrenzenden<br />
Disziplinen interdisziplinär zusammenarbeiten.<br />
Inhalte 1. Dampferzeugerbauarten <strong>und</strong> praktische Anwendung<br />
2. Aufbau <strong>und</strong> Funktionsweise verschiedener Dampferzeugertypen<br />
3. Verschiedene Arten von Feuerungen<br />
4. Aufbau <strong>und</strong> Funktionsweise von technischen Brennern<br />
7. Technischer Betrieb von Feuerungen<br />
8. Sicherheitseinrichtungen <strong>und</strong> –maßnahmen an Dampferzeugern<br />
<strong>und</strong> Feuerungen, wie Flammenüberwachung, Meß- <strong>und</strong><br />
Regeleinrichtungen<br />
9. Übersicht über Dampfturbinen<br />
10. Dampfturbinenbauarten<br />
11. Dampfturbinenbetrieb<br />
STCW - Bezug Fachpraktische <strong>und</strong> fachtheoretische Anforderungen zu Wartung,<br />
Betrieb <strong>und</strong> Instandhaltung gem. Tab. A-III/1 <strong>und</strong> A-III/2<br />
Übereinkommens.<br />
Literatur Bohn (Hrsg): Handbuchreihe Energie: Konzeption <strong>und</strong> Aufbau von<br />
Dampfkraftwerken<br />
64
Strauß: Kraftwerkstechnik<br />
VGB: VGB Powertech (Zeitschrift)<br />
VDI: BWK (Zeitschrift)<br />
Name:<br />
Unterschrift: Datum:<br />
V 24.3 Dampfanlagen Labor<br />
Modul 24 Dampfanlagen<br />
zugehörige Veranstaltung V 24.3 Dampfanlagen 2 Labor<br />
Dozentinnen / Dozenten Prof. Dr.-Ing. Holger Watter<br />
Prof. Dr.-Ing. Michael Thiemke<br />
Position im Studienverlauf 5.Fachsemester<br />
Angebotsrhythmus Beginn jedes Wintersemester<br />
Semesterwochenst<strong>und</strong>en 2<br />
Workload (Zeitst<strong>und</strong>en) Präsenz: 30 Selbststudium: 30<br />
ECTS-Leistungspunkte (CP) 2<br />
Sprache Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />
Lehr- <strong>und</strong> Lernformen Labor<br />
Prüfung (Form, Dauer) Erforderlich für Anerkennung Dampfanlagen 2<br />
Teilnahmevoraussetzungen Orientierungsprüfung<br />
Kompetenzziele fachlich-inhaltliche Kompetenzen<br />
Die Studierenden sind in der Lage, sich selbstständig in eine<br />
komplexe energietechnische Anlage einzufinden <strong>und</strong> die für deren<br />
Betrieb wesentlichen technischen <strong>und</strong> formalen Randbedingungen<br />
zu erfassen. Sie können nach Einarbeitung bei der Betriebsleitung<br />
mitwirken.<br />
Schlüsselkompetenzen<br />
Die Studierenden sind in der Lage den Betrieb technischer<br />
Anlagen in Berichtsform zu dokumentieren <strong>und</strong> bewerten.<br />
Sie lernen Informationen zu verarbeiten. Die Arbeit im Labor<br />
fördert die Teamfähigkeit.<br />
Inhalte 1. Erläuterung der Dampfkesselverordnung mit den Technische<br />
Regeln für Dampfkessel<br />
2. Sicherheitsvorschriften für den Betrieb von Dampfanlagen<br />
(TRD)3. Befähigung <strong>zum</strong> Kesselwärter nach Dampfkessel VO<br />
3. Praktische Untersuchungen <strong>zum</strong> Betrieb von Dampferzeugern<br />
4. Praktische Untersuchungen <strong>zum</strong> Betrieb von Dampfturbinen<br />
5. Praktische Untersuchungen <strong>zum</strong> Betrieb von Dampfkraftwerken<br />
6. Praktische Untersuchungen zur Kraft-Wärme-Kopplung in<br />
Dampfanlagen<br />
STCW - Bezug Fachpraktische <strong>und</strong> fachtheoretische Anforderungen zu Wartung,<br />
Betrieb <strong>und</strong> Instandhaltung gem. Tab. A-III/1 <strong>und</strong> A-III/2<br />
Übereinkommens.<br />
Literatur Bohn (Hrsg): Handbuchreihe Energie: Konzeption <strong>und</strong> Aufbau von<br />
Dampfkraftwerken<br />
65
Strauß: Kraftwerkstechnik<br />
VGB: VGB Powertech (Zeitschrift)<br />
VDI: BWK (Zeitschrift)<br />
Name:<br />
Unterschrift: Datum:<br />
1. Schiffsdampfsysteme<br />
- Elemente des Kreislaufs (Kondensator, Turbine, Wärmeübertrager….)<br />
- Prozessvarianten (Kombi-Prozesse, Turbogenerator, Kernenergie….)<br />
- Rohrleitungssysteme (Dampf-, Kondensatleitungen, Kondensatableiter … Dimensionierung<br />
Festigkeit <strong>und</strong> Strömungszustand, Nachverdampfung ….)<br />
2. Schiffsdampfkessel<br />
- Aufbau <strong>und</strong> Funktionsweise verschiedener Dampferzeugertypen<br />
- Wärmeübertragung, Wärmeleitung, Wärmeübergang<br />
- Rauchrohrkessel, Wasserrohrkessel: Naturumlauf, Zwangsumlauf, Zwangsdurchlauf<br />
- Strahlungs- <strong>und</strong> Konvektionsflächen<br />
- Regelung der Überhitzeraustrittstemp.<br />
- Rippenrohr, Gattrohr<br />
- Korrosion; Rohrbefestigungen; Kombikessel; Verschmutzungen<br />
- Kesselausrüstung; Sicherheitseinrichtungen <strong>und</strong> –maßnahmen an Dampferzeugern <strong>und</strong><br />
Feuerungen, wie Flammenüberwachung, Mess- <strong>und</strong> Regeleinrichtungen<br />
- Kondensatableiter<br />
3. Feuerungstechnik<br />
- Aufbau <strong>und</strong> Funktionsweise von technischen Brennern<br />
- Technischer Betrieb von Feuerungen<br />
4. Betrieb von Schiffdampfanlagen<br />
- Anfahren, Stillstand, Schwachlast, Vollast<br />
- Abschlämmen<br />
- Abschalten<br />
- Besichtigungen <strong>und</strong> Prüfungen<br />
- Schadensbeispiele<br />
- Korrosion (wasser- <strong>und</strong> rauchgasseitig)<br />
- Abgaskesselbrand<br />
- Instandhaltung <strong>und</strong> Pflege<br />
5. Dampfturbinen<br />
- Übersicht über Dampfturbinen<br />
- Dampfturbinenbauarten<br />
- Dampfturbinenbetrieb<br />
Labor: Kesselsimulator/Brennersicherheitskette<br />
Werft-/Kraftwerksbesuch<br />
CBT: http://www.fh-flensburg.de/watter/IMA/CBT-Maschinensimulation_UNITEST.pdf<br />
� Auxiliary Steam Boiler Installation<br />
� Steam Turbine System<br />
� Comb. Oil Fired and Exhaust Gas Boiler<br />
� Marine Heat Exchangers<br />
66
M 25 Gefahrstoffe<br />
Modulkennziffer 25<br />
Modulname Gefahrstoffe<br />
Modultyp Pflichtmodul<br />
zugehörige Veranstaltung V 25.1 Gr<strong>und</strong>lagen Gefahrstoffe<br />
Position im Studienverlauf 6. Fachsemester<br />
Angebotsrhythmus Beginn jedes Wintersemester<br />
Modulbeauftragter Dipl.-Ing. Eduard Jäger<br />
Dozentinnen / Dozenten<br />
Semesterwochenst<strong>und</strong>en 2<br />
Workload (Zeitst<strong>und</strong>en) Präsenz: 30 Selbststudium: 30<br />
ECTS-Leistungspunkte (CP) 2<br />
Sprache Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />
Lehr- <strong>und</strong> Lernformen Vorlesung<br />
Prüfung (Form, Dauer) Prüfungsleistung (PL):<br />
1 Klausur, 60 Minuten<br />
Teilnahmevoraussetzungen Orientierungsprüfung<br />
Kompetenzziele fachlich-inhaltliche Kompetenzen<br />
Die Studierenden sind in der Lage,<br />
� Informationen über alle an Bord verwendeten oder zu<br />
transportierenden Gefahrstoffe zu beschaffen<br />
� die Gefährdung von Personen <strong>und</strong>/oder der Umwelt durch die<br />
Stoffe zu beurteilen<br />
� die korrekte Einhaltung der Verpackung <strong>und</strong> Lagerung der<br />
Stoffe an Bord zu beurteilen<br />
� den korrekten Umgang mit den Stoffen zu beurteilen<br />
� Erst- <strong>und</strong> Folgemaßnahmen bei Notfällen zu entwickeln <strong>und</strong><br />
deren Durchführung zu planen <strong>und</strong> zu organisieren<br />
Schlüsselkompetenzen<br />
Die Studierenden sind in der Lage, unter Beachtung der<br />
einschlägigen Sicherheitsvorschriften mit Gefahrstoffen<br />
umzugehen, Mitarbeiter <strong>zum</strong> korrekten Umgang mit<br />
Gefahrstoffen zu unterweisen <strong>und</strong> auf Einhaltung der<br />
Vorschriften anzuhalten, Gefährdungen frühzeitig zu erkennen<br />
<strong>und</strong> geeignete Erst- <strong>und</strong> Folgenmaßnahmen einzuleiten. Die<br />
ökologische Kompetenz sowie das Verantwortungsbewusstsein<br />
der Studierenden werden geschult.<br />
Inhalte � Physikalische, chemische, toxische, Zünd- <strong>und</strong><br />
Brandeigenschaften von Gefahrstoffen<br />
� Lagerung, Transport <strong>und</strong> Anwendung von Gefahrstoffen<br />
� Vorschriften im Umgang mit Gefahrstoffen<br />
� Umweltschutz <strong>und</strong> Entsorgung<br />
STCW - Bezug Fachpraktische <strong>und</strong> fachtheoretische Anforderungen zu<br />
Wartung, Betrieb <strong>und</strong> Instandhaltung gem. Tab. A-III/1 <strong>und</strong> A-<br />
67
III/2 Übereinkommens.<br />
Literatur Meier-Peter/Bernhardt: „Handbuch Schiffsbetriebstechnik“<br />
Name:<br />
Unterschrift: Datum:<br />
M 26 Anlagentechnik<br />
Modulkennziffer 26<br />
Modulname Anlagentechnik<br />
Modultyp Pflichtmodul<br />
Position im Studienverlauf 6. Fachsemester<br />
Angebotsrhythmus Beginn jedes Wintersemester<br />
Modulbeauftragter Prof. Dr.-Ing. Holger Watter<br />
Dozentinnen / Dozenten Prof. Dr.-Ing. Holger Watter<br />
Semesterwochenst<strong>und</strong>en 3<br />
Workload (Zeitst<strong>und</strong>en) Präsenz: 60 Selbststudium: 30<br />
ECTS-Leistungspunkte (CP) 3<br />
Sprache Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />
Lehr- <strong>und</strong> Lernformen 1x Vorlesung<br />
1x Labor<br />
Prüfung (Form, Dauer) Studienleistung (SL):<br />
1 Klausur, 90 Minuten<br />
Teilnahmevoraussetzungen Orientierungsprüfung<br />
Kompetenzziele fachlich-inhaltliche Kompetenzen<br />
Die Studierenden sind in der Lage<br />
� alle für den Betrieb eines Schiffes sowie seiner Einrichtungen<br />
<strong>und</strong> Anlagen erforderlichen Rohrleitungssysteme einschließlich<br />
deren Auslegungsparameter zu benennen<br />
� alle für den Betrieb eines Schiffes <strong>und</strong> seiner Einrichtungen <strong>und</strong><br />
Anlagen erforderlichen Rohrleitungssysteme zu dimensionieren<br />
<strong>und</strong> die zu verwendenden Werkstoffe auszuwählen<br />
� Die Studierenden sind in der Lage, komplexe<br />
Rohrleitungsnetze in Berechnungsmodellen zu abstrahieren<br />
<strong>und</strong> mit Hilfe Analogieverfahren zu beurteilen.<br />
Schlüsselkompetenzen<br />
siehe Tabellen V 26.1 <strong>und</strong> V 26.2<br />
zugeordnete Veranstaltungen V 26.1: Anlagentechnik<br />
V 26.2: Anlagentechnik Labor<br />
Beschreibung der Veranstaltungen siehe Tabellen V 26.1 <strong>und</strong> V 26.2<br />
Name:<br />
Unterschrift: Datum:<br />
68
V 26.1 Anlagentechnik<br />
Modulkennziffer 26 Anlagentechnik<br />
Zugehörige Veranstaltung V 26.1 Anlagentechnik<br />
Dozentinnen/Dozenten<br />
Position im Studienverlauf 6. Fachsemester<br />
Angebotsrhythmus Beginn jedes Wintersemester<br />
Semesterwochenst<strong>und</strong>en 2<br />
Workload (Zeitst<strong>und</strong>en) Präsenz: 30 Selbststudium: 30<br />
ECTS-Leistungspunkte (CP) 2<br />
Sprache Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />
Lehr- <strong>und</strong> Lernformen Vorlesung<br />
Prüfung (Form, Dauer) Studienleistung (SL):<br />
1 Klausur, 90 Minuten<br />
Teilnahmevoraussetzungen Orientierungsprüfung<br />
Kompetenzziele fachlich-inhaltliche Kompetenzen<br />
Die Studierenden verfügen über gr<strong>und</strong>legende Kenntnisse, um:<br />
� die zu installierenden Systeme nach wirtschaftlichen,<br />
sicherheits- <strong>und</strong> versorgungstechnischen Gesichtspunkten zu<br />
gestalten, die Hauptabmessungen zu bestimmen <strong>und</strong><br />
geeignete Werkstoffe auszuwählen<br />
� das dynamische Betriebsverhalten der Systeme zu<br />
bestimmen <strong>und</strong> Sicherheitseinrichtungen zur Vermeidung der<br />
Überschreitung von Grenzwerten auszuwählen<br />
Die Studierenden sind in der Lage, räumlich komplexe Systeme<br />
in eben Strukturen darzustellen.<br />
Schlüsselkompetenzen<br />
Die Problemlösungsfähigkeit der Studierenden wird erweitert.<br />
Inhalte � Gr<strong>und</strong>lagen der konstruktiven Gestaltung von Ver- <strong>und</strong><br />
Entsorgungssystemen<br />
� Gr<strong>und</strong>lagen der Umströmung von Körpern <strong>und</strong> der<br />
Durchströmung von Rohren durch ein- <strong>und</strong> mehrphasige<br />
Stoffe<br />
� Statisches <strong>und</strong> dynamisches Betriebsverhalten von<br />
Rohrleitungssystemen<br />
� Konstruktionselemente im Rohrleitungsbau<br />
� Rohrleitungsstatik<br />
STCW - Bezug Fachpraktische <strong>und</strong> fachtheoretische Anforderungen zu<br />
Wartung, Betrieb <strong>und</strong> Instandhaltung gem. Tab. A-III/1 <strong>und</strong> A-<br />
III/2 Übereinkommens.<br />
Literatur GL: „Bauvorschriften für Seeschiffe“<br />
Meier-Peter/Bernhardt: „Handbuch Schiffsbetriebstechnik“<br />
Name:<br />
Unterschrift: Datum:<br />
69
5. Kälteanlagen<br />
5.1 Thermodynamik der Kälteerzeugung, CARNOT-Prozess, Zustandsänderungen, Leistungszahl,<br />
Wärmeübertragung, Kompression, lg p-h-Diagramm, Anfahren der Anlage<br />
5.2 Marktgängige Kältemittel <strong>und</strong> Alternativkältemittel, ODP, GWP, TEWI, GL-Klassevorschriften,<br />
Eigenschaften der Kältemittel<br />
5.3 Bauteile <strong>und</strong> Komponenten: Anlagenaufbau, Thermoexpansionsventil, Störungsbeispiele<br />
5.4 Schaltungsvarianten: Einstufige <strong>und</strong> mehrstufige Prozesse, Steigerung der Leistungszahl durch<br />
Überhitzung, Unterkühlung, Problemfeld: Lagerung von Kühlcontainern unter Deck,<br />
Absorptionskälteanlage, Dampfstrahlkälteanlage<br />
5.5 Rückverflüssigungsanlagen auf Gastankern<br />
5.6 Übungen<br />
5.7 Labor (Dipl.-Ing. Tove Möller)<br />
5.7.1 Kälteanlage: log p-h-Diagramm, Kälte- <strong>und</strong> Wärmeleistungszahl, Gütegrad<br />
6. Klimaanlagen<br />
6.1 Gr<strong>und</strong>aufbau von Klimananlagen, Betriffe, Betriebszustände, Behaglichkeitsgebiete, Zug<br />
6.2 Zustandänderungen der feuchten Luft (h-x-Diagramm),<br />
6.3 Anlagentechnik, Sommer- <strong>und</strong> Winterbetrieb, Wartung <strong>und</strong> Betrieb, Übungen<br />
6.4 Geräusche: dB, dB[A]<br />
7. Trenn- <strong>und</strong> Aufbereitungsverfahren<br />
7.1 Bauliche Maßnahmen auf Seeschiffen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Öl,<br />
Abwasser <strong>und</strong> Müll (Schiffssicherheitsabteilung D.16), Überblick Trenntechnik, Setztankprinzip<br />
7.2 Separatoren: Funktionsweise, Separiertemperatur, Regulierscheibe, Greifer, Lage der<br />
Trennzone, Einfluss des Durchsatzes, Temperatur <strong>und</strong> Viskosität, Nenndurchsatz, Trennen-<br />
Klären, Schmierölseparation, mechanische Belastungen (Unwucht, biegekritische Drehzahl,<br />
Lagerbelastung durch Kreiselmomente)<br />
7.3 Entöler: Verunreinigungen durch ölhaltige Abfälle, MARPOL Anl. I, Öltagebuch, MEPC. 107(49),<br />
Klassevorschriften, Tankanordnung, Abscheiderprinzipien, Koaleszenz, Emulsion <strong>und</strong><br />
Emulsionsbrecher, 15 ppm Monitor (Streulichtverfahren/Trübung), Betriebserfahrungen <strong>und</strong><br />
Betrieb, Port State Control, Herstellerbeispiele, Übung.<br />
7.4 Frischwassererzeuger: Trinkwasseranforderungen, Entkeimung, Trinkwasseraufbereitung,<br />
Wassereigenschaften (Härte, Kalk-Kohlensäuregleichgewicht, Sättigungsindex (LDS), pH-Wert)<br />
7.4.1 Verdampferprinzip: Tauchrohrverdampfer, Sprühfilmverdampfer,<br />
Entspannungsverdampfer, Rising-Film-Evaporation, Multi-Stage-Evaporation, Multi-Effect-<br />
Evaporation, Plate-Type-Evaporation (Plattenwärmetauscher), Steuerung- <strong>und</strong> Regelung,<br />
Wartung, Betrieb, Instandhaltung, Übungen<br />
7.4.2 Umkehrosmose: Funktionsprinzip, Betriebsparameter, Wartung, Betrieb, Aufbau <strong>und</strong><br />
Betriebsergebnisse einer Beispielanlage.<br />
7.5 Abwasseraufbereitungsanlagen: Problembeschreibung, Abbaumechanismen, MARPOL Anl.<br />
IV; MEPC.2(IV) <strong>und</strong> MEPC.159(55), Schwarzwasser/Grauwasser, Beurteilungsparameter: CSB<br />
(COD), BSB (BOD), AFS (TSS), Kolibakterien, Anforderungen an Schiffsabwasseranlagen,<br />
Verfahrensbeschreibung (3-Kammerbauweise, Belebtschlammverfahren), Ultrafiltration, Wartung,<br />
Betrieb, Instandhaltung, ausgeführte Anlagenbeispiele<br />
7.6 Ballastwasserbehandlungsanlagen: Problembeschreibung, Ballastwassersystem,<br />
Ballastwasserconvention, Ballast Water Exchange Standard (D1), Ballast Water Performance<br />
Standard (D2), Ballast Exchange Plan (BEP); Basic, Final and Type Approval, Prozessvarianten,<br />
Status/Ausblick, Anlagenbeispiele: MAHLE NFV, RWO, HAMANN, ALFA LAVAL, …..<br />
7.7 Filter: Filterarten, -einbauorte, Filterfeinheit, Normung Filterfeinheit (Rückspül- Automatikfilter),<br />
7.8 Inertgas-Anlagen: Tanker safty, Inertgassystem (Molekularsieb, Verbrennung); Inertgaserzeuger,<br />
Gaswäsche, -kühlung, -trocknung; Druckwechselanlagen, Anlagenbeispiele<br />
7.9 Müllverbrennung: MEPC.76(40) Incinerator, Hinweise <strong>zum</strong> Führen des Öltagebuches MEPC 61-<br />
7-1<br />
70
Laborübung:<br />
CBT: http://www.fh-flensburg.de/watter/IMA/CBT-Maschinensimulation_UNITEST.pdf<br />
� Biological Sewage Treatment Plant<br />
� Fuel Oil Treatment Plant<br />
� Hydrophore Installation; Hydrophore Installation 3D<br />
� Oily Water Separator<br />
� Freshwater Generator; Freshwater Generator 3D<br />
� Reverse Osmosis Desalination System<br />
� Refrigeration Plant; Refrigeration Plant 3D<br />
� S-type Separation System<br />
� Fuel Conditioning Module 3D<br />
� Marine Compressors<br />
� Rotary Vane Steering Gear<br />
� Marine Hydraulic Machinery<br />
� Air Conditioning Plant 3D<br />
� EcoStream<br />
Literaturempfehlung:<br />
V 26.2 Anlagentechnik Labor<br />
Modulkennziffer 26 Anlagentechnik<br />
Zugehörige Veranstaltung V 26.2 Anlagentechnik Labor<br />
Dozentinnen/Dozenten Dipl.-Ing. Tove Möller<br />
Position im Studienverlauf 6. Fachsemester<br />
Angebotsrhythmus Beginn jedes Wintersemester<br />
Semesterwochenst<strong>und</strong>en 1<br />
Workload (Zeitst<strong>und</strong>en) Präsenz: 30 Selbststudium:<br />
ECTS-Leistungspunkte (CP) 1<br />
Sprache Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />
Lehr- <strong>und</strong> Lernformen Labor<br />
Prüfung (Form, Dauer) Erforderlich für Anerkennung Anlagentechnik<br />
Teilnahmevoraussetzungen Orientierungsprüfung<br />
Kompetenzziele fachlich-inhaltliche Kompetenzen<br />
Die Studierenden sind in der Lage,<br />
� Geräte <strong>und</strong> Verfahren zur Messung des statischen <strong>und</strong><br />
dynamischen Betriebsverhaltens von Rohrleitungen zu<br />
benennen<br />
� für die jeweilige Messung das geeignete Verfahren <strong>und</strong><br />
Geräte auszuwählen <strong>und</strong> sicher anzuwenden<br />
� die Messergebnisse in entsprechenden Kennlinien oder<br />
Kennfeldern darzustellen.<br />
Schlüsselkompetenzen<br />
Die Studierenden sind in der Lage, geeignete Messverfahren<br />
auszuwählen <strong>und</strong> sicher anzuwenden <strong>und</strong> die Einflüsse<br />
geometrischer <strong>und</strong>/oder stofflicher Veränderungen auf das<br />
71
Betriebsverhalten von Rohrleitungen beurteilen zu können.<br />
Kooperationsfähigkeit wird gefördert.<br />
Inhalte � Messung thermischer, mechanischer <strong>und</strong> elektrischer Größen<br />
� Analoge <strong>und</strong> digitale Meßverfahren, AD/DA – Wandler<br />
� Messfehler <strong>und</strong> Fehlerfortpflanzungsgesetze<br />
STCW - Bezug Fachpraktische <strong>und</strong> fachtheoretische Anforderungen zu<br />
Wartung, Betrieb <strong>und</strong> Instandhaltung gem. Tab. A-III/1 <strong>und</strong> A-<br />
III/2 Übereinkommens.<br />
Literatur Piwinger: „Stellgeräte <strong>und</strong> Armaturen für strömende Stoffe“<br />
Wagner: „Rohrleitungstechnik“<br />
Name:<br />
Unterschrift: Datum:<br />
M 27 Automatisierungstechnik<br />
Modulkennziffer 27<br />
Modulname Automatisierungstechnik<br />
Modultyp Pflichtmodul<br />
Position im Studienverlauf 6. <strong>und</strong> 7. Fachsemester<br />
Angebotsrhythmus Beginn jedes Sommersemester<br />
Beginn jedes Wintersemester<br />
Modulbeauftragter Prof. Dr.-Ing. Jochen Wendiggensen<br />
Dozentinnen / Dozenten Prof. Dr.-Ing. Jochen Wendiggensen<br />
Semesterwochenst<strong>und</strong>en 6<br />
Workload (Zeitst<strong>und</strong>en) Präsenz: 90 Selbststudium: 120<br />
ECTS-Leistungspunkte (CP) 6<br />
Sprache Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />
Lehr- <strong>und</strong> Lernformen 1x Vorlesung<br />
1x Labor<br />
Prüfung (Form, Dauer) Prüfungsleistung (PL):<br />
1Klausur, 120 Minuten<br />
Teilnahmevoraussetzungen Orientierungsprüfung<br />
Kompetenzziele fachlich-inhaltliche Kompetenzen<br />
siehe V27.1 <strong>und</strong> V27.2<br />
Schlüsselkompetenzen<br />
siehe V27.1 <strong>und</strong> V27.2<br />
zugeordnete Veranstaltungen V 27.1: Leittechnik<br />
V 27.2: Leittechnik Labor<br />
Beschreibung der Veranstaltungen siehe Tabellen V 27.1 <strong>und</strong> V 27.2<br />
Name:<br />
Unterschrift: Datum:<br />
72
V 27.1 Leittechnik<br />
Modul 27 Automatisierungstechnik<br />
zugehörige Veranstaltung V 27.1 Leittechnik<br />
Dozentinnen / Dozenten Prof. Dr.-Ing. Jochen Wendiggensen<br />
Position im Studienverlauf 6. Fachsemester<br />
Angebotsrhythmus Beginn jedes Wintersemester<br />
Semesterwochenst<strong>und</strong>en 4<br />
Workload (Zeitst<strong>und</strong>en) Präsenz: 60 Selbststudium: 60<br />
ECTS-Leistungspunkte (CP) 4<br />
Sprache Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />
Lehr- <strong>und</strong> Lernformen Vorlesung<br />
Prüfung (Form, Dauer) Prüfungsleistung (PL):<br />
1Klausur, 120 Minuten<br />
Teilnahmevoraussetzungen Orientierungsprüfung<br />
Kompetenzziele fachlich-inhaltliche Kompetenzen<br />
Schlüsselkompetenzen<br />
Die Studierenden sind in der Lage, die wichtigsten Systeme zur<br />
Erzeugung von Strom an Bord, oder der Maschinensteuerung in<br />
ihrem Aufbau <strong>und</strong> in ihrer Wirkungsweise zu beschreiben.<br />
Durch das Wissen über die in der automatischen Betriebsart<br />
realisierten Funktionen der Systeme sind sie in der Lage<br />
Teilfunktionen bei Ausfall der Systeme händisch auszuführen.<br />
Darüber hinaus können sie komplexere regelungstechnische<br />
Zusammenhänge in R/I-Fließbildern oder Wirkungsplänen<br />
erkennen, verstehen <strong>und</strong> <strong>zum</strong> Teil berechnen.<br />
Inhalte Einführung in Automationsziele an Bord von Schiffen,<br />
Stromerzeugung mit Hilfsdieseln, Electrical Load Balance,<br />
Zeigerdiagramm <strong>und</strong> Erregungsarten der Synchronmaschine,<br />
selbsterregter kompo<strong>und</strong>ierter Synchrongenerator, Insel- <strong>und</strong><br />
Netzbetrieb, Spannungsregelung, Frequenzregelung, Prinzip der<br />
Rückkopplung, Ölhydraulische Regler, Synchronisation<br />
Parallelbetrieb, Berechnung der Lastverteilung, Power-<br />
Management-System, Stabilität von Regelkreisen, Erweiterung der<br />
Regelkreisstruktur, durch Störgrößenaufschaltungen <strong>und</strong><br />
Hilfsregelkreise <strong>und</strong> Kaskadenschaltung, Stromerzeugung mit<br />
Wellengeneratoren, Wellengenerator mit rotierenden Umrichter,<br />
Wellengenerator mit elektronischem Umrichter, Main Engine<br />
Remote Control für Fest- <strong>und</strong> Verstellpropellerantriebe,<br />
Leittechnische Systeme <strong>und</strong> ihre Komponenten.<br />
STCW - Bezug Fachpraktische <strong>und</strong> fachtheoretische Anforderungen zu Wartung,<br />
Betrieb <strong>und</strong> Instandhaltung gem. Tab. A-III/1 <strong>und</strong> A-III/2<br />
Übereinkommens.<br />
Literatur PowerPoint-Folien, Herstellerunterlagen<br />
73
Name:<br />
Unterschrift: Datum:<br />
V 27.2 Leittechnik Labor<br />
Modul 27 Automatisierungstechnik<br />
zugehörige Veranstaltung V 27.2 Leittechnik Labor<br />
Dozentinnen / Dozenten Prof. Dr.-Ing. Jochen Wendiggensen<br />
Position im Studienverlauf 7. Fachsemester<br />
Angebotsrhythmus Beginn jedes Sommersemester<br />
Semesterwochenst<strong>und</strong>en 2<br />
Workload (Zeitst<strong>und</strong>en) Präsenz: 30 Selbststudium: 30<br />
ECTS-Leistungspunkte (CP) 2<br />
Sprache Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />
Lehr- <strong>und</strong> Lernformen Labor<br />
Prüfung (Form, Dauer) Erforderlich für Anerkennung Leittechnik<br />
Teilnahmevoraussetzungen Orientierungsprüfung<br />
Kompetenzziele fachlich-inhaltliche Kompetenzen<br />
Schlüsselkompetenzen<br />
Fehlersuche in einer Hauptmaschinenfernsteuerautomatik,<br />
Abgleich von Synchrongeneratoren in Spannungsstatik <strong>und</strong><br />
Frequenzstatik, Manuelle Synchronisation <strong>und</strong> Parallelbetrieb von<br />
Hilfsdieseln.<br />
Inhalte<br />
STCW - Bezug Fachpraktische <strong>und</strong> fachtheoretische Anforderungen zu Wartung,<br />
Betrieb <strong>und</strong> Instandhaltung gem. Tab. A-III/1 <strong>und</strong> A-III/2<br />
Übereinkommens.<br />
Literatur<br />
Name:<br />
Unterschrift: Datum:<br />
74
M 28 Antriebssysteme<br />
Modulkennziffer 28<br />
Modulname Antriebssysteme<br />
Modultyp Pflichtmodul<br />
Position im Studienverlauf 7. Fachsemester<br />
Angebotsrhythmus Beginn jedes Sommersemester<br />
Modulbeauftragter<br />
Dozentinnen / Dozenten<br />
Semesterwochenst<strong>und</strong>en 4<br />
Workload (Zeitst<strong>und</strong>en) Präsenz: 60 Selbststudium: 90<br />
ECTS-Leistungspunkte (CP) 5<br />
Sprache Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />
Lehr- <strong>und</strong> Lernformen 2x Vorlesung<br />
Prüfung (Form, Dauer) Prüfungsleistung (PL):<br />
1Klausur, 120 Minuten<br />
Teilnahmevoraussetzungen Orientierungsprüfung<br />
Kompetenzziele fachlich-inhaltliche Kompetenzen<br />
siehe V28.1 <strong>und</strong> V28.2<br />
Schlüsselkompetenzen<br />
siehe V28.1 <strong>und</strong> V28.2<br />
zugeordnete Veranstaltungen V 28.1: Maschinendynamik<br />
V 28.2: Wellen/Kupplungen/Getriebe<br />
Beschreibung der Veranstaltungen siehe Tabellen V 28.1 <strong>und</strong> V 28.2<br />
Name:<br />
Unterschrift: Datum:<br />
75
V 28.1 Maschinendynamik<br />
Modul 28 Antriebssysteme<br />
zugehörige Veranstaltung V 28.1 Maschinendynamik<br />
Dozentinnen / Dozenten<br />
Position im Studienverlauf 7. Fachsemester<br />
Angebotsrhythmus Beginn jedes Sommersemester<br />
Semesterwochenst<strong>und</strong>en 2<br />
Workload (Zeitst<strong>und</strong>en) Präsenz: 30 Selbststudium: 60<br />
ECTS-Leistungspunkte (CP) 3<br />
Sprache Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />
Lehr- <strong>und</strong> Lernformen Vorlesung<br />
Prüfung (Form, Dauer) Sonstige Prüfung (SP):<br />
1 Klausur, 120 Minuten, schriftliche Ausarbeitung, Vortrag<br />
Teilnahmevoraussetzungen Orientierungsprüfung<br />
Kompetenzziele fachlich-inhaltliche Kompetenzen<br />
Die Studenten beherrschen die für den Ingenieursberuf wichtigen<br />
erweiterten Gr<strong>und</strong>lagen der Maschinendynamik/Technischen<br />
Schwingungslehre <strong>und</strong> Maschinenakustik. Sie können in<br />
Strukturen denken <strong>und</strong> die erlernten Denkweisen <strong>und</strong> Techniken in<br />
verschiedenen technischen <strong>und</strong> naturwissenschaftlichen<br />
Zusammenhängen verknüpfen <strong>und</strong> anwenden.<br />
Schlüsselkompetenzen<br />
Die Studierenden sind in der Lage,<br />
Sie sind in der Lage, naturwissenschaftliche Probleme zu<br />
erkennen, zu analysieren <strong>und</strong> zu lösen.<br />
Inhalte 1. Aufgaben <strong>und</strong> Ziele der Maschinendynamik<br />
2. Verschiedene Methoden zur Analyse von<br />
maschinendynamischen Systemen<br />
2.1 Kenngrößen der Maschinendynamik<br />
2.2 Transiente Simulation<br />
3. Der Ein-Massen Schwinger<br />
3.1 Schwingungstechnische Kenngrößen des freien<br />
harmonischen Schwingers<br />
3.2 Gedämpfte freie Schwinger<br />
4 Erzwungene Schwingungen<br />
4.3 Harmonische Erregung<br />
4.3.3 Krafterregung<br />
4.3.4 Unwuchterregung<br />
4.3.5 Wegerregung<br />
4.4 Überlagerung von harmonischen Erregungen<br />
4.5 Fourier-Analyse<br />
4.6 Sprunghafte Erregung<br />
4.7 Allgemeine Erregung<br />
4.8 Parametererregte Schwingungen<br />
76
5 Verschiedene Verfahren zur Aufstellung von<br />
Bewegungsgleichungen<br />
6 Mehrmassen-Schwinger<br />
6.3 Freie Schwingungssysteme<br />
6.4 Erzwungene Schwingungen<br />
7 Schwinger mit kontinuierlicher Massenverteilung<br />
8 Modalanalyse<br />
9. Maschinenakustik II<br />
10. FFT Schallanalyse<br />
11. Übertragungsfunktionen im Frequenzbereich<br />
12. Condition Monitoring an Maschinen<br />
13. Experimentelle Modalanalyse mit MS-scope<br />
14. Laborprüfstandsversuche Maschinenakustik<br />
15. Nachbereitungen <strong>zum</strong> Praktikum<br />
STCW - Bezug entfällt<br />
Literatur Reimers, E.: Arbeitsblätter z. Vorlesung „Maschinenakustik“<br />
Kollmann : Maschinenakustik<br />
Cremer <strong>und</strong> Heckl: Körperschall<br />
Name:<br />
Unterschrift: Datum:<br />
V 28.2 Wellen/Kupplungen/Getriebe<br />
Modul 28 Antriebssysteme<br />
zugehörige Veranstaltung V 28.2 Wellen/Kupplungen/Getriebe<br />
Dozentinnen / Dozenten Prof. Dr.-Ing. Michael Thiemke<br />
Position im Studienverlauf 7. Fachsemester<br />
Angebotsrhythmus Beginn jedes Sommersemester<br />
Semesterwochenst<strong>und</strong>en 2<br />
Workload (Zeitst<strong>und</strong>en) Präsenz: 30 Selbststudium: 30<br />
ECTS-Leistungspunkte (CP) 2<br />
Sprache Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />
Lehr- <strong>und</strong> Lernformen Labor<br />
Prüfung (Form, Dauer)<br />
Teilnahmevoraussetzungen Orientierungsprüfung<br />
Kompetenzziele fachlich-inhaltliche Kompetenzen<br />
Die Studierenden sind in der Lage,<br />
� gr<strong>und</strong>legende Aspekte der Funktion, der Auslegung, der<br />
technischen Ausführung <strong>und</strong> der Anordnung von Bauteilen von<br />
Propellerwellenanlagen <strong>und</strong> Getrieben zu verstehen.<br />
� die gewonnenen Erkenntnisse im Praxisbezug anzuwenden.<br />
Schlüsselkompetenzen<br />
Die Studierenden sind in der Lage,<br />
� das erlernte Wissen anzuwenden, um hierdurch bei<br />
Auslegung, Montage, Ausrichtung <strong>und</strong> Betrieb von<br />
Schiffsantriebsanlagen Vor- <strong>und</strong> Nachteile sowie mögliche<br />
77
Fehler an Vorgehensweisen <strong>und</strong> Bauteilen zu erkennen.<br />
� Interdisziplinär zu kommunizieren.<br />
Inhalte 1 Wellenleitung<br />
• Auslegung von Wellen<br />
• Welle-Nabe-Verbindungen (WNV)<br />
• Lagerung (Wälzlager, Gleitlager)<br />
• Abdichtungen<br />
• Schmierölsystem<br />
• Korrosionsschutz<br />
2 Kupplungen<br />
• nicht schaltbar (starr oder ausgleichend/nachgiebig)<br />
• schaltbar (pneumatisch oder hydraulisch betätigt)<br />
• weitere Typen<br />
• kombiniert<br />
3 Getriebe<br />
• Hydraulische Drehmomentwandler<br />
• Zahnradgetriebe (Verzahnung, Planetengetriebe,<br />
Fertigungsqualitäten)<br />
• Kettengetriebe<br />
4. Propeller<br />
• Anfänge der Entwicklung von Propulsionsorganen<br />
• Gr<strong>und</strong>lagen: Propellergeometrie <strong>und</strong> Hydrodynamik<br />
• Weiterentwicklung von Propulsionsorganen<br />
• Festpropeller / Verstellpropeller<br />
• Regelung von Verstellpropelleranlagen<br />
5. Antriebanlagen<br />
• Montage<br />
• Ausrichtmethoden <strong>und</strong> -werkzeuge<br />
• Ausrichtrechnung<br />
• Antriebskonzepte <strong>und</strong> Ausführungen<br />
6 jeweils zu den Punkten 1-5:<br />
• Zustandsüberwachung<br />
• Schäden <strong>und</strong> Schadensvermeidung<br />
STCW - Bezug entfällt<br />
Literatur • MEIER-PETER, H. <strong>und</strong> BERNHARDT, F.:<br />
Handbuch der Schiffsbetriebstechnik, Seehafen Verlag, 1.<br />
Auflage, 2006<br />
• MATEK, W.; MUHS, D.; WITTEL, H. <strong>und</strong> BECKER, M.:<br />
Roloff/Matek Maschinenelemente, Viehweg Verlag,<br />
13 Auflage, 1995.<br />
• LANG, O.R. <strong>und</strong> STEINHILPER, W.: Gleitlager. Springer Verlag,<br />
1978.<br />
Name:<br />
Unterschrift: Datum:<br />
78
M 29 Elektrische Anlagen<br />
Modulkennziffer 29<br />
Modulname Elektrische Anlagen<br />
Modultyp Pflichtmodul<br />
Position im Studienverlauf 7. Fachsemester<br />
Angebotsrhythmus Beginn jedes Wintersemester<br />
Modulbeauftragter Prof. Dr.-Ing. Peter Sahner<br />
Dozentinnen / Dozenten Prof. Dr.-Ing. Peter Sahner<br />
Semesterwochenst<strong>und</strong>en 6<br />
Workload (Zeitst<strong>und</strong>en) Präsenz: 120 Selbststudium: 120<br />
ECTS-Leistungspunkte (CP) 6<br />
Sprache Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />
Lehr- <strong>und</strong> Lernformen 2x Vorlesung, 1x Labor<br />
Prüfung (Form, Dauer) 1Klausur, a 120 Minuten<br />
Teilnahmevoraussetzungen Orientierungsprüfung für Veranstaltungen ab Semester 5<br />
Kompetenzziele fachlich-inhaltliche Kompetenzen<br />
Die Studierenden sind in der Lage,<br />
� siehe Tabellen V 29.1, V 29.2, V29.3<br />
Schlüsselkompetenzen<br />
Die Studierenden sind in der Lage,<br />
� siehe Tabellen siehe Tabellen V 29.1, V 29.2, V29.3<br />
zugeordnete Veranstaltungen V 29.1: Mittelspannung<br />
V 29.2: Elektrische Anlagen<br />
V 29.3: Elektrische Anlagen Labor<br />
Beschreibung der Veranstaltungen siehe Tabellen V 29.1, V 29.2, V29.3<br />
Name:<br />
Unterschrift: Datum:<br />
79
V 29.1 Mittelspannung<br />
Modul 29 Elektrische Anlagen<br />
zugehörige Veranstaltung V 29.1 Mittelspannung<br />
Dozentinnen / Dozenten Prof. Dr.-Ing. Peter Sahner<br />
Position im Studienverlauf 7. Fachsemester<br />
Angebotsrhythmus Beginn jedes Wintersemester<br />
Semesterwochenst<strong>und</strong>en 2<br />
Workload (Zeitst<strong>und</strong>en) Präsenz: 30 Selbststudium: 60<br />
ECTS-Leistungspunkte (CP) 2<br />
Sprache Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />
Lehr- <strong>und</strong> Lernformen Vorlesung<br />
Prüfung (Form, Dauer) Prüfungsleistung (PL):<br />
1 Klausur, 120 Minuten zusammen mit Elektrische Anlagen<br />
Teilnahmevoraussetzungen Orientierungsprüfung<br />
Kompetenzziele fachlich-inhaltliche Kompetenzen<br />
Inhalte<br />
Schlüsselkompetenzen<br />
�<br />
STCW - Bezug Fachpraktische <strong>und</strong> fachtheoretische Anforderungen zu Wartung,<br />
Betrieb <strong>und</strong> Instandhaltung gem. Tab. A-III/1 <strong>und</strong> A-III/2<br />
Übereinkommens.<br />
Literatur<br />
Name:<br />
Unterschrift: Datum:<br />
V 29.2 Elektrische Anlagen<br />
Modul 29 Elektrische Anlagen<br />
zugehörige Veranstaltung V 29.2 Elektrische Anlagen<br />
Dozentinnen / Dozenten Prof. Dr.-Ing. Peter Sahner<br />
Position im Studienverlauf 7. Fachsemester<br />
Angebotsrhythmus Beginn jedes Wintersemester<br />
Semesterwochenst<strong>und</strong>en 2<br />
Workload (Zeitst<strong>und</strong>en) Präsenz: 30 Selbststudium: 30<br />
ECTS-Leistungspunkte (CP) 2<br />
Sprache Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />
Lehr- <strong>und</strong> Lernformen Vorlesung<br />
Prüfung (Form, Dauer) Prüfungsleistung (PL):<br />
1 Klausur, 120 Minuten zusammen mit Mittelspannung<br />
Teilnahmevoraussetzungen Orientierungsprüfung<br />
Kompetenzziele fachlich-inhaltliche Kompetenzen<br />
80
Inhalte<br />
� Die Studierenden sind mit dem Aufbau <strong>und</strong> Betrieb des<br />
Bordnetzes vertraut. Sie kennen die wichtigsten<br />
Installationskonzepte (Kabel, Schaltgeräte)<br />
� Sie erhalten einen Überblick über die Bauelemente der<br />
Leistungselektronik <strong>und</strong> deren Anwendung in Stromrichtern<br />
Schlüsselkompetenzen<br />
� Sie kennen die Gefahren der Elektrizität <strong>und</strong> die<br />
entsprechenden Schutzmaßnahmen <strong>und</strong> sind über die<br />
Sicherheitsvorschriften für die Arbeit mit elektrischen<br />
Systemen informiert<br />
� Die technische Kompetenz der Studierenden wird erweitert.<br />
Vorschriften <strong>und</strong> Normen (DIN, UVV, Klasse)<br />
Besonderheiten des Bordnetzes<br />
- Leistungsbedarf<br />
- Netzsysteme ( Erdungssysteme)<br />
- Netzkonfigurationen<br />
Kurzschlüsse : Ursachen <strong>und</strong> Arten, Auswirkungen<br />
( Störlichtbogen, Elektromagnetische Kräfte)<br />
Mittelspannungsanlagen (Einführung)<br />
Kabel <strong>und</strong> Leitungen<br />
- Typenbezeichnung <strong>und</strong> Auswahlkriterien<br />
- Kabeldimensionierung<br />
- Schiffskabel<br />
- Brandschutz<br />
- Mittelspannungskabel<br />
Schaltgeräte<br />
- Einteilung <strong>und</strong> Kenngrößen<br />
- Schaltlichtbogen<br />
Anlagenschutz<br />
- Übersicht ( Aufgabe, Schutzgeräte,, Selektivität )<br />
- Sicherungen( Aufbau, Auslösekennlinien, Arbeitsschutz )<br />
- Leitungsschutzschalter<br />
- Leistungsschalter<br />
- Motorschutzschalter<br />
- FI-Schutzschalter<br />
- Erhöhung der Kurzschlussleistung (Duplexdrossel, Is-Begrenzer)<br />
Personenschutz<br />
- Stromgefährdung<br />
- Schutzarten<br />
- netzunabhängige Schutzmaßnahmen<br />
- netzabhängige Schutzmaßnahmen (IT-System, TN-System<br />
,Potentialausgleich / Erder)<br />
Leistungselektronik<br />
- Stromrichterfunktionen<br />
- Bauelemente<br />
- netzgeführte Stromrichter (M1, M3, B6, B12)<br />
81
- Wechselstromsteller<br />
- Umrichter (Prinzipien)<br />
STCW - Bezug Fachpraktische <strong>und</strong> fachtheoretische Anforderungen zu Wartung,<br />
Betrieb <strong>und</strong> Instandhaltung gem. Tab. A-III/1 <strong>und</strong> A-III/2<br />
Übereinkommens.<br />
Literatur Knies, Schierack, K.: Elektrische Anlagentechnik<br />
Carl Hanser Verlag München<br />
Meier-Peter, Bernhardt: Handbuch Schiffsbetriebstechnik<br />
Seehafen-Verlag Hamburg 2006<br />
Germanischer Lloyd: Klassifikations- <strong>und</strong> Bauvorschriften I -Teil 1 -<br />
Seeschiffe , Kapitel 3 - Elektrische Anlagen<br />
Seip, G.G.: Elektrische Installationstechnik Band 1 + 2<br />
Siemens AG<br />
DIN VDE 0100 Beuth-Verlag<br />
Stephan, W.; Leistungselektronik interaktiv Fachbuchverlag<br />
Leipzig 2001<br />
Hall,D.T.;Practical marine electrical knowledge Witherby<br />
Publishers, London 1999<br />
Jahrbücher der Schiffstechnischen Gesellschaft (STG)<br />
Giersch; Harthus, Vogelsang; Elektrische Maschinen<br />
B. G. Teubner Stuttgart . Leipzig<br />
Name:<br />
Unterschrift: Datum:<br />
V 29.3 Elektrische Anlagen Labor<br />
Modul 29 Elektrische Anlagen<br />
zugehörige Veranstaltung V 29.3 Elektrische Anlagen Labor<br />
Dozentinnen / Dozenten Prof. Dr.-Ing. Peter Sahner<br />
Position im Studienverlauf 7. Fachsemester<br />
Angebotsrhythmus Beginn jedes Wintersemester<br />
Semesterwochenst<strong>und</strong>en 2<br />
Workload (Zeitst<strong>und</strong>en) Präsenz: 30 Selbststudium: 30<br />
ECTS-Leistungspunkte (CP) 2<br />
Sprache Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />
Lehr- <strong>und</strong> Lernformen Labor<br />
Prüfung (Form, Dauer) Erforderlich für Anerkennung elektrische Anlagen<br />
Teilnahmevoraussetzungen Orientierungsprüfung<br />
Kompetenzziele fachlich-inhaltliche Kompetenzen<br />
� Die Studierenden vertiefen <strong>und</strong> erweitern ihre Kenntnisse<br />
aus der Vorlesung Elektrische Anlagen durch die praktische<br />
Anwendung dieser im Labor<br />
Schlüsselkompetenzen<br />
� Anwendungsorientiertes Handeln<br />
� Teamfähigkeit<br />
82
� Problemlösungsfertigkeiten<br />
Inhalte Schutzmaßnahmen nach DIN VDE 100<br />
Leistungsmessung<br />
Isolationsmessung<br />
Steuerung von Motoren mit Schützen<br />
Transformator 1<br />
Stromrichter<br />
STCW - Bezug Fachpraktische <strong>und</strong> fachtheoretische Anforderungen zu Wartung,<br />
Betrieb <strong>und</strong> Instandhaltung gem. Tab. A-III/1 <strong>und</strong> A-III/2<br />
Übereinkommens.<br />
Literatur Knies, Schierack, K.: Elektrische Anlagentechnik<br />
Carl Hanser Verlag München<br />
Meier-Peter, Bernhardt: Handbuch Schiffsbetriebstechnik<br />
Seehafen-Verlag Hamburg 2006<br />
Germanischer Lloyd: Klassifikations- <strong>und</strong> Bauvorschriften I -Teil 1 -<br />
Seeschiffe , Kapitel 3 - Elektrische Anlagen<br />
Seip, G.G.: Elektrische Installationstechnik Band 1 + 2<br />
Siemens AG<br />
DIN VDE 0100 Beuth-Verlag<br />
Stephan, W.; Leistungselektronik interaktiv Fachbuchverlag<br />
Leipzig 2001<br />
Hall,D.T.;Practical marine electrical knowledge Witherby<br />
Publishers, London 1999<br />
Jahrbücher der Schiffstechnischen Gesellschaft (STG)<br />
Giersch; Harthus, Vogelsang; Elektrische Maschinen<br />
B. G. Teubner Stuttgart . Leipzig<br />
Name:<br />
Unterschrift: Datum:<br />
M 30 Schiffsbetrieb<br />
Modulkennziffer 30<br />
Modulname Schiffsbetrieb<br />
Modultyp Pflichtmodul<br />
Zugeordnete Veranstaltung V 30.1 Überwachung Schiffsbetrieb<br />
Position im Studienverlauf 7. Fachsemester<br />
Angebotsrhythmus Beginn jedes Sommersemesters<br />
Modulbeauftragter Prof. Dr.-Ing. Holger Watter<br />
Dozentinnen / Dozenten Prof. Dr.-Ing. Holger Watter<br />
Prof. Dr.-Ing. Michael Thiemke<br />
Semesterwochenst<strong>und</strong>en 4<br />
Workload (Zeitst<strong>und</strong>en) Präsenz: 60 Selbststudium: 60<br />
ECTS-Leistungspunkte (CP) 4<br />
Sprache Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />
Lehr- <strong>und</strong> Lernformen Vorlesung<br />
Prüfung (Form, Dauer) Studienleistung (SL): Sonstige Prüfung (SP):<br />
83
Schriftliche Ausarbeitung, Vortrag, Hausaufgabe<br />
Teilnahmevoraussetzungen Orientierungsprüfung<br />
Kompetenzziele fachlich-inhaltliche Kompetenzen<br />
Die Studierenden sind in der Lage, die Haupt- <strong>und</strong> Hilfsmotoren<br />
von Schiffen mit ihren Hilfssystemen zu fahren, ebenso wie alle<br />
anderen Hilfsanlagen an Bord von Schiffen. Sie können Fehler an<br />
den Motoren <strong>und</strong> in den Anlagen erkennen, beurteilen <strong>und</strong><br />
beheben.<br />
Schlüsselkompetenzen<br />
Die Studierenden sind in der Lage, komplexe Vorgänge <strong>und</strong> deren<br />
Auswirkungen in Schiffsanlagen zu verstehen <strong>und</strong> zu beurteilen.<br />
Inhalte 1.Hochfahren <strong>und</strong> Absetzen von Motorhilfssystemen inklusive E-<br />
Anlagen<br />
2.Hochfahren <strong>und</strong> Absetzen des Schiffshilfsbetriebes<br />
3. Hochfahren <strong>und</strong> Betrieb der Hauptmaschine<br />
4. Erfassen der Betriebsdaten<br />
5. Aufnehmen von Fehlfunktionen<br />
6. Erkennen von Fehlern<br />
7. Maßnahmen zur Behebung von Fehlfunktionen <strong>und</strong> Schäden<br />
8. Überwachung <strong>und</strong> Diagnose<br />
9. Wachbetrieb<br />
10. Bunkern, Routing, Wartung<br />
STCW - Bezug Fachpraktische <strong>und</strong> fachtheoretische Anforderungen zu Wartung,<br />
Betrieb <strong>und</strong> Instandhaltung gem. Tab. A-III/1 <strong>und</strong> A-III/2<br />
Übereinkommens.<br />
Literatur Handbuch Schiffsbetriebstechnik<br />
Name:<br />
Unterschrift: Datum:<br />
Der Schiffsmaschinensimulator SES 4000 (Ship Engine Simulator) bildet die wesentlichen Komponenten<br />
des technischen Schiffsbetriebes aus ca. 30 Subsystemen sowie deren Dynamik ab:<br />
� Hauptmaschine (SULZER 5-RTA 84 C),<br />
� Hilfsmaschinensysteme,<br />
� Bordnetz mit Stromerzeugungs-, Verteilungs- <strong>und</strong> Verbrauchersystem,<br />
� Mess-, Regelungs-, Überwachungs- <strong>und</strong> Automatisierungstechnik.<br />
Einen Überblick über die Systemkreisläufe erhalten Sie über<br />
http://www.fh-flensburg.de/watter/SES_Systeme.pdf<br />
Alle entscheidenden Prozessvariablen werden visualisiert. Beim Simulationslauf wird unter anderem ein<br />
virtueller Großdieselmotor betrieben <strong>und</strong> dessen Thermodynamik detailliert mittels eines Echtzeit-<br />
Rechenmodells nachgebildet. Durch die Veränderung von<br />
� 1300 Festwertparametern <strong>und</strong> die Einbindung von<br />
� 450 Störungsübungen<br />
in technische Szenarien kann der routinierte Umgang mit Notfallsituationen sowie deren Auswirkungen<br />
auf andere Systeme exemplarisch untersucht werden. Durch die Vielzahl der Störungsbeispiele<br />
(Malfunction) <strong>und</strong> die Möglichkeit der Veränderungen von Festwertparametern (Parameter Overwrite)<br />
besitzt die Simulationsanlage eine hohe Flexibilität. Die Weiterbildungskurse an der<br />
84
Maschinensimulationsanlage werden daher in Abhängigkeit von der Zielgruppe k<strong>und</strong>enspezifisch<br />
zusammengestellt:<br />
� IMO-Engine-Room Simulator Model-Course,<br />
� Familiarizations-Course,<br />
� Trouble-Shooting / Störungsübungen,<br />
� Kennfeldsimulation <strong>und</strong> Parametervariationen.<br />
Der Simulator verfügt über 2 Bediener-Arbeitsplätze <strong>und</strong> einen Instruktor-Arbeitsplatz, die alle<br />
gleichberechtigt auf das gleiche Simulationsmodell zurückgreifen. Es ist also eine gemeinsame<br />
Interaktion möglich <strong>und</strong> notwendig. Die Seminarteilnehmerzahl ist daher auf max. 6 beschränkt.<br />
Lernsoftware: CBT, 3-D-Simulation <strong>und</strong> Animationen zur schiffstechnischen Betriebsführung:<br />
http://www.fh-flensburg.de/watter/IMA/CBT-Maschinensimulation_UNITEST.pdf<br />
Fächerübergreifendes Seminar zu den Lehrinhalten aus allen technischen Fachgebieten. Die<br />
Technische Betriebsführung, Überwachung, Instandhaltung wird anhand ausgewählter exemplarischer<br />
Anlagen aufgearbeitet.<br />
85
M 31 Bachelor Thesis<br />
Modulkennziffer 31<br />
Modulname Bachelor Thesis<br />
Modultyp Pflichtmodul<br />
Zugeordnete Veranstaltungen V. 31.1. Bachelor-Thesis <strong>und</strong> Kolloquium<br />
Position im Studienverlauf 7. Fachsemester<br />
Angebotsrhythmus Beginn jedes Sommer- <strong>und</strong> Wintersemester<br />
Modulbeauftragter DozentInnen<br />
Dozentinnen / Dozenten DozentInnen<br />
Semesterwochenst<strong>und</strong>en entfällt<br />
Workload (Zeitst<strong>und</strong>en) Präsenz: 1 Selbststudium: 359<br />
ECTS-Leistungspunkte (CP) 12<br />
Sprache Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />
Lehr- <strong>und</strong> Lernformen entfällt<br />
Prüfung (Form, Dauer) Dauer Thesis: 2 Monate; Kolloquium: 45 Minuten<br />
Teilnahmevoraussetzungen Orientierungsprüfung<br />
Kompetenzziele fachlich-inhaltliche Kompetenzen<br />
Die Studierenden sind in der Lage,<br />
� in der vorgegebenen Zeit eine praxisorientierte Aufgabe aus<br />
dem Berufsfeld <strong>Schiffstechnik</strong> selbstständig mit den in der<br />
Anwendung erprobten wissenschaftlichen <strong>und</strong><br />
fachpraktischen Methoden zu bearbeiten.<br />
Schlüsselkompetenzen<br />
Die Studierenden sind in der Lage,<br />
� Projekte zu organisieren.<br />
� Aufgaben zu analysieren.<br />
� verschiedene Verfahren anzuwenden <strong>und</strong> zu vergleichen.<br />
� Ergebnisse zu bewerten <strong>und</strong> praktisch umzusetzen.<br />
� Sich selbst zu organisieren.<br />
� Die Forschungsfähigkeit wird erhöht.<br />
Inhalte 1. Beschreibung <strong>und</strong> Begrenzung der Aufgabenstellung,<br />
2. Analyse <strong>und</strong> Lösungsverfahren,<br />
3. Umsetzungsstrategie <strong>und</strong> Implementierung,<br />
4. Bewertung der Ergebnisse<br />
STCW - Bezug entfällt<br />
Literatur aktuelle wissenschaftliche Veröffentlichungen <strong>zum</strong> Thema<br />
Name:<br />
Unterschrift: Datum:<br />
86
M 32 Berufspraktikum<br />
Modulkennziffer 32<br />
Modulname Berufspraktikum<br />
Modultyp Pflichtmodul<br />
Position im Studienverlauf 8. Fachsemester<br />
Angebotsrhythmus Beginn jedes Wintersemesters<br />
Modulbeauftragter Prof. Dr.-Ing. Holger Watter<br />
Dozentinnen / Dozenten Prof. Dr.-Ing. Holger Watter<br />
Semesterwochenst<strong>und</strong>en<br />
Workload (Zeitst<strong>und</strong>en) Präsenz: 750 Selbststudium: 150<br />
ECTS-Leistungspunkte (CP) 30<br />
Sprache Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />
Lehr- <strong>und</strong> Lernformen<br />
Prüfung (Form, Dauer) Studienleistung (SL): Dauer 26 Wochen ( Praktikumsbericht,<br />
Training Record Book)<br />
Teilnahmevoraussetzungen Orientierungsprüfung<br />
Kompetenzziele fachlich-inhaltliche Kompetenzen<br />
Die Studierenden sind in der Lage<br />
� alle wesentlichen Bauelemente eines Schiffskörpers zu<br />
benennen<br />
� alle für den Betrieb eines Schiffes erforderlichen technischen<br />
Einrichtungen <strong>und</strong> Anlagen zu benennen <strong>und</strong> deren jeweiligen<br />
Aufgaben zu beschreiben<br />
� alle für den Betrieb eines Schiffes erforderlichen technischen<br />
Einrichtungen <strong>und</strong> Anlagen unter Anleitung zu bedienen; sofern<br />
zulässig, auch selbstständig<br />
� komplexe Aufgaben gemäß TRB unter Anleitung planen <strong>und</strong><br />
durchführen; sofern zulässig, auch selbstständig<br />
� die einschlägigen Sicherheitsvorschriften bei der Ausführung<br />
aller Tätigkeiten sowie während des Einsatzes auf einem Schiff<br />
anzuwenden.<br />
Schlüsselkompetenzen<br />
Die Studierenden sind in der Lage, komplexe Systeme <strong>und</strong> deren<br />
gegenseitige Wechselwirkungen <strong>und</strong> Zusammenhänge zu<br />
erfassen <strong>und</strong> verstehen.<br />
Die Studierenden sind in der Lage, sich in die gesellschaftlichen,<br />
kulturellen <strong>und</strong> funktionalen Organisationsstrukturen an Bord<br />
einzugliedern <strong>und</strong> die Zusammenarbeit aktiv mitgestalten.<br />
Dies erhöht die interkulturelle Kompetenz der Studierenden.<br />
An Bord wird die Fähigkeit fächerübergreifend zu denken <strong>und</strong><br />
interdisziplinär zu kommunizieren erhöht.<br />
Inhalte Die in dem TRB aufgeführten Ausbildungsinhalte <strong>und</strong> Tätigkeiten.<br />
STCW - Bezug Fachpraktische <strong>und</strong> fachtheoretische Anforderungen zu Wartung,<br />
87
Betrieb <strong>und</strong> Instandhaltung gem. Tab. A-III/1 <strong>und</strong> A-III/2<br />
Übereinkommens.<br />
Literatur � BSH (Hrsg): „On Board Training Record Book“ (TRB)<br />
� BSH (Hrsg): „IMO – Standard – Redewendungen in der<br />
Seeschifffahrt“<br />
� Kropp/Peters/Wand: „Leben <strong>und</strong> Lernen an Bord“<br />
Name:<br />
Unterschrift: Datum:<br />
88
Modulkatalog <strong>Schiffstechnik</strong> (B. Eng.)<br />
5.2 Modulkatalog Schwerpunkt Schiffsmaschinenbau<br />
Stand 15.11.2011<br />
Folgende nicht markierte Module aus dem Vgl. SBT Modul<br />
Schwerpunkt Schiffsmaschinenbau sind<br />
identisch mit Schiffsbetriebstechnik <strong>und</strong><br />
werden nicht noch einmal abgebildet.<br />
M 1 Mathematik 1 M 2<br />
M 2 Physik M 3<br />
M 3 Elektrotechnik 1, Messtechnik M 4<br />
M 4 Technische Mechanik 1 M 5<br />
M 5 Gr<strong>und</strong>lagen der Werkstofftechnik M 6<br />
M 6 Englisch M 7<br />
M7 Wirtschaft<br />
M 8 Informatik M 9<br />
M 9 Mathematik 2 M 10<br />
M 10 Elektrotechnik 2 M 11<br />
M 11 Thermodynamik M 12<br />
M 12 Recht1<br />
M 13 CA Methoden der Konstruktionstechnik<br />
M 14 Technische Mechanik 2<br />
M 15 Elektrische Maschinen M 15<br />
M 16 Schiffbau<br />
M 17 Qualitätsmanagement<br />
M 18 Betriebstechnik M 14<br />
M 19 Maschinenelemente M 19<br />
M 20 Regelungstechnik M 20<br />
M 21 Arbeitsmaschinen M 21<br />
M 22 Dampfanlagen M 24<br />
M 23 Betriebsstoffe M 18<br />
M 24 Automatisierungstechnik (ohne Leittechnik M 27<br />
Labor)<br />
M 25 Konstruktion <strong>und</strong> Berechnung<br />
M 26 Betreutes Projektlabor<br />
M 27 Verbrennungskraftmaschinen 1<br />
M 28 Antriebssysteme M 28<br />
M 29 Schiffsbetrieb M 30<br />
M 30 Elektrische Anlagen<br />
M 31 <strong>Schiffstechnik</strong><br />
M 32 Recht 2<br />
M 33 Berufspraktikum<br />
M 34 Bachelor Thesis M 31<br />
1
Inhalt<br />
5.2 Modulkatalog Schwerpunkt Schiffsmaschinenbau ................................................................................. 1<br />
M 7 Wirtschaft ..................................................................................................................................... 2<br />
M 12 Recht 1 ...................................................................................................................................... 3<br />
M 13 CA Methoden der Konstruktionstechnik .................................................................................. 4<br />
V 13.1 CA- Methoden der Konstruktionstechnik .............................................................................. 5<br />
V 13.2 CA- Methoden Labor ............................................................................................................. 6<br />
M 14 Technische Mechanik 2 ............................................................................................................ 7<br />
M 16 Schiffbau ................................................................................................................................... 8<br />
V 16.1 Einrichtung <strong>und</strong> Ausrüstung von Schiffen ............................................................................. 9<br />
V 16.2 Strömungslehre ........................................................................................................................ 10<br />
V 16.3 Schiffbau ................................................................................................................................... 11<br />
V 16.4 Schiffssicherheit ....................................................................................................................... 12<br />
M 25 Konstruktion <strong>und</strong> Berechnung ................................................................................................ 14<br />
V 25.1 Methodische Konstruktion .................................................................................................. 14<br />
V 25.2 FEM ...................................................................................................................................... 15<br />
M 26 Betreutes Projektlabor ........................................................................................................... 17<br />
M 27 Verbrennungskraftmaschinen 1 ............................................................................................. 18<br />
M 30 Elektrische Anlagen ................................................................................................................ 19<br />
V 30.1 Elektrische Anlagen ............................................................................................................. 20<br />
V 30.2 Elektrische Anlagen Labor ................................................................................................... 22<br />
M 31 <strong>Schiffstechnik</strong> .......................................................................................................................... 23<br />
V 31.1 Anlagentechnik .................................................................................................................... 23<br />
V 31.2 Schiffsfertigung .................................................................................................................... 25<br />
V 29.3 <strong>Schiffstechnik</strong> ...................................................................................................................... 26<br />
M 32 Recht 2 .................................................................................................................................... 27<br />
M 33 Berufspraktikum ..................................................................................................................... 28<br />
M 7 Wirtschaft<br />
Modulkennziffer 7<br />
Modulname Wirtschaft<br />
Modultyp Pflichtmodul<br />
Zugehörige Veranstaltung V 7.1<br />
Position im Studienverlauf 1. Fachsemester<br />
Angebotsrhythmus Beginn jedes Wintersemester<br />
Modulbeauftragter<br />
Dozentinnen / Dozenten Dr. Christian Czogalla<br />
Semesterwochenst<strong>und</strong>en 2<br />
Workload (Zeitst<strong>und</strong>en) Präsenz: 30 Selbststudium: 60<br />
ECTS-Leistungspunkte (CP) 3<br />
2
Sprache Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />
Lehr- <strong>und</strong> Lernformen Vorlesung<br />
Prüfung (Form, Dauer) Studienleistung (SL):<br />
1 Klausur, 60 Minuten oder 1 Vortrag/Referat oder<br />
1 schriftliche Ausarbeitung<br />
Teilnahmevoraussetzungen keine<br />
Kompetenzziele fachlich-inhaltliche Kompetenzen<br />
Die Studierenden sind in der Lage,<br />
� Wichtige ökonomische Termini <strong>und</strong> Zusammenhänge zu<br />
verstehen;<br />
� Unternehmerische Zielgrößen mit Hilfe ausgewählter<br />
Instrumente der Erfolgsrechnung zu berechnen<br />
Schlüsselkompetenzen<br />
Die Studierenden sind in der Lage,<br />
� Probleme zu erkennen <strong>und</strong> zu analysieren.<br />
� Sie beherrschen wichtige Instrumente der Erfolgskontrolle.<br />
Inhalte 1) Einführung in die Wirtschaftswissenschaften<br />
- ökonomische Gr<strong>und</strong>begriffe<br />
- das Unternehmen im volkswirtschaftl. Zusammenhang<br />
2) Unternehmen <strong>und</strong> Märkte<br />
- betriebliche Kategorien (Kosten, Gewinn, Rentabilität,<br />
Produktivität<br />
- Angebots- <strong>und</strong> Nachfrageverhalten<br />
- Preismechanismus <strong>und</strong> Gleichgewicht auf den Märkten<br />
3) Ziele unternehmerischer Aktivitäten <strong>und</strong> das Informa-<br />
tionssystem ihrer Erfolgskontrolle<br />
- ROI-Bau<br />
- Kurzfristige Erfolgsrechnung mittels Deckungs-beiträgen<br />
- Break-Even-Analyse<br />
- Investitionsrechenarten<br />
- Strategische Konzepte der Erfolgsmessung<br />
Literatur Scheck/Scheck, Wirtschaftliches Gr<strong>und</strong>wissen für Ingenieure;<br />
Wöhe, Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschafts- lehre;<br />
Czogalla, Materialsammlung zur Vorlesung<br />
Name:<br />
Unterschrift: Datum:<br />
M 12 Recht 1<br />
Modulkennziffer 12<br />
Modulname Recht<br />
Modultyp Pflichtmodul<br />
Zugehörige Veranstaltung V12.1 Gr<strong>und</strong>lagen Recht<br />
Position im Studienverlauf 2. Fachsemester<br />
Angebotsrhythmus Beginn jedes Sommersemester<br />
Modulbeauftragter<br />
3
Dozentinnen / Dozenten Rechtsanwältin Ilka Albers (LA), Rechtsanwalt Stefan Prinzler<br />
(LA)<br />
Semesterwochenst<strong>und</strong>en 2<br />
Workload (Zeitst<strong>und</strong>en) Präsenz: 30 Selbststudium: 30<br />
ECTS-Leistungspunkte (CP) 2<br />
Sprache Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />
Lehr- <strong>und</strong> Lernformen Vorlesung<br />
Prüfung (Form, Dauer) Studienleistung (SL):<br />
1 Klausur, 60 Minuten oder 1 Vortrag/Referat oder<br />
1 schriftliche Ausarbeitung<br />
Teilnahmevoraussetzungen keine<br />
Kompetenzziele fachlich-inhaltliche Kompetenzen<br />
Die Studierenden sind in der Lage,<br />
die wesentlichen Gr<strong>und</strong>züge des deutschen Rechtssystems<br />
insbesondere im Zusammenhang mit vertragsrechtlichen<br />
Aspekten einzuschätzen.<br />
Schlüsselkompetenzen<br />
Die Studierenden sind in der Lage,<br />
bei rechtlichen Fragestellungen eine erste grobe Analyse <strong>und</strong><br />
Bewertung vorzunehmen, um anschließend einschätzen zu<br />
können, welches Fachwissen zu akquirieren ist. Ihre Fähigkeit<br />
Informationen zu gewinnen <strong>und</strong> zu verarbeiten wird geschult.<br />
Strategien <strong>zum</strong> autonomen Wissensmanagement werden<br />
vermittelt.<br />
Inhalte In der Lehrveranstaltung werden Gr<strong>und</strong>kenntnisse des<br />
deutschen Rechtssystems, überwiegend im Zivilrecht, vermittelt.<br />
Inhalte sind z.B. Anspruchsaufbau, Geschäftsfähigkeit,<br />
Willenserklärung, Zustandekommen von Verträgen,<br />
Vertragstypen im Einzelnen (Kaufvertrag, Werkvertrag,<br />
Arbeitsvertrag). Daneben werden Gr<strong>und</strong>lagen des Deliktsrechts,<br />
des Sachenrechts, des Familienrechts <strong>und</strong> des Strafrechts<br />
erläutert.<br />
Literatur BGB<br />
HGB<br />
Name:<br />
Unterschrift: Datum:<br />
M 13 CA Methoden der Konstruktionstechnik<br />
Modulkennziffer 13<br />
Modulname CA Methoden der Konstruktionstechnik<br />
Modultyp Pflichtmodul<br />
Position im Studienverlauf 3. Fachsemester<br />
Angebotsrhythmus Beginn jedes Wintersemester:<br />
4
V 13.1: CA- Methoden der Konstruktionstechnik,<br />
V 13.2: CA- Methoden Labor<br />
Modulbeauftragter Prof. Dr. Detlef Wirries<br />
Dozentinnen / Dozenten Prof. Dr. Detlef Wirries<br />
Semesterwochenst<strong>und</strong>en 4 SWS<br />
Workload (Zeitst<strong>und</strong>en) Präsenz: 60 Selbststudium: 90<br />
ECTS-Leistungspunkte (CP) 5<br />
Sprache Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />
Lehr- <strong>und</strong> Lernformen 1x Vorlesung<br />
1x Labor<br />
Prüfung (Form, Dauer) Sonstige Studienleistung (SL):Laboraufgabe<br />
Teilnahmevoraussetzungen Orientierungsprüfung<br />
Kompetenzziele � siehe V13.1, V13.2<br />
zugeordnete Veranstaltungen V 13.1: CA- Methoden der Konstruktionstechnik<br />
V 13.2: CA- Methoden Labor<br />
Beschreibung der Veranstaltungen siehe Tabellen V 13.1, V 13.2<br />
Name:<br />
Unterschrift: Datum:<br />
V 13.1 CA- Methoden der Konstruktionstechnik<br />
Modul 13 CA Methoden der Konstruktionstechnik<br />
zugehörige Veranstaltung V 13.1 CA- Methoden der Konstruktionstechnik<br />
Dozentinnen / Dozenten Prof. Dr. Detlef Wirries<br />
Position im Studienverlauf 3. Fachsemester<br />
Angebotsrhythmus Beginn jedes Wintersemester<br />
V 13.1 CA- Methoden der Konstruktionstechnik<br />
Semesterwochenst<strong>und</strong>en 1<br />
Workload (Zeitst<strong>und</strong>en) Präsenz: 15 Selbststudium: 60<br />
ECTS-Leistungspunkte (CP) 2,5<br />
Sprache Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />
Lehr- <strong>und</strong> Lernformen Vorlesung<br />
Prüfung (Form, Dauer) Studienleistung (SL): Sonstige Prüfung (SP): Klausur, 120<br />
Minuten, Hausaufgabe, Schriftliche Ausarbeitung, Vortrag<br />
Teilnahmevoraussetzungen Orientierungsprüfung<br />
Kompetenzziele fachlich-inhaltliche Kompetenzen<br />
Die Studierenden sind in der Lage,<br />
� Konstruktionen <strong>und</strong> Zeichnungsableitungen basierend auf<br />
CAD-Methoden zu erstellen.<br />
5
Schlüsselkompetenzen<br />
� Die Studenten bekommen fachspezifisches<br />
Vertiefungswissen<br />
� Und vertiefen die Fähigkeit analytisch zu denken.<br />
Inhalte Einführung in die graphische Dokumentation <strong>und</strong> in die modernen<br />
Computermethoden des Maschinenbaus:<br />
� Zeichnungsarten<br />
� Blattaufteilung<br />
� Linienarten<br />
� Symbole<br />
� Projektionen<br />
� Abwicklungen<br />
� Sammelstücklisten<br />
� Baugruppenstücklisten<br />
� Zeichnungserstellung<br />
� 2D/3D-CAD-Systeme (Solid Edge)<br />
� Umfangreiche Laborübungen am Rechner<br />
Literatur Hoischen, H.: Technisches Zeichnen; Cornelsen Verlag<br />
Klein, M.: DIN Normen. Stuttgart/Leipzig; Teubner Verlag<br />
Name:<br />
Unterschrift: Datum:<br />
V 13.2 CA- Methoden Labor<br />
Modul 13 CA Methoden der Konstruktionstechnik<br />
zugehörige Veranstaltung V 13.2 CA- Methoden Labor<br />
Dozentinnen / Dozenten Prof. Dr. Detlef Wirries<br />
Position im Studienverlauf 3. Fachsemester<br />
Angebotsrhythmus Beginn jedes Wintersemester<br />
Semesterwochenst<strong>und</strong>en 3<br />
Workload (Zeitst<strong>und</strong>en) Präsenz: 45 Selbststudium: 30<br />
ECTS-Leistungspunkte (CP) 2,5<br />
Sprache Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />
Lehr- <strong>und</strong> Lernformen Labor<br />
Prüfung (Form, Dauer) Erforderlich für die Anerkennung CA-Methoden der<br />
Konstruktionstechnik<br />
Teilnahmevoraussetzungen Keine<br />
Kompetenzziele fachlich-inhaltliche Kompetenzen<br />
Die Studierenden sind in der Lage,<br />
siehe V13.1<br />
Schlüsselkompetenzen<br />
� Problemlösungsfähigkeit<br />
6
� Methodenkompetenz<br />
� Technische Kompetenz<br />
� Teamfähigkeit<br />
� Anwendungsorientiertes Handeln<br />
Inhalte Laborübungen:<br />
CAD-Arbeitsmethoden<br />
3D-Volumengenerierung mittels Solid Edge<br />
Zeichnungsableitung<br />
Literatur Hoischen, H.: Technisches Zeichnen; Cornelsen Verlag<br />
Klein, M.: DIN Normen. Stuttgart/Leipzig; Teubner Verlag<br />
Name:<br />
Unterschrift: Datum:<br />
M 14 Technische Mechanik 2<br />
Modulkennziffer 14<br />
Modulname Mechanik<br />
Modultyp Pflichtmodul<br />
Position im Studienverlauf 3. Fachsemester<br />
zugehörige Veranstaltung V 14.1 Technische Mechanik 2<br />
Dozentinnen / Dozenten Prof. Dr.-Ing. Axel Krapoth<br />
Position im Studienverlauf 3. Fachsemester<br />
Angebotsrhythmus Beginn jedes Wintersemester<br />
Semesterwochenst<strong>und</strong>en 4<br />
Workload (Zeitst<strong>und</strong>en) Präsenz: 60 Selbststudium: 90<br />
ECTS-Leistungspunkte (CP) 5<br />
Sprache Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />
Lehr- <strong>und</strong> Lernformen Vorlesung / Übung<br />
Prüfung (Form, Dauer) Prüfungsleistung (PL)<br />
1 Klausur, 120 Minuten<br />
Teilnahmevoraussetzungen keine<br />
Kompetenzziele fachlich-inhaltliche Kompetenzen<br />
Die Studierenden sind in der Lage,<br />
� Die Studenten beherrschen die wichtigsten Gr<strong>und</strong>gesetze<br />
der linearen Elastostatik/Festigkeitslehre.<br />
� Sie sind in der Lage, einfache Probleme der Elastostatik <strong>und</strong><br />
Festigkeitslehre als solche zu erkennen <strong>und</strong> ihrer<br />
Problematik nach einzuordnen.<br />
� Sie können ein entsprechendes mechanisches Modell<br />
entwerfen <strong>und</strong> mögliche Lösungswege aufzeigen.<br />
Schlüsselkompetenzen<br />
Die Studierenden sind in der Lage,<br />
7
� Die Probleme zu lösen, oder<br />
� sich die zur Lösung der Probleme notwendigen Kenntnisse<br />
anzueignen, oder<br />
� sich auf den entsprechenden Teilgebieten selbstständig<br />
weiterzubilden.<br />
Inhalte Einführung in die Festigkeitsberechnung<br />
1.1 Aufgaben der Festigkeitsberechnung<br />
1.2 Relevante Größen in Festigkeitsberechnung <strong>und</strong> Elastostatik<br />
(Spannung, Dehnung, Stoffgesetz, Formänderungsarbeit)<br />
1.3 Relationen zwischen Normal- <strong>und</strong> Schubspannungen<br />
1.4 Der Mohr’sche Spannungskreis<br />
1.5 Ebener Dehnungs- <strong>und</strong> Spannungszustand<br />
1.6 Verschiedene Vergleichspannungen <strong>und</strong> Festigkeits-<br />
Hypothesen<br />
2. Das Superpositionsprinzip in der linearen Mechanik<br />
2.1 Definitionen<br />
2.2 Anwendung des Superpositionsprinzips für statisch<br />
unbestimmte Systeme<br />
3. Balkenbiegung<br />
3.1 Die Gr<strong>und</strong>gleichungen der Balkenbiegung<br />
3.1 Die Spannungs- rsp. Verformungshypothese für schlanke<br />
Balken<br />
3.2 Die Dgl. der Balkenbiegung<br />
3.3 Verschiedene Methoden zur Berechnung von<br />
Balkensystemen<br />
3.4 Schub im Balken<br />
4. Dünnwandige Behälter unter Druck (Kesselformel)<br />
5. Torsion<br />
6. Erweiterung der Balkentheorie<br />
7. Ausgewählte weiterführende Kapitel der Festigkeitslehre<br />
Literatur Walter Schnell, Dietmar Gross, Werner Hauger; Technische<br />
Mechanik (4 Bde.), 2. Auflage, Springer 1989<br />
Mayr, M.: Technische Mechanik, Hanser 1995<br />
Name:<br />
Unterschrift: Datum:<br />
M 16 Schiffbau<br />
Modulkennziffer 16<br />
Modulname Schiffbau<br />
Modultyp Pflichtmodul<br />
Position im Studienverlauf 3. <strong>und</strong> 4. Fachsemester<br />
Angebotsrhythmus Beginn jedes Sommersemester<br />
Beginn jedes Wintersemester<br />
Modulbeauftragter<br />
8
Dozentinnen / Dozenten<br />
Semesterwochenst<strong>und</strong>en 8<br />
Workload (Zeitst<strong>und</strong>en) Präsenz: 120 Selbststudium: 210<br />
ECTS-Leistungspunkte (CP) 11<br />
Sprache Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />
Lehr- <strong>und</strong> Lernformen 4x Vorlesung, Übungen<br />
Prüfung (Form, Dauer) 1 Prüfungsleistung (PL):1 Klausur, 60 Minuten<br />
3 Studienleistungen (SL): 2 Klausuren, 60 Minuten<br />
Teilnahmevoraussetzungen Orientierungsprüfung<br />
Kompetenzziele fachlich-inhaltliche Kompetenzen<br />
Schlüsselkompetenzen<br />
zugeordnete Veranstaltungen V 16.1: Einrichtung <strong>und</strong> Ausrüstung von Schiffen<br />
V 16.2: Strömungslehre<br />
V 16.3: Gr<strong>und</strong>lagen Schiffbau<br />
V 16.4: Schiffssicherheit<br />
Beschreibung der Veranstaltungen siehe Tabellen V 16.1; V 16.2; 16.3 <strong>und</strong> V 16.4<br />
Name:<br />
Unterschrift: Datum:<br />
V 16.1 Einrichtung <strong>und</strong> Ausrüstung von Schiffen<br />
Modul 16 Schiffbau<br />
zugehörige Veranstaltung V 16.1 Einrichtung <strong>und</strong> Ausrüstung von Schiffen<br />
Dozentinnen / Dozenten N.N.<br />
Position im Studienverlauf 3. Fachsemester<br />
Angebotsrhythmus Beginn jedes Wintersemester<br />
Semesterwochenst<strong>und</strong>en 2<br />
Workload (Zeitst<strong>und</strong>en) Präsenz: 30 Selbststudium: 30<br />
ECTS-Leistungspunkte (CP) 2<br />
Sprache Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />
Lehr- <strong>und</strong> Lernformen Vorlesung<br />
Prüfung (Form, Dauer) Studienleistung (SL): Sonstige Prüfung (SP): Klausur, 60 Minuten,<br />
Hausaufgabe, Schriftliche Ausarbeitung, Vortrag<br />
Teilnahmevoraussetzungen keine<br />
Kompetenzziele fachlich-inhaltliche Kompetenzen<br />
Die Studierenden kennen<br />
� die Gr<strong>und</strong>elemente der Ausrüstung <strong>und</strong> Einrichtung von<br />
Schiffen<br />
� das gesamte Spektrum der Schiffstypen mit ihren spezifischen<br />
technischen Einrichtungen.<br />
9
Schlüsselkompetenzen<br />
Die Studierenden sind in der Lage,<br />
� das erlernte Wissen anzuwenden <strong>und</strong> zu verknüpfen, sowie<br />
alternative technische Lösungen für die Einrichtung <strong>und</strong><br />
Ausrüstung der Schiffe zu bewerten.<br />
� Sie werden verstärkt interdisziplinär denken <strong>und</strong> handeln.<br />
Inhalte � Rumpf, Aufbauten, Deckshäuser, Besatzungs- <strong>und</strong><br />
Betriebsräume, Laderäume <strong>und</strong> Tanks<br />
� Lade- <strong>und</strong> Löscheinrichtungen, Sonderausrüstungen<br />
� Rettungsausrüstungen, Schiffssicherungssysteme<br />
� Antriebsanlagen, Leistungsübertragung, Vortriebsanlagen<br />
� Hilfssysteme der Antriebsanlagen<br />
� Schiffsbetriebsanlagen<br />
� Elektrische Anlage<br />
Literatur G. Holbach, Einrichtung <strong>und</strong> Ausrüstung von Schiffen,<br />
Vorlesungen, TU Berlin, 2007<br />
STG, Jahrbücher, Schiffbautechnische Gesellschaft<br />
Hansa, International Maritime Journal, Schifffahrtsverlag „Hansa“<br />
Schiff & Hafen, International Publication for Shipping and Maritime<br />
Technology, Seehafen Verlag<br />
<strong>Schiffstechnik</strong> <strong>und</strong> Schiffbautechnologie, Seehafen Verlag, 2006<br />
Handbuch Schiffsbetriebstechnik, Seehafen Verlag, 2006<br />
Name:<br />
Unterschrift: Datum:<br />
V 16.2 Strömungslehre<br />
Modul 16 Schiffbau<br />
zugehörige Veranstaltung V 16.2 Strömungslehre<br />
Dozentinnen / Dozenten<br />
Position im Studienverlauf 4. Fachsemester<br />
Angebotsrhythmus Beginn jedes Sommersemester<br />
Semesterwochenst<strong>und</strong>en 2<br />
Workload (Zeitst<strong>und</strong>en) Präsenz: 30 Selbststudium: 60<br />
ECTS-Leistungspunkte (CP) 3<br />
Sprache Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />
Lehr- <strong>und</strong> Lernformen Vorlesung / Übung<br />
Prüfung (Form, Dauer) Studienleistung (SL): 1 Klausur, 60 Minuten<br />
Teilnahmevoraussetzungen Orientierungsprüfung<br />
Kompetenzziele fachlich-inhaltliche Kompetenzen<br />
Schlüsselkompetenzen<br />
�<br />
10
Inhalte<br />
Literatur<br />
Name:<br />
Unterschrift: Datum:<br />
V 16.3 Schiffbau<br />
Modul 16 Schiffbau<br />
zugehörige Veranstaltung V 16.3 Gr<strong>und</strong>lagen Schiffbau<br />
Dozentinnen / Dozenten<br />
Position im Studienverlauf 4. Fachsemester<br />
Angebotsrhythmus Beginn jedes Sommersemester<br />
Semesterwochenst<strong>und</strong>en 2<br />
Workload (Zeitst<strong>und</strong>en) Präsenz: 30 Selbststudium: 60<br />
ECTS-Leistungspunkte (CP) 3<br />
Sprache Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />
Lehr- <strong>und</strong> Lernformen Vorlesung<br />
Prüfung (Form, Dauer) Prüfungsleistung (PL): 1Klausur, 60 Minuten<br />
Teilnahmevoraussetzungen Orientierungsprüfung<br />
Kompetenzziele fachlich-inhaltliche Kompetenzen<br />
Die Studierenden verfügen über gr<strong>und</strong>legende Kenntnisse des<br />
Schiffbaus, um die Seetüchtigkeit <strong>und</strong> Sicherheit eines Schiffes zu<br />
gewährleisten <strong>und</strong> die Schwimmfähigkeit beurteilen zu können.<br />
Schlüsselkompetenzen<br />
� . /.<br />
Inhalte Werkstoffe.<br />
Hydromechanik <strong>und</strong> -dynamik (Auftrieb),<br />
Schwimmfähigkeit <strong>und</strong> Stabilität.<br />
Gr<strong>und</strong>kenntnisse des Schiffbaus <strong>und</strong> der Schiffsverbände sowie<br />
der korrekten Bezeichnungen der verschiedenen Teile.<br />
Fertigkeiten im Lesen von Zeichnungen <strong>und</strong> Plänen,<br />
- Linienriss, Spantriss, Hauptspant, Generalplan,<br />
Einrichtung <strong>und</strong> Ausrüstung<br />
- Schiffselemente. Entwurfsziele.<br />
- Schiffstypen<br />
- Klassifikation<br />
- Freibordabkommen (Freibordberechnung)<br />
- Schiffsvermessung (Messbrief: BRZ, NRZ))<br />
- Wartung <strong>und</strong> Instandsetzung im Schiffsbetrieb, Korrosionsschutz,<br />
Kräne, Hebezeuge<br />
- stark beanspruchte Schiffsverbände in Bezug auf Festigkeit<br />
(Ermüdung) <strong>und</strong> Korrosion (A. 866)<br />
- Bau- <strong>und</strong> Reparaturaufsicht.<br />
11
Werftabläufe, Aufgaben der Versuchsanstalten,<br />
Schiffswiderstand <strong>und</strong> Propulsion,<br />
Propellertheorie, Schuberzeuger, Propellerauswahl.<br />
Propellererregte Schwingungen (Vibration)<br />
Literatur VDSM (Hrsg.): <strong>Schiffstechnik</strong> <strong>und</strong> Schiffbautechnologie<br />
R. Schmitz (Script): Schiffbauk<strong>und</strong>e für Nautiker.<br />
Meier-Peter/ Bernhard (Hrsg.): Handbuch der<br />
Schiffsbetriebstechnik.<br />
EXPO 2000, EXPO am Meer (Hrsg.): Leidenschaft Schiffbau.<br />
Name:<br />
Unterschrift: Datum:<br />
V 16.4 Schiffssicherheit<br />
Modul 16 Schiffbau<br />
zugehörige Veranstaltung V 16.4 Schiffssicherheit<br />
Dozentinnen / Dozenten<br />
Position im Studienverlauf 4. Fachsemester<br />
Angebotsrhythmus Beginn jedes Sommersemester<br />
Semesterwochenst<strong>und</strong>en 2<br />
Workload (Zeitst<strong>und</strong>en) Präsenz: 30 Selbststudium: 60<br />
ECTS-Leistungspunkte (CP) 3<br />
Sprache Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />
Lehr- <strong>und</strong> Lernformen<br />
Prüfung (Form, Dauer) Studienleistung (SL): 1 Klausur, 60 Minuten<br />
Teilnahmevoraussetzungen Orientierungsprüfung<br />
Kompetenzziele fachlich-inhaltliche Kompetenzen<br />
�<br />
Inhalte<br />
Literatur<br />
Name:<br />
Unterschrift: Datum:<br />
M 17 Qualitätsmanagement<br />
Schlüsselkompetenzen<br />
Modulkennziffer 17<br />
Modulname Qualitätsmanagement<br />
Modultyp Pflichtmodul<br />
Position im Studienverlauf 3. Fachsemester<br />
zugehörige Veranstaltung V 17.1 Qualitätsmanagement<br />
12
Dozentinnen / Dozenten Prof. Dr.-Ing. Volker Staben<br />
Position im Studienverlauf 3. Fachsemester<br />
Angebotsrhythmus Beginn jedes Wintersemester<br />
Semesterwochenst<strong>und</strong>en 2<br />
Workload (Zeitst<strong>und</strong>en) Präsenz: 30 Selbststudium: 60<br />
ECTS-Leistungspunkte (CP) 3<br />
Sprache Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />
Lehr- <strong>und</strong> Lernformen Vorlesung<br />
Prüfung (Form, Dauer) Studienleistung (SL): Sonstige Prüfung (SP):<br />
Klausur, 120 Minuten, Schriftliche Ausfertigung, Vortrag<br />
Teilnahmevoraussetzungen Orientierungsprüfung<br />
Kompetenzziele fachlich-inhaltliche Kompetenzen<br />
Die Studierenden bekommen eine<br />
� Einführung in Gr<strong>und</strong>lagen, Philosophien, Begriffe, Werkzeuge<br />
<strong>und</strong> Methoden eines zeitgerechten industriellen<br />
Qualitätsmanagements<br />
Schlüsselkompetenzen<br />
� Die Studierenden erlernen die Gr<strong>und</strong>lagen des<br />
Qualitätsmanagements.<br />
� Ihre ökonomische Kompetenz wird dadurch gefestigt.<br />
� Sie bekommen die Fähigkeit fächerübergreifend zu denken.<br />
Inhalte Definition <strong>und</strong> Historie des Qualitätsbegriffs, Bedeutung von<br />
Qualität für ein Unternehmen. Prozessmodelle, statistische<br />
Beschreibung <strong>und</strong> Kenngrößen technischer Prozesse. Elementare<br />
Werkzeuge des Qualitätsmanagement wie Fehlersammelkarte,<br />
Ishikawa-Diagramm, Pareto-Analyse. Charakterisierung von<br />
Prozessen mittels Stichprobenplänen <strong>und</strong><br />
Prozessfähigkeitsindizes, statistische Prozesslenkung.<br />
Fortgeschrittene Werkzeuge wie Quality Function Deployment<br />
(QFD), Fehlermöglichkeits- <strong>und</strong> Einfluss-Analyse (FMEA). Qualität<br />
<strong>und</strong> Zuverlässigkeit technischer Systeme. Struktur <strong>und</strong><br />
Dokumentation von Qualitätsmanagementsystemen, die<br />
Normenreihe ISO 9000ff, Auditierung <strong>und</strong> Zertifizierung von<br />
Qualitätsmanagementsystemen, Produkt- <strong>und</strong> Prozessqualität,<br />
CE-Kennzeichen. Null-Fehler- <strong>und</strong> 6�-Programme, Total Quality<br />
Management (TQM) <strong>und</strong> Kaizen. Qualitätsbezogene Kosten,<br />
Qualität <strong>und</strong> Recht, Produkthaftung, Werkzeuge für Computer<br />
Assisted Quality (CAQ).<br />
Literatur 1. Masing, W.: Handbuch Qualitätsmanagement, 3. Auflage. Carl<br />
Hanser Verlag München, Wien 1994<br />
2. Pfeifer, T.: Qualitätsmanagement - Strategien, Methoden,<br />
Technik, 2. Auflage. Carl Hanser Verlag München, Wien 1994<br />
3. Geiger, W.: Qualitätslehre, 2. Auflage. Friedr. Vieweg & Sohn<br />
Verlagsgesellschaft mbH Braunschweig, Wiesbaden 1994<br />
4. Hering, E., Steparsch, W., Linder, M.: Zertifizierung nach DIN<br />
13
EN ISO 9000. VDI Verlag Düsseldorf 1996<br />
Rinne, H., Mittag, H.-J.: Statistische Methoden der<br />
Qualitätssicherung. Carl Hanser Verlag München 1989<br />
Name:<br />
Unterschrift: Datum:<br />
M 25 Konstruktion <strong>und</strong> Berechnung<br />
Modulkennziffer 25<br />
Modulname Konstruktion <strong>und</strong> Berechnung<br />
Modultyp Pflichtmodul<br />
Position im Studienverlauf 5. Fachsemester<br />
Angebotsrhythmus Beginn jedes Wintersemester<br />
Modulbeauftragter Prof. Dr.-Ing. Axel Krapoth<br />
Dozentinnen / Dozenten Prof. Dr.-Ing. Detlef Wirries<br />
Prof. Dr.-Ing. Axel Krapoth<br />
Semesterwochenst<strong>und</strong>en 8<br />
Workload (Zeitst<strong>und</strong>en) Präsenz: 120 Selbststudium: 180<br />
ECTS-Leistungspunkte (CP) 10<br />
Sprache Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />
Lehr- <strong>und</strong> Lernformen Vorlesung <strong>und</strong> Labor<br />
Prüfung (Form, Dauer) Studienleistung (SL): Sonstige Prüfung (SP): Klausur, 120<br />
Minuten, Hausaufgabe, Schriftliche Ausarbeitung, Vortrag<br />
Teilnahmevoraussetzungen Orientierungsprüfung<br />
Kompetenzziele fachlich-inhaltliche Kompetenzen<br />
Die Studierenden sind in der Lage, Maschinenbauprodukte zu<br />
entwickeln, zu berechnen <strong>und</strong> zu konstruieren<br />
Schlüsselkompetenzen<br />
Die Studierenden sind in der Lage,<br />
� industrielle computergestützte Methoden zur<br />
Produktentwicklung sicher anzuwenden<br />
zugeordnete Veranstaltungen V 25.1: K & B Konstruktion<br />
V 25.2: FE- Berechnungsmethoden<br />
Beschreibung der Veranstaltungen siehe Tabelle V 25.1 <strong>und</strong> V 25.2<br />
Name:<br />
Unterschrift: Datum:<br />
V 25.1 Methodische Konstruktion<br />
Modul 25 Konstruktion <strong>und</strong> Berechnung<br />
zugehörige Veranstaltung V 25.1 Methodische Konstruktion<br />
14
Dozentinnen / Dozenten Prof. Dr.-Ing. Detlef Wirries<br />
Position im Studienverlauf 5. Fachsemester<br />
Angebotsrhythmus Beginn jedes Wintersemester<br />
Semesterwochenst<strong>und</strong>en 4<br />
Workload (Zeitst<strong>und</strong>en) Präsenz: 60 Selbststudium: 90<br />
ECTS-Leistungspunkte (CP) 5<br />
Sprache Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />
Lehr- <strong>und</strong> Lernformen Vorlesung <strong>und</strong> Seminar mit Labor<br />
Prüfung (Form, Dauer) Zusammen mit FEM<br />
Teilnahmevoraussetzungen Orientierungsprüfung<br />
Kompetenzziele fachlich-inhaltliche Kompetenzen<br />
Die Studierenden sind in der Lage<br />
� Anlagen <strong>und</strong> Produkte mit den computergestützten Methoden<br />
wie CAD <strong>und</strong> Projektmanagementtools im industriellen<br />
Konstruktionsprozess zu entwickeln.<br />
Schlüsselkompetenzen<br />
Die Studierenden sind in der Lage,<br />
� industrielle computergestützte Methoden zur<br />
Produktentwicklung sicher anzuwenden.<br />
Inhalte � VDI-Richtlinien <strong>und</strong> Normen<br />
� Funktionsanalyse<br />
� Bewertungsmatrix<br />
� Projektmanagement<br />
� Netzplantechnik<br />
� Konzepterstellung<br />
� Konzeptpräsentation<br />
� Baugruppenstücklisten<br />
� Zeichnungserstellung<br />
� Kostenrechnung<br />
� 2D/3D-CAD-Modelle (SolidEdge, oder Unigraphics)<br />
� Durchführung der Produktentwicklung am CAD-Arbeitsplatz<br />
Literatur Bernd Schmid Schlembach CAD mit Solid Edge – J.Schlembach<br />
Fachverlag<br />
Stefan Britz/Florian Steinwender 3D-Konstruktion mit Solid Edge –<br />
Hanser Verlag<br />
Hoischen Technisches Zeichnen – Cornelsen Verlag<br />
Name:<br />
Unterschrift: Datum:<br />
V 25.2 FEM<br />
Modul 25 Konstruktion <strong>und</strong> Berechnung<br />
zugehörige Veranstaltung V 25.2 FEM<br />
15
Dozentinnen / Dozenten Prof. Dr.-Ing. Axel Krapoth<br />
Position im Studienverlauf 5. Fachsemester<br />
Angebotsrhythmus Beginn jedes Wintersemester<br />
Semesterwochenst<strong>und</strong>en 4<br />
Workload (Zeitst<strong>und</strong>en) Präsenz: 60 Selbststudium: 90<br />
ECTS-Leistungspunkte (CP) 5<br />
Sprache Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />
Lehr- <strong>und</strong> Lernformen Vorlesung<br />
Prüfung (Form, Dauer) Studienleistung (SL): Sonstige Prüfung (SP): Klausur, 120<br />
Minuten, Hausaufgabe, Schriftliche Ausarbeitung, Vortrag<br />
Teilnahmevoraussetzungen Orientierungsprüfung<br />
Kompetenzziele fachlich-inhaltliche Kompetenzen<br />
Die Studierenden sind in der Lage,<br />
� einfache lineare Probleme Festigkeitslehre <strong>und</strong> Wärmeleitung<br />
zu modellieren <strong>und</strong> mittels eines kommerziellen FEM-Codes<br />
zu analysieren.<br />
� Sie können die Ergebnisse der Berechnungen auswerten <strong>und</strong><br />
hinsichtlich relevanter Kriterien darstellen.<br />
� Sie können sich in die Bedienung von kommerziellen FEM-<br />
Codes einarbeiten.<br />
Schlüsselkompetenzen<br />
Die Studierenden sind in der Lage,<br />
� industrielle computergestützte Methoden zur<br />
Produktentwicklung sicher anzuwenden<br />
� Sie sind in der Lage, sich die zur Lösung anderer Probleme<br />
notwendigen Kenntnisse anzueignen oder sich auf den<br />
entsprechenden Gebieten selbstständig weiterzubilden.<br />
Inhalte Herleitung der FEM als numerisches Näherungsverfahren aus<br />
dem P.d.v.A.<br />
1.1 Aufgaben <strong>und</strong> Eigenschaften einer numerischen Näherung<br />
1.2 Das P.d.v.A. am Beispiel einer linearen Feder<br />
1.3 Elementare <strong>und</strong> globale Steifigkeitsmatrix. Lastvektor <strong>und</strong><br />
Vektor der Knotenfreiheitsgrade<br />
1.4 Transformation auf das globale Koordinatensystem<br />
1.5 Stabelemente<br />
1.6 Verschiedene Form-Funktionen. Realisierung von verteilten<br />
Lasten.<br />
2. Bernoulli’sche Balkenelemente<br />
3. Ebene Elemente<br />
3.1 Isoparametrische Ansätze<br />
3.2 Jacobi-Matrix<br />
3.3 Numerische Integration<br />
3.4 Ebener Spannungs- <strong>und</strong> Dehnungszustand<br />
4. Schalenelemente<br />
16
5. Wärmeleitungsprobleme<br />
5.1 Stationäre Probleme<br />
5.2 Instationäre Probleme<br />
5.2.1 Implizite Zeitintegration<br />
5.2.2 Explizite Zeitintegration<br />
5.2.3 Grenzen für die Zeitschrittgröße<br />
6. Dynamik <strong>und</strong> Schwingungen<br />
6.1 Implizite Dynamik<br />
6.2 Explizite Dynamik<br />
6.3 Eigenwert-Dynamik<br />
7. Ausgewählte Kapitel<br />
Literatur Steinbuch, R.; Finite Elemente – Ein Einstieg; Springer, 1997<br />
Zienkiewcz, O.C., Taylor, R.L.; The Finite Element Method, Vol.<br />
1&2; McGraw-Hill, 1989<br />
Name:<br />
Unterschrift: Datum:<br />
M 26 Betreutes Projektlabor<br />
Modulkennziffer 26<br />
Modulname Betreutes Projektlabor<br />
Modultyp Pflichtmodul<br />
Zugeordnete Veranstaltung V 26.1 Betreutes Projektlabor<br />
Position im Studienverlauf 5. Fachsemester<br />
Angebotsrhythmus Beginn jedes Wintersemester<br />
Modulbeauftragter Prof. Dr.-Ing. Holger Watter<br />
Dozentinnen / Dozenten<br />
Semesterwochenst<strong>und</strong>en 4<br />
Workload (Zeitst<strong>und</strong>en) Präsenz: 30 Selbststudium: 120<br />
ECTS-Leistungspunkte (CP) 5<br />
Sprache Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />
Lehr- <strong>und</strong> Lernformen Labor<br />
Prüfung (Form, Dauer) Studienleistung (SL) :Sonstige Prüfung (SP):<br />
Hausaufgabe, schriftliche Ausarbeitung <strong>und</strong> Vortrag<br />
Teilnahmevoraussetzungen Orientierungsprüfung<br />
Kompetenzziele fachlich-inhaltliche Kompetenzen<br />
Die Studierenden beherrschen die wichtigsten Gr<strong>und</strong>lagen der<br />
Ingenieurwissenschaften. Sie können begrenzte<br />
ingenieurtypische Projekte in einer Projektgruppe<br />
ergebnisorientiert organisieren <strong>und</strong> bearbeiten. Sie können die<br />
Ergebnisse aufbereiten, einen Report darüber schreiben <strong>und</strong> in<br />
einer Präsentation darstellen.<br />
Schlüsselkompetenzen<br />
Die Studierenden sind in der Lage,<br />
17
� erfolgreich <strong>und</strong> zielgerichtet zu handeln<br />
� Fächerübergreifendes Wissen anzuwenden<br />
� Ein Projekt selbst zu organisieren<br />
� Analytisch zu denken <strong>und</strong><br />
� Eventuell auftretende Probleme zu lösen.<br />
.<br />
Inhalte Die Studenten beherrschen die wichtigsten Gr<strong>und</strong>lagen<br />
der Ingenieurwissenschaften.<br />
Sie können begrenzte ingenieurtypische Projekte in einer<br />
Projektgruppe ergebnisorientiert organisieren <strong>und</strong> bearbeiten.<br />
Sie können die Ergebnisse aufbereiten, einen Report darüber<br />
schreiben <strong>und</strong> in einer Präsentation darstellen.<br />
Literatur<br />
Name:<br />
Unterschrift: Datum:<br />
M 27 Verbrennungskraftmaschinen 1<br />
Modulkennziffer 27<br />
Modulname Verbrennungskraftmaschinen 1<br />
Modultyp Pflichtmodul<br />
zugehörige Veranstaltung V 27.1 Verbrennungskraftmaschinen 1<br />
Dozentinnen / Dozenten Prof. Dr.-Ing. Michael Thiemke<br />
Position im Studienverlauf 6. Fachsemester<br />
Angebotsrhythmus Beginn jedes Sommersemester<br />
Semesterwochenst<strong>und</strong>en 4<br />
Workload (Zeitst<strong>und</strong>en) Präsenz: 60 Selbststudium: 90<br />
ECTS-Leistungspunkte (CP) 5<br />
Sprache Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />
Lehr- <strong>und</strong> Lernformen Vorlesung<br />
Prüfung (Form, Dauer) Prüfungsleistung (PL): Klausur, 120 Minuten<br />
Teilnahmevoraussetzungen Orientierungsprüfung<br />
Kompetenzziele fachlich-inhaltliche Kompetenzen<br />
Die Studierenden sind in der Lage, die Gr<strong>und</strong>lagen von<br />
Verbrennungskraftmaschinen zu erfassen. Sie können<br />
thermodynamische <strong>und</strong> mechanische Abhängigkeiten erkennen<br />
<strong>und</strong> die Wirkungsweise von Schiffsmotoren erklären.<br />
Schlüsselkompetenzen<br />
Die Studierenden sind in der Lage, Prozesse, Entwicklungen,<br />
Funktionen <strong>und</strong> Probleme von Verbrennungskraftmaschinen zu<br />
beurteilen.<br />
.<br />
Inhalte 1. Gr<strong>und</strong>lagen von Dieselmotoren <strong>und</strong> Gasturbinen, Klassifizierung<br />
<strong>und</strong> Einordnung,<br />
18
2. Betriebstoffe für Dieselmotoren <strong>und</strong> Gasturbinen, Anwendung<br />
3. Energieumwandlung, ideale <strong>und</strong> reale Arbeitsverfahren <strong>und</strong> –<br />
prozesse<br />
4. Leistungen <strong>und</strong> Kenngrößen<br />
4. Gaswechsel von 2 <strong>und</strong> 4 Takt Motoren<br />
5. Einspritzung, Zündverzug <strong>und</strong> Verbrennung<br />
6. Emissionen, Entstehung <strong>und</strong> Vermeidung von Schademissionen<br />
Literatur Bernhardt, Meier-Peter; Handbuch Schiffsbetriebstechnik<br />
Mollenhauer; Handbuch Dieselmotoren<br />
Van Basshuysen; Handbuch Verbrennungsmotor<br />
M 30 Elektrische Anlagen<br />
Modulkennziffer 30<br />
Modulname Elektrische Anlagen<br />
Modultyp Pflichtmodul<br />
Position im Studienverlauf 6. Fachsemester<br />
Angebotsrhythmus Beginn jedes Wintersemester<br />
Modulbeauftragter Prof. Dr.-Ing. Peter Sahner<br />
Dozentinnen / Dozenten Prof. Dr.-Ing. Peter Sahner<br />
Semesterwochenst<strong>und</strong>en 4<br />
Workload (Zeitst<strong>und</strong>en) Präsenz: 60 Selbststudium: 90<br />
ECTS-Leistungspunkte (CP) 5<br />
Sprache Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />
Lehr- <strong>und</strong> Lernformen 1x Vorlesung, 1x Labor<br />
Prüfung (Form, Dauer) 1Klausur, a 90 Minuten<br />
Teilnahmevoraussetzungen Orientierungsprüfung<br />
Kompetenzziele fachlich-inhaltliche Kompetenzen<br />
Die Studierenden sind in der Lage,<br />
� siehe Tabellen V 30.1, V 30.2<br />
Schlüsselkompetenzen<br />
Die Studierenden sind in der Lage,<br />
� siehe Tabellen siehe Tabellen V 30.1, V 30.2<br />
zugeordnete Veranstaltungen V 30.1: Elektrische Anlagen<br />
V 30.2: Elektrische Anlagen Labor<br />
Beschreibung der Veranstaltungen siehe Tabellen V 30.1, V 30.2<br />
Name:<br />
Unterschrift: Datum:<br />
19
V 30.1 Elektrische Anlagen<br />
Modul 30 Elektrische Anlagen<br />
zugehörige Veranstaltung V 30.1 Elektrische Anlagen<br />
Dozentinnen / Dozenten Prof. Dr.-Ing. Peter Sahner<br />
Position im Studienverlauf 6. Fachsemester<br />
Angebotsrhythmus Beginn jedes Sommersemester<br />
Semesterwochenst<strong>und</strong>en 2<br />
Workload (Zeitst<strong>und</strong>en) Präsenz: 30 Selbststudium: 60<br />
ECTS-Leistungspunkte (CP) 3<br />
Sprache Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />
Lehr- <strong>und</strong> Lernformen Vorlesung<br />
Prüfung (Form, Dauer) Prüfungsleistung (PL):<br />
1 Klausur, 90 Minuten<br />
Teilnahmevoraussetzungen Orientierungsprüfung<br />
Kompetenzziele fachlich-inhaltliche Kompetenzen<br />
� Die Studierenden sind mit dem Aufbau <strong>und</strong> Betrieb des<br />
Bordnetzes vertraut. Sie kennen die wichtigsten<br />
Installationskonzepte (Kabel, Schaltgeräte)<br />
� Sie erhalten einen Überblick über die Bauelemente der<br />
Leistungselektronik <strong>und</strong> deren Anwendung in Stromrichtern<br />
Inhalte<br />
Schlüsselkompetenzen<br />
� Sie kennen die Gefahren der Elektrizität <strong>und</strong> die<br />
entsprechenden Schutzmaßnahmen <strong>und</strong> sind über die<br />
Sicherheitsvorschriften für die Arbeit mit elektrischen<br />
Systemen informiert<br />
� Die technische Kompetenz der Studierenden wird erweitert.<br />
Vorschriften <strong>und</strong> Normen (DIN, UVV, Klasse)<br />
Besonderheiten des Bordnetzes<br />
- Leistungsbedarf<br />
- Netzsysteme ( Erdungssysteme)<br />
- Netzkonfigurationen<br />
Kurzschlüsse : Ursachen <strong>und</strong> Arten, Auswirkungen<br />
( Störlichtbogen, Elektromagnetische Kräfte)<br />
Mittelspannungsanlagen (Einführung)<br />
Kabel <strong>und</strong> Leitungen<br />
- Typenbezeichnung <strong>und</strong> Auswahlkriterien<br />
- Kabeldimensionierung<br />
- Schiffskabel<br />
- Brandschutz<br />
- Mittelspannungskabel<br />
Schaltgeräte<br />
20
- Einteilung <strong>und</strong> Kenngrößen<br />
- Schaltlichtbogen<br />
Anlagenschutz<br />
- Übersicht ( Aufgabe, Schutzgeräte,, Selektivität )<br />
- Sicherungen( Aufbau, Auslösekennlinien, Arbeitsschutz )<br />
- Leitungsschutzschalter<br />
- Leistungsschalter<br />
- Motorschutzschalter<br />
- FI-Schutzschalter<br />
- Erhöhung der Kurzschlussleistung (Duplexdrossel, Is-Begrenzer)<br />
Personenschutz<br />
- Stromgefährdung<br />
- Schutzarten<br />
- netzunabhängige Schutzmaßnahmen<br />
- netzabhängige Schutzmaßnahmen (IT-System, TN-System<br />
,Potentialausgleich / Erder)<br />
Leistungselektronik<br />
- Stromrichterfunktionen<br />
- Bauelemente<br />
- netzgeführte Stromrichter (M1, M3, B6, B12)<br />
- Wechselstromsteller<br />
- Umrichter (Prinzipien)<br />
Literatur Knies, Schierack, K.: Elektrische Anlagentechnik<br />
Carl Hanser Verlag München<br />
Meier-Peter, Bernhardt: Handbuch Schiffsbetriebstechnik<br />
Seehafen-Verlag Hamburg 2006<br />
Germanischer Lloyd: Klassifikations- <strong>und</strong> Bauvorschriften I -Teil 1 -<br />
Seeschiffe , Kapitel 3 - Elektrische Anlagen<br />
Seip, G.G.: Elektrische Installationstechnik Band 1 + 2<br />
Siemens AG<br />
DIN VDE 0100 Beuth-Verlag<br />
Stephan, W.; Leistungselektronik interaktiv Fachbuchverlag<br />
Leipzig 2001<br />
Hall,D.T.;Practical marine electrical knowledge Witherby<br />
Publishers, London 1999<br />
Jahrbücher der Schiffstechnischen Gesellschaft (STG)<br />
Giersch; Harthus, Vogelsang; Elektrische Maschinen<br />
B. G. Teubner Stuttgart . Leipzig<br />
Name:<br />
Unterschrift: Datum:<br />
21
V 30.2 Elektrische Anlagen Labor<br />
Modul 30 Elektrische Anlagen<br />
zugehörige Veranstaltung V 30.2 Elektrische Anlagen Labor<br />
Dozentinnen / Dozenten Prof. Dr.-Ing. Peter Sahner<br />
Position im Studienverlauf 6. Fachsemester<br />
Angebotsrhythmus Beginn jedes Wintersemester<br />
Semesterwochenst<strong>und</strong>en 2<br />
Workload (Zeitst<strong>und</strong>en) Präsenz: 30 Selbststudium: 30<br />
ECTS-Leistungspunkte (CP) 2<br />
Sprache Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />
Lehr- <strong>und</strong> Lernformen Labor<br />
Prüfung (Form, Dauer) Erforderlich für Anerkennung elektrische Anlagen<br />
Teilnahmevoraussetzungen Orientierungsprüfung<br />
Kompetenzziele fachlich-inhaltliche Kompetenzen<br />
� Die Studierenden vertiefen <strong>und</strong> erweitern ihre Kenntnisse<br />
aus der Vorlesung Elektrische Anlagen durch die praktische<br />
Anwendung dieser im Labor<br />
Schlüsselkompetenzen<br />
� Anwendungsorientiertes Handeln<br />
� Teamfähigkeit<br />
� Problemlösungsfertigkeiten<br />
Inhalte Schutzmaßnahmen nach DIN VDE 100<br />
Leistungsmessung<br />
Isolationsmessung<br />
Steuerung von Motoren mit Schützen<br />
Transformator 1<br />
Stromrichter<br />
Literatur Knies, Schierack, K.: Elektrische Anlagentechnik<br />
Carl Hanser Verlag München<br />
Meier-Peter, Bernhardt: Handbuch Schiffsbetriebstechnik<br />
Seehafen-Verlag Hamburg 2006<br />
Germanischer Lloyd: Klassifikations- <strong>und</strong> Bauvorschriften I -Teil 1 -<br />
Seeschiffe , Kapitel 3 - Elektrische Anlagen<br />
Seip, G.G.: Elektrische Installationstechnik Band 1 + 2<br />
Siemens AG<br />
DIN VDE 0100 Beuth-Verlag<br />
Stephan, W.; Leistungselektronik interaktiv Fachbuchverlag<br />
Leipzig 2001<br />
Hall,D.T.;Practical marine electrical knowledge Witherby<br />
Publishers, London 1999<br />
Jahrbücher der Schiffstechnischen Gesellschaft (STG)<br />
Giersch; Harthus, Vogelsang; Elektrische Maschinen<br />
B. G. Teubner Stuttgart . Leipzig<br />
Name:<br />
22
Unterschrift: Datum:<br />
M 31 <strong>Schiffstechnik</strong><br />
Modulkennziffer 31<br />
Modulname <strong>Schiffstechnik</strong><br />
Modultyp Pflichtmodul<br />
Position im Studienverlauf 6. Fachsemester<br />
Angebotsrhythmus Beginn jedes Sommersemester<br />
Modulbeauftragter Prof. Dr.-Ing. Holger Watter<br />
Dozentinnen / Dozenten Prof. Dr.-Ing. Holger Watter<br />
Semesterwochenst<strong>und</strong>en 6<br />
Workload (Zeitst<strong>und</strong>en) Präsenz: 90 Selbststudium: 150<br />
ECTS-Leistungspunkte (CP) 8<br />
Sprache Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />
Lehr- <strong>und</strong> Lernformen 3x Vorlesung<br />
Prüfung (Form, Dauer) 2 Studienleistungen (SL): Sonstige Prüfungen (SP): Klausur, 90<br />
bzw. 120 Minuten, Schriftliche Ausarbeitung, Vortrag<br />
Teilnahmevoraussetzungen Orientierungsprüfung<br />
Kompetenzziele fachlich-inhaltliche Kompetenzen<br />
Die Studierenden sind in der Lage,<br />
� siehe Tabellen V 31.1, V 31.2, V 31.3<br />
Schlüsselkompetenzen<br />
Die Studierenden sind in der Lage,<br />
� siehe Tabellen V 31.1, V 31.2, V 31.3<br />
zugeordnete Veranstaltungen V 31.1: Anlagentechnik<br />
V 31.2: Schiffsfertigung<br />
V 31.3: Maschinenraumgestaltung<br />
Beschreibung der Veranstaltungen siehe Tabellen V 31.1, V 31.2, V 31.3<br />
Name:<br />
Unterschrift: Datum:<br />
V 31.1 Anlagentechnik<br />
Modulkennziffer 31 <strong>Schiffstechnik</strong><br />
Zugehörige Veranstaltung V 31.2 1 Anlagentechnik<br />
Dozentinnen/Dozenten<br />
Position im Studienverlauf 6. Fachsemester<br />
Angebotsrhythmus Beginn jedes Wintersemester<br />
Semesterwochenst<strong>und</strong>en 2<br />
Workload (Zeitst<strong>und</strong>en) Präsenz: 30 Selbststudium: 30<br />
23
ECTS-Leistungspunkte (CP) 2<br />
Sprache Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />
Lehr- <strong>und</strong> Lernformen Vorlesung<br />
Prüfung (Form, Dauer) Studienleistung (SL):<br />
1 Klausur, 90 Minuten<br />
Teilnahmevoraussetzungen Orientierungsprüfung<br />
Kompetenzziele fachlich-inhaltliche Kompetenzen<br />
Die Studierenden verfügen über gr<strong>und</strong>legende Kenntnisse, um:<br />
� die zu installierenden Systeme nach wirtschaftlichen,<br />
sicherheits- <strong>und</strong> versorgungstechnischen Gesichtspunkten zu<br />
gestalten, die Hauptabmessungen zu bestimmen <strong>und</strong><br />
geeignete Werkstoffe auszuwählen<br />
� das dynamische Betriebsverhalten der Systeme zu<br />
bestimmen <strong>und</strong> Sicherheitseinrichtungen zur Vermeidung der<br />
Überschreitung von Grenzwerten auszuwählen<br />
Die Studierenden sind in der Lage, räumlich komplexe Systeme<br />
in eben Strukturen darzustellen.<br />
Schlüsselkompetenzen<br />
Die Problemlösungsfähigkeit der Studierenden wird erweitert.<br />
Inhalte � Gr<strong>und</strong>lagen der konstruktiven Gestaltung von Ver- <strong>und</strong><br />
Entsorgungssystemen<br />
� Gr<strong>und</strong>lagen der Umströmung von Körpern <strong>und</strong> der<br />
Durchströmung von Rohren durch ein- <strong>und</strong> mehrphasige<br />
Stoffe<br />
� Statisches <strong>und</strong> dynamisches Betriebsverhalten von<br />
Rohrleitungssystemen<br />
� Konstruktionselemente im Rohrleitungsbau<br />
� Rohrleitungsstatik<br />
Literatur GL: „Bauvorschriften für Seeschiffe“<br />
Meier-Peter/Bernhardt: „Handbuch Schiffsbetriebstechnik“<br />
Name:<br />
Unterschrift: Datum:<br />
24
V 31.2 Schiffsfertigung<br />
Modul 31 <strong>Schiffstechnik</strong><br />
zugehörige Veranstaltung V 31.2 Schiffsfertigung<br />
Dozentinnen / Dozenten N.N.<br />
Position im Studienverlauf 6. Fachsemester<br />
Angebotsrhythmus Beginn jedes Sommersemester<br />
Semesterwochenst<strong>und</strong>en 2<br />
Workload (Zeitst<strong>und</strong>en) Präsenz: 30 Selbststudium: 30<br />
ECTS-Leistungspunkte (CP) 2<br />
Sprache Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />
Lehr- <strong>und</strong> Lernformen Vorlesung<br />
Prüfung (Form, Dauer) Zusammen mit Maschinenraumgestaltung<br />
Teilnahmevoraussetzungen Orientierungsprüfung<br />
Kompetenzziele fachlich-inhaltliche Kompetenzen<br />
Die Studierenden kennen<br />
� Die Schiffbaumaterialien <strong>und</strong> ihre Eigenschaften<br />
� Trennverfahren <strong>und</strong> ihre Anwendung<br />
� Umformverfahren<br />
� Montageverfahren<br />
� Fügeverfahren<br />
� Sektions- <strong>und</strong> Blockbauweise<br />
Schlüsselkompetenzen<br />
Die Studierenden sind in der Lage,<br />
� das erlernte Wissen anzuwenden<br />
� um den Fertigungsablauf zu beurteilen<br />
� <strong>und</strong> Vor- <strong>und</strong> Nachteile von Fertigungsverfahren einzuschätzen<br />
� sowie Fehler in der Schiffsfertigung zu erkennen<br />
Inhalte � Eigenschaften von Stahl <strong>und</strong> Aluminium im Schiffbau<br />
� thermische <strong>und</strong> mechanische Trennverfahren<br />
� Platten- <strong>und</strong> Profilformung<br />
� Sektionsbauweise, Fertigungsfolge<br />
� Fertigung von ebenen <strong>und</strong> gekrümmten Flachbaugruppen<br />
� Träger- <strong>und</strong> Rahmenfertigung<br />
� Bau von Sektionen, Großsektionen, Endmontage<br />
� Positionieren<br />
� Fügen von Bauteilen, Schweißverfahren<br />
� Hebe- <strong>und</strong> Transporteinrichtungen<br />
Literatur D. Steinhauer, Schiffsfertigung, Vorlesungen, TU Berlin, 2007<br />
STG, Jahrbücher, Schiffbautechnische Gesellschaft<br />
Hansa, International Maritime Journal, Schifffahrtsverlag „Hansa“<br />
Schiff & Hafen, International Publication for Shipping and Maritime<br />
Technology,<br />
25
Seehafen Verlag<br />
<strong>Schiffstechnik</strong> <strong>und</strong> Schiffbautechnologie, Seehafen Verlag, 2006<br />
Name:<br />
Unterschrift: Datum:<br />
V 29.3 <strong>Schiffstechnik</strong><br />
Modul 29 <strong>Schiffstechnik</strong><br />
zugehörige Veranstaltung V 29.3 Maschinenraumgestaltung<br />
Dozentinnen / Dozenten N.N.<br />
Position im Studienverlauf 6. Fachsemester<br />
Angebotsrhythmus Beginn jedes Sommersemester<br />
Semesterwochenst<strong>und</strong>en 2<br />
Workload (Zeitst<strong>und</strong>en) Präsenz: 30 Selbststudium: 60<br />
ECTS-Leistungspunkte (CP) 3<br />
Sprache Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />
Lehr- <strong>und</strong> Lernformen Vorlesung<br />
Prüfung (Form, Dauer) Studienleistung (SL): Sonstige Prüfung (SP): Klausur, 120<br />
Minuten, Schriftliche Ausarbeitung, Vortrag<br />
Teilnahmevoraussetzungen Orientierungsprüfung<br />
Kompetenzziele fachlich-inhaltliche Kompetenzen<br />
Die Studierenden kennen<br />
� die unterschiedlichen Schiffstypen <strong>und</strong> ihre Antriebssysteme<br />
Inhalte � Antriebsanlagen<br />
� die Antriebsanlagen, ihr Aufbau <strong>und</strong> ihre optimale Anordnung<br />
im Schiff<br />
� die Hilfsanlagen, Stromerzeuger <strong>und</strong> schiffsbetrieblichen<br />
Anlagen sowie ihre optimale Anordnung im Schiff<br />
� Alternativen der Anordnung der Anlagen <strong>und</strong> Systeme im Schiff<br />
� Betriebs- <strong>und</strong> Wartungserfordernisse<br />
Schlüsselkompetenzen<br />
Die Studierenden sind in der Lage,<br />
� das erlernte Wissen anzuwenden <strong>und</strong> hierdurch bei Auslegung,<br />
Montage <strong>und</strong> Betrieb von Schiffsantriebsanlagen mögliche Vor-<br />
<strong>und</strong> Nachteile der Maschinenraumgestaltung sowie mögliche<br />
Fehler zu erkennen<br />
� Wellenanlagen, Getriebe <strong>und</strong> Kupplungen<br />
� Propulsionsanlagen<br />
� Hilfssysteme<br />
� Rohrleitungen, Pumpen, Aggregate<br />
� Zuordnung <strong>und</strong> räumliche Aufteilung der Systeme im<br />
Maschinenraum<br />
� Montage, Demontage <strong>und</strong> Wartung der Systeme <strong>und</strong> ihre<br />
Auswirkungen auf die Gestaltung des Maschinenraums<br />
26
� Kontrolle Steuerung <strong>und</strong> Betrieb im Maschinenraum <strong>und</strong> ihre<br />
Auswirkungen auf den Entwurfsprozess<br />
Literatur G. Holbach, Einrichtung <strong>und</strong> Ausrüstung von Schiffen,<br />
Vorlesungen, TU Berlin, 2007<br />
STG, Jahrbücher, Schiffbautechnische Gesellschaft<br />
Hansa, International Maritime Journal, Schifffahrtsverlag „Hansa“<br />
Schiff & Hafen, International Publication for Shipping and Maritime<br />
Technology,<br />
Seehafen Verlag<br />
<strong>Schiffstechnik</strong> <strong>und</strong> Schiffbautechnologie, Seehafen Verlag, 2006<br />
Handbuch Schiffsbetriebstechnik, Seehafen Verlag, 2006<br />
Name:<br />
Unterschrift: Datum:<br />
M 32 Recht 2<br />
Modulkennziffer 32<br />
Modulname Recht 2<br />
Modultyp Pflichtmodul<br />
Position im Studienverlauf 6. Fachsemester<br />
zugehörige Veranstaltung V 32.1 Wirtschaftsrecht<br />
Dozentinnen / Dozenten<br />
Position im Studienverlauf 6. Fachsemester<br />
Angebotsrhythmus Beginn jedes Sommersemester<br />
Semesterwochenst<strong>und</strong>en 2<br />
Workload (Zeitst<strong>und</strong>en) Präsenz: 30 Selbststudium: 30<br />
ECTS-Leistungspunkte (CP) 2<br />
Sprache Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />
Lehr- <strong>und</strong> Lernformen Vorlesung<br />
Prüfung (Form, Dauer) Studienleistung (SL)<br />
1 Klausur, 120 Minuten, 1 schriftliche Ausarbeitung, 1 Vortrag<br />
Teilnahmevoraussetzungen keine<br />
Kompetenzziele fachlich-inhaltliche Kompetenzen<br />
� Die Studierenden lernen mit dem Gesetz umzugehen <strong>und</strong><br />
können die erlernten Inhalte praktischen Fällen zuordnen.<br />
� Sie sind in der Lage, einfache rechtliche Probleme zu<br />
erkennen, zu analysieren <strong>und</strong> zu lösen.<br />
Schlüsselkompetenzen<br />
� Problemlösungsfähigkeit<br />
� Analysefähigkeit<br />
Inhalte � Vertragliche <strong>und</strong> gesetzliche Schuldverhältnisse<br />
� Schadensersatz <strong>und</strong> sonstige Haftungsfragen<br />
27
� Internationale Aspekte<br />
� Rechtsdurchsetzung <strong>und</strong> Verfahrensfragen<br />
Literatur Führich: Wirtschaftsprivatrecht<br />
Müssig: Wirtschaftsprivatrecht<br />
Aunert-Micus u.a.: Wirtschaftsprivatrecht<br />
Name:<br />
Unterschrift: Datum:<br />
M 33 Berufspraktikum<br />
Modulkennziffer 33<br />
Modulname Berufspraktikum, Projekt<br />
Modultyp Pflichtmodul<br />
Position im Studienverlauf 7. Fachsemester<br />
Angebotsrhythmus Beginn jedes Wintersemesters<br />
Modulbeauftragter Prof. Dr. –Ing. Holger Watter<br />
Dozentinnen / Dozenten Prof. Dr.-Ing. Holger Watter<br />
Semesterwochenst<strong>und</strong>en 3 Monate<br />
Workload (Zeitst<strong>und</strong>en) Präsenz: Selbststudium:<br />
ECTS-Leistungspunkte (CP) 18<br />
Sprache Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />
Lehr- <strong>und</strong> Lernformen<br />
Prüfung (Form, Dauer) Studienleistung (SL): Dauer 3 Monate, Praktikumsbericht gemäß<br />
Praktikumsordnung <strong>Schiffstechnik</strong>, Schwerpunkt<br />
Schiffsmaschinenbau §9. 3<br />
Teilnahmevoraussetzungen Orientierungsprüfung<br />
Kompetenzziele fachlich-inhaltliche Kompetenzen<br />
Die Studierenden sind in der Lage,<br />
� Erlerntes Wissen aus verschiedenen Bereichen zu verknüpfen.<br />
�<br />
Schlüsselkompetenzen<br />
Die Studierenden sind in der Lage,<br />
� Teamfähig zu arbeiten.<br />
� Probleme zu analysieren <strong>und</strong> zu lösen.<br />
� Ihr erlerntes Wissen anzuwenden.<br />
� Sich selbst zu organisieren<br />
� Und konstruktiv mit Kritik umzugehen.<br />
Inhalte � Auslegung von Versorgungs- <strong>und</strong> Hilfssystemen auf Schiffen<br />
� Anlagenkonstruktion<br />
� Rohrleitungsauslegung- <strong>und</strong> Konstruktion<br />
� Auslegung <strong>und</strong> Dimensionierung von<br />
schiffsmaschinenbaulichen Komponenten<br />
� F<strong>und</strong>amentierungen<br />
� Inbetriebnahme Motor<br />
� Inbetriebnahme Anlagen<br />
28
� Schiffselektrotechnik<br />
Literatur<br />
Name:<br />
Unterschrift: Datum:<br />
29
6. Muster-Diploma-Supplement
Diploma Supplement<br />
This Diploma Supplement model was developed by the European Commission, Council of Europe and UNESCO/CEPES.The purpose of the supplement is to provide sufficient<br />
independent data to improve the international 'transparency' and fair academic and professional recognition of qualifications (diplomas, degrees, certificates, etc.). It is designed to<br />
provide a description of the nature, level, context, content and status of the studies that were pursued and successfully completed by the individual named on the original qualification to<br />
which this supplement is appended. It should be free from any value judgements, equivalence statements or suggestions about recognition. Information in all eight sections should be<br />
provided. Where information is not provided, an explanation should give the reason why.<br />
1. HOLDER OF THE QUALIFICATION<br />
1.1 Family Name<br />
Mustermann<br />
1.2 First Name<br />
Max<br />
1.3 Date, Place, Country of Birth<br />
9 September 1985, Musterstadt, Germany<br />
1.4 Student ID Number or Code<br />
No.: 999999<br />
2. QUALIFICATION<br />
2.1 Name of Qualification<br />
Bachelor of Engineering (B.Eng.)<br />
Title Conferred<br />
n.a.<br />
2.2 Main Field(s) of Study<br />
Ship Technology<br />
2.3 Institution Awarding the Qualification<br />
Fachhochschule Flensburg / Flensburg University of Applied Sciences<br />
Status (Type / Control)<br />
University of Applied Sciences / State Institution<br />
2.4 Institution Administering Studies<br />
Fachhochschule Flensburg / Flensburg University of Applied Sciences<br />
Status (Type / Control)<br />
University of Applied Sciences / State Institution<br />
2.5 Language(s) of Instruction/Examination<br />
Page 1 of 5<br />
German and English
3. LEVEL OF THE QUALIFICATION<br />
3.1 Level<br />
First degree, with thesis<br />
3.2 Official Length of Programme<br />
Specialization in Marine Engineering: 3,5 years / 210 ETCS-Credits<br />
Specialization in Technical Ship Operation: 4 years / 240 ETCS-Credits<br />
3.3 Access Requirements<br />
Page 2 of 5<br />
Diploma Supplement Max Mustermann<br />
Qualification for entrance to university of applied sciences or qualification for entrance to university<br />
For the specialization in Technical Ship Operation the student need to have one of the additional<br />
qualifications:<br />
� Ships Mechanic or<br />
� Technical Ship Officer Assistant or<br />
� Vocational training in a metal or electrical profession and 12 months of sea time as an engine<br />
cadet<br />
For the internship model in the specialisation Technical Ship Operation (2 internships each 26 weeks<br />
during the study programme) the student has to fulfil the following requirements:<br />
Proof that he has completed a 26 weeks pre study technical internship<br />
Internship contract<br />
Seafarer medical (Engine)<br />
Basic safety training<br />
4. CONTENTS AND RESULTS GAINED<br />
4.1 Mode of Study<br />
Full-time<br />
4.2 Programme Requirements<br />
The student of the specialization technical ship operation has successfully completed the following<br />
modules:<br />
practical training (26 weeks), mathematics I-II, physics, electrical technology I-II, engineering mechanics I-II,<br />
materials science, english, business administration, informatics, thermodynamics, law, steam plants, maintenance<br />
and repair technology, electrical machines, human resources management, machine components, control<br />
engineering, machines and plant technology, internal combustion engines, ship building, operation media,<br />
dangerous goods, tanker familiarization, electrical installations, automatization technology, machine dynamics,<br />
technical ship operation, plant engineering, shaft/couplings/gears, bachelor thesis, practical training (26 weeks);<br />
With the completion of the study programme Technical Ship Operation the student will fulfil the requirements<br />
according to § 15 SchOffzAusbV. She or he will receive a certificate of competence as technical officer of watch.<br />
The student of the specialization marine engineering has successfully completed the following modules:<br />
mathematics I-II, physics, electrical technology I-II, engineering mechanics I-III, materials science, english, business<br />
administration, informatics, thermodynamics, law, CA methods of construction, steam plants, electrical machines,<br />
CAD construction, machine components, control engineering, fluid mechanics, machines and plant technology, ship<br />
technology, management, internal combustion engines, automatization technology, construction and calculation,<br />
project laboratory, machine dynamics, technical operation, technical ship operation, electrical installations,<br />
shaft/couplings/gears, practical training (12 weeks), bachelor thesis<br />
4.3 Programme Details<br />
See Notenkonto (Transcript) for list of courses and grades, and Prüfungszeugnis (Final Examination<br />
Certificate) for subjects offered in final examinations (written and oral), and topic of thesis, including<br />
evaluations.
4.4 Grading Scheme<br />
Grade Distribution<br />
Sehr gut from 1.0 to 1.5 Very Good<br />
Gut above 1.5 to 2.5 Good<br />
Befriedigend above 2.5 to 3.5 Satisfactory<br />
Ausreichend above 3.5 to 4.0 Sufficient<br />
Nicht ausreichend above 4.0 Non-Sufficient/Fail<br />
4.5 Overall Classification<br />
Gut (1.7)<br />
5. FUNCTION OF THE QUALIFICATION<br />
5.1 Access to Further Studies<br />
Qualifies to apply for admission to Master courses.<br />
5.2 Professional Status<br />
---------<br />
6. ADDITIONAL INFORMATION<br />
6.1 Additional Information<br />
Page 3 of 5<br />
Diploma Supplement Max Mustermann<br />
The participants of the specialization Technical Ship Operation can apply upon the successfully<br />
completed study programme for Certificate of Competence as Technical Officer of Watch.<br />
6.2 Further Information Sources<br />
On the institution: www.fh-flensburg.de<br />
On the programme: www.fh-flensburg.de/fhfl/schiffstechnik.html<br />
For national information: www.higher-education-compass.hrk.de<br />
7. CERTIFICATION<br />
This Diploma Supplement refers to the following original documents:<br />
Urk<strong>und</strong>e über die Verleihung des Bachelorgrades dated 25 November 2010<br />
Prüfungszeugnis dated 25 November 2010<br />
Notenkonto dated 25 November 2010<br />
Certification Date: 25 November 2010<br />
(Official Stamp/Seal)<br />
8. NATIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM<br />
Prof. Dr. Ursula Heller<br />
Chairperson<br />
Examination Committee<br />
The information on the national higher education system on the following pages provides a context for<br />
the qualification and the type of higher education that awarded it.
8. INFORMATION ON THE GERMAN HIGHER EDUCATION<br />
SYSTEM 1<br />
8.1 Types of Institutions and Institutional Status<br />
Higher education (HE) studies in Germany are offered at three types of<br />
Higher Education Institutions (HEI). 2<br />
- Universitäten (Universities) including various specialized institutions,<br />
offer the whole range of academic disciplines. In the German tradition,<br />
universities focus in particular on basic research so that advanced stages<br />
of study have mainly theoretical orientation and research-oriented<br />
components.<br />
- Fachhochschulen (Universities of Applied Sciences) concentrate their<br />
study programmes in engineering and other technical disciplines,<br />
business-related studies, social work, and design areas. The common<br />
mission of applied research and development implies a distinct<br />
application-oriented focus and professional character of studies, which<br />
include integrated and supervised work assignments in industry,<br />
enterprises or other relevant institutions.<br />
- Kunst- <strong>und</strong> Musikhochschulen (Universities of Art/Music) offer studies for<br />
artistic careers in fine arts, performing arts and music; in such fields as<br />
directing, production, writing in theatre, film, and other media; and in a<br />
variety of design areas, architecture, media and communication.<br />
Higher Education Institutions are either state or state-recognized<br />
institutions. In their operations, including the organization of studies and<br />
the designation and award of degrees, they are both subject to higher<br />
education legislation.<br />
Table 1: Institutions, Programmes and Degrees in German Higher Education<br />
8.2 Types of Programmes and Degrees Awarded<br />
Page 4 of 5<br />
Diploma Supplement Max Mustermann<br />
Studies in all three types of institutions have traditionally been offered in<br />
integrated "long" (one-tier) programmes leading to Diplom- or Magister<br />
Artium degrees or completed by a Staatsprüfung (State Examination).<br />
Within the framework of the Bologna-Process one-tier study programmes<br />
are successively being replaced by a two-tier study system. Since 1998,<br />
a scheme of first- and second-level degree programmes (Bachelor and<br />
Master) was introduced to be offered parallel to or instead of integrated<br />
"long" programmes. These programmes are designed to provide<br />
enlarged variety and flexibility to students in planning and pursuing<br />
educational objectives, they also enhance international compatibility of<br />
studies.<br />
For details cf. Sec. 8.4.1, 8.4.2, and 8.4.3 respectively. Table 1 provides<br />
a synoptic summary.<br />
8.3 Approval/Accreditation of Programmes and Degrees<br />
To ensure quality and comparability of qualifications, the organization of<br />
studies and general degree requirements have to conform to principles<br />
and regulations established by the Standing Conference of the Ministers<br />
of Education and Cultural Affairs of the Länder in the Federal Republic of<br />
Germany (KMK). 3 In 1999, a system of accreditation for programmes of<br />
study has become operational <strong>und</strong>er the control of an Accreditation<br />
Council at national level. All new programmes have to be accredited<br />
<strong>und</strong>er this scheme; after a successful accreditation they receive the<br />
quality-label of the Accreditation Council. 4
8.4 Organization and Structure of Studies<br />
The following programmes apply to all three types of institutions.<br />
Bachelor’s and Master’s study courses may be studied consecutively, at<br />
various higher education institutions, at different types of higher education<br />
institutions and with phases of professional work between the first and the<br />
second qualification. The organization of the study programmes makes<br />
use of modular components and of the European Credit Transfer and<br />
Accumulation System (ECTS) with 30 credits corresponding to one<br />
semester.<br />
8.4.1 Bachelor<br />
Bachelor degree study programmes lay the academic fo<strong>und</strong>ations,<br />
provide methodological skills and lead to qualifications related to the<br />
professional field. The Bachelor degree is awarded after 3 to 4 years.<br />
The Bachelor degree programme includes a thesis requirement. Study<br />
courses leading to the Bachelor degree must be accredited according to<br />
the Law establishing a Fo<strong>und</strong>ation for the Accreditation of Study<br />
Programmes in Germany. 5<br />
First degree programmes (Bachelor) lead to Bachelor of Arts (B.A.),<br />
Bachelor of Science (B.Sc.), Bachelor of Engineering (B.Eng.), Bachelor<br />
of Laws (LL.B.), Bachelor of Fine Arts (B.F.A.) or Bachelor of Music<br />
(B.Mus.).<br />
8.4.2 Master<br />
Master is the second degree after another 1 to 2 years. Master study<br />
programmes must be differentiated by the profile types “more practiceoriented”<br />
and “more research-oriented”. Higher Education Institutions<br />
define the profile of each Master study programme.<br />
The Master degree study programme includes a thesis requirement. Study<br />
programmes leading to the Master degree must be accredited according<br />
to the Law establishing a Fo<strong>und</strong>ation for the Accreditation of Study<br />
Programmes in Germany. 6<br />
Second degree programmes (Master) lead to Master of Arts (M.A.),<br />
Master of Science (M.Sc.), Master of Engineering (M.Eng.), Master of<br />
Laws (L.L.M), Master of Fine Arts (M.F.A.) or Master of Music (M.Mus.).<br />
Master study programmes, which are designed for continuing education or<br />
which do not build on the preceding Bachelor study programmes in terms<br />
of their content, may carry other designations (e.g. MBA).<br />
8.4.3 Integrated "Long" Programmes (One-Tier):<br />
Diplom degrees, Magister Artium, Staatsprüfung<br />
An integrated study programme is either mono-disciplinary (Diplom<br />
degrees, most programmes completed by a Staatsprüfung) or comprises<br />
a combination of either two major or one major and two minor fields<br />
(Magister Artium). The first stage (1.5 to 2 years) focuses on broad<br />
orientations and fo<strong>und</strong>ations of the field(s) of study. An Intermediate<br />
Examination (Diplom-Vorprüfung for Diplom degrees; Zwischenprüfung or<br />
credit requirements for the Magister Artium) is prerequisite to enter the<br />
second stage of advanced studies and specializations. Degree<br />
requirements include submission of a thesis (up to 6 months duration) and<br />
comprehensive final written and oral examinations. Similar regulations<br />
apply to studies leading to a Staatsprüfung. The level of qualification is<br />
equivalent to the Master level.<br />
- Integrated studies at Universitäten (U) last 4 to 5 years (Diplom degree,<br />
Magister Artium) or 3 to 6.5 years (Staatsprüfung). The Diplom degree is<br />
awarded in engineering disciplines, the natural sciences as well as<br />
economics and business. In the humanities, the corresponding degree is<br />
usually the Magister Artium (M.A.). In the social sciences, the practice<br />
varies as a matter of institutional traditions. Studies preparing for the legal,<br />
medical, pharmaceutical and teaching professions are completed by a<br />
Staatsprüfung.<br />
The three qualifications (Diplom, Magister Artium and Staatsprüfung) are<br />
academically equivalent. They qualify to apply for admission to doctoral<br />
studies. Further prerequisites for admission may be defined by the Higher<br />
Education Institution, cf. Sec. 8.5.<br />
- Integrated studies at Fachhochschulen (FH)/Universities of Applied<br />
Sciences (UAS) last 4 years and lead to a Diplom (FH) degree. While the<br />
FH/UAS are non-doctorate granting institutions, qualified graduates may<br />
apply for admission to doctoral studies at doctorate-granting institutions,<br />
cf. Sec. 8.5.<br />
- Studies at Kunst- and Musikhochschulen (Universities of Art/Music etc.)<br />
are more diverse in their organization, depending on the field and<br />
individual objectives. In addition to Diplom/Magister degrees, the<br />
integrated study programme awards include Certificates and certified<br />
examinations for specialized areas and professional purposes.<br />
8.5 Doctorate<br />
Universities as well as specialized institutions of university standing and<br />
some Universities of Art/Music are doctorate-granting institutions. Formal<br />
prerequisite for admission to doctoral work is a qualified Master (UAS and<br />
U), a Magister degree, a Diplom, a Staatsprüfung, or a foreign equivalent.<br />
Particularly qualified holders of a Bachelor or a Diplom (FH) degree may<br />
also be admitted to doctoral studies without acquisition of a further degree<br />
by means of a procedure to determine their aptitude. The universities<br />
respectively the doctorate-granting institutions regulate entry to a<br />
Page 5 of 5<br />
Diploma Supplement Max Mustermann<br />
doctorate as well as the structure of the procedure to determine aptitude.<br />
Admission further requires the acceptance of the Dissertation research<br />
project by a professor as a supervisor.<br />
8.6 Grading Scheme<br />
The grading scheme in Germany usually comprises five levels (with<br />
numerical equivalents; intermediate grades may be given): "Sehr Gut"<br />
(1) = Very Good; "Gut" (2) = Good; "Befriedigend" (3) = Satisfactory;<br />
"Ausreichend" (4) = Sufficient; "Nicht ausreichend" (5) = Non-<br />
Sufficient/Fail. The minimum passing grade is "Ausreichend" (4). Verbal<br />
designations of grades may vary in some cases and for doctoral<br />
degrees.<br />
In addition institutions may already use the ECTS grading scheme, which<br />
operates with the levels A (best 10 %), B (next 25 %), C (next 30 %), D<br />
(next 25 %), and E (next 10 %).<br />
8.7 Access to Higher Education<br />
The General Higher Education Entrance Qualification (Allgemeine<br />
Hochschulreife, Abitur) after 12 to 13 years of schooling allows for<br />
admission to all higher educational studies. Specialized variants<br />
(Fachgeb<strong>und</strong>ende Hochschulreife) allow for admission to particular<br />
disciplines. Access to Fachhochschulen (UAS) is also possible with a<br />
Fachhochschulreife, which can usually be acquired after 12 years of<br />
schooling. Admission to Universities of Art/Music may be based on other<br />
or require additional evidence demonstrating individual aptitude.<br />
Higher Education Institutions may in certain cases apply additional<br />
admission procedures.<br />
8.8 National Sources of Information<br />
- Kultusministerkonferenz (KMK) [Standing Conference of the Ministers<br />
of Education and Cultural Affairs of the Länder in the Federal Republic<br />
of Germany]; Lennéstrasse 6, D-53113 Bonn; Fax: +49[0]228/501-<br />
229; Phone: +49[0]228/501-0<br />
- Central Office for Foreign Education (ZaB) as German NARIC;<br />
www.kmk.org; E-Mail: zab@kmk.org<br />
- "Documentation and Educational Information Service" as German<br />
EURYDICE-Unit, providing the national dossier on the education<br />
system (www.kmk.org/doku/bildungswesen.htm; E-Mail:<br />
eurydice@kmk.org)<br />
- Hochschulrektorenkonferenz (HRK) [German Rectors’ Conference];<br />
1 The information covers only aspects directly relevant to purposes of<br />
the Diploma Supplement. All information as of 1 July 2005.<br />
2 Berufsakademien are not considered as Higher Education<br />
Institutions, they only exist in some of the Länder. They offer<br />
educational programmes in close cooperation with private companies.<br />
Students receive a formal degree and carry out an apprenticeship at<br />
the company. Some Berufsakademien offer Bachelor courses which<br />
are recognized as an academic degree if they are accredited by a<br />
German accreditation agency.<br />
3 Common structural guidelines of the Länder as set out in Article 9<br />
Clause 2 of the Framework Act for Higher Education (HRG) for the<br />
accreditation of Bachelor’s and Master’s study courses (Resolution of<br />
the Standing Conference of the Ministers of Education and Cultural<br />
Affairs of the Länder in the Federal Republic of Germany of 10.10.<br />
2003, as amended on 21.4.2005).<br />
4 “Law establishing a Fo<strong>und</strong>ation ‘Fo<strong>und</strong>ation for the Accreditation of<br />
Study Programmes in Germany’”, entered into force as from<br />
26.2.2005, GV. NRW. 2005, nr. 5, p. 45 in connection with the<br />
Declaration of the Länder to the Fo<strong>und</strong>ation “Fo<strong>und</strong>ation: Fo<strong>und</strong>ation<br />
for the Accreditation of Study Programmes in Germany” (Resolution of<br />
the Standing Conference of the Ministers of Education and Cultural<br />
Affairs of the Länder in the Federal Republic of Germany of<br />
16.12.2004.<br />
5 See note No. 4.<br />
6 See note No. 4.
7. Nachweis der Lehrkapazität / CNW<br />
Vgl. letzte Akkreditierung (???)
8. B<strong>und</strong>-Länder-Vereinbarung / Prüfung nach §2(2) SeeAufgG<br />
1. Schiffsoffizierausbildungsverordnung:<br />
http://www.gesetze-im-internet.de/schoffzausbv/index.html<br />
2. Seeaufgabengesetz: http://www.gesetze-im-internet.de/bseeschg/BJNR208330965.html<br />
3. Beispieleinladung für die Abschlussprüfung des B<strong>und</strong>es gem. §2(2) Seeaufgabengesetz.
Verwaltungsvereinbarung<br />
zwischen der B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland <strong>und</strong> dem<br />
Land Schleswig - Holstein<br />
über die Überprüfung der Bewerber<br />
um Befähigungszeugnisse <strong>zum</strong> Kapitän oder Schiffsoffizier<br />
Die B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland, vertreten durch das B<strong>und</strong>esministerium für Verkehr, Bau<br />
<strong>und</strong> Stadtentwicklung,<br />
- im folgenden B<strong>und</strong> genannt,<br />
<strong>und</strong> das Land Schleswig - Holstein, vertreten durch das Ministerium für Wissenschaft, Wirt-<br />
schaft <strong>und</strong> Verkehr sowie durch das Ministerium für Bildung <strong>und</strong> Frauen,<br />
- im folgenden Land genannt,<br />
schließen auf Gr<strong>und</strong> des § 2 Abs. 2 des Seeaufgabengesetzes in der Fassung der Bekanntma-<br />
chung vom 26. Juli 2002 (BGBl. I S. 2876)<br />
- zur Umsetzung des Internationalen Übereinkommens über Normen für die Ausbil-<br />
dung, die Erteilung von Befähigungszeugnissen <strong>und</strong> den Wachdienst von Seeleuten<br />
- STCW–Übereinkommen - (BGBl. 1982 II S. 298) <strong>und</strong><br />
- zur Konkretisierung der Anforderungen aus der Richtlinie 2001/25/EG über Mindest-<br />
anforderungen für die Ausbildung von Seeleuten (ABl. EG Nr. L 136 S. 17)<br />
in der jeweils innerstaatlich geltenden Fassung die folgende Vereinbarung:
§ 1<br />
Berufseingangsprüfung <strong>und</strong> Abschlussprüfung<br />
(1) Der B<strong>und</strong> erkennt die Abschlussprüfungen an den nach Landesrecht eingerichteten<br />
Ausbildungsstätten als Berufseingangsprüfung <strong>zum</strong> Nachweis der fachlichen Eignung <strong>zum</strong><br />
Erwerb der Befähigungszeugnisse nach der Schiffsoffizier – Ausbildungsverordnung an.<br />
(2) Das Land lässt zu den praktischen <strong>und</strong> mündlichen Teilen der Abschlussprüfung an<br />
den nach Landesrecht eingerichteten Ausbildungsstätten einen Vertreter des B<strong>und</strong>es als Be-<br />
obachter zu. Das Land teilt dem B<strong>und</strong> rechtzeitig vor Prüfungsbeginn die Termine für den<br />
praktischen <strong>und</strong> mündlichen Teil der Abschlussprüfung mit. Der Beobachter hat das Recht,<br />
alle Prüfungsarbeiten einzusehen <strong>und</strong> Prüfungsfragen anzuregen.<br />
(3) Als Abschlussprüfung im Sinne dieser Vereinbarung gilt auch die im Rahmen der<br />
Ausbildung <strong>zum</strong> Kapitän oder nautischen Schiffsoffizier abzulegende Prüfung der Bewerber<br />
um ein Seefunkzeugnis.<br />
§ 2<br />
Qualitätssicherung <strong>und</strong> externe Begutachtung<br />
(1) Das Land richtet für seine Ausbildungsstätten nach § 1 ein Qualitätssicherungssystem<br />
ein, das insbesondere die Anforderungen der Regel I/8 des STCW–Übereinkommens <strong>und</strong> des<br />
Artikels 9 der Richtlinie 2001/25/EG erfüllt.<br />
(2) Das Land bestellt im Einvernehmen mit dem B<strong>und</strong> eine unabhängige <strong>und</strong> international<br />
akkreditierte Organisation als externen Begutachter (Zertifizierer). Das Land stellt sicher, dass<br />
dem Zertifizierer Zugang zu allen Tätigkeiten <strong>und</strong> Unterlagen gewährleistet wird, die für sei-<br />
ne Zertifizierung von Belang sind.<br />
(3) Das Land gewährleistet dem B<strong>und</strong> die zur Erfüllung seiner Verpflichtungen aus inter-<br />
nationalem <strong>und</strong> europäischem Recht notwendige Amtshilfe <strong>und</strong> gewährt Zugang zu Einrich-<br />
tungen <strong>und</strong> Unterlagen.
§ 3<br />
Zusammenarbeit zwischen B<strong>und</strong> <strong>und</strong> Land<br />
(1) Liegen dem B<strong>und</strong> begründete Beanstandungen vor oder wird die B<strong>und</strong>esrepublik<br />
Deutschland davon unterrichtet, dass ein ausländischer Staat oder die Internationale Seeschiff-<br />
fahrts–Organisation (IMO) die Voraussetzungen für die Anwendung des § 1 nicht für gegeben<br />
halten, so wird dies auf Initiative des B<strong>und</strong>es umgehend mit dem Land sowie geeignetenfalls<br />
in einer Sitzung der Ständigen Arbeitsgemeinschaft der Küstenländer für das Seefahrtbil-<br />
dungswesen (StAK) erörtert. Der B<strong>und</strong> kann die Anwendung des § 1 aussetzen, bis eine Eini-<br />
gung mit dem Land erzielt worden ist.<br />
(2) Das Land gibt dem B<strong>und</strong> Gelegenheit, zu Entwürfen von Prüfungsordnungen, Studie-<br />
nordnungen <strong>und</strong> Lehrplänen Stellung zu nehmen, soweit diese nicht in der StAK erarbeitet<br />
worden sind. Das Land übersendet dem B<strong>und</strong> die endgültigen Fassungen der jeweiligen Ord-<br />
nungen <strong>und</strong> Lehrpläne.<br />
(3) Das Land übermittelt der Berufsbildungsstelle Seeschifffahrt e. V. die Angaben, die<br />
für deren Mitwirkung bei der Erteilung von Schiffsbesatzungszeugnissen durch die See-<br />
Berufsgenossenschaft erforderlich sind.<br />
§ 4<br />
Erteilung von Befähigungszeugnissen<br />
Das Land übersendet die für die Erteilung der Befähigungszeugnisse erforderlichen Unterla-<br />
gen an die vom B<strong>und</strong> benannte zuständige Stelle. Die beteiligten Stellen können zur Optimie-<br />
rung des Verwaltungsverfahrens die erforderlichen Absprachen treffen. Der B<strong>und</strong> erteilt bei<br />
Vorliegen aller Voraussetzungen die beantragten Befähigungszeugnisse.<br />
§ 5<br />
Kostenregelungen<br />
Der B<strong>und</strong> <strong>und</strong> das Land verzichten darauf, dass die Kosten, die aus der Anwendung dieser<br />
Vereinbarung entstehen <strong>und</strong> nicht durch Gebühreneinnahmen gedeckt sind, vom jeweils ande-<br />
ren Vereinbarungspartner erstattet werden.
§ 6<br />
Inkrafttreten, Außerkrafttreten<br />
(1) Die Vereinbarung tritt am in Kraft.<br />
(2) Gleichzeitig treten<br />
1. die Verwaltungsvereinbarung zwischen der B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland <strong>und</strong> dem<br />
Land Schleswig-Holstein nach § 2 des Gesetzes über die Aufgaben des B<strong>und</strong>es auf<br />
dem Gebiet der Seeschiffahrt vom 25. Juni/12. Juli 1973 (BAnz 1973 Nr. 136 S. 2)<br />
<strong>und</strong><br />
2. die Verwaltungsvereinbarung zwischen der B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland <strong>und</strong> den<br />
außer Kraft.<br />
Küstenländern über die Anerkennung der Prüfungen der Bewerber um Seefunkzeug-<br />
nisse vom 30. August 1993 (BAnz 1993 S. 9142)<br />
Berlin, den Kiel, den<br />
Der B<strong>und</strong>esminister für Verkehr, Bau Für das Ministerium für Wissenschaft<br />
<strong>und</strong> Stadtentwicklung Wirtschaft <strong>und</strong> Verkehr<br />
In Vertretung des Landes Schleswig-Holstein<br />
(Staatssekretär)<br />
Für das Ministerium für Bildung<br />
<strong>und</strong> Frauen<br />
des Landes Schleswig-Holstein<br />
(Staatssekretär)
Fachhochschule Flensburg<br />
Flensburg University of Applied Sciences<br />
Prof. Dr.‐Ing. HOLGER WATTER ‐ FH Flensburg – Kanzleistr. 91‐93 – 24943 Flensburg<br />
B<strong>und</strong>esamt fuer Seeschifffahrt <strong>und</strong> Hydrographie (BSH)<br />
z.Hd. Herrn Artur Roth o.V.i.A. (S12)<br />
Bernhard‐Nocht‐Str. 78<br />
20359 Hamburg<br />
Tel: +49 (0) 40 3190‐7120<br />
Fax: +49 (0) 40 3190‐5000<br />
email: artur.roth@bsh.de<br />
http://www.bsh.de<br />
Praktischer <strong>und</strong> mündlicher Teil der Abschlussprüfungen<br />
gemäß §2 Abs. 2 Seeaufgabengesetz.<br />
Donnerstag, 26. Mai 2011<br />
Sehr geehrter Herr Roth,<br />
auf der AG‐Sitzung der StAK vom Dez. 2010 wurde empfohlen, die<br />
Simulatorausbildung als Teil der B<strong>und</strong>esprüfung nach §2(2)<br />
SeeAufgG festzulegen.<br />
Für die Studienrichtung Schiffsbetriebstechnik im <strong>Studiengang</strong><br />
<strong>Schiffstechnik</strong> finden Sie die Prüfungsordnung in der aktuell gültigen<br />
Fassung unter<br />
http://www.fh‐flensburg.de/fhfl/ordnungen_satzungen_fbt.html<br />
In der Anlage übersende ich Ihnen die derzeitige Planung für die<br />
Simulatorausbildung in diesem Semester. Ich würde mich freuen,<br />
Sie oder einen Vertreter Ihres Hauses im Rahmen dieser<br />
Veranstaltung am Montag, den 20. Juni 2011 von 14:00 bis 17:00<br />
Uhr im Raum F117 im Maritimen Zentrum begrüßen zu dürfen.<br />
Wegen möglicher Terminverschiebungen empfehle ich kurzfristig<br />
vorab einen Terminabgleich.<br />
Mit fre<strong>und</strong>lichen Grüßen<br />
Prof. Dr.‐Ing. Holger Watter<br />
www.fh‐flensburg.de/watter<br />
1 von 2<br />
Kanzleistraße 91‐93<br />
24943 Flensburg<br />
Telefon: +49 (0461) 805‐01<br />
Telefax: +49 (0461) 805‐1300<br />
Prof. Dr.‐Ing. HOLGER WATTER<br />
‐ www.fh‐flensburg.de/watter ‐<br />
Phone: ++49 (0) 171 53 00 309<br />
Fax: ++49 (0) 3 222 3 77 56 95<br />
Mail: holger.watter@fh‐flensburg.de
Ablaufstruktur:<br />
Fachhochschule Flensburg<br />
Flensburg University of Applied Sciences<br />
Übung Inhalt Bemerkungen<br />
0<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
Einführung<br />
Schiffsmaschinensimulation<br />
2 von 2<br />
Kanzleistraße 91‐93<br />
24943 Flensburg<br />
Telefon: +49 (0461) 805‐01<br />
Telefax: +49 (0461) 805‐1300<br />
Systemkreisläufe, Bedien‐ <strong>und</strong> Eingriffsmöglichkeiten,<br />
Automationseinrichtungen (Manuell ‐ Auto, Local ‐<br />
Remote, PID), verfügbare Unterlagen / Handbücher:<br />
Dokumentation<br />
Seminarplanung, Gruppeneinteilung STCW‐Gr<strong>und</strong>lagen; Ziele & Randbedingungen; Arbeits‐<br />
/Zeit‐/Gruppenplanung<br />
Einführungsübung<br />
Schiffsmaschinenbetrieb<br />
"Warming up": Checkliste erarbeiten, Ausgangslage<br />
checken, Beurteilung des Schiffsbetriebes/<br />
Seeklarmachen HM, Füllstände: Bunker, Tanks <strong>und</strong><br />
Zellen, Betriebsmodus (Local, Remote, Auto, Manuell<br />
....), Parameterplott (P, M, n, pLL), Bar‐Charts<br />
(Kompressionsdruck pc)<br />
Elektrische Schaltübung Manuelle Inbetriebnahme aller Generatoren <strong>und</strong><br />
Betrieb des Bugstrahlruders,<br />
Synchronisationsbedingungen, Anlassschaltungen<br />
(Stern‐Dreieck‐Schaltungen, Sanftanlasser)<br />
Dampfanlage Manueller Kesselbetrieb, Dampfsystem an Bord von<br />
Seeschiffen, HFO‐Vorwärmung, Turbinenbetrieb,<br />
Kesselinbetriebnahme, Brennersicherheitskessel,<br />
Betriebsvorschriften TRD u.a.,<br />
Inbetriebnahme komplexer<br />
Maschinenanlage<br />
Reiseplanung (Betriebsstoffplanung); Aufbau <strong>und</strong><br />
Betrieb 2‐Takt‐Hauptmaschine <strong>und</strong> Turbogenerator,<br />
Brennstoffsystem, Brennstoffaufbereitung,<br />
Schmiersystem, Schmierölaufbereitung,<br />
Schwerölbetrieb (HTK, NTK), Aufladung,<br />
Dokumentenanalyse: Project Guide <strong>und</strong> Operational<br />
Manual (Teillastbetrieb, Pumpen), Darstellung des<br />
Betriebspunktes im Motor‐ <strong>und</strong> ATL‐Kennfeld,<br />
Beurteilung des Betriebspunktes<br />
Fahrbetrieb Monitoring: Mechanik, Thermodynamik,<br />
Drehschwingungen, Betriebsstoffe , Motorenkennfeld<br />
(Drückung, Verstellpropellercharakteristik), Propulsion,<br />
Optional: Austauchender Propeller, Einfluß des<br />
gelegten Ruders, gedrückter Betrieb,<br />
Flachwassereffekt, Kolbendurchbläser<br />
(Kolbenringleckage)<br />
Wachbetrieb Störungsübung: Vorbereitung, Planung (15 Min),<br />
Durchführung (45 Min.), Nachbereitung: Diskussion<br />
<strong>und</strong> Dokumentation (15 Min.)<br />
Hilfsbetrieb Kältemittelkreislauf: R717(NH3) <strong>und</strong> R134a (CF3‐<br />
CH2F), Klimaanlage, Frischwassererzeuger, Incinerator,<br />
Seawage<br />
Monitoring / Sicherheitssysteme Motorkennfeld, Propulsionsuntersuchungen, ATL‐<br />
Kennfeld, allg. thermodyn. <strong>und</strong> strömungstechn.<br />
Untersuchungen (z.B. am Ballastsystem),<br />
regelungstechnische Untersuchungen (PID),<br />
Reibmitteldruck der Hauptmaschine (WILLANS‐Linie),<br />
Gasdruckmonitoring, Drehschwingungsmonitoring<br />
Mehr Informationen unter: http://www.fh‐flensburg.de/watter/lehre.htm
9. Akkreditierung SNL <strong>und</strong> ST<br />
http://www.zeva.org/de/programmakkreditierung/akkreditierte-studiengaenge/detail/157/<br />
http://www.zeva.org/de/programmakkreditierung/akkreditierte-studiengaenge/detail/162/
10. Qualitätsmanagementsystem<br />
Siehe dazu: http://www.inf.fh-flensburg.de/lang/qs/index.htm
Fachhochschule Flensburg<br />
Flensburg University of Applied Sciences<br />
Einführung eines Qualitätsmanagementsystems (QMS) an der FH Flensburg<br />
Ziel<br />
Die FH Flensburg hat sich <strong>zum</strong> Ziel gesetzt in<br />
den nächsten drei Jahren ein nachhaltiges<br />
Qualitätsmanagementsystem (QMS) für den<br />
Bereich Studium <strong>und</strong> Lehre zu entwickeln <strong>und</strong><br />
umzusetzen. Langfristig ist die FH Flensburg<br />
bestrebt weitere Bereiche wie bspw. Weiterbildung,<br />
Forschung <strong>und</strong> Transfer oder Verwaltung<br />
außerhalb des Bereichs Studium <strong>und</strong> Lehre<br />
in das QMS zu integrieren.<br />
Ausgangssituation<br />
Mitarbeiterinnen <strong>und</strong> Mitarbeiter der FH<br />
Flensburg haben vielfach in Eigeninitiative <strong>und</strong><br />
aufgr<strong>und</strong> von externen Anforderungen Qualitätssicherung<br />
<strong>und</strong> –verbesserung von Studium<br />
<strong>und</strong> Lehre innerhalb ihrer Arbeit verankert.<br />
Hierzu zählen die Akkreditierung von Studiengängen,<br />
verschiedene Beratungs- <strong>und</strong> Betreuungsangebote<br />
für Studierende sowie für<br />
Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler, aber auch Lehrveranstaltungsevaluationen,Erstsemesterbefragungen,<br />
regelmäßige Datenaufbereitungen zu<br />
Studierenden- <strong>und</strong> Absolventenzahlen <strong>und</strong> vieles<br />
mehr.<br />
Ein übergeordnetes QMS besteht derzeit nicht.<br />
Alle genannten Aktivitäten nehmen jedoch<br />
wichtige Anteile in einem QMS ein.<br />
Begriffsklärung<br />
Innerhalb eines QMS werden Qualitätsziele, ein<br />
Messsystem zur Überprüfung der Ziele sowie<br />
die Umsetzung von Maßnahmen festgelegt <strong>und</strong><br />
in einem Regelkreis zur kontinuierlichen Qualitätsverbesserung<br />
vereint (vgl. Abb.). Kommunikationsstrukturen<br />
<strong>und</strong> Verantwortlichkeiten<br />
werden auf zentraler <strong>und</strong> dezentraler Ebene<br />
geschaffen. Prozesse im Bereich Studium <strong>und</strong><br />
Lehre werden abgebildet <strong>und</strong> weiterentwickelt.<br />
Verschiedene Anforderungen an Hochschulen<br />
seitens der Studierenden, des Arbeitsmarktes,<br />
der Ministerien, der Akkreditierungsagenturen,<br />
des Bologna-Prozesses, der Gesellschaft <strong>und</strong><br />
der Hochschulmitarbeiterinnen <strong>und</strong> -<br />
mitarbeiter finden Berücksichtigung. Aufgr<strong>und</strong><br />
begrenzter finanzieller, sächlicher <strong>und</strong> personeller<br />
Ressourcen ist ein QMS bestrebt,<br />
Red<strong>und</strong>anzen aufzudecken, Synergien zu schaffen<br />
<strong>und</strong> damit die Qualitätsziele effizient <strong>und</strong><br />
effektiv zu erreichen. Für die Konzeption <strong>und</strong><br />
Umsetzung eines QMS existieren verschiedene<br />
Modelle (z. B. TQM, EFQM, ISO 9001, Academic<br />
Scorecard)<br />
Notwendigkeit eines QMS<br />
Ein QMS <strong>und</strong> damit eine kontinuierliche Reflexion<br />
der Qualität von Studium <strong>und</strong> Lehre ist aus<br />
folgenden Gründen erforderlich:<br />
o Stetiger Wandel des Arbeitsmarktes (verändernde<br />
Berufsfelder, verändernde notwendige<br />
Kompetenzen <strong>und</strong> Fähigkeiten, verändernde<br />
Anforderungen an Studiengänge)<br />
o Stetiger Wandel der Voraussetzungen <strong>und</strong><br />
der Zusammensetzung unter Studierenden<br />
(zunehmende Heterogenität)<br />
o neue Gesetze, Beschlüsse <strong>und</strong> Vorgaben u. a.<br />
der Ministerien, der Kultusministerkonferenz,<br />
des Akkreditierungsrates <strong>und</strong> der<br />
Hochschulrektorenkonferenz<br />
o zunehmender Wettbewerb auf nationaler<br />
<strong>und</strong> internationaler Ebene um Studierende,<br />
Lehrende <strong>und</strong> Drittmittel<br />
o Verknappung der zur Verfügung stehenden<br />
öffentlichen Mittel<br />
o Zunehmender äußerer Druck, Rechenschaft<br />
über Qualität von Studium <strong>und</strong> Lehre abzulegen<br />
Abb. Regelkreis zur kontinuierlichen Qualitätsverbesserung<br />
als Bestandteil eines QMS<br />
Qualität definieren /<br />
Qualitätsleitbild<br />
erstellen<br />
Indikatoren/<br />
Kennzahlen <strong>und</strong><br />
Messinstrumente<br />
festlegen<br />
Konzeption <strong>und</strong><br />
Implementierung<br />
von Konzepten /<br />
Maßnahmen<br />
Der Regelkreis kann auf alle Aspekte von Studium<br />
<strong>und</strong> Lehre, auf die Organisationsstruktur, aber<br />
auch auf das QMS selbst angewendet werden.<br />
Beispiele:<br />
•Bezug „Gestaltung von Studiengängen“<br />
•Bezug „Beratung <strong>und</strong> Betreuung „<br />
•Bezug „Kommunikations- <strong>und</strong><br />
Informationsstrukturen“<br />
•Bezug „Prozesse“<br />
Qualität messen<br />
Qualitätsziele<br />
festlegen<br />
Ergebnisse<br />
analysieren <strong>und</strong><br />
reflektieren
Qualitätsmanagement<br />
Kontakt<br />
Fachhochschule Flensburg<br />
Flensburg University of Applied Sciences<br />
Bei Fragen, Anmerkungen <strong>und</strong> Anregungen <strong>zum</strong> Qualitätsmanagement wenden Sie sich gerne an:<br />
Aufgaben (Stand: 02.09. 2011)<br />
Birgit Zittlau<br />
Fachhochschule Flensburg<br />
Qualitätsmanagement<br />
Kanzleistr. 91-93<br />
24943 Flensburg<br />
Raum: H 122<br />
Telefon: +49 (0)461 - 805 1325<br />
Fax: +49 (0)461 - 805 1300<br />
E-Mail: birgit.zittlau@fh-flensburg.de<br />
� Einführung eines Qualitätsmanagement-Systems an der Fachhochschule Flensburg<br />
� Studierenden- <strong>und</strong> Absolventenbefragungen<br />
� Hochschulstatistiken über Studierende <strong>und</strong> Absolventen<br />
� Entwicklung eines Kennzahlenmodells<br />
� Dokumentation <strong>und</strong> Weiterentwicklung von Prozessen im Bereich Studium <strong>und</strong> Lehre<br />
� Zusammenstellung <strong>und</strong> Aufbereitung von Informationen <strong>zum</strong> Thema Qualitätsmanagement für das<br />
Präsidium, die Fachbereiche <strong>und</strong> andere Hochschulangehörige<br />
� Jahresbericht Qualitätsmanagement
Qualitätssicherung in Lehre <strong>und</strong> Studium http://www.inf.fh-flensburg.de/lang/qs/qs.htm<br />
Fh Fachhochschule Flensburg<br />
Prof. Dr. H. W. Lang<br />
Qualitätssicherung in Lehre <strong>und</strong> Studium<br />
im Fachbereich Technik<br />
Die Einführung der Qualitätssicherung in Lehre <strong>und</strong> Studium an der Fachhochschule<br />
Flensburg gründet sich auf die Vorgaben des Hochschulgesetzes. Tatsächlich ist eine<br />
Qualitätssicherung jedoch auch ohne gesetzliche Verpflichtung sinnvoll.<br />
Gesetzliche Gr<strong>und</strong>lagen<br />
Die Einführung der Qualitätssicherung in Lehre <strong>und</strong> Studium beruht auf folgenden<br />
gesetzlichen Gr<strong>und</strong>lagen:<br />
Umsetzung<br />
Hochschulgesetz (HSG) des Landes Schleswig-Holstein<br />
Ordnung zur Qualitätssicherung in Lehre <strong>und</strong> Studium der Fachhochschule<br />
Flensburg<br />
Richtlinen für die Durchführung von Evaluationen des Fachbereichs Technik<br />
Ziel ist eine möglichst hohe Akzeptanz bei Studierenden <strong>und</strong> Lehrenden, daher ist<br />
Richtschnur bei der Einführung der Qualitätssicherung<br />
die maßgebenden Ordnungen <strong>und</strong> Richtlinien möglichst kurz <strong>und</strong> bündig zu<br />
halten,<br />
die festgelegten Verfahrensweisen möglichst einfach <strong>und</strong> überschaubar zu<br />
halten,<br />
den Aufwand der Durchführung durch weitgehende Automatisierung möglichst<br />
gering zu halten,<br />
aus den Ergebnissen den größtmöglichen Nutzen im Hinblick auf eine ständige<br />
Verbesserung der Qualität zu ziehen.<br />
Evaluation von Lehrveranstaltungen<br />
Ein wichtiges Mittel zur Erhebung von Daten über die Qualität der Lehre <strong>und</strong> des Studiums<br />
sind Befragungen von Studierenden, Lehrenden <strong>und</strong> Mitarbeitern.<br />
Besondere Bedeutung kommt hierbei der Bewertung von Lehrveranstaltungen durch die<br />
Studierenden zu. Die Ergebnisse einer solchen Bewertung geben Aufschluss über die<br />
Zufriedenheit der Studierenden mit der Lehre. Positive Ergebnisse tragen auch zur<br />
1 von 2 18.12.2011 20:19
Qualitätssicherung in Lehre <strong>und</strong> Studium http://www.inf.fh-flensburg.de/lang/qs/qs.htm<br />
Zufriedenheit der Lehrenden mit ihrer eigenen Arbeit bei; negative Ergebnisse geben ihnen<br />
Anstöße zur Verbesserung ihrer Arbeit.<br />
Eine laufende Bewertung der Lehrveranstaltungen verursacht einen erheblichen Aufwand,<br />
sowohl für die Studierenden, die jedes Semester etliche Lehrveranstaltungen bewerten<br />
müssen, als auch für die Lehrenden, die jedes Semester die entsprechenden Bewertungen<br />
auswerten müssen. Es gilt daher hier, ein vernünftiges Maß zu finden, derart dass zu<br />
häufige Bewertungen sich nicht nachteilig auf die Akzeptanz auswirken. In der Ordnung<br />
zur Qualitätssicherung ist festgelegt, dass jede Lehrveranstaltung einmal innerhalb von<br />
drei Jahren bewertet werden soll.<br />
Ferner ist vorgesehen, alle Bewertungen online durchzuführen, damit sie automatisch<br />
ausgewertet werden können. Hierfür bietet sich das Portal Stud.IP an, das der<br />
Fachhochschule Flensburg weithin genutzt wird. Stud.IP ermöglicht sowohl das Anlegen<br />
eigener Befragungen als auch die Übernahme des offiziellen Bewertungsbogens des<br />
Fachbereichs Technik. Es ist gewährleistet, dass die Fragebögen nur von Teilnehmern der<br />
jeweiligen Veranstaltung, aber gleichzeitig auch anonym ausgefüllt werden können. In<br />
Stud.IP steht eine automatische Auswertung der Lehrveranstaltungsbewertungen zur<br />
Verfügung.<br />
Aufrufen von Stud.IP<br />
Hinweise <strong>zum</strong> Anlegen einer Evaluation in Stud.IP<br />
Hinweise <strong>zum</strong> Hochladen der Auswertung einer Evaluation<br />
H.W. Lang FH Flensburg lang@fh-flensburg.de Impressum ©<br />
2 von 2 18.12.2011 20:19
Evaluation einrichten<br />
Arbeiten mit Stud.IP<br />
Evaluation einrichten<br />
Die folgende Beschreibung enthält nur das Nötigste, das <strong>zum</strong> Anlegen <strong>und</strong> <strong>zum</strong> Auswerten einer Standard-<br />
Evaluation des Fachbereichs Technik erforderlich ist. Ausführlichere Tipps <strong>zum</strong> Einrichten von Evaluationen<br />
finden sich auf der entsprechenden Hilfe-Seite von Stud.IP (Seite Evaluations-Verwaltung aufrufen wie im<br />
übernächsten Abschnitt beschrieben <strong>und</strong> dann auf Hilfe in der Kopfleiste klicken).<br />
Voraussetzungen<br />
Sie sind als Dozent bei Stud.IP registriert <strong>und</strong> Sie haben die Veranstaltungen, die evaluiert werden sollen,<br />
bereits in Stud.IP angelegt.<br />
Rufen Sie Stud.IP auf <strong>und</strong> betätigen Sie Login.<br />
Seite Evaluations-Verwaltung öffnen<br />
1. Klicken Sie in der Symbolleiste auf das Symbol Admin (ein Schloss im rechten Bereich).<br />
2. Wählen Sie in der Kopfleiste der erscheinenden Seite Evaluationen. Es erscheint die Seite<br />
Evaluations-Verwaltung.<br />
3. Wenn sich die offizielle Evaluationsvorlage des Fachbereichs Technik bereits unter Ihren eigenen<br />
Evaluationsvorlagen befindet, gehen Sie weiter <strong>zum</strong> übernächsten Abschnitt dieser Anleitung.<br />
Ansonsten führen Sie die Schritte des nächsten Abschnitts Offizielle Evaluationsvorlage kopieren<br />
durch.<br />
Offizielle Evaluationsvorlage kopieren<br />
Dieser Schritt ist nur dann erforderlich, wenn die Evaluationsvorlage des Fachbereichs Techik noch nicht in<br />
Ihren eigenen Evaluationsvorlagen vorhanden ist.<br />
1. Öffnen Sie wie oben beschrieben die Seite Evaluations-Verwaltung.<br />
2. Tragen Sie anschließend unter Öffentliche Evaluationsvorlage suchen den Text eva ein <strong>und</strong> wählen<br />
Sie suchen.<br />
3. In der erscheinenden Liste gehen Sie zu Evaluation der Veranstaltung von Prof. Steffens <strong>und</strong> klicken<br />
Sie auf das Symbol in der Spalte Kopieren.<br />
Die Evaluationsvorlage, d.h. der Fragebogen, befindet sich nun unter Ihren eigenen Evaluationsvorlagen.<br />
Nun können Sie die Evaluationsvorlage in jede Ihrer Veranstaltungen kopieren.<br />
Evaluation für eine Veranstaltung einrichten<br />
1. Öffnen Sie wie oben beschrieben die Seite Evaluations-Verwaltung.<br />
2. Es erscheinent die Liste Ihrer eigenen Evaluationsvorlagen. Beachten Sie nicht die Schaltflächen<br />
daneben, sondern klicken Sie direkt auf den Titel Evaluation der Veranstaltung.<br />
3. Auf der folgenden Seite aktivieren Sie das Kästchen kopieren (nicht das Kästchen einhängen) für jede<br />
Ihrer Veranstaltungen, in denen Sie die Befragung durchführen wollen.<br />
4. Legen Sie den Zeitpunkt des Starts <strong>und</strong> des Endes der Befragung fest.<br />
5. Betätigen Sie <strong>zum</strong> Schluss die Schaltfläche übernehmen.<br />
Seite 1 von 2<br />
Sobald eine Evaluation in eine Veranstaltung kopiert <strong>und</strong> gestartet ist, können die Studierenden, die sich für<br />
diese Veranstaltung in Stud.IP angemeldet haben, daran teilnehmen.<br />
Eingerichtete Evaluationen erscheinen auf der Seite Meine Veranstaltungen als Balkendiagramm-Symbole<br />
hinter den betreffenden Veranstaltungen.<br />
http://www.inf.fh-flensburg.de/lang/qs/anlegeneval.htm<br />
15.06.2010
Evaluation einrichten<br />
Evaluation ankündigen<br />
Um aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten, ist es erforderlich, dass möglichst viele Teilnehmer der Veranstaltung<br />
an der Evaluation teilnehmen. Kündigen Sie den Beginn der Evaluation in der Vorlesung an <strong>und</strong><br />
vermitteln Sie den Studierenden, dass Sie an ihrem Feedback interessiert sind.<br />
Zusätzlich empfiehlt es sich, die Studierenden per Stud.IP-R<strong>und</strong>mail zur Teilnahme an der Evaluation<br />
aufzufordern. Wenn die Studierenden die R<strong>und</strong>mail empfangen, sitzen sie bereits am Computer <strong>und</strong> können<br />
dort unmittelbar den Online-Fragebogen ausfüllen.<br />
1. Klicken Sie in der Kopfleiste von Stud.IP auf das Symbol Veranstaltungen. Es erscheint die Seite<br />
Meine Veranstaltungen.<br />
2. Wählen Sie die entsprechende Veranstaltung.<br />
3. Wählen Sie den Tab TeilnehmerInnen.<br />
4. Dort klicken Sie im oberen Bereich auf Systemnachricht mit Emailweiterleitung an alle Teilnehmer<br />
verschicken.<br />
5. Füllen Sie die Textfelder Betreff <strong>und</strong> Nachricht aus <strong>und</strong> betätigen Sie abschicken.<br />
Gegebenenfalls ist es erforderlich, die Studierenden kurz vor dem Ende des Evaluationszeitraums noch<br />
einmal an die Teilnahme zu erinnern.<br />
Evaluation auswerten<br />
1. Öffnen Sie wie oben beschrieben die Seite Evaluations-Verwaltung.<br />
2. Wählen Sie im unteren Bereich unter der Überschrift Evaluationen unter Evaluationen aus dem<br />
Bereich ... anzeigen die Veranstaltung, deren Evaluation Sie auswerten wollen, <strong>und</strong> betätigen Sie die<br />
Schaltfläche anzeigen.<br />
3. Es erscheint nun die betreffende Evaluation, entweder unter Laufende Evaluationen oder unter<br />
Beendete Evaluationen. Durch Betätigen der Schaltfläche Auswertung erhalten Sie eine Auswertung,<br />
die Sie als PDF-Datei speichern können.<br />
Weiter mit: [Evaluationsergebnisse hochladen] oder<br />
H.W. Lang FH Flensburg lang@fh-flensburg.de Impressum ©<br />
http://www.inf.fh-flensburg.de/lang/qs/anlegeneval.htm<br />
Seite 2 von 2<br />
15.06.2010
http:� � www� inf� fh� flensburg� de� lang� qs� hochladen� htm<br />
Arbeiten mit Stud.IP<br />
Evaluationsergebnisse hochladen<br />
Die Ergebnisse der Lehrveranstaltungsbewertungen werden beim Fachbereich gesammelt <strong>und</strong> ausschließlich für den<br />
Zweck der Qualitätssicherung in der Lehre verwendet.<br />
Laden Sie zunächst die PDF-Datei mit der Auswertung der jeweiligen Lehrveranstaltungsbewertung von Stud.IP auf<br />
Ihren Computer <strong>und</strong> von dort aus wieder hoch nach Stud.IP in die Veranstaltung Qualitätssicherung Fachbereich<br />
Technik.<br />
Voraussetzungen<br />
Sie sind als Dozent bei Stud.IP registriert <strong>und</strong> Sie haben Veranstaltungen in Stud.IP evaluieren lassen.<br />
Rufen Sie Stud.IP auf <strong>und</strong> betätigen Sie Login.<br />
Evaluationsergebnisse speichern<br />
1. Legen Sie auf Ihrem Computer ein Verzeichnis an, in dem Sie die Auswertungen Ihrer Evaluationen speichern.<br />
2. Klicken Sie in der Kopfleiste von Stud.IP auf das Symbol Veranstaltungen.<br />
3. Wählen Sie eine Ihrer Veranstaltungen, in der Sie eine Evaluation durchgeführt haben, <strong>und</strong> dann Administration<br />
dieser Veranstaltung.<br />
4. Wählen Sie als nächstes Evaluationen. Auf der erscheinenden Seite finden Sie die entsprechende Evaluation im<br />
unteren Teil unter Beendete Evaluationen. Betätigen Sie dort die Schaltfläche Auswertung.<br />
5. Es erscheint eine grafische Auswertung der Evaluation. Klicken Sie auf PDF-Export im oberen Teil des Fensters.<br />
Es wird eine PDF-Datei geöffnet; speichern Sie diese mit Kopie speichern auf Ihrem Rechner. Geben Sie der<br />
Datei einen aussagekräftigen Namen mit <strong>Studiengang</strong> <strong>und</strong> Veranstaltung, z.B. Informatik_Datenbanken.pdf.<br />
6. Wiederholen Sie dieses Vorgehen für alle Veranstaltungen, in denen Sie eine Evaluation durchgeführt haben.<br />
Veranstaltung "Qualitätssicherung Fachbereich Technik" belegen<br />
Dieser Schritt ist nur erforderlich, wenn Sie die Veranstaltung Qualitätssicherung Fachbereich Technik noch nicht belegt<br />
haben.<br />
Um die Veranstaltung Qualitätssicherung Fachbereich Technik belegen zu können, benötigen Sie das Passwort für den<br />
Zugang zur Veranstaltung, das Ihnen per Email mitgeteilt wurde [Passwort noch einmal anfordern].<br />
1. Klicken Sie in der Kopfleiste von Stud.IP auf das Symbol Veranstaltungen.<br />
2. Wählen Sie den Tab Veranstaltungen suchen / hinzufügen.<br />
3. Geben Sie als Suchbegriff quali ein <strong>und</strong> starten Sie die Suche.<br />
4. Wählen Sie in der erscheinenden Liste die Veranstaltung Qualitätssicherung Fachbereich Technik.<br />
5. Klicken Sie im rechten Teil des Fensters auf Tragen Sie sich hier für die Veranstaltung ein.<br />
6. Geben Sie das Passwort ein.<br />
Sie haben nun die Veranstaltung Qualitätssicherung Fachbereich Technik belegt.<br />
Dateien hochladen<br />
1. Klicken Sie in der Kopfleiste von Stud.IP auf das Symbol Veranstaltungen.<br />
2. Wählen Sie in der erscheinenden Liste die Veranstaltung Qualitätssicherung Fachbereich Technik.<br />
3. Wählen Sie den Tab Dateien. Es erscheint eine Liste von Ordnern, nach Semestern geordnet, z.B. Evaluationen<br />
09WS.<br />
4. Wählen Sie das Semester, in dem Sie die Evaluation durchgeführt haben, <strong>und</strong> klicken Sie auf Datei hochladen.<br />
5. Mit der Schaltfläche Durchsuchen... suchen Sie auf Ihrem Computer nach der Datei, die Sie hochladen wollen.<br />
6. Im darunter befindlichen Feld Name geben Sie ggf. einen neuen Namen an, aus dem der <strong>Studiengang</strong> <strong>und</strong> die<br />
Lehrveranstaltung hervorgehen, also z.B. Informatik_Datenbanken. Die Dateiendung .pdf ist nicht erforderlich.<br />
Betätigen Sie absenden.<br />
7. Wiederholen Sie dieses Vorgehen für alle Veranstaltungen, in denen Sie eine Evaluation durchgeführt haben.<br />
H.W. Lang FH Flensburg lang@fh-flensburg.de Impressum ©
ANHANG<br />
A1 Selbstbericht Maritimes Zentrum<br />
Auszug aus www.fh-flensburg.de/mz
In Deutschland ganz oben!<br />
Fachhochschule Flensburg<br />
Flensburg University of Applied Sciences<br />
Maritimes Forschungs <strong>und</strong> Ausbildungszentrum<br />
Maritim<br />
Modern<br />
Praxisnah<br />
FH Flensburg<br />
Home<br />
Intranet<br />
VPN<br />
Lernportal Stud.IP<br />
WebMail<br />
Notenaushänge<br />
Fachbereich Technik<br />
Home<br />
Energiesystemtechnik<br />
Maschinen <strong>und</strong> Anlagen<br />
Werkstofftechnik<br />
Chem. Technologie<br />
Fachschaft Seefahrt<br />
<strong>Schiffstechnik</strong><br />
Nautik/Logistik<br />
Maritimes Forschungs <strong>und</strong><br />
Ausbildungszentrum<br />
Home<br />
Ausstattung<br />
Kontakt/Lageplan<br />
Presse<br />
INMT – Institut für Nautik <strong>und</strong><br />
Maritime Technologie<br />
Home<br />
Ansprechpersonen<br />
Projekte/Weiterbildung<br />
Kontakt/Lageplan<br />
ISF – Institut für<br />
Schiffsbetriebsforschung<br />
Ansprechpersonen<br />
Ausstattung<br />
Weiterbildung<br />
IMA Institut für Maschinen <strong>und</strong><br />
Anlagen<br />
Ansprechpersonen<br />
Ausstattung<br />
Prof. Dr.Ing. Holger Watter<br />
Home<br />
RSSNews<br />
Lehrveranstaltungen<br />
Skripte/Download<br />
Forschung <strong>und</strong> Projekte<br />
Leistungs/Tätigkeitsprofil<br />
Kontakt <strong>und</strong> Lageplan<br />
Outlook<br />
Links<br />
Fachschule für Seefahrt<br />
Berufsfachschule SBTA<br />
STGF<br />
STG<br />
Weitere Links<br />
Das Maritime Forschungs <strong>und</strong> Ausbildungszentrum ist eines der modernsten <strong>und</strong> größten<br />
Simulationszentren in Nordeuropa.<br />
Ausstattung<br />
Das Maritime Forschungs <strong>und</strong> Ausbildungszentrum verfügt über 33 moderne Übungs <strong>und</strong> Seminarräume,<br />
6 Schiffsführungssimulationsanlagen (Brückenkabinen, Radar <strong>und</strong> Schiffsführungssimulatoren) sowie einen<br />
Maschinenraumsimulator, zahlreiche CBTs <strong>und</strong> 3DAnimationen.<br />
Es nutzt die umfangreiche <strong>und</strong> moderne Laborausstattung<br />
� der Hochschuleinrichtungen <strong>zum</strong> Forschungs <strong>und</strong> Technologietransfer,<br />
� des Instituts für Maschinen <strong>und</strong> Anlagen sowie<br />
� des Instituts für Nautik <strong>und</strong> Maritime Technologie – INMT – als Nachfolgeorganisation des Instituts<br />
für Schiffsbetriebsforschung.<br />
Aus <strong>und</strong> Weiterbildung<br />
� Fachschullehrgänge der Fachschule für Seefahrt<br />
� Bachelorstudiengänge <strong>Schiffstechnik</strong> sowie Seeverkehr, Nautik <strong>und</strong> Logistik,<br />
� Masterstudiengänge Systemtechnik, Wind Engineering, Biotechology and Process Engineering,<br />
� Weiterbildungsveranstaltungen der Lotsenbrüderschaft NOK II,<br />
� Weiterbildungslehrgänge des Instituts für Schiffsbetriebsforschung,<br />
� Projekte des Instituts für Nautik <strong>und</strong> Maritime Technologie – INMT,<br />
� k<strong>und</strong>enspezifische Seminare auf Anfrage.<br />
Forschung <strong>und</strong> Projekte<br />
http://www.fh-flensburg.de/mz/<br />
Das Schiff ist das energieeffizienteste, ökonomischste <strong>und</strong> ökologischste Transportmittel. Die Emissions<strong>und</strong><br />
Kostenstrukturen liegen um mehrere Zehnerpotenzen unter den Vergleichswerten anderer<br />
Transportsysteme. Es trägt daher überproportional <strong>zum</strong> globalen Warenaustausch bei.<br />
� Wir tragen mit unserem Sachverstand zur Weiterentwicklung <strong>und</strong> Verbesserung dieses<br />
Transportsystems in den Bereichen maritime Technologie <strong>und</strong> Forschung bei.<br />
� Wir fühlen uns den Zielen Energieeffizienz, Emissionsminderung <strong>und</strong> umweltfre<strong>und</strong>licher<br />
Schiffsbetrieb verpflichtet.<br />
� Dazu bringen wir unsere technologische <strong>und</strong> wissenschaftliche Expertise in Aus <strong>und</strong><br />
Weiterbildung sowie Forschung <strong>und</strong> Entwicklung für die maritime Industrie ein.<br />
� Uns locken neue Herausforderungen <strong>und</strong> Problembeschreibungen. Wir leisten unseren<br />
Seite 1 von 3<br />
15.11.2011
SAFETY<br />
FIRST<br />
GREENER<br />
OCEANS<br />
NEW<br />
ENERGY<br />
FUTURE<br />
MOBILITY<br />
Lösungsbeitrag über Studien <strong>und</strong> Diplomarbeiten, bzw. Bachelor <strong>und</strong> Masterarbeiten sowie<br />
unterstützen im Rahmen unserer Möglichkeiten mit Hilfe unseres Kompetenznetzwerkes. Dazu<br />
bringen wir uns auf unterschiedlichen gesellschaftlichen Ebenen in die Arbeit von Vereinen <strong>und</strong><br />
Verbänden sowie in Forschungs <strong>und</strong> Entwicklungsprojekte tatkräftig mit ein. Wir identifizieren<br />
uns mit den Zielen der Verbände …<br />
PRODUCTIVITY<br />
COMPETITION<br />
COMPE<br />
TENCE<br />
An der Fachhochschule Flensburg werden anwendungsorientierte maritime Forschungs <strong>und</strong><br />
Entwicklungsarbeiten sowie Beratungs <strong>und</strong> Begutachtungstätigkeiten durchgeführt. Diese Tätigkeiten sind<br />
dialogorientiert <strong>und</strong> durch Netzwerkstrukturen geprägt.<br />
Durch die ausgesprochene Breite der Kompetenzen an der Hochschule können für eine Vielzahl von<br />
Problemstellungen im Verb<strong>und</strong> mit der maritimen Wirtschaft ganz spezifische Lösungskonzepte<br />
erarbeitet werden: Nautik <strong>und</strong> Schiffsbetriebstechnik, Umwelt <strong>und</strong> Verfahrenstechnik, Informations <strong>und</strong><br />
Kommunikationstechnik, Logistik <strong>und</strong> Umschlagstechnik, Beratung <strong>und</strong> Begutachtung ......<br />
Siehe hierzu auch die Seite des Projektträgers INSTITUT FÜR NAUTIK UND MARITIME TECHNOLOGIE<br />
Kontakt <strong>und</strong> Lageplan<br />
― schaffen wir die technischen Voraussetzungen <strong>und</strong> geeigneten Prozessabläufe für den sicheren <strong>und</strong><br />
effizienten Betrieb von Schiffen <strong>und</strong> meerestechnischen Anlagen. Wir übernehmen Verantwortung für die<br />
Sicherheit von Menschen <strong>und</strong> Investitionsgütern unter den anspruchsvollen Umgebungsbedingungen auf<br />
Meeren <strong>und</strong> Ozeanen;<br />
― entwickeln wir die erforderlichen Technologien für die Erreichung umwelt <strong>und</strong> klimapolitischer Ziele <strong>und</strong><br />
leisten einen maritimen Beitrag zur Umstellung der Verkehrs <strong>und</strong> Energiewirtschaft von fossilen auf<br />
alternative <strong>und</strong> regenerative Energieträger. Wir übernehmen Verantwortung für den nachhaltigen Umgang<br />
mit der Natur <strong>und</strong> endlichen Ressourcen;<br />
― realisieren wir fortschrittliche Förder <strong>und</strong> Transportkonzepte für die sichere <strong>und</strong> umweltfre<strong>und</strong>liche Energie<strong>und</strong><br />
Rohstoffversorgung Deutschlands aus dem Meer. Wir übernehmen Verantwortung für die<br />
wirtschaftlichen Gr<strong>und</strong>lagen <strong>und</strong> Wachstumspotenziale kommender Generationen;<br />
― zu Energieeffizienz <strong>und</strong> Transportlogistik schaffen wir die technischen Voraussetzungen für die<br />
Verkehrsverlagerung von der Straße auf das Wasser. Wir übernehmen Verantwortung im Kampf gegen den<br />
Verkehrsinfarkt <strong>und</strong> für die Sicherung nachhaltiger Mobilität für die Industrie <strong>und</strong> Exportnation Deutschland;<br />
― optimieren wir die Anlagen <strong>und</strong> Prozesse in Schiffbau <strong>und</strong> Schifffahrt sowie OffshoreTechnik <strong>und</strong> erreichen<br />
Exzellenz in der Produktion, Betrieb <strong>und</strong> Dienstleistung. Wir entwickeln die technologischen <strong>und</strong><br />
methodischen Voraussetzungen dafür, dass trotz Lohnkostennachteils Schiffe <strong>und</strong> meerestechnische Anlagen<br />
nach dem Stand der Technik wirtschaftlich in Deutschland produziert <strong>und</strong> betrieben werden können. Wir<br />
übernehmen Verantwortung für den Erhalt wettbewerbsfähiger Arbeitsplätze in Schifffahrt, Schiffbau <strong>und</strong><br />
Meerestechnik;<br />
INMT INSTITUT FÜR NAUTIK UND MARITIME TECHNOLOGIE<br />
Maritimes Zentrum der<br />
Fachhochschule Flensburg<br />
Campusallee 5<br />
24943 Flensburg<br />
Lageplan / CampusMap<br />
http://www.fh-flensburg.de/mz/<br />
― <strong>und</strong> durch Aus <strong>und</strong> Weiterbildung leisten wir einen Beitrag <strong>zum</strong> Erhalt der Technologieführerschaft <strong>und</strong> zur<br />
Erhöhung der maritimen Kompetenz. Wir übernehmen Verantwortung für den akademischen Nachwuchs <strong>und</strong><br />
für den Bildungsstandort Deutschland.<br />
Postanschrift: Kanzleistr. 9193<br />
Telefon: ++49 (0) 461 805 – 01<br />
Telefax: ++49 (0) 461 805 – 1300<br />
Mail: infopoint fhflensburg.de<br />
Homepage: Maritimes Zentrum<br />
Presse<br />
Broschüre <strong>zum</strong> Maritimen Zentrum als PDF<br />
INGENIEURSPIEGEL Maritimes Zentrum<br />
Infoveranstaltung zu den Perspektiven in der maritimen Industrie für Berufsberater, SHZBeitrag;<br />
Schiffsingenieure: Süddeutsche Zeitung<br />
Video: Jubiläum 125 Jahre (Download) @ Youtube;<br />
SCHIFF & HAFEN <strong>zum</strong> Maritimen Zentrum<br />
RTL Fachhochschule Flensburg<br />
NDR Schiffsführungssimulatoren<br />
Informationstagung Entwicklungen <strong>und</strong> Betriebserfahrungen<br />
NDR Schiffsemissionen<br />
WDR Leichtlauföle<br />
MARINEFORUM Maritimes Zentrum<br />
FLETTNERRotor SHZ; FLETTNERRotorVersuchsbeschreibung; FLETTNERSegelboot der UniFlensburg<br />
Seite 2 von 3<br />
Quelle: VSM<br />
15.11.2011
A2 Ausstattung<br />
Auszug aus www.fh-flensburg.de/ima
In Deutschland ganz oben!<br />
INSTITUT FÜR MASCHINEN UND ANLAGEN<br />
Maritim<br />
Modern<br />
Praxisnah<br />
FH Flensburg<br />
Home<br />
Intranet<br />
VPN<br />
Lernportal Stud.IP<br />
WebMail<br />
Notenaushänge<br />
Fachbereich Technik<br />
Home<br />
Energiesystemtechnik<br />
Maschinen <strong>und</strong> Anlagen<br />
Werkstofftechnik<br />
Chem. Technologie<br />
Fachschaft Seefahrt<br />
<strong>Schiffstechnik</strong><br />
Nautik/Logistik<br />
Maritimes Forschungs <strong>und</strong><br />
Ausbildungszentrum<br />
Home<br />
Ausstattung<br />
Kontakt/Lageplan<br />
Presse<br />
INMT – Institut für Nautik <strong>und</strong><br />
Maritime Technologie<br />
Home<br />
Ansprechpersonen<br />
Projekte/Weiterbildung<br />
Kontakt/Lageplan<br />
ISF – Institut für<br />
Schiffsbetriebsforschung<br />
Ansprechpersonen<br />
Ausstattung<br />
Weiterbildung<br />
IMA Institut für Maschinen <strong>und</strong><br />
Anlagen<br />
Ansprechpersonen<br />
Ausstattung<br />
Prof. Dr.Ing. Holger Watter<br />
Home<br />
RSSNews<br />
Lehrveranstaltungen<br />
Skripte/Download<br />
Forschung <strong>und</strong> Projekte<br />
Leistungs/Tätigkeitsprofil<br />
Kontakt <strong>und</strong> Lageplan<br />
Outlook<br />
Links<br />
Fachschule für Seefahrt<br />
Berufsfachschule SBTA<br />
STGF<br />
STG<br />
Weitere Links<br />
Fachhochschule Flensburg<br />
Flensburg University of Applied Sciences<br />
Kanzleistraße 9193<br />
24943 Flensburg<br />
Telefon: +49 (0461) 80501<br />
Telefax: +49 (0461) 8051300<br />
www.fhflensburg.de<br />
Das INSTITUT FÜR MASCHINEN UND ANLAGEN ist eine Einrichtung des Fachbereichs Technik. Es<br />
hält Versuchseinrichtungen <strong>und</strong> Laborausstattungen bereit, die für das systemtechnische Verständnis in<br />
verschiedenen Studienbereichen der Hochschule benötigt werden: Maschinenbau, elektrische Energietechnik,<br />
regenerative Energiesysteme, Energie <strong>und</strong> Umweltmanagement, <strong>Schiffstechnik</strong> sowie Seeverkehr, Nautik <strong>und</strong><br />
Logistik finden hier ihre komplexen Anwendungsbeispiele. Die systemtechnischen Zusammenhänge <strong>und</strong> das<br />
Zusammenwirken der einzelnen Systemkomponenten können anschaulich <strong>und</strong> praxisnah gezeigt werden.<br />
FHBroschürenflyer "Study Courses in Energy Engineering at Flensburg University of applied Sciences"<br />
Ansprechpersonen<br />
Prof. Dr. Peter Boy (em.)<br />
Kapt. Prof. Sander Limant, LL.M. (Master of Laws); Link zur Kanzlei<br />
Kapt. Dipl. Wirt.Ing. Günter Schmidt<br />
Prof. Dr.Ing. Ulrich Franke (em.)<br />
Prof. Dr.Ing. Holger Watter<br />
Sigrid Lürkens<br />
Dipl.Ing. Tove Möller<br />
Holger Rehbehn<br />
Ausstattung<br />
Energieeffizienz, Emissionsreduzierungen <strong>und</strong> Ressourcenschonung der Geräte, Anlagen <strong>und</strong> Systeme können<br />
durch technologische <strong>und</strong> betriebliche Maßnahmen erreicht werden. Die größten Potentiale liegen dabei „in<br />
der Hand des Betreibers“. Falsche oder nichtoptimale Betriebskonzepte können zu beträchtlichen<br />
Abweichungen vom Optimalwert führen (ein anschauliches Beispiel ist der PKW: Die Normverbräuche können<br />
oft erheblich von den tatsächlichen Betriebswerten abweichen. Auch sind die physischen <strong>und</strong> audiovisuellen<br />
Eindrücke einer simulierten Rennwagenfahrt auf dem PC deutlich anders als bei einer reellen Fahrt).<br />
Hilfen <strong>zum</strong> Selbststudium<br />
Das Institut für Maschinen <strong>und</strong> Anlagen sieht seinen Tätigkeitsschwerpunkt im Bereich der optimalen<br />
Betriebsführung logistischer <strong>und</strong> energieeffizienter Systeme am Beispiel des Transportsystems Schiff.<br />
Analogien <strong>und</strong> Konzepte der „Erneuerbaren Energien“ werden konsequent übertragen <strong>und</strong> bewertet.<br />
Exemplarische Anlagenkonzepte werden hier intensiv untersucht <strong>und</strong> hinsichtlich Energieeffizienz <strong>und</strong><br />
Ressourcenschonung bewertet:<br />
1. Schiffsführungssimulatoren<br />
2. Safety and Security Trainer<br />
3. Stabilitäts <strong>und</strong> Ladungsrechner<br />
4. Schiffsmaschinensimulator<br />
5. Technikum/Maschinenhalle<br />
6. Versuchsmotor AVL<br />
7. Versuchsmotor MWM<br />
8. Montageübungen am MWMMotor<br />
9. Kraftstoffeinspritzsystem<br />
10. Abgasanalyse<br />
11. Abgasturbolader<br />
12. Kolben <strong>und</strong> Kolbenringinspektion<br />
13. Wasserturbine<br />
14. MikroGasturbine<br />
15. Wärmepumpe & Kälteanlage<br />
16. Pumpenprüfstand<br />
17. Rohrleitungswiderstände<br />
18. Hydraulikprüfstand<br />
19. Pneumatik<br />
20. Verdichterprüfstand<br />
21. Windkanal<br />
Schiffsführungssimulatoren<br />
http://www.fh-flensburg.de/ima/index.htm<br />
Seite 1 von 13<br />
15.11.2011
Die 6 Schiffsführungssimulatoren bilden realitätsnah die Brücken <strong>und</strong> Schiffsumgebungen auf modernen<br />
Handelsschiffen nach. Dabei können verschiedene Schiffstypen <strong>und</strong> nautische Situationen nachgebildet<br />
werden. Er gewährleistet so eine praxisnahe Ausbildung für die Schiffsführung (Navigation, Manövrieren,<br />
Kollisionsverhütung, VTS, Brückenorganisation, ECDIS, GMDSS, etc.). Es können neue technische <strong>und</strong><br />
praktische Lösungen für die Bereiche Schiffsführung, Hafen <strong>und</strong> Wasserstraßenplanung, Verkehrsregelung<br />
<strong>und</strong> Verkehrssicherheit entwickelt werden.<br />
Safety and Security Trainer SST<br />
nach oben<br />
Quelle: www.rheinmetall.com<br />
Der "Safety and Security"Trainer ist speziell auf Sicherheitsaspekte zugeschnitten ist. Das Konzept deckt alle<br />
Aspekte der Sicherheit ab. So stellt das System als 2DVersion die Entwicklung <strong>und</strong> Kombination von<br />
simulierten Katastrophenszenarien, technischen Störungen <strong>und</strong> sich daraus ergebenden Folgereaktionen für<br />
Einzel oder Teamschulungen zur Verfügung. Zugang zu allen Decks über eine detaillierte grafische Darstellung,<br />
vollfunktionsfähige schiffstechnische Systeme <strong>und</strong> Kommunikationsmöglichkeiten wie an Bord eines realen<br />
Schiffes zeichnen die Funktionalität des Simulators aus – <strong>und</strong> das in Echtzeit.<br />
Der "Safety and Security"Trainer kann für Team oder für Einzelschulungen konfiguriert werden. Im<br />
Teammodus üben die Teilnehmer alle auf ein <strong>und</strong> demselben Schiff, so dass Kommunikation, Interaktionen<br />
<strong>und</strong> Entscheidungen in einer Notsituation wirksam trainiert werden können. Alternativ dazu können<br />
http://www.fh-flensburg.de/ima/index.htm<br />
Seite 2 von 13<br />
15.11.2011
Teilnehmer individuell <strong>und</strong> mit eigenen Übungen auf ihrem Schiff ihre Fähigkeiten schulen.<br />
Zu dem Konzept gehört außerdem die gesamte notwendige Dokumentation (z.B. Kursunterlagen,<br />
Katastrophenpläne, Ausbilderschulungskurse).<br />
Stabilitäts <strong>und</strong> Ladungsrechner<br />
nach oben<br />
Der Stabilitäts <strong>und</strong> Ladungsrechner dient zur Überwachung des Schwimmzustandes des Schiffes. Der<br />
Nautische Offizier an Bord überwacht damit u.a. Stabilität (= vermeiden des Umkippens bzw. Kenterns) <strong>und</strong><br />
Festigkeit (= vermeiden des Durchbrechens des Schiffes). Zusätzlich werden Belange der gefährlichen<br />
Ladungsanteile berücksichtigt, sowie das Tank <strong>und</strong> Ballastwassermanagement überwacht <strong>und</strong> koordiniert.<br />
Schiffsmaschinensimulator<br />
nach oben<br />
Der Schiffsmaschinensimulator SES 4000 (Ship Engine Simulator) bildet die wesentlichen Komponenten des<br />
technischen Schiffsbetriebes aus ca. 30 Subsystemen sowie deren Dynamik ab:<br />
Hauptmaschine (SULZER 5RTA 84 C),<br />
Hilfsmaschinensysteme,<br />
http://www.fh-flensburg.de/ima/index.htm<br />
Seite 3 von 13<br />
15.11.2011
Bordnetz mit Stromerzeugungs, Verteilungs <strong>und</strong> Verbrauchersystem,<br />
Mess, Regelungs, Überwachungs <strong>und</strong> Automatisierungstechnik.<br />
Einen Überblick über die Systemkreisläufe erhalten Sie hier<br />
In Ergänzung <strong>zum</strong> Schiffsmaschinensimulator werden Lernprogramme, 3DSimulationen <strong>und</strong> Annimationen<br />
zur schiffstechnischen Betriebsführung als Lernsystem angeboten.<br />
Technikum/Maschinenhalle<br />
nach oben<br />
Computersimulationen <strong>und</strong> virtuelle Umgebungen sind moderne Lern <strong>und</strong> Arbeitswerkszeuge der<br />
Ingenieurwissenschaften. Theoretisch <strong>und</strong> in der Simulation stellen sich die Systemzusammenhänge einfach<br />
<strong>und</strong> übersichtlich dar. Unsere technische Umgebung wird jedoch geprägt von komplexen technischen<br />
Systemen:<br />
„Du fragst Fre<strong>und</strong>, was ist Theorie <br />
was stimmen soll <strong>und</strong> stimmt doch nie...<br />
Und was ist Praxis? Frag nicht dumm <br />
was stimmt <strong>und</strong> keiner weiß warum...“<br />
(Urheber unbekannt)<br />
Praktische Erfahrungen <strong>und</strong> theoretischen Wissen sind die Basis für beruflichen Erfolg!<br />
Das INSTITUT FÜR MASCHINEN UND ANLAGEN hält daher neben den komplexen Simulationseinrichtungen<br />
praxisnahe Versuchsstände bereit, in der Theorie <strong>und</strong> Praxis nachhaltig miteinander verknüpft werden können.<br />
Wissen wirkt …<br />
http://www.fh-flensburg.de/ima/index.htm<br />
Seite 4 von 13<br />
15.11.2011
Versuchsmotor AVL<br />
Nichts ist praktischer als Theorie!<br />
nach oben<br />
Alternative Kraftstoffe (Pflanzenöl, Schweröl, Bio oder Deponiegase …)?<br />
Angepasste Steuerzeiten zur Emissionsminderung?<br />
Mit dem Versuchsmotor AVL können die wesentlichen Parameter zur motorischen Verbrennung angepasst<br />
<strong>und</strong> auf ihre Wirkungen untersucht werden.<br />
Technischen Daten: Motortyp AVL 528; 1 Zylinder, D = 85 mm, s = 92 mm, n Nenn = 3000 min 1 , P Nenn = 7,7 kW<br />
Als Belastung dient eine wassergekühlte, geregelte Wirbelstrombremse von ZÖLLNER.<br />
Praktikum: Bestimmung von Leistungs <strong>und</strong> Wirkungsgradanteilen sowie Untersuchung des Einflusses des<br />
statischen Förderbeginns auf die Verbrennung <strong>und</strong> Analyse der aufgenommenen Druckverlaufsdiagramme.<br />
http://www.fh-flensburg.de/ima/index.htm<br />
Seite 5 von 13<br />
15.11.2011
Versuchsmotor MWM<br />
nach oben<br />
Der MWMVersuchsmotor repräsentiert die Motorgrößenklasse von kleineren Blockheizkraftwerken (BHKW)<br />
zur KraftWärmeKopplung (KWK) oder von kleineren Schiffsdieselmotoren für den robusten Seebetrieb.<br />
Technische Daten: Motortyp MWM TD 232 V 12; 12 Zylinder, D = 120 mm, s = 130 mm, n Nenn = 1500 min 1 ,<br />
P Nenn = 184 kW. Als Belastung dient eine hydraulische Bremse mit Schieberregulierung der Firma ZÖLLNER.<br />
Praktikum: Erstellung eines KraftstoffVerbrauchskennfeldes, Darstellung von Leistungen <strong>und</strong> Wärmeströme in<br />
einem SANKEYDiagramm <strong>und</strong> thermodynamische Untersuchung am Turbolader.<br />
Montageübungen am MWM-Motor<br />
nach oben<br />
Technische Daten: Motortyp MWM TBD 601, Leistung: 302 kW, Drehzahl: 1500 U/min, Zylinderzahl: 6,<br />
Generator: Siemens 1 FC 5354, Leistung: 330 kVA.<br />
Praktikum: Bislang verwendet für die Aufnahme von Steuerdaten.<br />
Abgasanalyse<br />
nach oben<br />
Energieeffizienz, Ressourcenschonung <strong>und</strong> nachhaltige Energiewandler werden mit Hilfe der Abgasanalyse<br />
bewertet <strong>und</strong> untersucht. Egal ob für konventionelle oder alternative Kraftwerke, Biogasanlagen oder<br />
Maritime, Luft, Straßen <strong>und</strong> Schienentransportsysteme: „Wer misst, misst Mist…“ ist ein alter Spruch aus<br />
der Messtechnik. Hier kann gezeigt werden, wo die Probleme liegen <strong>und</strong> wie diese umgangen werden können.<br />
http://www.fh-flensburg.de/ima/index.htm<br />
Seite 6 von 13<br />
15.11.2011
Kraftstoffeinspritzsystem<br />
nach oben<br />
Technische Daten: BOSCHKraftstoffeinspritzpumpe; Einspritzpumpe mit Schrägkantenregelung<br />
Praktikum: Aufnahme der Nockenerhebungskurve, Bestimmung von Förderbeginn, –ende <strong>und</strong> –menge.<br />
Abgasturboaufladung<br />
nach oben<br />
Die Entwicklung der Abgasturboaufladung war ein Quantensprung für die Motorentwicklung: Neben der<br />
erhöhten Leistungsfähigkeit wurde die Energieeffizienz deutlich gesteigert. Gegenüber einem Saugmotor hat<br />
ein vergleichbarer, aufgeladener Motor in etwa die 3 bis 5fache Leistung bei gleichen Abmessungen. Durch die<br />
Nutzung der Abgasenergie sind die Verbrauchs <strong>und</strong> Emissionswerte deutlich niedriger als beim vergleichbaren<br />
Saugmotor.<br />
Im Großmotorenbau (im Kraftwerks <strong>und</strong> Schiffsbetrieb) werden hohe Anforderungen an die<br />
Belastungsfähigkeit <strong>und</strong> die Lebensdauer der Komponenten gestellt. Eine einfache Überschlagsrechnung soll<br />
dies verdeutlichen:<br />
Bei einer 90%igen Verfügbarkeit hat ein Jahr 0,9 . 365 Tage . 24 Std. = ca. 8000 Betriebsst<strong>und</strong>en. Ein PKW<br />
würde in dieser Zeit bei 100 km/h ca. 800.000 km zurücklegen.<br />
Vergleicht man dies mit der „normalen Lebensdauer“ eines PKWMotors <strong>und</strong> bedenkt, dass bei<br />
Biogaskraftwerken oder im Schiffsbetrieb Wartungsintervalle von 2 … 3 … 5 Jahren erwartet werden, werden<br />
die hohen Anforderungen an die Komponenten verdeutlicht.<br />
Der dargestellte Turbolader von einem Großmotor wird von den Studierenden demontiert <strong>und</strong> montiert.<br />
Dabei werden hohe Anforderungen an Genauigkeit <strong>und</strong> Präzision gestellt.<br />
http://www.fh-flensburg.de/ima/index.htm<br />
Seite 7 von 13<br />
15.11.2011
Technische Daten: Turboladertyp ABB VTR 354, Turbolader mit Stoßaufladung<br />
Praktikum: Demontage <strong>und</strong> Montage<br />
Kolben- <strong>und</strong> Kolbenringinspektion<br />
nach oben<br />
Die zuvor genannten Lebensdauer <strong>und</strong> Präzisionsanforderungen gelten in gleicher Weise für den thermisch<br />
<strong>und</strong> mechanisch hoch beanspruchten Kolben <strong>und</strong> die Kolbenringe. Kolben <strong>und</strong> Kolbenringinspektionen<br />
werden daher im Labor an Großmotorenkomponenten durchgeführt <strong>und</strong> geübt.<br />
Wasserturbine<br />
nach oben<br />
Die Wasserkraft stellt neben der Windenergie die bedeutendste „Erneuerbare Energie“ dar. Wegen der<br />
1000fach größeren Dichte gegenüber Luft können sehr große Energiemengen gespeichert <strong>und</strong> z.B. im<br />
Pumpspeicherkraftwerk bei Bedarf schnell abgerufen werden.<br />
Die FRANCISTurbine ist der am meisten verbreitete Turbinentyp bei Wasserkraftwerken. Die<br />
Betriebseigenschaften, Energieeffizienz <strong>und</strong> Lebensdaueruntersuchungen können hier durchgeführt werden:<br />
Technische Daten: FRANCISTurbine VOITH, Kleinwasserturbine mit Spiralgehäuse, den Wasserstrom erhält die<br />
Turbine von den beiden Kühlwasserpumpen mit je 190 m³/h Förderleistung.<br />
Q = 280 m²/h, H Nutz = 6 m, n Nenn = 800 min 1 , P Nenn = 3,7 kW<br />
Praktikum: Bestimmung des optimalen Betriebspunktes bezogen auf Volumenstrom <strong>und</strong> Fallhöhe.<br />
Mikro-Gasturbine<br />
nach oben<br />
Mikrogasturbine stellen eine interessante Alternative zu konventionellen Energiewandlern dar. Sie sind klein<br />
<strong>und</strong> kompakt, Lastschwankungen können dynamisch sehr schnell kompensiert werden; Sie können mit einem<br />
breiten Spektrum an Kraftstoffen wie Erd <strong>und</strong> Biogas, sowie flüssigen Brennstoffen betrieben werden.<br />
Mikrogasturbinen werden daher in jüngster Zeit zunehmend für die dezentrale Energieversorgung diskutiert.<br />
http://www.fh-flensburg.de/ima/index.htm<br />
Seite 8 von 13<br />
15.11.2011
Technische Daten: Gasturbine DEUTZ T 216<br />
Turbine mit einstufigem Radialverdichter <strong>und</strong> Radialturbine, die Leistungsabgabe erfolgt über ein<br />
zweistufiges Untersetzungsgetriebe. P Nenn = 73,5 kW bei n = 50.000 min 1<br />
Praktikum: Bestimmung von Leistung <strong>und</strong> Wirkungsgrad<br />
Wärmepumpe & Kälteanlage<br />
nach oben<br />
Bei der Wärmepumpe <strong>und</strong> der Kälteanlage handelt es sich um den gleichen technischen Prozess, nur mit<br />
unterschiedlichen Zielrichtungen. Egal ob zur Nutzung von Erdwärme, zur Raumklimatisierung oder für den<br />
Transport verderblicher Güter: Auch wenn die Anlage technisch optimiert wurde, falsche Betriebs oder<br />
Umweltbedingungen können die Energieeffizienz erheblich beeinträchtigen. Die Qualifikationsanforderungen<br />
an den Betreiber hinsichtlich Wartung, Betrieb <strong>und</strong> Instandhaltung sind daher sehr hoch. An der<br />
nachstehenden Anlage können daher alle Teilkomponenten so optimiert eingestellt werden, dass der<br />
Gesamtprozess Energieeffizient <strong>und</strong> Ressourcenschonend bleibt.<br />
Technische Daten: Kältemittel R 404 A, Kühlbecken 1,35 m tief; 0,95 m breit; 0,8 m hoch, Sole (20°C).<br />
Praktikum: Erstellung <strong>und</strong> Bestimmung von logp-hDiagramm, Kälte <strong>und</strong> Wärmeleistungszahl, Gütegrad<br />
Pumpenprüfstand<br />
http://www.fh-flensburg.de/ima/index.htm<br />
nach oben<br />
Seite 9 von 13<br />
15.11.2011
Pumpen <strong>und</strong> Rohrleitungssysteme in Anlagen für Biogas, Wasser oder Meereskraft, konventionelle<br />
Kraftswerke an Land <strong>und</strong> im Schiffsbetrieb …. – oft werden diese Systeme wenig beachtet. Falsche<br />
Betriebsbedingungen können jedoch zur Energieverschwendung (<strong>und</strong> damit erhöhten CO 2 Emissionen) <strong>und</strong><br />
einer verkürzten Lebensdauer (somit zu erhöhten Betriebskosten) führen.<br />
In der Anlage können verschiedene Pumpentypen mit veränderten Betriebsbedingungen (bis hin zur<br />
Kavitation) belastet werden.<br />
Technische Daten der Kreiselpumpe SIHI, ZPNA 3216: Q N = 15 m²/h, H N = 32 m, n N = 2900 min 1 –<br />
Drehzahländerung mittels Frequen<strong>zum</strong>former.<br />
Sehr anschaulich ist der Blick durch eine Plexiglasscheibe ins Pumpeninnere, um die Blasenbildung bei<br />
Kavitation zu zeigen.<br />
Praktikum: Ermittlung von Anlagen <strong>und</strong> Pumpenkennlinien, NPSH, Affinitätsgesetze.<br />
nach oben<br />
Rohrleitungswiderstände <strong>und</strong> -eigenschaften<br />
Es werden die Widerstandeigenschaften verschiedener Einbauten <strong>und</strong> Rohrleitungen untersucht um<br />
Energieverluste zu minimieren <strong>und</strong> die Betriebsbedingungen in Verbindung mit der Pumpe optimieren zu<br />
können.<br />
Technische Daten: Rohrradius: 28 mm, Strömungsgeschwindigkeit bis 8,5 m/s<br />
Praktikum: Bestimmung der Widerstandsbeiwerte für Bögen, Winkel, glattes <strong>und</strong> raues Rohr sowie Aufnahme<br />
einer Ventilkennlinie.<br />
Hydraulikprüfstand<br />
http://www.fh-flensburg.de/ima/index.htm<br />
nach oben<br />
Seite 10 von 13<br />
15.11.2011
Zur Bedeutung der Hydraulik <strong>und</strong> Pneumatik schreibt der Verband Deutscher Maschinen <strong>und</strong> Anlagenbauer<br />
(VDMA):<br />
Fluidtechnik - Hydraulik <strong>und</strong> Pneumatik überträgt Kraft <strong>und</strong> Leistung <strong>zum</strong> Antreiben, Steuern <strong>und</strong><br />
Bewegen. Schnelligkeit, Kraft, Präzision die Dynamik von Maschinen <strong>und</strong> Anlagen sind häufig<br />
Resultate hydraulischer <strong>und</strong> pneumatischer Antriebs <strong>und</strong> Steuerungstechnik. Bei linearen wie auch<br />
rotatorischen Bewegungen, gleichmäßigen Hub oder Senkbewegungen, Beschleunigungsforderungen,<br />
Leistungsübertragungen oder dem Bedarf Positionen anzufahren <strong>und</strong> zu halten, finden hydraulische<br />
<strong>und</strong> pneumatische Komponenten in fast allen Bereichen der Industrie ihre Anwendung. Im Wettbewerb<br />
mit alternativen Antriebstechniken weist sich die Hydraulik vor allem durch ihre wesentlich höhere<br />
Leistungsdichte <strong>und</strong> die Pneumatik durch ihre kostengünstige <strong>und</strong> effiziente Bauweise aus. Hydraulik<br />
<strong>und</strong> Pneumatik begegnet uns überall im täglichen Leben. Kaum ein Produkt kommt ohne den Einsatz<br />
der Fluidtechnik zustande, kaum eine Maschine oder ein Flugzeug bewegt sich ohne sie nur ist es uns<br />
meistens nicht bewusst. Die Hydraulik <strong>und</strong> Pneumatikhersteller sind Zulieferer für die gesamte<br />
Industrie. Zu ihren Abnehmerbranchen zählen z.B. die Automobilindustrie, die Baumaschinen <strong>und</strong><br />
Landmaschinenindustrie, die Fördertechnik, die Hersteller von Nahrungsmitteln <strong>und</strong><br />
Verpackungsmaschinen, von Holzbearbeitungs <strong>und</strong> Werkzeugmaschinen, ebenso wie die<br />
Elektrotechnik, der Schiffbau, die Hütten <strong>und</strong> Walzwerkindustrie bis hin zur Luft <strong>und</strong> Raumfahrt,<br />
Medizintechnik, Umwelttechnik, Gummi <strong>und</strong> Kunststoffindustrie <strong>und</strong> Chemie.<br />
Ein Vergleich der Antriebs <strong>und</strong> Steuerungssysteme (neudeutsch „Benchmark“) liefert folgende Vor <strong>und</strong><br />
Nachteile:<br />
Vorteile der Hydraulik:<br />
� Erzeugung großer Kräfte <strong>und</strong> Drehmomente bei geringen Abmessungen <strong>und</strong> Massen der dazu<br />
verwendeten Bauelemente als Folge der hohen Energiedichte der Hydraulik (das Verhältnis der<br />
Leistungsgewichte von Hydromotor zu Elektromotor liegt bei etwa 1:10).<br />
� Stufenlose Änderung der Antriebsgeschwindigkeit bzw. –drehzahl, einfache Umkehr der<br />
Bewegungsrichtung, Anfahren aus dem Stillstand auch unter voller Last.<br />
� Niedrige Trägheitsmomente hydraulischer Motoren wegen ihrer geringen Abmessungen <strong>und</strong> bewegten<br />
Massen, folglich geringe Zeitkonstanten bei Anfahrt <strong>und</strong> Verzögerung (das Verhältnis der<br />
Massenträgheitsmomente von Hydromotoren zu Elektromotoren liegt bei gleichem Drehmoment etwa<br />
bei 1:50).<br />
� Einfache Anzeige der wirkenden Kräfte <strong>und</strong> Drehmomente durch Druckmessgeräte.<br />
� Einfach, beliebig einstellbarer Überlastschutz durch Druckbegrenzungsventile.<br />
� Einfache Umwandlung von rotierender in oszillierende Bewegung <strong>und</strong> umgekehrt.<br />
� Stufenlose Übersetzungsänderung unter Last (besonders vorteilhaft für mobile Arbeitsmaschinen).<br />
� Problemloser Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (EXZonen).<br />
Nachteile der Hydraulik:<br />
http://www.fh-flensburg.de/ima/index.htm<br />
� Relativ hohe Anschaffungskosten durch die zur Erzielung kleinstmöglicher Spalte zwischen bewegten<br />
Bauteilen erforderliche genaue Fertigung (Präzisions <strong>und</strong> Feinmechanik der Bauteile).<br />
� Hohe Anforderungen an die Filterung der Hydraulikflüssigkeiten.<br />
� Geringe Übertragungsentfernung hydraulischer Anlagen durch die aus der relativ hohen Viskosität der<br />
Hydraulikflüssigkeit resultierenden hohen Druckverluste.<br />
� Abhängigkeit wichtiger Eigenschaften der Hydraulikflüssigkeit, wie<br />
Viskosität, Dichte <strong>und</strong> Kompressibilität von Druck <strong>und</strong> Temperatur.<br />
� Geringer Wirkungsgrad der hydraulischen Antriebe gegenüber den<br />
mechanischen Antrieben (infolge von Druckverlusten durch<br />
Flüssigkeitsreibung in Rohren <strong>und</strong> Elementen sowie infolge von<br />
Leckölverlusten in den Spalten der Elemente).<br />
� Schlupf zwischen An <strong>und</strong> Abtrieb (infolge von Leckölverlusten <strong>und</strong><br />
Seite 11 von 13<br />
15.11.2011
Kompression des Öles, so dass keine exakte Synchronisierung von<br />
Bewegungsabläufen möglich ist).<br />
Ausstattung: Mobiler Labortisch, kleine Schaltungen lassen sich aufbauen <strong>und</strong> untersuchen;<br />
Literaturempfehlung.<br />
Praktikum: Aufbau von Schaltungen <strong>und</strong> Fehlersuche<br />
Pneumatikprüfstand<br />
Vorteile der Pneumatik:<br />
nach oben<br />
Siehe auch Fluidtechnik<br />
� Wegen der großen Kompressiblität der Luft ist eine Speicherung von Druckluft einfach <strong>und</strong> damit die<br />
Anwendung zentraler Druckluftsysteme möglich.<br />
� Große Übertragungsentfernungen pneumatischer Anlagen, da wegen der geringen Viskosität der Luft<br />
geringe Druckverluste auftreten.<br />
� Rückfluss <strong>und</strong> Leckleitungen nicht erforderlich.<br />
� Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (z.B. Produktionsprozessen) problemlos möglich.<br />
Nachteile der Pneumatik:<br />
� Infolge der Energiespeicherfähigkeit der Luft (Unfallgefahr) wird der Druck pneumatischer Netze auf<br />
0,6...1,0 Mpa (= 6...10 bar) begrenzt, weshalb pneumatische Anlagen im Vergleich zur Hydraulik nur<br />
geringe Kräfte übertragen können.<br />
� Gleichförmige Bewegung, insbesondere bei veränderlicher Belastung pneumatischer Motoren, sind<br />
wegen der großen Kompressiblität der Luft nicht möglich.<br />
� Beim Ausströmen der Abluft in die Atmosphäre treten Entlüftungsgeräusche auf<br />
(Lärmschutzproblematik).<br />
Ausstattung: Das Labor umfasst drei Arbeitsplätze mit Stecktafeln, es sind genügend Elemente vorhanden, um<br />
größere Schaltungen zu realisieren; Literaturempfehlung.<br />
Praktikum: Aufbau einer Schaltung <strong>und</strong> Fehlersuche<br />
Verdichterprüfstand<br />
nach oben<br />
Im Vergleich der Steuerungssysteme Pneumatik, Hydraulik, Elektronik/Elektrik <strong>und</strong> Mechanik zeichnet sich die<br />
Pneumatik durch relativ große Übertragungsweiten, gute Speichereigenschaften <strong>und</strong> hohe Leistungsdichten<br />
[in W/Ltr oder W/kg] aus. Sie stellt daher ein probates Steuerungs <strong>und</strong> Regelungskonzept sowie<br />
leistungsstarker Aktor dar.<br />
Wegen der Asymmetrien der Windparks bezüglich Energieangebot <strong>und</strong> nachfrage werden<br />
Druckluftspeicherkraftwerk als interessante Option gehandelt.<br />
An der dargestellten Verdichterstation können die wichtigsten System <strong>und</strong> Betriebsparameter analysiert <strong>und</strong><br />
untersucht werden:<br />
Technische Daten:<br />
Verdichter 1: 3 Zylinder, Hubraum = 0,411 l/Zyl., p = 10 bar, n = 600 bis 1200 min 1<br />
Verdichter 2: 1 Zylinder, Hubraum = 0,411 l, p = 16 bar, n = 600 bis 1200 min 1<br />
Praktikum: Erstellung <strong>und</strong> Bestimmung von pVDiagrammen, Wirkungs, Füllungs, <strong>und</strong> Liefergrad von<br />
Verdichter 2; Literaturempfehlung.<br />
http://www.fh-flensburg.de/ima/index.htm<br />
Seite 12 von 13<br />
15.11.2011
Windkanal<br />
nach oben<br />
Strömungsgünstige Fahrzeugkarosserien, neuartige Profile für Wind <strong>und</strong> Wasserkraftanlagen, alternative<br />
Windantriebskonzepte können im Windkanal hinsichtlich ihrer Effizienz <strong>und</strong> Nachhaltigkeit untersucht werden:<br />
Technische Daten:<br />
Ventilatorenprüfstand nach DIN 24163,<br />
Antrieb: DrehstromAsynchronmotor, P Nenn = 11 kW, n max = 2900 min 1<br />
Ventilatordurchmesser: 560 mm<br />
Maximale Strömungsgeschwindigkeit: 60 m/s<br />
Praktikum: Ermittlung von Anlagen <strong>und</strong> Ventilatorkennlinien, Geschwindigkeitsdreiecken, Aufnahme eines<br />
Strömungsprofils sowie Ermittlung von Widerstandsbeiwerten div. geometrischer Körper, Widerstands <strong>und</strong><br />
Auftriebskraft eines Tragflügelprofils, MAGNUSEffekt.<br />
Beispiel: FLETTNERRotor <strong>und</strong> MAGNUSEffekt am Beispiel ESHIP1; Ergebnisse <strong>und</strong> Interpretation einer<br />
Messfahrt mit dem FLETTNERSegelboot der Uni Flensburg.<br />
Im Auftrag von auswärtigen K<strong>und</strong>en wurden am Prüfstand Ventilatorkennlinien bzw. c W Werte bestimmt.<br />
Versuch<br />
Bild & Kurzbeschreibung der Versuchsstände<br />
http://www.fh-flensburg.de/ima/index.htm<br />
nach oben<br />
nach oben<br />
Seite 13 von 13<br />
15.11.2011
A3 STCW-Konvention
STCW/CONF.2/34 - 84 -<br />
I:\CONF\STCW\2\34.doc<br />
CHAPTER III<br />
Standards regarding engine department<br />
Section A-III/1<br />
Mandatory minimum requirements for certification of officers in charge of an engineering watch<br />
in a manned engine-room or as designated duty engineers in a periodically unmanned<br />
engine-room<br />
Training<br />
1 The education and training required by paragraph 2.4 of regulation III/1 shall include<br />
training in mechanical and electrical workshop skills relevant to the duties of an engineer officer.<br />
Onboard training<br />
2 Every candidate for certification as officer in charge of an engineering watch in a manned<br />
engine-room or as designated duty engineer in a periodically unmanned engine-room of ships<br />
powered by main propulsion machinery of 750 kW or more whose seagoing service,<br />
in accordance with paragraph 2.2 of regulation III/1, forms part of a training programme<br />
approved as meeting the requirements of this section shall follow an approved programme of<br />
onboard training which:<br />
.1 ensures that, during the required period of seagoing service, the candidate receives<br />
systematic practical training and experience in the tasks, duties and<br />
responsibilities of an officer in charge of an engine-room watch, taking into<br />
account the guidance given in section B-III/1 of this Code;<br />
.2 is closely supervised and monitored by a qualified and certificated engineer<br />
officer aboard the ships in which the approved seagoing service is performed; and<br />
.3 is adequately documented in a training record book.<br />
Standard of competence<br />
3 Every candidate for certification as officer in charge of an engineering watch in a manned<br />
engine-room or as designated duty engineer in a periodically unmanned engine-room on a<br />
seagoing ship powered by main propulsion machinery of 750 kW propulsion power or more shall<br />
be required to demonstrate ability to <strong>und</strong>ertake, at the operational level, the tasks, duties and<br />
responsibilities listed in column 1 of table A-III/1.<br />
4 The minimum knowledge, <strong>und</strong>erstanding and proficiency required for certification is<br />
listed in column 2 of table A-III/1.<br />
5 The level of knowledge of the material listed in column 2 of table A-III/1 shall be<br />
sufficient for engineer officers to carry out their watchkeeping duties. *<br />
* The relevant IMO Model Course(s) may be of assistance in the preparation of courses.
I:\CONF\STCW\2\34.DOC<br />
- 85 - STCW/CONF.2/34<br />
6 Training and experience to achieve the necessary theoretical knowledge, <strong>und</strong>erstanding<br />
and proficiency shall be based on section A-VIII/2, part 4-2 Principles to be observed in<br />
keeping an engineering watch, and shall take into account the relevant requirements of this part<br />
and the guidance given in part B of this Code.<br />
7 Candidates for certification for service in ships in which steam boilers do not form part of<br />
their machinery may omit the relevant requirements of table A-III/1. A certificate awarded on<br />
such a basis shall not be valid for service on ships in which steam boilers form part of a ship’s<br />
machinery until the engineer officer meets the standard of competence in the items omitted from<br />
table A-III/1. Any such limitation shall be stated on the certificate and in the endorsement.<br />
8 The Administration may omit knowledge requirements for types of propulsion machinery<br />
other than those machinery installations for which the certificate to be awarded shall be valid.<br />
A certificate awarded on such a basis shall not be valid for any category of machinery installation<br />
which has been omitted until the engineer officer proves to be competent in these knowledge<br />
requirements. Any such limitation shall be stated on the certificate and in the endorsement.<br />
9 Every candidate for certification shall be required to provide evidence of having achieved the<br />
required standard of competence in accordance with the methods for demonstrating competence<br />
and the criteria for evaluating competence tabulated in columns 3 and 4 of table A-III/1.<br />
Near-coastal voyages<br />
10 The requirements of paragraphs 2.2 to 2.5 of regulation III/1 relating to level of<br />
knowledge, <strong>und</strong>erstanding and proficiency required <strong>und</strong>er the different sections listed in<br />
column 2 of table A-III/1 may be varied for engineer officers of ships powered by main<br />
propulsion machinery of less than 3,000 kW propulsion power engaged on near-coastal voyages,<br />
as considered necessary, bearing in mind the effect on the safety of all ships which may be<br />
operating in the same waters. Any such limitation shall be stated on the certificate and in the<br />
endorsement.
STCW/CONF.2/34 - 86 -<br />
Table A-III/1<br />
Specification of minimum standard of competence for officers in charge of<br />
an engineering watch in a manned engine-room or designated duty engineers<br />
in a periodically unmanned engine-room<br />
Function: Marine engineering at the operational level<br />
Column 1 Column 2 Column 3 Column 4<br />
Competence Knowledge, <strong>und</strong>erstanding<br />
and proficiency<br />
Maintain a safe<br />
engineering watch<br />
I:\CONF\STCW\2\34.doc<br />
Thorough knowledge of<br />
Principles to be observed in<br />
keeping an engineering watch,<br />
including:<br />
.1 duties associated with<br />
taking over and accepting a<br />
watch<br />
.2 routine duties <strong>und</strong>ertaken<br />
during a watch<br />
.3 maintenance of the<br />
machinery space logs and<br />
the significance of the<br />
readings taken<br />
.4 duties associated with<br />
handing over a watch<br />
Safety and emergency<br />
procedures; change-over of<br />
remote/automatic to local<br />
control of all systems<br />
Safety precautions to be<br />
observed during a watch and<br />
immediate actions to be taken in<br />
the event of fire or accident,<br />
with particular reference to oil<br />
systems<br />
Methods for<br />
demonstrating<br />
competence<br />
Assessment of evidence<br />
obtained from one or<br />
more of the following:<br />
.1 approved in-service<br />
experience<br />
.2 approved training<br />
ship experience<br />
.3 approved simulator<br />
training, where<br />
appropriate<br />
.4 approved laboratory<br />
equipment training<br />
Criteria for<br />
evaluating competence<br />
The conduct, handover<br />
and relief of the watch<br />
conforms with accepted<br />
principles and<br />
procedures<br />
The frequency and<br />
extent of monitoring of<br />
engineering equipment<br />
and systems conforms<br />
to manufacturers’<br />
recommendations and<br />
accepted principles and<br />
procedures, including<br />
Principles to be<br />
observed in keeping an<br />
engineering watch<br />
A proper record is<br />
maintained of the<br />
movements and<br />
activities relating to the<br />
ship’s engineering<br />
systems
I:\CONF\STCW\2\34.DOC<br />
- 87 - STCW/CONF.2/34<br />
Column 1 Column 2 Column 3 Column 4<br />
Competence Knowledge, <strong>und</strong>erstanding<br />
and proficiency<br />
Maintain a safe<br />
engineering watch<br />
(continued)<br />
Use English in<br />
written and oral<br />
form<br />
Use internal<br />
communication<br />
systems<br />
Engine-room resource<br />
management<br />
Knowledge of engine-room<br />
resource management<br />
principles, including:<br />
.1 allocation, assignment, and<br />
prioritization of resources<br />
.2 effective communication<br />
.3 assertiveness and leadership<br />
.4 obtaining and maintaining<br />
situational awareness<br />
.5 consideration of team<br />
experience<br />
Adequate knowledge of the<br />
English language to enable the<br />
officer to use engineering<br />
publications and to perform<br />
engineering duties<br />
Operation of all internal<br />
communication systems on<br />
board<br />
Methods for<br />
demonstrating<br />
competence<br />
Assessment of evidence<br />
obtained from one or<br />
more of the following:<br />
.1 approved training<br />
.2 approved in-service<br />
experience<br />
.3 approved simulator<br />
training<br />
Examination and<br />
assessment of evidence<br />
obtained from practical<br />
instruction<br />
Examination and<br />
assessment of evidence<br />
obtained from one or<br />
more of the following:<br />
.1 approved in-service<br />
experience<br />
.2 approved training<br />
ship experience<br />
.3 approved simulator<br />
training, where<br />
appropriate<br />
.4 approved laboratory<br />
equipment training<br />
Criteria for<br />
evaluating competence<br />
Resources are allocated<br />
and assigned as needed<br />
in correct priority to<br />
perform necessary tasks<br />
Communication is<br />
clearly and<br />
unambiguously given and<br />
received<br />
Questionable decisions<br />
and/or actions result in<br />
appropriate challenge<br />
and response<br />
Effective leadership<br />
behaviours are<br />
identified<br />
Team member(s) share<br />
accurate <strong>und</strong>erstanding<br />
of current and predicted<br />
engine-room and<br />
associated systems<br />
state, and of external<br />
environment<br />
English language<br />
publications relevant to<br />
engineering duties are<br />
correctly interpreted<br />
Communications are<br />
clear and <strong>und</strong>erstood<br />
Transmission and<br />
reception of messages<br />
are consistently<br />
successful<br />
Communication records<br />
are complete, accurate<br />
and comply with<br />
statutory requirements
STCW/CONF.2/34 - 88 -<br />
Column 1 Column 2 Column 3 Column 4<br />
Competence Knowledge, <strong>und</strong>erstanding<br />
and proficiency<br />
Operate main and<br />
auxiliary machinery<br />
and associated<br />
control systems<br />
I:\CONF\STCW\2\34.doc<br />
Basic construction and<br />
operation principles of<br />
machinery systems, including:<br />
.1 marine diesel engine<br />
.2 marine steam turbine<br />
.3 marine gas turbine<br />
.4 marine boiler<br />
.5 shafting installations,<br />
including propeller<br />
.6 other auxiliaries, including<br />
various pumps, air<br />
compressor, purifier, fresh<br />
water generator, heat<br />
exchanger, refrigeration,<br />
air-conditioning and<br />
ventilation systems<br />
.7 steering gear<br />
.8 automatic control systems<br />
.9 fluid flow and<br />
characteristics of<br />
lubricating oil, fuel oil and<br />
cooling systems<br />
.10 deck machinery<br />
Safety and emergency<br />
procedures for operation of<br />
propulsion plant machinery,<br />
including control systems<br />
Methods for<br />
demonstrating<br />
competence<br />
Examination and<br />
assessment of evidence<br />
obtained from one or<br />
more of the following:<br />
.1 approved in-service<br />
experience<br />
.2 approved training<br />
ship experience<br />
.3 approved laboratory<br />
equipment training<br />
Criteria for<br />
evaluating competence<br />
Construction and<br />
operating mechanisms<br />
can be <strong>und</strong>erstood and<br />
explained with<br />
drawings/instructions
I:\CONF\STCW\2\34.DOC<br />
- 89 - STCW/CONF.2/34<br />
Column 1 Column 2 Column 3 Column 4<br />
Competence Knowledge, <strong>und</strong>erstanding<br />
and proficiency<br />
Operate main and<br />
auxiliary machinery<br />
and associated<br />
control systems<br />
(continued)<br />
Operate fuel,<br />
lubrication, ballast<br />
and other pumping<br />
systems and<br />
associated control<br />
systems<br />
Preparation, operation, fault<br />
detection and necessary<br />
measures to prevent damage for<br />
the following machinery items<br />
and control systems:<br />
.1 main engine and associated<br />
auxiliaries<br />
.2 steam boiler and associated<br />
auxiliaries and steam<br />
systems<br />
.3 auxiliary prime movers and<br />
associated systems<br />
.4 other auxiliaries, including<br />
refrigeration, airconditioning<br />
and ventilation<br />
systems<br />
Operational characteristics of<br />
pumps and piping systems,<br />
including control systems<br />
Operation of pumping systems:<br />
.1 routine pumping operations<br />
.2 operation of bilge, ballast<br />
and cargo pumping<br />
systems<br />
Oily-water separators<br />
(or-similar equipment)<br />
requirements and operation<br />
Methods for<br />
demonstrating<br />
competence<br />
Examination and<br />
assessment of evidence<br />
obtained from one or<br />
more of the following:<br />
.1 approved in-service<br />
experience<br />
.2 approved training<br />
ship experience<br />
.3 approved simulator<br />
training, where<br />
appropriate<br />
.4 approved laboratory<br />
equipment training<br />
Examination and<br />
assessment of evidence<br />
obtained from one or<br />
more of the following:<br />
.1 approved in-service<br />
experience<br />
.2 approved training<br />
ship experience<br />
.3 approved simulator<br />
training, where<br />
appropriate<br />
.4 approved laboratory<br />
equipment training<br />
Criteria for<br />
evaluating competence<br />
Operations are planned<br />
and carried out in<br />
accordance with<br />
operating manuals,<br />
established rules and<br />
procedures to ensure<br />
safety of operations and<br />
avoid pollution of the<br />
marine environment<br />
Deviations from the<br />
norm are promptly<br />
identified<br />
The output of plant and<br />
engineering systems<br />
consistently meets<br />
requirements, including<br />
bridge orders relating to<br />
changes in speed and<br />
direction<br />
The causes of<br />
machinery malfunctions<br />
are promptly identified<br />
and actions are designed<br />
to ensure the overall<br />
safety of the ship and<br />
the plant, having regard<br />
to the prevailing<br />
circumstances and<br />
conditions<br />
Operations are planned<br />
and carried out in<br />
accordance with<br />
operating manuals,<br />
established rules and<br />
procedures to ensure<br />
safety of operations and<br />
avoid pollution of the<br />
marine environment<br />
Deviations from the<br />
norm are promptly<br />
identified and<br />
appropriate action is<br />
taken
STCW/CONF.2/34 - 90 -<br />
Function: Electrical, electronic and control engineering at the operational level<br />
Column 1 Column 2 Column 3 Column 4<br />
Competence Knowledge, <strong>und</strong>erstanding<br />
and proficiency<br />
Operate electrical,<br />
electronic and<br />
control systems<br />
I:\CONF\STCW\2\34.doc<br />
Basic configuration and<br />
operation principles of the<br />
following electrical,<br />
electronic and control<br />
equipment:<br />
.1 electrical equipment:<br />
.a generator and<br />
distribution systems<br />
.b preparing, starting,<br />
paralleling and changing<br />
over generators<br />
.c electrical motors<br />
including starting<br />
methodologies<br />
.d high-voltage<br />
installations<br />
.e sequential control<br />
circuits and associated<br />
system devices<br />
.2 electronic equipment:<br />
.a characteristics of basic<br />
electronic circuit<br />
elements<br />
.b flowchart for automatic<br />
and control systems<br />
.c functions, characteristics<br />
and features of control<br />
systems for machinery<br />
items, including main<br />
propulsion plant<br />
operation control and<br />
steam boiler automatic<br />
controls<br />
.3 control systems:<br />
.a various automatic control<br />
methodologies and<br />
characteristics<br />
.b Proportional–Integral–<br />
Derivative (PID) control<br />
characteristics and<br />
associated system devices<br />
for process control<br />
Methods for<br />
demonstrating<br />
competence<br />
Examination and<br />
assessment of evidence<br />
obtained from one or<br />
more of the following:<br />
.1 approved in-service<br />
experience<br />
.2 approved training<br />
ship experience<br />
.3 approved simulator<br />
training, where<br />
appropriate<br />
.4 approved laboratory<br />
equipment training<br />
Criteria for<br />
evaluating competence<br />
Operations are planned and<br />
carried out in accordance<br />
with operating manuals,<br />
established rules and<br />
procedures to ensure safety<br />
of operations<br />
Electrical, electronic and<br />
control systems can be<br />
<strong>und</strong>erstood and explained<br />
with drawings/instructions
I:\CONF\STCW\2\34.DOC<br />
- 91 - STCW/CONF.2/34<br />
Column 1 Column 2 Column 3 Column 4<br />
Competence Knowledge, <strong>und</strong>erstanding<br />
and proficiency<br />
Maintenance and<br />
repair of electrical<br />
and electronic<br />
equipment<br />
Safety requirements for<br />
working on shipboard<br />
electrical systems, including<br />
the safe isolation of electrical<br />
equipment required before<br />
personnel are permitted to<br />
work on such equipment<br />
Maintenance and repair of<br />
electrical system equipment,<br />
switchboards, electric motors,<br />
generator and DC electrical<br />
systems and equipment<br />
Detection of electric<br />
malfunction, location of<br />
faults and measures to<br />
prevent damage<br />
Construction and operation of<br />
electrical testing and<br />
measuring equipment<br />
Function and performance<br />
tests of the following<br />
equipment and their<br />
configuration:<br />
.1 monitoring systems<br />
.2 automatic control devices<br />
.3 protective devices<br />
The interpretation of<br />
electrical and simple<br />
electronic diagrams<br />
Methods for<br />
demonstrating<br />
competence<br />
Examination and<br />
assessment of evidence<br />
obtained from one or<br />
more of the following:<br />
.1 approved workshop<br />
skills training<br />
.2 approved practical<br />
experience and tests<br />
.3 approved in-service<br />
experience<br />
.4 approved training<br />
ship experience<br />
Criteria for<br />
evaluating competence<br />
Safety measures for<br />
working are appropriate<br />
Selection and use of hand<br />
tools, measuring<br />
instruments, and testing<br />
equipment are appropriate<br />
and interpretation of results<br />
is accurate<br />
Dismantling, inspecting,<br />
repairing and reassembling<br />
equipment are in<br />
accordance with manuals<br />
and good practice<br />
Reassembling and<br />
performance testing is in<br />
accordance with manuals<br />
and good practice
STCW/CONF.2/34 - 92 -<br />
Function: Maintenance and repair at the operational level<br />
Column 1 Column 2 Column 3 Column 4<br />
Competence Knowledge, <strong>und</strong>erstanding<br />
and proficiency<br />
Appropriate use of<br />
hand tools, machine<br />
tools and measuring<br />
instruments for<br />
fabrication and<br />
repair on board<br />
Maintenance and<br />
repair of shipboard<br />
machinery and<br />
equipment<br />
I:\CONF\STCW\2\34.doc<br />
Characteristics and limitations<br />
of materials used in<br />
construction and repair of<br />
ships and equipment<br />
Characteristics and limitations<br />
of processes used for<br />
fabrication and repair<br />
Properties and parameters<br />
considered in the fabrication<br />
and repair of systems and<br />
components<br />
Methods for carrying out safe<br />
emergency/temporary repairs<br />
Safety measures to be taken to<br />
ensure a safe working<br />
environment and for using<br />
hand tools, machine tools and<br />
measuring instruments<br />
Use of hand tools, machine<br />
tools and measuring<br />
instruments<br />
Use of various types of<br />
sealants and packings<br />
Safety measures to be taken<br />
for repair and maintenance,<br />
including the safe isolation of<br />
shipboard machinery and<br />
equipment required before<br />
personnel are permitted to<br />
work on such machinery or<br />
equipment<br />
Appropriate basic mechanical<br />
knowledge and skills<br />
Methods for<br />
demonstrating<br />
competence<br />
Assessment of evidence<br />
obtained from one or<br />
more of the following:<br />
.1 approved workshop<br />
skills training<br />
.2 approved practical<br />
experience and tests<br />
.3 approved in-service<br />
experience<br />
.4 approved training ship<br />
experience<br />
Examination and<br />
assessment of evidence<br />
obtained from one or<br />
more of the following:<br />
.1 approved workshop<br />
skills training<br />
.2 approved practical<br />
experience and tests<br />
.3 approved in-service<br />
experience<br />
Criteria for<br />
evaluating competence<br />
Identification of important<br />
parameters for fabrication<br />
of typical ship-related<br />
components is appropriate<br />
Selection of materials is<br />
appropriate<br />
Fabrication is to<br />
designated tolerances<br />
Use of equipment and<br />
hand tools, machine tools<br />
and measuring instruments<br />
is appropriate and safe<br />
Safety procedures<br />
followed are appropriate<br />
Selection of tools and<br />
spare gear is appropriate
I:\CONF\STCW\2\34.DOC<br />
- 93 - STCW/CONF.2/34<br />
Column 1 Column 2 Column 3 Column 4<br />
Competence Knowledge, <strong>und</strong>erstanding<br />
and proficiency<br />
Maintenance and<br />
repair of shipboard<br />
machinery and<br />
equipment<br />
(continued)<br />
Maintenance and repair, such<br />
as dismantling, adjustment<br />
and reassembling of<br />
machinery and equipment<br />
The use of appropriate<br />
specialized tools and<br />
measuring instruments<br />
Design characteristics and<br />
selection of materials in<br />
construction of equipment<br />
Interpretation of machinery<br />
drawings and handbooks<br />
The interpretation of piping,<br />
hydraulic and pneumatic<br />
diagrams<br />
Methods for<br />
demonstrating<br />
competence<br />
.4 approved training<br />
ship experience<br />
Criteria for<br />
evaluating competence<br />
Dismantling, inspecting,<br />
repairing and reassembling<br />
equipment is in<br />
accordance with manuals<br />
and good practice<br />
Re-commissioning and<br />
performance testing is in<br />
accordance with manuals<br />
and good practice<br />
Selection of materials and<br />
parts is appropriate<br />
Function: Controlling the operation of the ship and care for persons on board at the<br />
operational level<br />
Column 1 Column 2 Column 3 Column 4<br />
Competence Knowledge, <strong>und</strong>erstanding<br />
and proficiency<br />
Ensure compliance<br />
with pollutionprevention<br />
requirements<br />
Prevention of pollution of the<br />
marine environment<br />
Knowledge of the<br />
precautions to be taken to<br />
prevent pollution of the<br />
marine environment<br />
Anti-pollution procedures<br />
and all associated equipment<br />
Importance of proactive<br />
measures to protect the<br />
marine environment<br />
Methods for<br />
demonstrating<br />
competence<br />
Examination and<br />
assessment of evidence<br />
obtained from one or more<br />
of the following:<br />
.1 approved in-service<br />
experience<br />
.2 approved training ship<br />
experience<br />
.3 approved training<br />
Criteria for<br />
evaluating competence<br />
Procedures for<br />
monitoring shipboard<br />
operations and ensuring<br />
compliance with<br />
MARPOL requirements<br />
are fully observed<br />
Actions to ensure that a<br />
positive environmental<br />
reputation is maintained
STCW/CONF.2/34 - 94 -<br />
Column 1 Column 2 Column 3 Column 4<br />
Competence Knowledge, <strong>und</strong>erstanding<br />
and proficiency<br />
Maintain<br />
seaworthiness of<br />
the ship<br />
Prevent, control and<br />
fight fires on board<br />
I:\CONF\STCW\2\34.doc<br />
Ship stability<br />
Working knowledge and<br />
application of stability, trim<br />
and stress tables, diagrams<br />
and stress-calculating<br />
equipment<br />
Understanding of the<br />
f<strong>und</strong>amentals of watertight<br />
integrity<br />
Understanding of<br />
f<strong>und</strong>amental actions to be<br />
taken in the event of partial<br />
loss of intact buoyancy<br />
Ship construction<br />
General knowledge of the<br />
principal structural members<br />
of a ship and the proper<br />
names for the various parts<br />
Fire prevention and<br />
fire-fighting appliances<br />
Ability to organize fire drills<br />
Knowledge of classes and<br />
chemistry of fire<br />
Knowledge of fire-fighting<br />
systems<br />
Action to be taken in the<br />
event of fire, including fires<br />
involving oil systems<br />
Methods for<br />
demonstrating<br />
competence<br />
Examination and<br />
assessment of evidence<br />
obtained from one or more<br />
of the following:<br />
.1 approved in-service<br />
experience<br />
.2 approved training ship<br />
experience<br />
.3 approved simulator<br />
training, where<br />
appropriate<br />
.4 approved laboratory<br />
equipment training<br />
Assessment of evidence<br />
obtained from approved<br />
fire-fighting training and<br />
experience as set out in<br />
section A-VI/3,<br />
paragraphs 1 to 3<br />
Criteria for<br />
evaluating competence<br />
The stability conditions<br />
comply with the IMO<br />
intact stability criteria<br />
<strong>und</strong>er all conditions of<br />
loading<br />
Actions to ensure and<br />
maintain the watertight<br />
integrity of the ship are in<br />
accordance with accepted<br />
practice<br />
The type and scale of the<br />
problem is promptly<br />
identified and initial<br />
actions conform with the<br />
emergency procedure and<br />
contingency plans for the<br />
ship<br />
Evacuation, emergency<br />
shutdown and isolation<br />
procedures are<br />
appropriate to the nature<br />
of the emergency and are<br />
implemented promptly<br />
The order of priority, and<br />
the levels and time-scales<br />
of making reports and<br />
informing personnel on<br />
board, are relevant to the<br />
nature of the emergency<br />
and reflect the urgency of<br />
the problem
I:\CONF\STCW\2\34.DOC<br />
- 95 - STCW/CONF.2/34<br />
Column 1 Column 2 Column 3 Column 4<br />
Competence Knowledge, <strong>und</strong>erstanding<br />
and proficiency<br />
Operate life-saving<br />
appliances<br />
Apply medical first<br />
aid on board ship<br />
Monitor<br />
compliance with<br />
legislative<br />
requirements<br />
Application of<br />
leadership and<br />
teamworking skills<br />
Life-saving<br />
Ability to organize abandon<br />
ship drills and knowledge of<br />
the operation of survival craft<br />
and rescue boats, their<br />
launching appliances and<br />
arrangements, and their<br />
equipment, including radio<br />
life-saving appliances,<br />
satellite EPIRBs, SARTs,<br />
immersion suits and thermal<br />
protective aids<br />
Medical aid<br />
Practical application of<br />
medical guides and advice by<br />
radio, including the ability to<br />
take effective action based on<br />
such knowledge in the case<br />
of accidents or illnesses that<br />
are likely to occur on board<br />
ship<br />
Basic working knowledge of the<br />
relevant IMO conventions<br />
concerning safety of life at sea,<br />
security and protection of the<br />
marine environment<br />
Working knowledge of<br />
shipboard personnel<br />
management and training<br />
A knowledge of related<br />
international maritime<br />
conventions and<br />
recommendations, and<br />
national legislation<br />
Ability to apply task and<br />
workload management,<br />
including:<br />
.1 planning and coordination<br />
.2 personnel assignment<br />
.3 time and resource<br />
constraints<br />
.4 prioritization<br />
Methods for<br />
demonstrating<br />
competence<br />
Assessment of evidence<br />
obtained from approved<br />
training and experience as<br />
set out in<br />
section A-VI/2,<br />
paragraphs 1 to 4<br />
Assessment of evidence<br />
obtained from approved<br />
training as set out in<br />
section A-VI/4,<br />
paragraphs 1 to 3<br />
Assessment of evidence<br />
obtained from examination<br />
or approved training<br />
Assessment of evidence<br />
obtained from one or more<br />
of the following:<br />
.1 approved training<br />
.2 approved in-service<br />
experience<br />
.3 practical demonstration<br />
Criteria for<br />
evaluating competence<br />
Actions in responding to<br />
abandon ship and survival<br />
situations are appropriate<br />
to the prevailing<br />
circumstances and<br />
conditions and comply<br />
with accepted safety<br />
practices and standards<br />
Identification of probable<br />
cause, nature and extent<br />
of injuries or conditions is<br />
prompt and treatment<br />
minimizes immediate<br />
threat to life<br />
Legislative requirements<br />
relating to safety of life at<br />
sea, security and protection<br />
of the marine environment<br />
are correctly identified<br />
The crew are allocated<br />
duties and informed of<br />
expected standards of<br />
work and behaviour in a<br />
manner appropriate to the<br />
individuals concerned<br />
Training objectives and<br />
activities are based on<br />
assessment of current<br />
competence and<br />
capabilities and<br />
operational requirements.<br />
Operations are<br />
demonstrated to be in<br />
accordance with<br />
applicable rules
STCW/CONF.2/34 - 96 -<br />
Column 1 Column 2 Column 3 Column 4<br />
Competence Knowledge, <strong>und</strong>erstanding<br />
and proficiency<br />
Application of<br />
leadership and<br />
teamworking skills<br />
(continued)<br />
I:\CONF\STCW\2\34.doc<br />
Knowledge and ability to<br />
apply effective resource<br />
management:<br />
.1 allocation, assignment,<br />
and prioritization of<br />
resources<br />
.2 effective communication<br />
on board and ashore<br />
.3 decisions reflect<br />
consideration of team<br />
experiences<br />
.4 assertiveness and<br />
leadership, including<br />
motivation<br />
.5 obtaining and maintaining<br />
situational awareness<br />
Knowledge and ability to<br />
apply decision-making<br />
techniques:<br />
.1 situation and risk<br />
assessment<br />
.2 identify and consider<br />
generated options<br />
.3 selecting course of action<br />
.4 evaluation of outcome<br />
effectiveness<br />
Methods for<br />
demonstrating<br />
competence<br />
Criteria for<br />
evaluating competence<br />
Operations are planned<br />
and resources are<br />
allocated as needed in<br />
correct priority to perform<br />
necessary tasks<br />
Communication is clearly<br />
and unambiguously given<br />
and received<br />
Effective leadership<br />
behaviours are<br />
demonstrated<br />
Necessary team<br />
member(s) share accurate<br />
<strong>und</strong>erstanding of current<br />
and predicted vessel state<br />
and operational status and<br />
external environment<br />
Decisions are most<br />
effective for the situation
I:\CONF\STCW\2\34.DOC<br />
- 97 - STCW/CONF.2/34<br />
Column 1 Column 2 Column 3 Column 4<br />
Competence Knowledge,<br />
<strong>und</strong>erstanding and<br />
proficiency<br />
Contribute to the<br />
safety of personnel<br />
and ship<br />
Knowledge of personal<br />
survival techniques<br />
Knowledge of fire<br />
prevention and ability to<br />
fight and extinguish fires<br />
Knowledge of elementary<br />
first aid<br />
Knowledge of personal<br />
safety and social<br />
responsibilities<br />
Methods for<br />
demonstrating<br />
competence<br />
Assessment of evidence<br />
obtained from approved<br />
training and experience as<br />
set out in section A-VI/1,<br />
paragraph 2<br />
Criteria for<br />
evaluating competence<br />
Appropriate safety and<br />
protective equipment is<br />
correctly used<br />
Procedures and safe working<br />
practices designed to safeguard<br />
personnel and the ship are<br />
observed at all times<br />
Procedures designed to<br />
safeguard the environment are<br />
observed at all times<br />
Initial and follow-up actions on<br />
becoming aware of an<br />
emergency conform with<br />
established emergency response<br />
procedures
STCW/CONF.2/34 - 98 -<br />
Section A-III/2<br />
Mandatory minimum requirements for certification of chief engineer officers and second engineer<br />
officers on ships powered by main propulsion machinery of 3,000 kW propulsion power or more<br />
Standard of competence<br />
1 Every candidate for certification as chief engineer officer and second engineer officer of<br />
seagoing ships powered by main propulsion machinery of 3,000 kW power or more shall be<br />
required to demonstrate ability to <strong>und</strong>ertake, at the management level, the tasks, duties and<br />
responsibilities listed in column 1 of table A-III/2.<br />
2 The minimum knowledge, <strong>und</strong>erstanding and proficiency required for certification is<br />
listed in column 2 of table A-III/2. This incorporates, expands and extends in depth the subjects<br />
listed in column 2 of table A-III/1 for officers in charge of an engineering watch.<br />
3 Bearing in mind that a second engineer officer shall be in a position to assume the<br />
responsibilities of the chief engineer officer at any time, assessment in these subjects shall be<br />
designed to test the candidate’s ability to assimilate all available information that affects the safe<br />
operation of the ship’s machinery and the protection of the marine environment.<br />
4 The level of knowledge of the subjects listed in column 2 of table A-III/2 shall be<br />
sufficient to enable the candidate to serve in the capacity of chief engineer officer or second<br />
engineer officer. *<br />
5 Training and experience to achieve the necessary level of theoretical knowledge,<br />
<strong>und</strong>erstanding and proficiency shall take into account the relevant requirements of this part and<br />
the guidance given in part B of this Code.<br />
6 The Administration may omit knowledge requirements for types of propulsion machinery<br />
other than those machinery installations for which the certificate to be awarded shall be valid.<br />
A certificate awarded on such a basis shall not be valid for any category of machinery installation<br />
which has been omitted until the engineer officer proves to be competent in these knowledge<br />
requirements. Any such limitation shall be stated on the certificate and in the endorsement.<br />
7 Every candidate for certification shall be required to provide evidence of having achieved<br />
the required standard of competence in accordance with the methods for demonstrating competence<br />
and the criteria for evaluating competence tabulated in columns 3 and 4 of table A-III/2.<br />
Near-coastal voyages<br />
8 The level of knowledge, <strong>und</strong>erstanding and proficiency required <strong>und</strong>er the different<br />
sections listed in column 2 of table A-III/2 may be varied for engineer officers of ships powered<br />
by main propulsion machinery with limited propulsion power engaged on near-coastal voyages,<br />
as considered necessary, bearing in mind the effect on the safety of all ships which may be<br />
operating in the same waters. Any such limitation shall be stated on the certificate and in the<br />
endorsement.<br />
* The relevant IMO Model Course(s) may be of assistance in the preparation of courses.<br />
I:\CONF\STCW\2\34.doc
I:\CONF\STCW\2\34.DOC<br />
- 99 - STCW/CONF.2/34<br />
Table A-III/2<br />
Specification of minimum standard of competence for chief engineer officers<br />
and second engineer officers on ships powered by main propulsion<br />
machinery of 3,000 kW propulsion power or more<br />
Function: Marine engineering at the management level<br />
Column 1 Column 2 Column 3 Column 4<br />
Competence Knowledge, <strong>und</strong>erstanding<br />
and proficiency<br />
Manage the<br />
operation of<br />
propulsion plant<br />
machinery<br />
Plan and schedule<br />
operations<br />
Design features, and<br />
operative mechanism of the<br />
following machinery and<br />
associated auxiliaries:<br />
.1 marine diesel engine<br />
.2 marine steam turbine<br />
.3 marine gas turbine<br />
.4 marine steam boiler<br />
Theoretical knowledge<br />
Thermodynamics and heat<br />
transmission<br />
Mechanics and<br />
hydromechanics<br />
Propulsive characteristics of<br />
diesel engines, steam and<br />
gas turbines, including<br />
speed, output and fuel<br />
consumption<br />
Heat cycle, thermal<br />
efficiency and heat balance<br />
of the following:<br />
.1 marine diesel engine<br />
.2 marine steam turbine<br />
.3 marine gas turbine<br />
.4 marine steam boiler<br />
Methods for<br />
demonstrating<br />
competence<br />
Examination and<br />
assessment of evidence<br />
obtained from one or<br />
more of the following:<br />
.1<br />
experience<br />
.2 approved training<br />
ship experience<br />
.3 approved simulator<br />
training, where<br />
appropriate<br />
.4 approved<br />
laboratory<br />
equipment training<br />
Examination and<br />
assessment of evidence<br />
obtained from one or<br />
more of the following:<br />
.1 approved in-service<br />
experience<br />
.2 approved training<br />
ship experience<br />
.3 approved simulator<br />
training, where<br />
appropriate<br />
.4 approved laboratory<br />
equipment training<br />
Criteria for<br />
evaluating competence<br />
Explanation and<br />
<strong>und</strong>erstanding of design<br />
features and operating<br />
mechanisms are<br />
appropriate<br />
The planning and<br />
preparation of operations is<br />
suited to the design<br />
parameters of the power<br />
installation and to the<br />
requirements of the voyage
STCW/CONF.2/34 - 100 -<br />
Column 1 Column 2 Column 3 Column 4<br />
Competence Knowledge, <strong>und</strong>erstanding<br />
and proficiency<br />
Plan and schedule<br />
operations<br />
(continued)<br />
Operation,<br />
surveillance,<br />
performance<br />
assessment and<br />
maintaining safety<br />
of propulsion plant<br />
and auxiliary<br />
machinery<br />
I:\CONF\STCW\2\34.doc<br />
Refrigerators and<br />
refrigeration cycle<br />
Physical and chemical<br />
properties of fuels and<br />
lubricants<br />
Technology of materials<br />
Naval architecture and ship<br />
construction, including<br />
damage control<br />
Practical knowledge<br />
Start up and shut down main<br />
propulsion and auxiliary<br />
machinery, including<br />
associated systems<br />
Operating limits of<br />
propulsion plant<br />
The efficient operation,<br />
surveillance, performance<br />
assessment and maintaining<br />
safety of propulsion plant<br />
and auxiliary machinery<br />
Functions and mechanism of<br />
automatic control for main<br />
engine<br />
Functions and mechanism of<br />
automatic control for<br />
auxiliary machinery<br />
including but not limited to:<br />
.1 generator distribution<br />
systems<br />
.2 steam boilers<br />
.3 oil purifier<br />
.4 refrigeration system<br />
.5 pumping and piping<br />
systems<br />
.6 steering gear system<br />
.7 cargo-handling<br />
equipment and deck<br />
machinery<br />
Methods for<br />
demonstrating<br />
competence<br />
Examination and<br />
assessment of evidence<br />
obtained from one or<br />
more of the following:<br />
.1 approved in-service<br />
experience<br />
.2 approved training<br />
ship experience<br />
.3 approved simulator<br />
training, where<br />
appropriate<br />
.4 approved laboratory<br />
equipment training<br />
Criteria for<br />
evaluating competence<br />
The methods of preparing<br />
for the start-up and of<br />
making available fuels,<br />
lubricants, cooling water<br />
and air are the most<br />
appropriate<br />
Checks of pressures,<br />
temperatures and<br />
revolutions during the<br />
start-up and warm-up<br />
period are in accordance<br />
with technical<br />
specifications and agreed<br />
work plans<br />
Surveillance of main<br />
propulsion plant and<br />
auxiliary systems is<br />
sufficient to maintain safe<br />
operating conditions<br />
The methods of preparing<br />
the shutdown, and of<br />
supervising the cooling<br />
down of the engine are the<br />
most appropriate<br />
The methods of measuring<br />
the load capacity of the<br />
engines are in accordance<br />
with technical<br />
specifications<br />
Performance is checked<br />
against bridge orders<br />
Performance levels are in<br />
accordance with technical<br />
specifications
I:\CONF\STCW\2\34.DOC<br />
- 101 - STCW/CONF.2/34<br />
Column 1 Column 2 Column 3 Column 4<br />
Competence Knowledge, <strong>und</strong>erstanding<br />
and proficiency<br />
Manage fuel,<br />
lubrication<br />
and ballast<br />
operations<br />
Operation and maintenance<br />
of machinery, including<br />
pumps and piping systems<br />
Methods for<br />
demonstrating<br />
competence<br />
Examination and<br />
assessment of evidence<br />
obtained from one or<br />
more of the following:<br />
.1 approved in-service<br />
experience<br />
.2 approved training<br />
ship experience<br />
.3 approved simulator<br />
training, where<br />
appropriate<br />
Criteria for<br />
evaluating competence<br />
Fuel and ballast operations<br />
meet operational<br />
requirements and are<br />
carried out so as to prevent<br />
pollution of the marine<br />
environment
STCW/CONF.2/34 - 102 -<br />
Function: Electrical, electronic and control engineering at the management level<br />
Column 1 Column 2 Column 3 Column 4<br />
Competence Knowledge, <strong>und</strong>erstanding<br />
and proficiency<br />
Manage operation<br />
of electrical and<br />
electronic control<br />
equipment<br />
Manage<br />
trouble-shooting,<br />
restoration of<br />
electrical and<br />
electronic control<br />
equipment to<br />
operating condition<br />
I:\CONF\STCW\2\34.doc<br />
Theoretical knowledge<br />
Marine electrotechnology,<br />
electronics, power<br />
electronics, automatic<br />
control engineering and<br />
safety devices<br />
Design features and system<br />
configurations of automatic<br />
control equipment and safety<br />
devices for the following:<br />
.1 main engine<br />
.2 generator and<br />
distribution system<br />
.3 steam boiler<br />
Design features and system<br />
configurations of operational<br />
control equipment for<br />
electrical motors<br />
Design features of<br />
high-voltage installations<br />
Features of hydraulic and<br />
pneumatic control<br />
equipment<br />
Practical knowledge<br />
Troubleshooting of electrical<br />
and electronic control<br />
equipment<br />
Function test of electrical,<br />
electronic control equipment<br />
and safety devices<br />
Troubleshooting of<br />
monitoring systems<br />
Software version control<br />
Methods for<br />
demonstrating<br />
competence<br />
Examination and<br />
assessment of evidence<br />
obtained from one or<br />
more of the following:<br />
.1 approved in-service<br />
experience<br />
.2 approved training<br />
ship experience<br />
.3 approved simulator<br />
training, where<br />
appropriate<br />
.4 approved laboratory<br />
equipment training<br />
Examination and<br />
assessment of evidence<br />
obtained from one or<br />
more of the following:<br />
.1 approved in-service<br />
experience<br />
.2 approved training<br />
ship experience<br />
.3 approved simulator<br />
training, where<br />
appropriate<br />
.4 approved laboratory<br />
equipment training<br />
Criteria for<br />
evaluating competence<br />
Operation of equipment and<br />
system is in accordance<br />
with operating manuals<br />
Performance levels are in<br />
accordance with technical<br />
specifications<br />
Maintenance activities are<br />
correctly planned in<br />
accordance with technical,<br />
legislative, safety and<br />
procedural specifications<br />
Inspection, testing and<br />
troubleshooting of<br />
equipment are appropriate
Function: Maintenance and repair at the management level<br />
I:\CONF\STCW\2\34.DOC<br />
- 103 - STCW/CONF.2/34<br />
Column 1 Column 2 Column 3 Column 4<br />
Competence Knowledge, <strong>und</strong>erstanding<br />
and proficiency<br />
Manage safe and<br />
effective<br />
maintenance and<br />
repair procedures<br />
Detect and identify<br />
the cause of<br />
machinery<br />
malfunctions and<br />
correct faults<br />
Ensure safe<br />
working practices<br />
Theoretical knowledge<br />
Marine engineering practice<br />
Practical knowledge<br />
Manage safe and effective<br />
maintenance and repair<br />
procedures<br />
Planning maintenance,<br />
including statutory and class<br />
verifications<br />
Planning repairs<br />
Practical knowledge<br />
Detection of machinery<br />
malfunction, location of faults<br />
and action to prevent damage<br />
Inspection and adjustment of<br />
equipment<br />
Non-destructive examination<br />
Practical knowledge<br />
Safe working practices<br />
Methods for<br />
demonstrating<br />
competence<br />
Examination and<br />
assessment of evidence<br />
obtained from one or<br />
more of the following:<br />
.1 approved in-service<br />
experience<br />
.2 approved training<br />
ship experience<br />
.3 approved workshop<br />
training<br />
Examination and<br />
assessment of evidence<br />
obtained from one or<br />
more of the following:<br />
.1 approved in-service<br />
experience<br />
.2 approved training<br />
ship experience<br />
.3 approved simulator<br />
training, where<br />
appropriate<br />
.4 approved laboratory<br />
equipment training<br />
Examination and<br />
assessment of evidence<br />
obtained from one or<br />
more of the following:<br />
.1 approved in-service<br />
experience<br />
.2 approved training<br />
ship experience<br />
.3 approved laboratory<br />
equipment training<br />
Criteria for<br />
evaluating competence<br />
Maintenance activities are<br />
correctly planned and carried<br />
out in accordance with<br />
technical, legislative, safety<br />
and procedural specifications<br />
Appropriate plans,<br />
specifications, materials and<br />
equipment are available for<br />
maintenance and repair<br />
Action taken leads to the<br />
restoration of plant by the<br />
most suitable method<br />
The methods of comparing<br />
actual operating conditions<br />
are in accordance with<br />
recommended practices and<br />
procedures<br />
Actions and decisions are in<br />
accordance with<br />
recommended operating<br />
specifications and limitations<br />
Working practices are in<br />
accordance with legislative<br />
requirements, codes of<br />
practice, permits to work and<br />
environmental concerns
STCW/CONF.2/34 - 104 -<br />
Function: Controlling the operation of the ship and care for persons on board at the<br />
management level<br />
Column 1 Column 2 Column 3 Column 4<br />
Competence Knowledge, <strong>und</strong>erstanding<br />
and proficiency<br />
Control trim,<br />
stability and stress<br />
Monitor and<br />
control<br />
compliance with<br />
legislative<br />
requirements and<br />
measures to<br />
ensure safety of<br />
life at sea,<br />
security and<br />
protection of the<br />
marine<br />
environment<br />
I:\CONF\STCW\2\34.doc<br />
Understanding of f<strong>und</strong>amental<br />
principles of ship construction<br />
and the theories and factors<br />
affecting trim and stability and<br />
measures necessary to<br />
preserve trim and stability<br />
Knowledge of the effect on<br />
trim and stability of a ship in<br />
the event of damage to, and<br />
consequent flooding of, a<br />
compartment and<br />
countermeasures to be taken<br />
Knowledge of IMO<br />
recommendations concerning<br />
ship stability<br />
Knowledge of relevant<br />
international maritime law<br />
embodied in international<br />
agreements and conventions<br />
Regard shall be paid especially<br />
to the following subjects:<br />
.1 certificates and other<br />
documents required to be<br />
carried on board ships by<br />
international conventions,<br />
how they may be obtained<br />
and the period of their<br />
legal validity<br />
.2 responsibilities <strong>und</strong>er the<br />
relevant requirements of<br />
the International<br />
Convention on Load<br />
Lines, 1966, as amended<br />
.3 responsibilities <strong>und</strong>er the<br />
relevant requirements of<br />
the International<br />
Convention for the Safety<br />
of Life at Sea, 1974, as<br />
amended<br />
Methods for<br />
demonstrating<br />
competence<br />
Examination and<br />
assessment of evidence<br />
obtained from one or<br />
more of the following:<br />
.1 approved in-service<br />
experience<br />
.2 approved training<br />
ship experience<br />
.3 approved simulator<br />
training, where<br />
appropriate<br />
Examination and<br />
assessment of evidence<br />
obtained from one or<br />
more of the following:<br />
.1 approved in-service<br />
experience<br />
.2 approved training<br />
ship experience<br />
.3 approved simulator<br />
training, where<br />
appropriate<br />
Criteria for<br />
evaluating competence<br />
Stability and stress<br />
conditions are maintained<br />
within safety limits at all<br />
times<br />
Procedures for monitoring<br />
operations and maintenance<br />
comply with legislative<br />
requirements<br />
Potential non-compliance is<br />
promptly and fully<br />
identified<br />
Requirements for renewal<br />
and extension of certificates<br />
ensure continued validity of<br />
survey items and equipment
I:\CONF\STCW\2\34.DOC<br />
- 105 - STCW/CONF.2/34<br />
Column 1 Column 2 Column 3 Column 4<br />
Competence Knowledge, <strong>und</strong>erstanding<br />
and proficiency<br />
Monitor and<br />
control<br />
compliance with<br />
legislative<br />
requirements and<br />
measures to<br />
ensure safety of<br />
life at sea and<br />
protection of the<br />
marine<br />
environment<br />
(continued)<br />
Maintain safety<br />
and security of the<br />
vessel, crew and<br />
passengers and<br />
the operational<br />
condition of<br />
life-saving,<br />
fire-fighting and<br />
other safety<br />
systems<br />
.4 responsibilities <strong>und</strong>er the<br />
International Convention<br />
for the Prevention of<br />
Pollution from Ships, as<br />
amended<br />
.5 maritime declarations of<br />
health and the<br />
requirements of the<br />
International Health<br />
Regulations<br />
.6 responsibilities <strong>und</strong>er<br />
international instruments<br />
affecting the safety of the<br />
ships, passengers, crew or<br />
cargo<br />
.7 methods and aids to<br />
prevent pollution of the<br />
environment by ships<br />
.8 knowledge of national<br />
legislation for<br />
implementing<br />
international agreements<br />
and conventions<br />
A thorough knowledge of<br />
life-saving appliance<br />
regulations (International<br />
Convention for the Safety of<br />
Life at Sea)<br />
Organization of fire and<br />
abandon ship drills<br />
Maintenance of operational<br />
condition of life-saving,<br />
fire-fighting and other safety<br />
systems<br />
Actions to be taken to protect<br />
and safeguard all persons on<br />
board in emergencies<br />
Actions to limit damage and<br />
salve the ship following fire,<br />
explosion, collision or<br />
gro<strong>und</strong>ing<br />
Methods for<br />
demonstrating<br />
competence<br />
Examination and<br />
assessment of evidence<br />
obtained from practical<br />
instruction and approved<br />
in-service training and<br />
experience<br />
Criteria for<br />
evaluating competence<br />
Procedures for monitoring<br />
fire-detection and safety<br />
systems ensure that all<br />
alarms are detected<br />
promptly and acted upon in<br />
accordance with established<br />
emergency procedures
STCW/CONF.2/34 - 106 -<br />
Column 1 Column 2 Column 3 Column 4<br />
Competence Knowledge, <strong>und</strong>erstanding<br />
and proficiency<br />
Develop<br />
emergency and<br />
damage control<br />
plans and handle<br />
emergency<br />
situations<br />
Use leadership<br />
and managerial<br />
skills<br />
I:\CONF\STCW\2\34.doc<br />
Ship construction, including<br />
damage control<br />
Methods and aids for fire<br />
prevention, detection and<br />
extinction<br />
Functions and use of<br />
life-saving appliances<br />
Knowledge of shipboard<br />
personnel management and<br />
training<br />
A knowledge of international<br />
maritime conventions and<br />
recommendations, and related<br />
national legislation<br />
Ability to apply task and<br />
workload management,<br />
including:<br />
.1 planning and coordination<br />
.2 personnel assignment<br />
.3 time and resource<br />
constraints<br />
.4 prioritization<br />
Knowledge and ability to<br />
apply effective resource<br />
management:<br />
.1 allocation, assignment,<br />
and prioritization of<br />
resources<br />
.2 effective communication<br />
on board and ashore<br />
.3 decisions reflect<br />
consideration of team<br />
experience<br />
Methods for<br />
demonstrating<br />
competence<br />
Examination and<br />
assessment of evidence<br />
obtained from approved<br />
in-service training and<br />
experience<br />
Assessment of evidence<br />
obtained from one or<br />
more of the following:<br />
.1 approved training<br />
.2 approved in-service<br />
experience<br />
.3 approved simulator<br />
training<br />
Criteria for<br />
evaluating competence<br />
Emergency procedures are<br />
in accordance with the<br />
established plans for<br />
emergency situations<br />
The crew are allocated<br />
duties and informed of<br />
expected standards of work<br />
and behaviour in a manner<br />
appropriate to the<br />
individuals concerned<br />
Training objectives and<br />
activities are based on<br />
assessment of current<br />
competence and capabilities<br />
and operational<br />
requirements<br />
Operations are<br />
demonstrated to be in<br />
accordance with applicable<br />
rules<br />
Operations are planned and<br />
resources are allocated as<br />
needed in correct priority to<br />
perform necessary tasks<br />
Communication is clearly<br />
and unambiguously given<br />
and received
I:\CONF\STCW\2\34.DOC<br />
- 107 - STCW/CONF.2/34<br />
Column 1 Column 2 Column 3 Column 4<br />
Competence Knowledge, <strong>und</strong>erstanding<br />
and proficiency<br />
Use leadership<br />
and managerial<br />
skills<br />
(continued)<br />
.4 assertiveness and<br />
leadership, including<br />
motivation<br />
.5 obtaining and maintaining<br />
situation awareness<br />
Knowledge and ability to<br />
apply decision-making<br />
techniques:<br />
.1 situation and risk<br />
assessment<br />
.2 identify and generate<br />
options<br />
.3 select course of action<br />
.4 evaluation of outcome<br />
effectiveness<br />
Development,<br />
implementation, and oversight<br />
of standard operating<br />
procedures<br />
Methods for<br />
demonstrating<br />
competence<br />
Criteria for<br />
evaluating competence<br />
Effective leadership<br />
behaviours are<br />
demonstrated<br />
Necessary team member(s)<br />
share accurate<br />
<strong>und</strong>erstanding of current<br />
and predicted vessel state<br />
and operational status and<br />
external environment<br />
Decisions are most effective<br />
for the situation<br />
Operations are<br />
demonstrated to be effective<br />
and in accordance with<br />
applicable rules
A4 Aufgaben <strong>und</strong> Ziele der Akkreditierung<br />
Auszug aus http://de.wikipedia.org/wiki/Akkreditierung_(Hochschulen)
Akkreditierung (Hochschulen) 1<br />
Akkreditierung (Hochschulen)<br />
Der Begriff Akkreditierung (lat. accredere, Glauben schenken) wird in verschiedenen Bereichen benutzt, um den<br />
Umstand zu beschreiben, dass eine allgemein anerkannte Instanz einer anderen das Erfüllen einer besonderen<br />
(nützlichen) Eigenschaft bescheinigt. Im Hochschulbereich ist die Akkreditierung eines der Werkzeuge der<br />
Qualitätssicherung. Kern des Verfahrens ist die Beurteilung der Qualität z. B. eines <strong>Studiengang</strong>es durch Experten<br />
(unabhängige Lehrende <strong>und</strong> Studierende anderer Hochschulen sowie Vertreter der Berufspraxis).<br />
Deutschland<br />
Ziele der Akkreditierung<br />
Speziell im Hochschulbereich verfolgt die Akkreditierung folgende Ziele:<br />
1. Qualität von Lehre <strong>und</strong> Studium sichern, um zur Fakultätsentwicklung beizutragen;<br />
2. Mobilität der Studierenden erhöhen;<br />
3. internationale Vergleichbarkeit von Studienabschlüssen verbessern (nota bene: die Akkreditierung garantiert an<br />
sich noch nicht die internationale Anerkennung);<br />
4. Studierenden, Arbeitgebern <strong>und</strong> Hochschulen die Orientierung über die neu eingeführten<br />
Bakkalaureus-/Bachelor- <strong>und</strong> Magister-/Master-Studiengänge erleichtern;<br />
5. Transparenz der Studiengänge erhöhen.<br />
Akkreditierungsrat <strong>und</strong> Akkreditierungsagenturen<br />
In Deutschland wurde am 8. Dezember 1998 der Akkreditierungsrat eingerichtet. Seine Aufgabe besteht darin,<br />
Agenturen zu begutachten bzw. zu akkreditieren, die ihrerseits wiederum Studiengänge akkreditieren, die zu den<br />
Abschlüssen Bachelor/Bakkalaureus <strong>und</strong> Master/Magister führen, welche in großem Umfang im Rahmen des<br />
Bologna-Prozesses eingeführt werden. Die Agenturen wie die von ihnen akkreditierten Studiengänge tragen im Falle<br />
einer erfolgreichen Begutachtung das Qualitätssiegel des Akkreditierungsrates.<br />
Folgende Agenturen sind berechtigt, das Qualitätssiegel des deutschen Akkreditierungsrates an von ihnen<br />
akkreditierte Studiengänge mit den Abschlüssen Bachelor/Bakkalaureus <strong>und</strong> Master/Magister zu vergeben:<br />
• Agentur für Qualitätssicherung durch Akkreditierung von Studiengängen - (AQAS)<br />
• Agentur für Qualitätssicherung <strong>und</strong> Akkreditierung kanonischer Studiengänge (AKAST )<br />
• Akkreditierungsagentur für Studiengänge der Ingenieurwissenschaften, der Informatik, der Naturwissenschaften<br />
<strong>und</strong> der Mathematik e.V. (ASIIN)<br />
• Akkreditierungsagentur für Studiengänge im Bereich Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Soziales e.V. (AHPGS)<br />
• Akkreditierungs-, Certifizierungs- <strong>und</strong> Qualitätssicherungs-Institut (ACQUIN)<br />
• Evaluationsagentur Baden-Württemberg (evalag)<br />
• Fo<strong>und</strong>ation for International Business Administration Accreditation (FIBAA)<br />
• Organ für Akkreditierung <strong>und</strong> Qualitätssicherung der Schweizerischen Hochschulen (OAQ)<br />
• Österreichische Qualitätssicherungsagentur (AQA)<br />
• Zentrale Evaluations- <strong>und</strong> Akkreditierungsagentur Hannover (ZEvA)
Akkreditierung (Hochschulen) 2<br />
Akkreditierungsverfahren [1]<br />
Die Hochschule stellt einen Antrag auf Programmakkreditierung <strong>und</strong> übermittelt eine Selbstdokumentation<br />
entsprechend den Vorgaben der Akkreditierungsagentur. Sie umfasst eine Beschreibung des Studienprogramms<br />
(Ziele, angestrebter Abschluss, gr<strong>und</strong>sätzlicher Aufbau), ein Modulhandbuch (Übersicht über alle Module des<br />
Studienprogramms) sowie weitere Dokumente. Die Akkreditierungsagentur stellt nach einer formalen Vorprüfung<br />
ein Team aus Gutachtern zusammen, das in der Regel aus Professoren <strong>und</strong> Studierenden anderer Hochschulen sowie<br />
aus Vertretern der Berufspraxis besteht <strong>und</strong> von einer Referentin oder einem Referenten der Agentur im Verfahren<br />
begleitet wird. Die Gutachter erstellen auf Basis der Selbstdokumentation sowie einer in der Regel 2-tägigen<br />
Begehung bei der antragstellenden Hochschule, in deren Rahmen Gespräche mit der Hochschulleitung, der<br />
<strong>Studiengang</strong>sleitung, Studierenden <strong>und</strong> Dozenten sowie weiteren Beteiligten (z. B. Bibliothek, Verwaltungspersonal,<br />
Studienberatung, Qualitätsmanagement) geführt werden, einen Bericht über das zu akkreditierende<br />
Studienprogramm. Auf dieser Gr<strong>und</strong>lage sprechen sie eine Empfehlung für oder gegen die Akkreditierung oder für<br />
eine Akkreditierung mit bestimmten Auflagen (gegenwärtig mit Abstand der häufigste Fall) aus. Die Hochschule<br />
erhält diesen Bericht ohne die Empfehlung <strong>und</strong> kann dazu Stellung nehmen. Die sog. Akkreditierungskommission<br />
der Agentur trifft auf Gr<strong>und</strong>lage des Gutachterberichtes sowie der Stellungnahme der Hochschule die Entscheidung.<br />
Erfolgt diese Akkreditierungsentscheidung "ohne Auflagen" oder werden die ausgesprochenen Auflagen (z. B.<br />
Schließung von Lücken in einer Prüfungsordnung) binnen der gesetzten Frist erfüllt, gilt der <strong>Studiengang</strong> für einen<br />
bestimmten Zeitraum als akkreditiert. Im Falle der Erstakkreditierung beträgt dieser Zeitraum gegenwärtig fünf<br />
Jahre, im Falle der Reakkreditierung sieben Jahre. Der dritte Fall, das Versagen der Akkreditierung, ist<br />
außerordentlich selten (weniger als ein Prozent der Verfahren), offizielle Statistiken liegen mangels<br />
Veröffentlichungspflichten derzeit noch nicht vor. Das gesamte Verfahren der Programmakkreditierung (von der<br />
Einreichung der Selbstdokumentation bis zur Akkreditierungsentscheidung) erstreckt sich in der Regel über einen<br />
Zeitraum von sechs bis neun Monaten.<br />
Kosten des Verfahrens<br />
Die Kosten der Akkreditierung eines einzelnen <strong>Studiengang</strong>es liegen in der Regel bei 10.000 bis 15.000 Euro. Bei<br />
einigen Akkreditierungsagenturen können Hochschulen Mitglied eines Träger- oder Fördervereins werden, sie<br />
erhalten dann einen Rabatt auf die Akkreditierungskosten, werden beteiligt an bestimmten Entscheidungen (z. B.<br />
Auswahl <strong>und</strong> Ernennung der SAK-Mitglieder) <strong>und</strong> können sich vielfach auch an Beratungen über die<br />
Weiterentwicklung der Akkreditierungsgr<strong>und</strong>lagen beteiligen. Kosteneinsparungen können durch die gemeinsame<br />
Akkreditierung affiner Studiengänge erreicht werden (Clusterakkreditierung).<br />
Die Kosten der Akkreditierung sind ein heiß diskutiertes Thema, sowohl die direkten Kosten, d.h. die von den<br />
Agenturen in Rechnung gestellten Kosten, als auch die weiteren durch die Akkreditierungsverfahren in den<br />
Hochschulen entstehenden Kosten. Auch im Hinblick auf die Kosten werden seit 2005 Alternativen zur<br />
Programmakkreditierung diskutiert (Prozessakkreditierung, Systemakkreditierung).<br />
In B<strong>und</strong>esländern, die keine zusätzlichen Finanzmittel für die Akkreditierung bereitstellen, gehen diese Kosten zu<br />
Lasten der Ausstattung für die Lehre. Inwiefern Qualitätsverbesserungen durch Akkreditierungen erreicht werden, ist<br />
umstritten. Zu beobachten ist, dass Hochschulen <strong>und</strong> einzelne Fächer erfolgreiche Akkreditierungen durchaus<br />
vorzeigen <strong>und</strong> als Marketing-Instrument benutzen, dies gilt insbesondere für private Hochschulen. Auch entsteht im<br />
Verfahrensverlauf, insbesondere bei den Begehungen im Rahmen der Erstakkreditierungen, vielfach eine besondere<br />
Aufmerksamkeit für Fragen von Studium <strong>und</strong> Lehre, so dass in Akkreditierungsverfahren <strong>zum</strong>indest ein potentieller<br />
Anstoß für die Befassung mit der Qualität von Studium <strong>und</strong> Lehre vermutet werden kann.
Akkreditierung (Hochschulen) 3<br />
Inhaltliche Kritik<br />
Kritiker, wie der die Interessen der deutschen Hochschullehrer vertretende Deutsche Hochschulverband halten das<br />
aktuelle Akkreditierungsverfahren für "teuer, bürokratisch, langsam, ineffizient, rechtlich zweifelhaft <strong>und</strong><br />
autonomiefeindlich". [2]<br />
Juristische Kritik<br />
Umstritten ist, ob eine wirksame Akkreditierung eines <strong>Studiengang</strong>es bereits dann vorliegt, wenn das<br />
Akkreditierungsverfahren überhaupt durchlaufen wurde, oder erst, wenn nach dem Verfahren ein positives<br />
Akkreditat erteilt wird.<br />
Die Akkreditierung erfolgt, indem die Einhaltung formaler Mindeststandards dokumentiert wird. Hier ist kritisch<br />
an<strong>zum</strong>erken, dass die Ausrichtung auf Minimalanforderungen im besten Fall zur Qualitätssicherung, aber vermutlich<br />
noch nicht zur Qualitätssteigerung reicht.<br />
Die Vereinbarkeit der Akkreditierungspflicht mit dem Gr<strong>und</strong>gesetz, insbesondere mit Artikel 5 Absatz 3 sowie mit<br />
dem in Artikel 20 Absätze 1 <strong>und</strong> 2 sowie Artikel 28 Absatz 1 normierten Demokratieprinzip, wird bezweifelt. Dies<br />
geschieht teilweise unter Bezugnahme auf die so genannte Wesentlichkeitstheorie, wonach solche Entscheidungen,<br />
welche für die Allgemeinheit von wesentlicher Bedeutung sind oder üblicherweise Gr<strong>und</strong>rechte erheblich berühren,<br />
vom parlamentarischen Gesetzgeber getroffen werden müssen (ausführlich Ute Mager, Ist die Akkreditierung von<br />
Studiengängen an Hochschulen verfassungsgemäß? Verwaltungsblätter Baden-Württemberg 2009, S. 9 - 15). Ferner<br />
wird der Verhältnismäßigkeitsgr<strong>und</strong>satz als zentrales Argument dafür angeführt, dass die Akkreditierungspflicht<br />
nicht den Vorgaben des Gr<strong>und</strong>gesetzes entspricht (so z. B. Susanne Meyer, Akkreditierungssystem<br />
verfassungswidrig? Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht [NVwZ] 16/2010, S. 1010-1013, 1011 f. mit<br />
umfangreichen Nachweisen). Das Verwaltungsgericht Arnsberg hat die Frage der Verfassungsmäßigkeit dem<br />
B<strong>und</strong>esverfassungsgericht vorgelegt (VG Arnsberg, Beschluss vom 16. April 2010, 12 K 2689/08, zitiert nach<br />
Susanne Meyer, NVwZ 2010, 1010-1013, 1010 mit Fn.3; Bericht <strong>und</strong> Kommentierung des Vorlagebeschlusses bei<br />
Margarete Mühl-Jäckel, Ist das Akkreditierungsverfahren verfassungswidrig? FAZ.net vom 8. August 2010).<br />
Österreich<br />
In Österreich ist eine Akkreditierung für Studiengänge an Privatuniversitäten <strong>und</strong> Fachhochschulen erforderlich. An<br />
Privatuniversitäten ist dafür der Österreichische Akkreditierungsrat zuständig, an Fachhochschulen der<br />
Fachhochschulrat.<br />
Staatliche Universitäten unterliegen keinerlei Akkreditierungserfordernis. Der Österreichische Akkreditierungsrat hat<br />
mehrmals öffentlich gefordert, dass <strong>zum</strong>indest postgraduale Universitätslehrgänge an staatlichen Universitäten<br />
akkreditierungspflichtig werden, [3] bislang allerdings ohne Erfolg.<br />
USA<br />
In den USA, die als Ursprungsland der Akkreditierung im Bildungsbereich gelten, ist zu beachten, dass es dort zwei<br />
Formen der Akkreditierung gibt. Neben der auch in Europa üblichen Form, die dort als national accreditation<br />
bezeichnet wird, existiert auch noch die sogenannte regional accreditation. Da in den Vereinigten Staaten weder die<br />
B<strong>und</strong>esregierung noch die Regierungen der einzelnen B<strong>und</strong>esstaaten die rechtliche Autorität besitzen, wie in Europa<br />
üblich, eine Hochschule oder High School staatlich anzuerkennen, wird diese Anerkennung durch die für das<br />
jeweilige Gebiet des Landes zuständige regionale Akkreditierungsagentur vorgenommen. Diese Art der<br />
Akkreditierung bezieht sich also nicht auf einen einzelnen <strong>Studiengang</strong>, sondern auf die jeweilige Institution als<br />
Ganzes. Die meisten nationalen Akkreditierungsagenturen in den USA verlangen die regionale Akkreditierung einer<br />
Hochschule als Gr<strong>und</strong>voraussetzung für die nationale Akkreditierung eines von dieser Institution angebotenen<br />
<strong>Studiengang</strong>es. Ein weiterer Unterschied zur Situation in Europa besteht darin, dass alle amerikanischen
Akkreditierung (Hochschulen) 4<br />
Akkreditierungsagenturen als gemeinnützige Unternehmen organisiert sind.<br />
Quellen<br />
[1] Akkreditierungsrat: Regeln für <strong>Studiengang</strong>s- <strong>und</strong> Systemakkreditierung (http:/ / www. akkreditierungsrat. de/ fileadmin/ Seiteninhalte/<br />
Beschluesse_AR/ Beschluss_Regeln_Studiengaenge_Systemakkreditierung_10122010. pdf)<br />
[2] DHV Pressemitteilung vom 31. März 2009 (http:/ / www. hochschulverband. de/ cms1/ pressemitteilung+ M53b7fb95070. html)<br />
[3] Positionspapier des Österreichischen Akkreditierungsrates (http:/ / www. akkreditierungsrat. at/ files/<br />
Positionspapier_Entwicklung_Akkreditierung_2007. pdf)<br />
Literatur<br />
• Bretschneider, Falk / Wildt, Johannes (Hrsg.): Handbuch Akkreditierung von Studiengängen: eine Einführung für<br />
Hochschule, Politik <strong>und</strong> Berufspraxis (Gewerkschaft Erziehung <strong>und</strong> Wissenschaft: GEW-Materialien aus<br />
Hochschule <strong>und</strong> Forschung; 110). Bertelsmann, Bielefeld, 2., vollst. überarb. Aufl 2007. ISBN<br />
978-3-7639-3290-0<br />
• Harris-Hümmert, Susan: Evaluating evaluators: an evaluation of education in Germany (Oxford, Univ., Diss.,<br />
2009). VS, Verl. für Sozialwiss., Wiesbaden 2011. ISBN 978-3-531-17783-0<br />
• Serrano-Velarde, Kathia: Evaluation, Akkreditierung <strong>und</strong> Politik: zur Organisation von Qualitätssicherung im<br />
Zuge des Bolognaprozesses. VS, Verl. für Sozialwiss., Wiesbaden 2008. ISBN 978-3-531-15843-3<br />
• Siever, Marco: Qualitätssicherung durch Programm- <strong>und</strong> Systemakkreditierung im deutschen Hochschulsystem:<br />
unter besonderer Berücksichtigung der Rechtslage in Baden-Württemberg (Schriftenreihe Schriften <strong>zum</strong><br />
Hochschulrecht; Bd. 2) (Tübingen, Univ., Diss., 2011). Kovač, Hamburg 2011. ISBN 978-3-8300-5787-1<br />
Weblinks<br />
Deutschland<br />
• Akkreditierungsrat (http:/ / www. akkreditierungsrat. de/ ) (Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in<br />
Deutschland)<br />
Österreich<br />
• Österreichischer Akkreditierungsrat (http:/ / www. akkreditierungsrat. at)<br />
• Fachhochschulrat (http:/ / www. fhr. ac. at)<br />
Schweiz<br />
• Organ für Akkreditierung <strong>und</strong> Qualitätssicherung der Schweizerischen Hochschulen (OAQ) (http:/ / www. oaq.<br />
EU<br />
ch/ )<br />
• European Committee for Quality Assurance - aufbauend auf ISO 9001/ ISO 9002 (http:/ / www. eu-admin. com/ )<br />
USA<br />
• Informationen über die Akkreditierung von Bildungsinstitutionen in den USA vom U.S. Department of Education<br />
(englisch) (http:/ / www. ed. gov/ admins/ finaid/ accred/ index. html)
Quelle(n) <strong>und</strong> Bearbeiter des/der Artikel(s) 5<br />
Quelle(n) <strong>und</strong> Bearbeiter des/der Artikel(s)<br />
Akkreditierung (Hochschulen) Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?oldid=94274517 Bearbeiter: Aka, Andrsvoss, Asdrubal, Badenserbub, Bapho, Bartian, BearTrommler,<br />
Bernburgerin, Blag, Bunnyfrosch, Calvin Ballantine, Carolin, Ctueck, Danielpflumm, Erasmus2, Fivel, Freddik, Fristu, Gammelgul, GesellschaftsKritiker, HaSee, Harro von Wuff, HelgeRieder,<br />
HolgerB, Invisigoth67, Joerg Winkelmann, Knoerz, Koerpertraining, Laureusop, Lexxodu, Lucky77, Matt1971, Mattes, Meffo, Misburg3014, Mrdaemon, Mueslifix, NessaTelemmaite,<br />
NiTenIchiRyu, Nothere, Ocrho, Ondeletecascade, Ot, PaulRg, Pfmeurer, Pinguin.tk, Reinhard Kraasch, SDB, Salocin, Sboehringer, Snc, ThePeritus, Ticketautomat, Tickle me, Tsui,<br />
UweRohwedder, Volunteer, Wikiwatchers, Zombi, ペーター, 77 anonyme Bearbeitungen<br />
Lizenz<br />
Wichtiger Hinweis zu den Lizenzen<br />
Die nachfolgenden Lizenzen bezieht sich auf den Artikeltext. Im Artikel gezeigte Bilder <strong>und</strong> Grafiken können unter einer anderen Lizenz stehen sowie von Autoren erstellt worden sein, die nicht in der Autorenliste<br />
erscheinen. Durch eine noch vorhandene technische Einschränkung werden die Lizenzinformationen für Bilder <strong>und</strong> Grafiken daher nicht angezeigt. An der Behebung dieser Einschränkung wird gearbeitet.<br />
Das PDF ist daher nur für den privaten Gebrauch bestimmt. Eine Weiterverbreitung kann eine Urheberrechtsverletzung bedeuten.<br />
Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported - Deed<br />
Diese "Commons Deed" ist lediglich eine vereinfachte Zusammenfassung des rechtsverbindlichen Lizenzvertrages (http:/ / de. wikipedia. org/ wiki/ Wikipedia:Lizenzbestimmungen_Commons_Attribution-ShareAlike_3. 0_Unported)<br />
in allgemeinverständlicher Sprache.<br />
Sie dürfen:<br />
• das Werk bzw. den Inhalt vervielfältigen, verbreiten <strong>und</strong> öffentlich zugänglich machen<br />
• Abwandlungen <strong>und</strong> Bearbeitungen des Werkes bzw. Inhaltes anfertigen<br />
Zu den folgenden Bedingungen:<br />
• Namensnennung — Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen.<br />
• Weitergabe unter gleichen Bedingungen — Wenn Sie das lizenzierte Werk bzw. den lizenzierten Inhalt bearbeiten, abwandeln oder in anderer Weise erkennbar als Gr<strong>und</strong>lage für eigenes Schaffen verwenden, dürfen Sie die<br />
daraufhin neu entstandenen Werke bzw. Inhalte nur unter Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch, vergleichbar oder kompatibel sind.<br />
Wobei gilt:<br />
• Verzichtserklärung — Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die ausdrückliche Einwilligung des Rechteinhabers dazu erhalten.<br />
• Sonstige Rechte — Die Lizenz hat keinerlei Einfluss auf die folgenden Rechte:<br />
• Die gesetzlichen Schranken des Urheberrechts <strong>und</strong> sonstigen Befugnisse zur privaten Nutzung;<br />
• Das Urheberpersönlichkeitsrecht des Rechteinhabers;<br />
• Rechte anderer Personen, entweder am Lizenzgegenstand selber oder bezüglich seiner Verwendung, <strong>zum</strong> Beispiel Persönlichkeitsrechte abgebildeter Personen.<br />
• Hinweis — Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen alle Lizenzbedingungen mitteilen, die für dieses Werk gelten. Am einfachsten ist es, an entsprechender Stelle einen Link auf http:/ / creativecommons. org/ licenses/<br />
by-sa/ 3. 0/ deed. de einzubinden.<br />
Haftungsbeschränkung<br />
Die „Commons Deed“ ist kein Lizenzvertrag. Sie ist lediglich ein Referenztext, der den zugr<strong>und</strong>eliegenden Lizenzvertrag übersichtlich <strong>und</strong> in allgemeinverständlicher Sprache, aber auch stark vereinfacht wiedergibt. Die Deed selbst<br />
entfaltet keine juristische Wirkung <strong>und</strong> erscheint im eigentlichen Lizenzvertrag nicht.<br />
GNU Free Documentation License<br />
Version 1.2, November 2002<br />
Copyright (C) 2000,2001,2002 Free Software Fo<strong>und</strong>ation, Inc.<br />
51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA<br />
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies<br />
of this license document, but changing it is not allowed.<br />
0. PREAMBLE<br />
The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other functional and useful document "free" in the sense of freedom: to assure everyone the effective freedom to copy and redistribute it, with or without modifying it,<br />
either commercially or noncommercially. Secondarily, this License preserves for the author and publisher a way to get credit for their work, while not being considered responsible for modifications made by others.<br />
This License is a kind of "copyleft", which means that derivative works of the document must themselves be free in the same sense. It complements the GNU General Public License, which is a copyleft license designed for free<br />
software.<br />
We have designed this License in order to use it for manuals for free software, because free software needs free documentation: a free program should come with manuals providing the same freedoms that the software does. But this<br />
License is not limited to software manuals; it can be used for any textual work, regardless of subject matter or whether it is published as a printed book. We recommend this License principally for works whose purpose is instruction or<br />
reference.<br />
1. APPLICABILITY AND DEFINITIONS<br />
This License applies to any manual or other work, in any medium, that contains a notice placed by the copyright holder saying it can be distributed <strong>und</strong>er the terms of this License. Such a notice grants a world-wide, royalty-free<br />
license, unlimited in duration, to use that work <strong>und</strong>er the conditions stated herein. The "Document", below, refers to any such manual or work. Any member of the public is a licensee, and is addressed as "you". You accept the license<br />
if you copy, modify or distribute the work in a way requiring permission <strong>und</strong>er copyright law.<br />
A "Modified Version" of the Document means any work containing the Document or a portion of it, either copied verbatim, or with modifications and/or translated into another language.<br />
A "Secondary Section" is a named appendix or a front-matter section of the Document that deals exclusively with the relationship of the publishers or authors of the Document to the Document's overall subject (or to related matters)<br />
and contains nothing that could fall directly within that overall subject. (Thus, if the Document is in part a textbook of mathematics, a Secondary Section may not explain any mathematics.) The relationship could be a matter of<br />
historical connection with the subject or with related matters, or of legal, commercial, philosophical, ethical or political position regarding them.<br />
The "Invariant Sections" are certain Secondary Sections whose titles are designated, as being those of Invariant Sections, in the notice that says that the Document is released <strong>und</strong>er this License. If a section does not fit the above<br />
definition of Secondary then it is not allowed to be designated as Invariant. The Document may contain zero Invariant Sections. If the Document does not identify any Invariant Sections then there are none.<br />
The "Cover Texts" are certain short passages of text that are listed, as Front-Cover Texts or Back-Cover Texts, in the notice that says that the Document is released <strong>und</strong>er this License. A Front-Cover Text may be at most 5 words, and a<br />
Back-Cover Text may be at most 25 words.<br />
A "Transparent" copy of the Document means a machine-readable copy, represented in a format whose specification is available to the general public, that is suitable for revising the document straightforwardly with generic text editors<br />
or (for images composed of pixels) generic paint programs or (for drawings) some widely available drawing editor, and that is suitable for input to text formatters or for automatic translation to a variety of formats suitable for input to<br />
text formatters. A copy made in an otherwise Transparent file format whose markup, or absence of markup, has been arranged to thwart or discourage subsequent modification by readers is not Transparent. An image format is not<br />
Transparent if used for any substantial amount of text. A copy that is not "Transparent" is called "Opaque".<br />
Examples of suitable formats for Transparent copies include plain ASCII without markup, Texinfo input format, LaTeX input format, SGML or XML using a publicly available DTD, and standard-conforming simple HTML,<br />
PostScript or PDF designed for human modification. Examples of transparent image formats include PNG, XCF and JPG. Opaque formats include proprietary formats that can be read and edited only by proprietary word processors,<br />
SGML or XML for which the DTD and/or processing tools are not generally available, and the machine-generated HTML, PostScript or PDF produced by some word processors for output purposes only.<br />
The "Title Page" means, for a printed book, the title page itself, plus such following pages as are needed to hold, legibly, the material this License requires to appear in the title page. For works in formats which do not have any title<br />
page as such, "Title Page" means the text near the most prominent appearance of the work's title, preceding the beginning of the body of the text.<br />
A section "Entitled XYZ" means a named subunit of the Document whose title either is precisely XYZ or contains XYZ in parentheses following text that translates XYZ in another language. (Here XYZ stands for a specific section<br />
name mentioned below, such as "Acknowledgements", "Dedications", "Endorsements", or "History".) To "Preserve the Title" of such a section when you modify the Document means that it remains a section "Entitled XYZ" according<br />
to this definition.<br />
The Document may include Warranty Disclaimers next to the notice which states that this License applies to the Document. These Warranty Disclaimers are considered to be included by reference in this License, but only as regards<br />
disclaiming warranties: any other implication that these Warranty Disclaimers may have is void and has no effect on the meaning of this License.<br />
2. VERBATIM COPYING<br />
You may copy and distribute the Document in any medium, either commercially or noncommercially, provided that this License, the copyright notices, and the license notice saying this License applies to the Document are reproduced<br />
in all copies, and that you add no other conditions whatsoever to those of this License. You may not use technical measures to obstruct or control the reading or further copying of the copies you make or distribute. However, you may<br />
accept compensation in exchange for copies. If you distribute a large enough number of copies you must also follow the conditions in section 3.<br />
You may also lend copies, <strong>und</strong>er the same conditions stated above, and you may publicly display copies.<br />
3. COPYING IN QUANTITY<br />
If you publish printed copies (or copies in media that commonly have printed covers) of the Document, numbering more than 100, and the Document's license notice requires Cover Texts, you must enclose the copies in covers that<br />
carry, clearly and legibly, all these Cover Texts: Front-Cover Texts on the front cover, and Back-Cover Texts on the back cover. Both covers must also clearly and legibly identify you as the publisher of these copies. The front cover<br />
must present the full title with all words of the title equally prominent and visible. You may add other material on the covers in addition. Copying with changes limited to the covers, as long as they preserve the title of the Document<br />
and satisfy these conditions, can be treated as verbatim copying in other respects.<br />
If the required texts for either cover are too voluminous to fit legibly, you should put the first ones listed (as many as fit reasonably) on the actual cover, and continue the rest onto adjacent pages.<br />
If you publish or distribute Opaque copies of the Document numbering more than 100, you must either include a machine-readable Transparent copy along with each Opaque copy, or state in or with each Opaque copy a<br />
computer-network location from which the general network-using public has access to download using public-standard network protocols a complete Transparent copy of the Document, free of added material. If you use the latter<br />
option, you must take reasonably prudent steps, when you begin distribution of Opaque copies in quantity, to ensure that this Transparent copy will remain thus accessible at the stated location until at least one year after the last time<br />
you distribute an Opaque copy (directly or through your agents or retailers) of that edition to the public.<br />
It is requested, but not required, that you contact the authors of the Document well before redistributing any large number of copies, to give them a chance to provide you with an updated version of the Document.<br />
4. MODIFICATIONS<br />
You may copy and distribute a Modified Version of the Document <strong>und</strong>er the conditions of sections 2 and 3 above, provided that you release the Modified Version <strong>und</strong>er precisely this License, with the Modified Version filling the role<br />
of the Document, thus licensing distribution and modification of the Modified Version to whoever possesses a copy of it. In addition, you must do these things in the Modified Version:<br />
• A. Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title distinct from that of the Document, and from those of previous versions (which should, if there were any, be listed in the History section of the Document). You may use<br />
the same title as a previous version if the original publisher of that version gives permission.<br />
• B. List on the Title Page, as authors, one or more persons or entities responsible for authorship of the modifications in the Modified Version, together with at least five of the principal authors of the Document (all of its principal<br />
authors, if it has fewer than five), unless they release you from this requirement.<br />
• C. State on the Title page the name of the publisher of the Modified Version, as the publisher.<br />
• D. Preserve all the copyright notices of the Document.<br />
• E. Add an appropriate copyright notice for your modifications adjacent to the other copyright notices.<br />
• F. Include, immediately after the copyright notices, a license notice giving the public permission to use the Modified Version <strong>und</strong>er the terms of this License, in the form shown in the Addendum below.<br />
• G. Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections and required Cover Texts given in the Document's license notice.<br />
• H. Include an unaltered copy of this License.<br />
• I. Preserve the section Entitled "History", Preserve its Title, and add to it an item stating at least the title, year, new authors, and publisher of the Modified Version as given on the Title Page. If there is no section Entitled<br />
"History" in the Document, create one stating the title, year, authors, and publisher of the Document as given on its Title Page, then add an item describing the Modified Version as stated in the previous sentence.<br />
• J. Preserve the network location, if any, given in the Document for public access to a Transparent copy of the Document, and likewise the network locations given in the Document for previous versions it was based on. These<br />
may be placed in the "History" section. You may omit a network location for a work that was published at least four years before the Document itself, or if the original publisher of the version it refers to gives permission.<br />
• K. For any section Entitled "Acknowledgements" or "Dedications", Preserve the Title of the section, and preserve in the section all the substance and tone of each of the contributor acknowledgements and/or dedications given<br />
therein.
Lizenz 6<br />
• L. Preserve all the Invariant Sections of the Document, unaltered in their text and in their titles. Section numbers or the equivalent are not considered part of the section titles.<br />
• M. Delete any section Entitled "Endorsements". Such a section may not be included in the Modified Version.<br />
• N. Do not retitle any existing section to be Entitled "Endorsements" or to conflict in title with any Invariant Section.<br />
• O. Preserve any Warranty Disclaimers.<br />
If the Modified Version includes new front-matter sections or appendices that qualify as Secondary Sections and contain no material copied from the Document, you may at your option designate some or all of these sections as<br />
invariant. To do this, add their titles to the list of Invariant Sections in the Modified Version's license notice. These titles must be distinct from any other section titles.<br />
You may add a section Entitled "Endorsements", provided it contains nothing but endorsements of your Modified Version by various parties--for example, statements of peer review or that the text has been approved by an organization<br />
as the authoritative definition of a standard.<br />
You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text, and a passage of up to 25 words as a Back-Cover Text, to the end of the list of Cover Texts in the Modified Version. Only one passage of Front-Cover Text and one of<br />
Back-Cover Text may be added by (or through arrangements made by) any one entity. If the Document already includes a cover text for the same cover, previously added by you or by arrangement made by the same entity you are<br />
acting on behalf of, you may not add another; but you may replace the old one, on explicit permission from the previous publisher that added the old one.<br />
The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this License give permission to use their names for publicity for or to assert or imply endorsement of any Modified Version.<br />
5. COMBINING DOCUMENTS<br />
You may combine the Document with other documents released <strong>und</strong>er this License, <strong>und</strong>er the terms defined in section 4 above for modified versions, provided that you include in the combination all of the Invariant Sections of all of<br />
the original documents, unmodified, and list them all as Invariant Sections of your combined work in its license notice, and that you preserve all their Warranty Disclaimers.<br />
The combined work need only contain one copy of this License, and multiple identical Invariant Sections may be replaced with a single copy. If there are multiple Invariant Sections with the same name but different contents, make the<br />
title of each such section unique by adding at the end of it, in parentheses, the name of the original author or publisher of that section if known, or else a unique number. Make the same adjustment to the section titles in the list of<br />
Invariant Sections in the license notice of the combined work.<br />
In the combination, you must combine any sections Entitled "History" in the various original documents, forming one section Entitled "History"; likewise combine any sections Entitled "Acknowledgements", and any sections Entitled<br />
"Dedications". You must delete all sections Entitled "Endorsements".<br />
6. COLLECTIONS OF DOCUMENTS<br />
You may make a collection consisting of the Document and other documents released <strong>und</strong>er this License, and replace the individual copies of this License in the various documents with a single copy that is included in the collection,<br />
provided that you follow the rules of this License for verbatim copying of each of the documents in all other respects.<br />
You may extract a single document from such a collection, and distribute it individually <strong>und</strong>er this License, provided you insert a copy of this License into the extracted document, and follow this License in all other respects regarding<br />
verbatim copying of that document.<br />
7. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS<br />
A compilation of the Document or its derivatives with other separate and independent documents or works, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an "aggregate" if the copyright resulting from the compilation<br />
is not used to limit the legal rights of the compilation's users beyond what the individual works permit. When the Document is included in an aggregate, this License does not apply to the other works in the aggregate which are not<br />
themselves derivative works of the Document.<br />
If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these copies of the Document, then if the Document is less than one half of the entire aggregate, the Document's Cover Texts may be placed on covers that bracket the<br />
Document within the aggregate, or the electronic equivalent of covers if the Document is in electronic form. Otherwise they must appear on printed covers that bracket the whole aggregate.<br />
8. TRANSLATION<br />
Translation is considered a kind of modification, so you may distribute translations of the Document <strong>und</strong>er the terms of section 4. Replacing Invariant Sections with translations requires special permission from their copyright holders,<br />
but you may include translations of some or all Invariant Sections in addition to the original versions of these Invariant Sections. You may include a translation of this License, and all the license notices in the Document, and any<br />
Warranty Disclaimers, provided that you also include the original English version of this License and the original versions of those notices and disclaimers. In case of a disagreement between the translation and the original version of<br />
this License or a notice or disclaimer, the original version will prevail.<br />
If a section in the Document is Entitled "Acknowledgements", "Dedications", or "History", the requirement (section 4) to Preserve its Title (section 1) will typically require changing the actual title.<br />
9. TERMINATION<br />
You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document except as expressly provided for <strong>und</strong>er this License. Any other attempt to copy, modify, sublicense or distribute the Document is void, and will automatically terminate<br />
your rights <strong>und</strong>er this License. However, parties who have received copies, or rights, from you <strong>und</strong>er this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.<br />
10. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE<br />
The Free Software Fo<strong>und</strong>ation may publish new, revised versions of the GNU Free Documentation License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new<br />
problems or concerns. See http:/ / www. gnu. org/ copyleft/ .<br />
Each version of the License is given a distinguishing version number. If the Document specifies that a particular numbered version of this License "or any later version" applies to it, you have the option of following the terms and<br />
conditions either of that specified version or of any later version that has been published (not as a draft) by the Free Software Fo<strong>und</strong>ation. If the Document does not specify a version number of this License, you may choose any version<br />
ever published (not as a draft) by the Free Software Fo<strong>und</strong>ation.<br />
ADDENDUM: How to use this License for your documents<br />
To use this License in a document you have written, include a copy of the License in the document and put the following copyright and license notices just after the title page:<br />
Copyright (c) YEAR YOUR NAME.<br />
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document<br />
<strong>und</strong>er the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2<br />
or any later version published by the Free Software Fo<strong>und</strong>ation;<br />
with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts.<br />
A copy of the license is included in the section entitled<br />
"GNU Free Documentation License".<br />
If you have Invariant Sections, Front-Cover Texts and Back-Cover Texts, replace the "with...Texts." line with this:<br />
with the Invariant Sections being LIST THEIR TITLES, with the<br />
Front-Cover Texts being LIST, and with the Back-Cover Texts being LIST.<br />
If you have Invariant Sections without Cover Texts, or some other combination of the three, merge those two alternatives to suit the situation.<br />
If your document contains nontrivial examples of program code, we recommend releasing these examples in parallel <strong>und</strong>er your choice of free software license, such as the GNU General Public License, to permit their use in free<br />
software.