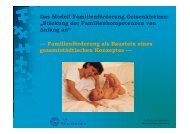Starke Kinder begleiten - fördern - schützen - Isa
Starke Kinder begleiten - fördern - schützen - Isa
Starke Kinder begleiten - fördern - schützen - Isa
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong> <strong>begleiten</strong> - <strong>fördern</strong> - stützen<br />
<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong><br />
<strong>begleiten</strong> – <strong>fördern</strong> -‐ <strong>schützen</strong><br />
Tagungsdokumentation<br />
Präven'onskonferenz Münster<br />
Donnerstag, den 22. März 2012
<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong> <strong>begleiten</strong> - <strong>fördern</strong> - <strong>schützen</strong><br />
2<br />
<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong><br />
<strong>begleiten</strong> – <strong>fördern</strong> -‐ <strong>schützen</strong><br />
Tagungsdokumentation<br />
Die Präventionskonferenz wurde durchgeführt und organisiert von:<br />
Stadt Münster Institut für soziale Arbeit e.V.<br />
Hafenstr. 30<br />
48153 Münster<br />
T. 02 51.492 51 01<br />
F. 02 51.492 77 30<br />
jugendamt@stadt-muenster.de<br />
www.muenster.de/stadt/jugendamt/<br />
Studtstraße 20<br />
48149 Münster<br />
T. 0251.92536-0<br />
F. 0251.92536-80<br />
info@isa-muenster.de<br />
www.isa-muenster.de<br />
Redaktion: Nina Andernach, Stefan Eberitzsch und Birgit F. Herdes
<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong> <strong>begleiten</strong> - <strong>fördern</strong> - <strong>schützen</strong><br />
Inhaltsverzeichnis:<br />
Programm 5<br />
Begrüßung durch den Oberbürgermeister Markus Lewe 7<br />
Klaus Hurrelmann<br />
Die Bedeutung der frühen Jahre 11<br />
Holger Ziegler<br />
Offensiver und Defensiver <strong>Kinder</strong>schutz - die Präventionsagenda aus<br />
wissenschaftlicher Sicht 13<br />
Reinhold Schone<br />
Bundeskinderschutzgesetz - neues Gesetz - neue Herausforderungen?! 19<br />
Die Fachforen 29<br />
Forum 1:<br />
Frühe Hilfen als Prävention gegen <strong>Kinder</strong>armut?! 31<br />
Forum 2:<br />
Einblicke in das Forschungsprojekt zu Elternbesuchsdiensten des ISA e.V. 47<br />
Forum 3:<br />
Schutzauftrag Bundeskinderschutzgesetz - Herausforderungen für die<br />
Zusammenarbeit der Fachkräfte aus Jugendhilfe und Gesundheitswesen 59<br />
Forum 4:<br />
Gelingende Vernetzung im Sozialraum gemeinsam entwickeln 71<br />
Das Auswertungsplenum 81<br />
Feedbackgruppen 83<br />
Rückmeldungen aus den Fachforen 86<br />
Die Pressenmitteilungen 89<br />
3
<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong> <strong>begleiten</strong> - <strong>fördern</strong> - <strong>schützen</strong><br />
4<br />
Impulsfilm: „Zwei Geschichten“<br />
„...es sei denn<br />
ihr habt mich nicht zurückgelassen<br />
ihr habt mich bei meinen Problemen immer unterstützt<br />
schon ganz früh<br />
bevor es zu spät wurde<br />
also gestern<br />
nicht morgen...“
<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong> <strong>begleiten</strong> - <strong>fördern</strong> - <strong>schützen</strong><br />
Programm<br />
Programm<br />
9.45 �Die Bedeutung der frühen Jahre�<br />
Prof. Dr. Klaus Hurrelmann, Her=e School of Governance<br />
10.45 -‐ Pause -‐<br />
11.15 „Offensiver und Defensiver <strong>Kinder</strong>schutz – die Präven=onsagenda aus<br />
wissenschaLlicher Sicht�<br />
Prof. Dr. Holger Ziegler, Uni Bielefeld<br />
12.15 -‐ MiQagspause -‐<br />
13.15 „Bundeskinderschutzgesetz: Neues Gesetz – neue Herausforderung?!�<br />
Prof. Dr. Reinhold Schone, FH Münster<br />
13.45 FACHFOREN<br />
14.45 -‐ Pause -‐<br />
15.00 AUSWERTUNGSPLENUM<br />
Eindrücke und Ergebnisse des Tages<br />
16.00 Ende der Veranstaltung<br />
5
<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong> <strong>begleiten</strong> - <strong>fördern</strong> - <strong>schützen</strong><br />
6<br />
Klaus Bellmund<br />
Tagungsmoderation
<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong> <strong>begleiten</strong> - <strong>fördern</strong> - <strong>schützen</strong><br />
Markus Lewe<br />
Oberbürgermeister der Stadt Münster<br />
Begrüßung anlässlich der Eröffnung der Präventionskonferenz<br />
„<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong>: <strong>begleiten</strong> – <strong>fördern</strong> – <strong>schützen</strong>“<br />
Sehr geehrte Damen und Herren,<br />
Begrüßung durch Oberbürgermeister M. Lewe<br />
ich freue mich sehr, Sie zur ersten Präventionskonferenz in Münster unter dem Titel „<strong>Starke</strong><br />
<strong>Kinder</strong>“ begrüßen zu dürfen und danke Ihnen, dass Sie meiner Einladung so zahlreich<br />
gefolgt sind.<br />
Im Mittelpunkt der heutigen Präventionskonferenz stehen die <strong>Kinder</strong> in unserer Stadt.<br />
Dazu kommt unsere gemeinsame Aufgabe, Familien mit ihren <strong>Kinder</strong>n in unterschiedlichen<br />
Lebenslagen so früh wie möglich zu erreichen und zu stärken. Nur so kann allen <strong>Kinder</strong>n<br />
eine Kindheit ermöglicht werden, die sie zu eben den „<strong>Starke</strong>n <strong>Kinder</strong>n“ macht. Dies ist unsere<br />
gemeinsame Aufgabe und Verantwortung. Als Stadt, als Politik und als Gesellschaft.<br />
An dieser Stelle gilt mein Dank daher besonders Frau Pohl und ihren Mitarbeiterinnen,<br />
die diese Präventionskonferenz mit viel Engagement und Herzblut in Kooperation mit dem<br />
Institut für Soziale Arbeit vorbereitet haben.<br />
Meine Damen und Herren, allen <strong>Kinder</strong>n in dieser Stadt einen guten Start ins Leben zu<br />
ermöglichen und sie in ihrer ganzheitlichen Entwicklung zu unterstützen, liegt mir mit der<br />
heutigen Veranstaltung besonders am Herzen. Wir können es uns nicht leisten, dass auch<br />
nur ein Kind verloren geht!<br />
Familie ist kein statisches Gebilde. Familien leben in verschiedenen Strukturen, Milieus<br />
und unterschiedlichen Lebensentwürfen. Sie sind unterschiedlich stark von strukturell bedingten,<br />
sozioökonomischen Belastungen betroffen. Die Folge ist, dass viele <strong>Kinder</strong> aufgrund<br />
ihres Umfeldes ungünstigere Startbedingungen als Gleichaltrige in privilegierteren<br />
Verhältnissen haben.<br />
7
<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong> <strong>begleiten</strong> - <strong>fördern</strong> - <strong>schützen</strong><br />
8<br />
Die Probleme sind dabei vielschichtig. Ein Aufwachsen in benachteiligten Lebensverhältnissen<br />
weist sich nicht allein an der Größe des Geldbeutels aus. Es zeigt sich darüber hinaus<br />
anhand zentraler Lebensbereiche der Eltern wie der Wohnsituation, Gesundheit, Bildung,<br />
sozialer und kultureller Integration.<br />
Gemeinsam müssen wir uns also fragen, welche Faktoren wirklich einen langfristigen Einfluss<br />
auf die Entwicklung unserer <strong>Kinder</strong> haben, wie Ungleichheiten ausgeglichen werden<br />
können und wie wir Familien mit <strong>Kinder</strong>n so früh wie möglich unterstützen können. Ich bin<br />
fest davon überzeugt, dass es ganz entscheidend von den lokalen Rahmenbedingungen<br />
abhängt, wie die Chancen und der Lebensalltag von Familien und ihren <strong>Kinder</strong>n verbessert<br />
werden können. Dies gilt grundsätzlich für alle Familien. Und hier können wir mit unserer<br />
Unterstützung ansetzen:<br />
Es geht also ganz konkret um die Förderung von <strong>Kinder</strong>n. Und zwar zu einem frühest möglichen<br />
Zeitpunkt. Gerade in den ersten Lebensjahren werden nun mal wesentliche Weichenstellungen<br />
für die Persönlichkeitsentwicklung gestellt. Das bedeutet, dass frühe Hilfen bereits<br />
mit Beginn der Schwangerschaft – also bei minus 9 Monaten – ansetzen sollten.<br />
Die ersten, unmittelbarsten Zugänge zu (werdenden) Eltern haben Gynäkologen, Geburtskliniken,<br />
Hebammen, <strong>Kinder</strong>ärzte und <strong>Kinder</strong>kliniken. Das ist bereits ein schwer wiegendes<br />
Pfund. Gerade die Angebote unseres Gesundheitssystems, der Familienbildung und<br />
der Schwangerenberatung erfreuen sich durchweg eines hohen Vertrauens der Eltern und<br />
werden quer durch die sozialen Schichten gut angenommen. Diese frühen Kontakte zu den<br />
Eltern und deren Akzeptanz für niedrigschwellige Bildungs- und Freizeitangebote können<br />
hier als Türöffner dienen, um für weitere<br />
Angebote der Jugend- und Gesundheitshilfe zu werben und somit die Eltern für weitere Hilfen<br />
zu gewinnen ohne sie zu überfordern oder zu verunsichern.<br />
Es liegt also auf der Hand, dass unser aller – vernetztes - Engagement gefordert ist. Und<br />
klar ist auch, dass es eine Herausforderung für die Fachpraxis vor Ort und deren Akteure<br />
darstellt. Von nichts kommt nichts!<br />
Frühe Hilfen und Prävention verlangen die Zusammenarbeit von Gesundheits-, <strong>Kinder</strong>- und<br />
Jugendhilfe- und Bildungssystemen. Denn die anspruchsvolle Aufgabe „<strong>Kinder</strong> stark zu machen“<br />
kann nur gemeinsam gelingen. Prof. Dr. Klaus Hurrelmann wird das gleich in seinem<br />
Referat sicherlich noch ausführen, wenn er davon spricht, dass es „ein ganzes Dorf bedarf<br />
um ein Kind zu erziehen“.<br />
Meine Damen und Herren, in den vergangenen Jahren hat es auf Landes- und Bundesebene<br />
zahlreiche Impulse gegeben; Gesetzesänderungen und wichtige Maßnahmen wurden auf<br />
den Weg gebracht. Beispielhaft sind folgende Bemühungen zu nennen:<br />
• die Einführung der positiven Meldepflicht der <strong>Kinder</strong>- und Jugendärzte bei den Früher-<br />
kennungsuntersuchungen,<br />
• der U3 Ausbau (mit einer aktuellen Versorgungsquote von 31.3%) mit einer besseren<br />
frühkindlichen Förderung,
<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong> <strong>begleiten</strong> - <strong>fördern</strong> - <strong>schützen</strong><br />
Begrüßung durch Oberbürgermeister M. Lewe<br />
• die Weiterentwicklung der <strong>Kinder</strong>tageseinrichtungen in Nordrhein-Westfalen zu Fa-<br />
milienzentren (Münster hat aktuell 24; lt. Familienministerin Ute Schäfer sollen die<br />
Familienzentren in NRW im nächsten <strong>Kinder</strong>gartenjahr um zusätzliche 150 Einrich-<br />
tungen weiter ausgebaut werden),<br />
• das neue Bundeskinderschutzgesetz, welches am 1. Januar 2012 in Kraft getreten<br />
ist und mit der Säule „Prävention“ darauf abzielt , alle Akteure zu stärken, die sich<br />
für das Wohlergehen von <strong>Kinder</strong>n engagieren und diese in einem Kooperationsnetz-<br />
werk zusammenzuführen.<br />
Darüber hinaus aber kommt gerade den lokalen Handlungsspielräumen beim Thema Prävention<br />
und der Ausgestaltung von Ressourcen und Schwerpunkten eine zentrale Rolle zu.<br />
Wie sich die Lebensbedingungen von Familien darstellen entscheidet sich vor Ort.<br />
Münster ist aktuell und in den vergangenen Jahren mit spezifischen Strategien und Handlungskonzepten<br />
neue Wege gegangen, um präventive Angebote für <strong>Kinder</strong> und Eltern vor<br />
Ort weiter zu entwickeln und auszubauen. Zu nennen sind hier insbesondere:<br />
• die Familienbesuche nach der Geburt eines Kindes,<br />
• das Maßnahmenprogramm einer kindbezogenen Armutsprävention,<br />
• die Stadtteilkoordinatoren in vier benachteiligten Stadtteilen mit der Aufgabe, ein<br />
speziell auf den Sozialraum abgestimmtes Präventionskonzept zu entwickeln,<br />
• die Hebammensprechstunden in den Familienzentren,<br />
• die Beteiligung beim kommunalen Partnerprozess „Gesund aufwachsen für alle“<br />
• Gesundheitsförderung bei sozial benachteiligte <strong>Kinder</strong>n und Jugendlichen (seit Nov.<br />
2011),<br />
• und das Modellvorhaben „kommunale Präventionsketten“.<br />
Vieles wurde bereits erreicht, neue Impulse und münster-spezifische Strategien wurden<br />
verfolgt und umgesetzt.<br />
An dieser Stelle möchte ich Ihnen allen meine Anerkennung und meinen Respekt für Ihre<br />
anspruchsvolle Tätigkeit, die Sie täglich leisten, aussprechen. Der unverzichtbare Einsatz<br />
der Jugendhilfe und des Gesundheitswesens für „unsere Kleinen“ kann nicht genug gewürdigt<br />
werden.<br />
Frühe Hilfen sind und bleiben eine sinnvoll angelegte Zukunftsinvestition für unsere <strong>Kinder</strong><br />
und für die Gesellschaft insgesamt.<br />
Ich bin der Überzeugung, dass wir gemeinsam das Unterstützungssystem noch wirksamer<br />
gestalten können. Ich sehe die Notwendigkeit, dass sich Verwaltung, Politik, die Verantwortlichen<br />
in Institutionen, Wohlfahrtsverbänden und Kirchen auf lokaler Ebene intensiv mit<br />
den Anforderungen an frühe und wirkungsvolle Unterstützungsleistungen befassen, damit<br />
– auch angesichts der demografischen Entwicklung – kein Kind verloren geht.<br />
<strong>Kinder</strong> sind unsere Zukunft; welchen Weg sie einschlagen, hängt entscheidend von den<br />
Chancen ab, die wir <strong>Kinder</strong>n vor Ort geben, damit sie gesund aufwachsen können und<br />
9
<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong> <strong>begleiten</strong> - <strong>fördern</strong> - <strong>schützen</strong><br />
erfolgreich lernen.<br />
Es gilt dauerhafte Verantwortungsgemeinschaften im Sinne einer umfassenden Familienbegleitung<br />
und Erziehungspartnerschaft zu bilden bzw. zu festigen. Nur in einer gelebten<br />
Verantwortungsgemeinschaft können wir Familien und ihre <strong>Kinder</strong> von Anfang an umfassend<br />
unterstützen.<br />
Setzen wir uns also gemeinsam für ein gesundes Aufwachsen, mehr Bildungschancen, mehr<br />
Teilhabe und mehr Förderung von „Klein auf an“ ein.<br />
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen wertvolle Informationen und eine anregende Konferenz.<br />
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!<br />
10
<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong> <strong>begleiten</strong> - <strong>fördern</strong> - <strong>schützen</strong><br />
Klaus Hurrelmann<br />
Professor an der Hertie School of Governance Berlin<br />
Die Bedeutung der frühen Jahre<br />
K. Hurrelmann - Die Bedeutung der frühen Jahre<br />
Die World Vision <strong>Kinder</strong>studien machen anschaulich deutlich, wie gut es der Mehrheit der<br />
<strong>Kinder</strong> in Deutschland geht, wie problematisch aber auch die Lebenslage von etwa einem<br />
Viertel der unter 12-Jährigen in Deutschland ist. Durch direkte Befragung von <strong>Kinder</strong>n (6-<br />
bis 11-Jährigen), ergänzt durch die Shell Jugendstudien (12- bis 25-Jährige), wissen wir<br />
Genaues über die Lebenssituation der jungen Generation und ihre persönliche Einschätzung<br />
und Bewertung. Zu Beginn des Vortrags werden die wichtigsten Ergebnisse vorgestellt.<br />
Im zweiten Teil geht es um die Determinanten der Lebenssituation der <strong>Kinder</strong> und Jugendlichen.<br />
Sie wird vor allem durch die wirtschaftliche, soziale und kulturelle Lage ihres<br />
Elternhauses bestimmt. Verfügen Mutter und Vater über ein gutes finanzielles Einkommen,<br />
haben sie einen guten Schulabschluss und aussichtsreichen Zugang zum Arbeitsmarkt,<br />
sind sie auch nachbarschaftlich und kulturell anerkannt und integriert, dann ist auch die Lebenssituation<br />
der <strong>Kinder</strong> gut, die in ihrem Haushalt leben. In der World Vision <strong>Kinder</strong>studie<br />
von 2007 geben 13 % der Eltern, die unabhängig von ihren <strong>Kinder</strong>n von den Interviewerinnen<br />
und Interviewern befragt wurden, eine unbefriedigende wirtschaftliche Situation ihres<br />
Haushaltes an. Damit deckt sich die subjektive Einschätzung der Eltern weitgehend mit<br />
den objektiven Zahlen des Armuts- und Reichtumsberichtes. Die World Vision Studie zeigt,<br />
dass zu diesen 13 % von Eltern, die ihre Situation subjektiv als wirtschaftlich außerordentlich<br />
schwierig einschätzen, noch einmal etwa 12 % hinzukommen, die im Vergleich zu den<br />
anderen Eltern in einer sehr ungünstigen wirtschaftlichen, bildungsmäßigen und kulturellen<br />
Lebenssituation stehen.<br />
11
<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong> <strong>begleiten</strong> - <strong>fördern</strong> - <strong>schützen</strong><br />
12<br />
Auf dieser Analyse aufbauend wird im letzten Teil des Vortrags die Frage aufgeworfen, was<br />
zu tun ist, um dieser unbefriedigenden Ausgangslage auf allen politischen Ebenen entgegenzusteuern.<br />
Dabei werden fünf Punkte angesprochen:<br />
1. Die Abhängigkeit der kindlichen Entwicklung von familiären Umfeld und unterstützenden<br />
Netzwerken.<br />
2. Die Stärken und die Schwächen der deutschen Tradition der Familien- und Wohlfahrtspolitik<br />
mit dem Subsidiaritätsprinzip als Ausgangspunkt.<br />
3. Die strukturellen Gründe der Fehlsteuerung der Förderpolitik für <strong>Kinder</strong> in<br />
Deutschland.<br />
4. Der Reformbedarf bei zielgenauen aufsuchenden Förderstrategien.<br />
5. Der Reformbedarf bei zielgenauen finanziellen Förderstrategien.
<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong> <strong>begleiten</strong> - <strong>fördern</strong> - <strong>schützen</strong><br />
Holger Ziegler<br />
Professor an der Universität Bielefeld<br />
H. Ziegler - Offensiver und defensiver <strong>Kinder</strong>schutz<br />
Ausgehend von einer Diskussion über die Implikationen des Präventionsbegriffs, argumentiert<br />
der Beitrag von Holger Ziegler, dass in der Sozialen Arbeit eine sozial-professionelle<br />
Perspektive auf den Präventionsbegriff, die das Moment der ermächtigenden Gestaltung<br />
sozialer und lebensweltlicher Verhältnisse der AdresstInnen betont hat, durch eine Präventionsphilosophie<br />
ersetzt worden ist, die die effektive Bearbeitung von Risiken betont.<br />
Damit verbunden sind „defensive“ Formen des <strong>Kinder</strong>schutzes, deren Ziel darin besteht<br />
Gefahren (bzw. ,worst case‘ Szenarien) zu verhindern. Ausgehend von der grundlegenden<br />
Einsicht, dass die Ermöglichung gelingender Aufwachsens- und Entwicklungsprozesse<br />
sich theoretisch wie empirisch nicht in der Sicherstellung der bloßen Abwesenheit massivster<br />
Formen des Leidens erschöpfen kann, wird stattdessen für einen „offensiven <strong>Kinder</strong>schutz“<br />
plädiert, der den Begriff des Kindeswohls in einer fachlichen Weise ernst nimmt.<br />
Dies erfordert eine Bestimmung dessen, was das zu gewährleistende Gut, das Wohlergehen<br />
von jungen Menschen, eigentlich ausmacht. Zur Bestimmung dieses Guts wird zunächst<br />
die subjektive Perspektive auf Wohlergehen vorgestellt und mit dem Argument verworfen,<br />
dass die Zielgröße „subjektive Zufriedenheit“ nicht in der Lage ist, der empirischen<br />
Tatsache gerecht zu werden, dass Menschen ihre Hoffnungen, Wünsche und Aspirationen<br />
an ihre realen Bedingungen anpassen. Der Fokus auf subjektive Zufriedenheit birgt die<br />
notorische Gefahr in sich, massive Ungerechtigkeiten zu übersehen, zu legitimieren und zu<br />
reproduzieren. Stattdessen wird ein Begriff von Wohlergehen als Fundament einer „offensiven<br />
<strong>Kinder</strong>schutzes“ verteidigt, in dessen Mittelpunkt die Erweiterung objektiver Teilhabe-,<br />
Verwirklichungs- und Entfaltungsmöglichkeiten von jungen Menschen und deren Familien<br />
steht. Dabei geht es zugleich um eine Begründung einer emanzipatorischen Sozialen<br />
Arbeit, die sich nicht auf Fragen ihrer technologischen Effizienz reduzieren lässt, sondern<br />
sich gegen ihre „Verzwergung“ und „Selbstverzwergung“ verteidigt und nach Kriterien von<br />
Angemessenheit und demokratischen Effektivität zu bemessen ist.<br />
13
<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong> <strong>begleiten</strong> - <strong>fördern</strong> - <strong>schützen</strong><br />
14<br />
1<br />
2<br />
!"#$%&'&()*+(,+-./0$1234.33/1350"6(78(9:(;
<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong> <strong>begleiten</strong> - <strong>fördern</strong> - <strong>schützen</strong><br />
3<br />
4<br />
!"#$%&'&()*+(,+-./0$1234.33/1350"6(78(9:(;
<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong> <strong>begleiten</strong> - <strong>fördern</strong> - <strong>schützen</strong><br />
16<br />
5<br />
6<br />
!"#$%&'&()*+(,+-./0$1234.33/1350"6(78(9:(;
<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong> <strong>begleiten</strong> - <strong>fördern</strong> - <strong>schützen</strong> H. Ziegler - Offensiver und defensiver <strong>Kinder</strong>schutz<br />
7<br />
!"#$%&'&()*+(,+-./0$1234.33/1350"6(78(9:(;
<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong> <strong>begleiten</strong> - <strong>fördern</strong> - <strong>schützen</strong><br />
18
<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong> <strong>begleiten</strong> - <strong>fördern</strong> - <strong>schützen</strong><br />
Reinhold Schone<br />
Professor an der Fachhochschule Münster<br />
Bundeskinderschutzgesetz<br />
neues Gesetz – neue Herausforderungen<br />
R. Schone - Bundeskinderschutzgesetz<br />
Der Beitrag nimmt die Regelungen des Bundeskinderschutzgesetzes unter fachlichen<br />
Gesichtspunkten in den Blick. Dabei wird dem Vortrag die Feststellung vorangestellt, dass<br />
die unterschiedlichen Handlungsbereiche der „Frühen Hilfen“ einerseits und des „Schutzauftrages<br />
bei Kindeswohlgefährdung“ andererseits in dem Gesetz diffus miteinander verwoben<br />
werden. Das mündet in der Ausgangsthese, dass das Bundeskinderschutzgesetz<br />
– allein durch seine Bezeichnung – zur ohnehin in der breiten (Fach-)Diskussion stattfindenden<br />
Erosion des Begriffs „<strong>Kinder</strong>schutz“ zusätzlich beiträgt.<br />
Die zentralen Herausforderungen werden auf den Ebenen der Fachkräfte, der Träger und<br />
Organisationen, der Infrastruktur und der Politik beschrieben. Auf all diesen Ebenen wirft<br />
das Gesetz durch seine Regelungen mehr Fragen auf, als dass es Orientierungen und klare<br />
Entwicklungslinien beschreibt. Besonders betonenswert ist, dass sich die allermeisten<br />
Regelungen mit der Aufgabenwahrnehmung des Jugendamtes und der Gestaltung seiner<br />
Kooperationsbezüge beschäftigen. Eine besondere „Herausforderung“ ist dabei z.B. die<br />
Schaffung „verbindlicher“ Netzwerkstrukturen im <strong>Kinder</strong>schutz unter gleichzeitiger Betonung<br />
– in der Gesetzesbegründung: „Eine Verpflichtung für die genannten Institutionen zur<br />
Kooperation und Beteiligung am Netzwerk ergibt sich aus der Vorschrift nicht.“ (Drucksache<br />
17/6256, S. 18) Die Erweiterung des Leistungsspektrums gegenüber Familien fällt mit<br />
der Schaffung von Informationssystemen, der Möglichkeit, Beratung auch schon während<br />
der Schwangerschaft zu erhalten, und der Möglichkeit, dass Familien bei Bedarf eine Familienhebamme<br />
in Anspruch nehmen können, ausgesprochen bescheiden aus.<br />
19
<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong> <strong>begleiten</strong> - <strong>fördern</strong> - <strong>schützen</strong><br />
20<br />
Das alles führt zu der Schlussfolgerung, dass<br />
• der fachlich differenzierte Umgang mit der Chiffre „<strong>Kinder</strong>schutz und eine klare<br />
Benennung dessen, was jeweils gemeint ist (Frühe Hilfen oder Gefährdungsabwehr),<br />
eine zentrale Voraussetzung für perspektivische Weiterentwicklungen in der<br />
<strong>Kinder</strong>- und Jugendhilfe sind;<br />
• eine innovative und zukunftsgerichtete Gestaltung der <strong>Kinder</strong>- und Jugendhilfe heute<br />
mehr denn je auf eine starke Jugendhilfeplanung angewiesen ist;<br />
• die größte Herausforderung des Gesetzes darin besteht, den in dem Gesetz angelegten<br />
Tendenzen zur Formalisierung und Bürokratisierung zu widerstehen.<br />
Gute Jugendhilfe – so die Abschlussthese – erfordert vor allem von der Praxis, dass hier<br />
inhaltlich fachliche Konzepte stetig kreativ auf das Ziel hin weiterentwickelt.<br />
Bundeskinderschutzgesetz<br />
Neues Gesetz – neue Herausforderungen?!<br />
Ziele des Gesetzes (laut Gesetzentwurf):<br />
• Einrichtung von Netzwerken im <strong>Kinder</strong>schutz auf örtlicher Ebene<br />
• Ausbau von Hilfen zur Stärkung elterlicher Erziehungskompetenz<br />
(frühe Hilfen) u.a. durch den Einsatz von Familienhebammen<br />
• Qualifizierung des Schutzauftrages des Jugendamtes bei<br />
Kindeswohlgefährdung<br />
• Verbesserung der Zusammenarbeit der Jugendämter bei Umzug von<br />
Familien<br />
• Befugnisnorm für Berufsgeheimnisträger<br />
• Verpflichtung der öffentlichen Jugendhilfeträger zur Qualitätsentwicklung<br />
sowie zum Abschluss entsprechender Vereinbarungen<br />
mit der freien Jugendhilfe als Grundlage für die Finanzierung<br />
• Erweitertes Führungszeugnis für alle in der Jugendhilfe<br />
beschäftigten Personen Erweiterung auch auf ehrenamtliche<br />
Personen durch (Vereinbarungen)<br />
© Prof. Dr. Reinhold Schone
<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong> <strong>begleiten</strong> - <strong>fördern</strong> - <strong>schützen</strong><br />
Bundeskinderschutzgesetz<br />
Neues Gesetz – neue Herausforderungen?!<br />
© Prof. Dr. Reinhold Schone<br />
Handlungsauslöser <br />
Handlungszeitpunkt<br />
Übersicht<br />
1. <strong>Kinder</strong>schutz – Von was reden wir?<br />
2. Herausforderungen<br />
1. auf der fachlichen Ebene<br />
2. auf der Ebene der Träger<br />
3. auf der Ebene der Infrastruktur<br />
4. auf der Ebene der Politik<br />
3. Fazit<br />
Fachlicher<br />
Ansatzpunkt<br />
Handlungsprinzipien<br />
© Prof. Dr. Reinhold Schone<br />
Auftrag zur Gewährleistung<br />
von Frühen Hilfen<br />
!Erste Signale<br />
!schwache Hinweise auf<br />
misslingende Erziehungsprozesse<br />
! Vor oder bei der Entstehung<br />
von Problemen<br />
! Als Einstieg in Hilfeprozesse<br />
! Gewährleistung einer<br />
niedrigschwelligen Hilfe-<br />
Infrastruktur<br />
! Angebot von alltagsorientierten<br />
Hilfen<br />
! Vertrauen als<br />
Handlungsgrundlage<br />
! Freiwilligkeit als Grundprinzip<br />
R. Schone - Bundeskinderschutzgesetz<br />
Zur Notwendigkeit einer fachlichen und begrifflich<br />
Differenzierung in der <strong>Kinder</strong>schutzdebatte<br />
Schutzauftrag bei<br />
Kindeswohlgefährdung<br />
!„gewichtige Anhaltspunkte� (§ 8a<br />
SGFB VIII) für eine<br />
Kindeswohlgefährdung<br />
! Bei Überschreitung der<br />
Gefährdungsschwelle<br />
! bei Verweigerung von Hilfen<br />
! Sicherung von geeigneten<br />
Interventionsstrukturen (Inobhutnahme,<br />
Vormundschaften) im Gefährdungsfall<br />
! Kontrolle von Eltern zum Schutz<br />
des Kindes<br />
!Ggf. unfreiwillige Eingriffe und<br />
Ausübung von Zwang<br />
21
<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong> <strong>begleiten</strong> - <strong>fördern</strong> - <strong>schützen</strong><br />
22<br />
Bundeskinderschutzgesetz<br />
Neues Gesetz – neue Herausforderungen?!<br />
These:<br />
Es gibt eine Erosion der Begrifflichkeit<br />
„<strong>Kinder</strong>schutz�. Diese mag zwar nützlich sein,<br />
um öffentliche Aufmerksamkeit und<br />
Ressourcen auf das Thema zu lenken. Es<br />
behindert aber klare Orientierungen und klare<br />
Entwicklungslinien.<br />
Das Bundeskinderschutzgesetz – allein sein<br />
Name – forciert diesen Erosionsprozess.<br />
© Prof. Dr. Reinhold Schone<br />
Bundeskinderschutzgesetz<br />
Neues Gesetz – neue Herausforderungen?!<br />
Zentrale Herausforderungen auf der<br />
fachlichen Ebene<br />
! Konzeptionelle Einbindung und Verortung von Familienhebammen<br />
im Angebot früher Hilfen<br />
! Konzeptionelle Fundierung der Kompetenzen „insoweit erfahrener<br />
Fachkräfte�<br />
! Risikoeinschätzung durch andere Professionen<br />
! „Keine Hausbesuche� werden begründungspflichtig<br />
© Prof. Dr. Reinhold Schone
<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong> <strong>begleiten</strong> - <strong>fördern</strong> - <strong>schützen</strong><br />
Bundeskinderschutzgesetz<br />
Neues Gesetz – neue Herausforderungen?!<br />
Zentrale Herausforderungen auf der Ebene der<br />
Träger<br />
! Schaffung eines qualifizierten „Gefährdungsmanagements� der<br />
Jugendämter<br />
! Bereitstellung/Bezahlung insoweit erfahrener Fachkräfte<br />
! Neue Vereinbarungen mit freien Trägern<br />
! Entwicklung von Qualitätskriterien für alle Felder der<br />
Jugendhilfe<br />
! Bei freien Trägern<br />
! Einlösung der durch die Jugendämter zu entwickelnden<br />
Qualitätskriterien zur Sicherung ihrer<br />
Finanzierungsgrundlagen<br />
! Beschwerdeverfahren für <strong>Kinder</strong> und Jugendliche<br />
© Prof. Dr. Reinhold Schone<br />
Bundeskinderschutzgesetz<br />
Neues Gesetz – neue Herausforderungen?!<br />
Zentrale Herausforderungen auf der Ebene der<br />
Ebene der Infrastruktur<br />
! Ausbau der Frühen Hilfen<br />
! Schaffung eines Informationssystems für Eltern<br />
! Beratung von der Schwangerschaft an<br />
! Errichtung eines Systems von Familienhebammen<br />
! Schaffung von „verbindlichen� Netzwerkstrukturen<br />
© Prof. Dr. Reinhold Schone<br />
R. Schone - Bundeskinderschutzgesetz<br />
23
<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong> <strong>begleiten</strong> - <strong>fördern</strong> - <strong>schützen</strong><br />
24<br />
Netzwerk im <strong>Kinder</strong>schutz<br />
<strong>Kinder</strong>garten<br />
Beratungsstellen<br />
<strong>Kinder</strong>ärzte<br />
© Prof. Dr. Reinhold Schone<br />
© Prof. Dr. Reinhold Schone<br />
Polizei<br />
Ambulante<br />
Psychotherapie<br />
Frauenhäuser<br />
Agentur für Arbeit/<br />
ARGE<br />
Schule<br />
Jugendamt/ASD<br />
<strong>Kinder</strong>psychiatrie<br />
Justiz<br />
Persönliche und institutionelle Netzwerke<br />
Netzwerk im <strong>Kinder</strong>schutz<br />
<strong>Kinder</strong>garten<br />
Beratungsstellen<br />
<strong>Kinder</strong>ärzte<br />
Polizei<br />
und Ordnungsbehörden<br />
Gesundheitsämter<br />
Interdisziplinäre<br />
Frühförderstellen<br />
Krankenhäuser<br />
Familiengerichte<br />
Sozialpädiatrische Zentren<br />
Ambulante<br />
Psychotherapie<br />
Frauenhäuser<br />
Agentur für Arbeit/<br />
ARGE<br />
Müttergenesung<br />
Familienbildungsstätten<br />
Schule<br />
Jugendamt/ASD<br />
Sozialämter<br />
<strong>Kinder</strong>psychiatrie<br />
Gemeinsame Servicestellen<br />
Justiz<br />
Schwangerschaftskonfliktberatung<br />
Persönliche und institutionelle Netzwerke
<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong> <strong>begleiten</strong> - <strong>fördern</strong> - <strong>schützen</strong><br />
Netzwerk im <strong>Kinder</strong>schutz<br />
© Prof. Dr. Reinhold Schone<br />
Persönliche und institutionelle Netzwerke<br />
Bundeskinderschutzgesetz<br />
Neues Gesetz – neue Herausforderungen?!<br />
© Prof. Dr. Reinhold Schone<br />
Jugendamt<br />
Zentrale Herausforderungen auf der Ebene der<br />
Ebene der Infrastruktur<br />
! Ausbau der Frühen Hilfen<br />
! Schaffung eines Informationssystems<br />
! Beratung auch von der Schwangerschaft an<br />
! Errichtung eines Systems von Familienhebammen<br />
! Schaffung von „verbindlichen� Netzwerkstrukturen<br />
R. Schone - Bundeskinderschutzgesetz<br />
25
<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong> <strong>begleiten</strong> - <strong>fördern</strong> - <strong>schützen</strong><br />
26<br />
Bundeskinderschutzgesetz<br />
Neues Gesetz – neue Herausforderungen?!<br />
Zentrale Herausforderungen auf der Ebene der<br />
Ebene der Infrastruktur<br />
! Ausbau der Frühen Hilfen<br />
! Schaffung eines Informationssystems<br />
! Beratung auch von der Schwangerschaft an<br />
! Errichtung eines Systems von Familienhebammen<br />
! Schaffung von „verbindlichen� Netzwerkstrukturen<br />
Gefahr: Wenn es nicht gelingt, die Aufgaben der fallunabhängigen<br />
Netzwerkbildung und der Qualitätsdiskussion unter dem Dach einer<br />
deutlich aufgewerteten Jugendhilfeplanung zu verankern werden<br />
wir es zukünftig mit Doppelstrukturen bzw. Dreifachstrukturen in<br />
den Jugendämtern zu tun haben.<br />
© Prof. Dr. Reinhold Schone<br />
Bundeskinderschutzgesetz<br />
Neues Gesetz – neue Herausforderungen?!<br />
Zentrale Herausforderungen auf der Ebene der<br />
Politik<br />
! Artikel 4 Evaluation<br />
„Die Bundesregierung hat die Wirkungen dieses Gesetzes unter<br />
Beteiligung der Länder zu untersuchen und dem Deutschen<br />
Bundestag bis zum 31. Dezember 2015 über die Ergebnisse<br />
dieser Untersuchung zu berichten.�<br />
© Prof. Dr. Reinhold Schone
<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong> <strong>begleiten</strong> - <strong>fördern</strong> - <strong>schützen</strong><br />
© Prof. Dr. Reinhold Schone<br />
Fazit<br />
Ein fachlich differenzierter Umgang mit der Chiffre<br />
„<strong>Kinder</strong>schutz� und eine klare Benennung dessen, was jeweils<br />
gemeint ist, ist Voraussetzung dafür, dass an den vielen<br />
aufgemachten Baustellen Fortschritte erzielt werden können.<br />
© Prof. Dr. Reinhold Schone<br />
Fazit<br />
R. Schone - Bundeskinderschutzgesetz<br />
Ein fachlich differenzierter Umgang mit der Chiffre<br />
„<strong>Kinder</strong>schutz� und eine klare Benennung dessen, was jeweils<br />
gemeint ist, ist Voraussetzung dafür, dass an den vielen<br />
aufgemachten Baustellen Fortschritte erzielt werden können.<br />
Eine innovative zukunftsgerichtete Gestaltung der Jugendhilfe ist<br />
auf eine starke Jugendhilfeplanung angewiesen.<br />
27
<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong> <strong>begleiten</strong> - <strong>fördern</strong> - <strong>schützen</strong><br />
28<br />
© Prof. Dr. Reinhold Schone<br />
Fazit<br />
Ein fachlich differenzierter Umgang mit der Chiffre<br />
„<strong>Kinder</strong>schutz� und eine klare Benennung dessen, was jeweils<br />
gemeint ist, ist Voraussetzung dafür, dass an den vielen<br />
aufgemachten Baustellen Fortschritte erzielt werden können.<br />
Eine innovative zukunftsgerichtete Gestaltung der Jugendhilfe ist<br />
auf eine starke Jugendhilfeplanung angewiesen.<br />
Die größte Herausforderung besteht m. E. darin, einem möglichen<br />
Anstieg an Formalisierung und Bürokratisierung durch das Gesetz<br />
zu widerstehen und nicht nachzulassen, inhaltlich fachliche<br />
Konzepte stetig kreativ (weiter) zu entwickeln, die dem Ziel dienen,<br />
gelingendes Aufwachsen von <strong>Kinder</strong>n und Jugendlichen zu<br />
ermöglichen.<br />
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!<br />
© Prof. Dr. Reinhold Schone
<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong> <strong>begleiten</strong> - <strong>fördern</strong> - <strong>schützen</strong><br />
<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong><br />
<strong>begleiten</strong> – <strong>fördern</strong> -‐ <strong>schützen</strong><br />
Die Fachforen<br />
Die Fachforen<br />
29
<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong> <strong>begleiten</strong> - <strong>fördern</strong> - <strong>schützen</strong><br />
30
<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong> <strong>begleiten</strong> - <strong>fördern</strong> - <strong>schützen</strong><br />
Gerda Holz<br />
ISS Frankfurt am Main<br />
G. Holz - Frühe Förderung/Hilfen als Prävention gegen <strong>Kinder</strong>armut<br />
Forum 1: Frühe Hilfen als Prävention gegen <strong>Kinder</strong>armut?!<br />
<strong>Kinder</strong>armut – präzise definiert als die Folgen familiärer Einkommensarmut – ist ein gravierendes<br />
Problem in Deutschland. <strong>Kinder</strong>armut ist gesellschaftlich bedingt und prägt<br />
zugleich die individuelle Lebensbedingungen und die Entwicklungs-/Bildungsmöglichkeiten<br />
des jungen Menschen: negativ.<br />
Prävention im Sinne der Verhinderung bzw. Verminderung der defizitären Auswirkungen<br />
für <strong>Kinder</strong> ist möglich und wirkt, wenn sie kindbezogen ausgerichtet sowie verhaltens- und<br />
verhältnisorientiert (Resilienz und strukturelle Armutsprävention) angelegt wird. Bei der<br />
Umsetzung sind besonders die Kommune und alle hier tätigen Akteure (Politik und Verwaltung,<br />
Einrichtungen, Organisationen Bürger/-innen usw.) gefordert.<br />
Je früher öffentliche Förderung und Hilfe armutsbetroffenen <strong>Kinder</strong>n zugutekommt, desto<br />
mehr kann ihr Aufwachsen im Wohlergehen gesichert werden. Je jünger die <strong>Kinder</strong> sind,<br />
desto mehr sind die Eltern die erste und wichtigste „Andockstation“ für öffentliche Unterstützung.<br />
Je belastender die elterliche Lage ist, desto geringer werden ihre Ressourcen,<br />
umso höher wird der Unterstützungsbedarf und desto mehr sind die <strong>Kinder</strong> auf außerfamiliäre<br />
Förderung und Hilfen angewiesen.<br />
Kindbezogene Armutsprävention bezieht immer das Kind und seine Eltern ein. Kindbezogene<br />
Armutsprävention auf kommunaler Ebene umfasst stets „Frühe Förderung“, “Frühe<br />
Hilfen“ und “<strong>Kinder</strong>schutz“, und das von der Geburt bis zum (erfolgreichen) Berufseinstieg.<br />
Sie wird in Form einer Präventionskette und auf der Basis von Präventionsnetzwerken in<br />
kommunaler Steuerung gesichert.<br />
31
<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong> <strong>begleiten</strong> - <strong>fördern</strong> - <strong>schützen</strong><br />
32<br />
Schwerpunkte<br />
1. Armut bei <strong>Kinder</strong>n – Was heißt das und wie<br />
wirkt sie?<br />
2. Kindbezogene Armutsprävention<br />
– Was ist damit gemeint?<br />
3. Frühe Förderung / Hilfen als Teil der<br />
kommunalen Armutsprävention?<br />
Definition – Mehrdimensionales Verständnis<br />
Armut !<br />
! ! ist immer zu erst Einkommensarmut<br />
! ! eine Lebenslage, die die Spielräume einschränkt<br />
! ! führt zur Unterversorgung<br />
! ! führt zu sozialer Ausgrenzung<br />
! ! hat ein spezifisches <strong>Kinder</strong>gesicht.<br />
Arm ist in Deutschland wer ...<br />
! ! weniger als 50%/60% des durchschnittlichen Nettoeinkommens<br />
(nach Haushaltsgröße gewichtet) zur Verfügung hat (EU-Definition).<br />
! ... wer Anspruch auf Sozialhilfe/Sozialgeld hat.
<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong> <strong>begleiten</strong> - <strong>fördern</strong> - <strong>schützen</strong><br />
Zentrale Ursachen und strukturelle Risiken<br />
" Erwerbsprobleme, z.B.<br />
" (Langzeit-)<br />
Erwerbslosigkeit<br />
" Niedrigeinkommen<br />
" Working poor<br />
" Hartz-IV-Bezug<br />
" Soziale Probleme, z.B.<br />
" Überschuldung<br />
" Trennung/Scheidung<br />
" Behinderung/Krankheit<br />
" Multiproblemlage<br />
G. Holz - Frühe Förderung/Hilfen als Prävention gegen <strong>Kinder</strong>armut<br />
Migration<br />
Alleinerziehend<br />
Bildung<br />
Sozialraum<br />
„<strong>Kinder</strong>reiche� Familien<br />
Folgen von Armut bei <strong>Kinder</strong>n /Jugendlichen<br />
33
<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong> <strong>begleiten</strong> - <strong>fördern</strong> - <strong>schützen</strong><br />
34<br />
Entwicklungsaufgaben von <strong>Kinder</strong>n und Jugendlichen<br />
!!"#"$"%&'()"<br />
"<br />
$"#"4"%&'()"<br />
"<br />
56(&7')""<br />
*)8)/.,/"<br />
07'19&3:)+1"<br />
*+,-.,/"<br />
0.12,23+)"<br />
4";")91&?1),"<br />
*)@+)'.,/),""<br />
)+,/)'),"<br />
Wie erleben <strong>Kinder</strong> Armut?<br />
<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong> <strong>begleiten</strong> - <strong>fördern</strong> - <strong>schützen</strong><br />
Lebenslage von Sechsjährigen<br />
– Nach Armut – 1999<br />
Anteil armer und nicht-armer <strong>Kinder</strong> mit Defiziten<br />
Lebenslagebereich arme <strong>Kinder</strong> nicht-arme<br />
<strong>Kinder</strong><br />
40 % 15 %<br />
Grundversorgung<br />
(n = 220 arm; 598 nicht-arm)<br />
Gesundheit<br />
(n = 225 arm; 640 nicht-arm)<br />
Kulturelle Lage<br />
(n = 223 arm; 614 nicht-arm)<br />
Soziale Lage<br />
(n = 219 arm; 618 nicht-arm)<br />
auf- oder abgerundete Angaben<br />
Quelle: „Armut im Vorschulalter“ 1999, Berechnungen des ISS<br />
31 % 20 %<br />
36 % 17 %<br />
36 % 18 %<br />
Verteilung der Lebenslagetypen bei armen und nicht-armen<br />
jungen Menschen – Nach Erhebungszeitpunkten 1999 – 2009/10<br />
""L(')J.,/9#<br />
@)+16.,:1""<br />
MN)J),9&?1)("<br />
-)("B+,-)(O"!<br />
)(.,-)1)"0,/&J),"<br />
Z.)??),[""0(3.1"+3"K2(97'.?&?1)("(.,-97'.?&?1)("=!!$V!W\"0P]#E55#B+,-)(&(3.196&,)?"=!!UV
<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong> <strong>begleiten</strong> - <strong>fördern</strong> - <strong>schützen</strong><br />
36<br />
Der strukturelle Zusammenhang<br />
„Bildungschancen und soziale Herkunft� in Deutschland ...<br />
• ist schon im Krippen-/KiTa-System angelegt, z.B.<br />
� Angebot und Nutzungsmöglichkeiten<br />
� verfrühte oder verspätete Einschulung<br />
• verfestigt sich in der Grundschulzeit, z.B.<br />
� vermehrte Klassenwiederholung<br />
� bei gleicher Leistung seltener Gymnasialempfehlung<br />
• nimmt in der Sekundarstufe I weiter zu, z.B.<br />
� vermehrte Klassenwiederholung<br />
� häufigere Schulformwechsel, d.h. Um-/Rückstufung<br />
Es gibt eine klare Rangfolge kindlicher Entwicklungsrisiken<br />
1. Einkommensarmut<br />
2. Bildungshintergrund<br />
3. Migrationshintergrund
<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong> <strong>begleiten</strong> - <strong>fördern</strong> - <strong>schützen</strong><br />
3. (Arme) Eltern – Ihr Handeln und Bedarf<br />
Auf was wurde verzichtet, wenn das Geld nicht reicht?<br />
(Haushaltsbefragung n=272)<br />
Quelle: DW – Wirksame Wege für Familien mit geringem Einkommen im Braunschweiger Land. Braunschweig 2011: 27.<br />
G. Holz - Frühe Förderung/Hilfen als Prävention gegen <strong>Kinder</strong>armut<br />
37
<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong> <strong>begleiten</strong> - <strong>fördern</strong> - <strong>schützen</strong><br />
38<br />
Bereiche, in denen von den Haushalten<br />
(weitere) Unterstützung gewünscht wird<br />
(Haushaltsbefragung, n = 311)<br />
Quelle: DW – Wirksame Wege für Familien mit geringem Einkommen im Braunschweiger Land. Braunschweig 2011:71.<br />
Die sieben B's der „Arbeit mit (sozial benachteiligten) Eltern�<br />
Beteiligung<br />
Wegfall, kein<br />
weiterer<br />
Bedarf<br />
Beratung<br />
kurzzeitig,<br />
wiederholend<br />
(z.B. Gesundheitsförderung,<br />
U-Untersuchungen)<br />
Bedarfe von Eltern<br />
Information<br />
Begegnung Begleitung Bildung Betreuung<br />
Erforderliche Angebotsschwerpunkte<br />
kurz-,<br />
mittelfristig<br />
(z.B. Elterntreff)<br />
mittel-,<br />
langfristig<br />
(z.B. individuelle<br />
Förderpläne)<br />
Anbieter Netzwerk<br />
mittel-,<br />
langfristig<br />
(z.B. Elternkurse)<br />
langfristig,<br />
permanent<br />
(z.B. <strong>Kinder</strong>schutz-<br />
Budget<br />
maßnahmen) Abgabe an<br />
Jugendamt /<br />
ASD<br />
© ISS-Frankfurt a.M. 2012
<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong> <strong>begleiten</strong> - <strong>fördern</strong> - <strong>schützen</strong><br />
Die Monheimer Nutzungspyramide zur „Arbeit mit<br />
(sozial benachteiligten) Eltern�<br />
(n=616) Datenquelle: Monheimer Neueltern-Studie 2011.<br />
Holz/Stallmann/Hock 2012<br />
Schwerpunkte<br />
2. Kindbezogene Armutsprävention<br />
– Was ist damit gemeint?<br />
G. Holz - Frühe Förderung/Hilfen als Prävention gegen <strong>Kinder</strong>armut<br />
39
<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong> <strong>begleiten</strong> - <strong>fördern</strong> - <strong>schützen</strong><br />
40<br />
Die zwei entscheidenden Ebenen einer<br />
kindbezogenen Armutsprävention<br />
1. Focus = Individuelle Förderung und Stärkung<br />
Gestaltung/Veränderung von Verhalten/Handeln<br />
durch Angebote/Maßnahme über öffentliche<br />
Infrastruktur, individuelle Zeit<br />
und Kompetenz<br />
2. Focus = Strukturelle Armutsprävention<br />
Gestaltung/Veränderung von Verhältnissen, z.B.<br />
durch armutsfeste Grundsicherung, kostenfreie<br />
Angebote sowie umfassende und qualifizierte<br />
öffentliche Infrastruktur und deren Vernetzung<br />
Kindbezogene Armutsprävention !<br />
" ist ein Konzept<br />
" das kindzentriert, d.h. aus der Perspektive des Kindes, angelegt ist,<br />
" das bei der Analyse und Stärkung der Ressourcen und Potenziale<br />
eines Kindes und auf allen gesellschaftlichen Ebenen ansetzt.<br />
" zielt darauf ab, armen <strong>Kinder</strong>n jene Entwicklungsbedingungen zu<br />
eröffnen, die ihnen ein Aufwachsen im Wohlergehen ermöglichen.<br />
" ist ein komplexer sozialer und kinder-/jugendpolitischer Prozess, der<br />
ausdrücklich die<br />
" Verbesserung von Lebensweisen und<br />
" Verbesserung von Lebensbedingungen (Verhältnisse, Strukturen,<br />
Kontexte)<br />
umfasst.
<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong> <strong>begleiten</strong> - <strong>fördern</strong> - <strong>schützen</strong><br />
(Frühe) Förderung, Frühe Hilfen, <strong>Kinder</strong>schutz<br />
!<br />
!<br />
"#$%&'(!<br />
"#$%&'(!<br />
)*+,-.!!<br />
)*+,-.!<br />
!<br />
/'0+&!1#23&$!<br />
/'0+&!1#23&$!<br />
/'0+&!/4'%&',$5!<br />
6'7,-)8'9:&$;
<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong> <strong>begleiten</strong> - <strong>fördern</strong> - <strong>schützen</strong><br />
42<br />
Strukturprinzip kindbezogener Armutsprävention:<br />
Präventionskette durch Netzwerke<br />
Eltern<br />
Schwangerschaftsbegleitung<br />
Kind<br />
Krippe<br />
(0-3 J.)<br />
Begleitung<br />
Begegnung Bildung<br />
Beratung Betreuung<br />
Information<br />
Kita<br />
(3-6 J.)<br />
Grundschule<br />
(6-10 J.)<br />
Die Formen von Netzwerken<br />
Weiterführende<br />
Schule (10-.. J.)<br />
Berufs-<br />
(aus-)bildung<br />
" Informationsnetzwerk<br />
Dient der gegenseitige Information und des Austausches mit dem Ziel der<br />
Transparenz und der gezielten Förderung von Kooperationen zwischen den<br />
verschiedenen Akteuren.<br />
( z.B. ein „Runder Tisch� oder „Arbeitskreise� zu Themen oder im Stadtteil).<br />
" Fall- oder projektbezogenes Netzwerk<br />
Dient der Kooperation einzelner Akteure im Rahmen einer zeitlich befristeten<br />
gemeinsamen Aufgabe<br />
(z.B. Hilfeplanverfahren, Sprachförderung/Gesundheitsförderung von KiTas)<br />
" Produktionsnetzwerk<br />
Damit ist die Verknüpfung der Dienstleistungen einzelner Akteure zu einer<br />
(potenziellen) integrierten Leistung gemeint.<br />
(z.B. Kita- oder schulbezogene Unterstützungsnetzwerke, Gesunde KiTa/Gesunde Schule<br />
sozialraumbezogene oder kommunale Frühwarnsysteme <strong>Kinder</strong>schutz, Präventionskette)<br />
© ISS-Frankfurt a.M.
<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong> <strong>begleiten</strong> - <strong>fördern</strong> - <strong>schützen</strong><br />
Schwerpunkte<br />
3. Frühe Förderung / Hilfen als Teil<br />
der kommunalen Armutsprävention<br />
Grundsätzlich ist zu berücksichtigen ...<br />
G. Holz - Frühe Förderung/Hilfen als Prävention gegen <strong>Kinder</strong>armut<br />
" Je früher <strong>Kinder</strong> Armut erleben und je länger sie in Armut aufwachsen,<br />
desto gravierender sind die Folgen – im Jetzt und für Morgen.<br />
Sie benötigen entsprechend mehr außerfamiliäre Förderung.<br />
" Je jünger die <strong>Kinder</strong> sind, desto mehr sind ihre Eltern der erste / wichtigste<br />
Ansatzpunkt für außerfamiliärer Angebote.<br />
" Je belasteter die Lebenslage der Eltern ist,<br />
desto geringer sind die Eigenressourcen und desto größer ist der Bedarf<br />
an Stärkung und Unterstützung.<br />
43
<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong> <strong>begleiten</strong> - <strong>fördern</strong> - <strong>schützen</strong><br />
44<br />
Grundsätzlich ist zu berücksichtigen ...<br />
" Eltern sind zuerst Erwachsene in ganz unterschiedlichen Lebenslagen, mit<br />
vielen Bedürfnissen und einem komplexen Bedarf über die Elternrolle hinaus.<br />
" Bei Reduzierung auf die Elternrolle – d. h. ihre Versorgungs-, Betreuungs-<br />
und Erziehungsfunktion – kommt es zur Verengung des Blicks auf nur einen<br />
Teilbereich des Lebens von Erwachsenen.<br />
" Die Verengung führt im familiären Umfeld, bei den Profis, in den<br />
Einrichtungen KiTas / Schulen zu Einschränkungen in der Wahrnehmung von<br />
Bedarfen und davon abgeleitet in der Entwicklung von Angeboten.<br />
" Es geht um die Umsetzung einer<br />
„Arbeit mit (armen /sozial benachteiligten) Eltern�.<br />
! !"#$%&'$(&)*+'$(&<br />
,&-*(&.&/01%$& .&-*(&2&/01%$& 2&-*(&3,&/01%$&<br />
!<br />
"!%-$*#&4*#&5(67*0"&-$+081#$*"*9#$+:&;"#$%+7804-/0:78'!38'/4A0'(!!<br />
Unterstützungsbedarfe<br />
von<br />
Eltern und<br />
mögliche Angebote<br />
im Netzwerk<br />
C%&*'-B!$FCF!<br />
# 2,:-'(+'0-/S*'!5!P'+D8/'(B!&0'!L,(!'0(J,
<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong> <strong>begleiten</strong> - <strong>fördern</strong> - <strong>schützen</strong><br />
Beispiel: Gesundheitsförderung und Prävention als<br />
lokales Produktionsnetzwerk<br />
Beratungs-<br />
stellen<br />
Kommune / Bezirk<br />
Jugendbehörde<br />
Bezirke/ Kommune /<br />
Land<br />
Vermittlung<br />
Informa-tionen<br />
zu Ämtern<br />
Verbände /<br />
Freie Träger<br />
Quelle: Eigene Darstellung 2012<br />
Hilfen zur<br />
Erziehung<br />
Erziehungsberatung <br />
Schwangerschaft<br />
/<br />
Vor-/<br />
Nachsorge-<br />
Lokale<br />
Gesundheitsförderungskette<br />
„Ab Schwangerschaft<br />
bis ins<br />
Erwachsenenleben�<br />
Koordinations-/<br />
Anlaufstelle<br />
Sprach-förderung<br />
Kind/Eltern<br />
Ärzteschaft/<br />
Hebammen<br />
Initiativen / Freie Träger<br />
Betreuung<br />
Risikofamilie<br />
Gesundheitsförderung<br />
Kind<br />
Gesundheits<br />
beratung<br />
Eltern<br />
Familienbildungseinrichtungen<br />
Familienhebamme<br />
Jugendbehörde,<br />
öffentlicher<br />
Gesundheitsdienst<br />
Krippe(/KiTa//Schule<br />
Schwangerschafts-,<br />
Familien-,<br />
Suchtberatungsstellen<br />
Beispiel: KiTa-bezogenes Unterstützungsnetzwerk<br />
zur „Arbeit mit Eltern“ in KiTas<br />
Beratungs-<br />
stellen<br />
Kommune / Kreis<br />
Sprachkurs-<br />
anbieter<br />
Vermittlung<br />
Verbände /<br />
Freie Träger<br />
Quelle: Eigene Darstellung 2012<br />
Informa-tionen<br />
zu Ämtern<br />
Sprach-<br />
kurse<br />
Erziehungsberatung<br />
Eltern-Café<br />
Elternangebote<br />
in der KiTa<br />
Familienbildungseinrichtungen<br />
G. Holz - Frühe Förderung/Hilfen als Prävention gegen <strong>Kinder</strong>armut<br />
Gesundheitsförderung <br />
Elterngespräch<br />
Bürgerschaftlich<br />
Engagierte<br />
Elternsprechstunde<br />
Elternbeirat<br />
Ärzteschaft/<br />
Initiativen / Freie Träger<br />
(Fachkräfte der)<br />
KiTa<br />
45
<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong> <strong>begleiten</strong> - <strong>fördern</strong> - <strong>schützen</strong><br />
46
<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong> <strong>begleiten</strong> - <strong>fördern</strong> - <strong>schützen</strong><br />
Désirée Frese<br />
Christina Günther<br />
ISA e.V.<br />
D. Frese, Ch. Günther - Elternbesuchsdienste in NRW<br />
Forum 2: Einblicke in das Forschungsprojekt zu Elternbesuchsdiensten<br />
des ISA e.V.<br />
Im Rahmen des Ausbaus früher Hilfen haben viele Kommunen in den letzten Jahren Elternbesuchsdienste<br />
für Neugeborene eingeführt. Hierbei handelt es sich um Willkommensbesuche,<br />
in denen kommunale Vertreter/innen die Familie in ihrem häuslichen Umfeld besuchen,<br />
das neugeborene Kind willkommen heißen und die Eltern über familienrelevante<br />
Themen und Angebote informieren. Dabei haben die Kommunen unterschiedliche Varianten<br />
von Babybegrüßungsdiensten entwickelt, im Rahmen derer verschiedene Institutionen<br />
und Professionen beteiligt sind. Auch der Gesetzgeber hat das Potential der Willkommensbesuche<br />
erkannt und im Rahmen des zum 01.01.2012 in Kraft getretenen Bundeskinderschutzgesetztes<br />
geregelt, dass Eltern über das örtliche Leistungsangebot informiert werden.<br />
Hierdurch wird ein bundesweiter Ausbau von Willkommensbesuchen gefördert.<br />
Da die Willkommensbesuche allerdings ein relativ neues Angebot der Jugendhilfe darstellen,<br />
fehlen bisher Informationen zur Verbreitung, zu den unterschiedlichen Organisationsformen<br />
und zum Nutzen des neuen Angebotes. Diese offenen Fragen wurden im Rahmen<br />
des Praxisentwicklungsprojektes „Aufsuchende Elternkontakte: Konzeptionen, Ziele, Wirkungen“<br />
aufgegriffen, das das Institut für soziale Arbeit e.V. von Mai 2010 bis April 2012<br />
durchführt. Der Vortrag gibt einen Überblick über das Forschungsdesign und erste Ergebnisse.<br />
Es werden Zahlen zur Verbreitung des Angebotes in Nordrhein-Westfalen vorgestellt<br />
und typische Besuchsvarianten beschrieben.<br />
47
<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong> <strong>begleiten</strong> - <strong>fördern</strong> - <strong>schützen</strong><br />
48<br />
Fachforum zum<br />
Praxisentwicklungsprojekt:<br />
„Aufsuchende „Aufsuchende Elternkontakte.<br />
Elternkontakte.<br />
Konzeptionen, Konzeptionen, Zugänge Zugänge und und<br />
Wirkungen� Wirkungen�<br />
Präsentation<br />
Fachforum<br />
erster<br />
zu den<br />
Zwischenergebnisse<br />
Zwischenergebnissen<br />
auf<br />
auf<br />
der<br />
dem<br />
Fachkongress „Qualitätsentwicklung im<br />
Präventionskonferenz <strong>Kinder</strong>schutz in NRW der – Herausforderungen Stadt Münster des<br />
„<strong>Starke</strong> Bundeskinderschutzgesetzes� <strong>Kinder</strong> <strong>begleiten</strong> – <strong>fördern</strong> am – 19.01.2012 <strong>schützen</strong>� in<br />
am Dortmund 22. März 2012<br />
Désirée Frese und Christina Günther, Institut für<br />
soziale Arbeit e.V.<br />
Désirée Frese und Christina Günther, Institut für<br />
soziale Arbeit e.V.<br />
Elternbesuchsdienst im Spiegel<br />
der Medien<br />
2
<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong> <strong>begleiten</strong> - <strong>fördern</strong> - <strong>schützen</strong><br />
9':'<br />
(.+6<br />
(&.-<br />
'"<br />
.;<<br />
<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong> <strong>begleiten</strong> - <strong>fördern</strong> - <strong>schützen</strong><br />
50<br />
Quantitative Analyse der Umsetzung<br />
in Nordrhein-Westfalen<br />
Methodisches Vorgehen:<br />
• Befragungszeitraum: 01.07.2010 bis 31.08.2010<br />
• Rücklauf zunächst: 171 von 184 Jugendämter,<br />
fehlende 13 Jugendämter in telefonsicher<br />
Nachfassaktion kontaktiert<br />
• Eingang in die Auswertung (strukturelle<br />
Dimension) ! 126 Jugendämter NRWs<br />
• Auswertung Organisatorische und Professionelle<br />
Dimension: N=119<br />
*")<br />
*!)<br />
*))<br />
')<br />
&)<br />
")<br />
!)<br />
)<br />
Quantitative Analyse<br />
- Strukturelle Dimension (1/3)<br />
!"#$%&'()%'*%$+%),'-.,%$&/%012#0*)%&0,%'*1$2#3'<br />
&'#$%<br />
!"#$%<br />
Abb. 1 Stand der Umsetzung der Elternbesuchsdienste (Stand 08/2010)<br />
(%<br />
+, -./0123/04#1567849:2;<br />
?,2:2;@<br />
-832
<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong> <strong>begleiten</strong> - <strong>fördern</strong> - <strong>schützen</strong><br />
$)<br />
%&<br />
%)<br />
#&<br />
#)<br />
!&<br />
!)<br />
&<br />
)<br />
Quantitative Analyse<br />
- Strukturelle Dimension (3/3)<br />
("<br />
!"#$%&#"%'#"(")%*+,-")%./,-")%!#"%0#((1233")45"467,"%<br />
86-%9"56-$%"#)"4%:#);"4%;6-7,%>?@A<br />
%'"<br />
%&"<br />
!$"<br />
* +!+,-./ !+0+#+,-./1 #+0+%+,-./1 %+0+$+,-./1 $+0+&+,-./1 2 +&+,-./1<br />
Abb. 2 Zeitliche Dimensionierung der Umsetzung der Elternbesuchsdienste in NRW (Stand 08/2010)<br />
Quantitative Analyse<br />
- Organisatorische Dimension (3/3)<br />
D. Frese, Ch. Günther - Elternbesuchsdienste in NRW<br />
Koordination Beteiligung an der Durchführung Häufigkeit<br />
Variante 1 Öffentliche <strong>Kinder</strong>- und<br />
Jugendhilfeträger<br />
Variante 2 Öffentliche <strong>Kinder</strong>- und<br />
Jugendhilfeträger<br />
Variante 3 Öffentliche <strong>Kinder</strong>- und<br />
Jugendhilfeträger<br />
Variante 4 Freie <strong>Kinder</strong>- und<br />
Jugendhilfeträger<br />
Variante 5 Öffentliche <strong>Kinder</strong>- und<br />
Jugendhilfeträger<br />
Öffentliche <strong>Kinder</strong>- und<br />
Jugendhilfeträger<br />
#"<br />
!"<br />
62%<br />
Freie <strong>Kinder</strong>- und Jugendhilfeträger 14%<br />
Träger der Gesundheitshilfe 10%<br />
Freie <strong>Kinder</strong>- und Jugendhilfeträger 7%<br />
Öffentliche und freie <strong>Kinder</strong>- und<br />
Jugendhilfeträger (Familienzentren in<br />
unterschiedlicher Trägerschaft)<br />
Variante 6 Träger der Gesundheitshilfe Öffentliche <strong>Kinder</strong>- und<br />
Jugendhilfeträger und Institutionen<br />
der Gesundheitshilfe<br />
zzgl. 4% sonstige Kooperationsformen<br />
2%<br />
1%<br />
51
<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong> <strong>begleiten</strong> - <strong>fördern</strong> - <strong>schützen</strong><br />
Quantitative Analyse<br />
- Professionelle Dimension (1/2)<br />
52<br />
!"#$%&'(%"&)*+,-.*<br />
/0*1&-*/0*<br />
2341&-53%(46343&<br />
!"#<br />
/0*'14*-3#*<br />
2341&-53%(46343&)*<br />
73$'##3&*1&-*<br />
!%&-3898'&93&:<br />
4;5634(38&<br />
!"#<br />
+,-.*/0*1&-*<br />
3583&'#(>.*<br />
C34;5,B(%?(3*#%(*<br />
1&(384;5%3->.*<br />
D1'>%B%9'(%"&3&*<br />
EF35838%&@*<br />
!%&-38,8=(%&@*<br />
C'&9'&?34(3>>(3@*<br />
G/H((38G<br />
&#<br />
1&(384;5%3->.*<br />
I8"B344%"&3&*%#*<br />
A583&'#(*-18;5*<br />
4';5$3="?3&3*<br />
1&?*<br />
J1'>%B%=%38(*E1.'.*<br />
/K0@*9'1B#.*<br />
0&?34(3>>(3@*<br />
38=%351&?4:<br />
+B>3?38<br />
$%#<br />
Abb. 4: Berufliche Qualifikation der Mitarbeiter der Elternbesuchsdienste<br />
Quantitative Analyse der Umsetzung von<br />
Elternbesuchsdiensten in NRW<br />
- Fazit<br />
• Verbreitung: 68,5% der Jugendämter in NRW setzen zum Zeitpunkt der<br />
Erhebung (Juli / August 2010) bereits einen Elternbesuchsdienst um<br />
• es existiert eine deutlich heterogene organisatorische Umsetzung des<br />
Angebotes in NRW<br />
• Die Umsetzung des Elternbesuchsdienstes in alleiniger Verantwortung<br />
des öffentlichen Jugendhilfeträgers ist mit 62% die am häufigsten<br />
praktizierte Variante<br />
• professionelle Dimension: Zunahme der Heterogenität bei Beteiligung<br />
eines freien Träger der Jugendhilfe
<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong> <strong>begleiten</strong> - <strong>fördern</strong> - <strong>schützen</strong><br />
Qualitative Konzeptanalyse<br />
Methodisches Vorgehen:<br />
• Besonders häufige und seltene<br />
Organisationsvarianten wurden<br />
ausgewählt (21 schriftliche Konzepte)<br />
• Unterschiedliches Material (PPP,<br />
Konzepte, Vorlagen JHA)<br />
• Auswertung mit der Methode der<br />
qualitativen Inhaltsanalyse nach P.<br />
Mayring<br />
Ausgewählte Ergebnisse<br />
Definition<br />
D. Frese, Ch. Günther - Elternbesuchsdienste in NRW<br />
„Ein Willkommensbesuch ist ein Angebot im Bereich der frühen<br />
Hilfen, das im Rahmen des SGB VIII erbracht wird. Der<br />
Willkommensbesuch hat zum Ziel, das neugeborene Kind<br />
willkommen zu heißen und einen Zugang zu Eltern zu schaffen.<br />
Typische Zielgruppe sind alle Eltern mit Neugeborenen einer<br />
Kommune. Die Eltern sollen Informationen zu familienrelevanten<br />
Angeboten erhalten und bei Bedarf beraten werden und Angebote<br />
vermittelt bekommen. Der Willkommensbesuch erfolgt dabei<br />
frühzeitig nach der Geburt des Kindes und typischerweise im<br />
häuslichen Umfeld der Familie.�<br />
1 2<br />
53
<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong> <strong>begleiten</strong> - <strong>fördern</strong> - <strong>schützen</strong><br />
54<br />
Kern- und Richtungsziele<br />
Richtungsziel<br />
Familienfreundlichkeit steigern<br />
Familienfreundlicher<br />
Willkommensbesuch<br />
Kernziele des Willkommensbesuchs<br />
Zugang zu den Eltern schaffen<br />
Informieren<br />
Angebote bei Bedarf vermitteln und Beratung<br />
Frühzeitigkeit<br />
Richtungsziel<br />
Belastungen frühzeitig erkennen<br />
und Angebote vermitteln<br />
Unterstützender<br />
Willkommensbesuch<br />
Richtungsziel<br />
Eigenständiges Beratungsangebot<br />
für die nachgeburtliche Phase<br />
vorhalten<br />
Helfender<br />
Willkommensbesuch<br />
Intensität des Kontaktes zwischen Besucher/in und Familie nimmt zu<br />
Besuchstypen<br />
Der familienfreundliche Willkommensbesuch<br />
Richtungsziel:<br />
Betonung des Kernziels<br />
Rolle des Besuchers<br />
Familienfreundlichkeit steigern<br />
Zugang und Informationen<br />
Repräsentant/ Botschafter<br />
Typische Organisationsform a) ÖT der Jugendhilfe<br />
Personalauswahl<br />
- Abteilung ASD<br />
- Abteilung außerhalb des ASD<br />
b) FT/ ÖT der Jugendhilfe<br />
in a) Fachkräfte (Sozialpädagogen,<br />
Erzieher)<br />
in b) Fachkräfte und Ehrenamtliche<br />
1 4
<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong> <strong>begleiten</strong> - <strong>fördern</strong> - <strong>schützen</strong><br />
Textbeispiel:<br />
Familienfreundlichkeit<br />
„Familien [...] sollen in der Weise unterstützt<br />
werden, als familien- und situationsgerechte<br />
Angebote, die bereits bei der Stadt xxx und den<br />
freien Trägern vorhanden sind, gebündelt und den<br />
Betroffenen erleichternd zugänglich gemacht<br />
sowie mit den Betroffenen gemeinsam und<br />
bedarfsorientiert neue Angebote initiiert und aus<br />
stadt- und familienpolitischer Sicht<br />
familienfreundliche Strukturen fortentwickelt<br />
werden.�<br />
Besuchstypen<br />
D. Frese, Ch. Günther - Elternbesuchsdienste in NRW<br />
Der unterstützende Willkommensbesuch<br />
Richtungsziel Unterstützung und Vermittlung<br />
Betonung des Kernziels Belastungen frühzeitig erkennen und<br />
Angebote vermitteln<br />
Rolle des Besuchers Lotse/ Bootsführer<br />
Typische Organisationsform<br />
Personalwahl<br />
a) ÖT der Jugendhilfe<br />
- Abteilung ASD<br />
- Abteilung außerhalb des ASD<br />
b) FT/ ÖT der Jugendhilfe<br />
c) ÖT der Jugendhilfe und<br />
Gesundheitswesen<br />
Fachkräfte der Jugendhilfe und des<br />
Gesundheitswesens<br />
1 6<br />
55
<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong> <strong>begleiten</strong> - <strong>fördern</strong> - <strong>schützen</strong><br />
56<br />
Textbeispiel:<br />
Frühzeitiges Erkennen von<br />
Belastungen und Angebotsvermittlung<br />
„Viele hochbelastete Familien finden nicht den Weg in<br />
eine Familienbildungsstätte mit klassischer<br />
Kommstruktur . Um Unterstützungs- und Hilfebedarfe<br />
solcher Familien überhaupt wahrzunehmen, sehen wir<br />
es als erforderlich an, im Sinne einer Geh-Struktur die<br />
Familien zu Hause zu besuchen. [...] Diese nicht<br />
stigmatisierende Vorgehensweise bietet die größte<br />
Chance zur Kooperationsbereitschaft der Familien und<br />
Wahrnehmung von Problemlagen.�<br />
Besuchstypen<br />
Der helfende Willkommensbesuch<br />
Ziele Postnatale Beratung<br />
Betonung des Kernziels Beratung und Hilfe<br />
Rolle des Besuchers Berater und Helfer<br />
Typische Organisationsform a) ÖT der Jugendhilfe +<br />
Gesundheitswesen<br />
b) Gesundheitswesen<br />
Personalauswahl Fachkräfte des Gesundheitswesens<br />
und der Jugendhilfe<br />
1 8
<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong> <strong>begleiten</strong> - <strong>fördern</strong> - <strong>schützen</strong><br />
D. Frese, Ch. Günther - Elternbesuchsdienste in NRW<br />
Textbeispiel: Beratung und<br />
Hilfe<br />
„Drei <strong>Kinder</strong>krankenschwestern mit<br />
Zusatzqualifikationen im Bereich der frühen Kindheit<br />
und Heilpädagogik bieten individuelle Beratung zur<br />
Förderung der Entwicklung des Säuglings und des<br />
Kleinkindes bis zu drei Jahren, Unterstützung und<br />
Begleitung bei besonderen Belastungen,<br />
Stillunterstützung sowie Beratung zum Thema<br />
Ernährung an.�<br />
Herausforderungen<br />
Spannungsfeld zwischen Hilfe<br />
und Kontrolle<br />
<strong>Kinder</strong>schutz als Ziel?<br />
• Willkommensbesuch soll zu einem „gelingenden<br />
<strong>Kinder</strong>schutz beitragen� (N= 7)<br />
• Abgrenzung des Willkommensbesuches als Instrument<br />
zum gezielten Erkennen von gewichtigen Anhaltspunkten<br />
nach § 8a SGB VIII (N=5)<br />
• In den meisten Konzepten uneindeutige Aussagen zur<br />
Frage, ob gewichtige Anhaltspunkte ermittelt werden<br />
sollen oder nicht (N=14)<br />
57
<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong> <strong>begleiten</strong> - <strong>fördern</strong> - <strong>schützen</strong><br />
58<br />
Textbeispiele<br />
„Der Besuch erfolgt bei den Familien zu Hause in ihrem eigenen Umfeld, da<br />
hier am präzisesten Ressourcen und Kompetenzen, Gefährdungspotentiale<br />
und erhöhter Hilfebedarf frühzeitig wahrgenommen werden können.�<br />
„Die Verteilung der Elternbriefe durch eine pädagogische Fachkraft des<br />
Jugendamtes, die auch regelmäßig im <strong>Kinder</strong>schutz tätig ist, hat zum Ziel,<br />
Eltern eine umfassende Beratung in allen Bereichen der <strong>Kinder</strong>- und<br />
Jugendhilfe anzubieten sowie mögliche Unterstützungsbedarfe der Eltern<br />
oder Vernachlässigungen von <strong>Kinder</strong>n frühzeitig zu erkennen und<br />
entsprechende Hilfen zu leisten.�<br />
• <strong>Kinder</strong>schutz als Verfahrensstandard?<br />
– in weniger als der Hälfte der Konzepte werden Verfahrensregelungen<br />
nach § 8a SGB VIII beschrieben (N=9 bzw. in dezidierter Weise nur<br />
N=6)<br />
– Fazit: überwiegend unklare Zielbestimmungen zum <strong>Kinder</strong>schutz und<br />
fehlende Verfahrensregelungen nach § 8a SGB VIII können fachliche<br />
Unsicherheit und Irritationen bei Fachkräften und Eltern erhöhen<br />
• Empfehlung<br />
– In den Zielbestimmungen klare Abgrenzung des<br />
Willkommensbesuches als Instrument zur gezielten Ermittlung von<br />
gew. Anhaltspunkten nach §8a SGB VIII formulieren<br />
– Verfahrensregelungen nach § 8a SGB VIII aufnehmen, wenn<br />
gewichtige Anhaltspunkte im Besuch bekannt werden (wer<br />
meldet was wann wem? Beteiligung der Eltern, Dokumentation)<br />
– Transparenter Umgang mit dem Schutzauftrag nach § 8a SGB VIII<br />
gegenüber Eltern
<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong> <strong>begleiten</strong> - <strong>fördern</strong> - <strong>schützen</strong><br />
Thomas Fischbach<br />
BVKJ NRW<br />
Schutzauftrag Bundeskinderschutzgesetz<br />
Kooperation von Gesundheits-<br />
wesen und Jugendhilfe<br />
Präventionskongress<br />
<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong><br />
<strong>begleiten</strong> – <strong>fördern</strong> – <strong>schützen</strong><br />
Münster, 22. März 2012<br />
T. Fischbach - Schutzauftrag Bundeskinderschutzgesetz<br />
Forum 3: Schutzauftrag durch das Bundeskinderschutzgesetz:<br />
Herausforderungen für die Zusammenarbeit<br />
der Fachkräfte aus Jugendhilfe und Gesundheitswesen<br />
59
<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong> <strong>begleiten</strong> - <strong>fördern</strong> - <strong>schützen</strong><br />
60<br />
Dr. med. Thomas Fischbach<br />
Facharzt für <strong>Kinder</strong>- und Jugendmedizin<br />
Berufsverband der <strong>Kinder</strong>- und Jugendärzte BVKJ e.V.<br />
BKiSchG -Kooperation erreichen
<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong> <strong>begleiten</strong> - <strong>fördern</strong> - <strong>schützen</strong><br />
T. Fischbach - Schutzauftrag Bundeskinderschutzgesetz<br />
Bundeskinderschutzgesetz<br />
! 16.12.2011: Zustimmung des Bundesrates nach Anrufung<br />
des Vermittlungsausschusses. Damit Inkrafttreten am<br />
01.01.2012<br />
! Nachbesserungen erreicht:<br />
- Verminderung bürokratischer Hemmnisse bei der<br />
Qualitätsentwicklung im Bereich der Jugendhilfe<br />
- Erweiterung der Bundesinitiative „Familienhebammen“<br />
- dauerhafte finanzielle Sicherstellung der psychosozialen<br />
Unterstützung von Familien mit kleinen <strong>Kinder</strong>n.<br />
Bundeskinderschutzgesetz<br />
Wesentliche Ziele<br />
! Frühe Hilfen und Netzwerke für werdende Eltern.<br />
! Stärkung des Einsatzes von Familienhebammen.<br />
! Ausschluss einschlägig Vorbestrafter von Tätigkeiten in der<br />
<strong>Kinder</strong>- und Jugendhilfe<br />
! Befugnisnorm für Berufsgeheimnisträger zur Informationsweitergabe<br />
an das Jugendamt.<br />
! Regelung zum Hausbesuch<br />
! Verbindliche Standards in der <strong>Kinder</strong>- und Jugendhilfe.<br />
61
<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong> <strong>begleiten</strong> - <strong>fördern</strong> - <strong>schützen</strong><br />
62<br />
Befugnisnorm im BuKiSchG<br />
Was muss JH und Gesundheits-<br />
wesen zusammenführen?<br />
! <strong>Kinder</strong>- und Familienarmut und ihre<br />
auch gesundheitlichen Folgen.<br />
! Mangelhafte Erziehungskompetenz der<br />
Eltern incl. Bindungsstörungen.<br />
! Zunehmende Gewalt innerhalb der<br />
Familien.
<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong> <strong>begleiten</strong> - <strong>fördern</strong> - <strong>schützen</strong><br />
T. Fischbach - Schutzauftrag Bundeskinderschutzgesetz<br />
Folgen der<br />
Kindesvernachlässigung…….<br />
! Zunahme von Verhaltens-/psychischen<br />
Störungen<br />
! - <strong>Kinder</strong> und Jugendliche: 18% bis 27%<br />
(Petermann et al., 2000)<br />
! - <strong>Kinder</strong>gartenkinder: ca. 18%<br />
(Hahlweg, & Miller, 2001)<br />
! - unter Dreijährige: ca. 20%<br />
(Remschmidt,1998)<br />
63
<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong> <strong>begleiten</strong> - <strong>fördern</strong> - <strong>schützen</strong><br />
64<br />
Frauenarzt<br />
Wer muss kooperieren?<br />
Hebamme<br />
<strong>Kinder</strong>klinik<br />
Geburtshilfe<br />
<strong>Kinder</strong>- und<br />
Jugendarzt<br />
Sozialpäd.<br />
Dienst<br />
Clearing-Stelle Jugendhilfe<br />
Ausgangssituation verbessern!<br />
! These 1:<br />
Viele Institutionen und Personen wissen<br />
etwas oder viel, aber selten genug von einer<br />
Mutter, einer Familie.<br />
! These 2:<br />
Durch eine konsequente Vernetzung der<br />
Akteure könn(t)en Risikofamilien und –kinder<br />
rechtzeitig(er) identifiziert und Hilfestellungen<br />
angeboten werden.
<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong> <strong>begleiten</strong> - <strong>fördern</strong> - <strong>schützen</strong><br />
T. Fischbach - Schutzauftrag Bundeskinderschutzgesetz<br />
BKiSchG birgt Chancen!<br />
! Gesundheitswesen als Türöffner der Jugendhilfe.<br />
! Dialogische Weiterbildung von Ärztinnen und<br />
Ärzten in Beratungsaufgaben schafft Kompetenzerweiterung.<br />
! <strong>Kinder</strong>schutzfachkraft kann Beratungsqualität<br />
des Arztes verbessern helfen (Lernen an der<br />
jeweils anderen Profession).<br />
! Erweiterung der mit dem Kindeswohl befassten<br />
gesellschaftlichen Gruppen/Institutionen.<br />
BKiSchG birgt Chancen!<br />
! Zugangswege des Gesundheitswesens nutzen.<br />
Die <strong>Kinder</strong>vorsorgeuntersuchung als Erkenntnisquelle<br />
potentieller Risikofaktoren.<br />
! Entstehung professionsübergreifender Unterstützungssysteme<br />
zwischen Gesundheitswesen<br />
und Jugendhilfe (z.B. Multicenterprojekt <strong>Kinder</strong>zukunft<br />
NRW).<br />
65
<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong> <strong>begleiten</strong> - <strong>fördern</strong> - <strong>schützen</strong><br />
66<br />
Und wo hakt es zwischen Gesundheits-diensten<br />
und Jugendhilfe?<br />
! Zeit für eine zielführende Kommunikation<br />
fehlt.<br />
! Gegenseitige Erreichbarkeit ist schwierig.<br />
! „etablierte“, d.h. persönliche/regionale Netze<br />
fehlen in der Fläche noch.<br />
! Mangel an gegenseitiger Akzeptanz und<br />
Wertschätzung. Gutachten werden nicht<br />
akzeptiert (...das muß der <strong>Kinder</strong>- und<br />
Jugendpsychiater machen...).
<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong> <strong>begleiten</strong> - <strong>fördern</strong> - <strong>schützen</strong><br />
Und wo hakt es zwischen Gesundheitsdiensten<br />
und Jugendhilfe?<br />
! Angst vor juristischen Problemen bei der<br />
Kooperation (Stichwort „Schweigepflicht).<br />
Rechtfertigender Notstand gem. § 34 StGB (Schutz<br />
höherrangiger Rechtsgüter), §§ 138 ff (Anzeige geplanter<br />
schwerer Straftaten) und §§ 9,10 IfSG (Meldepflicht).<br />
! Koordinationsinstanz fehlt weitgehend:<br />
1. Clearingstelle/Casemanagement.<br />
2. <strong>Kinder</strong>schutzbeauftragte<br />
3. Gemeinsame Fallbesprechungen<br />
4. KJGD als Mittlerinstanz<br />
T. Fischbach - Schutzauftrag Bundeskinderschutzgesetz<br />
Und wo hakt es zwischen Gesundheitsdiensten<br />
und Jugendhilfe?<br />
! Zuständigkeitsgerangel/-unkenntnis:<br />
Sozialgesetzbuch VIII § 8a: Schutzauftrag bei<br />
Kindewohlgefährdung:<br />
(1) Werden dem Jugendamt gewichtige<br />
Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls<br />
eines Kindes oder Jugendlichen bekannt, so<br />
hat es das Gefährdungsrisiko im<br />
Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte<br />
abzuschätzen............<br />
67
<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong> <strong>begleiten</strong> - <strong>fördern</strong> - <strong>schützen</strong><br />
68<br />
Und wo hakt es zwischen Gesundheitsdiensten<br />
und Jugendhilfe?<br />
! Sozialgesetzbuch VIII § 8a: Schutzauftrag bei<br />
Kindewohlgefährdung:<br />
(4) Soweit zur Abwendung der Gefährdung das<br />
Tätigwerden anderer Leistungsträger, Einrichtungen<br />
der Gesundheitshilfe...notwendig ist, hat das<br />
Jugendamt auf die Inanspruchnahme durch die<br />
Personensorgeberechtigten hinzuwirken. Ist ein<br />
sofortiges Tätigwerden erforderlich und wirken die<br />
Persornensorgeberechtigten nicht mit, so schaltet das<br />
Jugendamt die anderen zur Abwendung der<br />
Gefährdung zuständigen Stellen selbst ein.<br />
Und wo hakt es zwischen Gesundheitsdiensten<br />
und Jugendhilfe?<br />
! Wissen um spezielle Hilfsangebote und –<br />
möglichkeiten ist unzureichend.<br />
! Kenntnis über die gegenseitigen<br />
Arbeitsabläufe und –strategien ist<br />
unzureichend (good man – bad man).<br />
! Verbesserung der Kooperation durch<br />
gemeinsame Fortbildungen etc.<br />
! Unzureichende finanzielle wie personelle<br />
Ressource.
<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong> <strong>begleiten</strong> - <strong>fördern</strong> - <strong>schützen</strong><br />
T. Fischbach - Schutzauftrag Bundeskinderschutzgesetz<br />
Und wo hakt es zwischen Gesundheitsdiensten<br />
und Jugendhilfe?<br />
! Fehlende Korrespondenznorm im SGB V.<br />
! Kooperation mit der Jugendhilfe und Koordinierungsleistungen<br />
werden im SGB V nicht honoriert. Position<br />
der Krankenkassen?<br />
! Ärzte arbeiten im Rahmen von „Überweisungen“; hier<br />
muss eine Systemverträglichkeit mit der Jugendhilfe<br />
hergestellt werden.<br />
! Unterschiedliche Vorstellungen von Handlungskaskaden<br />
zwischen JH und Gesundheitswesen bei Vd. auf<br />
Kindeswohlgefährdung (z.B. Kontaktaufnahme zum ASD).<br />
! Prozessorientierung in der Jugendhilfe vs. „Symptomlösungsorientierung“<br />
im Gesundheitswesen.<br />
Und wo hakt es zwischen Gesundheitsdiensten<br />
und Jugendhilfe?<br />
! Beratung durch eine „insoweit erfahrene<br />
Fachkraft“. Mehr Fragen als Antworten:<br />
- Qualifikation und Qualifizierung?<br />
- Was tut diese Fachkraft?<br />
- Spannungsfeld Leistungsmöglichkeit der Fach-<br />
kraft und Erwartungen des Arztes.<br />
! Vertrauensverhältnis Arzt-Patient; Doktorhopping.<br />
69
<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong> <strong>begleiten</strong> - <strong>fördern</strong> - <strong>schützen</strong><br />
70<br />
Wir brauchen ein neues Teamverständnis bei<br />
den Akteuren – mehr Miteinander zwischen<br />
Gesundheitsdiensten und Jugendhilfe
<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong> <strong>begleiten</strong> - <strong>fördern</strong> - <strong>schützen</strong><br />
Virginia Dellbrügge<br />
Hochschule Osnabrück<br />
V. Dellbrügge - Gelingende Vernetzung im Sozialraum<br />
Forum 4: Gelingende Vernetzung im Sozialraum gemeinsam<br />
entwickeln<br />
Seit 2007 werden im Rahmen des Aktionsprogramms „Frühe Hilfen für Familien und soziale<br />
Frühwarnsysteme“ – initiiert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen<br />
und Jugend (BMFSFJ) und begleitet vom Nationalen Zentrum Frühe Hilfen (NZFH) – Unterstützungssysteme<br />
für Schwangere und Eltern mit <strong>Kinder</strong>n unter drei Jahren sowie deren<br />
wissenschaftliche Begleitung gefördert. Frühe Hilfen zielen darauf ab, Entwicklungsmöglichkeiten<br />
von <strong>Kinder</strong>n und Eltern frühzeitig zu verbessern. Ein wesentliches Element<br />
dieser Hilfen ist der Versuch, vorhandene Angebote zu koordinieren: Eine Vernetzung von<br />
Gesundheitshilfe (Gynäkologen, Schwangerschaftsberatungsstellen, Hebammen, Geburtskliniken,<br />
<strong>Kinder</strong>kliniken, <strong>Kinder</strong>ärzte) und <strong>Kinder</strong>- und Jugendhilfe ist Kernelement der<br />
Hilfen. Die Forschungsergebnisse der Netzwerkanalyse der wissenschaftlichen Begleitung<br />
„Frühe Hilfe für Familien und soziale Frühwarnsysteme in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein“<br />
(2007-2010) zeigen, dass gut überschaubare engere Kooperationssysteme<br />
praktikabel und ausreichend sind. Vor dem Hintergrund des jeweiligen Kontext einer<br />
Frühen Hilfe und den daraus resultierenden Bedarfen zur Unterstützung der Zielgruppen<br />
ist es empfehlenswert, Schwerpunkte zu setzen und das Potential einer kleinen Gruppe<br />
von direkten ergänzenden indirekten Netzwerkpartnern zu ergründen und zu nutzen. Bei<br />
der Frage, welche Kooperationsformen die Zufriedenheit der Helfer mit ihrer Tätigkeit (die<br />
bedingt überhaupt erst die Qualität der Hilfeleistung und die Kooperationsbereitschaft der<br />
Fachkräfte) und der Eltern mit den Angeboten Früher Hilfen (Zufriedenheit der Eltern mit<br />
dem Helfer und der Hilfeleistungen sind ein Prädiktor für positive Hilfeeffekte) begünstigen,<br />
lässt sich folgendes festhalten: In Netzwerken, in denen der Großteil der Beziehungen dem<br />
Austausch dient und Beziehungen zur konzeptionellen Auseinandersetzung unterhalten<br />
71
<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong> <strong>begleiten</strong> - <strong>fördern</strong> - <strong>schützen</strong><br />
72<br />
werden, weisen die Helfenden in den Frühen Hilfen tendenziell eine höhere Zufriedenheit<br />
auf. In den Konzeptionen Früher Hilfen werden hingegen die Fallvermittlung und noch mehr<br />
die gemeinsame Arbeitsorganisation mit dem Ziel einer passgenauen und multidimensionalen<br />
Unterstützung für die Familien hervorgehoben. Mit Blick auf diese Ergebnisse ist<br />
dafür zu plädieren, den Nutzen eines informellen Austausches der Netzwerkpartner nicht<br />
zu vernachlässigen ist. Zudem ist darauf zu achten, die Beteiligten in die Entwicklung von<br />
Konzeptionen und Auseinandersetzung um die Ausgestaltung Früher Hilfen einzubinden.<br />
Es ist daher für die Ausgestaltung der Zusammenarbeit in Frühen Hilfen eine Mischung<br />
verschiedener Kooperationsformen zu empfehlen. Auch die wichtige Rolle eines Projektmanagements<br />
konnte in dieser Untersuchung bestätigt werden. Es kann jedoch in Frage<br />
gestellt werden, ob diese Position tatsächlich in einer Person verortet sein müsste. Als<br />
Empfehlung wird eine Verteilung der Koordinationstätigkeiten auf unterschiedliche Akteure<br />
mit unterschiedlichen Positionen innerhalb des Netzwerks angeboten, um so ein Maximum<br />
an fachlichen Ressourcen in die Unterstützung der Zielgruppe Früher Hilfen einzubinden.<br />
�������<br />
� ������������������������������������������������������<br />
� �����������������������������������������������������<br />
�����������������������������������������������������<br />
�����������������������������������������������������<br />
��������
<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong> <strong>begleiten</strong> - <strong>fördern</strong> - <strong>schützen</strong><br />
������������������������<br />
���������������������<br />
�������<br />
����������������������<br />
����������������������<br />
� ���������������������������<br />
� ������������������������<br />
��������������������<br />
� ���������������������������<br />
� ������������������<br />
� �������������������<br />
� ����������������������<br />
� ������������<br />
����������� ����������������������<br />
� �������������������������<br />
� ����������������������������������<br />
� ������������������������<br />
� �������������������<br />
V. Dellbrügge - Gelingende Vernetzung im Sozialraum<br />
�����<br />
���������<br />
����<br />
�������<br />
�������<br />
����<br />
�������<br />
��� ���<br />
��������<br />
������<br />
�������<br />
73
<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong> <strong>begleiten</strong> - <strong>fördern</strong> - <strong>schützen</strong><br />
74<br />
���������<br />
����������<br />
���������������������������������<br />
�������<br />
�����������������������������������<br />
����������������������������������<br />
������������������������������������<br />
����������������������<br />
�����������������������������<br />
��������������������������������<br />
������������������������������������������<br />
�����������������������������������<br />
�����������������������������������������<br />
�������������������������������<br />
����������������������������������������<br />
��������<br />
�������������<br />
����<br />
���������������<br />
������������<br />
��������������������������������������<br />
��<br />
�� ��<br />
��<br />
� �����������������<br />
�� ���������������<br />
���������������<br />
� ���������������������
<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong> <strong>begleiten</strong> - <strong>fördern</strong> - <strong>schützen</strong><br />
����������������������������������������<br />
������������������������������������<br />
����������������������<br />
����������������<br />
�����������������������������������<br />
��������������������������������������������<br />
����������������������������������<br />
�����������������������������������<br />
������� ����<br />
�����������<br />
����������<br />
��������<br />
��������<br />
������������<br />
�����<br />
�������������<br />
������������<br />
�����������������<br />
�������<br />
�������������<br />
V. Dellbrügge - Gelingende Vernetzung im Sozialraum<br />
���������<br />
�������<br />
����������<br />
��������<br />
���������<br />
����������������������������<br />
�������������������������������������<br />
75
<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong> <strong>begleiten</strong> - <strong>fördern</strong> - <strong>schützen</strong><br />
76<br />
�����������������������������������<br />
�����������������������������������<br />
�������<br />
������������������� �������������������������������������������������������<br />
������������������<br />
����������������<br />
����������� �����������<br />
����������������������������<br />
�����������������������<br />
�������������<br />
���������������<br />
��������������������������������������<br />
�������������������<br />
������������������<br />
�������������������<br />
�����������������������������<br />
������������
<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong> <strong>begleiten</strong> - <strong>fördern</strong> - <strong>schützen</strong><br />
�����������������������������������<br />
��������������������������<br />
�������������<br />
�������������������<br />
����������������������<br />
���������������� ������������������<br />
�����������<br />
����������������<br />
�����������<br />
�����������<br />
���������������<br />
�������������������<br />
��������������������������<br />
����������������<br />
��������<br />
��������<br />
�����������<br />
����������������������������<br />
�����������<br />
�������� ��������������������������������������������<br />
�����������������������������������<br />
����������������<br />
����������������<br />
�����������<br />
�����������<br />
��������������������������<br />
�������������<br />
�������������������<br />
���������������<br />
����������������������<br />
������������������<br />
�����������<br />
�������������������<br />
V. Dellbrügge - Gelingende Vernetzung im Sozialraum<br />
��������������������������<br />
����������������<br />
��������<br />
��������<br />
�����������<br />
����������������������������<br />
�����������<br />
�������� ��������������������������������������������<br />
77
<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong> <strong>begleiten</strong> - <strong>fördern</strong> - <strong>schützen</strong><br />
78<br />
�������������<br />
� ������������������������������������������������������������<br />
�����������������<br />
� �����������������������������������������������������������<br />
������������������������������������������������������<br />
� ������������������������� ���������������������������������<br />
� ������������������������������������������������������<br />
� �������������������������������������������<br />
� ���������������������������������������������������������<br />
� ���������������������������������������������������<br />
���������������������������<br />
� �������������������������� ������������������������������<br />
��������������<br />
���������������������������������<br />
��������� ���������<br />
����������<br />
��������<br />
��������������<br />
��������<br />
�������<br />
������������<br />
��������������<br />
��������<br />
���������
<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong> <strong>begleiten</strong> - <strong>fördern</strong> - <strong>schützen</strong><br />
����������������������������������<br />
��������������������<br />
� ���������������<br />
� �������������������������<br />
� ��������������������������������<br />
������������������<br />
����������������������<br />
�������������<br />
�����������������������<br />
�����������������<br />
��������������������������������<br />
������������������������<br />
� ������������������������<br />
� �����������������������<br />
�����������������������������<br />
� �����������������������<br />
�����������������������������<br />
� ������������������������������<br />
V. Dellbrügge - Gelingende Vernetzung im Sozialraum<br />
�������������������������<br />
�����������<br />
����������������������<br />
���������������<br />
79
<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong> <strong>begleiten</strong> - <strong>fördern</strong> - <strong>schützen</strong><br />
80<br />
���������������<br />
� �������������������������������������������������<br />
� �����������������������������������������<br />
� ��������������������������������������������������<br />
�� ����������������������������������������<br />
����������������������������������������<br />
� ����������������������������������������������������������������<br />
� �������������������������������������������������������<br />
���������������������<br />
��������������<br />
��������<br />
��������<br />
��������������������<br />
���������������������������
<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong> <strong>begleiten</strong> - <strong>fördern</strong> - <strong>schützen</strong><br />
<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong><br />
<strong>begleiten</strong> – <strong>fördern</strong> -‐ <strong>schützen</strong><br />
Das Auswertungsplenum<br />
Das Auswertungsplenum<br />
81
<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong> <strong>begleiten</strong> - <strong>fördern</strong> - <strong>schützen</strong><br />
82<br />
Impulsfilm:
<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong> <strong>begleiten</strong> - <strong>fördern</strong> - <strong>schützen</strong><br />
Feedbackgruppen:<br />
1. Vom Kind aus denken<br />
„Wünsche für Münster - Was brauchen Sie für eine gelingende Präventionsarbeit?“<br />
- Perspektive/Rechte/Potenziale des Kindes in den Mittelpunkt<br />
- Interesse an der Entwicklung des Kindes<br />
- Teilnahme am Kind/am Leben des Kindes<br />
- Finanzielle Absicherung der Familienhebammen!!<br />
- Kooperationen für die <strong>Kinder</strong> und Familien und nicht für die Institutionen<br />
2. Begriffe definieren und Ziele benennen<br />
„Wünsche für Münster - Was brauchen Sie für eine gelingende Präventionsarbeit?“<br />
- gemeinsames Begriffsverständnis erarbeiten<br />
- Gemeinsame Definitionen/Standards und diesbezüglich Fortbildungen<br />
- klare Definitionen von Netzwerken, Kindesschutz, frühe Hilfen<br />
- klare Zuständigkeiten<br />
- Begriffsbestimmungen: Hebamme/Familienhebamme<br />
- Ziele definieren<br />
- Einheitliches Verständnis von Prävention & <strong>Kinder</strong>schutz<br />
Das Auswertungsplenum<br />
83
<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong> <strong>begleiten</strong> - <strong>fördern</strong> - <strong>schützen</strong><br />
3. Zeit<br />
84<br />
„Wünsche für Münster - Was brauchen Sie für eine gelingende Präventionsarbeit?“<br />
-zeitliche Ressourcen<br />
- Zeit für Klienten, Beziehungsarbeit, Vernetzungen in der Jugendhilfe<br />
- Mehr Arbeitszeit<br />
- Kreative Handlungsspielräume<br />
4. Netzwerke koordinieren<br />
„Wünsche für Münster - Was brauchen Sie für eine gelingende Präventionsarbeit?“<br />
- funktionierende, tragfähige Netzwerke<br />
- WER steuert WAS?<br />
- d.h. WO laufen die Fäden zusammen? (Netzwerkbezogen)<br />
- Auflösung von Versäulung<br />
- Zentrale Koordination, kurze Dienstwege, unbürokratrische Zusammenarbeit<br />
- mehr Raum für „Kreativität“<br />
- Die stadtweite Koordination der Bereiche Gesundheit, Justiz, Sozialhilfe<br />
und Jugendhilfeplanung<br />
- multiprofessionelle Teams
<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong> <strong>begleiten</strong> - <strong>fördern</strong> - <strong>schützen</strong><br />
5. Wissenstransfer - Wer macht was?<br />
„Wünsche für Münster - Was brauchen Sie für eine gelingende Präventionsarbeit?“<br />
- ein stadtweiter Ressourcencheck<br />
- Internetauftritt „Frühe Hilfen“/Online-Bündelung von Angeboten/Datenbank<br />
- Öffentlichkeitsarbeit: Bekanntheit/Akzeptanz<br />
- Anerkennung der Schwangerschaftsberatung als Akteure früher Hilfen<br />
- Wissen über bestehende Angebote und vorhandene Kompetenzen/Transparenz<br />
- klare Übersicht über mögliche Netzwerke<br />
6. Vom Projekt zur Nachhaligkeit<br />
„Wünsche für Münster - Was brauchen Sie für eine gelingende Präventionsarbeit?“<br />
- Struktur statt Projekte finanzieren<br />
- Abkehr von Projekten -> Hin zur langfristigen Arbeit (Nachhaltigkeit)<br />
- Verbindliche, dauerhafte Strukturen zur Unterstützung von Eltern<br />
(z.B. mehr Familienzentren, Zugänge ermöglichen)<br />
- starkes Jugendamt (=mutig, offensiv, gestaltungsbereit)<br />
Das Auswertungsplenum<br />
85
<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong> <strong>begleiten</strong> - <strong>fördern</strong> - <strong>schützen</strong><br />
86<br />
Rückmeldung aus den Fachforen:<br />
Forum 1:<br />
Frühe Hilfen als Prävention gegen <strong>Kinder</strong>armut?<br />
- Bessere Zusammenarbeit zwischen <strong>Kinder</strong>- und Jugendhilfe und Gesund-<br />
heitssystem, insbesondere mit den <strong>Kinder</strong>ärzten<br />
- Ausreichend Kitaplätze, insbesondere im U3-Bereich<br />
- Der politische Wille (auch auf kommunaler Ebene) Mittel umzuverteilen<br />
= Teilhabe für alle ermöglichen!<br />
- Einkommensschwachen Familien Teilhabe ermöglichen z.B. durch<br />
Quersubvention als höhere Belastung für solvente Familien<br />
Forum 2:<br />
Einblicke in das Forschungsprojekt zu Elternbesuchsdiensten des ISA e.V.<br />
- In einzelnen Münsteraner Stadtteilen finden die Baby-Begrüßungsbesuche<br />
im Tandem statt. Jeweils ein/eine MA des Jugendamtes und eine Hebam-<br />
me besuchen die Eltern gemeinsam. Dies hat zu einem positiven Effekt<br />
hinsichtlich der elterlichen Bereitschaft geführt, Besuche anzunehmen.<br />
- Im Hinblick auf die Themen Datenschutz und Schweigepflicht wünschen<br />
sich die Forumsteilnehmerinnen mehr Handlungssicherheit für schwierige<br />
Besuche, in denen Fragen des <strong>Kinder</strong>schutzes berührt werden.<br />
- Mit „wie kriege ich die Frauen ins Dorf?“ wurde die Schwierigkeit benannt,<br />
die Eltern zur aktiven Annahme von Beratungs- oder Bildungsangeboten<br />
zu bewegen. Hier fehlt es noch an guten Ideen/Strategien.<br />
- Mehr zeitliche Ressourcen wünschten sich die Forumsteilnehmerinnen für<br />
die Verankerung der Willkommensbesuche in den Stadtteilen. Hierfür sei<br />
Netzwerkarbeit durch die Besucherinnen erforderlich und Zeit, um sich<br />
Kenntnisse über Strukturen und Angebote im Stadtteil anzueignen.
<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong> <strong>begleiten</strong> - <strong>fördern</strong> - <strong>schützen</strong><br />
Das Auswertungsplenum<br />
Forum 3:<br />
Schutzauftrag durch das Bundeskinderschutzgesetz: Herausforderung<br />
für die Zusammenarbeit der Fachkräfte aus Jugendhilfe und Gesundheitswesen<br />
In der Diskussion im Fachforum wurde deutlich, dass es „die“ Jugendhilfe und<br />
„das“ Gesundheitswesen nicht gibt. Es gab einerseits Meinungen und Beobachtungen<br />
im Fachpublikum, dass die Kooperation mit den <strong>Kinder</strong>- und Jugendmedizinern<br />
gut funktioniert; andere berichteten, dass die Kooperation mit<br />
den <strong>Kinder</strong>ärzten schwierig sei. Es ist eine konkrete und differenzierte Betrachtung<br />
notwendig.<br />
Interessant waren in der Diskussion die unterschiedlichen Beispiele guter Kooperation:<br />
- In einer Kita in Münster wird eine Hebammensprechstunde angeboten.<br />
- Der DKSB in Münster bietet niedrigschwellige Beratung an, an die ein<br />
<strong>Kinder</strong>arzt/eine <strong>Kinder</strong>ärztin verweisen kann, wenn bei Patient(inn)en ein<br />
pädagogisches Angebot sinnvoll ist.<br />
- Dr. Fischbach berichtete, dass es in jeder Stadt einen Qualitätszirkel der<br />
<strong>Kinder</strong>ärzte/-ärztinnen gibt, in dem die Idee des Zusammenwirkens von<br />
Jugendhilfe und Gesundheitswesen diskutiert und in die Breite getragen<br />
werden kann und soll.<br />
Das Fachplenum diskutierte ebenso über Stolpersteine in der Kooperation.<br />
- Dr. Fischbach verdeutlichte, dass es für <strong>Kinder</strong>- und Jugendärzte eine<br />
Hürde darstellt, dass grundsätzlich Leistungen im Zusammenhang mit<br />
Kooperation mit der Jugendhilfe über die Krankenkassen nicht abgerech-<br />
net werden können.<br />
- Im Plenum wurden unterschiedliche Zugangsmöglichkeiten der Jugend-<br />
hilfe und des Gesundheitswesens zu sog. bildungsfernen Eltern thema-<br />
tisiert und wie eine Zusammenarbeit beider Systeme die Zugang erleich-<br />
tern kann.<br />
In der vielschichtigen Trägerlandschaft in Münster wird es viele weitere Beispiele<br />
einer guten Zusammenarbeit zwischen Jugendhilfe und Gesundheitswesen<br />
geben, und es werden weitere Hürden zu bewältigen sein. Es lohnt für alle<br />
Beteiligten, sich hier einen Überblick zu verschaffen. Wie diese Gelegenheit<br />
des Austausches aussehen und organisiert werden könnte, wäre ein nächster<br />
Arbeitsschritt.<br />
87
<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong> <strong>begleiten</strong> - <strong>fördern</strong> - <strong>schützen</strong><br />
Forum 4:<br />
Gelingende Vernetzung im Sozialraum gemeinsam entwickeln<br />
- Vernetzung zu <strong>Kinder</strong>schutz und Frühen Hilfen soll an bestehende Struk-<br />
turen anknüpfen. Insbesondere die Stadtteilrunden und AG´s nach §78<br />
SGB VIII sollen einbezogen und genutzt werden.<br />
- Um eine gemeinsame Sprache zu finden, soll in den verschiedenen Gre-<br />
mien ein regelmäßiger Austausch zu den Begriffen „<strong>Kinder</strong>schutz“, „Frühe<br />
Hilfen“ und „Prävention“ stattfinden.<br />
- Präventionskonferenzen wie diese sollen einmal im Jahr als Austausch-<br />
und Kontaktforum für alle in den Bereichen tätigen Fachkräfte etabliert<br />
werden.<br />
- Vernetzung soll kein Selbstzweck sein, sondern der aktiven Auseinan-<br />
dersetzung mit bestimmten Themen oder der Umsetzung konkreter Vor-<br />
haben dienen. Parallelstrukturen sollen möglichst vermieden werden.<br />
Hierfür braucht es Koordination.<br />
88
<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong> <strong>begleiten</strong> - <strong>fördern</strong> - <strong>schützen</strong><br />
<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong><br />
<strong>begleiten</strong> – <strong>fördern</strong> -‐ <strong>schützen</strong><br />
Die Pressemitteilungen<br />
89
enz <strong>Starke</strong> mit 180 Teilnehmern <strong>Kinder</strong> : Die<br />
<strong>begleiten</strong><br />
Stadt will<br />
- <strong>fördern</strong><br />
starke<br />
- <strong>schützen</strong><br />
<strong>Kinder</strong> - Münster... http://www.wn.de/Muenster/Konferenz-<br />
90<br />
!"#$%&%#'()*+(,-.(/%*0#%1)%&#<br />
23#4+%&(5(,-.(2%#461%#(#71)%#(7)(8"##%&4+79(7#(:%&(!"#$%&%#'(;(+%*0?('#",$)5:;$"5,51$7'#5,8$7'))<br />
4#34-$1(4"#$Y,)64-"$7"#$*',7&(,1)D"7'#0$1#3Z$5)4?<br />
H(,7$[W$B#3-",4$'&&"#$%5,7"#$&"D",$(,4"#$(,1E,)451",$P"75,1(,1",8$;"5Z4$")?$I",7",-$)4"51",7?$Y&)3<br />
+E))"$+',$75")"$%5,7"#$23#$'&&"+$73#4$"##"5:;",8$>3$)5"$'+$(,+544"&D'#)4",$D"4#"(4$>"#7",O$5,$7",<br />
N'+5&5",?$N'+5&5",0/#7"#(,1$'&&"#75,1)$5#4):;'04&5:;"<br />
.,4>5:9&(,1$7"#$.&4"#,;6()"#$4(,?$@Y&&"$%5,7"#$)5,7$'(0$N'+5&5",$',1">5")",8$75"$5,$\"4->"#9"<br />
"5,1"D"44"4$)5,7C8$+"5,4$%&'()$*(##"&+',,?$S"#$4#'75453,"&&"$!3;&0';#4))4''4$)43Z"$7'D"5$',$)"5,"<br />
]#",-",?<br />
!5:;451$)"58$7'))$)5:;$'&&"$"5,51$)5,7$(,7$1"+"5,)'+$;',7"&,O$23,$7"#$N'+5&5",;"D'++"$ED"#$75"$%54'<br />
D5)$-(#$G:;(&"?$P5)$-(#$B3&5-"58$>",,$")$)"5,$+())?$%&5,14$)"&D)42"#)46,7&5:;8$5)4$")$'D"#$,5:;4?$K5"&"<br />
I"5&,";+"#$D"9",,",$0#"5+E4518$7'))$75"$K"#-';,(,1$7"#$A,)454(453,",$'(:;$5,$RE,)4"#$,5:;4<br />
#"5D(,1)&3)$9&'MM48$7'))$")$.50"#)E:;4"&"5",$"5,-"&,"#$P"#(0)1#(MM",$(,7$%3+M"4",-1"#',1"&$15D4?<br />
R54(,4"#$):;"54"#4$75"$L()'++",'#D"54$):;&5:;4$7'#',8$7'))$+',$)5:;$,5:;4$1(4$9",,4?<br />
RE,)4"#$)"5$'&&"#75,1)$'(0$"5,"+$1(4",$!"18$&3D4"$%&'()$*(##"&+',,^$):;3,$"5,"$%3,0"#",-$>5"$75")"<br />
)"5$1',-$'(Z"#1">/;,&5:;?$S')$5)4$!'))"#$'(0$75"$RE;&",$23,$R'#9()$=">"8$7"#$23,$@"5,"+$7"#<br />
>5:;451)4",$M3&545):;",$I;"+",$5,$RE,)4"#C$)M#5:;4?
<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong> <strong>begleiten</strong> - <strong>fördern</strong> - <strong>schützen</strong><br />
Freitag, 23. März 2012<br />
91
<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong> <strong>begleiten</strong> - <strong>fördern</strong> - <strong>schützen</strong><br />
92<br />
Netzwerk für “<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong>”<br />
Allen Mädchen und Jungen dieser Stadt einen guten Start ins Leben zu geben – das ist<br />
Anliegen der Präventionskonferenz “<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong>”. Rund 150 Fachkräfte aus dem Gesundheitswesen<br />
und der Jugendhilfe aus Münster werden dazu am 22.03.2012 erwartet.<br />
Im Mittelpunkt von Vorträgen und Fachforen stehen die “frühen Hilfen” für Familien mit ihren<br />
<strong>Kinder</strong>n. “Begleiten – Fördern – Schützen” heißt es im Untertitel der Konferenz, die auf eine<br />
Initiative von Oberbürgermeister Markus Lewe zurückgeht. “<strong>Kinder</strong>, die unter benachteiligten<br />
Bedingungen heranwachsen, bedürfen unserer besonderen Aufmerksamkeit und einer frühzeitigen<br />
Unterstützung”, erklärt der OB “<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong>” zu einem zentralen Zukunftsthema.<br />
So soll die Konferenz im Sinne einer kindbezogenen Präventionsstrategie auch die Zusammenarbeit<br />
und Vernetzung von Akteuren aus Medizin, Gesundheit und Jugendhilfe weiter<br />
<strong>fördern</strong>.<br />
Gemeinsame Ausrichter der Tagung sind das Amt für <strong>Kinder</strong>, Jugendliche und Familien und<br />
das Institut für soziale Arbeit (ISA). Ihnen ist es gelungen, namhafte Experten als Gastredner<br />
zu gewinnen. Der renommierte Sozialwissenschaftler und Jugendforscher Prof. Dr. Klaus<br />
Hurrelmann (Hertie School of Governance, Berlin) spricht zur “Bedeutung der frühen Jahre”.<br />
Offensiven und defensiven <strong>Kinder</strong>schutz beleuchtet Prof. Dr. Holger Ziegler (Universität<br />
Bielefeld). Chancen und Herausforderungen des neuen Bundeskinderschutzgesetzes nehmen<br />
Prof. Dr. Reinhold Schone (FH Münster) und Dr. Thomas Fischbach (Berufsverband<br />
der <strong>Kinder</strong>- und Jugendärzte NRW) in den Blick. Weitere Fachforen am Nachmittag vertiefen<br />
ausgewählte Aspekte. So hinterfragt Gerda Holz (Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik,<br />
Frankfurt) die frühen Hilfen als Prävention gegen <strong>Kinder</strong>armut.<br />
Durch das Programm führt der Redakteur Klaus Bellmund. Veranstaltungsort sind die Stadtwerke<br />
Münster. Anmeldungen für die Präventionskonferenz sind ausschließlich online bis<br />
zum 08.03.2012 möglich an das Institut für soziale Arbeit, www.isa-muenster.de/veranstaltungen.<br />
Quelle: http://www.muensteranerbote.de/muenster/netzwerk-fuer-starke-kinder/17379
<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong> <strong>begleiten</strong> - <strong>fördern</strong> - <strong>schützen</strong><br />
93
<strong>Starke</strong> <strong>Kinder</strong> <strong>begleiten</strong> - <strong>fördern</strong> - <strong>schützen</strong><br />
Mit freundlicher Unterstützung von:<br />
94