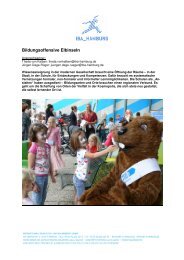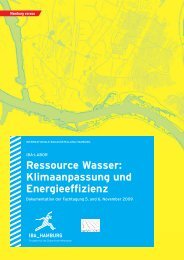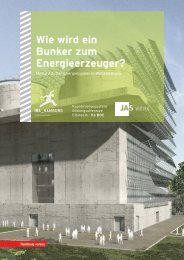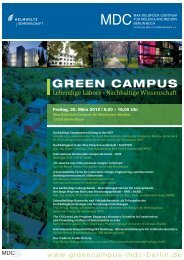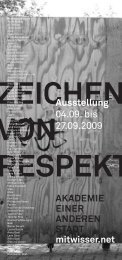AkADemie einer AnDeren stADt mitwisser.net - IBA Hamburg
AkADemie einer AnDeren stADt mitwisser.net - IBA Hamburg
AkADemie einer AnDeren stADt mitwisser.net - IBA Hamburg
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Zeichen von<br />
respekt<br />
AussteLLung<br />
nevin Aladag<br />
berlin<br />
familie tezcan<br />
Video, 2001<br />
Stills aus „Familie Tezcan“, courtesy/© Nevin Aladag<br />
Die Tezcans sind eine außerordentliche<br />
Familie. Vater, Mutter, die beiden Töchter und<br />
der kleine Sohn sind alle Tänzer. Was man<br />
beim ersten Blick auf die türkischstämmige<br />
Familie aus Stuttgart nicht ahnt, ist, wie<br />
leidenschaftlich gern und gut sie tanzen.<br />
Unvermutet entpuppt sich der Vater als<br />
ausgezeich<strong>net</strong>er Breakdancer und die Mutter<br />
verbindet professionell kurdische Folklore<br />
mit Disco-Tanzschritten. Die beiden Mädchen<br />
tanzen Karaoke singend zu Popsongs, und<br />
der kaum den Windeln entwachsene Sohn<br />
geht mit dem Papa zu Hiphop-Klängen auf<br />
die Tanzfläche.<br />
Das Video versetzt seine Betrachter/innen in<br />
Bewegung. Die Tezcans werden zum Vorbild<br />
für eine Zukunft, in der die Grenzen wie die<br />
Überschneidungen verschiedener Kulturen<br />
und Traditionen im einzelnen Menschen<br />
balanciert werden und nicht mehr trennend<br />
zwischen Menschen verschiedener<br />
Herkunftsorte verlaufen.<br />
Auch in ihren anderen Arbeiten konzentriert<br />
sich Nevin Aladag auf Musik und Tanz als<br />
Ausdrucksformen von kultureller Identität.<br />
Sie sucht nach den Freiräumen für unerwartet<br />
andere Artikulationen in urbanen Räumen.<br />
Über die Präsentation ihrer Arbeit hinaus<br />
ist sie deshalb auch an die Akademie <strong>einer</strong><br />
anderen stadt eingeladen, um ein neues<br />
Tanz-Video-Stück mit Bewohner/innen der<br />
Elbinseln zu entwickeln. (U.V.)<br />
Antoine beuger<br />
Düsseldorf<br />
stimmen hören<br />
Projekt für die Gesamtschule Rolandstraße<br />
Düsseldorf<br />
Sound Installation, 2004<br />
Antoine Beuger, 2005, © Sylvia Kamm-Gabathuler<br />
Antoine Beuger präsentiert mit „stimmen<br />
hören“ ein Projekt mit der Gesamtschule<br />
Rolandstraße Düsseldorf, das seit dem Jahr<br />
2004 läuft.<br />
Das Schulgebäude wurde der Idee nach als<br />
ein Gesamtkunstwerk konzipiert. Bau, Kunst<br />
und Umfeld durchdringen sich und bilden<br />
ein durchgestaltetes Ganzes, das zwar eine<br />
große innere Transparenz und Großzügigkeit<br />
aufweist, sich aber gleichzeitig nach außen<br />
zu verschließen scheint.<br />
Das Projekt soll eine versöhnende, aufweichende,<br />
freimachende Geste sein, die<br />
<strong>einer</strong>seits die Architektur etwas zurückweichen<br />
lässt, um Anderem – der menschlichen<br />
Stimme, den Körpern – Raum zu geben, und<br />
andererseits den Menschen die Möglichkeit<br />
bietet, sich mit ihren Stimmen die Architektur<br />
bestimmend zu erleben.<br />
Das Projekt „stimmen hören“ erstreckt sich<br />
mittlerweile über einen Zeitraum von fünf<br />
Jahren. Jedes Jahr werden in Form von<br />
jeweils <strong>einer</strong> Unterrichtsstunde pro Klasse<br />
die Stimmen aller Kinder sowie des Lehr- und<br />
Verwaltungspersonals der Schule aufgenommen.<br />
Jeder spricht mit ruhiger Stimme den<br />
Satz: „Ich heiße … (Vorname und Nachname)<br />
und ich bin … Jahre alt.“ Es wird jeweils eine<br />
CD erstellt, auf der alle Stimmen in <strong>einer</strong><br />
zufälligen Reihenfolge zu hören sind.<br />
An einem schulfreien Tag pro Jahr wird das<br />
Stück über einen Zeitraum von 7 Stunden aus<br />
vielen Lautsprechern als Klanginstallation in<br />
der ganzen Schule aufgeführt: Die Stimmen<br />
sind überall. Die gleichzeitig eingespielten,<br />
sehr leisen Instrumentalklänge erzeugen eine<br />
ruhige, konzentrierte Atmosphäre. (A.B.)<br />
bunny hood<br />
hh mümmelmannsberg<br />
Video, 2006<br />
Das Video entstand in <strong>einer</strong> einwöchigen<br />
Projektarbeit der KurzFilmSchule. Ausgangspunkt<br />
des Workshops war die Auseinandersetzung<br />
mit <strong>einer</strong> ZDF-Reportage, in<br />
der Jugendliche und Schüler aus Mümmelmannsberg<br />
als besonders kriminell dargestellt<br />
wurden. Vor Beginn des Workshops<br />
wurde in der Schule diese negative und<br />
zum Teil falsche Berichterstattung analysiert.<br />
In der Projektwoche realisierten die<br />
in drei Gruppen aufgeteilten Schüler/innen<br />
mit verschiedenen Schwerpunkten kleine<br />
Videosequenzen. Sie interviewten Passanten,<br />
inszenierten eine Redaktionssitzung, experimentierten<br />
mit Bild und Ton und setzten<br />
sich auf diese Art auch künstlerisch mit dem<br />
Medium auseinander. Ziel war es, trotz Gruppenaufteilung<br />
ein gemeinsames Video fertig<br />
zu stellen. Bei täglicher Sichtung wurden die<br />
Aufnahmen mit allen besprochen und übergreifende<br />
Pas sagen entwickelt. Beim Schnitt<br />
des Materials entstanden Sequenzen, die in<br />
Absprache während der letzten Schnittphase<br />
von den Anleiter/innen zu einem Video<br />
zusammengestellt wurden.<br />
beteiligte schüler/innen: Diva Akari, Christian<br />
Böhm, Sugandi Duesperan, Freschta Dugmale,<br />
Maria Gorni, Seydi Güzel, Schabnam<br />
Hayda, Nathalie Jansen, Sven Johannsen,<br />
Semra Karatasch, Shirin Homann Saadat, Bomera<br />
Pulitsch, Sanja Qaderi, Pana Salewiandi,<br />
Benjamin Stölzel, Natascha Stur, Khatera<br />
Wali. Anleitung: Arne Bunk, Dorothea Carl,<br />
Julia Kapelle in Kooperation mit den Lehrern<br />
Volker Krane und Klaus Ebel, Gesamtschule<br />
Mümmelmannsberg <strong>Hamburg</strong><br />
Still aus „Bunny Hood“, 2006, courtesy/© KFS <strong>Hamburg</strong><br />
Dorothea carl<br />
hamburg<br />
zwischen welten<br />
Videoinstallation, 2009<br />
Frauen mit Migrationshintergrund geben<br />
Einblick in ihre Welt zwischen verschiedenen<br />
Kulturen. In Deutschland geboren, als Gastarbeiterkind<br />
oder Kriegsflüchtling zugezogen,<br />
als Spätaussiedlerin in <strong>Hamburg</strong> wohnhaft.<br />
Die Biographien sind vielfältig.<br />
In neutraler Studioatmosphäre schildern<br />
Frauen ihre Erfahrungen und Konflikte in<br />
Familie, Schule, Ausbildung und Gesellschaft.<br />
Zwischen unterschiedlichen Rollenvorstellungen<br />
balancierend, gegen Zuschreibungen<br />
kämpfend – die Protagonistinnen erzählen<br />
von Lebenssituationen, in denen Globalisierung<br />
persönlich greifbar wird.<br />
„zwischen welten“ zeigt eine Reihe von Portraits,<br />
die das Leben in <strong>einer</strong> multikulturellen<br />
Gesellschaft vielschichtig hinterfragen. Die<br />
Protagonistinnen sind: Zeynep Acar, Betoul<br />
Barouni, Hülya Bayram, Elisabeth Becker, Maria<br />
Eisenach, Shirin Homann-Saadat, Aysel<br />
Kesen, Gwladys Plesch, Sanja Qaderi. (D.C.)<br />
„zwischen welten“ veranschaulicht Dorothea<br />
Carls Arbeitsweise, mit der sie auch ein<br />
neues Projekt zur Fragestellung „Kulturelle<br />
Identitätsbildung“ im Kontext der Akademie<br />
<strong>einer</strong> anderen stadt entwickeln möchte.<br />
Still aus „zwischen welten“, courtesy/© Dorothea Carl<br />
esra ersen<br />
berlin<br />
if you could speak swedish<br />
Video / Videoinstallation, 2001<br />
Für das Projekt „If you could speak Swedish“<br />
(„Wenn du Schwedisch sprechen könntest“)<br />
bat die Künstlerin Esra Ersen eine Vielzahl<br />
von Ausländern und Flüchtlingen, die in<br />
einem der Vororte Stockholms leben und an<br />
der Swedish Info Komp Huddige die schwedische<br />
Sprache lernen, in ihrer Muttersprache<br />
zu beschreiben, was sie erzählen würden,<br />
wenn sie schwedisch sprechen könnten. Das<br />
Thema ihrer Erzählung wählten die Studenten<br />
selbst. So variieren die Inhalte von sehr<br />
persönlichen emotionalen Aussagen bis hin<br />
zu politischen Statements.<br />
Still aus „If you could speak Swedish“, courtesy/© Esra Ersen<br />
Ihre Antworten wurden übersetzt aus der<br />
chinesischen, der arabischen, der russischen,<br />
der spanischen Sprache und aus Bengali.<br />
Frontal vor der Kamera sitzend, versuchen<br />
die Sprechenden – mit Hilfestellung <strong>einer</strong><br />
Lehrerin – die richtige Betonung und die korrekte<br />
Aussprache zu treffen. Die Einfachheit<br />
und Flüssigkeit im Sprechen ihrer eigenen<br />
Sprache, ihrer Muttersprache, kontrastiert<br />
stark mit Ihrer Schwierigkeit, mit der neu zu<br />
lernenden Sprache unzugehen.<br />
Esra Ersen kennt die Sprach- und Kulturprobleme<br />
eines Lebens im Ausland gut aus<br />
eigener Erfahrung. Deshalb thematisiert sie<br />
diese aus wechselnden Perspektiven. Für die<br />
Elbinseln hat sie ein neues Projekt über türkische<br />
Floskeln in den Blick genommen. (E.E.)<br />
fantasy world<br />
hh veddel<br />
Installation aus Modellen, 2009<br />
utopieschulung<br />
Mit Phantasie, Durchhaltevermögen und<br />
Spaß bauten dreizehn Mädchen von der<br />
Veddel über Monate ihre Umgebung nach und<br />
um. Aus eigener Erfahrung und freier<br />
Wunschproduktion entstand so im Wahlkurs<br />
Kunst an der Schule Slomannstieg ein Modell<br />
<strong>einer</strong> ganz speziellen Stadtlandschaft. Die<br />
Schülerinnen der Klassen 5 und 6 formten für<br />
ihre buntgebastelte Welt nicht nur eine Autowaschanlage<br />
und einen gewöhnlichen Pennymarkt,<br />
sie entwickelten auch ein Karussell<br />
und einen eisförmigen Kiosk, der alle jemals<br />
erfundenen Süßigkeiten unglaublich günstig<br />
führt, eine Hundefutterfabrik (mit einem angrenzenden<br />
Spielplatz für die Hundekunden),<br />
auch eine knallgrüne Moschee und gleich<br />
neben dem traumhaft goldenen Haus eine so<br />
bemerkenswerte Attraktion, wie das Museum<br />
der ‘Ältesten Seifenblase der Welt’.<br />
Dieses von den Schülerinnen Fantasy World<br />
genannte Modell, schaffte sogar den Sprung<br />
‘zurück’ über die Elbe: Seine Ausstellung<br />
beim Stadtmodell <strong>Hamburg</strong> im Frühjahr 2009<br />
war eine doppelte Premiere. Ins offizielle, in<br />
der Wexstraße ausgestellte Modell der Behörde<br />
für Stadtentwicklung brachen nicht nur<br />
plötzlich utopische Phantasien ein, sondern<br />
es wurde auch räumlich erweitert. Denn das<br />
auf 111 Quadratmetern präzis dargestellte<br />
<strong>Hamburg</strong> hört dort an der Elbe auf. So bleibt<br />
es den Schülerinnen von der Veddel vorbehalten,<br />
mit der erstmaligen Erweiterung auf<br />
die andere Elbseite einen visionären neuen<br />
Stadtteil zu zeigen.<br />
Das Projekt stand unter der Leitung der<br />
<strong>Hamburg</strong>er Künstlerin Julia Münz, die sich<br />
2008 auch im Rahmen des BVS – Büro Verborgene<br />
Stätte – mit der Wahrnehmung des<br />
Stadtraums der Elbinsel und s<strong>einer</strong> Planung<br />
befasst hatte. (Hajo Schiff)<br />
beteiligte schülerinnen: Dilara Bademci, Hatice<br />
Bakir, Zilhidze Bakiji, Meriem Balocada,<br />
Rabia Ertas, Laura Hasanaj, Havva Kiliç, Julianne<br />
Reis Mariduena, Diana Fatema Rahman,<br />
Sofia Rizvanovic,Vanessa Rizvanovic, Süheda<br />
Sarieriklioglu, Sümeyye Tokgöz und Gamze<br />
Tsamli. Anleitung: Julia Münz, Künstlerin,<br />
<strong>Hamburg</strong><br />
Modell, entstanden während des Projektes „Fantasy World.<br />
Stadtmodell“, 2009, courtesy/© Julia Münz<br />
fluid rooms (warten)<br />
hh othmarschen<br />
künstlerische raumkonzepte für die<br />
s-bahnstation othmarschen<br />
Fotografien und Video, 2009<br />
Der S-Bahnhof Othmarschen, ein stadt(teil)räumlicher<br />
Transitionsort des Wartens,<br />
wurde mit Mitteln von Kunst, Architektur und<br />
Performance im öffentlichen Raum erfahren<br />
und in Teilen gestaltet, um (private) Nischen<br />
und Schutzräume für alle Nutzer der S-Bahn<br />
zu schaffen.<br />
Die Schüler/innen des Gymnasiums Hochrad<br />
waren Beobachter/innen und Fragende: Wie<br />
verhalten sich die Reisenden und Wartenden?<br />
Wie vermischen sich private und öffentliche<br />
Räume? Wie wird gewartet? An einem<br />
intensiven Projekttag wurden der S-Bahnhof<br />
und das Thema WARTEN gemeinsam mit der<br />
Performancekünstlerin Katharina Oberlik<br />
spielerisch und körperlich erforscht, um<br />
Gesehenes experimentell auszuprobieren<br />
und zu erfahren.<br />
Im Anschluss haben sich die Schüler/innen<br />
unter Anleitung des Architekten Achim<br />
Aisslinger dem S-Bahnhofs als transitorischen<br />
Stadtraum genähert. Für eine fiktive<br />
Ausschreibung bestand die Aufgabe, einen<br />
Entwurf zur künstlerischen Gestaltung eines<br />
gewählten Bereichs des S-Bahnhofs anzufertigen,<br />
der sich u. a. mit der Frage beschäftigte:<br />
Wie schafft man in diesem öffentlichen<br />
Warteraum private Schutzräume?<br />
beteiligte schüler/innen: Leon Agius, Alena<br />
von Ancken, Johanna Braun, Hendrik Doll,<br />
Jale Frotscher, Johanna Gimpe, Valentina<br />
Harrendorf, Sina Heidenreich, Gina Hennies,<br />
Leonard Jährig, Lenard Lehmann, Nina Loderhose,<br />
Malina Meyer, Thilo Pötzold, Lorenz<br />
Riemer, Patricia Römeth, Paloma Saalbach,<br />
Alia Scheid, Tatjana Seebode, Dae-Seung<br />
Seon und Marc Vetter. Anleitung: Katharina<br />
Oberlik, Achim Aisslinger, Virginia Brunnert<br />
rainer ganahl<br />
new york<br />
basic chinese<br />
Installation mit Video, 4 min, Shanghai,<br />
April 2009<br />
In „Projekten wie 5 Days a Week, 6 Hours<br />
a Day – Basic Korean“ setzt du dich dann<br />
tatsächlich dem Prozess des Fremdsprachenerwerbs<br />
aus. Welche Bedeutung hat das<br />
Sprachenlernen für dich im Zusammenhang<br />
mit der Produktion von Kunst?<br />
Rainer Ganahl: Das Lernen ist das Rückgrat<br />
m<strong>einer</strong> Gehversuche und die Rechtfertigung<br />
<strong>einer</strong> visuellen Produktion, die nicht-retinale<br />
Präferenzen privilegiert. Ich könnte auch<br />
sagen, das Lernen ist mein Anti-Alzheimerprogramm<br />
und/oder meine Anti-Depressivmedizin;<br />
es ist die billigste Art, teuren<br />
Psychotherapierechnungen zu entkommen.<br />
Es ist wahrscheinlich auch ein Easy-jet Ticket<br />
ins Nirgendwo der Nachmittage, die unaufgelesen<br />
sich am Rande <strong>einer</strong> Kunstproduktion<br />
akkumulieren; eine Süßspeise für Diabetiker<br />
unter Einfluss; ein Ersatz für monastische<br />
Spreizübungen vor dem Schlafengehen; ein<br />
Schutz vor Wahnsinn und nicht zuletzt das<br />
Abklopfen eines oxidierenden Fabrikkessels,<br />
der Sinn auf Unsinn reimt. Anders gesagt: Ich<br />
verkaufe nicht viel, aber ich lerne wenigsten<br />
etwas (es macht Sinn ohne Kunst als Kontext).<br />
(Interview mit Krystian Woznicki, http://<br />
www.ganahl.info/woznicki.html)<br />
Still aus „Wo jiao Yu Ren“, 2009, courtesy/© Rainer Ganahl<br />
Im kommenden Jahr wird Rainer Ganahl auf<br />
den <strong>Hamburg</strong>er Elbinseln seinen Chinesisch-<br />
Lern-Prozess in einem Workshop fortsetzen.<br />
olafur gislason<br />
reykjavik<br />
träumen in hannover<br />
Ortsspezifische Rauminstallation, 2002 /<br />
2009<br />
In Hannover hat Olafur Gislason mit drei<br />
lebenden Personen außereuropäischer<br />
Herkunft, dem Kurden Yasin Baban aus dem<br />
Irak, mit Abdou Karim Sané aus Senegal und<br />
der Philippinin Teresa Fantasny Gespräche<br />
geführt. Sie waren Grundlage der ersten Installation<br />
des Sprengel Museums Hannover.<br />
In <strong>einer</strong> zum Teil begehbaren und von oben<br />
einsehbaren Konstruktion aus zehn Räumen<br />
hat der Künstler seine Eindrücke und die<br />
Ergebnisse s<strong>einer</strong> Begegnungen auf verschiedene<br />
Weise künstlerisch umgesetzt.<br />
Installationsansicht „Träumen in Hannover“, 2002, Sprengel<br />
Museum Hannover, courtesy/© Olafur Gislason<br />
Jedem Teilnehmer war <strong>einer</strong> der drei mittleren<br />
Räume zugeord<strong>net</strong>. Dort konnte man<br />
ihre Lebensgeschichten lesen. Ein anderes<br />
Element der Rauminstallation, eine in<br />
neunzehn verschiedenen Farben gestrichene<br />
Raumflucht, war zu den drei zentralen Räumen<br />
hin geöff<strong>net</strong>. Gegenüber befand sich ein<br />
durch Luken einsichtiger Raum. Ventilatoren<br />
erzeugten hier eine Luftbewegung, in der<br />
originale Stoffe aus den Herkunftsländern<br />
der Teilnehmer flatterten. (O.G.)<br />
Im ehemaligen kubi-center in <strong>Hamburg</strong> Wilhelmsburg<br />
wird die Arbeit für die Ausstellung<br />
Zeichen von respekt dem Raum angepasst<br />
neu installiert.<br />
Zugleich wird Olafur Gislason mit <strong>einer</strong> Neuauflage<br />
seines Projekts „Sieben Botschafter“<br />
auf den Elbinseln beginnen, in dem er auf<br />
Menschen zugeht, die ein ungewöhnliches<br />
Wissen besitzen, für das sie zusammen mit<br />
dem Künstler neue Darstellungsformen<br />
finden wollen.<br />
hanswalter graf<br />
thun<br />
tanner & holzer und andere projekte<br />
Dokumentationen<br />
Die Wünsche und Bedürfnisse der Be- oder<br />
Anwohner/innen eines Orts zu berücksichtigen,<br />
stellt den grundlegenden Zug der Arbeitsweise<br />
von Hanswalter Graf dar, der sich<br />
selbst als Künstler und Initiator bezeich<strong>net</strong>.<br />
Die Grenzen zwischen Architektur und Kunst,<br />
zwischen Kulturgeschichte und Handwerk<br />
verschwimmen dabei in seinen Arbeiten.<br />
Stets bezieht er lokale Traditionen ein,<br />
wenn er Projekte anstößt, die alte Visionen<br />
und neue Ideen miteinander verbinden, die<br />
vorhandene Gegebenheiten aufgreifen und<br />
innovative Ergänzungen oder Umgestaltungen<br />
ineinander fließen lassen.<br />
Beispielhaft dafür ist sein Projekt „Tanner &<br />
Holz“, bei dem er in einem mehrtägigen<br />
Arbeitsprozess im Freilichtmuseum<br />
Ballenberg, Schweiz, zusammen mit <strong>einer</strong><br />
Gruppe von Schr<strong>einer</strong>lehrlingen Modelle für<br />
eine temporäre Installation entwickelte, die<br />
Projekt „Tanner und Holzer“, 2006/07, Freilichtmuseum Ballenberg,<br />
courtesy/© Hanswalter Graf<br />
sowohl dem historischen Außenbau als auch<br />
den modernen Innenräumen gerecht werden.<br />
Unter dem Titel „Black und Decker“ griff er die<br />
Graffitis und Tags in <strong>einer</strong> Straßenunterführung<br />
in Zolligofen, Schweiz, auf und ließ diese<br />
durch Kinder <strong>einer</strong> nahe gelegenen Schule<br />
über- und bearbeiten. In der Ausstellung wird<br />
eine Auswahl von Projekten des Schweizer<br />
Künstlers auf Postern präsentiert, die einen<br />
Eindruck von der Vielfältigkeit der Erfindungen<br />
und Interventionen geben, die er in<br />
unterschiedlichen Arbeitsgruppen realisiert.<br />
(A.K.)<br />
im hafen<br />
hh wilhelmsburg<br />
Arbeitsergebnisse von Dieter boxberger,<br />
Anke grube und Desiree Zick, stipendiat/innen<br />
aus dem vhs sommeratelier „im hafen“<br />
Unter dem Titel „Im Hafen - Malen – Fotografieren<br />
– Schreiben – Inszenieren“ veranstaltet<br />
die VHS an vier Tagen sechs Werkstätten<br />
mit sechs Künstler/innen im Hafen nahe der<br />
Veddel auf dem Kleinen Grasbrook. Es sollen<br />
Freiräume entdeckt und für eine künstlerische<br />
Auseinandersetzung genutzt werden.<br />
Ausgehend von der Fotografie, dem kreativen<br />
Schreiben, der Malerei, der Bildhauerei oder<br />
dem Theaterspiel können intensive und auch<br />
großzügige Arbeiten entwickelt werden,<br />
die die normalen Medien verlassen und bei<br />
fachkundiger Unterstützung zu ganz neuen<br />
Ergebnissen führen.<br />
Erstmals in diesem Jahr wurden von der <strong>IBA</strong><br />
<strong>Hamburg</strong> drei Plätze im Sommeratelier als<br />
Stipendien für Bewohner/innen der Elbinseln<br />
vergeben. Innerhalb der Ausstellung Zeichen<br />
von respekt werden die Arbeitsergebnisse<br />
der Stipendiat/innen Dieter Boxberger, Anke<br />
Grube und Desiree Zick vorgestellt.<br />
Bildhauerworkshop der VHS, 2008, courtesy/© Hans-Hermann<br />
Groppe<br />
nina katchadourian<br />
new york<br />
Accent elimination (Akzent eliminierung)<br />
Sechskanal-Videoinstallation, 2005<br />
Meine im Ausland geborenen Eltern leben<br />
schon seit über 40 Jahren in den Vereinigten<br />
Staaten und haben beide einen sehr<br />
ausgeprägten und doch schwer zuzuordnenden<br />
Akzent. Ich habe diese Akzente weder<br />
übernommen noch war ich jemals in der Lage,<br />
sie exakt zu imitieren.<br />
Inspiriert durch ein Kursangebot zum<br />
Beseitigen von Sprachakzenten, begann<br />
ich, gemeinsam mit meinen Eltern und dem<br />
professionellen Sprach-Coach Sam Chwat<br />
intensiv über mehrere Wochen zu arbeiten,<br />
um den Akzent m<strong>einer</strong> Eltern zu ‘neutralisieren’<br />
mit dem Ziel, dass sie das ‘akzentfreie’<br />
Englisch ihrer Tochter annehmen und ich mir<br />
gleichzeitig ihre beiden Akzente beibringe.<br />
Die bloße Existenz solcher Kursangebote<br />
lässt die Komplexität von Assimilation und<br />
Selbstbild erkennen. Es zeigt das Manövrieren<br />
zwischen dem Verlangen des Erhalts<br />
bestimmter Eigenschaften der eigenen Kultur<br />
auf der einen Seite und auf der anderen Seite<br />
das Verlangen, diese Merkmale zu verbergen,<br />
um weniger fremd zu erscheinen. Das Video<br />
Installationsansicht „Accent Elimination“, 2005, courtesy/© Nina<br />
Katchadourian