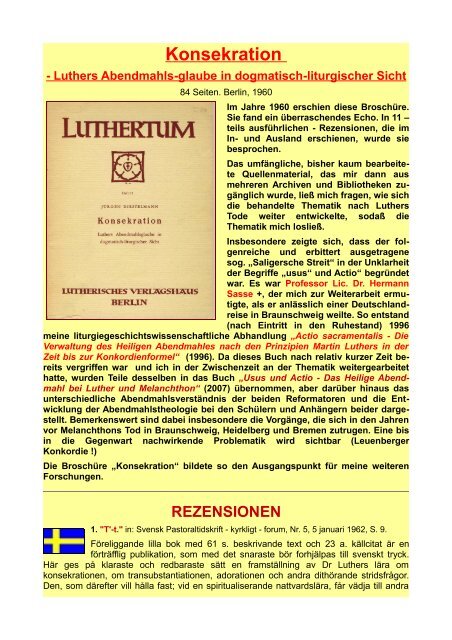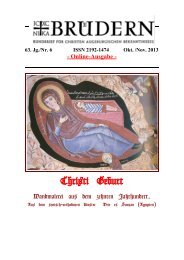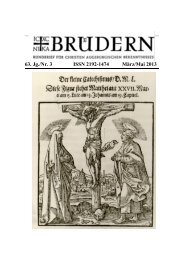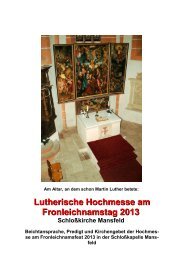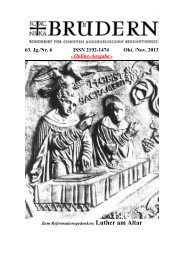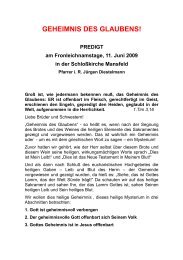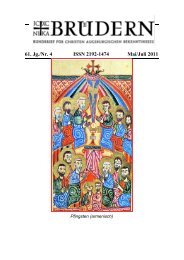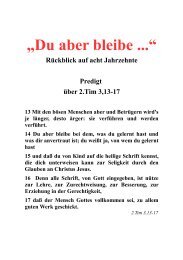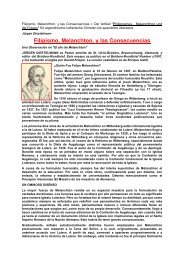Konsekration - Luther in Braunschweig
Konsekration - Luther in Braunschweig
Konsekration - Luther in Braunschweig
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Konsekration</strong><br />
- <strong>Luther</strong>s Abendmahls-glaube <strong>in</strong> dogmatisch-liturgischer Sicht<br />
84 Seiten. Berl<strong>in</strong>, 1960<br />
Im Jahre 1960 erschien diese Broschüre.<br />
Sie fand e<strong>in</strong> überraschendes Echo. In 11 –<br />
teils ausführlichen - Rezensionen, die im<br />
In- und Ausland erschienen, wurde sie<br />
besprochen.<br />
Das umfängliche, bisher kaum bearbeitete<br />
Quellenmaterial, das mir dann aus<br />
mehreren Archiven und Bibliotheken zugänglich<br />
wurde, ließ mich fragen, wie sich<br />
die behandelte Thematik nach <strong>Luther</strong>s<br />
Tode weiter entwickelte, sodaß die<br />
Thematik mich losließ.<br />
Insbesondere zeigte sich, dass der folgenreiche<br />
und erbittert ausgetragene<br />
sog. „Saligersche Streit“ <strong>in</strong> der Unklarheit<br />
der Begriffe „usus“ und Actio“ begründet<br />
war. Es war Professor Lic. Dr. Hermann<br />
Sasse +, der mich zur Weiterarbeit ermutigte,<br />
als er anlässlich e<strong>in</strong>er Deutschlandreise<br />
<strong>in</strong> <strong>Braunschweig</strong> weilte. So entstand<br />
(nach E<strong>in</strong>tritt <strong>in</strong> den Ruhestand) 1996<br />
me<strong>in</strong>e liturgiegeschichtswissenschaftliche Abhandlung „Actio sacramentalis - Die<br />
Verwaltung des Heiligen Abendmahles nach den Pr<strong>in</strong>zipien Mart<strong>in</strong> <strong>Luther</strong>s <strong>in</strong> der<br />
Zeit bis zur Konkordienformel“ (1996). Da dieses Buch nach relativ kurzer Zeit bereits<br />
vergriffen war und ich <strong>in</strong> der Zwischenzeit an der Thematik weitergearbeitet<br />
hatte, wurden Teile desselben <strong>in</strong> das Buch „Usus und Actio - Das Heilige Abendmahl<br />
bei <strong>Luther</strong> und Melanchthon“ (2007) übernommen, aber darüber h<strong>in</strong>aus das<br />
unterschiedliche Abendmahlsverständnis der beiden Reformatoren und die Entwicklung<br />
der Abendmahlstheologie bei den Schülern und Anhängern beider dargestellt.<br />
Bemerkenswert s<strong>in</strong>d dabei <strong>in</strong>sbesondere die Vorgänge, die sich <strong>in</strong> den Jahren<br />
vor Melanchthons Tod <strong>in</strong> <strong>Braunschweig</strong>, Heidelberg und Bremen zutrugen. E<strong>in</strong>e bis<br />
<strong>in</strong> die Gegenwart nachwirkende Problematik wird sichtbar (Leuenberger<br />
Konkordie !)<br />
Die Broschüre „<strong>Konsekration</strong>“ bildete so den Ausgangspunkt für me<strong>in</strong>e weiteren<br />
Forschungen.<br />
REZENSIONEN<br />
1. "T'-t." <strong>in</strong>: Svensk Pastoraltidskrift - kyrkligt - forum, Nr. 5, 5 januari 1962, S. 9.<br />
Föreliggande lilla bok med 61 s. beskrivande text och 23 a. källcitat är en<br />
förträfflig publikation, som med det snaraste bör forhjälpas till svenskt tryck.<br />
Här ges på klaraste och redbaraste sätt en framställn<strong>in</strong>g av Dr <strong>Luther</strong>s lära om<br />
konsekrationen, om transubstantiationen, adorationen och andra dithörande stridsfrågor.<br />
Den, som därefter vill hålla fast; vid en spiritualiserande nattvardslära, får vädja till andra
auktoriteter än den <strong>Luther</strong>, som beskriver konsekrationen som "Wandlung" och<br />
"reverenter" tillbedjer det eleverade sakramentet. Särskilt <strong>in</strong>strukttiv är det att läsa <strong>Luther</strong>s<br />
vredgade uppgörelse med en präst, som vågat skriva honom på näsan, att sakramentet<br />
upphör "extra usum" och därför vågat lägga consecrata bland det ovigda. Av de kyrkliga<br />
akterna i detta mål framgår f. ö., att man vid denna tid i Kursachsen iakttrog tvagn<strong>in</strong>g av<br />
kalken, så att Herrens blod "diligentissime" tillvaratogs. Några sidor ägnas åt den s. k.<br />
Heidelberger Landlüge, berättelsen om hur <strong>Luther</strong> strax före s<strong>in</strong> död skulle ha återkallat<br />
eller mildrat s<strong>in</strong> bekännelse om sakramentet. Den här givna förklar<strong>in</strong>gen till detta<br />
kyrkohistoriska problem gör ett synnerligen trovärdigt <strong>in</strong>tryck. <strong>Luther</strong>s ord "Lieber Philippe,<br />
ich muß bekennnen, der Sache vom Abendmahl ist viel zu viel getan" skulle enligt<br />
Diestelmann avse ett alldeles specielt nattvardsfall, nämligen den olyklige kaplan Besserer<br />
som angavs för att den 3 adventssondagen 1545 ha framräckt en okonsekrerad oblat till<br />
en kommunikant. <strong>Luther</strong> torde på sistone ha övertygats, att kaplatlen handlat i panik och<br />
icke av ond vilja och därför velat återkalla sitt berömda anathema: "Vadat ad suos<br />
Zw<strong>in</strong>glianos", over den man, som trotts vilja förneka Guds mäktiga skaparord i konsekrationen.<br />
[Übersetzung:<br />
Vorliegendes kle<strong>in</strong>es Buch mit 61 Seiten beschreibendem Text und 25 Seiten Quellenzitaten<br />
ist e<strong>in</strong>e vortreffliche Publikation, die aufs schnellste schwedisch gedruckt werden sollte.<br />
Hier wird auf die klarste und zuverlässigste Weise e<strong>in</strong>e Darstellung von Dr. <strong>Luther</strong>s<br />
Lehre der <strong>Konsekration</strong>, der Transsubstantiation, der Adoration und anderer diesbezüglicher<br />
Streitfragen gegeben. Diejenigen, die trotzdem an e<strong>in</strong>er spiritualisierenden Abendmahlslehre<br />
festhalten wollen, müssen sich an andere Autoritäten als an <strong>Luther</strong> wenden,<br />
der die <strong>Konsekration</strong> als "Wandlung" beschreibt und das elevierte Sakrament verehrend<br />
anbetet. Besonders <strong>in</strong>struktiv zu lesen ist <strong>Luther</strong>s zornige Abrechnung mit e<strong>in</strong>em Priester,<br />
der ihm <strong>in</strong>s Gesicht zu sagen wagt, daß das Sakrament "extra usum" ke<strong>in</strong>e Gültigkeit<br />
mehr habe und der es wagt, die consecrata zum Ungeweihten zu zählen. Aus den kirchlichen<br />
Akten zu diesem Fall geht hervor, daß man zu dieser Zeit <strong>in</strong> Kursachsen die Waschung<br />
des Kelches, <strong>in</strong> dem des Herren Blut "diligentissime" aufbewahrt wurde, vornahm.<br />
E<strong>in</strong>ige Seiten handeln von der sogen. Heidelberger Landlüge, e<strong>in</strong>er Erzählung, <strong>in</strong> der <strong>Luther</strong><br />
kurz vor se<strong>in</strong>em Tod se<strong>in</strong> Bekenntnis zum Sakrament widerrufen oder abgeschwächt<br />
haben soll. Die hier gegebene Erklärung zu. diesem kirchenhistorischen Problem macht<br />
e<strong>in</strong>en besonders glaubwürdigen E<strong>in</strong>druck. <strong>Luther</strong>s Wort: "Lieber Philippe, ich muß bekennen,<br />
der Sache vom Abendmahl ist viel zu viel getan" soll gemäß Diestelmann auf e<strong>in</strong>en<br />
ganz speziellen Abendmahlsfall h<strong>in</strong>zielen, nämlich auf den des unglücklichen Kaplan Besserer,<br />
der angezeigt wurde, als er am 3. Adventssonntag 1545 e<strong>in</strong>em Kommunikanten<br />
e<strong>in</strong>e unkonsekrierte Hostie reichte. <strong>Luther</strong> dürfte schließlich davon überzeugt worden se<strong>in</strong>,<br />
daß der Kaplan <strong>in</strong> Panik und nicht aus bösem Willen gehandelt hat, weshalb er se<strong>in</strong> berühmtes<br />
Anathema ", über den, der mutwillig Gottes mächtiges Schöpferwort <strong>in</strong> der <strong>Konsekration</strong><br />
leugnet, widerrufen wollte: "Vadat ad suos Zw<strong>in</strong>glianos.]<br />
2. Paul Re<strong>in</strong>hardt <strong>in</strong>: Informationsblatt Hamburg, Nr. 23/24; 10. Jahrgang 1 und 2, Dezemberheft<br />
1961:<br />
Der Vorzug dieser Arbeit besteht dar<strong>in</strong>, daß sie möglichst weitgehend <strong>Luther</strong> selbst aus<br />
se<strong>in</strong>en Abendmahlsschriften zitiert und außerdem noch e<strong>in</strong>en fast 20seitigen Quellenanhang<br />
bietet. Ausgehend von der Bedeutung der E<strong>in</strong>setzung des Heiligem Mahles durch<br />
Jesus fragt der Verfasser nach den <strong>Konsekration</strong>sworten und ihrer Wirkung und zwar <strong>in</strong>nerhalb<br />
der ganzen actio sacramentalis. E<strong>in</strong>e besondere Überlegung widmet er der Stellung<br />
der <strong>Konsekration</strong>slehre bei dem sog. „Jungen <strong>Luther</strong>". Nach e<strong>in</strong>er Darstellung der Abweichung<br />
Melanchthons von <strong>Luther</strong>, wozu auch die Ausführungen über die „Heidelberger
Landlüge" und den „Fall Besserer" gehören, gibt der Verfasser e<strong>in</strong>e kurze zusammenfassende<br />
Würdigung von <strong>Luther</strong>s <strong>Konsekration</strong>slehre mit e<strong>in</strong>em H<strong>in</strong>weis auf die Arnoldsha<strong>in</strong>er<br />
Abendmahlsthesen, <strong>in</strong> welchen ja Äußerungen über die <strong>Konsekration</strong> bewußt vermieden<br />
worden s<strong>in</strong>d. Es wäre e<strong>in</strong>e Überforderung, wenn man von e<strong>in</strong>er so knappen Schrift<br />
verlangen wollte, daß sie die mancherlei Probleme, welche die Frage der <strong>Konsekration</strong><br />
aufwirft, auch nur annähernd ausbreiten. solle. Auch ohne e<strong>in</strong>e solche kritische Darstellung<br />
behält das Heft mit den dargebotenen Quellen se<strong>in</strong>en e<strong>in</strong>deutigen Wert. Dies gilt besonders<br />
auch deshalb, weil der Verfasser sich bemüht, die doppelte Bedeutung herauszustellen,<br />
welche die E<strong>in</strong>setzungsworte im Zusammenhang mit der ganzen Abendmahlshandlung<br />
nach <strong>Luther</strong>s Auffassung haben: „Die e<strong>in</strong>e, die den Elementen zugewandt ist<br />
(<strong>Konsekration</strong>), die andere, die sich an die Geme<strong>in</strong>de wendet (Verkündigung). Auf beide<br />
legt <strong>Luther</strong> großen Wert, je nach Erfordernis diese oder jene besonders hervorhebend" (S.<br />
43).<br />
3. Werner Schill<strong>in</strong>g <strong>in</strong>: Zeitschrift: "LUTHER", Heft 2/1963:<br />
Das Büchle<strong>in</strong> behandelt e<strong>in</strong>e Spezialfrage der Abendmahlslehre, nämlich die, wie es um<br />
die »Segnung« oder »Weihung« der »Elemente« (Brot und We<strong>in</strong>) stehe. Es wird von der<br />
Bedeutung der E<strong>in</strong>setzung des Mahles durch Jesus, von den <strong>Konsekration</strong>sworten und ihrer<br />
Wirkung, von der <strong>Konsekration</strong>slehre des jungen <strong>Luther</strong> und von Melanchthons Abweichungen<br />
gegenüber <strong>Luther</strong> gesprochen. Schließlich wird <strong>Luther</strong>s Auffassung dogmengeschichtlich<br />
gewürdigt.<br />
Die Arbeit kommt zu dem Ergebnis, daß die <strong>Konsekration</strong> nicht <strong>in</strong> e<strong>in</strong>zelnen Worten (etwa<br />
beim Kreuzschlagen) bestehe, sondern daß sie durch die ganze Handlung geschehe. <strong>Luther</strong><br />
sei alles darauf angekommen, daß die Gnadengabe des Heiligen Mahles ganz unabhängig<br />
sei von menschlichem Zutun. Die Vorstellung sei falsch, daß mit dem Kreuzschlagen<br />
über Brot und We<strong>in</strong> die <strong>Konsekration</strong> erfolge. Das Kreuzschlagen sei im 16. Jahrhundert<br />
überhaupt nicht geübt worden, sondern sei erst viel später aufgekommen.<br />
Der Verfasser beanstandet, daß <strong>in</strong> den "Arnoldsha<strong>in</strong>er Thesen" die <strong>Konsekration</strong> im S<strong>in</strong>ne<br />
der von Jesus e<strong>in</strong>gesetzten ganzen Handlung (Essen, Tr<strong>in</strong>ken, Worte Christi, Ritus) weder<br />
sachlich noch dem Wortlaut nach erwähnt sei und daß daher »der der Kirche von Christus<br />
gegebene <strong>Konsekration</strong>sauftrag« »nicht mehr im Blickfeld« sei. Mit der Annahme dieser<br />
Thesen würden nicht nur <strong>Luther</strong> und die Bekenntnisschriften, sondern Christi eigenes Wort<br />
selbst verleugnet (S. 61).<br />
E<strong>in</strong> Quellen-Anhang beschließt diese nützliche Arbeit, der m<strong>in</strong>destens <strong>in</strong> ihrer Hauptthese,<br />
daß die »<strong>Konsekration</strong>« <strong>in</strong> der ganzen Handlung der Abendmahlsfeier bestehe, schwerlich<br />
widersprochen werden kann.<br />
4. Klaus Haendler <strong>in</strong>: Theologische Literaturzeitung 1961, Nr. 5, Sp. 374 ff.<br />
Die vorliegende Untersuchung versteht sich als Äußerung zum gegenwärtigen Abendmahlsgespräch,<br />
wie es etwa im deutschen Raum <strong>in</strong> den Arnoldsha<strong>in</strong>er Thesen" e<strong>in</strong>en wesentlichen<br />
Punkt erreicht hat. Gegenüber diesen Thesen, durch die nach Me<strong>in</strong>ung des<br />
Verfs., nicht nur <strong>Luther</strong> nicht nur e<strong>in</strong>e grundlegende Bekenntnisschrift der lutherischen Kirche<br />
und nicht nur die abendländische vorscholastische Tradition verleugnet (wird), sondern<br />
Christi eigenes Wort salbst" (6I), will diese Arbeit "e<strong>in</strong>en klärenden Beitrag für die derzeitige<br />
Diskussion <strong>in</strong> der Abendmahlstheologie liefern" (9), <strong>in</strong>dem die e<strong>in</strong>en für <strong>Luther</strong> wesentlichen<br />
Aspekt se<strong>in</strong>er Abendmah1slehre herausgreift, nämlich die <strong>Konsekration</strong> und<br />
hier den dogmatischen Gehalt und e<strong>in</strong>ige sich daraus ergebende liturgisch-gottesdienstliche<br />
Konsequenzen darstellt. Die Entfaltung der Anschauungen <strong>Luther</strong>s geschieht vor-
nehmlich an Hand von Quellenauszügen, die die wesentlichsten Aussagen <strong>Luther</strong>s zu diesem<br />
Thema darbieten. Dabei s<strong>in</strong>d die late<strong>in</strong>ischen Zitate, um auch dem Nicht-Fachtheologen<br />
verständlich zu se<strong>in</strong> (9), übersetzt worden (und zwar, wie man dem Verf. zugestehen<br />
muß, sachlich richtig und gut).<br />
Die Untersuchung gliedert sich <strong>in</strong> drei Abschnitte. Im ersten Abschnitt (Kap.1-4) wird <strong>Luther</strong>s<br />
Anschauung von der <strong>Konsekration</strong> dargestellt, im zweiten (Kap. 5 und 6) wird der<br />
Befund des ersten Abschnittes mit Melanchthons Auffassung verglichen, im letzten Abschnitt<br />
(Kap. 7) werden diese beiden Abendmahlslehren <strong>in</strong> die dogmengeschichtliche Entwicklung<br />
e<strong>in</strong>geordnet und abschließend die heutige Situation kurz charakterisiert.<br />
Im I. Kapitel ("Die Bedeutung der E<strong>in</strong>setzung des Hl. Mahles durch JEsus", 11-17) zeigt<br />
der Verf. die alles beherrschende Bedeutung der E<strong>in</strong>setzung des Abendmahles durch<br />
Christus im Ganzen des Abendmahlsdenkens <strong>Luther</strong>s auf. Die unbed<strong>in</strong>gte und nicht relativierbare<br />
B<strong>in</strong>dung der Theologie <strong>Luther</strong>s an das Wort der Schrift ist der Grund dafür, daß <strong>in</strong><br />
bezug auf das Abendmahl die E<strong>in</strong>setzung durch Christus und se<strong>in</strong> Befehl "Das tut!" konstìtutiv.<br />
Für alle Abendmahlslehre und -praxis wird. Das erste Abendmahl Christi ist darum<br />
"Urbild und Vorbild jeder Heiligen Abendmahlsfeier" (I2). Es geht <strong>Luther</strong> darum, gegenüber<br />
allen Abweichungen und Streitigkeiten auf die E<strong>in</strong>setzung a1s auf den normativen Kanon<br />
des Abendmahles zu verweisen. Das zentrale Geschehen, "das von Christus beabsichtigte<br />
Ziel des Heiligen, Mahles", das "<strong>in</strong> der Communion gegeben" ist (I5), muß daher ständig<br />
an der E<strong>in</strong>setzung und dem E<strong>in</strong>setzungsbefehl ausgerichtet und gemessen werden. Von<br />
den durch die E<strong>in</strong>setzung als notwendig geforderten D<strong>in</strong>gen unterscheidet <strong>Luther</strong> scharf<br />
die Adiaphora, <strong>in</strong> denen Freiheit herrschen kann (I 6 f. ; I 7: Anbetung des Sakramentes).<br />
Im 2. Kapitel ("Die <strong>Konsekration</strong>sworte und ihre Wirkung", I8-30), dem wichtigsten und umfangreichsten<br />
wird die Bedeutung und Punktion der E<strong>in</strong>setzungsworte entwickelt. Es geht<br />
hier um die "Frage nach der die Realpräsenz bewirkenden Ursache" (I9). Diese Ursache<br />
ist das Wort Christi selbst, das die Realpräsenz se<strong>in</strong>es Leibes und Blutes setzt. Indem im<br />
"stiftungsgemäßen Nachvollzog des Heiligen Mahles" nicht nur das Handeln Christi, sondern<br />
auch se<strong>in</strong>e Worte wiederholt werden (19f.), eignet diesen Worten wahrhaft Realpräsenz<br />
setzende d. h. konsekrierende Kraft. "Für <strong>Luther</strong> steht fest, daß das über den Elementen<br />
ausgesprochene Wort Christi das Sakrament schafft und Leib und Blut Christi <strong>in</strong><br />
den Elementen wirklich gegenwärtig setzt" (21). Alle<strong>in</strong> dem Wirken des Wortes, das für <strong>Luther</strong><br />
auf das engste mit dem Wirken des HI. Geistes verbunden, ja, mit ihm "wesensmäßig<br />
identisch" ist (25), kommt die vis consecrationis zu (21 f.), nicht der durch die Priesterweihe<br />
verliehenen priesterlichen Vollmacht (19). Die Funktion des das Abendmahl verwaltenden<br />
Amtsträgers ist darum lediglich e<strong>in</strong>e dienende Funktion. Der Amtsträger handelt nur<br />
als Werkzeug, durch das Christus selbst als Konsekrator am Werk ist. Die efficacia der<br />
vom Amtsträger gesprochenen <strong>Konsekration</strong>sworte hat ihren ausschließlichen Grund <strong>in</strong><br />
der Ordnung und dem Befehl Christi (22 F.). Aber kraft dieser Ordnung und dieses Befehles<br />
kommt se<strong>in</strong>em Sprechen nun auch wirklich die vis consecrationis zu. Dadurch wird jedoch<br />
nicht der Abstand, der zwischen Christus und dem Amtsträger herrscht, aufgehoben.<br />
Nach wie vor steht er <strong>in</strong> bezug auf das Abendmahl auf der gleichen Stufe wie der Laie;<br />
beide, Amtsträger und Laie, s<strong>in</strong>d hier nur Empfangende (23 f.). Es kommt <strong>Luther</strong> <strong>in</strong> diesem<br />
Zusammenhang nicht auf das Wie des <strong>Konsekration</strong>svorganges an, sondern nur auf das<br />
Daß, d. h. auf die durch das Wort bewirkte Verb<strong>in</strong>dung von Leib und Blut Christi mit den<br />
Elementen" (26). - In diesem Zusammenhang ist <strong>Luther</strong>s E<strong>in</strong>stellung zur Elevation symptomatisch<br />
(27 ff.; 41): er behält sie darum bei, weil er <strong>in</strong> ihr, sofern sie nicht als Opfergestus<br />
verstanden wird, e<strong>in</strong>en "sachgemäßen Ausdruck des Sakramentsglaubens" (29) sieht,<br />
da durch sie deutlich auf die konsekrierten Elemente, die Leib und Blut Christi s<strong>in</strong>d, h<strong>in</strong>gewiesen<br />
wird.<br />
Im 3. Kapitel ("Die <strong>Konsekration</strong> <strong>in</strong>nerhalb der ganzen actio sacramentalis", 31-36) werden<br />
e<strong>in</strong>ige Probleme der gottsdienstlichen Praxis erwogen, deren Ordnung und Regelung Lu-
ther von se<strong>in</strong>er <strong>Konsekration</strong>sanschauung aus vornimmt, vor allem das Problem der Nachkonsekration<br />
(3I ff.), der reliquia sacramenti (33 ff.) und der Reservation des Sakramentes<br />
(35 f.). An diesen Problemen der Praxis bewährt <strong>Luther</strong> se<strong>in</strong>e Überzeugung von der vis<br />
consecrationis der E<strong>in</strong>setzungsworte, <strong>in</strong>dem er e<strong>in</strong>erseits (im Falle der geforderten Nachkonsekration)<br />
scharf zwischen konsekrierten und nichtkonsekrierten Elementen unterscheidet<br />
(31), jedoch andererseits die Frage nach dem Ende der Realpräsenz abweist<br />
(34f.). Se<strong>in</strong> Interesse liegt e<strong>in</strong>zig und alle<strong>in</strong> auf dem Abendmahlsgeschehen als ganzem,<br />
auf der actio sacramentalis. Innerhalb dieser actio, die <strong>Luther</strong> "<strong>in</strong> e<strong>in</strong>er bestimmten Zeitdauer"<br />
(34) sieht, nämlich beg<strong>in</strong>nend mit dem als eucharistisches Tischgebet verstandenen<br />
Vaterunser und. endend mit der Entlassung der Kommunikanten, ist Christus <strong>in</strong> den<br />
Elementen realpräsent. Darum ist die Nachkonsekration gefordert, darum wird aber auch<br />
angemahnt, ke<strong>in</strong>e reliquia sacramenti übrig zu lassen, um jeden Ansche<strong>in</strong> zu vermeiden,<br />
"der den E<strong>in</strong>druck e<strong>in</strong>er mangelnden Ehrfurcht der so def<strong>in</strong>ierten actio sacramentalis gegenüber<br />
erwecken könnte" (35). Weil jedoch die Kommunion das Ziel dieser actio ist, ist<br />
e<strong>in</strong>e Reservation zum Zweck der Krankenkommunion statthaft (36), zum Zweck der Anbetung<br />
außerhalb der actio und zur Mitführung <strong>in</strong> Prozessionen jedoch nicht (35).<br />
Zum Abschluß des sich: besonders mit <strong>Luther</strong> beschäftigenden Abschnitts wird im 4. Kapitel<br />
("Die <strong>Konsekration</strong>slehre beim 'jungen <strong>Luther</strong>' 37-43) die Frage nach der E<strong>in</strong>heit des<br />
<strong>Konsekration</strong>sverständnisses beim jungen und älteren <strong>Luther</strong> erörtert. Dieses Problem<br />
kann dadurch entstehen, daß bei <strong>Luther</strong> "<strong>in</strong> se<strong>in</strong>er Frühzeit die Triebfedern se<strong>in</strong>er theologischen<br />
Erwägungen über das H1. Abendmahl mehr pastoral - theologische Anliegen, als<br />
dogmatische Interessen s<strong>in</strong>d" (38). Aus diesem Grund spricht er <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er Frühzeit <strong>in</strong> bezug<br />
auf die Verba testamenti mehr von ihrem Verkündigungscharakter als von ihrer vis<br />
consecrationis. Doch wird damit, auch mit der Polemik gegen die Meßopfertheologie, ke<strong>in</strong>eswegs<br />
die <strong>Konsekration</strong> verne<strong>in</strong>t. Die Äußerungen <strong>Luther</strong>s "lassen auf jeden Fall nicht<br />
den Schluß zu, daß er bei der Hervorhebung des Verkündigungscharakters der Verba Testamenti<br />
ihre konsekratorische Kraft bestritten habe" (42). Somit besteht, was die <strong>Konsekration</strong><br />
betrifft, ke<strong>in</strong>e Differenz zwischen dem jungen und älteren <strong>Luther</strong>. Damit ist die Me<strong>in</strong>ung,<br />
die z. B. Kawerau und Loofs vertreten haben, die Anschauung des älteren <strong>Luther</strong><br />
von der <strong>Konsekration</strong> sei e<strong>in</strong> Rückfall <strong>in</strong> römisches Denken und "e<strong>in</strong>e der grandiosesten<br />
Verirrungen christlicher Glaubensgedanken" (Loofs), als falsch erwiesen.<br />
Es ist dem Verf. dar<strong>in</strong> zuzustimmen, daß die E<strong>in</strong>setzungsworte für <strong>Luther</strong> unbestritten im<br />
Mittelpunkt se<strong>in</strong>es Nachdenkens über das Abendmahl stehen. Sie s<strong>in</strong>d konstitutiv für das<br />
Abendmahl, da sie Realpräsenz schaffen. Wort und Sakrament gehören darum um der<br />
Gegenwart Christi willen unauflöslich zusammen. Ohne das Wort gibt es ke<strong>in</strong> Sakrament.<br />
Doch erschöpft sich die Funktion der E<strong>in</strong>setzungsworte nicht dar<strong>in</strong>, <strong>Konsekration</strong>sworte zu<br />
se<strong>in</strong>; die Funktion, die sie gegenüber den Elementen haben, ist nicht ihre e<strong>in</strong>zige. Ebenso<br />
wesentlich und wichtig ist für <strong>Luther</strong> das Wort <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er Funktion, die es gegenüber dem<br />
Empfänger des Sakramentes hat. Diese letztere ist e<strong>in</strong>e doppelte: erstens appliziert es<br />
dem Empfänger die Realpräsenz, <strong>in</strong>dem es diese anzeigt und offenbar macht, und zum<br />
zweiten wird es zur lebendigen Verkündigung des Evangeliums von der Sündenvergebung.<br />
Denn auch das E<strong>in</strong>setzungswort ist Evangelium, das heißt: die efficacia des Wortes<br />
geht <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie und pr<strong>in</strong>cipaliter auf Glauben, wenn auch natürlich durch die eben damit<br />
konsekrierten Elemente h<strong>in</strong>durch. Diese auf den Empfänger zielende efficacia des<br />
Wortes ist für <strong>Luther</strong> das Zentrale und Wesentliche (vgl. WA VIII, 447, 6 ff.; XII,. 181, 27<br />
ff.). Indem diese zweifache (bzw. dreifache) Funktion des Wortes nicht dargelegt und entfaltet<br />
wird (der Verf. erwähnt den "Verkündigungscharakter" der Verba testamenti nur beiläufig<br />
[40. 42]), kann es nicht zu e<strong>in</strong>er wirklichen Erfassung und Darstellung dessen kommen,<br />
was für <strong>Luther</strong> das Wort <strong>in</strong>nerhalb des Abendmahles besagt, bewirkt und bedeutet.<br />
So richtig die Betonung der vis consecrationis des Wortes ist, so falsch, weil e<strong>in</strong>seitig und<br />
damit verzeichnend, ist das Ausklammern der anderen Funktionen. <strong>in</strong> denen erst das ei-
gentliche Anliegen <strong>Luther</strong>s deutlich wird.<br />
Zu e<strong>in</strong>er zweiten, damit zusammenhängenden E<strong>in</strong>seitigkeit und Beschränkung des Stoffes<br />
s<strong>in</strong>d ähnliche kritische E<strong>in</strong>wendungen zu machen. Es ist zu fragen, ob überhaupt zutreffend<br />
über <strong>Luther</strong>s Abendmahlsanschauung gesprochen werden kann, wenn man nur über<br />
die res sacramenti, das "obiectum fidei", spricht, nicht aber über usus und fructus des Sakramentes.<br />
Das Unterstreichen der res, d. h. der Realpräsenz, und darum auch der <strong>Konsekration</strong><br />
ist s<strong>in</strong>nvoll und legitim (für <strong>Luther</strong> wie für den <strong>Luther</strong>-Interpreten) nur, sofern diese<br />
auf den Zielpunkt des Abendmahles bezogen wird, auf usus und fructus <strong>in</strong> der Kommunion.<br />
Ohne diesen größeren Zusammenhang, der sachlich gefordert ist, kann es nicht zu<br />
e<strong>in</strong>er angemessenen Darstellung des "Abendmahlsglaubens" <strong>Luther</strong>s kommen (und die<br />
beabsichtigt der Verf. Doch wohl, wie der Untertitel des Buches zeigt!). Jede Isolierung<br />
e<strong>in</strong>e, sei es auch noch so wichtigen Teilaspektes ist unstatthaft (und auch <strong>in</strong> bezug auf das<br />
gegenwärtige Abendmahlsgespräch nutzlos).<br />
Die Behauptung, <strong>Luther</strong> habe die Realpräsenz des Leibes und Blutes Christi räumlich (<strong>in</strong><br />
der Hostie)" geglaubt (18), ist <strong>in</strong> dieser Form falsch. So schwierig es auch se<strong>in</strong> mag die<br />
Realpräsenz <strong>in</strong> den Elementen gegen die Auffassung von der <strong>in</strong>clusio localis abzugrenzen,<br />
so ist doch daran festzuhalten, daß die Ablehnung dieser <strong>in</strong>clusio localis des Leibes<br />
und Blutes Christi <strong>in</strong> den Elementen von <strong>Luther</strong> mit allem Nachdruck vertreten wird. Vgl.<br />
die Marburger Unionsformel von I 529 (H. v. Schubert, Die Anfänge d. ev. Bekenntnisbildung<br />
bis 1529/3o, 1928 41): "non autem ... localiter". Wittenberger Konkordie von 1536<br />
(CR III, 75): "nec sentiunt fieri localem <strong>in</strong>clusionem <strong>in</strong> pane". Es muß sorgfältiger, als es<br />
der Verf. tut zwischen der unio sacramentalis der Elemente mit dem präsenten Christus<br />
und der <strong>in</strong>clusio localis Christi <strong>in</strong> den Elementen unterschieden werden.<br />
Im Anschluß an diese speziell <strong>Luther</strong> gewidmeten Kapitel wird im 5. Kapitel ("Melanchthons<br />
Abweichen von <strong>Luther</strong>", 44-51) kurz die Eigenart des melanchthonischen Abendmahlsverständnisses<br />
dargelegt. Seit den I530er Jahren bestehen "entscheidende Unterschiede"<br />
zwischen <strong>Luther</strong> und Melanchthon (44). Sie liegen dar<strong>in</strong>, daß Melanchthon <strong>in</strong> bezug<br />
auf die Transsubstantiationslehre von <strong>Luther</strong> abrückt, daß er die <strong>Konsekration</strong> als<br />
überflüssig empf<strong>in</strong>det und sie sogar bekämpft. Deutliches Zeichen ist dafür se<strong>in</strong> Verhalten<br />
im Falle Wolfer<strong>in</strong>us (45ff.; 32ff.). Nicht mehr die Frage nach der substantialen, materialen<br />
Seite der Realpräsenz steht im Mittelpunkt se<strong>in</strong>es Interesses, sondern das Geschehen<br />
selbst nimmt den zentralen Platz e<strong>in</strong> (48). So ist der Gegensatz zwischen ihm und <strong>Luther</strong><br />
deutlich; besonders <strong>in</strong> der <strong>Konsekration</strong>slehre ist der theologische Unterschied "unüberbrückbar"<br />
(51).<br />
Dieser Darstellung und Beurteilung der Abendmahlstheologie Melanchthons, die die Ergebnisse<br />
und Ansichten der bisherigen Forschung wiedergibt, kann nicht unwidersprochen<br />
bleiben. Wenn man schon die melanchthonische Variation der lutherischen Abendmahlslehre,<br />
die <strong>in</strong> der Betonung des actio-Charakters liegt, als "Abweichen von <strong>Luther</strong>" betrachten<br />
will, so läßt sich diese nicht erst <strong>in</strong> den 1530er Jahren nachweisen, sondern bereits <strong>in</strong><br />
der Mitte der I520er (Suppl. Mel. VI/1, 274 [2.1. 1525]; vielleicht sogar schon 1520/21: vgl.<br />
CR I, 145; XXI, 221). Diese Tatsache aber läßt es fraglich ersche<strong>in</strong>en, ob die (im Zusammenhang<br />
mit der patristischen Argumentation stehende) Betonung des actio-Momentes<br />
und des Ereignis-Charakters (man darf Melanchthon hier nicht den modernen aktualistisch-punktualistischen<br />
"Ereignis"-Begriff unterschieben!), die ja die substantiale Gegenwart<br />
des Leibes und Blutes Christi nicht aufgibt, überhaupt als Abweichung angesehen<br />
werden kann. Die Differenz zu <strong>Luther</strong> ist mehr e<strong>in</strong>e Differenz des theologischen Aspektes<br />
als e<strong>in</strong> wirklicher sachlicher Unterschied: <strong>Luther</strong> redet über die Gegenwart Christi im<br />
Abendmahl von der res sacramenti und der <strong>Konsekration</strong> her, Melanchthon von dem Totalzusammenhang<br />
und -ereignis des Abendmahles als solchem. Auf ke<strong>in</strong>en Fall hat dieser<br />
unterschiedliche Ausgangspunkt damit etwas zu tun, daß "es für Melanchthon nicht mehr<br />
so wie für <strong>Luther</strong> das erste Anliegen [ist], dem Wort der Schrift gehorsam zu se<strong>in</strong>" (47 f.).
(Vgl. hierzu Peter Fraenkel, Ten Questions concern<strong>in</strong>g Melanchthon, the Fathers and the<br />
Eucharist. Referat auf dem II. Internationalen Kongreß für <strong>Luther</strong>forschung, Münster, 8: I 3.<br />
August 1960.)<br />
Im 6. Kapitel (52-56) wird die berühmte und viel behandelte letzte Unterredung <strong>Luther</strong>s mit<br />
Melanchthon über das Abendmahl untersucht. Das Problem, um das es hier geht ist ob<br />
<strong>Luther</strong> <strong>in</strong> diesem Gespräch se<strong>in</strong>e bisherige Abendmahlsanschauung widerrufen oder doch<br />
zum<strong>in</strong>dest stark modifiziert hat. Der Verf. entscheidet diese Frage zutreffend dah<strong>in</strong>, daß<br />
"e<strong>in</strong>e grundsätzliche Revision nicht anzunehmen sei" (53).<br />
Der Verf. bezieht dieses Gespräch auf den Fall Besserer. Doch dürfte die von Joh. Haußleiter<br />
(NKZ 9, 1898, 831 ff.; 10, 1899, 455 ff.; vgl. E. Bizer, Stud. z. Gesch. d. Abendmahlsstreites<br />
im 16. Jhdt., 1940, 244, Anm.) herausgestellte Beziehung auf Bucer die zutreffende<br />
se<strong>in</strong>.<br />
Das 7., abschließende Kapitel ("<strong>Luther</strong>s <strong>Konsekration</strong>slehre <strong>in</strong> dogmengeschichtlicher<br />
Würdigung", 57-61) stellt <strong>Luther</strong>s und Melanchthons Lehre von der <strong>Konsekration</strong> <strong>in</strong> den<br />
dogmengeschichtlichen Zusammenhang. <strong>Luther</strong> knüpft, über die Scholastik h<strong>in</strong>weg, an die<br />
alte abendländische Tradition e<strong>in</strong>es Ambrosius und August<strong>in</strong> an (58). Demgegenüber ist<br />
Melanchthons Bestreitung der <strong>Konsekration</strong> dogmengeschichtlich "e<strong>in</strong> völliges Novum"<br />
(59) und e<strong>in</strong> Abfall von <strong>Luther</strong>s Lehre" (61). Das zeitweilige Vordr<strong>in</strong>gen der melanchthonischen<br />
Auffassung wird für den Bereich der lutherischen Kirche durch die Konkordienformel<br />
aufgehalten. In neuerer Zeit dagegen ist <strong>Luther</strong>s Konsekratianslehre mehr und mehr <strong>in</strong><br />
den H<strong>in</strong>tergrund gerückt, und damit ist auch der Befehl Christi verleugnet worden (6I). Gegenüber<br />
dieser Fehlentwicklung will der Verf. zu <strong>Luther</strong> und damit (I) zu dem ursprünglichen<br />
Befehl Christi zurückrufen.<br />
Den Beschluß der Arbeit bildet e<strong>in</strong> Anhang mit weiteren Quellenauszügen (62-82), e<strong>in</strong>em<br />
kurzen Literaturverzeichnis (83; hier vermißt man wesentliche neuere Literatur) sowie e<strong>in</strong>em<br />
Register (84).<br />
Da sich diese Arbeit als Beitrag zum gegenwärtigen Abendmahlsgespräch versteht, ist zu<br />
fragen. ob sie diese selbstgesetzte Aufgabe erfüllen kann. Dieses ist aus zwei Gründen zu<br />
verne<strong>in</strong>en. E<strong>in</strong>mal ist ihre Darstellung <strong>Luther</strong>s, <strong>in</strong> den Interpretationsergebnissen ke<strong>in</strong>eswegs<br />
Neues bietend und nicht über die bisherige Forschung h<strong>in</strong>ausführend, e<strong>in</strong>seitig und<br />
darum verzeichnend, wie oben gezeigt. Sie br<strong>in</strong>gt also nicht den ganzen und wahren <strong>Luther</strong><br />
zum Sprechen und kann darum auch nicht als gültiger von <strong>Luther</strong> ausgehender Beitrag<br />
zum gegenwärtigen Gespräch angesehen werden. Der zweite Grund warum diese Arbeit<br />
ihre Aufgabe nicht erfüllen kann, ist, daß die Aufgabe der Überprüfung der lutherischen<br />
Auffassung am Zeugnis des NT nicht klar gesehen, geschweige denn bejaht und erfüllt<br />
wird. (Offenbar ist für den Verf. das Zeugnis des NT mit der Lehre <strong>Luther</strong>s voll<strong>in</strong>haltlich<br />
identisch, so daß die Rückfrage nach dem nt.-lichen Befund gar nicht mehr ernsthaft gestellt<br />
zu werden braucht; vgl. die Schlußsätze [61]I) Von e<strong>in</strong>em lutherischen Beitrag zur gegenwärtigen<br />
Abendmahlsdiskussion ist zu fordern, daß er zum ersten die lutherischen<br />
Aussagen <strong>in</strong> ihrem ganzen Umfang und nach ihrer eigentlichen Intention darstellt und sie<br />
<strong>in</strong> Beziehung zur gegenwärtigen Fragestellung setzt und daß er sie zum zweiten mit dem<br />
Zeugnis des NT kritisch konfrontiert. Jedes andere Verfahren ist nicht als wirklicher Gesprächsbeitrag<br />
anzusehen. (Auch ist die nicht immer sehr sachliche und unvore<strong>in</strong>genommene<br />
Charakterisierung der gegenwärtigen Diskussion. die offensichtlich von kirchlichen<br />
und kirchenpolitischen Ressentiments [vgl. 60 f.; bes. 60, Anm.128] bestimmt ist, für e<strong>in</strong><br />
Gespräch nicht wirklich förderlich.)<br />
Der positive Wert dieser Veröffentlichung ist dar<strong>in</strong> zu sehen, daß sie das Material zu <strong>Luther</strong>s<br />
<strong>Konsekration</strong>slehre umfassend, klar geordnet und übersichtlich bereitstellt und daß<br />
sie damit deutlich macht, daß das Abendmahl bei <strong>Luther</strong> nicht <strong>in</strong> der Wort fides-Relation<br />
auf-, bzw: untergeht, sondern daß sich diese Relation ohne die res sacramenti und das
heißt: ohne die <strong>Konsekration</strong>, auflöst und verschw<strong>in</strong>det.<br />
5. Eugen Goschenhofer <strong>in</strong>: "Nachrichten d. Ev.-<strong>Luther</strong>ischen Kirche <strong>in</strong> Bayern", München,<br />
Nr. 7, 1. Aprilausgabe 61, 16. Jahrgang.<br />
Ausgangspunkt für diese theologie- und liturgiegeschichtliche Untersuchung ist für den<br />
Verfasser <strong>Luther</strong>s Glaube, daß die Kraft; die die <strong>Konsekration</strong> bewirkt, e<strong>in</strong>zig Christus und<br />
se<strong>in</strong> Wort ist. Deshalb ist der Reformator immun gegen jegliches römische <strong>Konsekration</strong>sverständnis<br />
und s<strong>in</strong>d ihm für jedes Abendmahl die E<strong>in</strong>setzungsworte konstitutiv. Der Gehorsam<br />
gegen den Stifterwillen zieht die Grenze gegenüber den Adiaphora im Abendmahl.<br />
In diesen Rahmen werden <strong>Luther</strong>s Äußerungen zur Transsubstantiation, zur Wandlung <strong>in</strong><br />
der römischen Messe und zur Elevation (die er anders begründet als die römische Kirche)<br />
<strong>in</strong>terpretiert. Ausführlich stellt der Verfasser die von <strong>Luther</strong>s <strong>Konsekration</strong>sverständnis her<br />
sich ergebende Abendmahlspraxis im Wittenberger Gebiet dar; ihr zufolge wird scharf unterschieden<br />
zwischen den konsekrierten und den nichtkonsekrierten Elementen; um vor allen<br />
verfänglichen Fragen bewahrt zu bleiben, wird die konsekrierte Abendmahlsspeise<br />
während der Kommunion völlig verzehrt.<br />
Diese Darlegungen legen uns, ohne gesetzlich oder gar römisch zu werden, e<strong>in</strong>e Bestandsaufnahme<br />
<strong>in</strong> den D<strong>in</strong>gen nahe, <strong>in</strong> denen man während. se<strong>in</strong>er Pfarrersausbildung<br />
so gut wie völlig sich selbst überlassen bleibt: Wie steht es bei uns mit der <strong>Konsekration</strong><br />
und der Behandlung der übriggebliebenen Speise? Welchen guten S<strong>in</strong>n kann die Abendmahlsanmeldung<br />
bei uns haben? Wer e<strong>in</strong>mal an e<strong>in</strong>em Abendmahl <strong>in</strong> der <strong>Braunschweig</strong>er<br />
Geme<strong>in</strong>de "Zu den Brüdern" teilgenommen hat, kann verstehen, daß diese Schrift dem<br />
verstorbenen Pfarrer dieser Geme<strong>in</strong>de, Max Witte, gewidmet ist.<br />
Im letzten Kapitel wird <strong>Luther</strong> mit den <strong>in</strong> dieser Frage anders denkenden Melanchthon verglichen.<br />
Von dem zutage tretenden Unterschied her werden die L<strong>in</strong>ien bis zum gegenwärtigen<br />
Abendmahlsgespräch anhand der Arnoldsha<strong>in</strong>er Thesen ausgezogen.<br />
Ungeklärt bleibt, weil der Verfasser darauf überhaupt nicht e<strong>in</strong>geht, wie zu dem Dargelegten<br />
das Verhalten <strong>Luther</strong>s und der Wittenberger während der Verhandlungen um die Wittenberger<br />
Konkordie 1536 paßt. Damals haben sich die Wittenberger mit dem H<strong>in</strong>weis Bucers<br />
und der Oberdeutschen begnügt, <strong>in</strong> Straßburg würden die übrigbleibenden Elemente<br />
wieder zu den unkonsekrierten Elementen zurückgelegt, "aber mit geziemender Ehrfurcht".<br />
Selbst wenn von diesem Entgegenkommen <strong>Luther</strong>s her sich manche Abstriche an<br />
des Verfassers Urteilen ergeben, so enthält die Untersuchung immer noch viele Anregungen,<br />
die wert s<strong>in</strong>d, von uns heute bedacht und praktiziert zu werden.<br />
6. "br." (= Pfarrer Wolfgang Büscher) <strong>in</strong>: Kirchliche Sammlung um Bibel und Bekenntnis,<br />
Informationsblatt, 2. Jahrgang Heft 9, 1969<br />
Angesichts der neu aufgebrochenen Frage nach dem Heiligen Abendmahl, se<strong>in</strong>em Wesen<br />
und se<strong>in</strong>er Bedeutung, ist dieses kle<strong>in</strong>e Büchle<strong>in</strong> (erschienen bereits 1960) e<strong>in</strong>e gute Hilfe<br />
zur Orientierung über <strong>Luther</strong>s Abendmahlsglaube und Abendmahlsfrömmigkeit. - Das<br />
Buch ist auch für den <strong>in</strong>teressierten Laien, ohne akademisch-theologisches Studium<br />
durchaus lesbar, da es alle late<strong>in</strong>ischen Zitate auch <strong>in</strong> Übersetzung wiedergibt. - Diestelmann<br />
hat se<strong>in</strong>e Untersuchung <strong>in</strong> 7 Kapiteln gegliedert wobei er von der Bedeutung der<br />
E<strong>in</strong>setzung des Hl. Mahles durch Jesus ausgeht, dann die E<strong>in</strong>setzungsworte und ihre Wirkung<br />
nach <strong>Luther</strong>s Auffassung betrachtet und im 3. Kapitel die <strong>Konsekration</strong> <strong>in</strong>nerhalb der<br />
Gesamthandlung der Abendmahlsfeier darstellt. - Dann folgt e<strong>in</strong> Kapitel über die <strong>Konsekration</strong>slehre<br />
beim "jungen <strong>Luther</strong>" und e<strong>in</strong>s über Melanchthons Abweichen von <strong>Luther</strong>s<br />
Lehre. - Interessant ist dann auch noch besonders das 6. Kapitel, <strong>in</strong> dem Diestelmann die<br />
letzte Unterredung <strong>Luther</strong>s mit Melanchthon über das Hl. Mahl untersucht, wobei die soge-
nannte "Heidelberger Landlüge" und der Fall Besserer zur Sprache kommen. Diestelmann<br />
zeigt, daß die Behauptung "<strong>in</strong> Bezug auf den, jungen <strong>Luther</strong>"` wie auch "<strong>in</strong> Bezug auf die<br />
letzten Lebenstage "<strong>Luther</strong>s" liege e<strong>in</strong>e Abschwächung bzw. Andersartigkeit der Abendmahlslehre<br />
<strong>Luther</strong>s" vor, nicht zu halten ist. - Das letzte Kapitel gibt e<strong>in</strong>e dogmengeschichtliche<br />
Würdigung der <strong>Konsekration</strong>slehre <strong>Luther</strong>s und e<strong>in</strong>en Ausblick, wobei Diestelmann<br />
auch auf die sogenannten "Arnoldsha<strong>in</strong>er Thesen" kurz zu sprechen kommt <strong>in</strong> denen<br />
angeblich "der, entscheidende Inhalt des biblischen Zeugnisses vom Abendmahl nieder-<br />
gelegt se<strong>in</strong> soll, ohne daß sachlich oder dem Wortlaut nach die <strong>Konsekration</strong> positiv<br />
erwähnt wird. Die hierdurch erstrebte E<strong>in</strong>heit gründet sich daher auf alles andere als auf<br />
die Erkenntnisse, die der Kirche durch Mart<strong>in</strong> <strong>Luther</strong> neu geschenkt wurden. Mit der Annahme<br />
dieser Thesen würde nicht nur <strong>Luther</strong>, nicht nur e<strong>in</strong>e grundlegende Bekenntnisschrift<br />
der lutherischen Kirche und nicht nur die abendländische vorscholastische Tradition<br />
verleugnet, sondern Christi eigenes Wort selbst". - Quellenanhang, Literatur-Verzeichnis<br />
und Stichwortregister machen dieses gediegene Bändchen zu e<strong>in</strong>em Fundort für die anstehende<br />
Frage. - Hier wird e<strong>in</strong>e Orientierungshilfe gegeben, wie wir sie dr<strong>in</strong>gend gerade<br />
jetzt brauchen.<br />
7. NN <strong>in</strong>: Les Questions Liturgiques & Pariessiales, C. C. P. Bruxelles No.<br />
1113.30, Abbaye du Mont CÉSAR (Belgique), No. 2 - 1962.<br />
Etude précieuse, faite avec diligence, sur un choix de textes parmi les plus<br />
significatifs des écrits de <strong>Luther</strong>. L'auteur relève la constance avec laquelle le<br />
Réformateur a professé la présence réelle du Seigneur dans l'Eucharistie, tout en ne<br />
voulant pas se rallier à l'idée de transsubstantiation telle que les scolastiques l'ont<br />
proposée. La démonstration est assez probante; mais on se demande si une trenta<strong>in</strong>e de<br />
textes, si clairs qu'ils soient, constituent une base suffisante pour exprimer toute la pensée<br />
de <strong>Luther</strong> aux différents stades de son évolution. Il est certa<strong>in</strong> toutefois qu'il a voulu<br />
toujours s'en tenir au contenu de l'Ecriture. Dans une courte synthèse f<strong>in</strong>ale, M. D. fait<br />
remarquer qu'en Occident aussi bien qu'en Orient, on a considéré aux premiers siècles<br />
que le sacrement de l'Eucharistie était effectué par un ensemble de rites et de prières,<br />
parmi lesquelles les paroles de l'<strong>in</strong>stitution. Mais il a fallu du temps avant qu'on en v<strong>in</strong>t à<br />
<strong>in</strong>sister nettement sur la valeur exclusive des verba <strong>in</strong>stitutionis. Ce serait dans cette<br />
perspective que <strong>Luther</strong> voulut s'en tenir aux seules données scripturaires.<br />
[Übersetzung:<br />
E<strong>in</strong>e wertvolle Studie, mit Fleiß erarbeitet, über e<strong>in</strong>e Auswahl von Texten aus den bedeutendsten<br />
Schriften <strong>Luther</strong>s. Der Verfasser hebt die Beharrlichkeit hervor, mit der der Reformator<br />
die Realpräsenz des HERRN im Hl, Abendmahl bekannt hat, ohne sich der Idee der<br />
Transsubstantiation anzuschließen, wie sie die Scholastiker vorgelegt haben. Die Beweisführung<br />
ist überzeugend genug; aber man fragt sich, ob e<strong>in</strong>e Reihe von ungefähr 30 Texten,<br />
so klar sie se<strong>in</strong> mögen, e<strong>in</strong>e genügende Basis darstellen, um alle Gedanken <strong>Luther</strong>s<br />
<strong>in</strong> den verschiedenen Stadien se<strong>in</strong>er Entwicklung wiederzugeben, Es ist jedoch gewiß,<br />
daß er sich immer an den Inhalt der Schrift hat halten wollen, In e<strong>in</strong>er kurzen Schlußzusammenfassung<br />
macht Monsieur D, darauf aufmerksam, daß man sowohl im Abendland<br />
wie im Orient <strong>in</strong> den ersten Jahrhunderten bedacht hat, daß das Sakrament der Eucharistie<br />
mit e<strong>in</strong>er Fülle von Riten und Gebeten durchgeführt wurde, unter ihnen die E<strong>in</strong>setzungsworte.<br />
Aber es hat lange gedauert, bis man dazu kam, ausschließlich Wert auf die<br />
E<strong>in</strong>setzungsworte zu legen, In dieser H<strong>in</strong>sicht wollte <strong>Luther</strong> nur bei den gegebenen Schriftworten<br />
bleiben.]<br />
8. NN <strong>in</strong>: Lumière et Vie Année, 1961, N° 94, Page 144
(Zugleich Rezension zu: August KIMME, Der Inhalt der Arnoldsha<strong>in</strong>er Abendmahlsthesen<br />
(<strong>Luther</strong>tum 23), Berl<strong>in</strong>, <strong>Luther</strong>isches Verlagshaus, 1960, 184 p.),<br />
Après un travail d'une diza<strong>in</strong>e d'années, la commission de la Sa<strong>in</strong>te Cène de l'E.K.D.<br />
(Eglise Evangélique d'Allemagne) a publié, en novembre 1957, une série de thèses, dites<br />
thèses d'Arnoldsha<strong>in</strong>, dans lesquelles se trouve exprimé ce que des théologiens de<br />
confessions luthérienne, réformée et unie, au se<strong>in</strong> de l'Eglise Evangélique allemande,<br />
«croient pouvoir répondre en commun aux questions concernant la nature, le don et la<br />
réception de la Sa<strong>in</strong>te Cène, en se fondant sur les résultats des travaux récents de<br />
1'exégèse néotestamentaire.»<br />
Pour déf<strong>in</strong>ir le contenu exact de ces thèses, August Kimme dans le cahier 23 de<br />
«<strong>Luther</strong>tum» a mis en œuvre les explications d'un certa<strong>in</strong> nombre de théologiens ayant<br />
participé à leur élaboration ou ayant été plus ou mo<strong>in</strong>s officieusement chargés de les<br />
présenter au public.<br />
Pour contribuer au débat auquel ces thèses ont donné lieu, la thèse de Jürgen<br />
Diestelmann rapelle les positions de <strong>Luther</strong> sur la Sa<strong>in</strong>te Cène et notamment sur<br />
l'efficacité des paroles de l'<strong>in</strong>stitution.<br />
[Übersetzung vorstehender Rezension):<br />
Nach e<strong>in</strong>er Arbeit von ungefähr 10 Jahren hat Kommission des Hl. Abendmahles der EKD<br />
(Ev. Kirche Deutschland) im November 1957 e<strong>in</strong>e Reihe von Thesen veröffentlicht, die sogenannten<br />
Arnoldsha<strong>in</strong>er Thesen, <strong>in</strong> denen sich ausgedrückt f<strong>in</strong>det, was Theologen lutherischer,<br />
reformierter und unierter Konfession im Schoß der deutschen evangelischen Kirche<br />
"glauben geme<strong>in</strong>sam antworten zu können auf die Fragen betr. die Natur, die Gabe<br />
und den Empfang des Hl. Abendmahls, unter Berufung auf die Ergebnisse der neusten Arbeiten<br />
der neutestamentlichen Exegese".<br />
Um den genannten Inhalt dieser Thesen zu umreißen, hat August Kimme im Heft 23 des<br />
"<strong>Luther</strong>tum" die Erklärungen e<strong>in</strong>er gewissen Anzahl von Theologen zusammengestellt, die<br />
an ihrer Ausarbeitung teilgehabt haben oder mehr oder weniger beauftragt waren, sie der<br />
Öffentlichkeit darzulegen.- Um zu der Debatte, zu der diese Thesen Anlaß gegeben haben,<br />
beizutragen, fügt die Dissertation von Jürgen Diestelmann die Stellungen <strong>Luther</strong>s<br />
über das Hl. Abendmahl und besonders über die Wirksamkeit der E<strong>in</strong>setzungsworte h<strong>in</strong>zu.<br />
9. Paul Re<strong>in</strong>hardt<br />
Der Vorzug dieser Arbeit besteht dar<strong>in</strong>, daß sie möglichst weitgehend <strong>Luther</strong> selbst aus<br />
se<strong>in</strong>en Abendmahls-schriften zitiert und außerdem noch e<strong>in</strong>en fast 20seitigen<br />
Quellenanhang bietet. Ausgehend von der Bedeutung der E<strong>in</strong>setzung des Heiligem Mahles<br />
durch Jesus fragt der Verfasser nach den <strong>Konsekration</strong>sworten und ihrer Wirkung und<br />
zwar <strong>in</strong>nerhalb der ganzen actio sacramentalis. E<strong>in</strong>e besondere Überlegung wirdmet er<br />
der Stellung der Konsekratioiislehre bei dem sog. „Jungen <strong>Luther</strong>". Nach e<strong>in</strong>er Darstellung<br />
der Abweichung Melanchthons von <strong>Luther</strong>, wozu auch die Ausführungen über die „Heidelberger<br />
Landlüge" und den „Fall Besserer" gehören, gibt der Verfasser e<strong>in</strong>e kurze zusammenfassende<br />
Würdigung von <strong>Luther</strong>s Konsekratiemslehre mit e<strong>in</strong>enn H<strong>in</strong>weis auf die<br />
Amoldsha<strong>in</strong>er Abendmahlsthesen, <strong>in</strong> welchen ja Äußerungcn über die <strong>Konsekration</strong> bewußt<br />
verrnieden worden s<strong>in</strong>d. Es wäre e<strong>in</strong>e Überforderung, wenn man von e<strong>in</strong>er so knappen<br />
S•ch^ift verlangrn wollte, daß sie die mancherlei Probleme, welche die Frage der Konaickration<br />
aufwirft, auch nur annähernd ausbreiten solle. Auch ohne e<strong>in</strong>e solche kritische<br />
Darstellung behält das Heft mit den dargebotenen Quellen se<strong>in</strong>en e<strong>in</strong>deutigen Wert. Dies<br />
gilt besonders auch deshalb, weil der Verfasser sich bemüht, die doppelte Bedeutung herauszustellen,<br />
welche die E<strong>in</strong>setzungsworte im Zusarnmenhang mit der ganzen Abendmahlshandlung<br />
nach <strong>Luther</strong>s Auffassung haben: „Die e<strong>in</strong>e, die den Elementen zugewandt
ist (<strong>Konsekration</strong>), die andere, dle sich an die Greme<strong>in</strong>de wendet (Verkündigung). Auf beide<br />
legt <strong>Luther</strong> großen Wert, je nach .Erfordernis diese oder Jene besonders hervorhebend"<br />
(S. 43).<br />
10. Werner Schill<strong>in</strong>g:<br />
Das Büchle<strong>in</strong> behandelt e<strong>in</strong>e Spezialfrage der Abendmahlslehre, nämlich die, wie es um<br />
die „Segnung“ oder „Weihung der Elemente“ (Brot und We<strong>in</strong>) stehe. Es wird von der Bedeutung<br />
der E<strong>in</strong>setzung des Mahles durch Jesus, von den <strong>Konsekration</strong>sworten und ihrer<br />
Wirkung, von der <strong>Konsekration</strong>slehre des jungen <strong>Luther</strong> und von Melanchthons Abweichungen<br />
gegenüber <strong>Luther</strong> gesprochen. Schließlich wird <strong>Luther</strong>s Auffassung dogmengeschichtlich<br />
gewürdigt.<br />
Die Arbeit kommt zu dem Ergebnis, daß die <strong>Konsekration</strong> nicht <strong>in</strong> e<strong>in</strong>zelnen Worten (etwa<br />
beim Kreuzschlagen) bestehe, sondern daß sie durch die ganze Handlung geschehe. <strong>Luther</strong><br />
sei alles darauf angekommen, daß die Gnadengabe des Heiligen Mahles ganz unabhängig<br />
sei von menschlichem Zutun. Die Vorstellung sei falsch, daß mit dem Kreuzschlagen<br />
über Brot und We<strong>in</strong> die <strong>Konsekration</strong> erfolge. Das Kreuzschlagen sei im 16. Jahrhundert<br />
überhaupt nicht geübt worden, sondern sei erst viel später aufgekommen.<br />
Der Verfasser beanstandet, daß <strong>in</strong> den "Arnoldsha<strong>in</strong>er Thesen" die <strong>Konsekration</strong> im S<strong>in</strong>ne<br />
der von Jesus e<strong>in</strong>gesetzten ganzen Handlung (Essen, Tr<strong>in</strong>ken, Worte Christi, Ritus) weder<br />
sachlich noch dem Wortlaut nach erwähnt sei und daß daher der der Kirche von Christus<br />
gegebene <strong>Konsekration</strong>sauftrag nicht mehr im Blickfeld sei. Mit der Annahme dieser Thesen<br />
würden nicht nur <strong>Luther</strong> und die Bekenntnisschriften, sondern Christi eigenes Wort<br />
selbst verleugnet (S. 61).<br />
E<strong>in</strong> Quellen-Anhang beschließt diese nützliche Arbeit, der m<strong>in</strong>destens <strong>in</strong> ihrer Hauptthese,<br />
daß die <strong>Konsekration</strong> <strong>in</strong> der ganzen Handlung der Abendmahlsfeier bestehe, schwerlich<br />
widersprochen werden kann.<br />
11. Eugen Goschenhofer <strong>in</strong>: "Nachrichten d. Ev.-<strong>Luther</strong>ischen Kirche <strong>in</strong> Bayern",<br />
München, Nr. 7, 1. Aprilausgabe 61, 16. Jahrgang.<br />
Ausgangspunkt für diese theologie- und liturgiegeschichtliche Untersuchung ist für den<br />
Verfasser <strong>Luther</strong>s Glaube, daß die Kraft; die die <strong>Konsekration</strong> bewirkt, e<strong>in</strong>zig Christus und<br />
se<strong>in</strong> Wort ist. Deshalb ist der Reformator immun gegen jegliches römische <strong>Konsekration</strong>sverständnis<br />
und s<strong>in</strong>d ihm für jedes Abendmahl die E<strong>in</strong>setzungsworte konstitutiv. Der Gehorsam<br />
gegen den Stifterwillen zieht die Grenze gegenüber den Adiaphora im Abendmahl.<br />
In diesen Rahmen werden <strong>Luther</strong>s Äußerungen zur Transsubstantiation, zur Wandlung <strong>in</strong><br />
der römischen Messe und zur Elevation (die er anders begründet als die römische Kirche)<br />
<strong>in</strong>terpretiert. Ausführlich stellt der Verfasser die von <strong>Luther</strong>s <strong>Konsekration</strong>sverständnis her<br />
sich ergebende Abendmahlspraxis im Wittenberger Gebiet dar; ihr zufolge wird scharf unterschieden<br />
zwischen den konsekrierten und den nichtkonsekrierten Elementen; um vor allen<br />
verfänglichen Fragen bewahrt zu bleiben, wird die konsekrierte Abendmahlsspeise<br />
während der Kommunion völlig verzehrt.<br />
Diese Darlegungen legen uns, ohne gesetzlich oder gar römisch zu werden, e<strong>in</strong>e Bestandsaufnahme<br />
<strong>in</strong> den D<strong>in</strong>gen nahe, <strong>in</strong> denen man während. se<strong>in</strong>er Pfarrersausbildung<br />
so gut wie völlig sich selbst überlassen bleibt: Wie steht es bei uns mit der <strong>Konsekration</strong><br />
und der Behandlung der übriggebliebenen Speise? Welchen guten S<strong>in</strong>n kann die Abendmahlsanmeldung<br />
bei uns haben? Wer e<strong>in</strong>mal an e<strong>in</strong>em Abendmahl <strong>in</strong> der <strong>Braunschweig</strong>er<br />
Geme<strong>in</strong>de "Zu den Brüdern" teilgenommen hat, kann verstehen, daß diese Schrift dem<br />
verstorbenen Pfarrer dieser Geme<strong>in</strong>de, Max Witte, gewidmet ist.
Im letzten Kapitel wird <strong>Luther</strong> mit den <strong>in</strong> dieser Frage anders denkenden Melanchthon verglichen.<br />
Von dem zutage tretenden Unterschied her werden die L<strong>in</strong>ien bis zum gegenwärtigen<br />
Abendmahlsgespräch anhand der Arnoldsha<strong>in</strong>er Thesen ausgezogen.<br />
Ungeklärt bleibt, weil der Verfasser darauf überhaupt nicht e<strong>in</strong>geht, wie zu dem Dargelegten<br />
das Verhalten <strong>Luther</strong>s und der Wittenberger während der Verhandlungen um die Wittenberger<br />
Konkordie 1536 paßt. Damals haben sich die Wittenberger mit dem H<strong>in</strong>weis Bucers<br />
und der Oberdeutschen begnügt, <strong>in</strong> Straßburg würden die übrigbleibenden Elemente<br />
wieder zu den unkonsekrierten Elementen zurückgelegt, "aber mit geziemender Ehrfurcht".<br />
Selbst wenn von diesem Entgegenkommen <strong>Luther</strong>s her sich manche Abstriche an<br />
des Verfassers Urteilen ergeben, so enthält die Untersuchung immer noch viele Anregungen,<br />
die wert s<strong>in</strong>d, von uns heute bedacht und praktiziert zu werden.<br />
E<strong>in</strong>e Wirkung der Broschüre „<strong>Konsekration</strong>“ <strong>in</strong> Schweden (1963):<br />
Nach dem Ersche<strong>in</strong>en der Broschüre „<strong>Konsekration</strong>“ wurde ich zur Weiterarbeit auch durch das Folgende ermuntert:<br />
Den schwedischen Pfarrer Sven Oskar Berglund lernte ich bei e<strong>in</strong>er Tagung des damaligen Landessuper<strong>in</strong>tendenten<br />
(späteren Landesbischofs) Heubach <strong>in</strong> Ratzeburg kennen. Da kam mir nämlich auf den Stufen zur Kirche e<strong>in</strong> Herr<br />
entgegen. Da wir beide Kollar trugen, g<strong>in</strong>gen wir uns lächelnd entgegen und stellten uns gegenseitig vor. Er erwiderte<br />
mir darauf: „Ach s<strong>in</strong>d Sie der Diestelmann, der über die <strong>Konsekration</strong> geschrieben hat?“ Es stellte sich heraus, daß<br />
me<strong>in</strong>e Broschüre ihm <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er persönlich schwierigen Situation sehr geholfen hat, sodaß me<strong>in</strong> Name ihm <strong>in</strong> Er<strong>in</strong>nerung<br />
geblieben war.<br />
Sven Oskar Berglund war nämlich Anfang der 60-er Jahre Vorsteher des Laurentiusstiftes <strong>in</strong> Lund, e<strong>in</strong>es<br />
Studentenheimes der südschwedischen hochkirchlichen Bewegung mit eigener Kirche und sehr regem<br />
gottesdienstlichen Leben, d. h. mit regelmäßiger Meßfeier und Stundengebeten. Die Gottesdienste fanden regen Zulauf.<br />
E<strong>in</strong>e große Zahl von Studierenden, aber auch andere Gläubige der Stadt nahmen daran regelmäßig teil. Dieses<br />
geistliche Leben war ganz von Schrift und Bekenntnis geprägt und daher von ähnlichem bzw. gleichem Charakter wie<br />
das Geme<strong>in</strong>deleben <strong>in</strong> St.Ulrici-Brüdern <strong>in</strong> <strong>Braunschweig</strong>.<br />
Aber auch <strong>in</strong> Schweden gab es protestantischen Widerstand gegen solche gottesdienstliche Erneuerungsbewegungen.<br />
In Lund geschah dies vor allem von seiten des damaligen Bischofs Mart<strong>in</strong> L<strong>in</strong>dström, dem Vorgesetzten Sven O.<br />
Berglunds.<br />
In se<strong>in</strong>en Memoiren „Laurentiusstiftelsen i brytn<strong>in</strong>gstid“ (Lund 2000, S. 150 ff.) berichtet Sven O. Berglund (nachfolgend<br />
<strong>in</strong>s Deutsche übersetzt) :<br />
„Am letzten Maisonntag 1963 hatte Mart<strong>in</strong> L<strong>in</strong>dström die Hochmesse <strong>in</strong> der Kapelle besucht. Es war der 6. Sonntag<br />
nach Ostern. Viele Studenten waren bereits heimgereist, aber die Kapelle war dennoch ganz gut besucht. Bischof Aulén<br />
gehörte zu den Besuchern, tat aber ke<strong>in</strong>en Dienst als Liturg. Ich selbst hielt die Messe.“ (Gustaf Aulén, geb. 1879, gest.<br />
1977, der seit 1913 Professor für Systematische Theologie <strong>in</strong> Lund gewesen war, seit 1922 dann Bischof der Diözese<br />
Strängnäs, lebte <strong>in</strong> se<strong>in</strong>em Ruhestand <strong>in</strong> Lund.) „L<strong>in</strong>dström folgte mit der Schlußprozession h<strong>in</strong>aus <strong>in</strong> die Sakristei und<br />
wollte unmittelbar danach e<strong>in</strong> Gespräch beg<strong>in</strong>nen. Aber ich bat den Sakristan dem Bischof e<strong>in</strong> Stundengebetbuch zu<br />
geben und begann mit der Lesung der Schlußgebete 'Post Missam'. Der Bischof hörte ungeduldig zu und sofort danach<br />
stellte er fest, daß das Schlußevangelium auch <strong>in</strong> der römischen Kirche nunmehr nicht mehr gelesen werde. Darauf<br />
antwortete ich bestimmt, aber freundlich, daß ich mich nicht dafür <strong>in</strong>teressiere, was man <strong>in</strong> dieser H<strong>in</strong>sicht <strong>in</strong> Rom tue<br />
oder nicht tue.“ Mart<strong>in</strong> L<strong>in</strong>dström bestellte ihn daraufh<strong>in</strong> zu e<strong>in</strong>em bestimmten Term<strong>in</strong> <strong>in</strong> den nächsten Tagen <strong>in</strong>s<br />
Bischofshaus e<strong>in</strong>.<br />
Sven O. Berglund berichtet weiter: „Kaum war ich im Pfarrhaus angekommen, kl<strong>in</strong>gelte es an der Haustür. Da stand<br />
Bischof Aulén. Er hatte gemerkt, daß etwas im Gange war, als L<strong>in</strong>dström <strong>in</strong> die Sakristei g<strong>in</strong>g, und hatte gewartet, bis er<br />
wieder herauskam. L<strong>in</strong>dström hatte wissen lassen, daß er über die Meßfeier im Laurentiusstiftelsen aufgebracht sei und<br />
die Absicht habe, e<strong>in</strong>zugreifen. Aulén hatte versucht, ihn zu beruhigen und ihn gebeten, von Maßnahmen abzusehen.<br />
Aber dagegen stand L<strong>in</strong>dströms feste Absicht. Aulén me<strong>in</strong>te, daß ich e<strong>in</strong>iges Düstere zu erwarten hätte, ermunterte mich<br />
aber und erklärte, daß eigentlich gar nichts passieren könne.“<br />
Schon vor dem Term<strong>in</strong> bei L<strong>in</strong>dström erfuhr Sven O. Berglund, daß auch der Dompropst und der Kontraktspropst dabei<br />
anwesend se<strong>in</strong> würden. Es sollte also e<strong>in</strong> regelrechtes Verhör unter Zeugen stattf<strong>in</strong>den. L<strong>in</strong>dström hatte e<strong>in</strong>e
umfangreiche Liste mit Anklagen vorbereitet. Dabei handekte es sich <strong>in</strong>sbesondere darum, daß er Anstoß an jenen<br />
gottesdienstlichen Gepflogenheiten genommen hatte, die nicht dem üblichen schwedischen Gottesdiensten<br />
entsprachen. (Knien oder Stehen, Verwendung bestimmter Hostien, Elevation, Verzehr übriger Abendmahlselemente<br />
etc.), Unterschwellig klang dabei mehrfach der Vorwurf römisch-katholischer Ansichten durch.<br />
Sven O. Berglund wußte den e<strong>in</strong>zelnen Anklagen <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er ausführlichen Antwort durchaus zu begegnen. L<strong>in</strong>dström<br />
hatte ihm u.a. auch vorgehalten, er solle für das Übriggebliebene e<strong>in</strong>e Pisc<strong>in</strong>a verwenden. Sven O. Berglund berichtet<br />
wörtlich „... Er schrie dreimal, dies sei lutherisch. Me<strong>in</strong>e Antwort war, daß die Anweisung, den We<strong>in</strong> zurück zu gießen <strong>in</strong><br />
theologischen Äußerungen lange nach <strong>Luther</strong> vorkämen. Aber um zu bestimmen, was lutherisch ist, muß man sich an<br />
das halten, was <strong>Luther</strong> selbst gesagt hat. Und hier wies ich auf Diestelmanns Abhandlung Consecratio h<strong>in</strong>, wo dieser<br />
deutlich aufweist, wie <strong>Luther</strong> mit der Sache e<strong>in</strong>es Priesters Wolfer<strong>in</strong>us umg<strong>in</strong>g, der den We<strong>in</strong> <strong>in</strong> die Flasche zurückgoß.<br />
Er sagte, vernünftigerweise solle er handeln wie <strong>in</strong> Wittenberg, d.h. wenn We<strong>in</strong> übrig bleibt, soll dieser <strong>in</strong> der Sakristei<br />
vom Priester oder e<strong>in</strong>igen Kommunikanten sumiert werden.“ Auch wies Sven O. Berglund auf die Kirchenordnung<br />
Laurentius Petri h<strong>in</strong>. Aber für se<strong>in</strong>e Argumentation wurde er nur „mit e<strong>in</strong>em Schnauben“ („med en frysn<strong>in</strong>g“) abgefertigt.<br />
Zehn Jahre nach jenen Kämpfen um Brüdern-St.Ulrici hat sich also <strong>in</strong> Schweden e<strong>in</strong> dazu ganz paralleler Vorgang<br />
zugetragen: In beiden Fällen stellten sich Vertreter der kirchlichen Obrigkeit fe<strong>in</strong>dselig gegen e<strong>in</strong>e gottesdienstliche<br />
Erneuerung: In <strong>Braunschweig</strong> e<strong>in</strong> großer Teil der Landessynode, <strong>in</strong> Lund der Bischof. In beiden Fällen suchte man nicht<br />
mit stichhaltigen theologischen Argumenten gegen die gottesdienstliche Erneuerung vorzugehen – von Schrift und<br />
Bekenntnis her wäre das ja auch nicht möglich gewesen, - sondern unterstellte ihr e<strong>in</strong>e „unlutherische“ Ausrichtung,<br />
wobei zum Beurteilungsmaßstab die „Normalform“ des gängigen protestantischen Gottesdienstes gemacht wurde. In<br />
dieser Situation hatte Sven O. Berglund mit me<strong>in</strong>er Broschüre „<strong>Konsekration</strong>“ e<strong>in</strong> kaum zu widerlegendes<br />
Gegenargument <strong>in</strong> der Hand, auf das man nur mit „mit e<strong>in</strong>em Schnauben“ („med en frysn<strong>in</strong>g“) antworten konnte.<br />
(Obgleich freilich festzustellen ist, daß auch persönliche Äußerungen <strong>Luther</strong>s nicht der letzte Maßstab se<strong>in</strong> kann,<br />
sondern das, worauf sich die Kirche nach Schrift und Bekenntnis verb<strong>in</strong>dlich festgelegt hat.)<br />
Erst später erfuhr ich, daß schon im Januar 1962 <strong>in</strong> der „Svensk Pastoraltidskrift“ (Nr. 5/1962, S. 9) e<strong>in</strong>e sehr positive<br />
Rezension me<strong>in</strong>er Broschüre „<strong>Konsekration</strong>“ gestanden hatte (siehe oben!), durch die sie <strong>in</strong> Schweden so bekannt<br />
wurde, daß Sven O. Berglund sich vor Bischof L<strong>in</strong>dström darauf berufen konnte. In dieser Rezension hatte sogar<br />
gestanden, sie sei „e<strong>in</strong>e vortreffliche Publikation, die aufs schnellste auf schwedisch im Druck ersche<strong>in</strong>en sollte“ („en<br />
förträfflig publikation, so med det snaraste bör förhjälpas till svenskt tryck.“) Dazu ist es nicht gekommen. Aber die<br />
beiden Namen Hermann Sasse und Sven O. Berglund blieben für mich Ansporn, an dem Thema me<strong>in</strong>es Lebens dran zu<br />
bleiben.