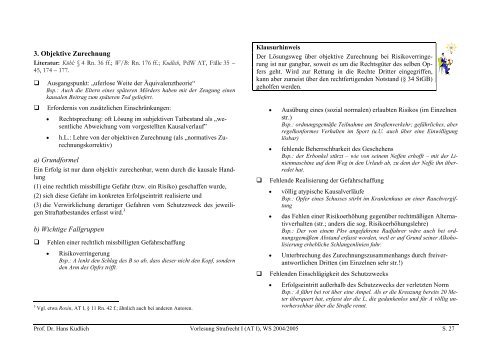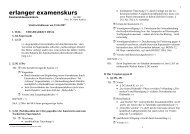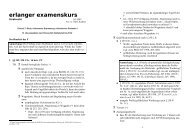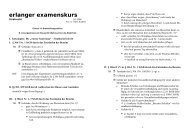3. Objektive Zurechnung a) Grundformel b) Wichtige Fallgruppen
3. Objektive Zurechnung a) Grundformel b) Wichtige Fallgruppen
3. Objektive Zurechnung a) Grundformel b) Wichtige Fallgruppen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>3.</strong> <strong>Objektive</strong> <strong>Zurechnung</strong><br />
Literatur: Kühl: § 4 Rn. 36 ff.; W/B: Rn. 176 ff.; Kudlich, PdW AT, Fälle 35 –<br />
45, 174 – 177.<br />
� Ausgangspunkt: „uferlose Weite der Äquivalenztheorie“<br />
Bsp.: Auch die Eltern eines späteren Mörders haben mit der Zeugung einen<br />
kausalen Beitrag zum späteren Tod geliefert.<br />
� Erfordernis von zusätzlichen Einschränkungen:<br />
• Rechtsprechung: oft Lösung im subjektiven Tatbestand als „wesentliche<br />
Abweichung vom vorgestellten Kausalverlauf”<br />
• h.L.: Lehre von der objektiven <strong>Zurechnung</strong> (als „normatives <strong>Zurechnung</strong>skorrektiv)<br />
a) <strong>Grundformel</strong><br />
Ein Erfolg ist nur dann objektiv zurechenbar, wenn durch die kausale Handlung<br />
(1) eine rechtlich missbilligte Gefahr (bzw. ein Risiko) geschaffen wurde,<br />
(2) sich diese Gefahr im konkreten Erfolgseintritt realisierte und<br />
(3) die Verwirklichung derartiger Gefahren vom Schutzzweck des jeweiligen<br />
Straftatbestandes erfasst wird. 3<br />
b) <strong>Wichtige</strong> <strong>Fallgruppen</strong><br />
� Fehlen einer rechtlich missbilligten Gefahrschaffung<br />
• Risikoverringerung<br />
Bsp.: A lenkt den Schlag des B so ab, dass dieser nicht den Kopf, sondern<br />
den Arm des Opfrs trifft.<br />
3 Vgl. etwa Roxin, AT I, § 11 Rn. 42 f.; ähnlich auch bei anderen Autoren.<br />
Klausurhinweis<br />
Der Lösungsweg über objektive <strong>Zurechnung</strong> bei Risikoverringerung<br />
ist nur gangbar, soweit es um die Rechtsgüter des selben Opfers<br />
geht. Wird zur Rettung in die Rechte Dritter eingegriffen,<br />
kann aber zumeist über den rechtfertigenden Notstand (§ 34 StGB)<br />
geholfen werden.<br />
• Ausübung eines (sozial normalen) erlaubten Risikos (im Einzelnen<br />
str.)<br />
Bsp.: ordnungsgemäße Teilnahme am Straßenverkehr; gefährliches, aber<br />
regelkonformes Verhalten im Sport (u.U. auch über eine Einwilligung<br />
lösbar)<br />
• fehlende Beherrschbarkeit des Geschehens<br />
Bsp.: der Erbonkel stürzt – wie von seinem Neffen erhofft – mit der Linienmaschine<br />
auf dem Weg in den Urlaub ab, zu dem der Neffe ihn überredet<br />
hat.<br />
� Fehlende Realisierung der Gefahrschaffung<br />
• völlig atypische Kausalverläufe<br />
Bsp.: Opfer eines Schusses stirbt im Krankenhaus an einer Rauchvergiftung<br />
• das Fehlen einer Risikoerhöhung gegenüber rechtmäßigen Alternativverhalten<br />
(str.; anders die sog. Risikoerhöhungslehre)<br />
Bsp.: Der von einem Pkw angefahrene Radfahrer wäre auch bei ordnungsgemäßem<br />
Abstand erfasst worden, weil er auf Grund seiner Alkoholisierung<br />
erhebliche Schlangenlinien fuhr.<br />
• Unterbrechung des <strong>Zurechnung</strong>szusammenhangs durch freiverantwortlichen<br />
Dritten (im Einzelnen sehr str.!)<br />
� Fehlenden Einschlägigkeit des Schutzzwecks<br />
• Erfolgseintritt außerhalb des Schutzzwecks der verletzten Norm<br />
Bsp.: A fährt bei rot über eine Ampel. Als er die Kreuzung bereits 20 Meter<br />
überquert hat, erfasst der die L, die gedankenlos und für A völlig unvorhersehbar<br />
über die Straße rennt.<br />
Prof. Dr. Hans Kudlich Vorlesung Strafrecht I (AT I), WS 2004/2005 S. 27
• Mitwirkung an einer eigenverantwortlichen Selbstgefährdung<br />
Bsp.: A und B veranstalten ein waghalsiges Motorradrennen über einen<br />
Acker, bei dem sich B schwer verletzt.<br />
• <strong>Zurechnung</strong> zu einem fremden Verantwortungsbereich<br />
Bsp.: Retter-Fälle: O sieht, dass es im Haus des A brennt. Er möchte retten,<br />
was zu retten ist und wird von einem herunterfallenden Dachbalken<br />
erschlagen. A hatte das Haus selbst angezündet, um die Versicherungssumme<br />
zu kassieren. (Anregung zum Nachdenken: Spielt es eine Rolle, ob<br />
O ein völlig Unbeteiligter, der Bruder von A’s Frau [die er im Haus vermutet]<br />
oder ein Feuerwehrmann ist?)<br />
Klausurhinweis:<br />
Die Lehre von der objektiven <strong>Zurechnung</strong> sowie die vorgenannten<br />
<strong>Fallgruppen</strong> und Untergruppen sind in ihren Details teilweise heftig<br />
umstritten. In praktischen Fällen sind auch oft mehrere der vorgenannten<br />
Lösungspunkte anwendbar (so z.B. bei den „Retter-<br />
Fällen“ der Gedanke der eigenverantwortlichen Selbstgefährdung).<br />
In der Klausur sollte deswegen in derartigen Fällen mit möglichst<br />
vielen einschlägigen Gesichtspunkten argumentiert werden.<br />
Vertiefende Hinweise:<br />
a) Lesenswerte Entscheidungen<br />
− BGHSt 11, 1 (Latswagenfall)<br />
− BGHSt 49, 1 = NJW 2004, 237 m. Anm. Roxin StV 2004, 485 ff. sowie<br />
Puppe, NStZ 2004, 554 ff.<br />
b) Aufsätze<br />
− Erb, <strong>Zurechnung</strong> von Erfolgen im Strafrecht, JuS 1994, 449 ff.<br />
− Puppe, Die Lehre von der objektiven <strong>Zurechnung</strong> dargestellt an Beispielsfällen<br />
aus der höchstrichterlichen Rechtsprechung, Jura 1997,<br />
408 ff., 513 ff.<br />
Prof. Dr. Hans Kudlich Vorlesung Strafrecht I (AT I), WS 2004/2005 S. 28