Kora népvándorláskori sírleletek Budapest területéről - EPA
Kora népvándorláskori sírleletek Budapest területéről - EPA
Kora népvándorláskori sírleletek Budapest területéről - EPA
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
ist, daß die Schlaufen–Haken–Konstruktion<br />
ausschließlich bei den Torques aus Buntmetall und<br />
den kleineren Ohrringen verwendet wurde. Der<br />
Zweihakenverschluß benötigt einfach einen<br />
kürzeren Draht; Diese Art, die Goldtorques zu<br />
schließen, wird vermutlich durch<br />
Materialeinsparung erklärt.<br />
Die Analogien der Torques–Anhänger–<br />
Kombination im Grab am Rákos–Bach finden sich in<br />
einem sehr großen Gebiet und vertreten mehrere<br />
Jahrhunderte. Eine Richtung der Verbreitung führt<br />
in Richtung des römischen Schmuckes, in dem<br />
Torques mit Halbmondanhänger oder Bulle in der<br />
Männer– und Frauentracht gleicherweise<br />
vorkommen. In der Castellani–Sammlung hängt an<br />
einem mit zwei Schlaufen geschlossenen tordierten<br />
Goldtorques eine runde Bulle. Bei den Germanen<br />
hatte das Tragen des Torques eine besondere<br />
Bedeutung. Goldtorques und goldene Armreife sind<br />
die Würdezeichen in barbarischen Königsgräbern<br />
des 3.–5. Jahrhunderts (Hassleben, Céke,<br />
Osztrópataka, Sackrau, Pietroasa usw.). Wie<br />
Michael Schmauder in seiner detaillierten<br />
Zusammenfassung nachwies, kann das Tragen des<br />
Torques in spätantiker Zeit, im römischen Milieu,<br />
amtliche rangbezeichnende Funktion gehabt haben,<br />
mit bestimmendem militärischen Charakter.<br />
Die andere Richtung der Torques–Lunula–<br />
Schmuckzusammensetzung führt nach Osten in<br />
das nördliche und östliche Küstengebiet des<br />
Schwarzen Meeres. Die alanischen Aristokraten<br />
des Kuban’–Gebietes trugen Halsschmuck aus<br />
glattem Golddraht mit Schlaufen–Haken–<br />
Verschluß schon im 1.–2. Jahrhundert. In den<br />
Katakomben von Kertsch wurden am Ende des 4.<br />
Jahrhunderts bis in die ersten Jahrzehnte des 5.<br />
Jahrhunderts die Mitglieder der lokalen<br />
Aristokratie mit ihrem Schmuck versehen bestattet:<br />
mit Diademen, goldblechüberzogenen Fibeln,<br />
Goldtorques mit Schlaufen–Haken–Verschluß.<br />
Kleine tordierte goldene Halsringe mit 8,5–11,1 cm<br />
Dm lagen in den Kindergräbern der Kertscher<br />
Katakomben. Die in die Kölner Diergardt–<br />
Sammlung gelangten tordierten Goldtorques mit<br />
Schlaufen–Haken–Verschluß hat Inciser Gürçay<br />
Damm aufgrund der Kertscher Parallelen in die<br />
erste Hälfte des 5. Jahrhunderts datiert. Es verdient<br />
Erwähnung, daß bei den südrussischen<br />
Goldtorques ebensowenig Spuren des Gebrauchs<br />
zu erkennen sind wie bei dem Exemplar am<br />
Rákos–Bach. Aus dem Fehlen von Abnutzungs -<br />
spuren kann darauf geschlossen werden, daß die<br />
Goldgegenstände unmittelbar vor der Bestattung<br />
hergestellt worden waren.<br />
126<br />
NAGY MARGIT<br />
Von der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts, von<br />
der Hunnenzeit an wurde der massive, schwere<br />
Goldtorques zu einem wichtigen Bestandteil der<br />
Männertracht. Michael Schmauders Zusammen -<br />
fassung gemäß hat den Torques als<br />
Rangbezeichnungsschmuck die hunnische<br />
militärische Führungsschicht im Karpatenbecken<br />
vom spätantiken Heer übernommen. Die<br />
Goldtorques junger Knaben werden vererbte<br />
Rangsymbole gewesen sein. Einen glatten<br />
Goldtorques mit Schlaufen–Haken–Verschluß trug<br />
der etwa 10 jährige Junge von Keszthely–Téglagyár.<br />
Allerdings hat sein Goldschmuck mehr als das<br />
sechsfache Gewicht des Torques am Rákos–Bach.<br />
Der Typ der Lunulafibel vom Rákos–Bach (Abb.<br />
2.2–2a) war nach den summierenden Arbeiten von<br />
Ibolya Sellye und Erzsébet Patek in den römischen<br />
Siedlungen an Donau (Carnuntum, Brigetio,<br />
Intercisa, Gradise, Novi Banovci) und Drau<br />
(Poetovio und Siscia) verbreitet. Am Oberrhein mag<br />
diese Fibelform besonders beliebt gewesen sein.<br />
Emilie Riha verröffentlichte eine ganze Serie<br />
ähnlicher Fibeln aus Augst und Kaiseraugst, die<br />
großenteils den Schichtenangaben gemäß in die<br />
Zeit vom Ende des 1. bis zur 2. Hälfte des 2.<br />
Jahrhunderts zu datieren sind. Aufgrund der<br />
Begleitfunde ist bloß bei zwei Exemplaren damit zu<br />
rechnen, daß sie am Ende des 4. Jahrhunderts in die<br />
Erde gelangten. Aus dem Sarmatengebiet kenne ich<br />
keine Lunulafibel mit Email. Möglicherweise hat der<br />
junge Mann vom Rákos–Bach die alte Bronzefibel<br />
mit unbrauchbarer Nadelkonstruktion sekundär<br />
verwendet, als Gürtelbeschlag.<br />
Die Gefäßbeigabe des Grabes am Rákos–Bach<br />
gehört zu den spätrömischen Krügen mit<br />
eingeglättetem Hals (Abb. 3). Mit seinem feinen<br />
Material, seiner guten Bearbeitung auf der<br />
Töpferscheibe, seiner dunklen, geglätteten<br />
Oberfläche sowie dem etwas eingedrückten Rand,<br />
kurzen Hals und hohen Fuß stellt dieser Krug in<br />
seiner Gruppe eine neue Variante dar. Die<br />
Krugform tauchte in Pannonien in der zweiten<br />
Hälfte des 4. Jahrhunderts auf (Ottományi Typ 9).<br />
Ihre Verwendung wurde schnell international und<br />
verbreitete sich in der ersten Hälfte des 5.<br />
Jahrhunderts auch im Karpatenbecken. Nach<br />
Katalin Ottományis Feststellung stellen das Ende<br />
das Krugtyps mit trichterförmigem Rand und<br />
eingeglättetem Hals die Krüge des Murga–Typs in<br />
Einzelgräbern des 5. Jahrhunderts dar (Abb. 4.2).<br />
Der Krug im Grab am Rákos–Bach ist eine Variante<br />
der sog. „Föderatenkeramik“, deren Exemplare im<br />
spätsuebischen Siedlungsgebiet sowie am<br />
norischen und pannonischen Donaulimes von



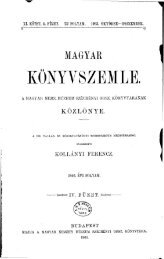



![Letöltés egy fájlban [36.8 MB - PDF] - EPA](https://img.yumpu.com/23369116/1/172x260/letoltes-egy-fajlban-368-mb-pdf-epa.jpg?quality=85)









