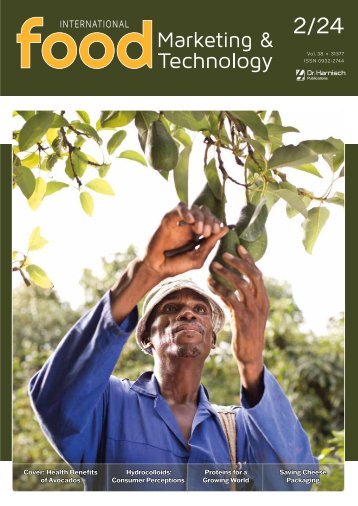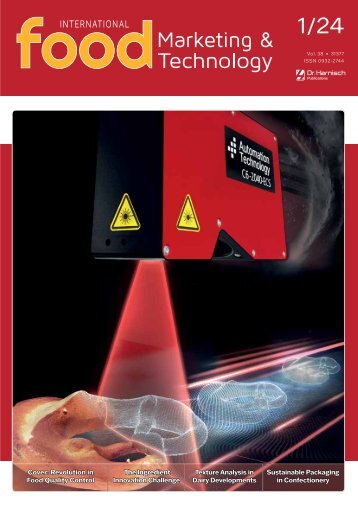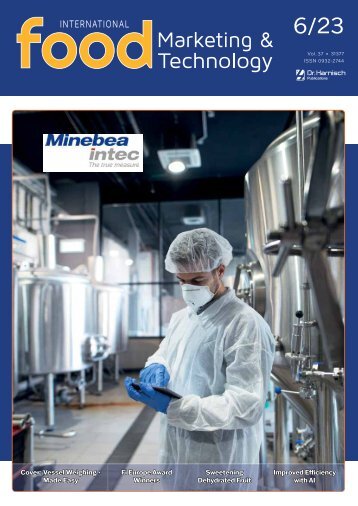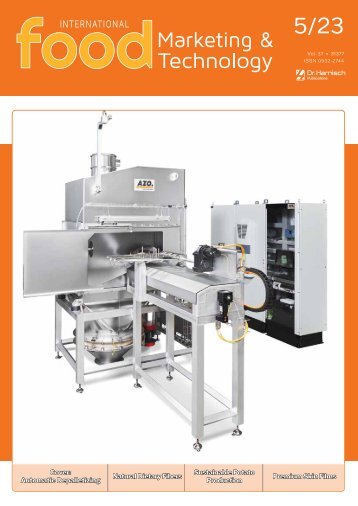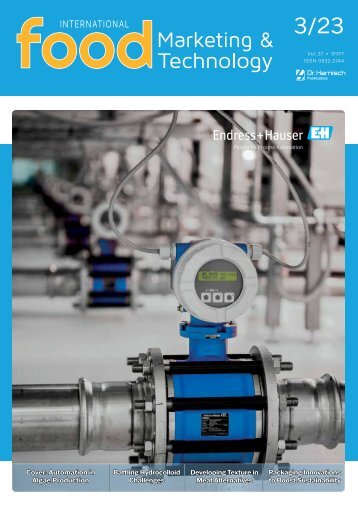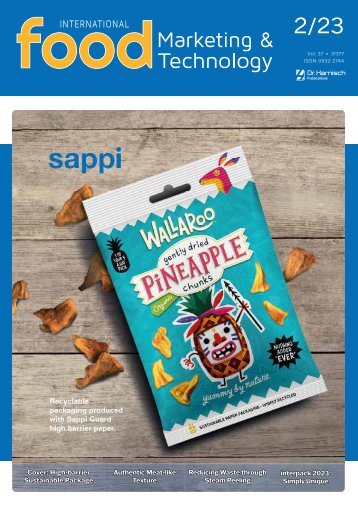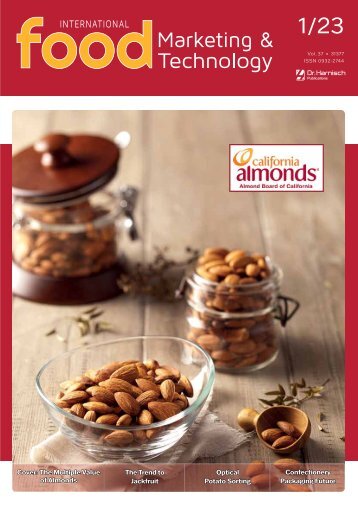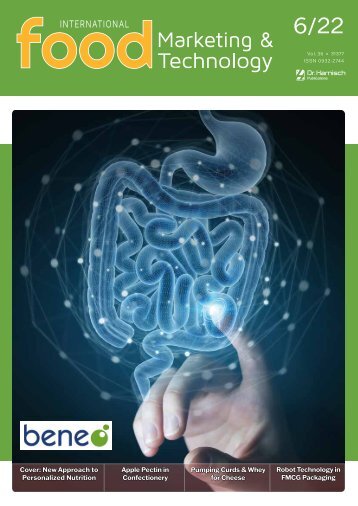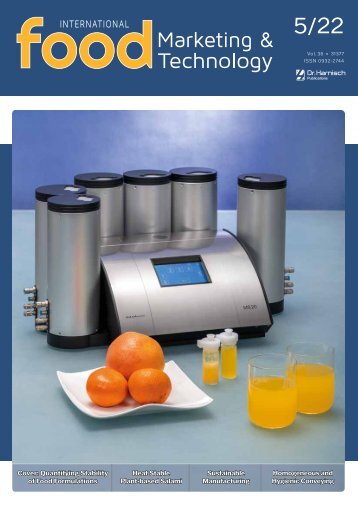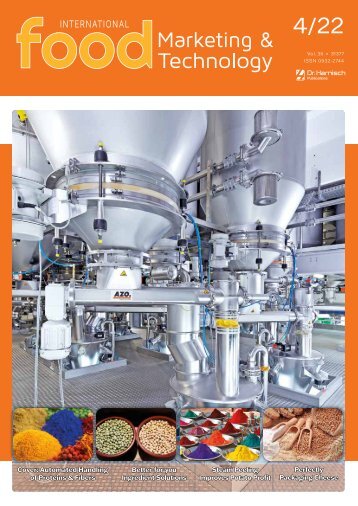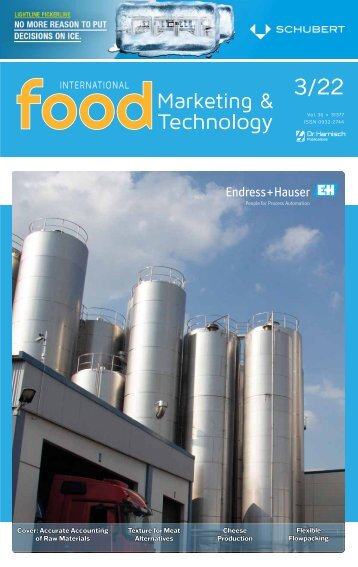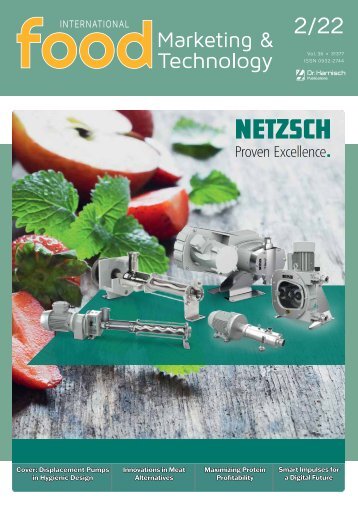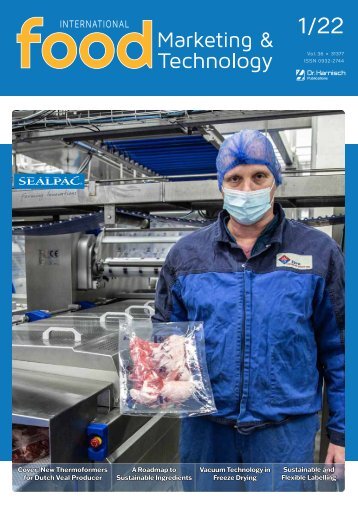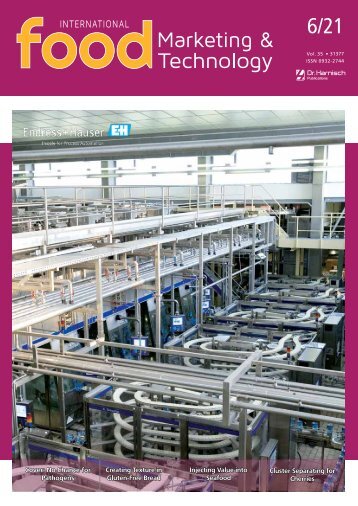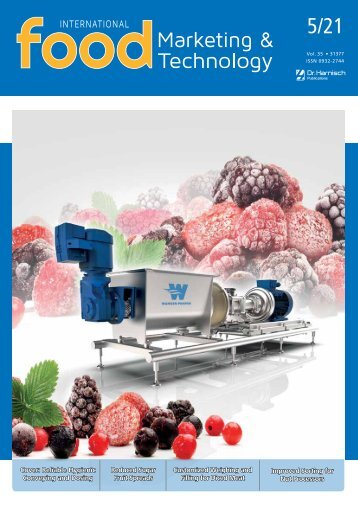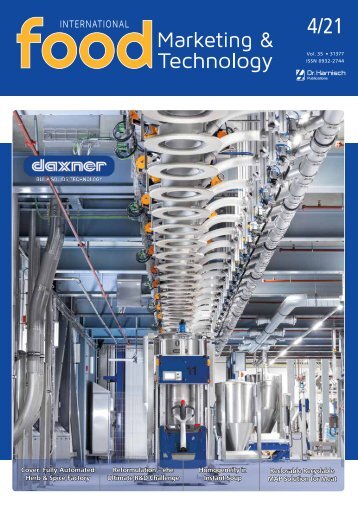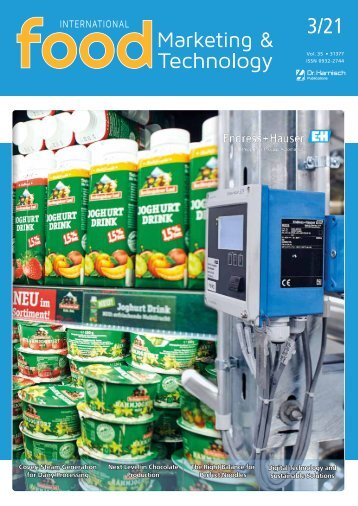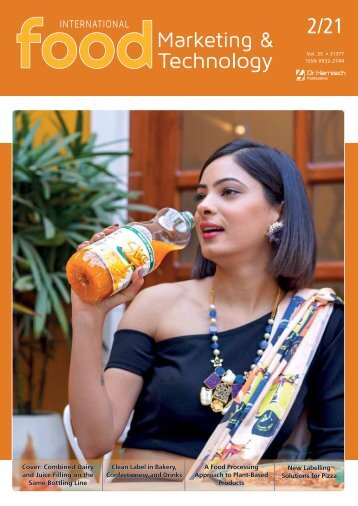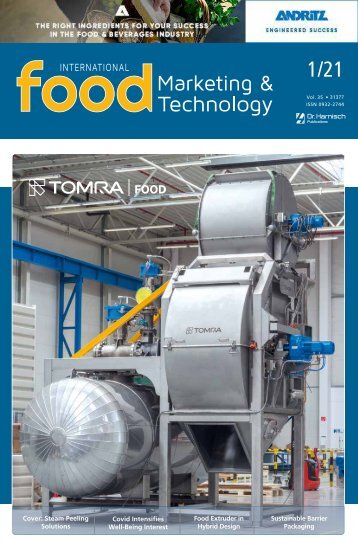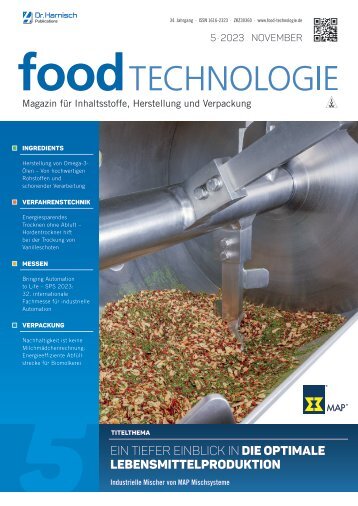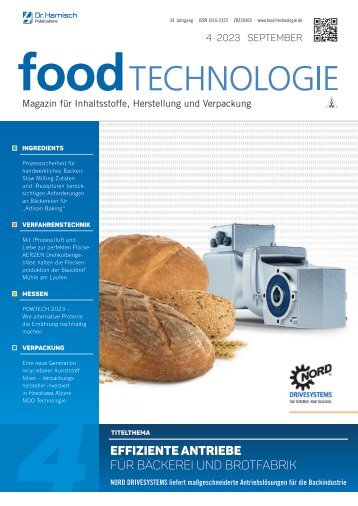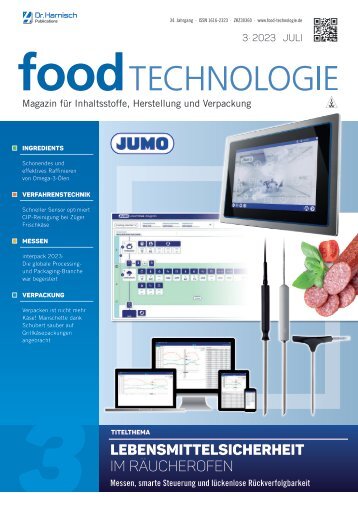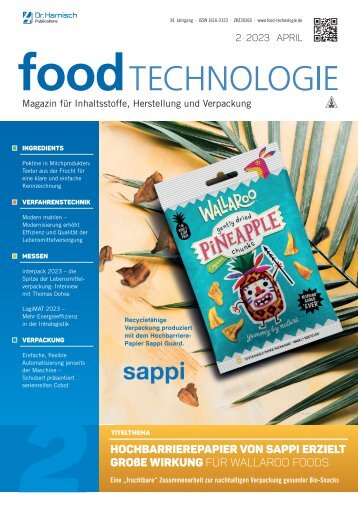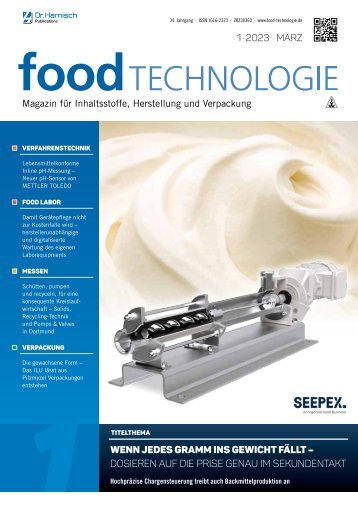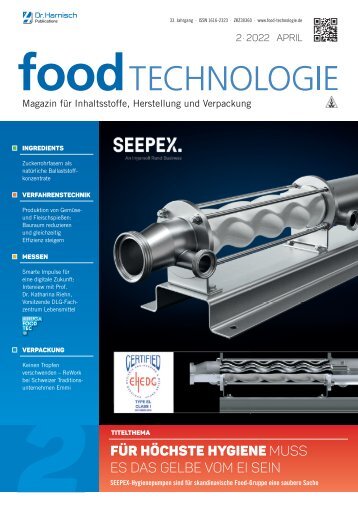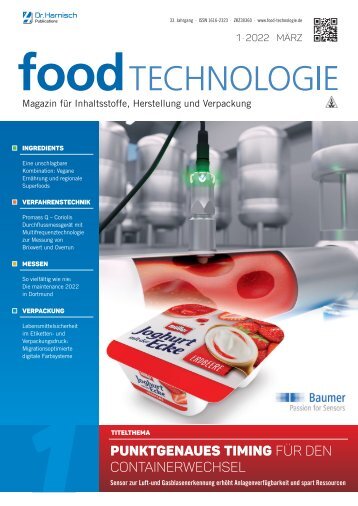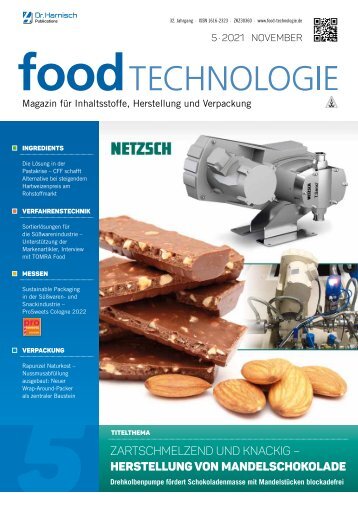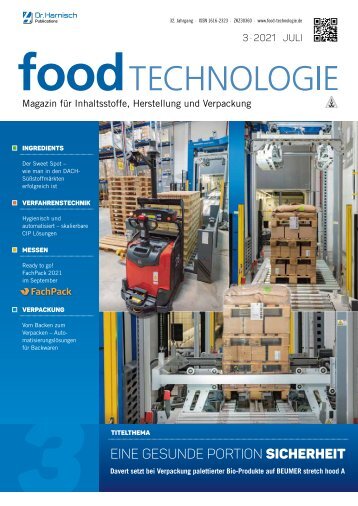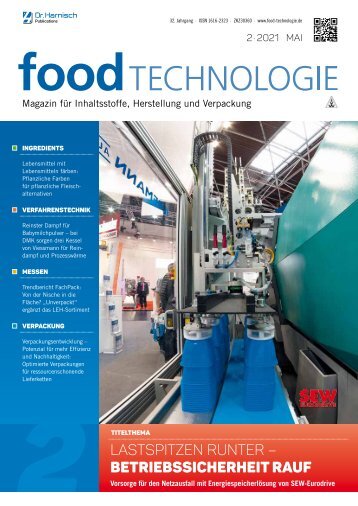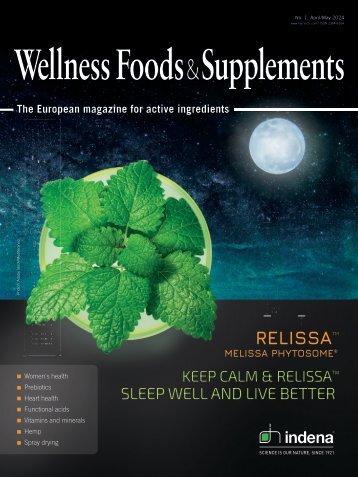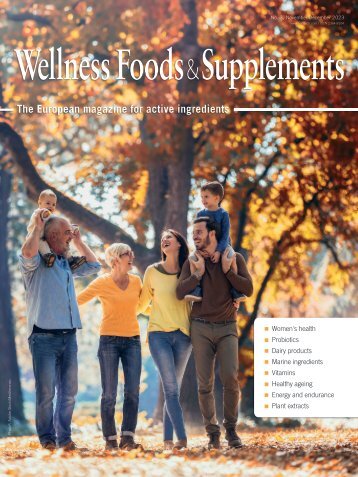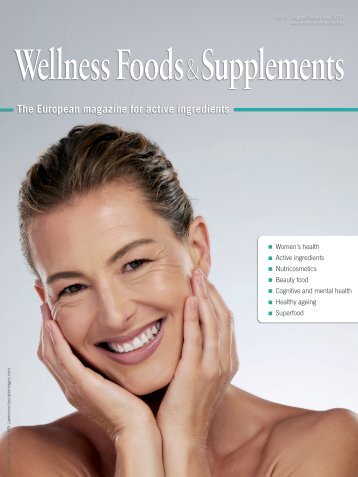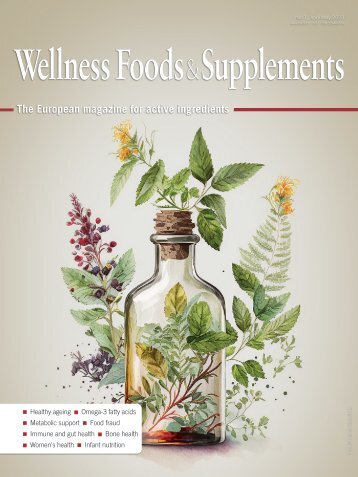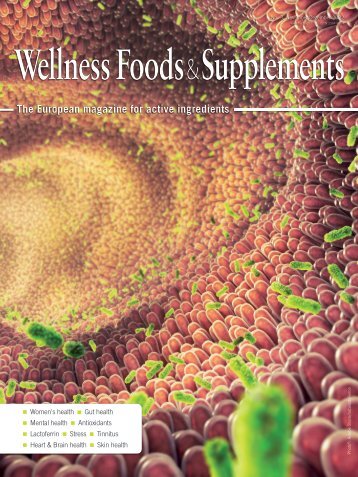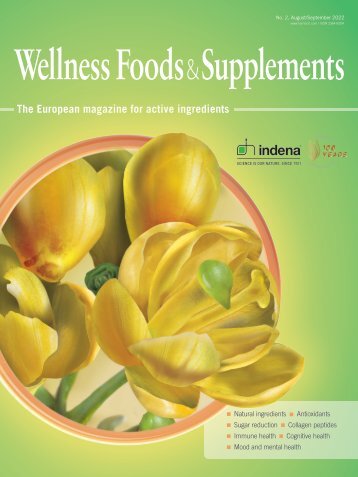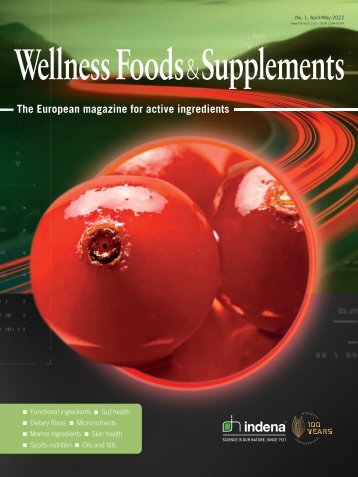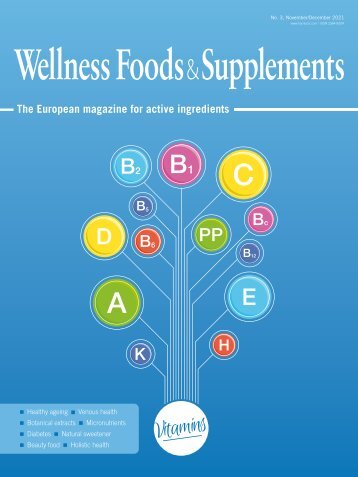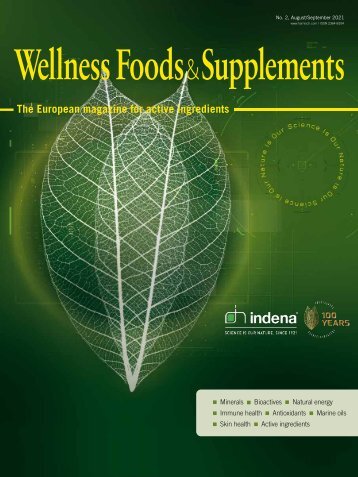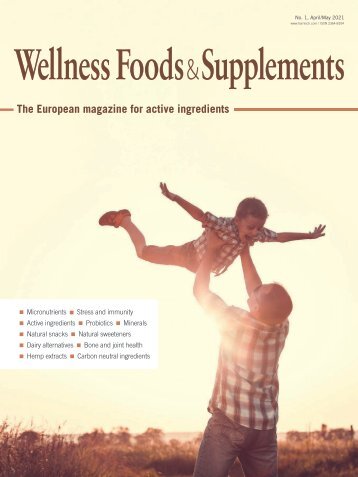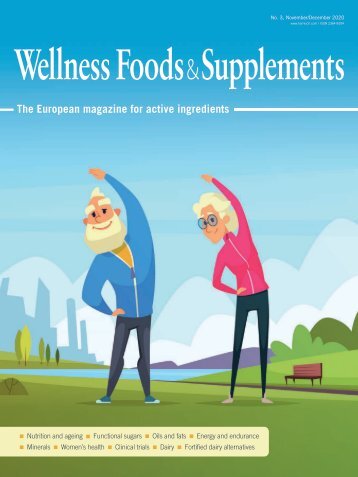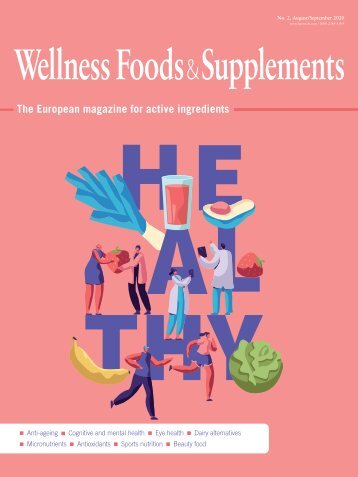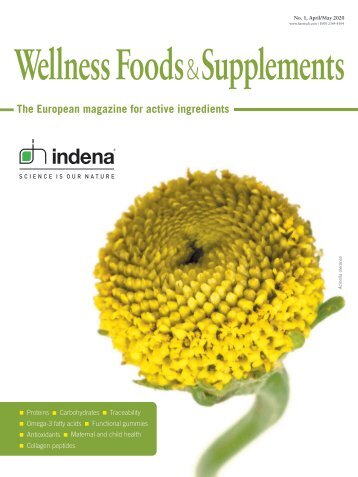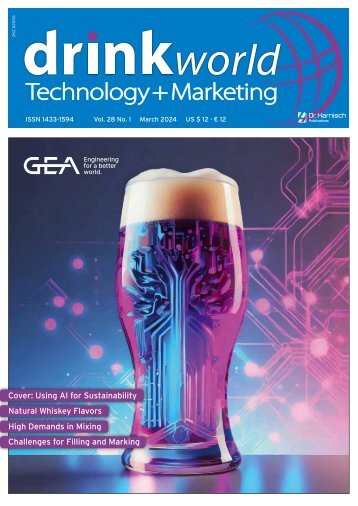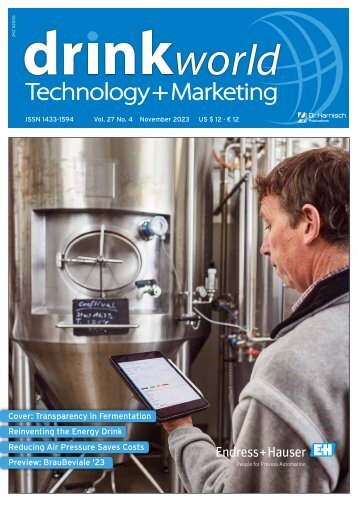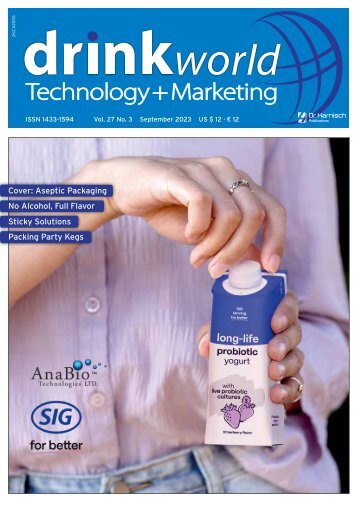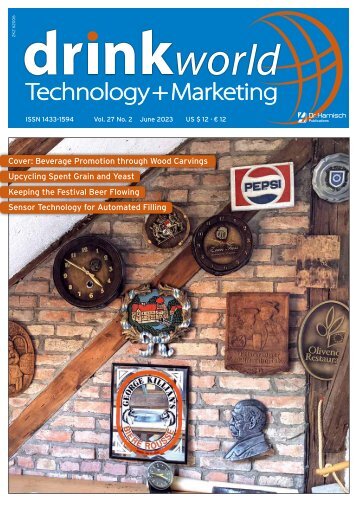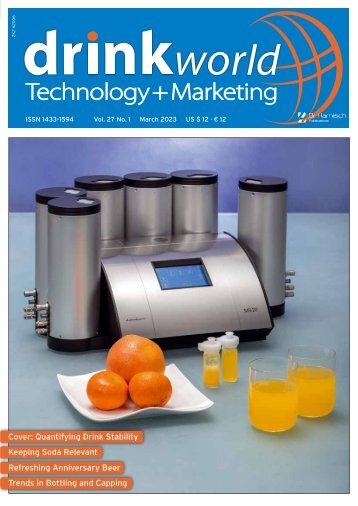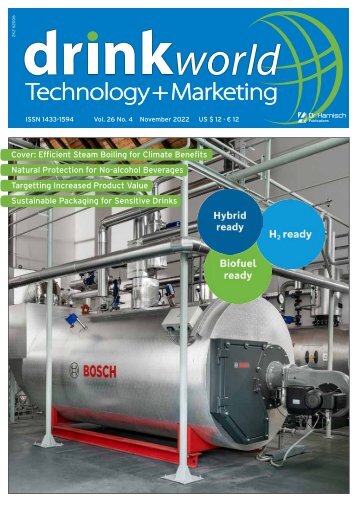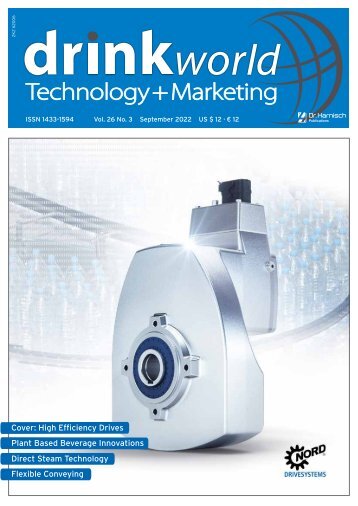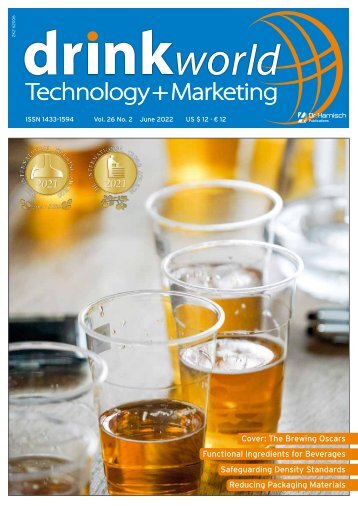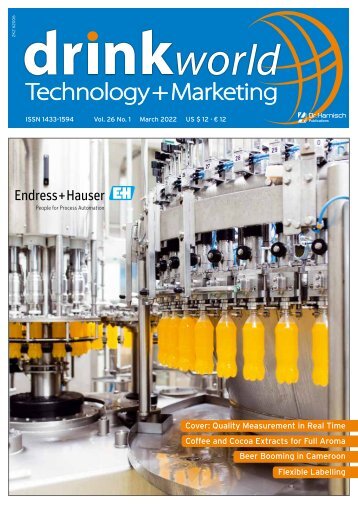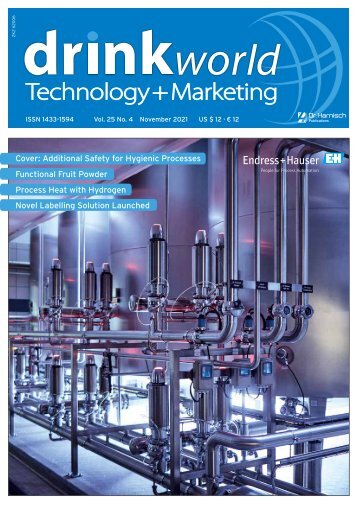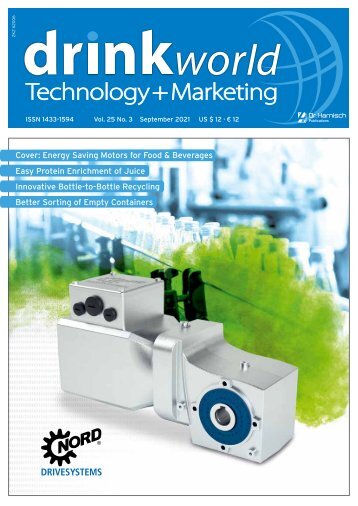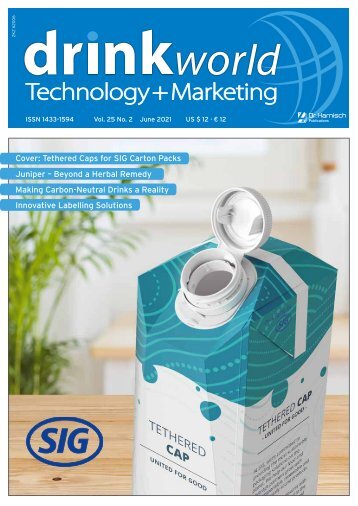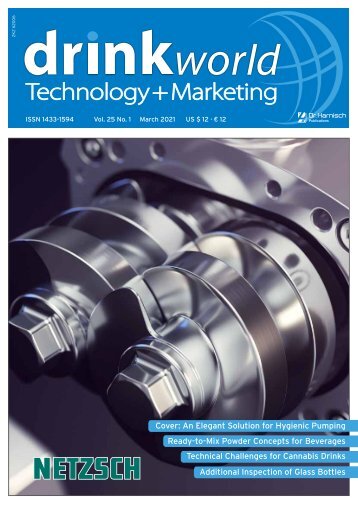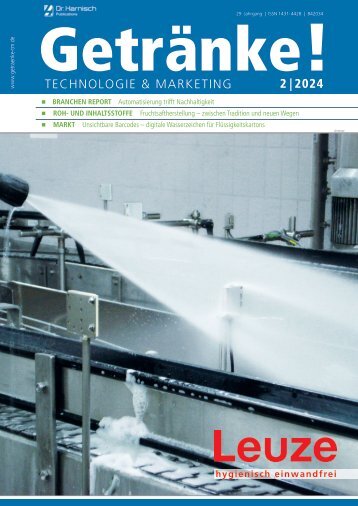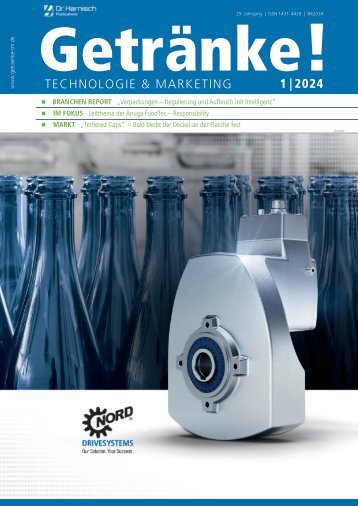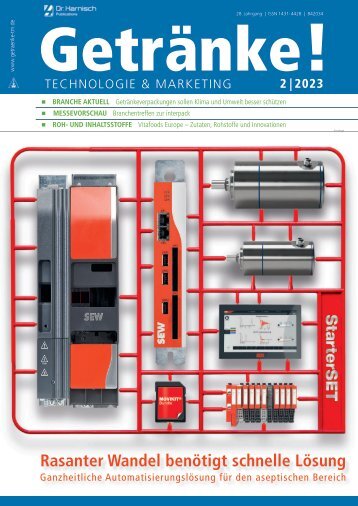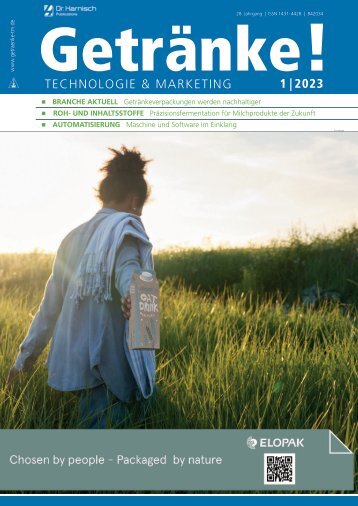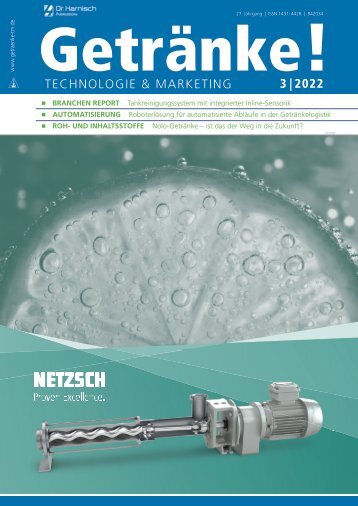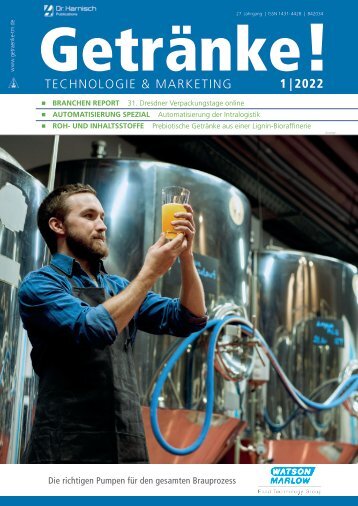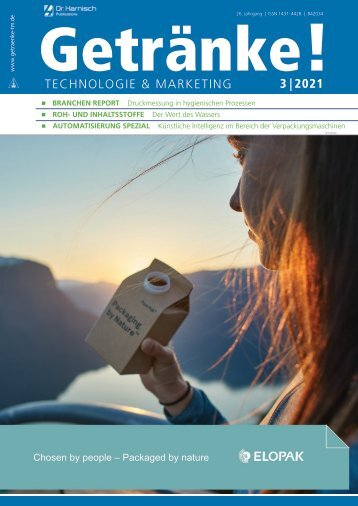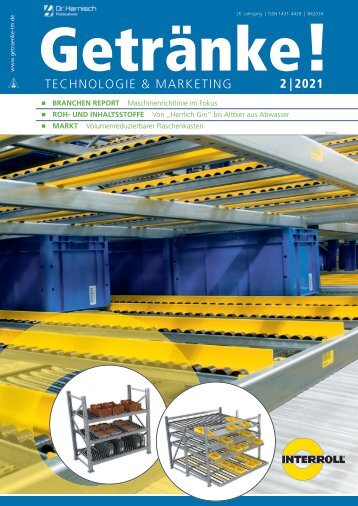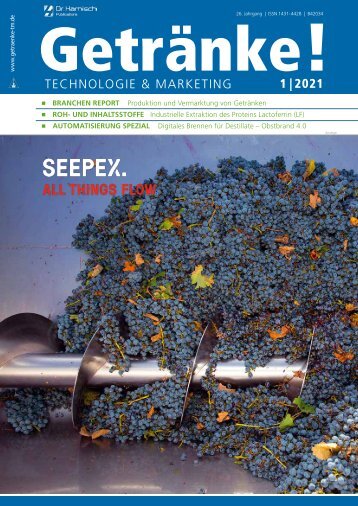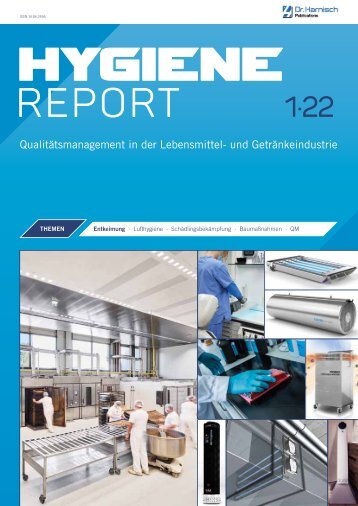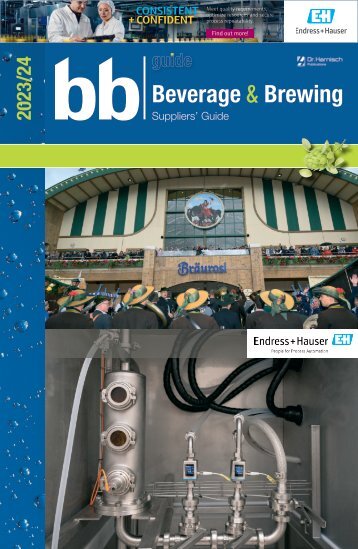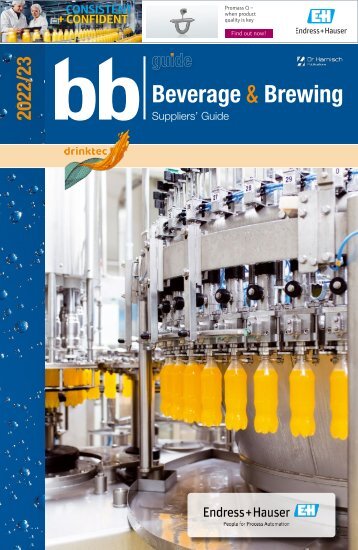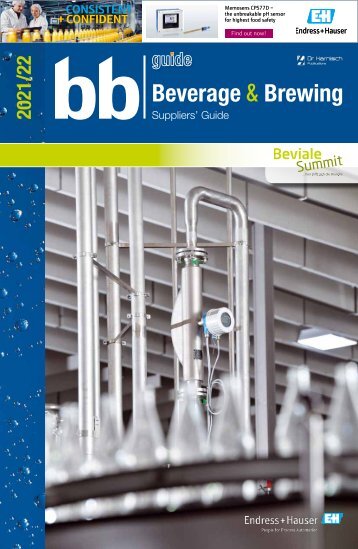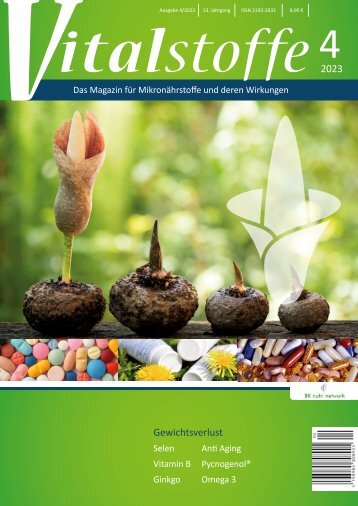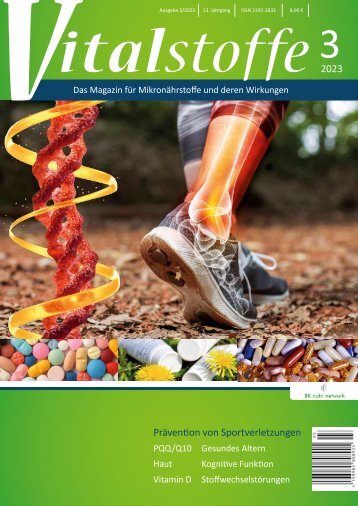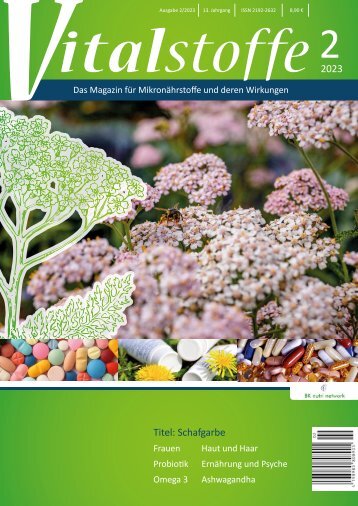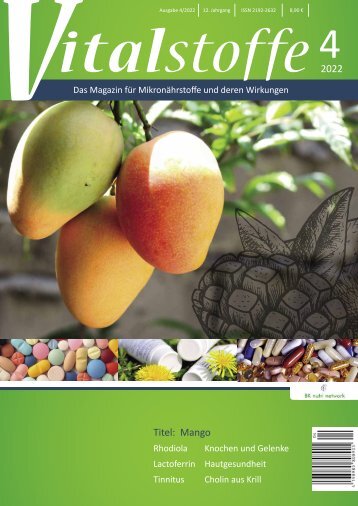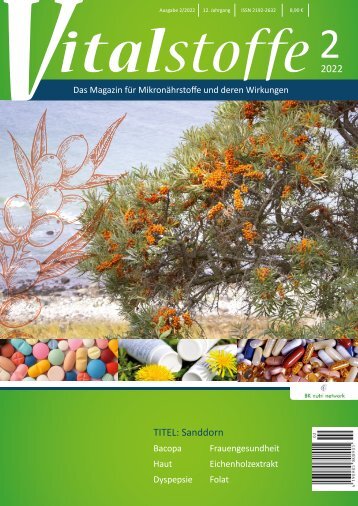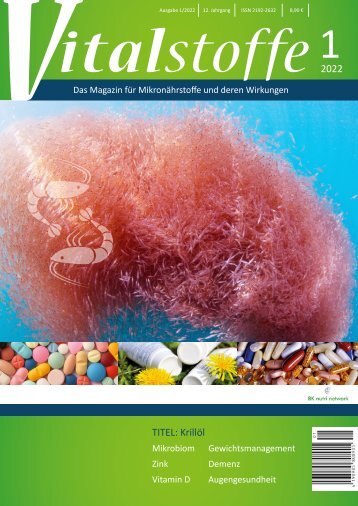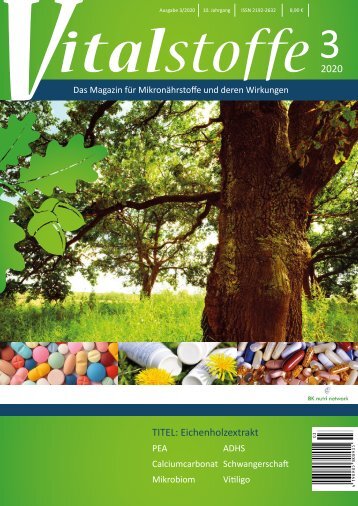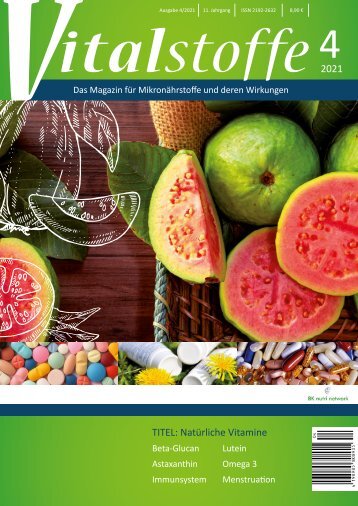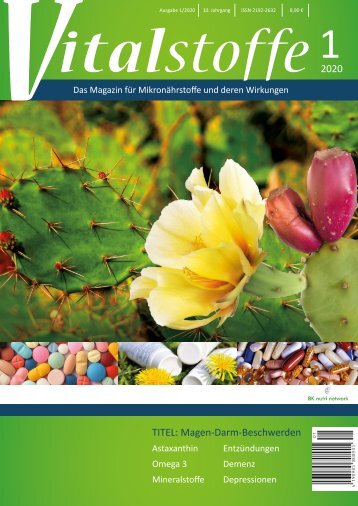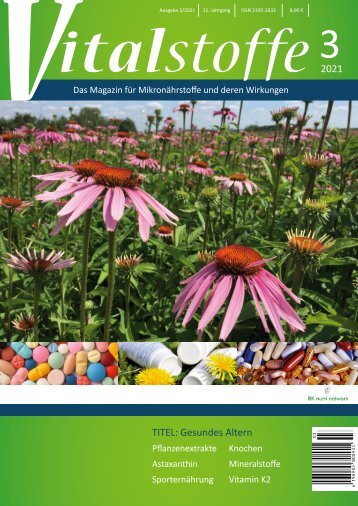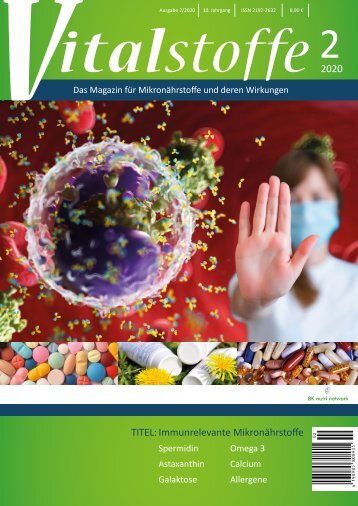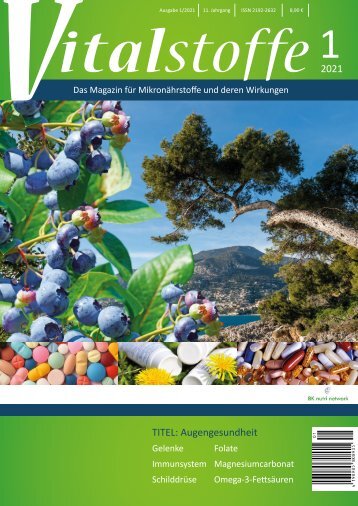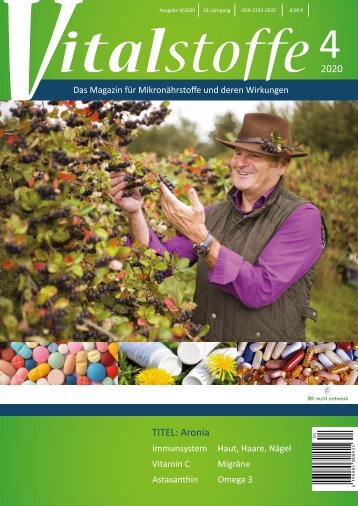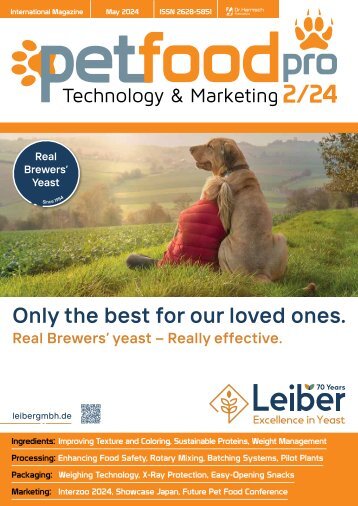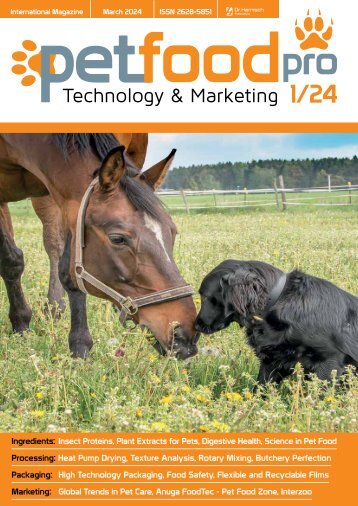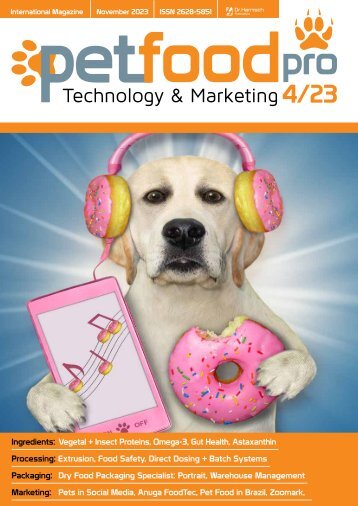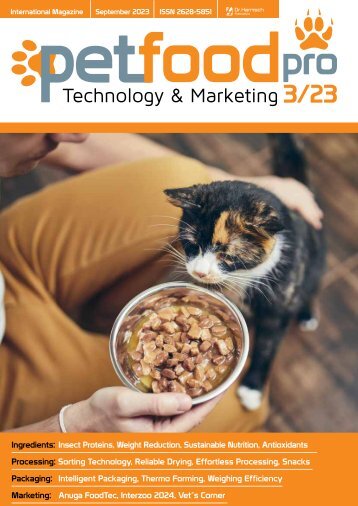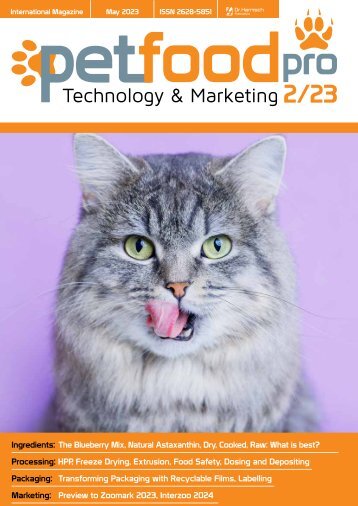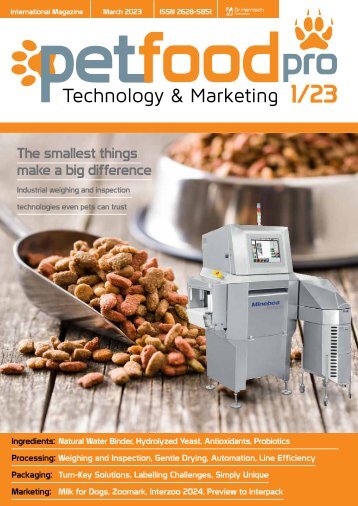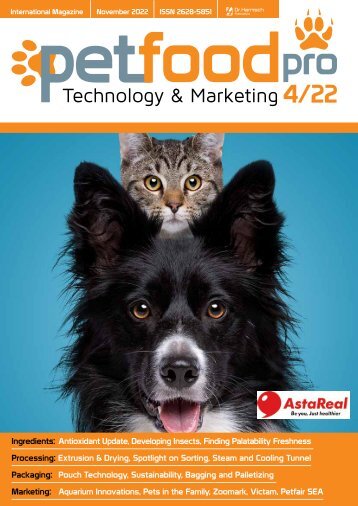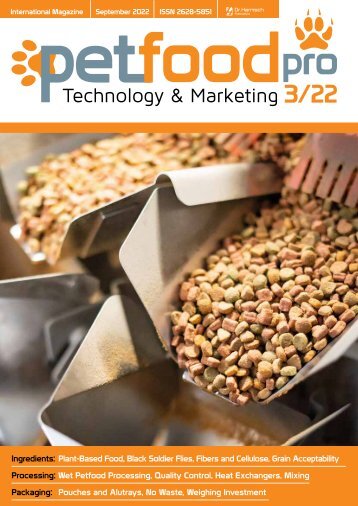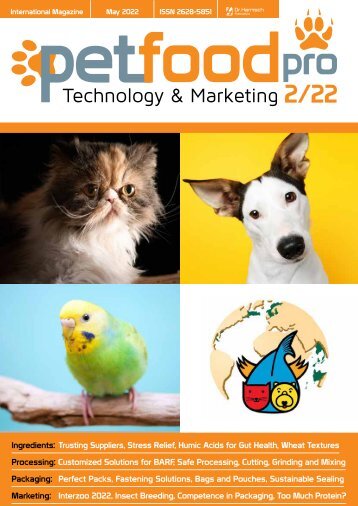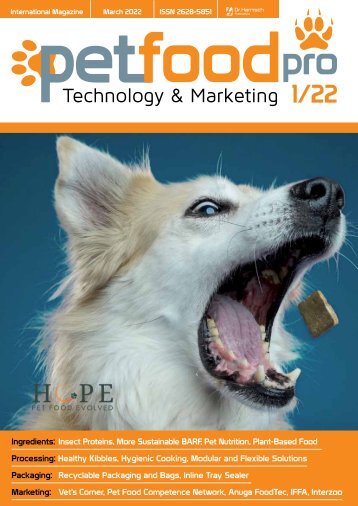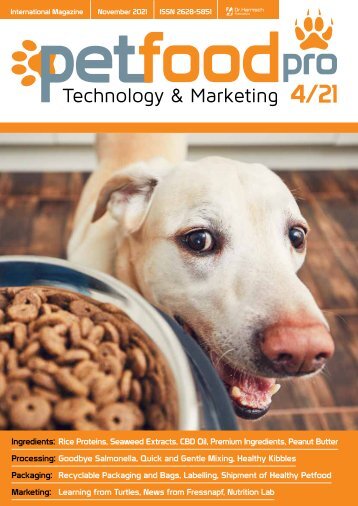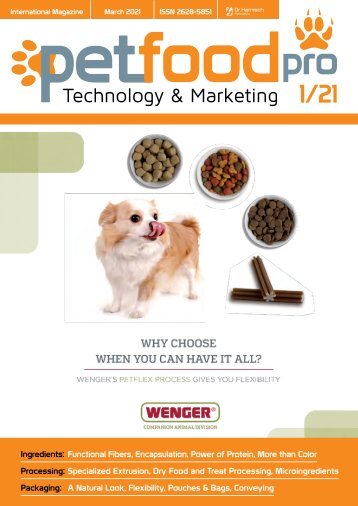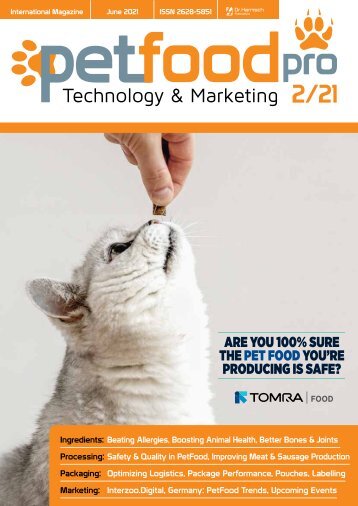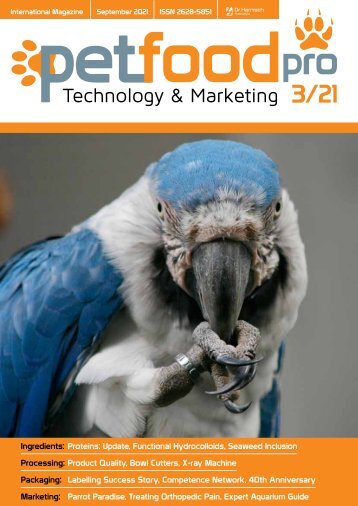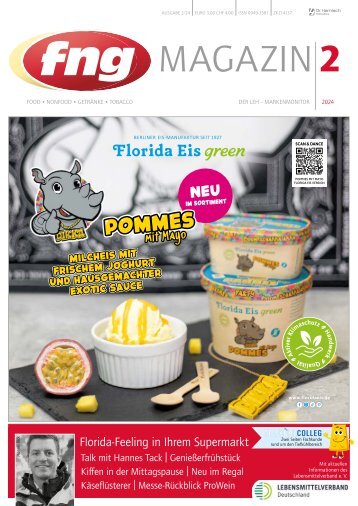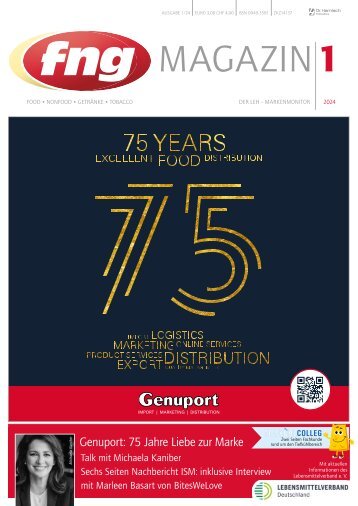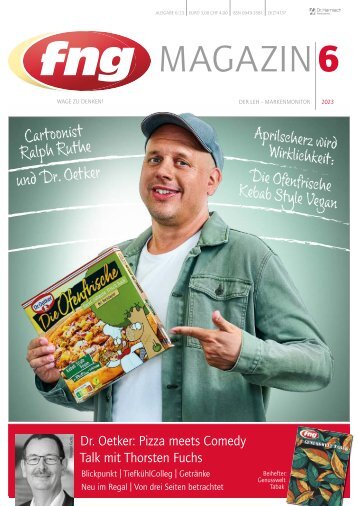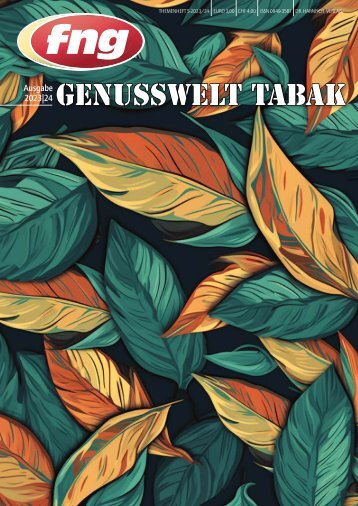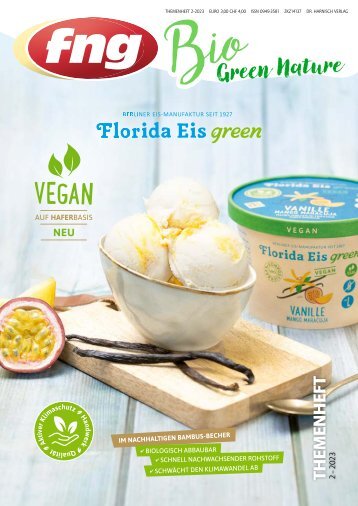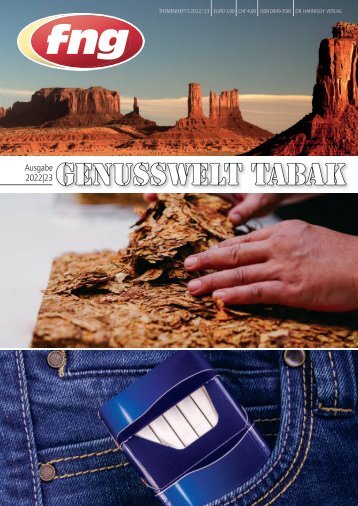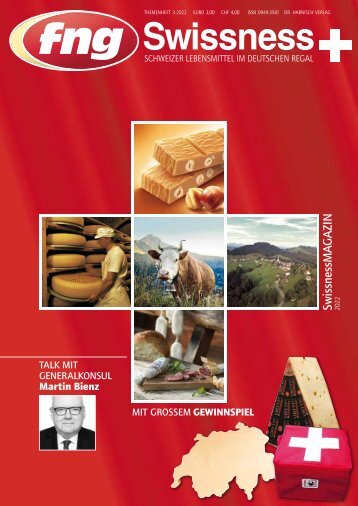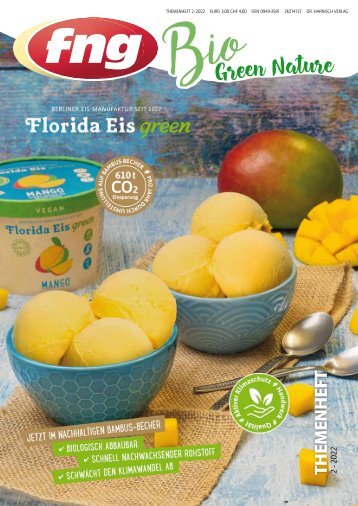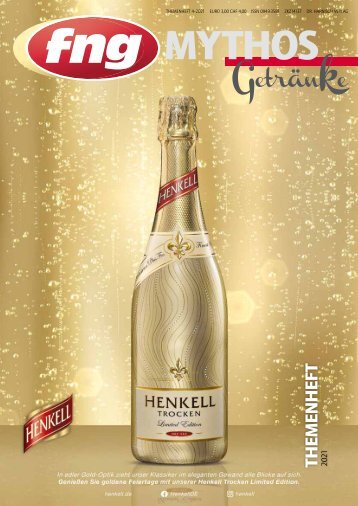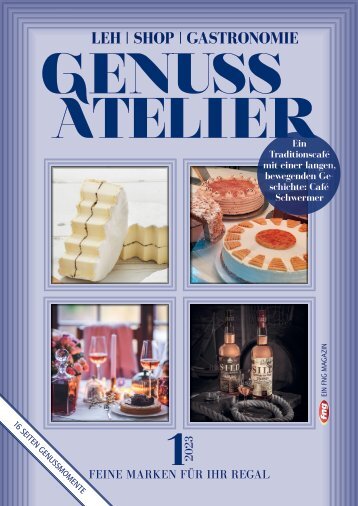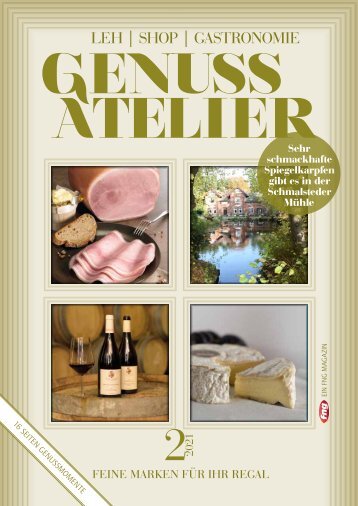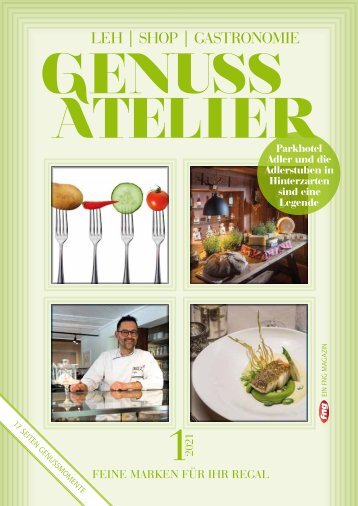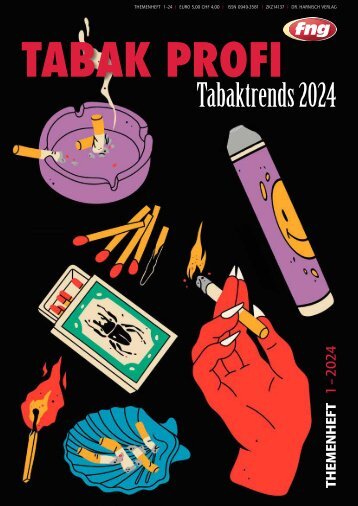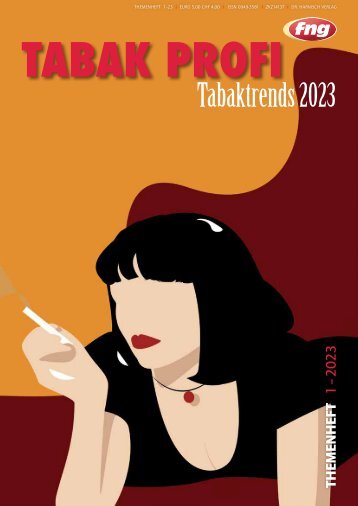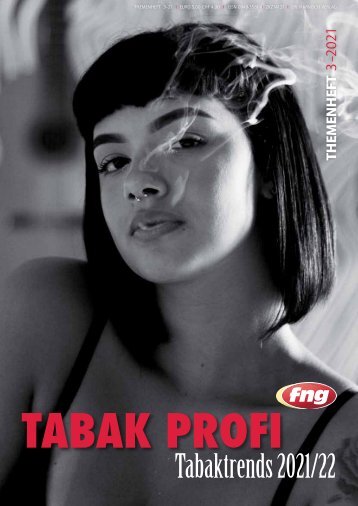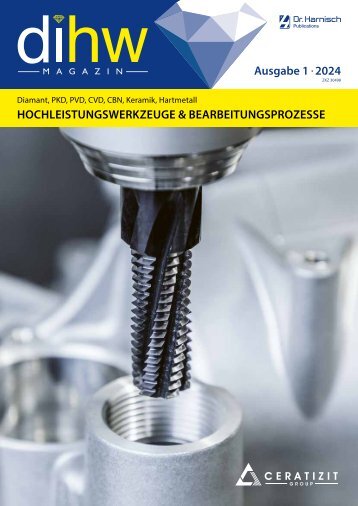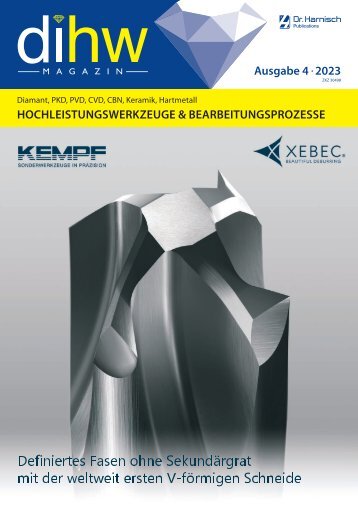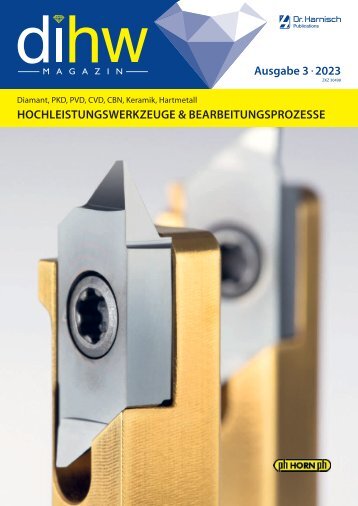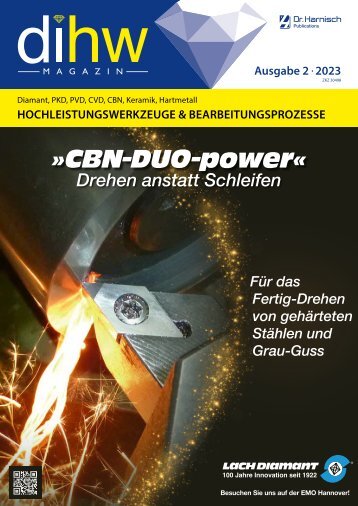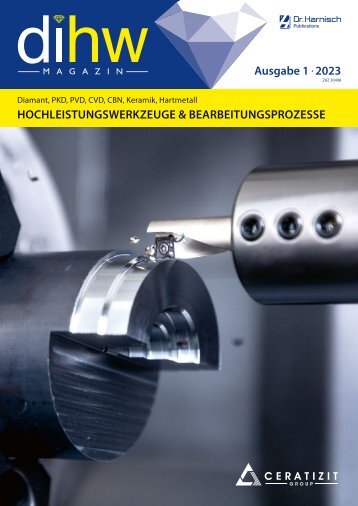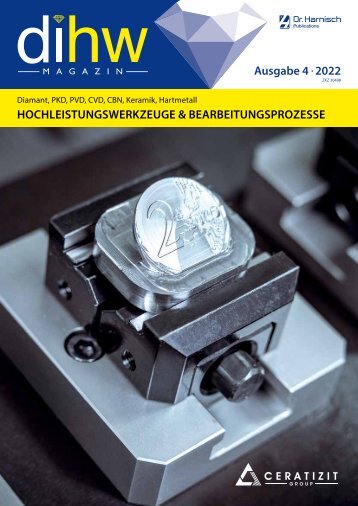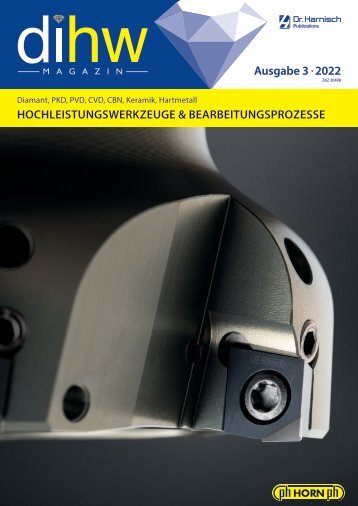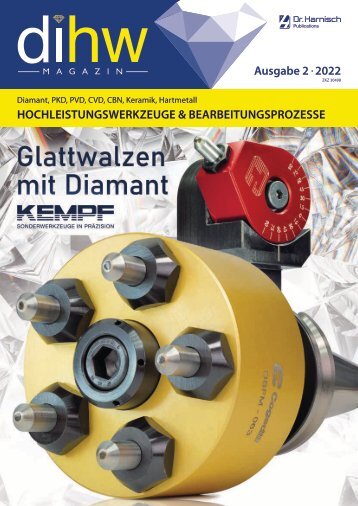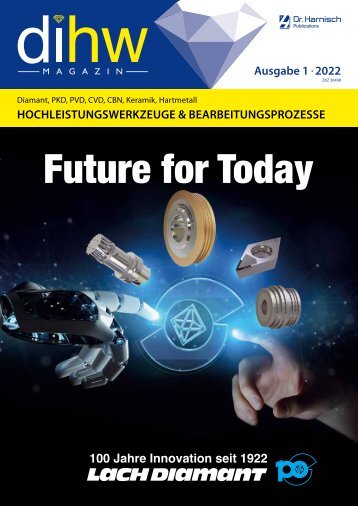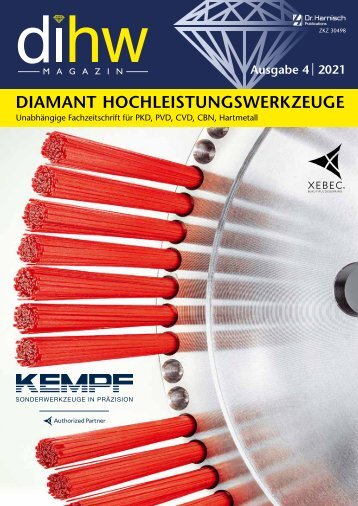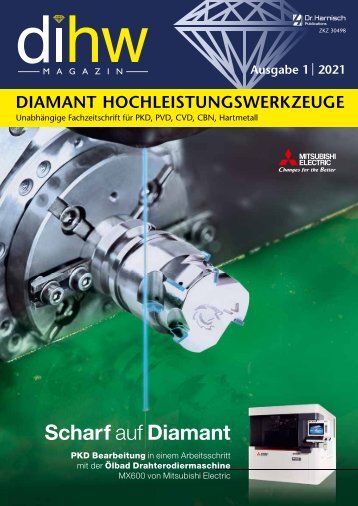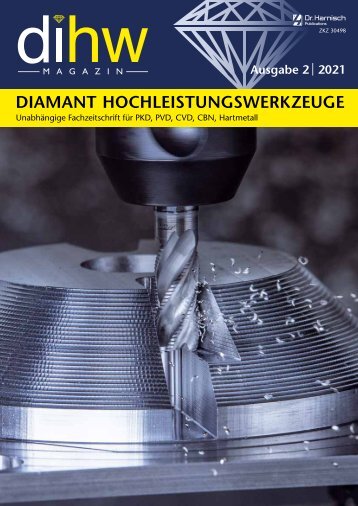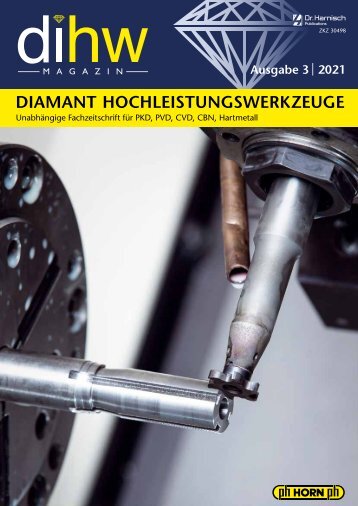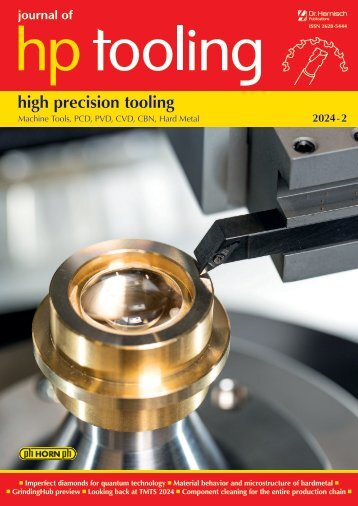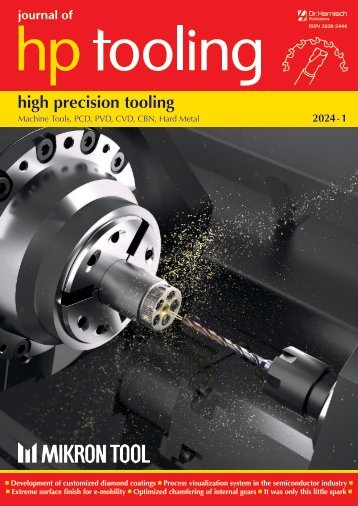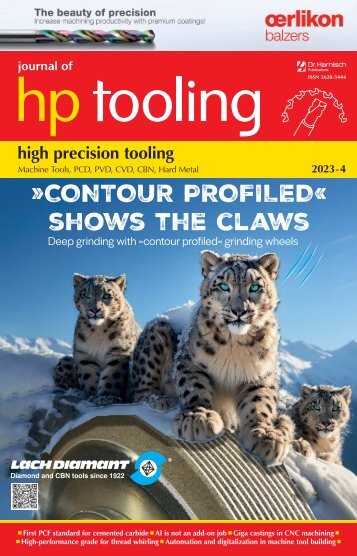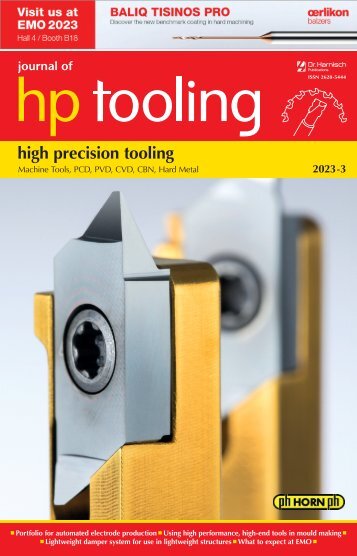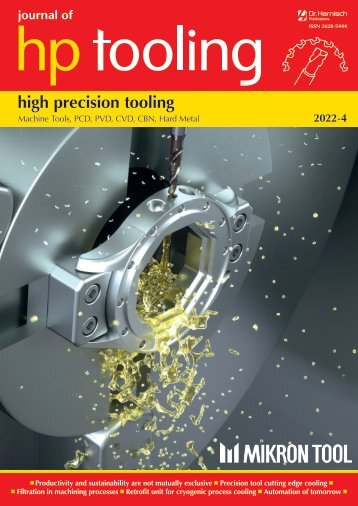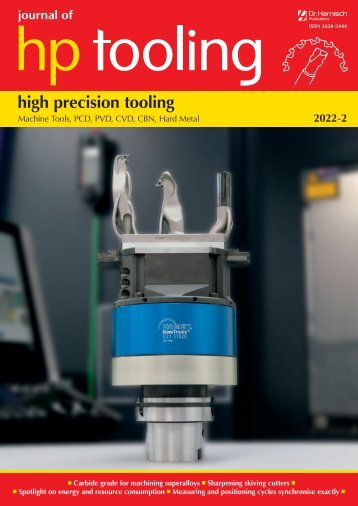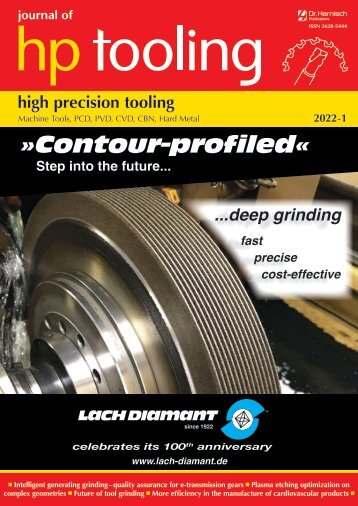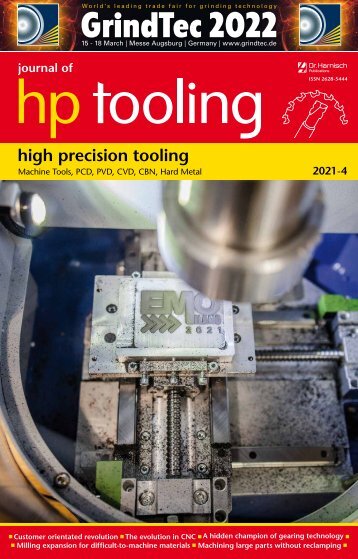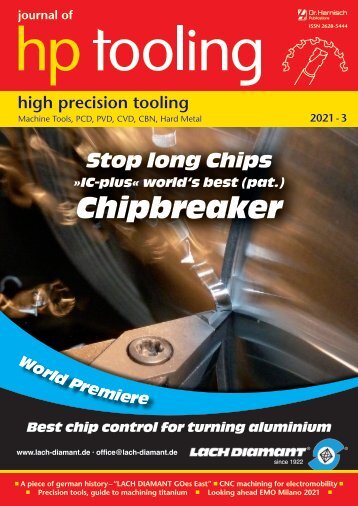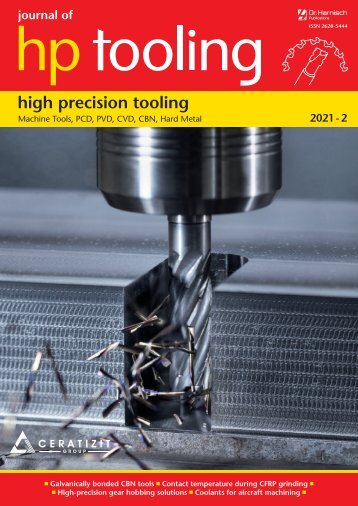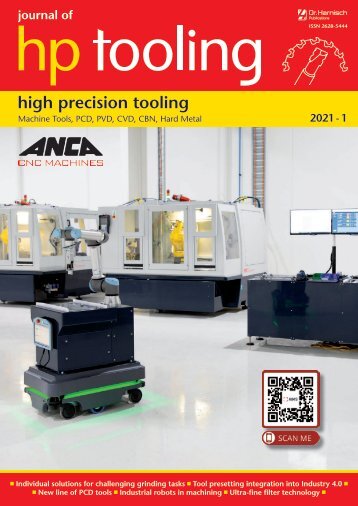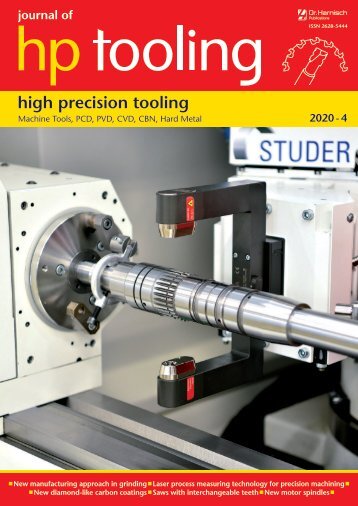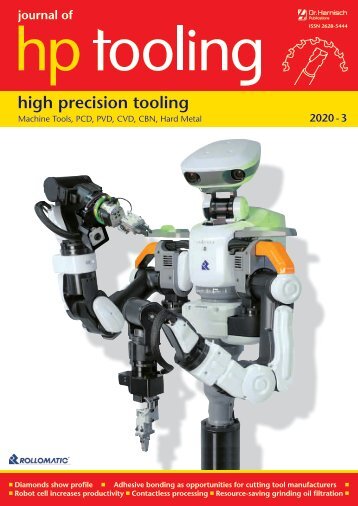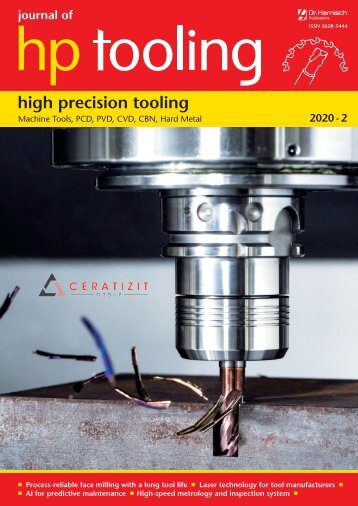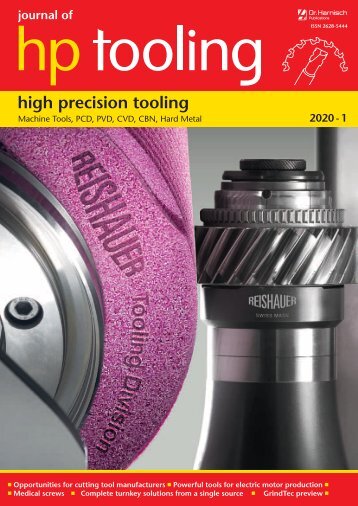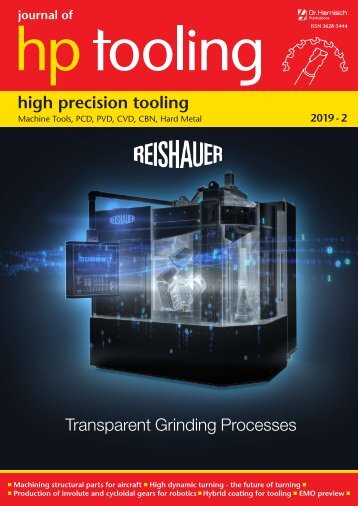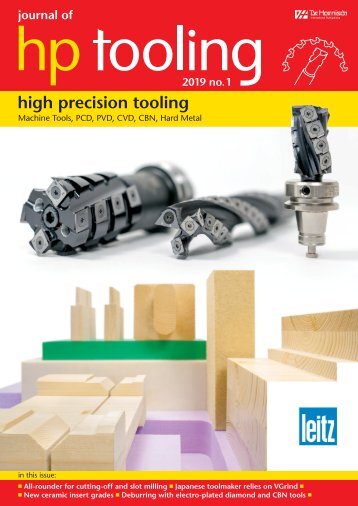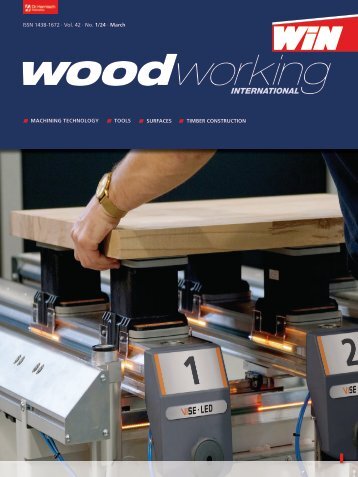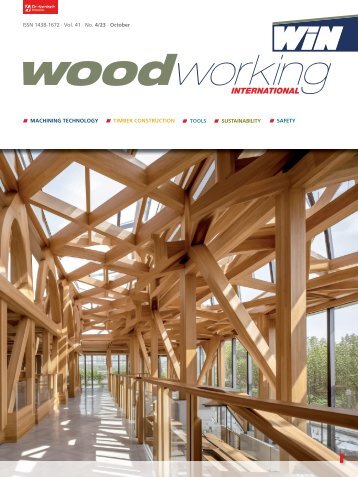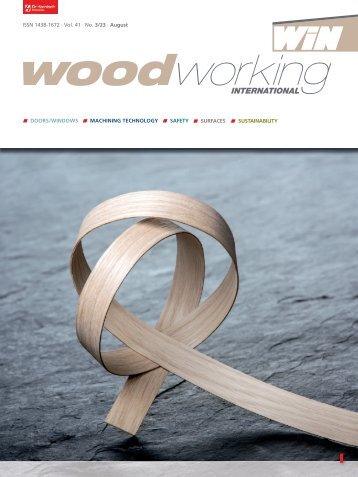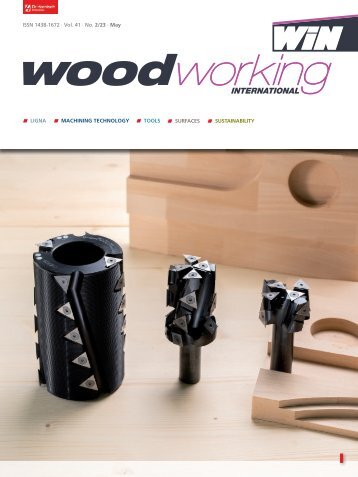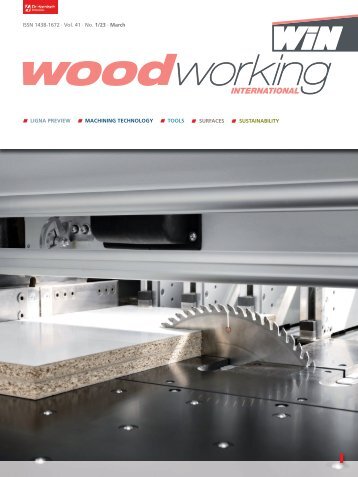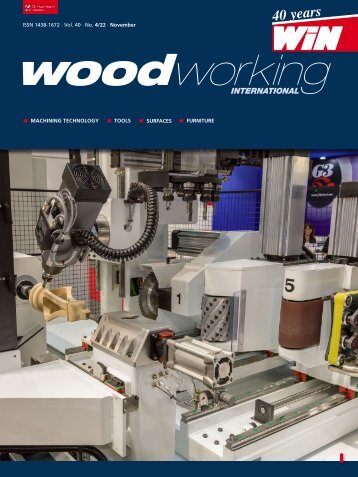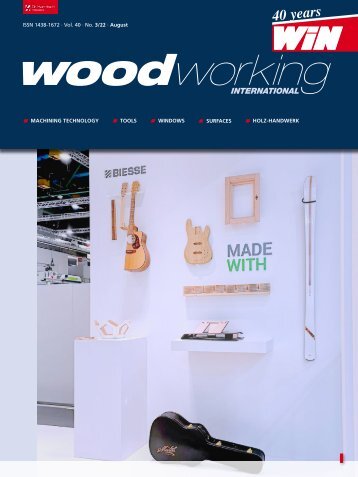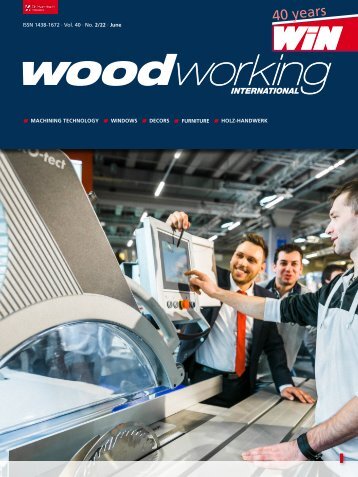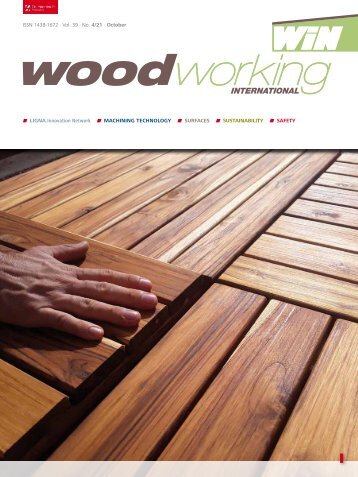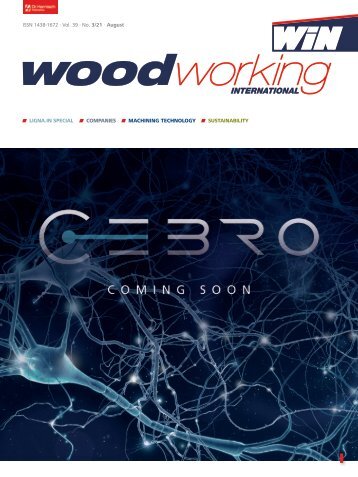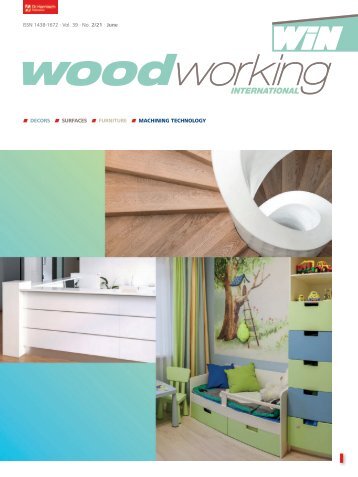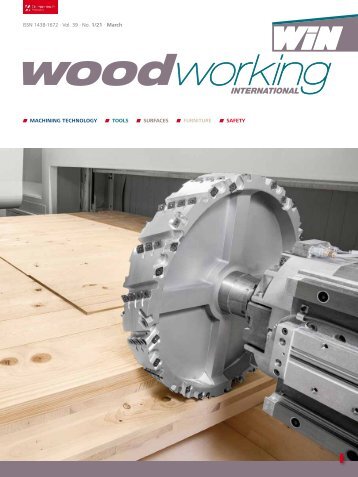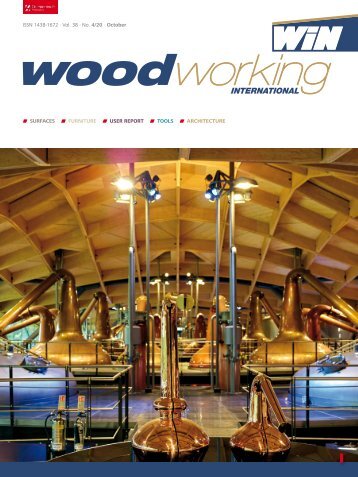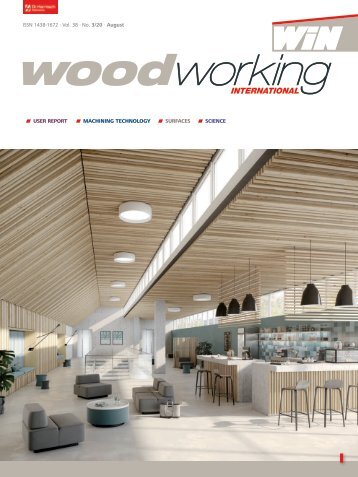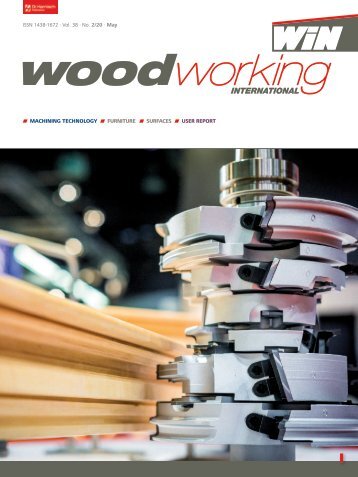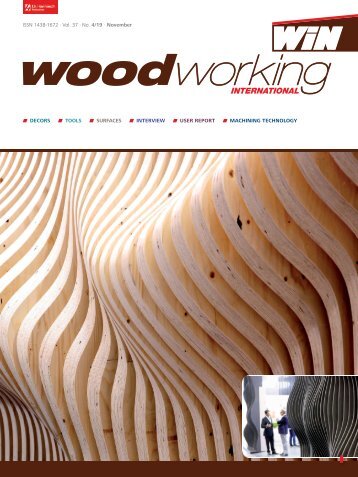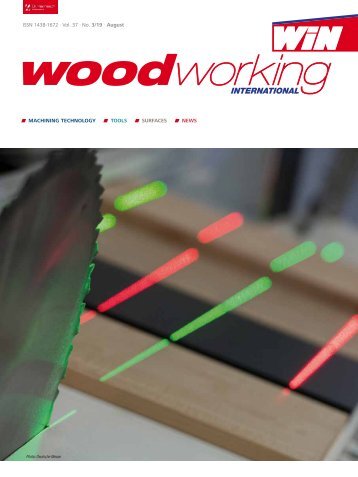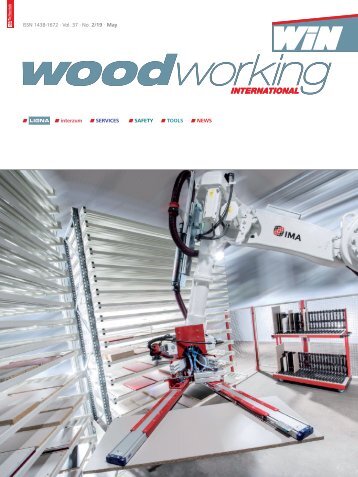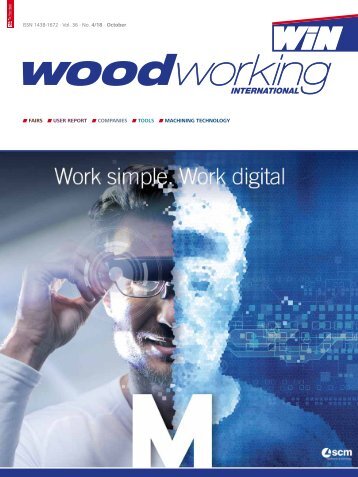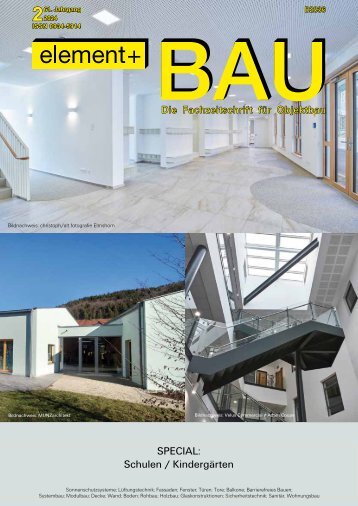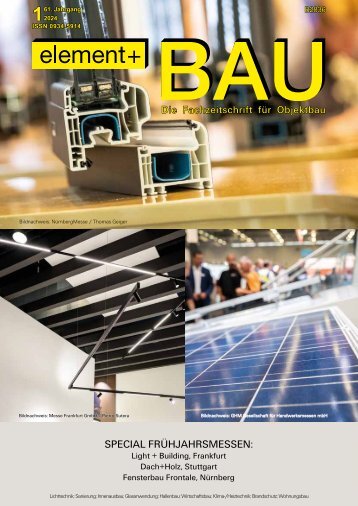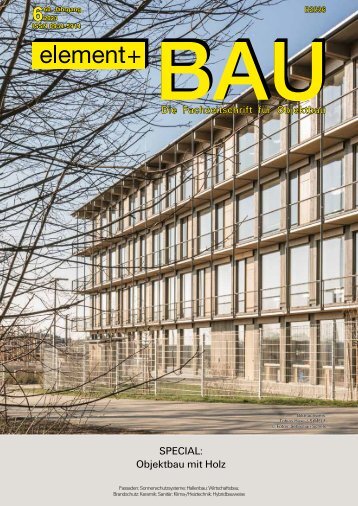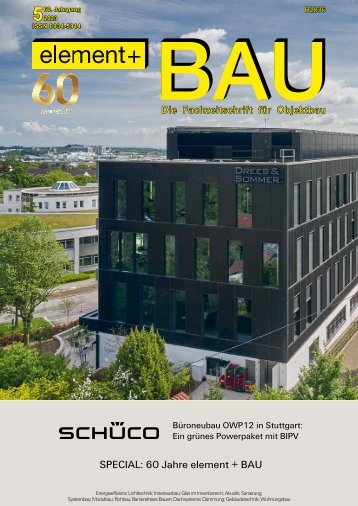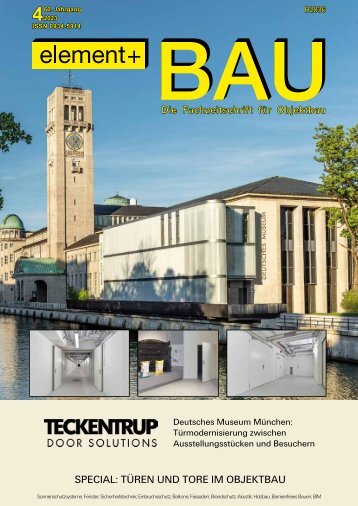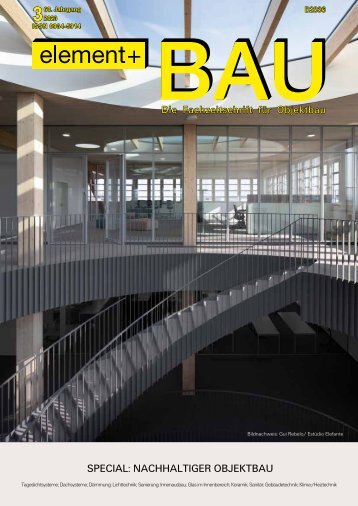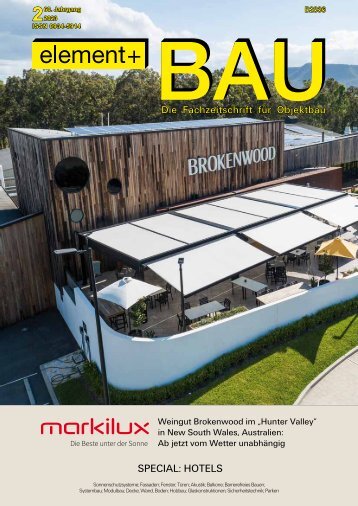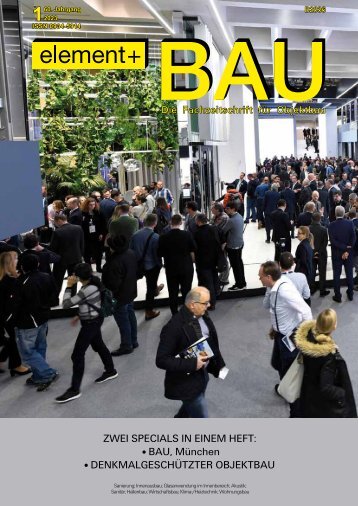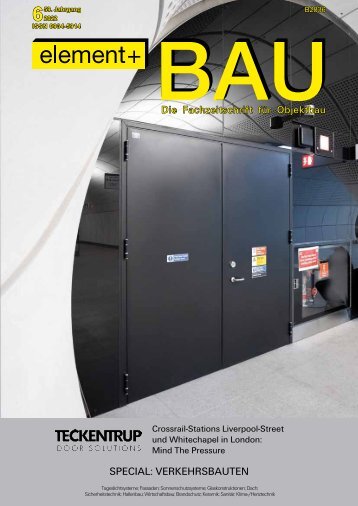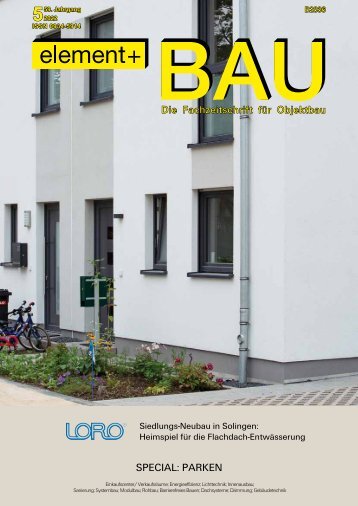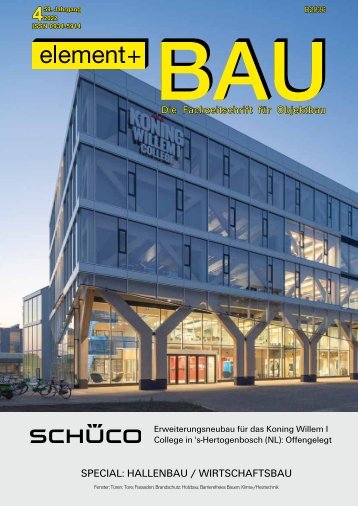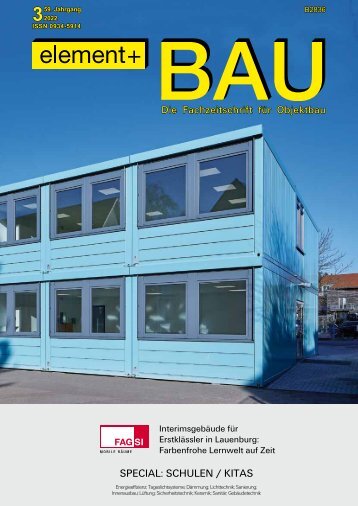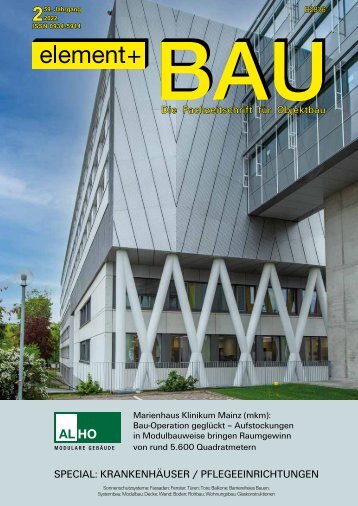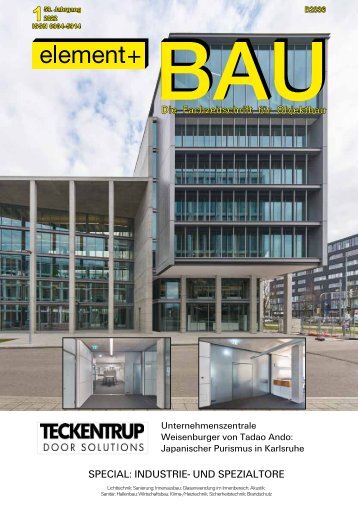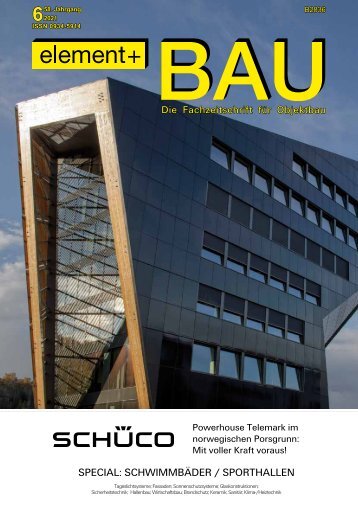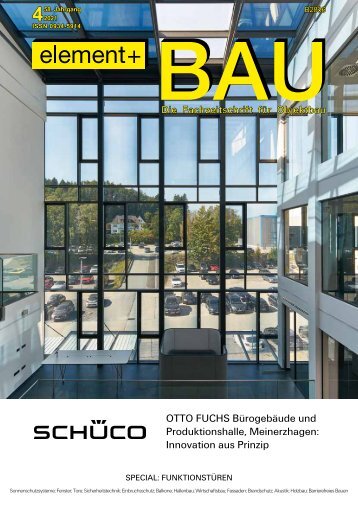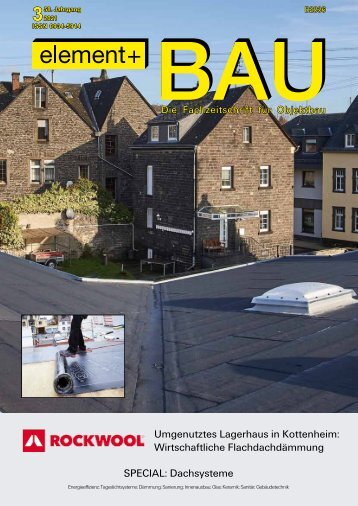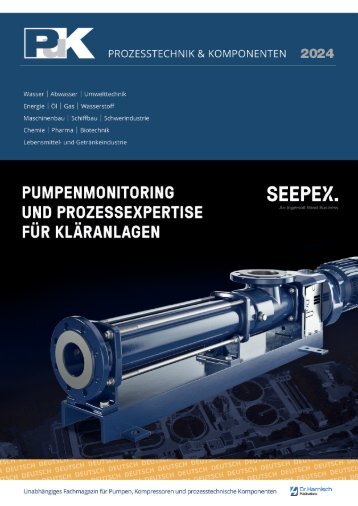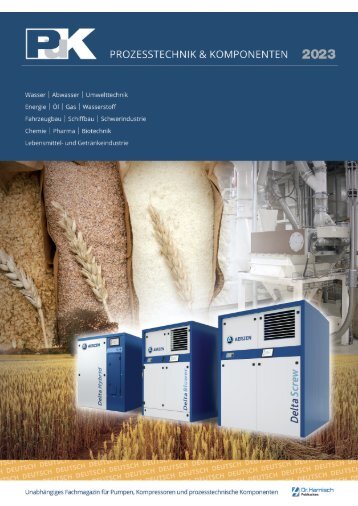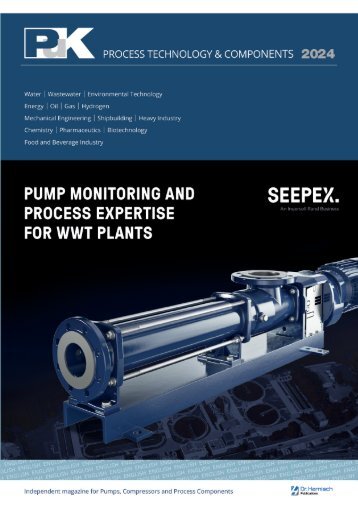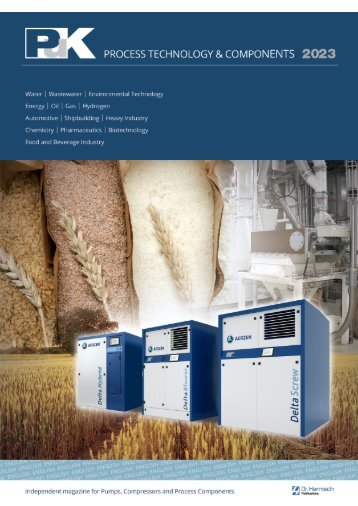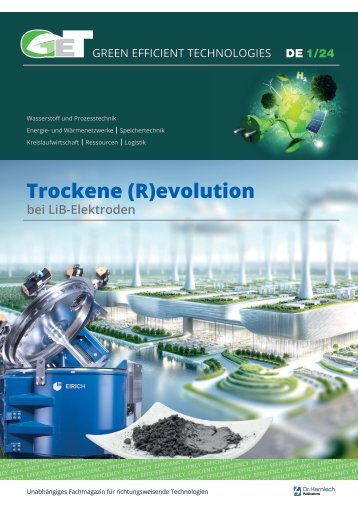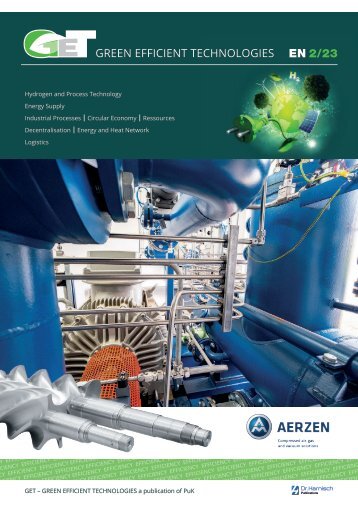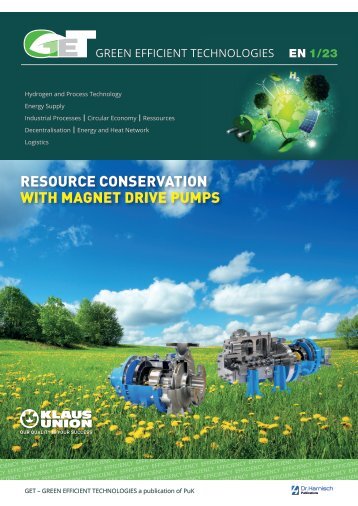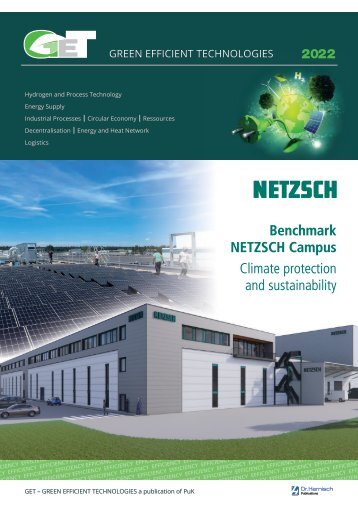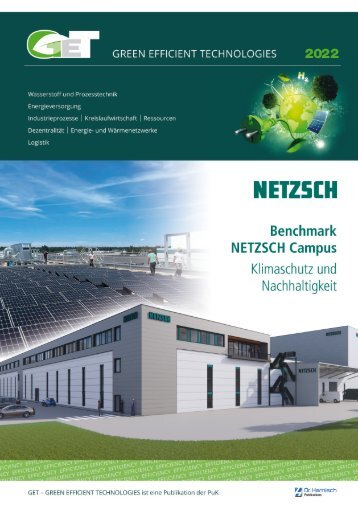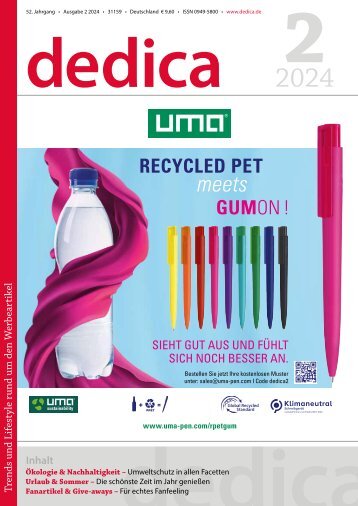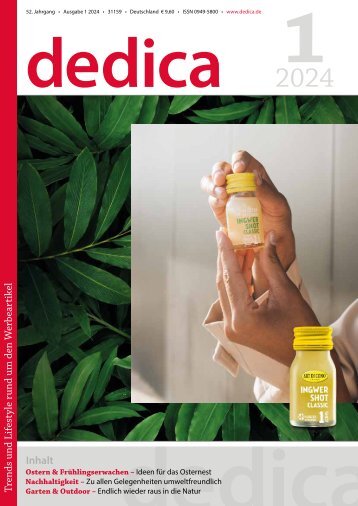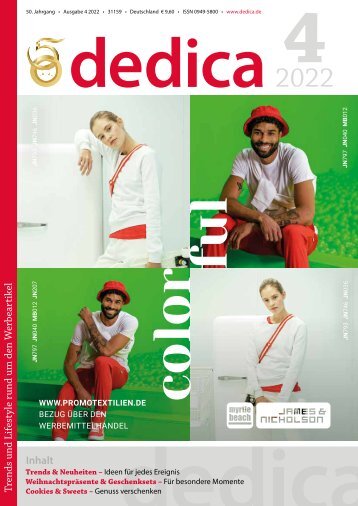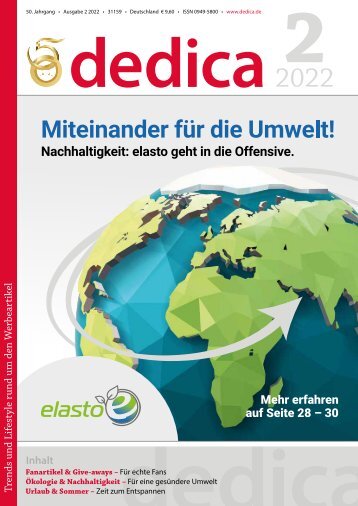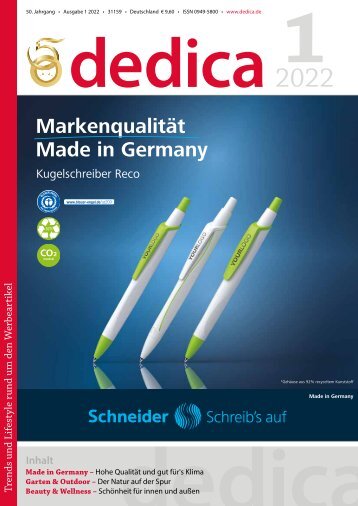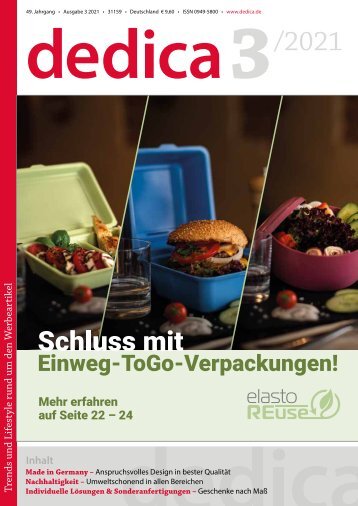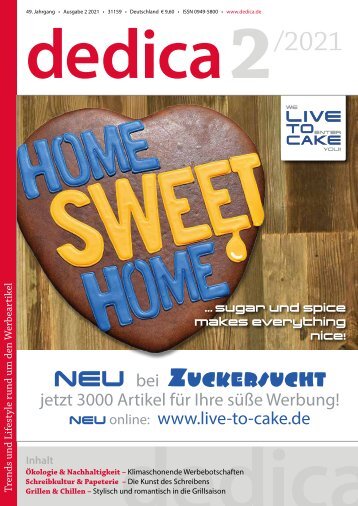Hygiene Report 5/2021
- Text
- Hygiene
- Produkte
- Unternehmen
- November
- Anforderungen
- Bakterien
- Lebensmitteln
- Wasser
- Viren
- Berufskleidung
- Harnischcom
wissenschaft 5·21 Die
wissenschaft 5·21 Die Autoren M. Eng. Johannes Knaus hat an der Technischen Hochschule Ulm ein Masterstudium der Medizintechnik absolviert. Mit der vorgestellten Arbeit zur Reduktion von Corona-ähnlichen Viren mittels UVC-Luftdesinfektionssysteme wurde er sowohl mit dem Förderpreis von Pro! Technische Hochschule Ulm als auch mit dem Förderpreis des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI) ausgezeichnet. Zuvor wurde bereits seine Bachelorarbeit zum Thema Prävention von nosokomialen Pneumonien mit dem WGKT- Innovationspreis prämiert. Dr. Petra Vatter hat in Tübingen und Ulm Biochemie studiert und promoviert und war anschließend über zehn Jahre als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Pharmakologie und Toxikologie der Universität Ulm tätig. Seit 2016 arbeitet sie an der Technischen Hochschule Ulm an verschiedenen Forschungs- und Entwicklungsprojekten zur Anwendung neuer Desinfektionsansätze. Außerdem ist sie Lehrbeauftragte für Grundlagen der Molekularbiologie im Studiengang Medizintechnik. Prof. Dr. Martin Hessling hat Physik und Medizintechnik studiert und ist seit über 15 Jahren Leiter des Biotechnologielabors des Instituts für Medizintechnik und Mechatronik der Technischen Hochschule Ulm. Seit über zehn Jahren beschäftigt er sich in anwendungsnahen Forschungsprojekten mit Strahlungsdesinfektion im Spektralbereich 200- 280 nm (Far-UVC bis zu blauem Licht). Das Ergebnis sind bisher ca. 100 Veröffentlichungen zu verschiedenen Anwendungen von Licht mit Strahlungsdesinfektion als großem Schwerpunkt. nur begrenzt sinnvoll, da in der Anwendung u.a. noch das Raumvolumen und die Raumluftzirkulation eine Rolle spielen. Wenn man sich als Beispiel ein UVC-Luftdesinfektionssystem vorstellt, das bei einer einmaligen Durchströmung nur 70 % der Erreger reduziert, aber dies in einem Raum, der so klein ist, dass die Luft im Mittel alle 5 min einmal durch das System strömt, sind bei einer vereinfachten Betrachtung nach 10 min mehr als 90 % und nach 30 min mehr als 99,9 % der Mikroorganismen oder Viren inaktiviert. Umgekehrt kann ein Luftdesinfektionssystem, das bei einer Durchströmung sogar 99 % Reduktionsleistung zeigt, effektiv zu höheren Keimkonzentrationen in der Luft führen, wenn der Raum so groß ist, dass die Luft weniger als einmal pro Stunde desinfiziert wird. Bei der Auslegung eines Desinfektionssystems spielen daher das Luftvolumen im Raum eine Rolle, die Strömungsgeschwindigkeit durch das Desinfektionssystem und die Desinfektionsleistung des UVC- Systems. Das Raumvolumen ist in einer konkreten Anwendung in der Regel bekannt und mit sogenannten CFD-Programmen (Computer Fluid Dynamics) lassen sich Luftströmungen im Raum simulieren und damit optimale Aufstellorte für Luftdesinfektionssysteme ermitteln. Schwieriger ist die Frage nach der tatsächlichen Desinfektionsleitung oder effektiven Bestrahlungsdosis des UVC-Systems bei einmaliger Durchströmung. Die Bestrahlungsstärke im Luftdesinfektionssystem hängt von der Entfernung zur UVC-Quelle und der Fluiddynamik ab. Es kann passieren, dass Teilströme deutlich kürzer und mit geringerer Intensität bestrahlt werden, als das im Mittel der Fall ist. Die Mittelwerte eignen sich immerhin, um einen Anhaltspunkt für die erreichbare Desinfektionsleistung zu erhalten, aber für verlässlichere Aussagen sind mikrobiologische Tests notwendig – und bei diesen Tests sind verschiedene Aspekte zu beachten. Die bedeutenden Erreger, die es zu reduzieren gilt, sind pathogen und daher dürfen solche Tests nur in geeigneten Laboren durchgeführt werden. Die Anforderungen an Labore, die mit SARS-CoV-2 arbeiten, sind sogar besonders hoch: Arbeiten mit diesen Viren sind nur in Laboratorien der Sicherheitsstufe 3 zulässig, da es in der Vergangenheit beim ersten SARS-Coronavirus zu Laborunfällen gekommen ist. Die Gefahr eines solchen Unfalls steigt, wenn solche Viren oder andere pathogene Krankheitserreger nicht nur in begrenzten Flüssigkeitsvolumen aufbewahrt, sondern sogar gezielt für Versuche in der Luft verteilt werden. Daher ist es praktisch kaum möglich, alle UVC-Luftdesinfektionssystemen, die seit der Corona-Pandemie auf den Markt gekommen sind oder sich aktuell noch in der Entwicklung befinden, mit hochinfektiösen Coronaviren oder anderen relevanten Krankheitserregern in der Luft zu testen. Teststand für UVC- Luftdesinfektionssysteme und Test mit Surrogaten Eine Abhilfe können hier Tests mit sogenannten Surrogaten bringen. Dabei handelt es sich um biologisch oder strukturell verwandte Mikroorganismen oder Viren, die nicht oder zumindest weniger pathogen sind und von denen bekannt ist oder angenommen werden darf, dass Abb. 3: Schematische Darstellung des entwickelten Teststands für UVC- Luftdesinfektionssysteme. Nach Verneblung der Mikroorganismen gelangen diese über eine Aerosolkammer in das UVC-Luftdesinfektionssystem. Durch Probenahme vor und nach der UVC-Bestrahlung kann auf die Effizienz des UVC-Luftdesinfektionssystems geschlossen werden. Eine weitere zusätzliche physikalische Filterung sorgt für Sicherheit im Labor. sie sich ähnlich verhalten wie die gefährlicheren Erreger. Zum Test der Wirkung eines kommerziellen UVC-Luftdesinfektionssystems mit einer 16 www.hygiene-report-magazin.de
november wissenschaft Abb. 4: 3D-Darstellung des entwickelten UVC- Luftdesinfektionsteststands. 60-W-Quecksilberdampflampe haben wir das Bakterium Staphylococcus carnosus und das Virus Phi6 verwendet. S. carnosus wird hier als Surrogat für den Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus (MRSA) eingesetzt, der im Krankenhausbereich problematisch ist. Phi6 ist wie SARS-CoV-2 ein behülltes RNA-Virus, aber mit dem Unterschied, dass Phi6 nur Bakterien infiziert und damit für den Menschen unbedenklich ist. Diese beiden Surrogate werden in einem Desinfektionsteststand (Abb. 3) getrennt voneinander vernebelt und durchströmen das zu testende UVC-Luftdesinfektionssystem. Direkt vor und hinter dem Desinfektionssystem sind Halterungen für Petrischalen, welche mit einer neutralen Salzlösung befüllt sind, angebracht. Ein Teil der Mikroorganismen im Desinfektionsteststand gelangt durch den mittels Vernebler erzeugten Volumenstrom auf die eingelegten Petrischalen und setzt sich in den Salzlösungen ab. Durch die anschließende mikrobiologische Analytik kann eine quantitative Auswertung vor und nach der UVC-Bestrahlung erfolgen. Für das Bakterium S. carnosus erfolgt die Auswertung, indem ein definiertes Volumen der bakterienhaltigen Salzlösung auf geeigneten Nähragarplatten ausplattiert wird. Bakterien, die die UVC- Strahlung überlebt haben, vermehren sich und bilden nach 24 h kleine, zählbare Kolonien. In Abb. 5 sind mit Bakterien vor und hinter der Bestrahlungseinheit bewachsene Agarplatten dargestellt und die Reduktion der Kolonien ist deutlich erkennbar. Die Bestimmung der Virus-Konzentrationen erfolgt ähnlich, benötigt aber zusätzliche Schritte, da die Viren für ihre Vermehrung Wirtzellen benötigen. Phi6 vermehrt sich mit Hilfe eines Pseudomonaden-Stamms. Befallene Pseudomonaden lösen sich auf. Damit können die Viren über Löcher („Plaques“) in einem Bakterienrasen sichtbar gemacht (Abb. 6) und ebenfalls gezählt werden. Die quantitative Auswertung der Versuche zeigt, dass S. carnosus bei einer einmaligen Durchströmung durch das getestete UVC-Luftdesinfektionssystem um 99,74 % reduziert wird, und es kann angenommen werden, dass die Wirkung auf den gefürchteten Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus ähnlich ist. Das Virus Phi6, das hier als Coronavirus-Surrogat verwendet wird, wird beim einmaligen Durchlauf um 85,10 % reduziert. Coronaviren und Phi6 sind ähnlich aufgebaute behüllte RNA-Viren, aber mikrobiologisch oder genetisch nicht miteinander verwandt. Eine Abschätzung der Bestrahlungsdosis aus mittlerer Bestrahlungsstärke und Bestrahlungsdauer führt dazu, dass Phi6 mit ca. 4,4 mJ/cm 2 bestrahlt wurde. Daraus ergibt sich, dass eine Dosis von 5,7 mJ/cm 2 für eine 90%-Reduktion notwendig gewesen wäre. Dieser Wert liegt deutlich über den zuletzt publizierten Daten für Coronaviren, daher wäre die Desinfektionsleistung des getesteten Systems für Coronaviren vermutlich deutlich besser. Dieses vorgestellte Beispiel zeigt, dass UVC-Strahlung sehr wirksam gegen Bakterien und Viren ist und dass schon eine einmalige Durchströmung eines kommerziellen UVC-Luftdesinfektionssystems den größten Teil der Erreger inaktivieren kann. Der tatsächliche Wirkungsnachweis ist schwierig, aber mit Hilfe von Surrogaten, die eine vergleichbare oder geringere UVC-Empfindlichkeit aufweisen als die relevanten Pathogene, kann die Desinfektionsleistung eines UVC-Luftdesinfektionssystems anwendungsnah ermittelt werden. Abb. 5: links: typische Agarplatte mit Kolonien von S. carnosus vor dem Luftdesinfektionssystem; rechts: Agarplatte mit Kolonien von S. carnosus hinter dem Luftdesinfektionssystem; die Reduktion der Staphylokokken ist deutlich zu erkennen. Abb. 6: links: durch Phi6 verursachte Plaques in einem Bakterienrasen aus einer Probe vor Bestrahlung mit dem UVC-Luftdesinfektionssystem; rechts: durch Phi6 verursachte Plaques in einem Bakterienrasen aus einer Probe nach Bestrahlung mit dem UVC-Luftdesinfektionssystem; die Reduktion der Viren ist deutlich zu erkennen. Quelle: TH Ulm Literaturnachweis und Referenzen auf Anfrage! Kontaktadresse der Autoren: Prof. Dr. Martin Hessling Technische Hochschule Ulm Institut für Medizintechnik und Mechatronik Albert-Einstein-Allee 55 D-89081 Ulm E-Mail: Martin.Hessling@thu.de 17
- Seite 1 und 2: ISSN 1618-2456 Internationale Fachz
- Seite 3 und 4: 5·21 Report Inhalt Editorial 4 9 1
- Seite 5 und 6: november schwerpunkt Das Tank-Über
- Seite 7 und 8: november schwerpunkt Kompromisslose
- Seite 9 und 10: november schwerpunkt Hygiene ist in
- Seite 11 und 12: ASR A1.5/1.2 R9 - R13 „Ein kleine
- Seite 13 und 14: november wissenschaft Mit „moleku
- Seite 15: november wissenschaft säure und Ri
- Seite 19 und 20: november hygienic design Schweißn
- Seite 21 und 22: november interview Hygiene, verknü
- Seite 23 und 24: november Aktuelles Desinfektionsmit
- Seite 25 und 26: november Aktuelles BVL: Wildpilze n
- Seite 27 und 28: november berufskleidung Vorgeschrie
- Seite 29 und 30: november qualitätsmanagement Effiz
- Seite 31 und 32: november schnellmethoden Fachkraft,
- Seite 33 und 34: november praxis Geschmackvoller Hyg
- Seite 35 und 36: november Fachforen/Messen Positiv g
- Seite 37 und 38: november produkte & Partner Steam H
- Seite 39 und 40: november produkte & Partner „Sich
- Seite 41 und 42: november veranstaltungen Mikrobiolo
Unangemessen
Laden...
Magazin per E-Mail verschicken
Laden...
Einbetten
Laden...