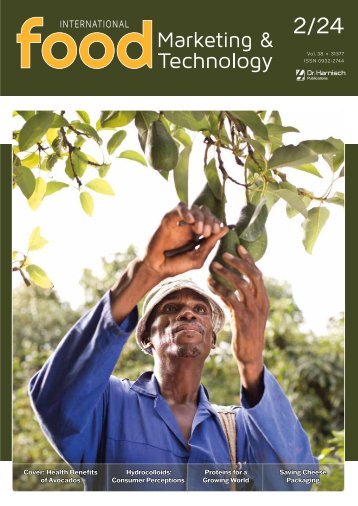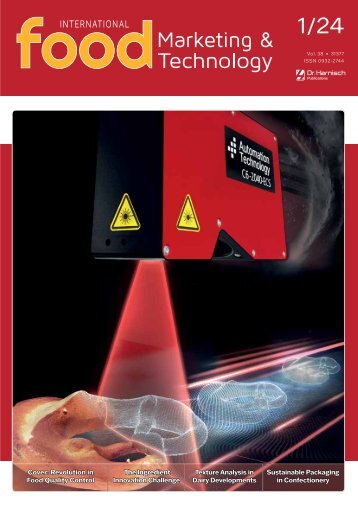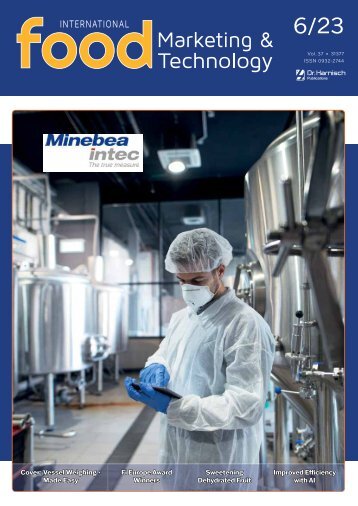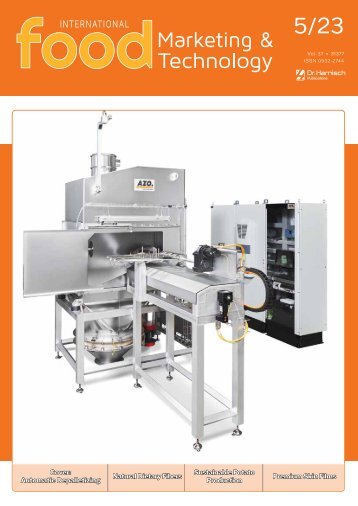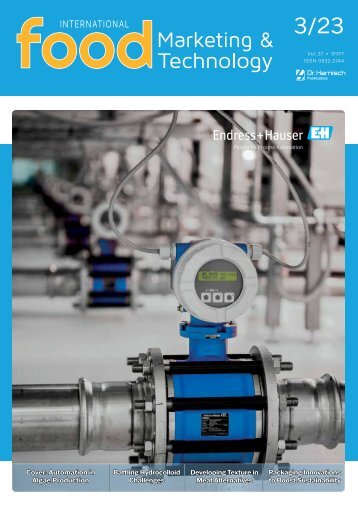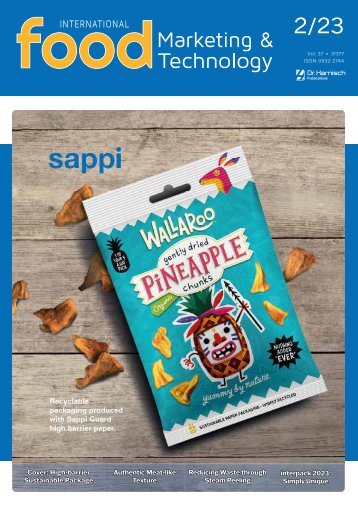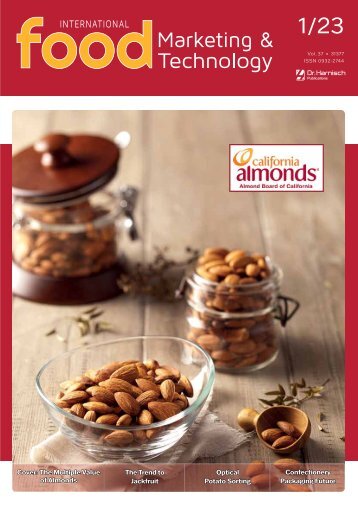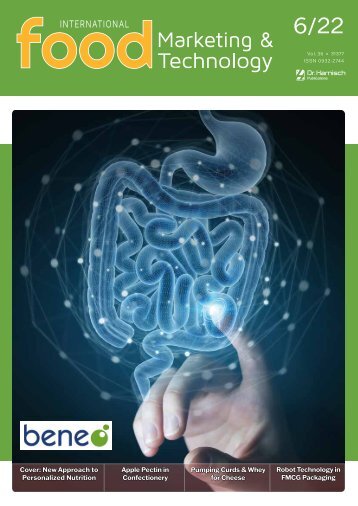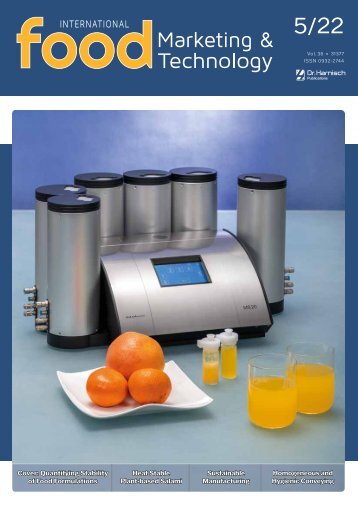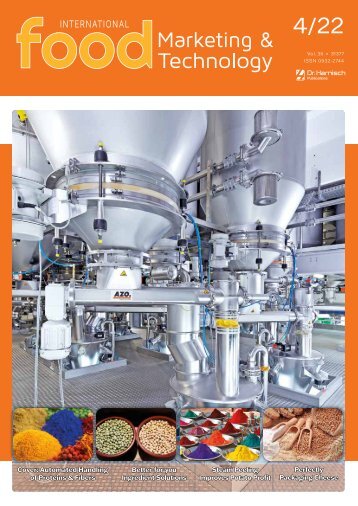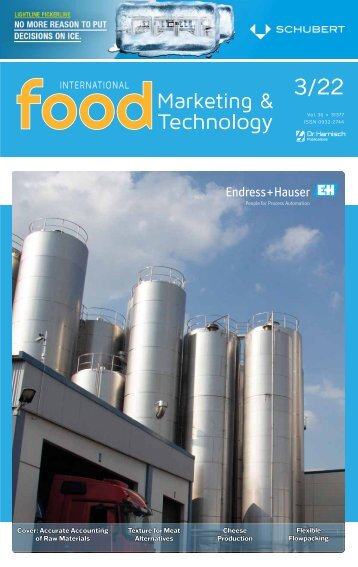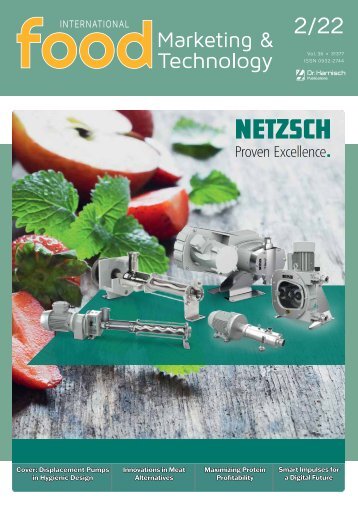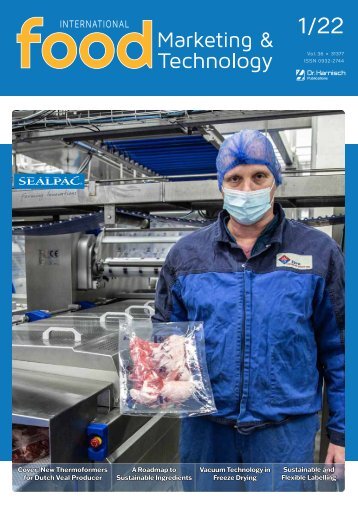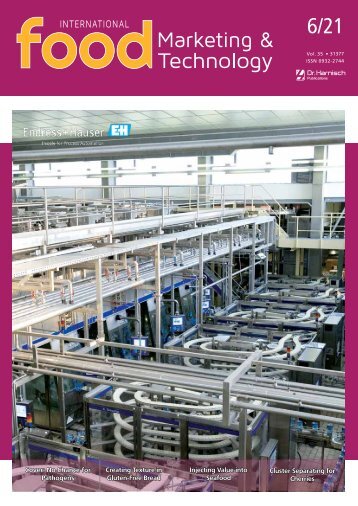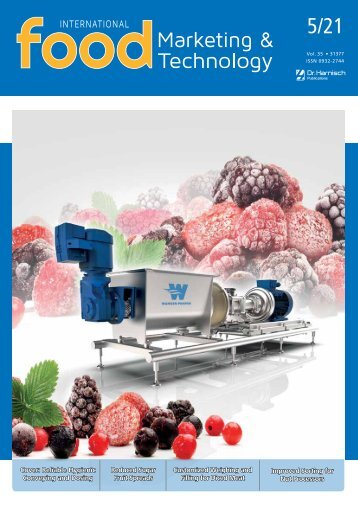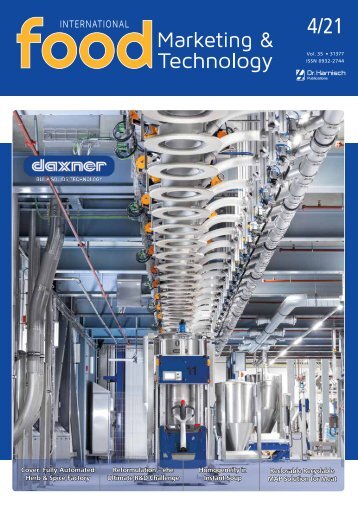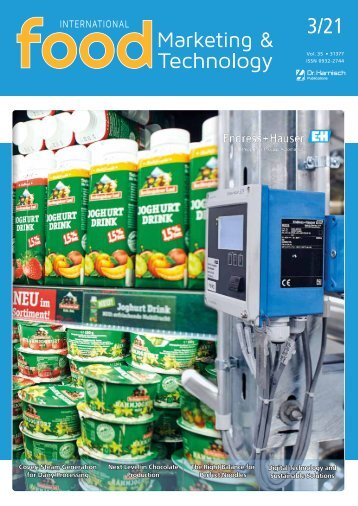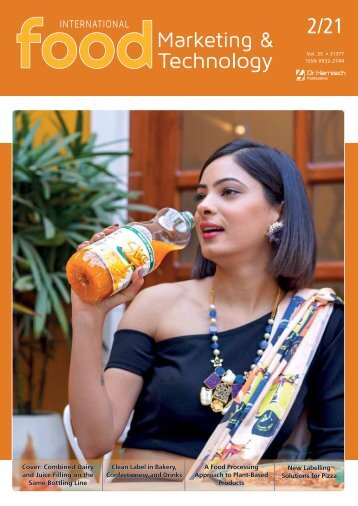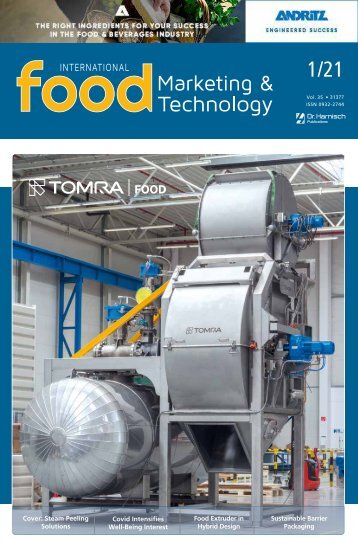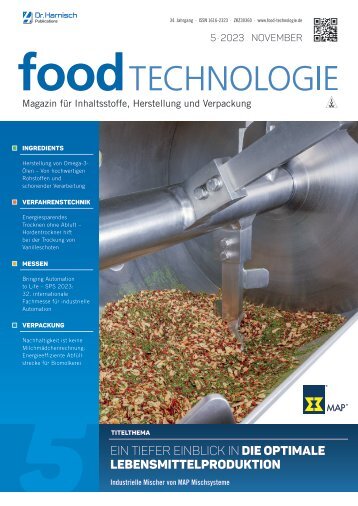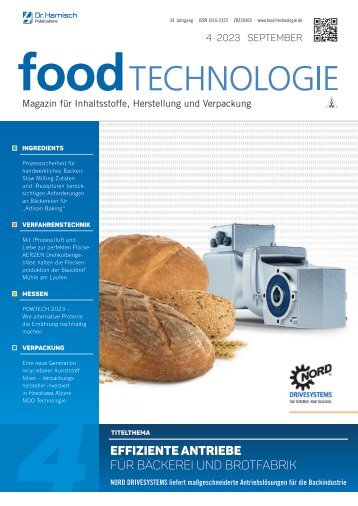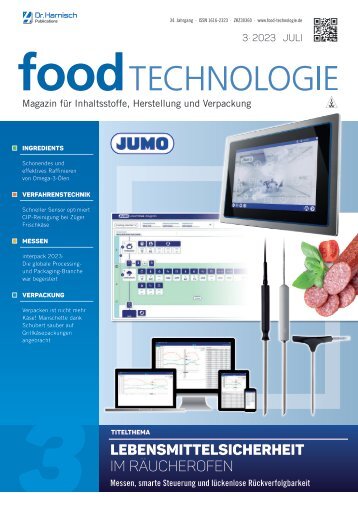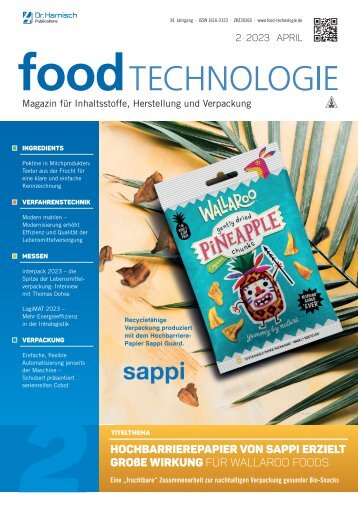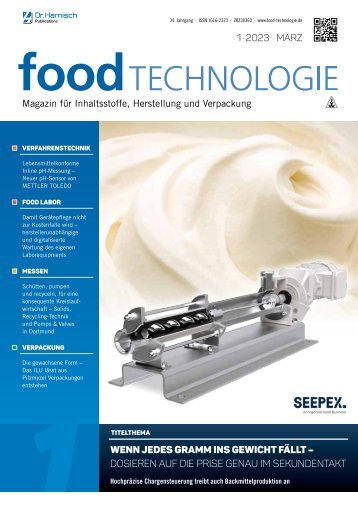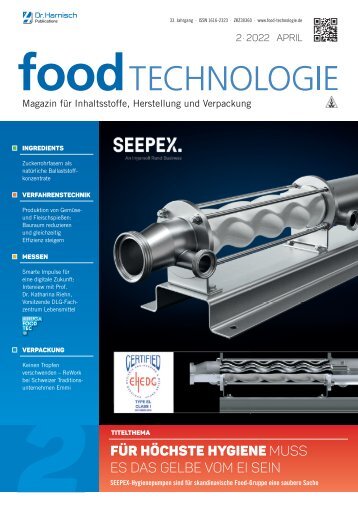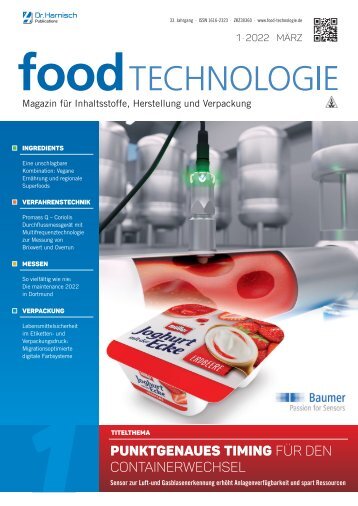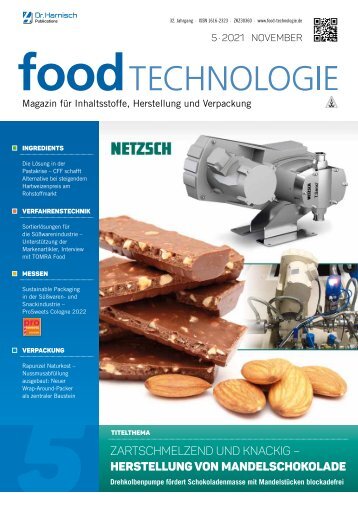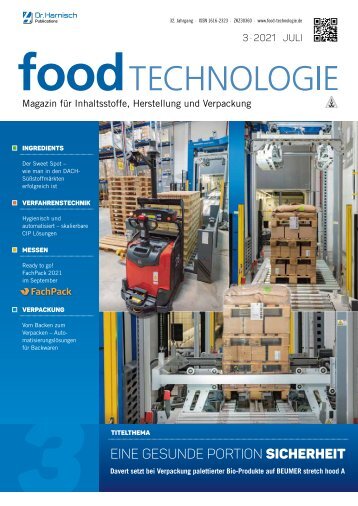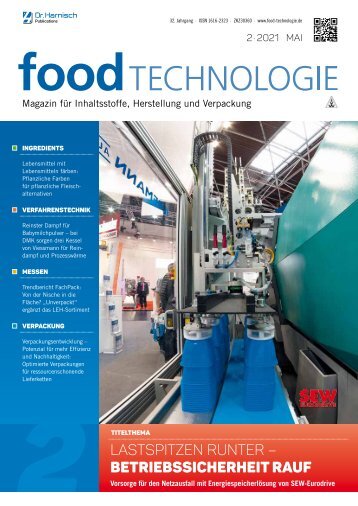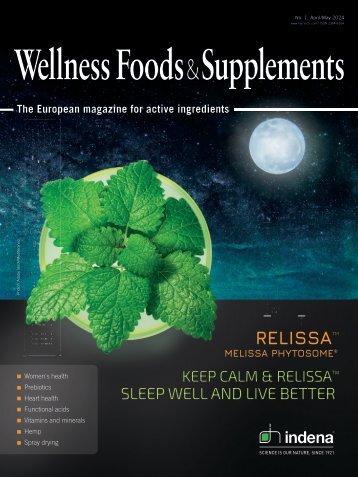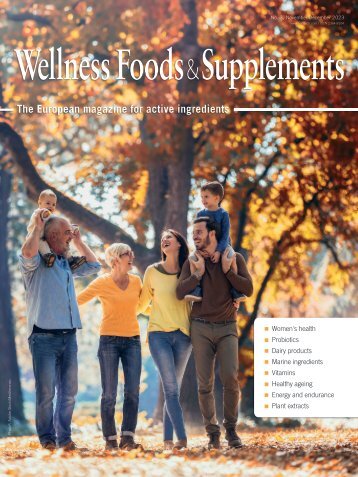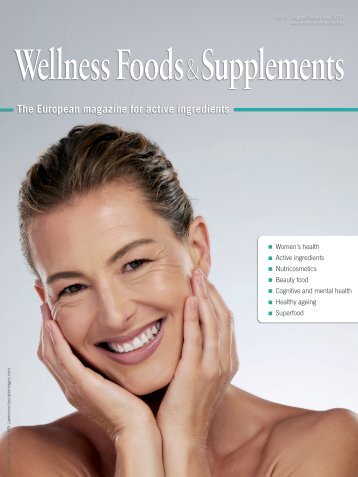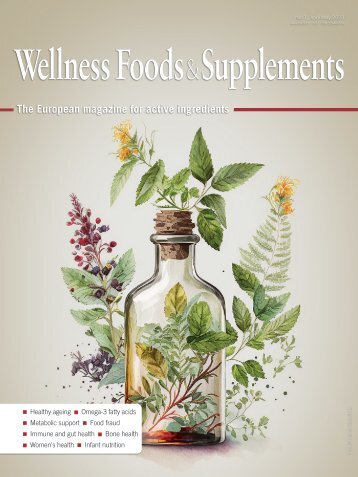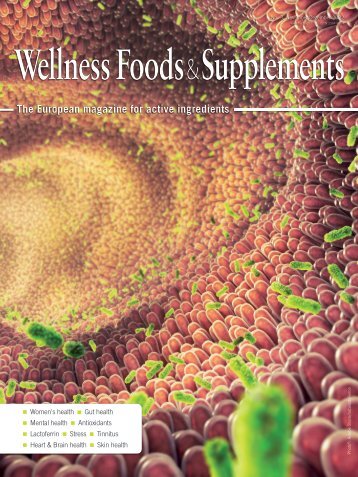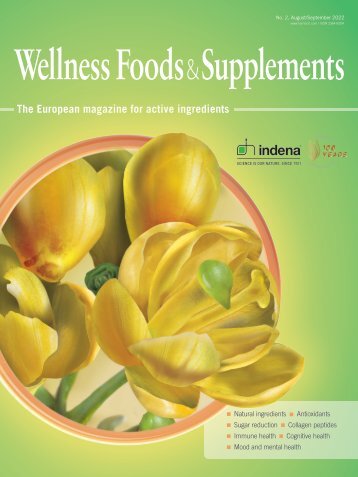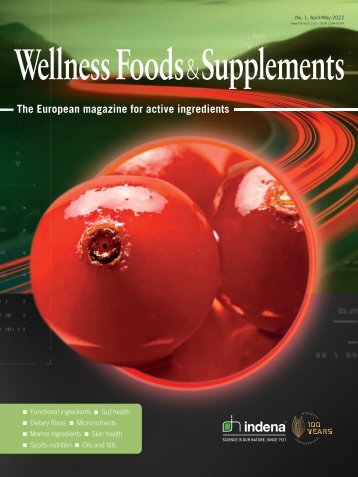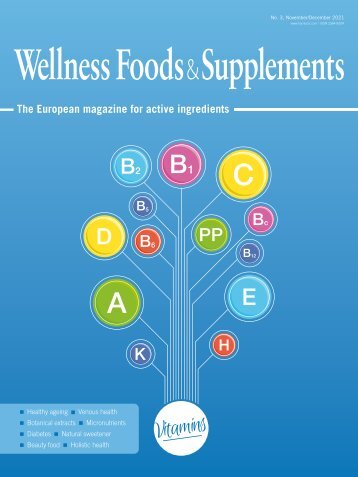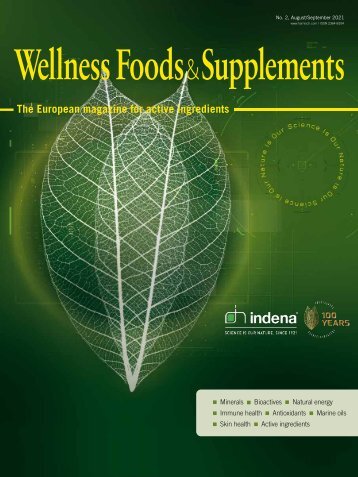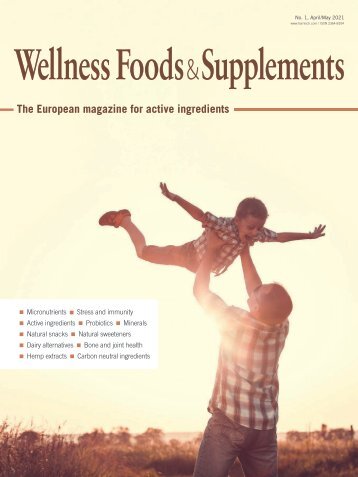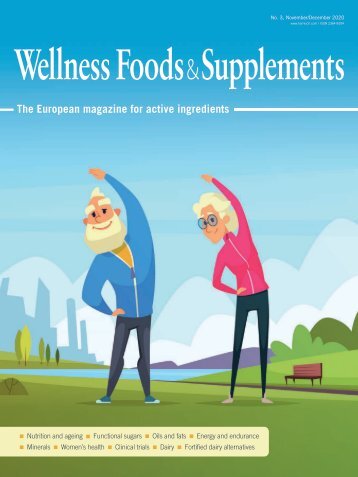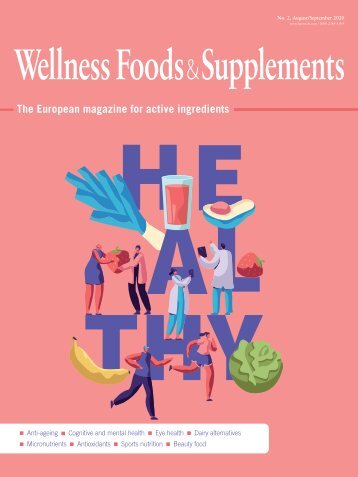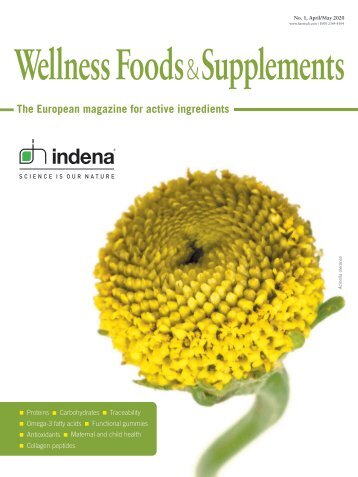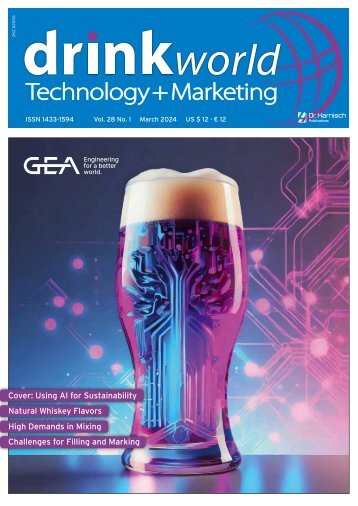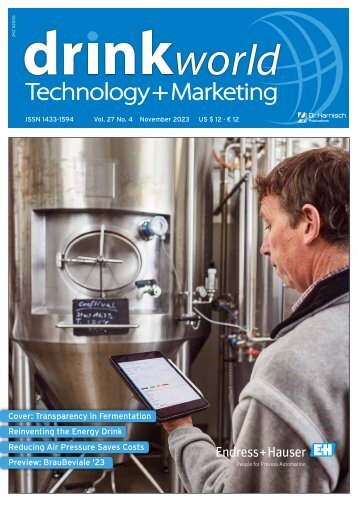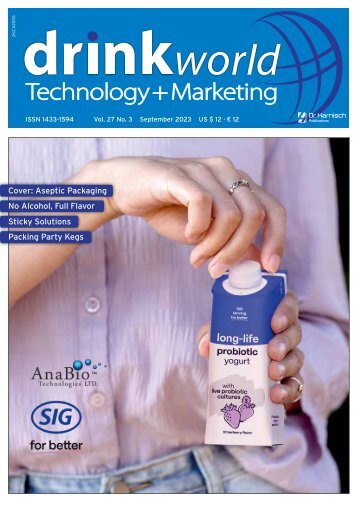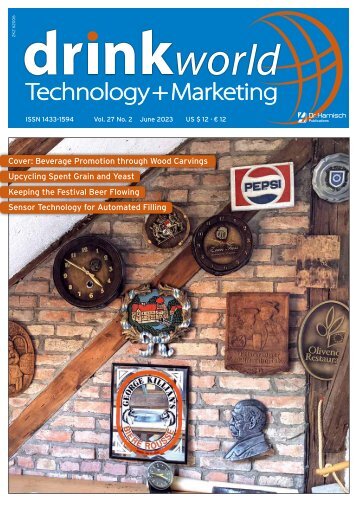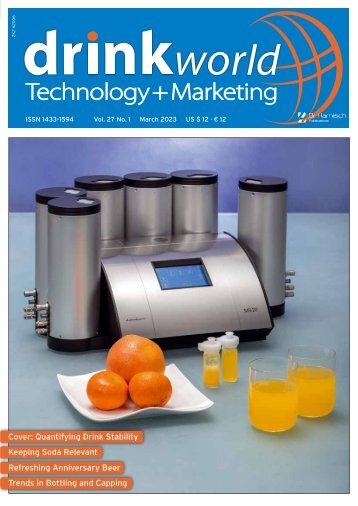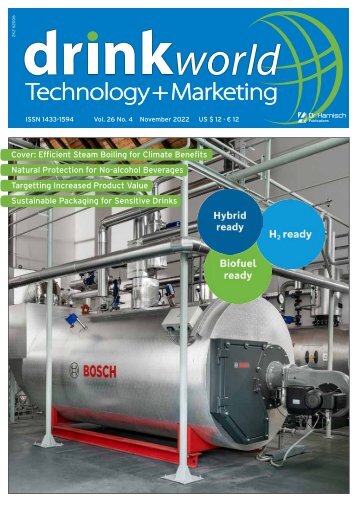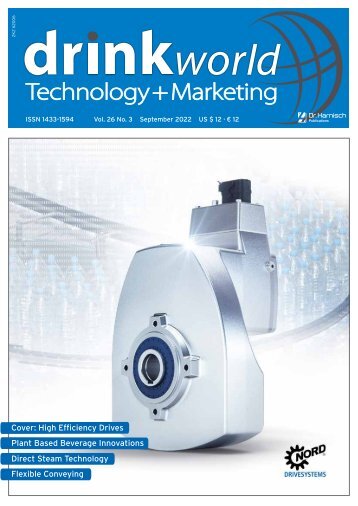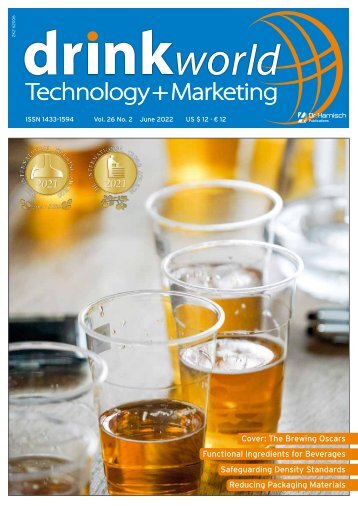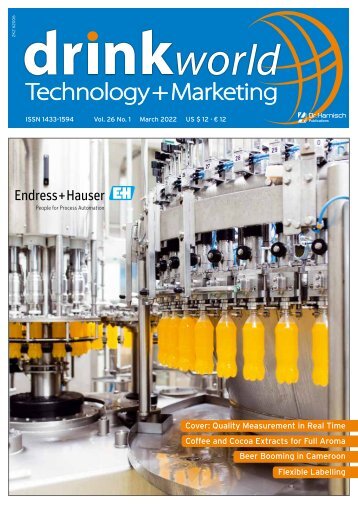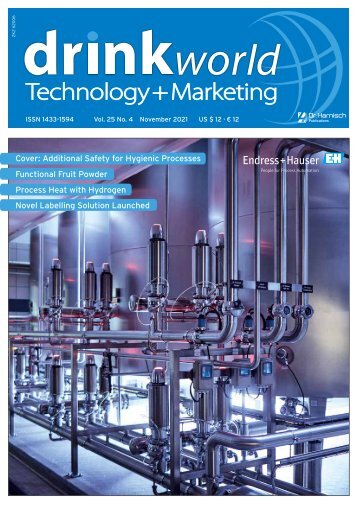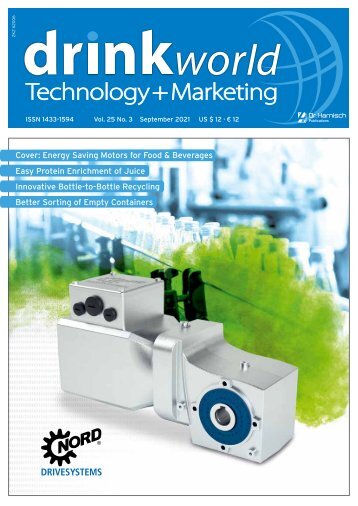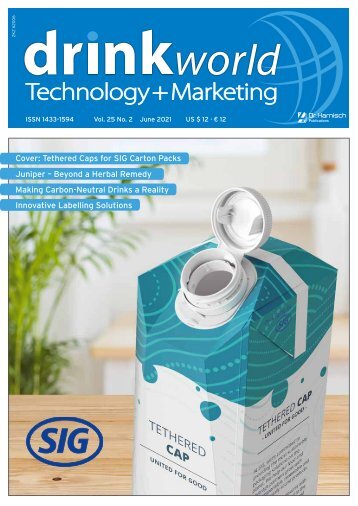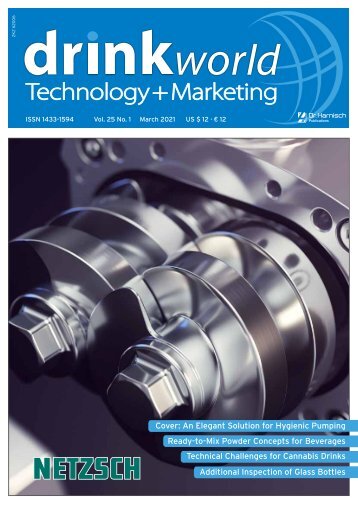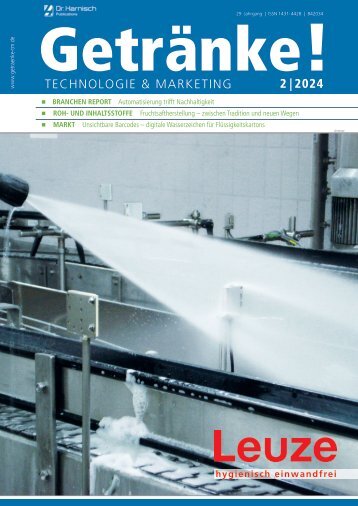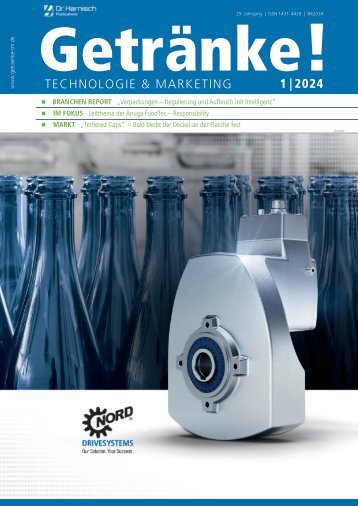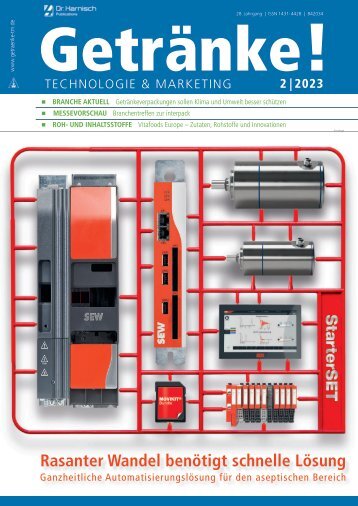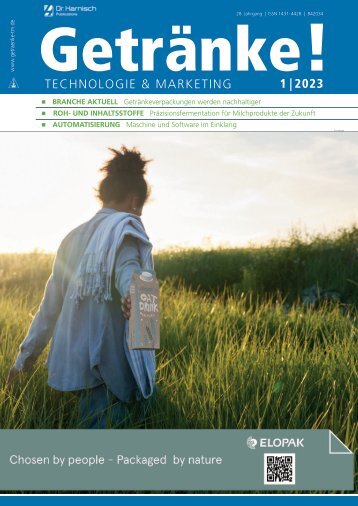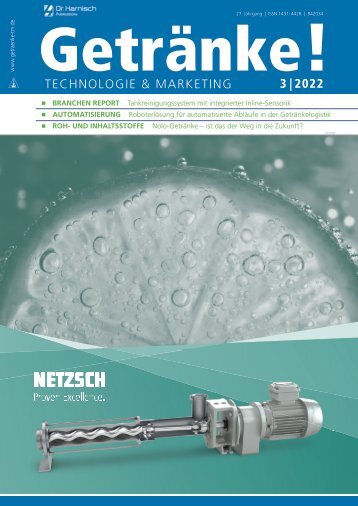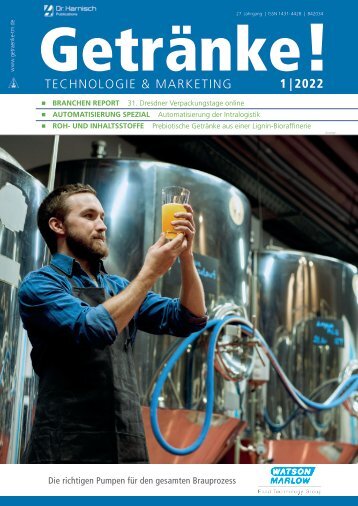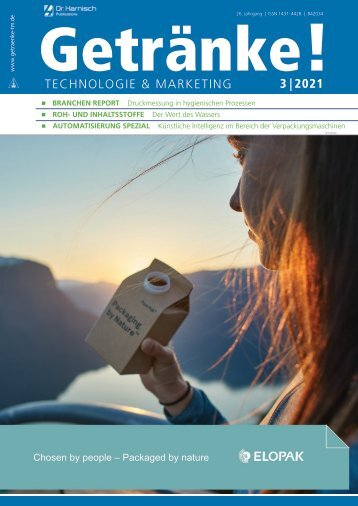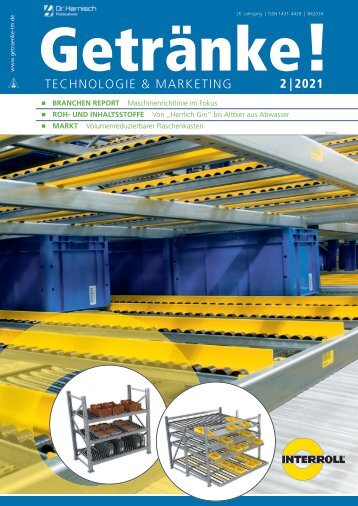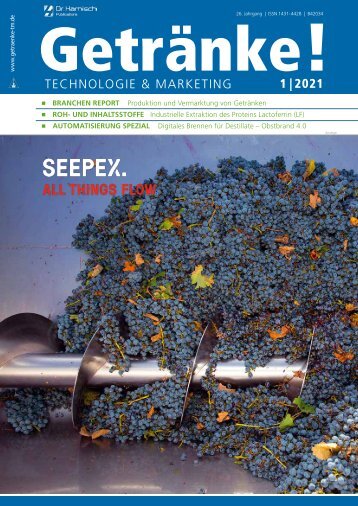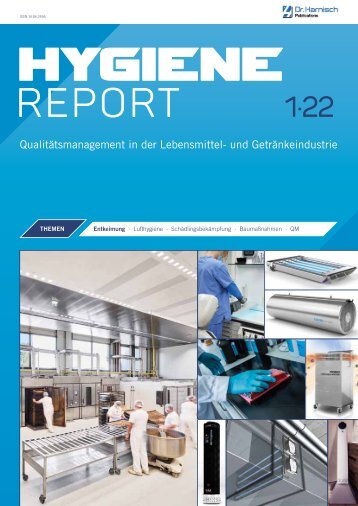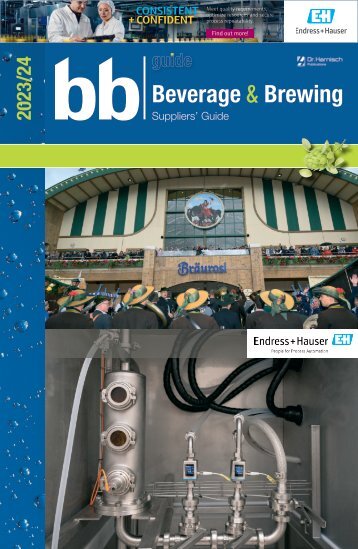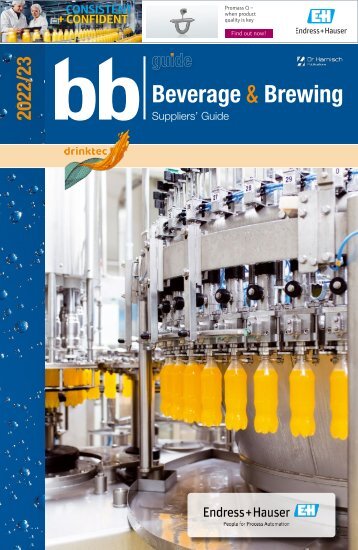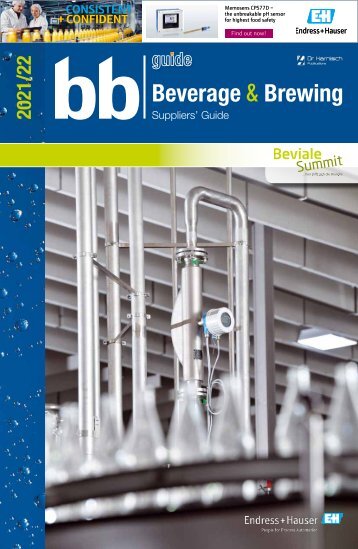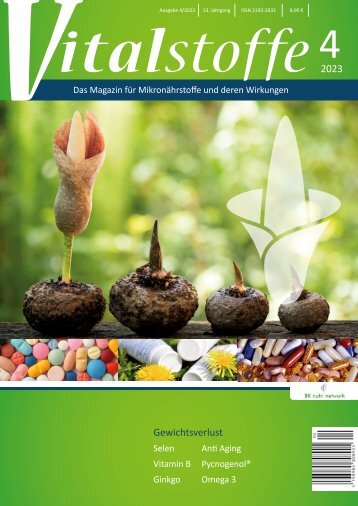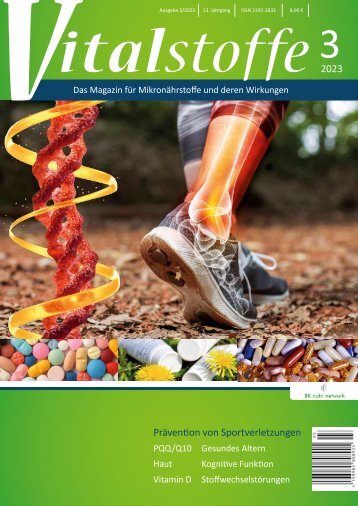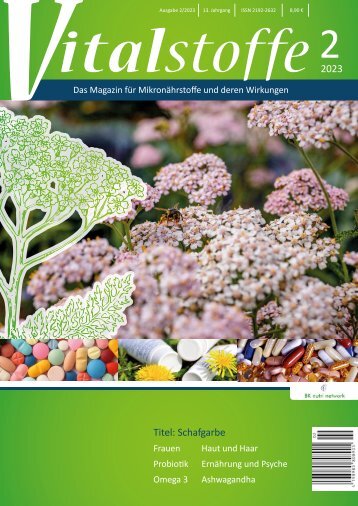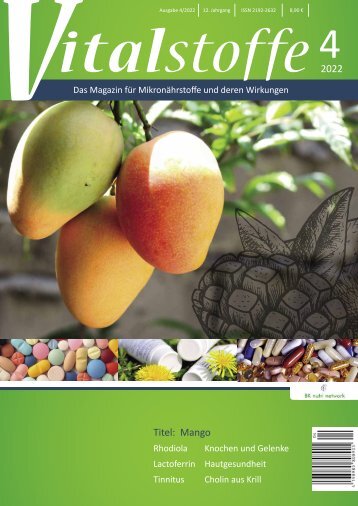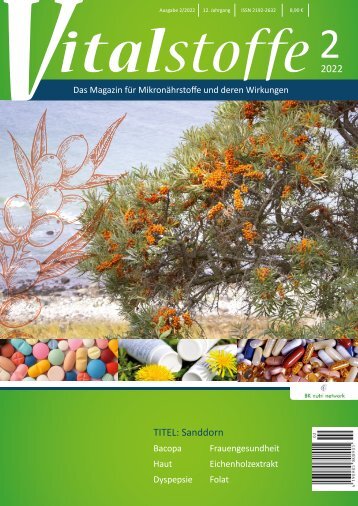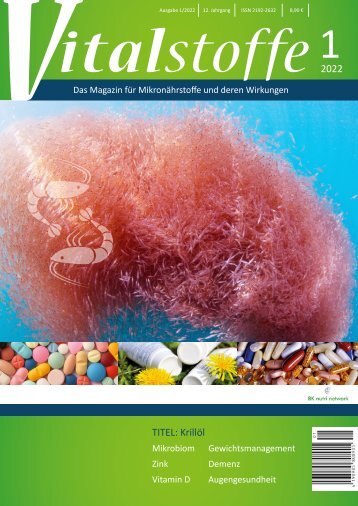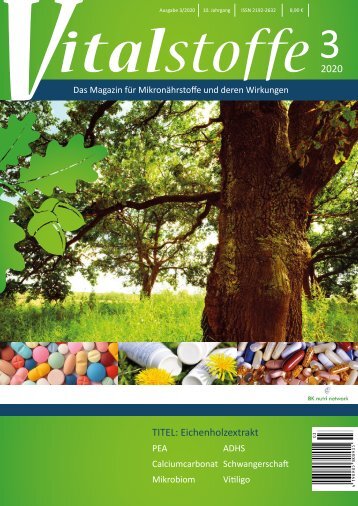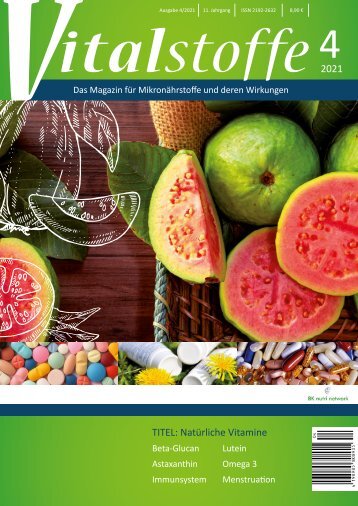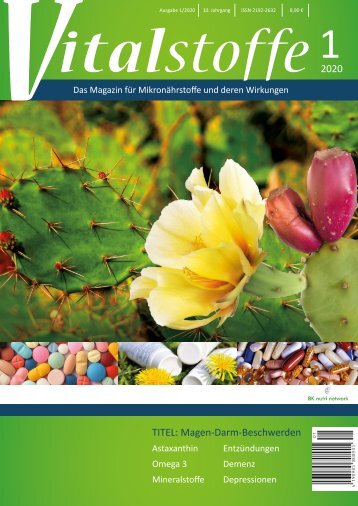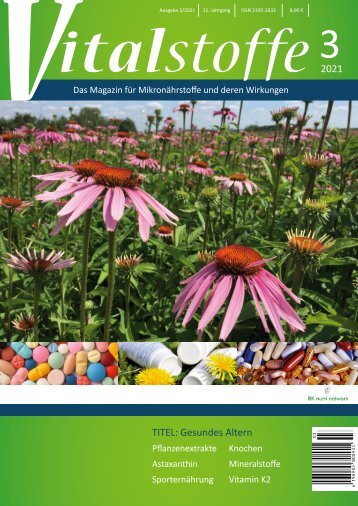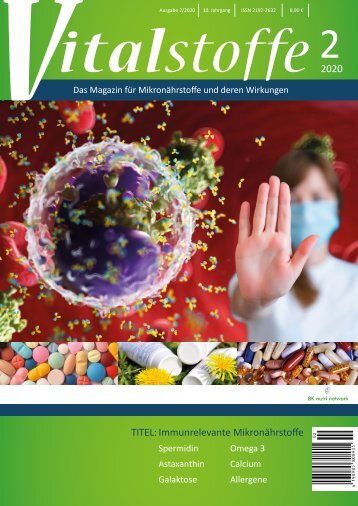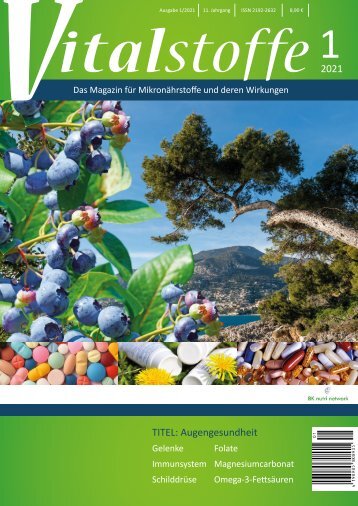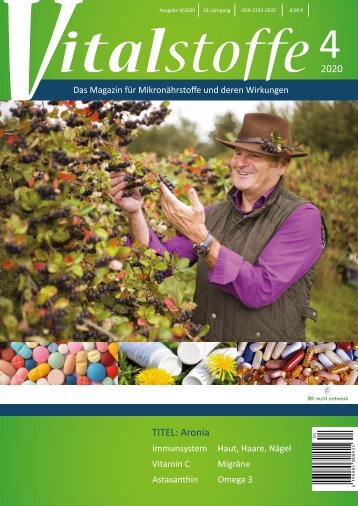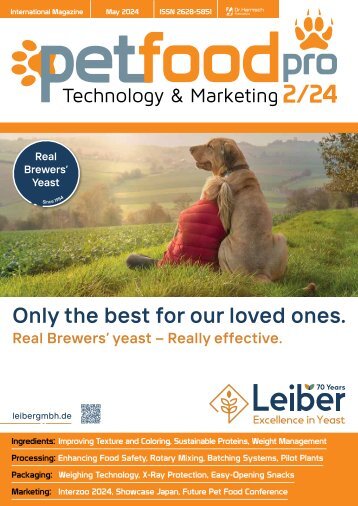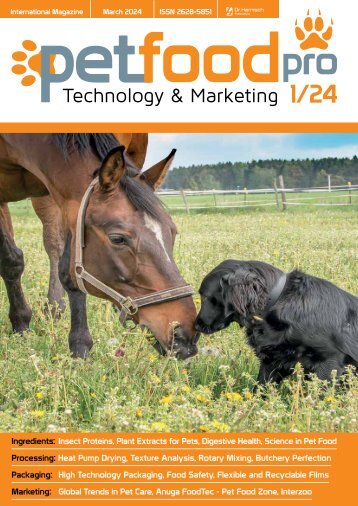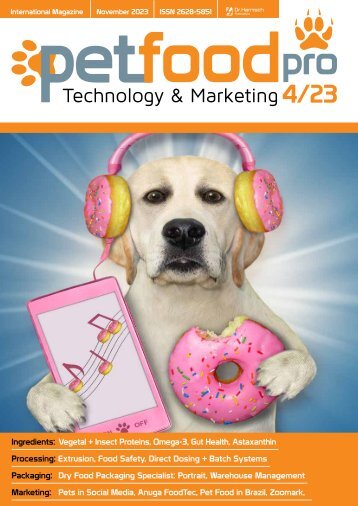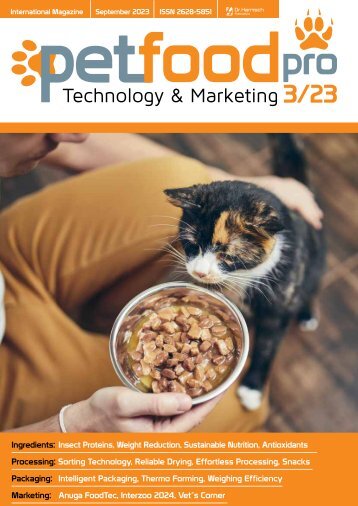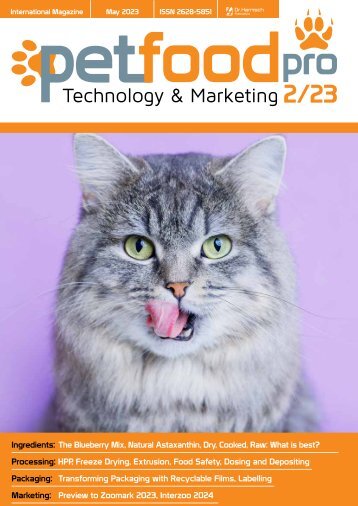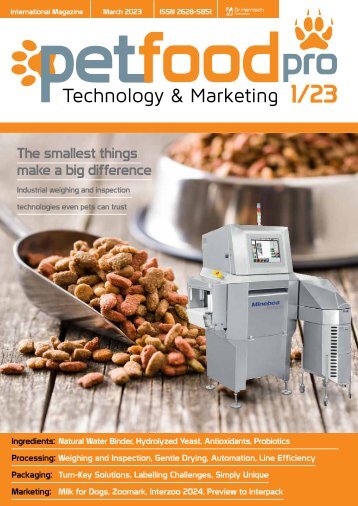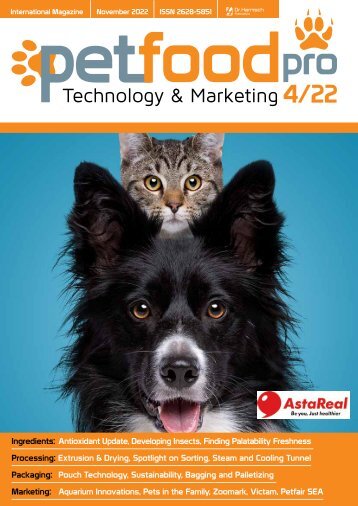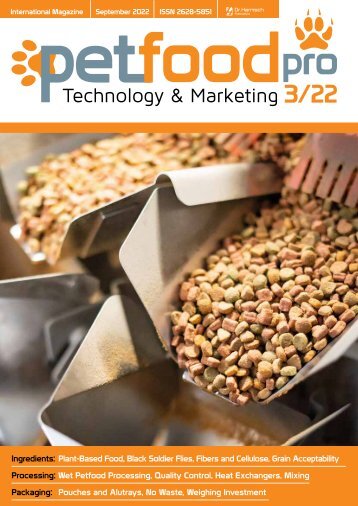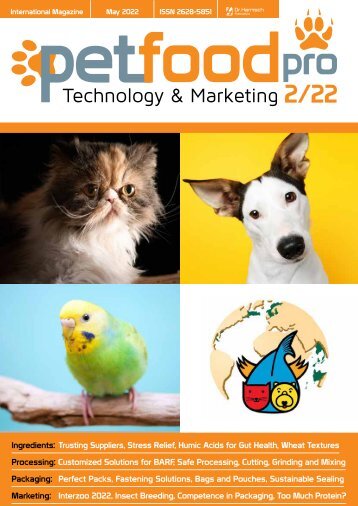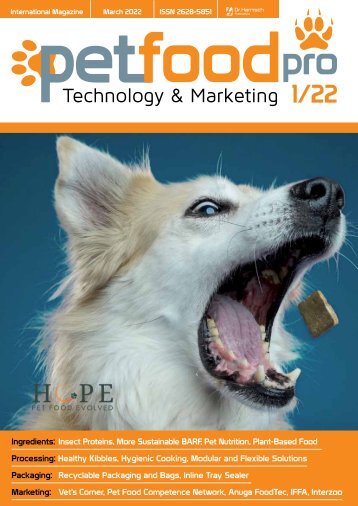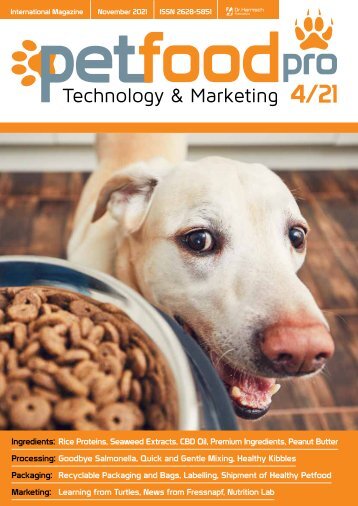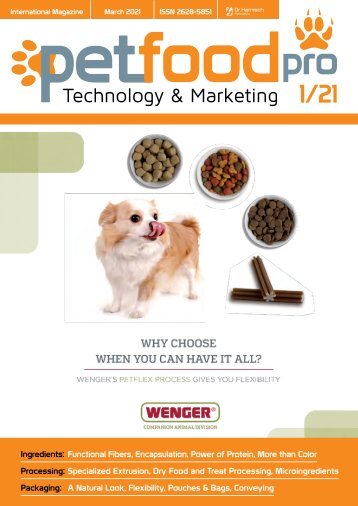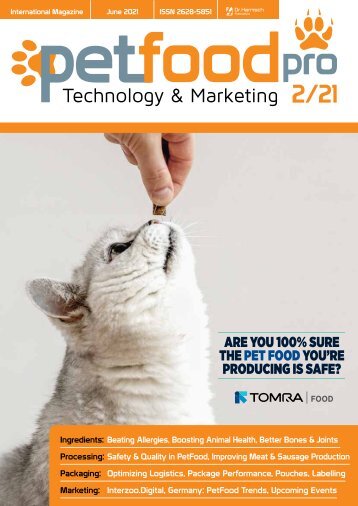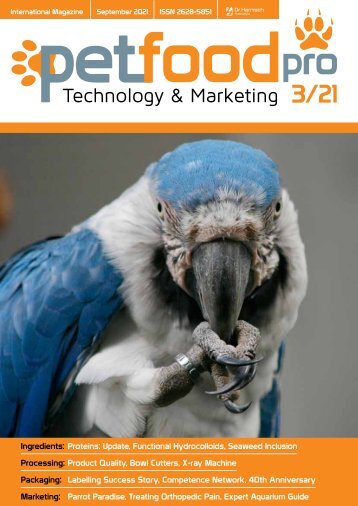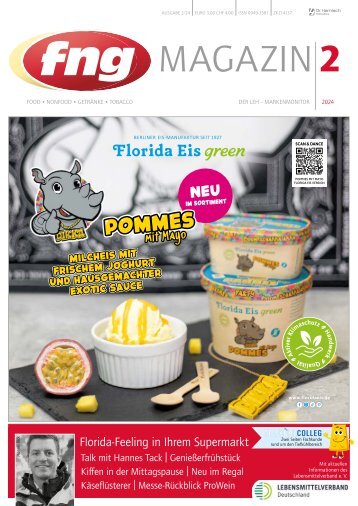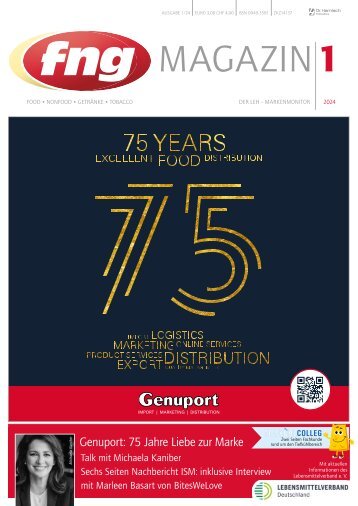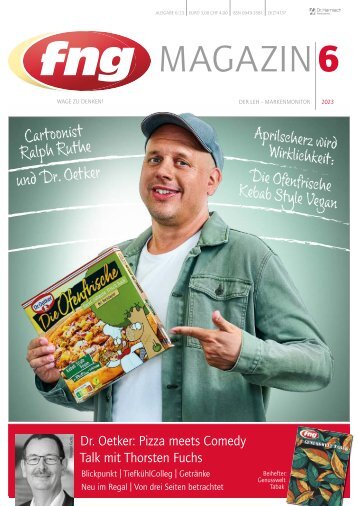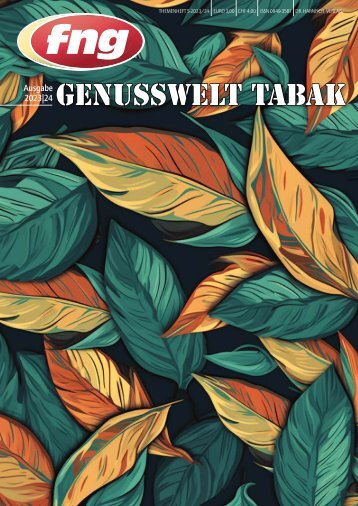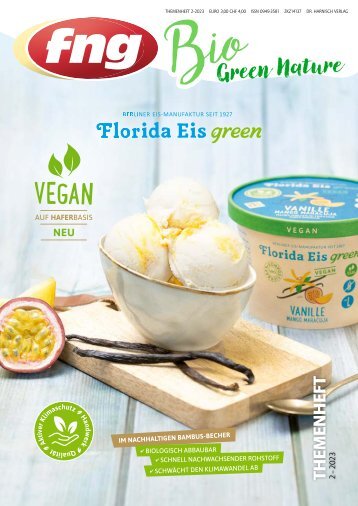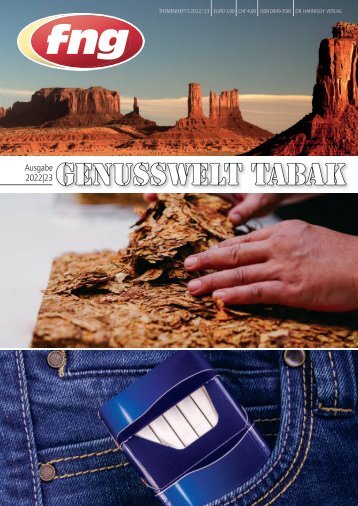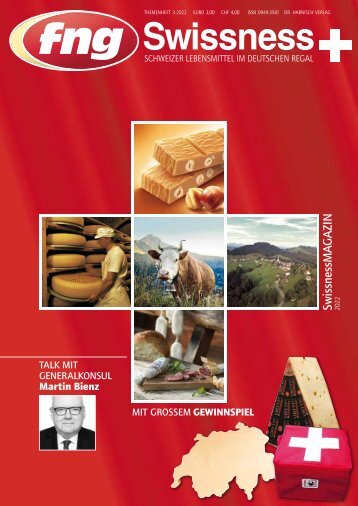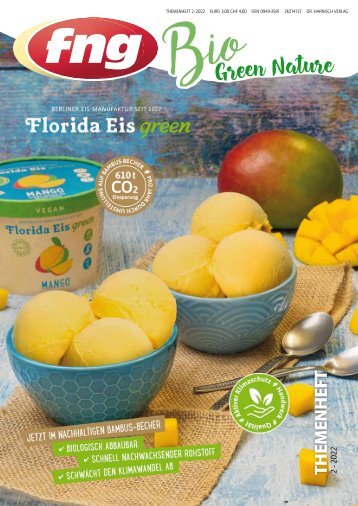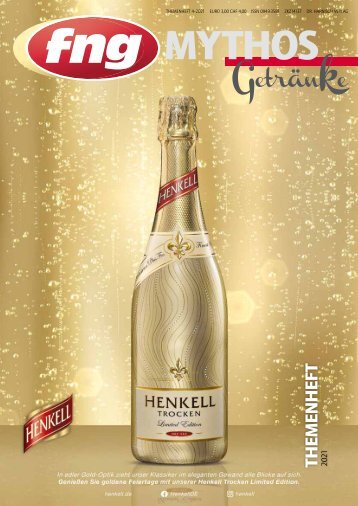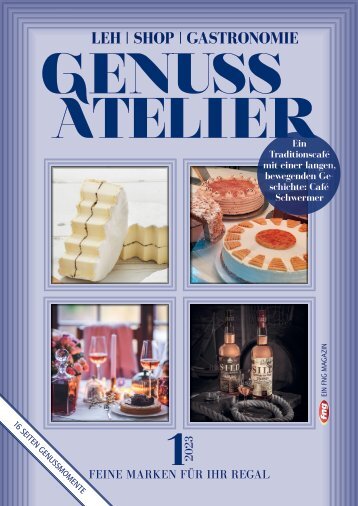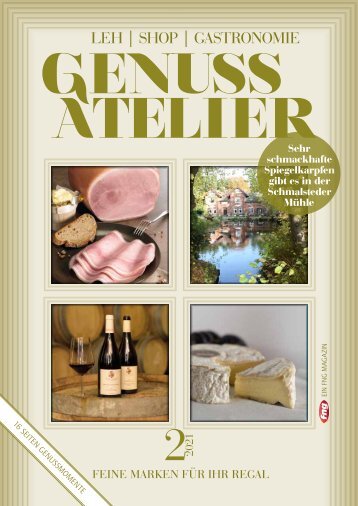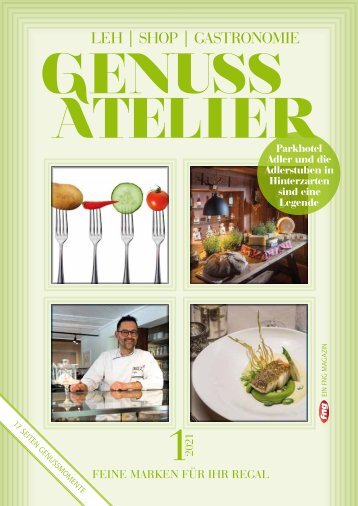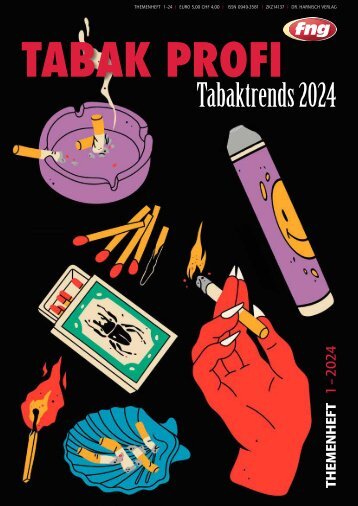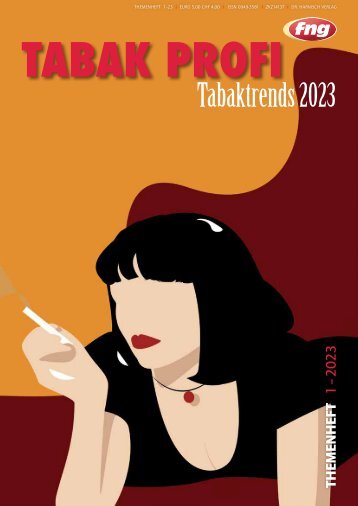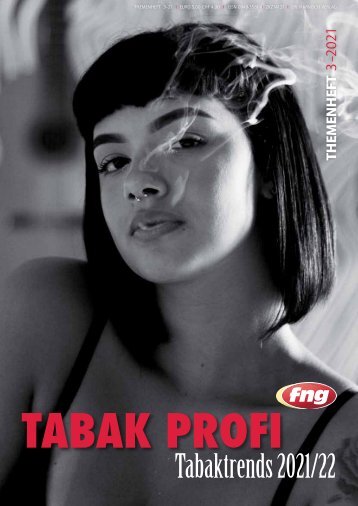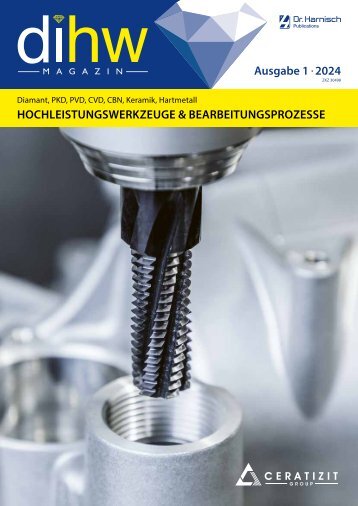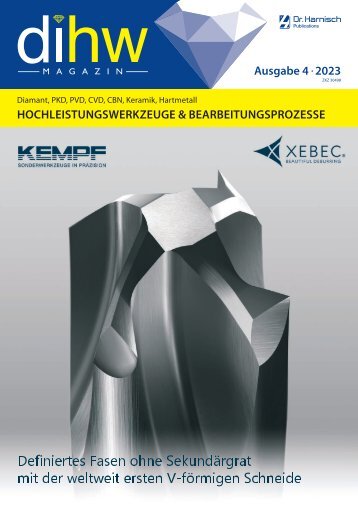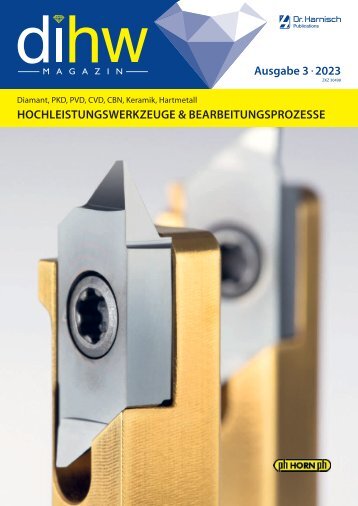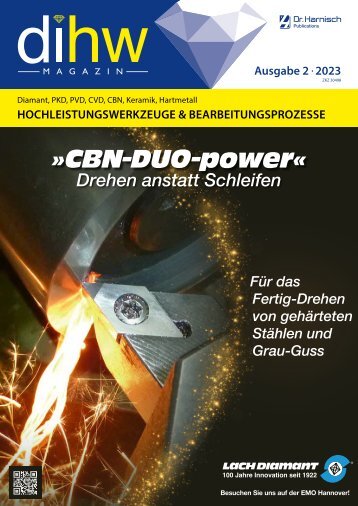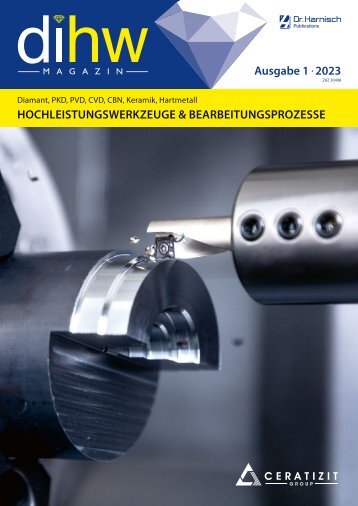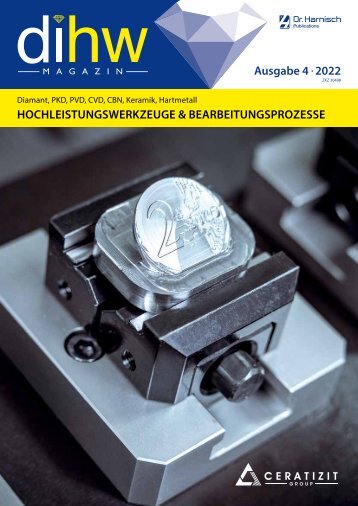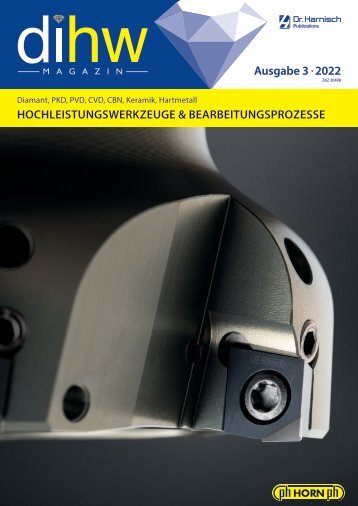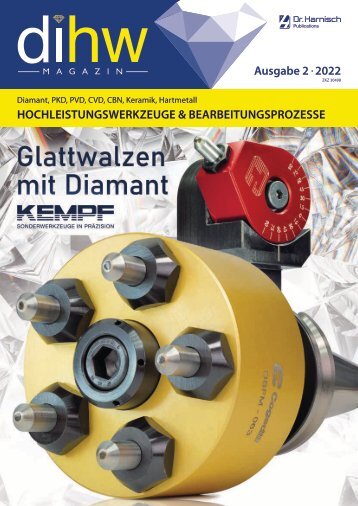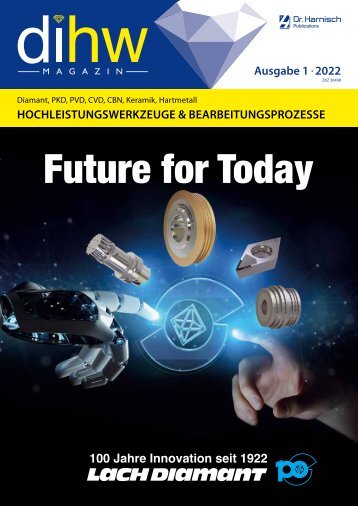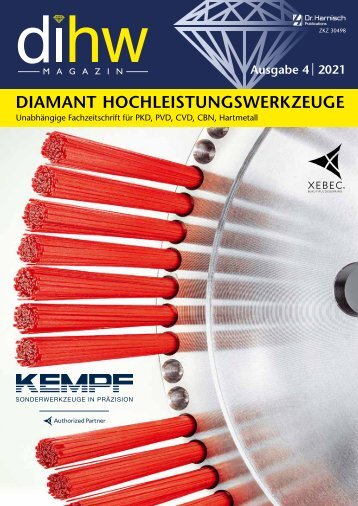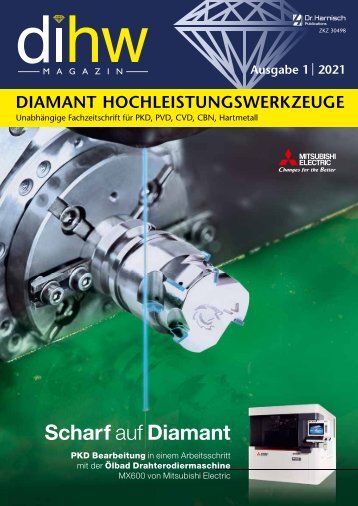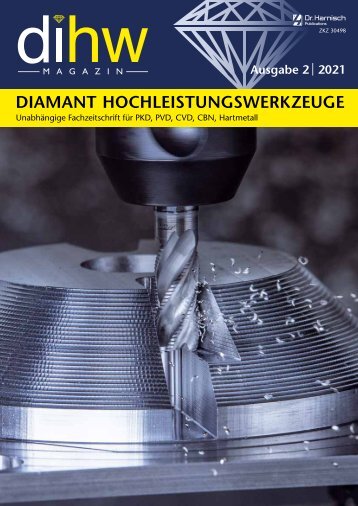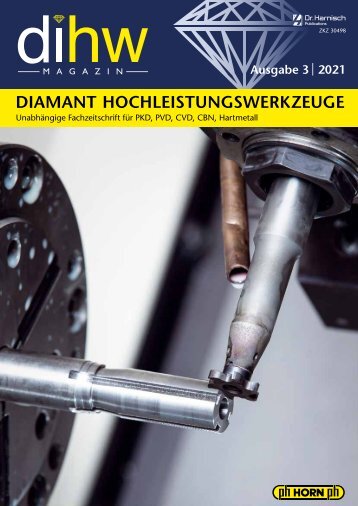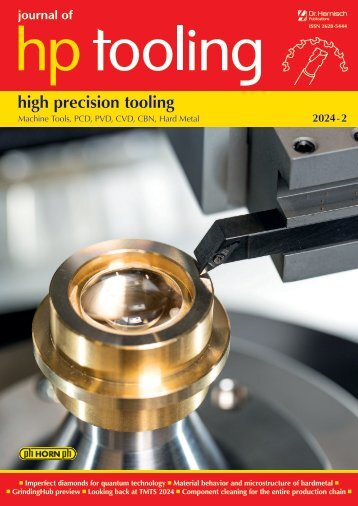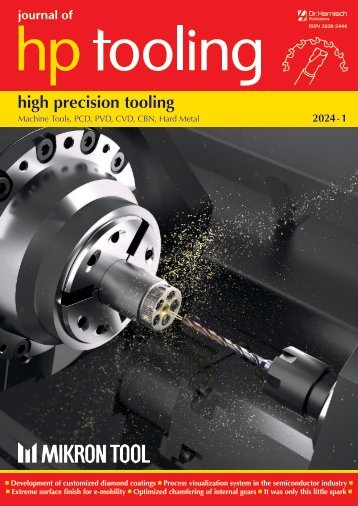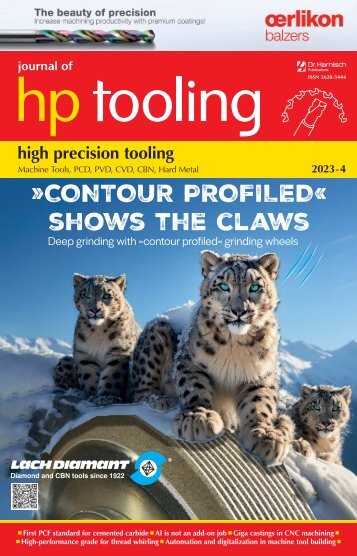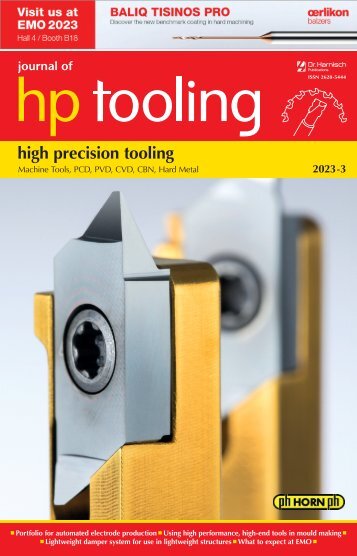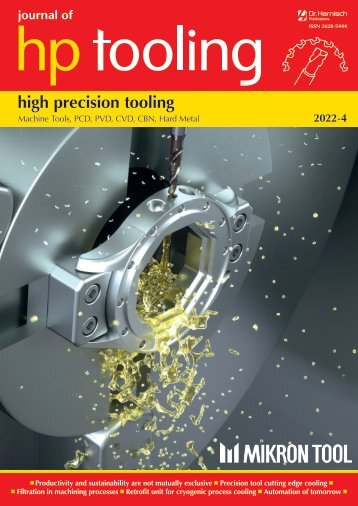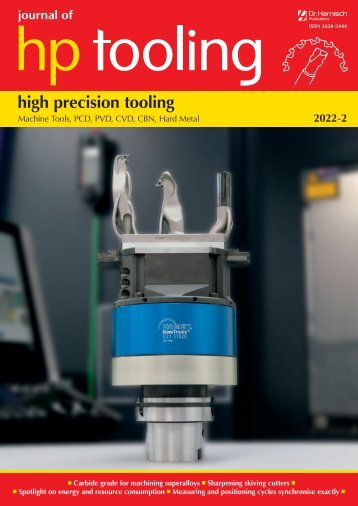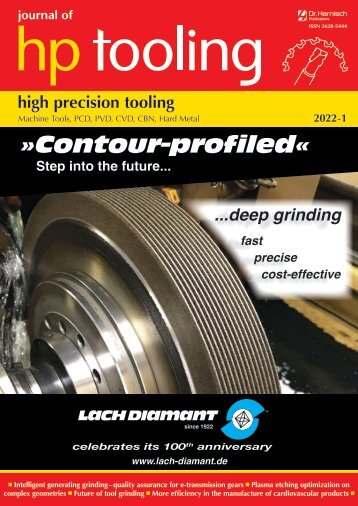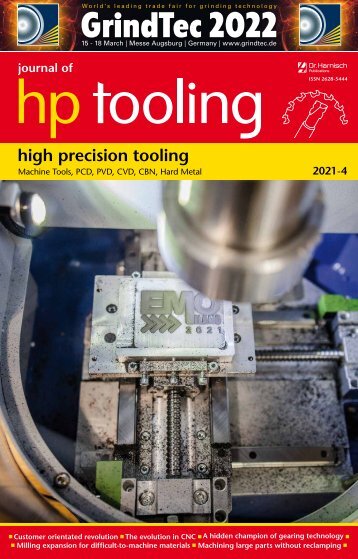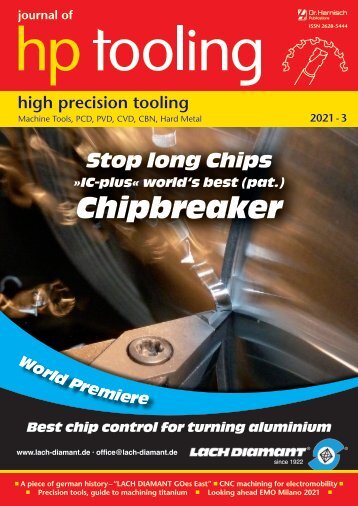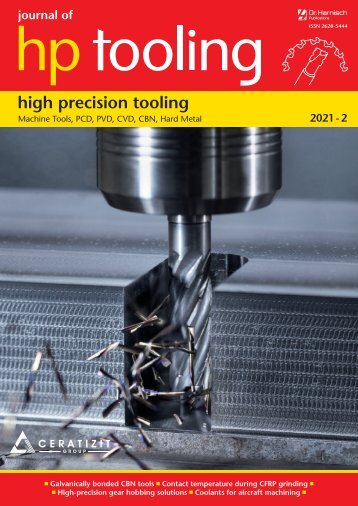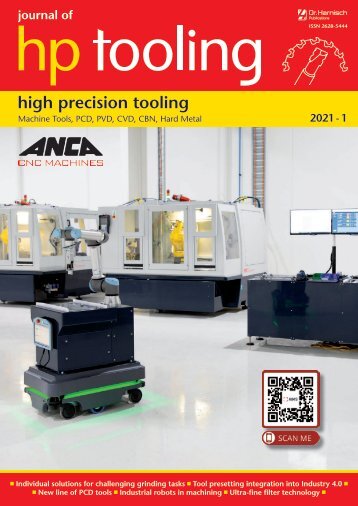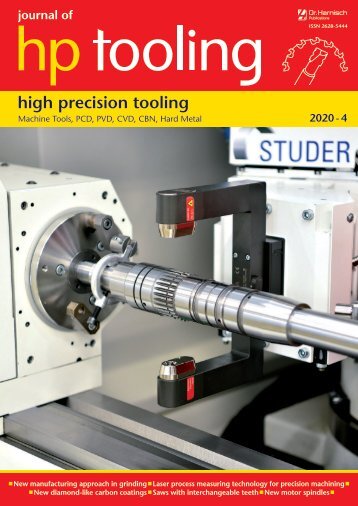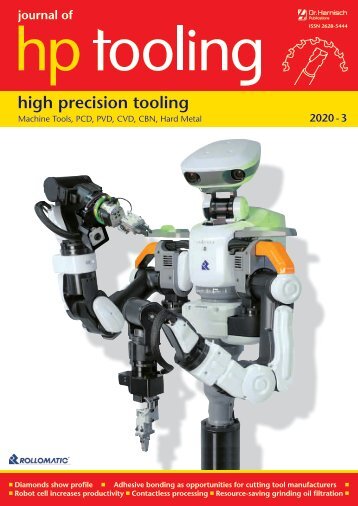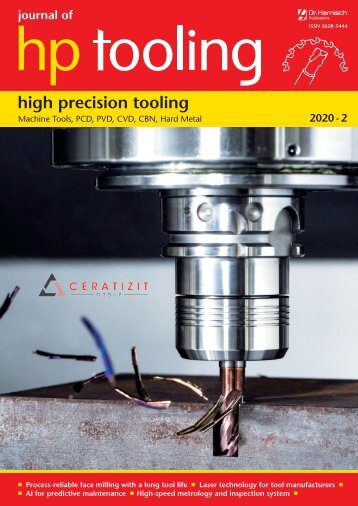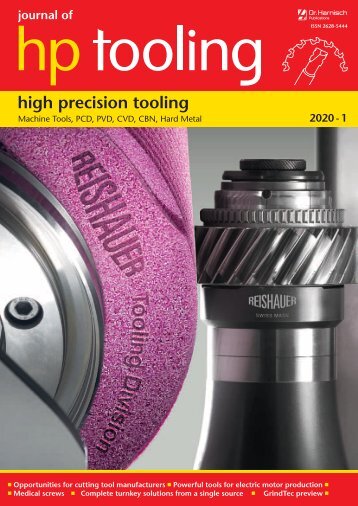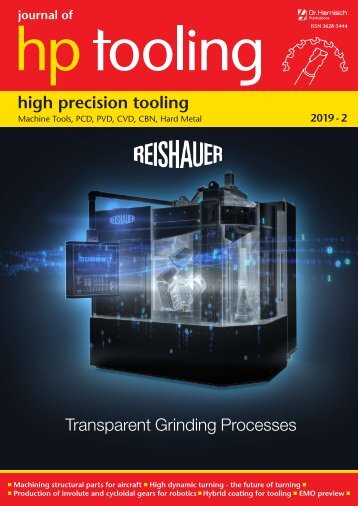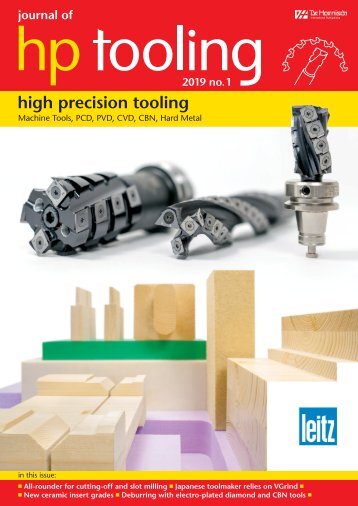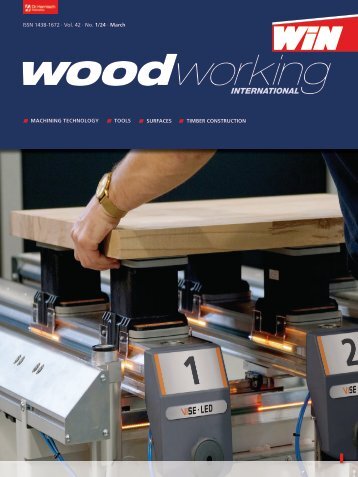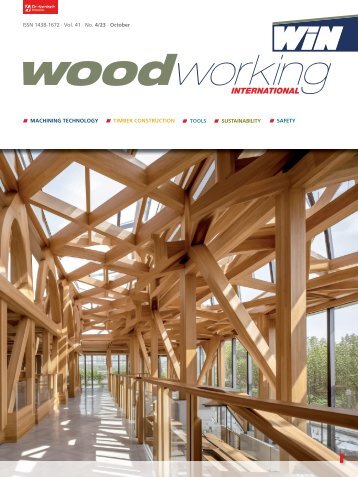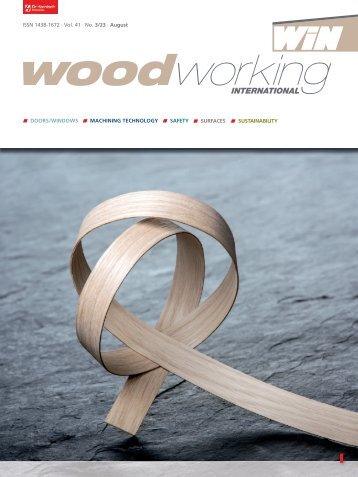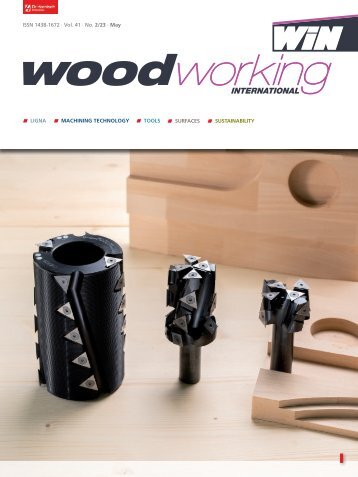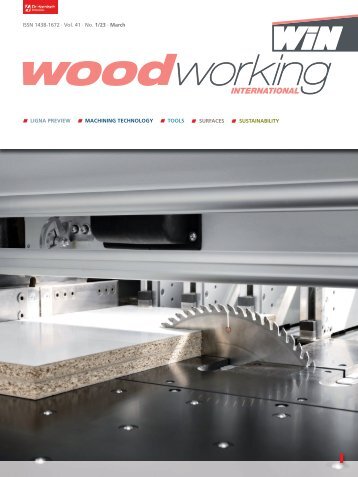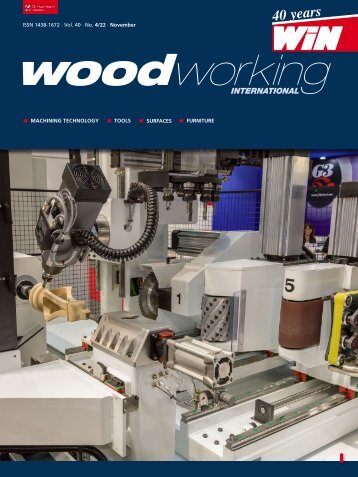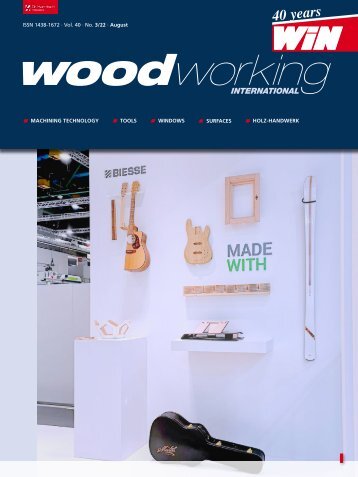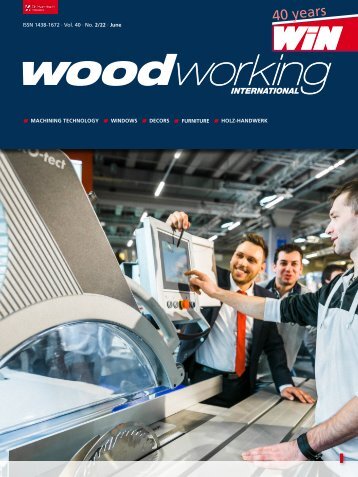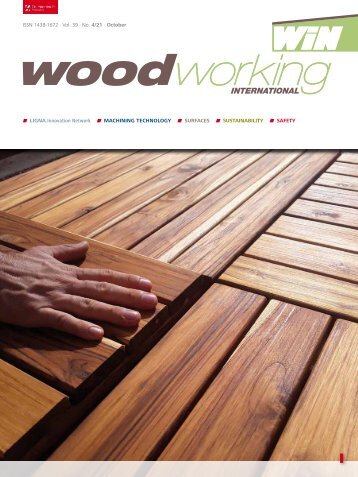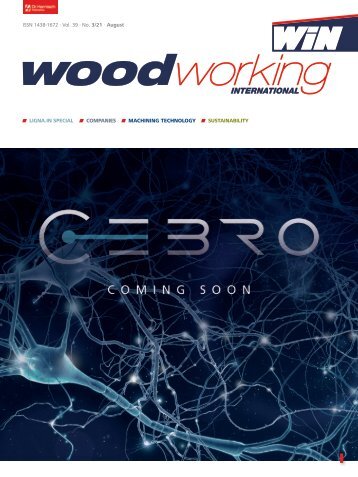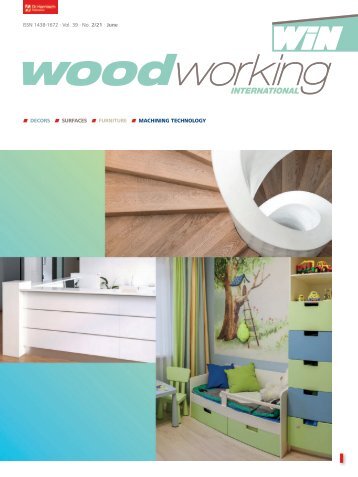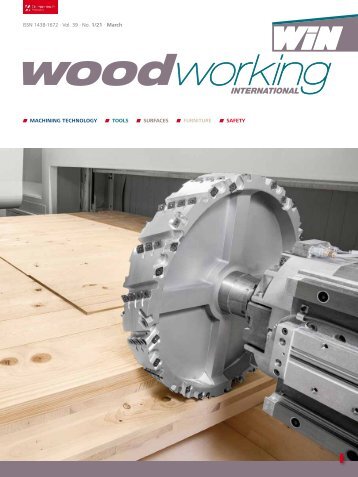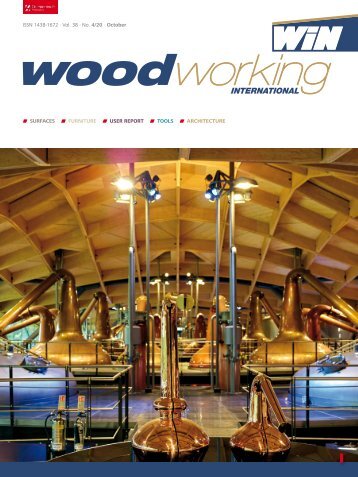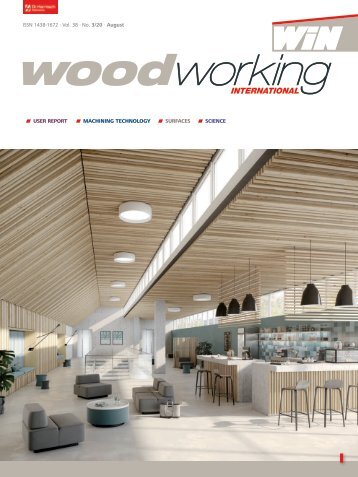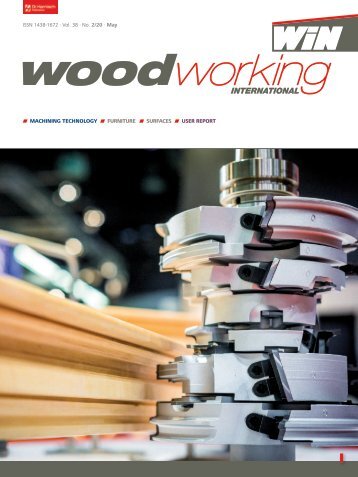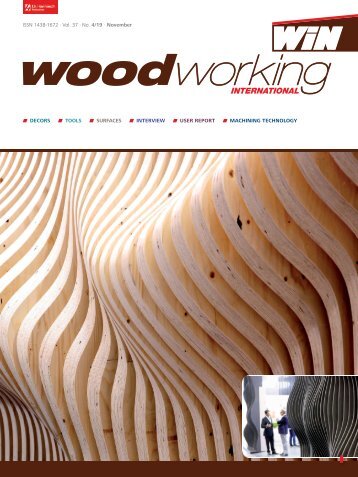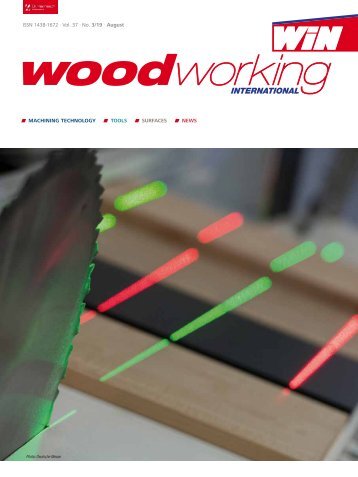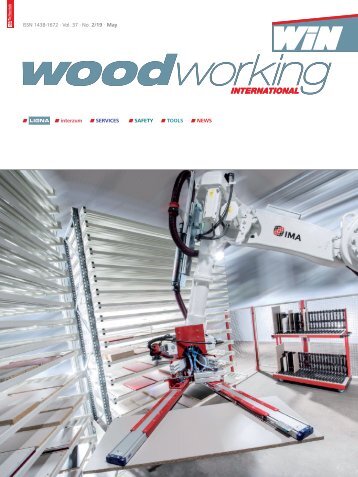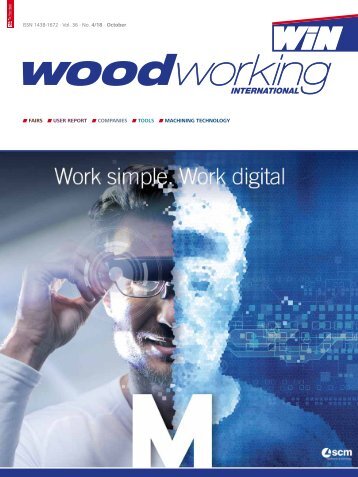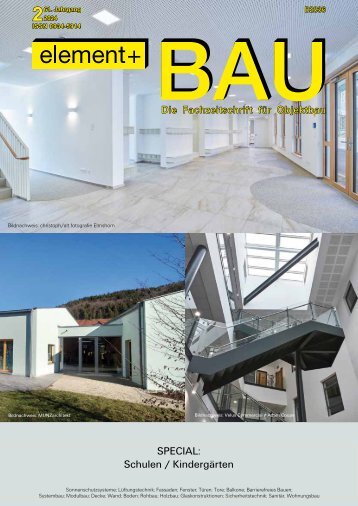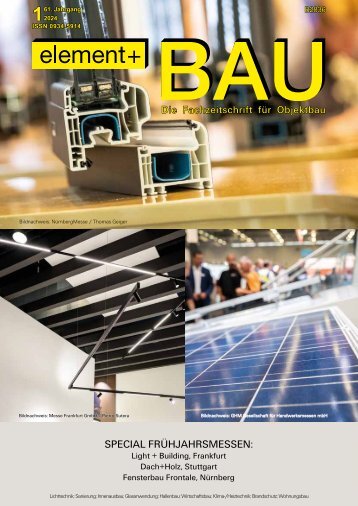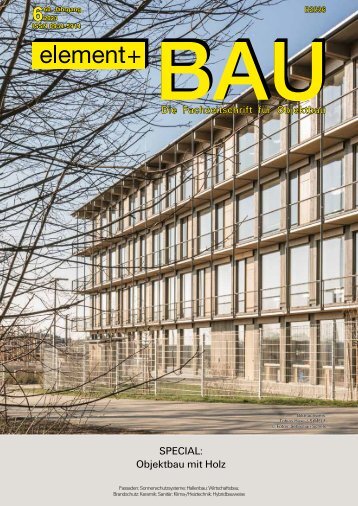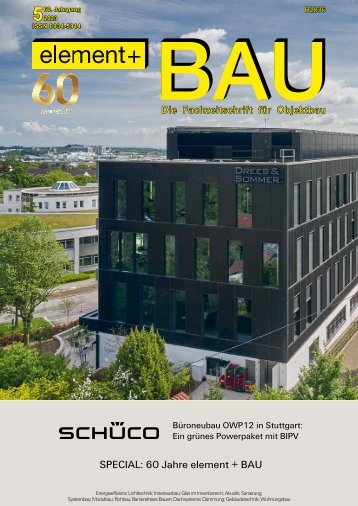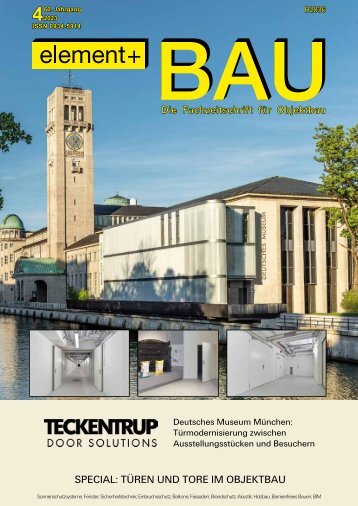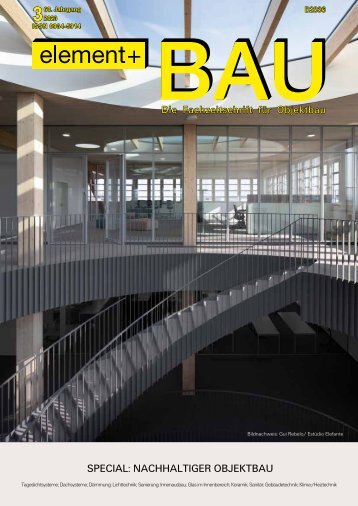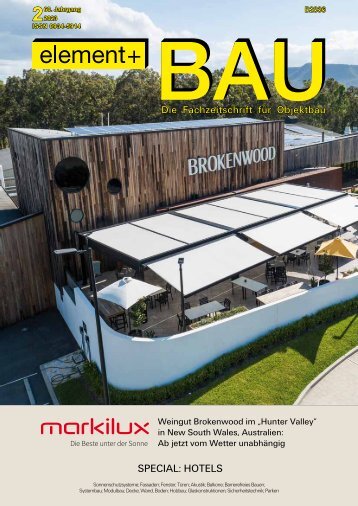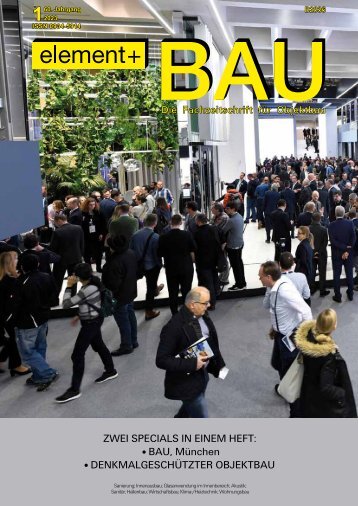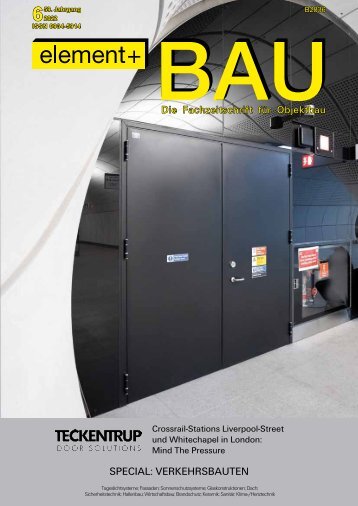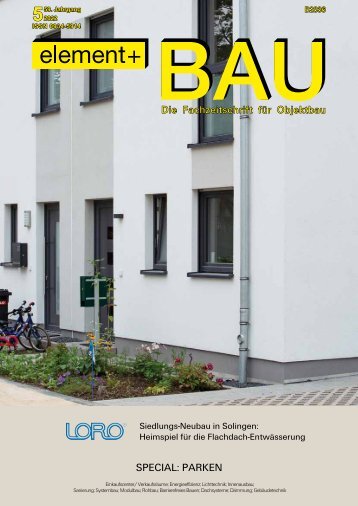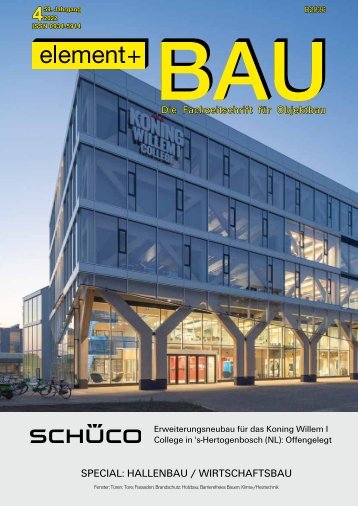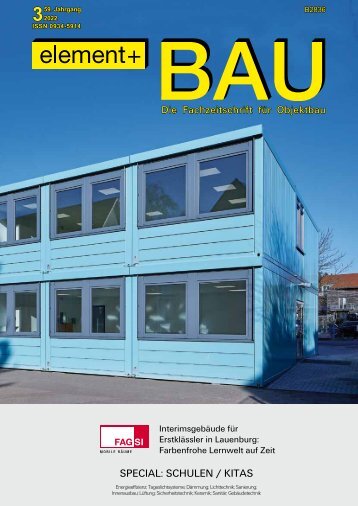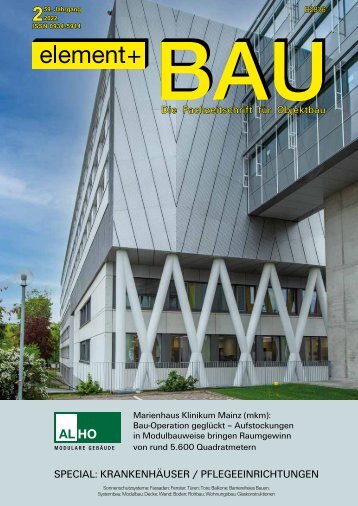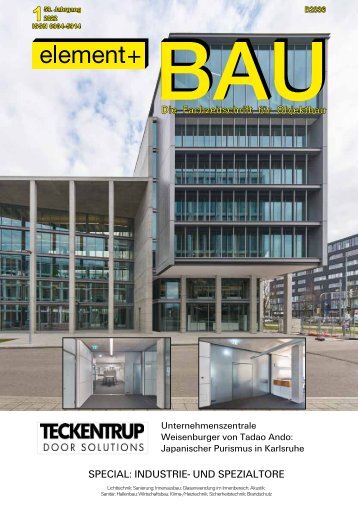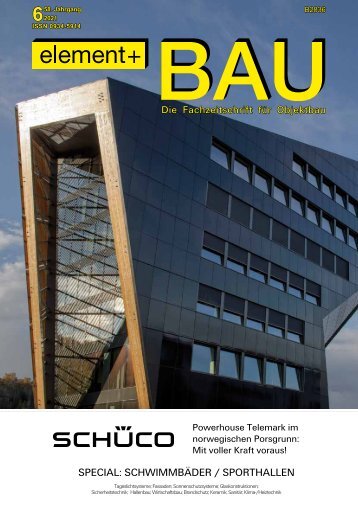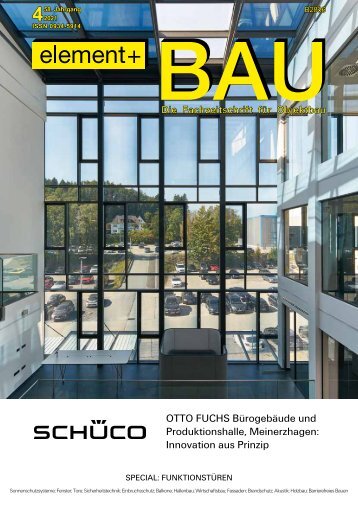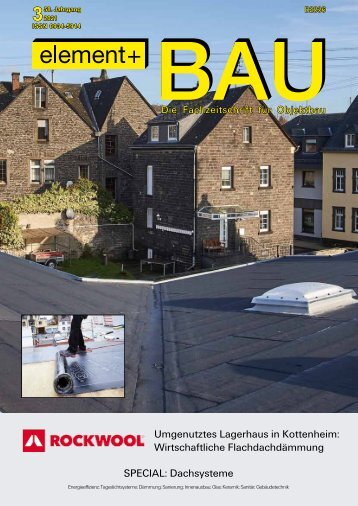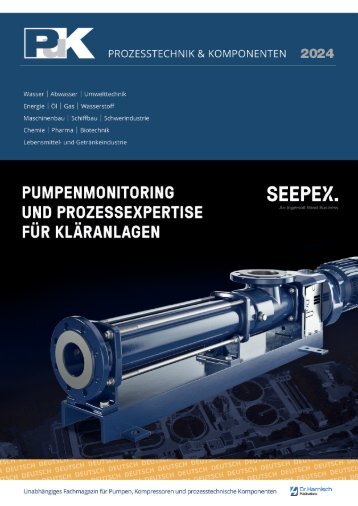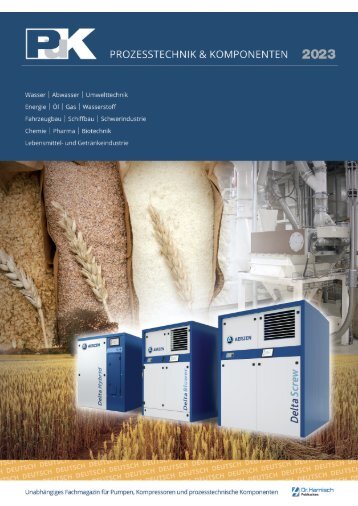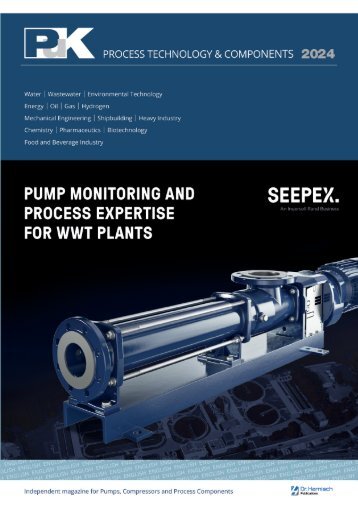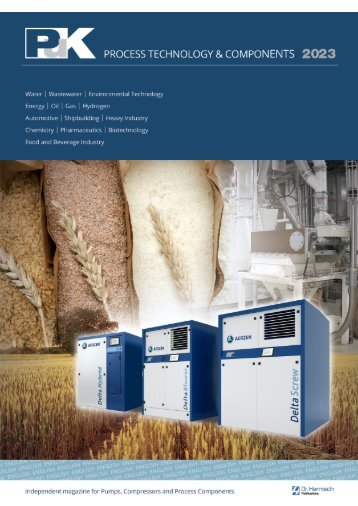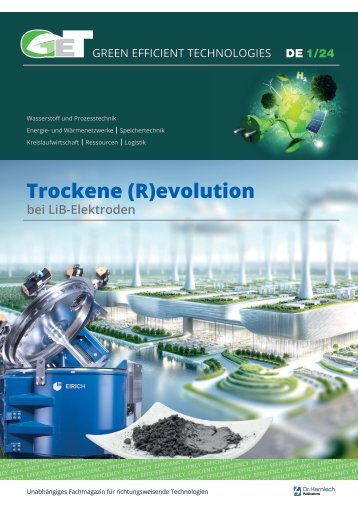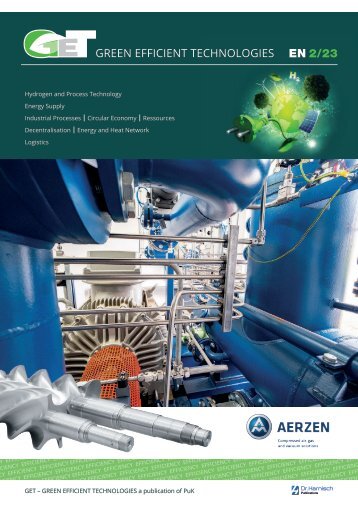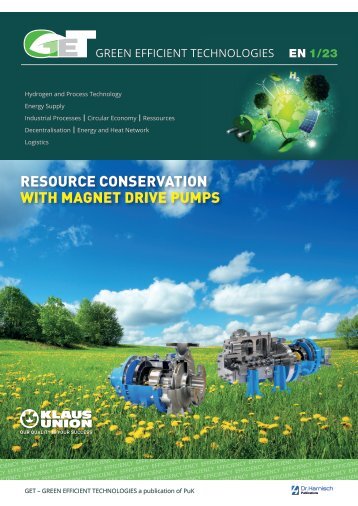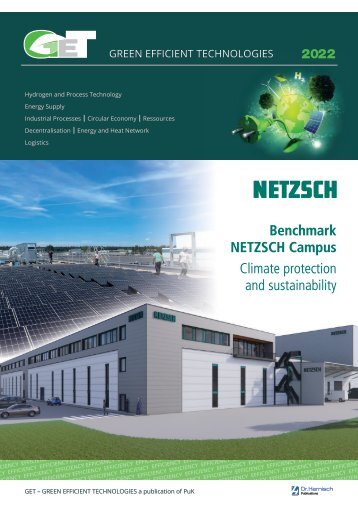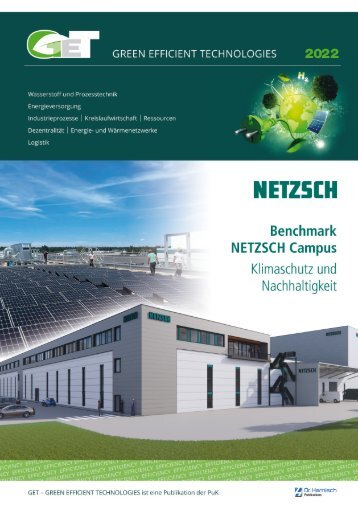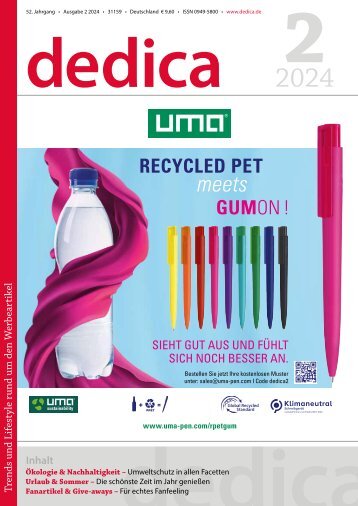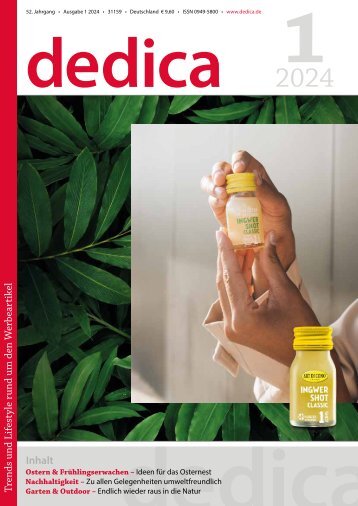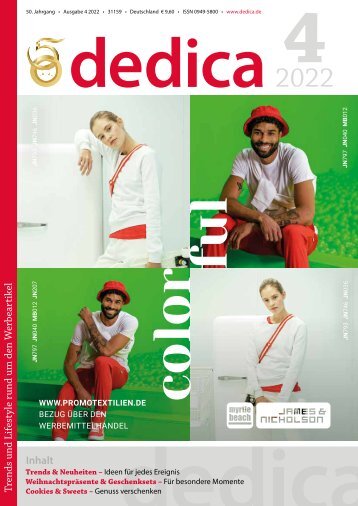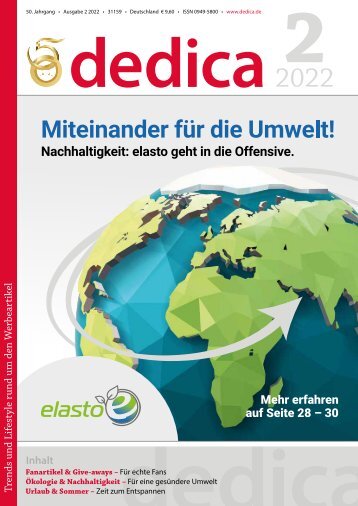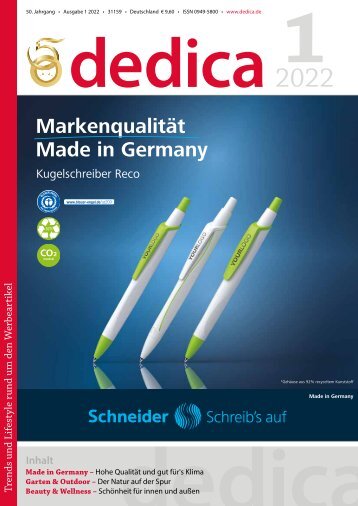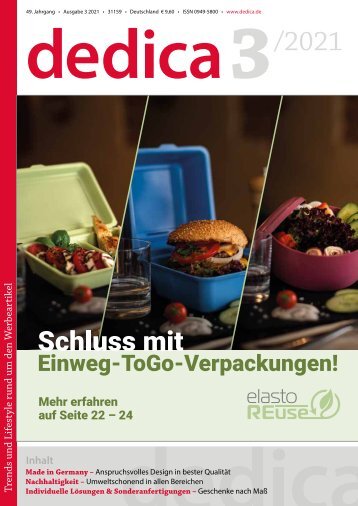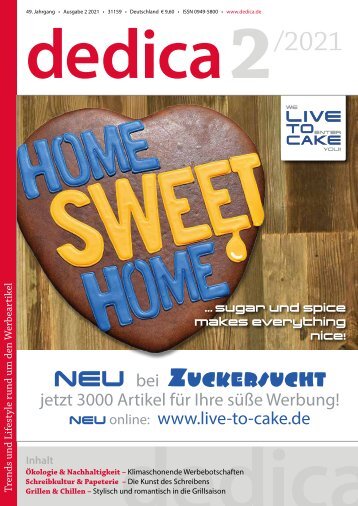Hygiene Report 5/2021
- Text
- Hygiene
- Produkte
- Unternehmen
- November
- Anforderungen
- Bakterien
- Lebensmitteln
- Wasser
- Viren
- Berufskleidung
- Harnischcom
Aktuelles 5·21 News
Aktuelles 5·21 News kompakt Antibiotikaalternative durch genetisch veränderte Bodenbakterien Einem Forschungsteam der Universität Ulm ist es gelungen, mit Hilfe gentechnisch veränderter Bodenbakterien (Corynebacterium glutamicum) antimikrobielle Wirkstoffe in Reinform herzustellen. Die so hergestellten Bacteriocine könnten als Antibiotika-Alternative zur Bekämpfung bakterieller Krankheitserreger eingesetzt werden. Und auch bei der Konservierung von Lebensmitteln könnten diese antibakteriellen Peptide wertvolle Dienste leisten. Bisher werden Bacteriocine ausschließlich mit natürlichen Bakterien in aufwändigen Fermentationsprozessen hergestellt. So entstehen bestenfalls halbgereinigte Präparate oder Rohfermente. Nun ist dem Ulmer Team gelungen, das Bakterium Corynebacterium glutamicum gentechnisch so zu verändern, dass es ein hochwirksames antimikrobielles Peptid (Pediocin PA-1) in Reinform herstellt, welches besonders gut gegen Listeria monocytogenes wirkt. Außerdem gelang es dem Forschungsteam, die synthetische Bacteriocin-Produktion vom Labormaßstab auf einen großtechnischen Pilotmaßstab für die Industrieproduktion zu skalieren. www.uni-ulm.de Lebensmittelkontaktmaterial aus Papier setzt Chlorpropanole frei Im Rahmen des Bundesweiten Überwachungsplans (BÜp) 2020 wurde eine Vielzahl von Lebensmittelkontaktmaterialien aus Papier auf die Freisetzung der Chlorpropanole 1,3-DCP und 3-MCPD untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass diese Thematik verstärkt in der amtlichen Kontrolle berücksichtig werden sollte. Im Fokus der Untersuchungen standen Lebensmittelkontaktmaterialien aus Papier, die in Kontakt mit feuchten Lebensmitteln kommen. Hierzu gehörten Backförmchen, Kaffee- sowie Teefilter, Servietten, Küchenrollen und Trinkhalme. Die Chlorpropanole 3-MCPD und 1,3- DCP können aus Epichlohydrin entstehen, das als Ausgangsstoff für Nassverfestigungsmittel genutzt wird. Insgesamt untersuchten die Behörden 256 Proben auf die Freisetzung der Chlorpropanole 3-MCPD und 1,3-DCP. Die Ergebnisse zeigen, dass 38 (14,8 %) bzw. 17 (6,6 %) der 256 untersuchten Proben nicht den Anforderungen der BfR-Empfehlung an die Freisetzung von 3-MCPD bzw. 1,3-DCP entsprachen. Besonders häufig wurden bei Trinkhalmen die BfR-Empfehlungen nicht eingehalten. www.bvl.bund.de Neuartiges Verfahren zum Nachweis hormonell aktiver Stoffe Forschende der Universitäten Dresden und Leipzig haben ein neues Verfahren zum Nachweis von hormonell aktiven Stoffen zum Patent angemeldet. Das Verfahren weist hormonell aktive Verbindungen mittels immobilisierter Sulfotransferasen und Mi kropartikel nach und beinhaltet einen Kit für den Nachweis der Verbindungen in Lebensmitteln, Kosmetika, Gewässerproben und vielem mehr. Dazu wurde das Enzym des Östrogen-Stoffwechsels in einen Biosensor implementiert, der als „Einfangsonde“ für östrogenartige Verbindungen dient. In Abhängigkeit der Konzentration an östrogenartigen Verbindungen in der Nachweislösung wird die Anbindung von Mikropartikeln an einen Biochip verhindert und so auch geringe Konzentrationen hormonell aktiver Stoffe schnell nachgewiesen. Der Ansatz ermöglicht auch die Verwendung anderer hormonmetabolisierender oder hormonbindender Proteine in einem Multiplex-Assay. Dies könnte neue Wege eröffnen, um die gesamte Komplexität der Bewertung der hormonell wirkenden Substanzen ohne Tierversuche abzudecken. www.tu-dresden.de E-VITA – mit beschleunigten Elektronen zu gesundem Saatgut Die Fraunhofer-Ausgründung E-VITA GmbH widmet sich der chemiefreien, nachhaltigen Behandlung von Saatgut und Futtermitteln, um es von Pilzen, Bakterien und Viren zu befreien. Das rein physikalische Verfahren zur Desinfektion von Saatgut basiert auf der keimabtötenden Wirkung von beschleunigten Elektronen. Erste Entwicklungen zur Behandlung von Saatgut mit Elektronen starteten in den 1980er Jahren und wurden vom Fraunhofer FEP mit unabhängigen Instituten und Unternehmen zur industriellen Reife geführt. Um das Verfahren auch für kleinere Mengen attraktiv zu gestalten, war die Entwicklung ganz neuer Anlagentechnik mit zum Teil neuartigen physikalischen Konzepten notwendig. Herzstück dieser Anlagen ist eine vom Fraunhofer FEP entwickelte Elektronenringquelle. E-VITA bietet interessierten Anwendern Anlagentechnik zur Miete und zum Kauf an. Geringe Jahresmengen können direkt vor Ort vom Kunden oder per Lohnauftrag auch durch E-VITA bearbeitet werden. www.fep.fraunhofer.de Fälschungssichere Kennzeichnung belegt Echtheit von Produkten Fälschungssicherer Produktschutz und resiliente Lieferketten sind Ziele des Fraunhofer-Projekts SmartID. Die Fraunhofer-Institute entwickeln dabei ein neuartiges Kennzeichnungssystem, mit dem die Echtheit von Produkten per Smartphone und offline, also ohne Zugriff auf eine Datenbank, erkannt werden kann. SmartID soll in bestehende Track & Trace-Infrastrukturen eingebettet und mit kommerziell verfügbaren Druckprozessen auf die Produkte bzw. deren Verpackungen gedruckt werden. In SmartID wird jedes Produkt eine einzigartige und fälschungssichere Kennzeichnung erhalten. Das Fraunhofer IAP entwickelt für das Kennzeichnen neuartige Materialien, welche per Smartphone detektierbar sind. Die Fraunhofer-Institute SIT und FOKUS entwickeln eine spezielle Software zum Auslesen und Verschlüsseln dieser Kennzeichnung sowie eine App für Smartphones. SmartID ist so ausgerichtet, dass sowohl QR-Codes als auch sogenannte Data Matrix-Codes und alle weiteren ISO-normierte Barcodes verwendet werden können. www.iap.fraunhofer.de 24 www.hygiene-report-magazin.de
november Aktuelles BVL: Wildpilze noch immer strahlenbelastet Eine Auswertung durch das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) zeigt, dass in den Jahren 2015 bis 2021 70 von 74 überprüften Wildpilzproben radioaktiv belastet sind. V.a. in Süddeutschland treten immer noch erhöhte Konzentrationen von Radiocäsium (Cäsium-137) als Folge der Atomreaktorkatastrophe von Tschernobyl 1986 auf. Im Vergleich zu landwirtschaftlichen Produkten sind wildwachsende Pilze noch höher kontaminiert – wegen des sehr wirksamen Nährstoffkreislaufs in Waldökosystemen. In Deutschland ist es nicht erlaubt, Lebensmittel wie Pilze mit einem Cäsium-137-Gehalt von mehr als 600 Bq/kg in den Verkehr zu bringen, für den Eigenverzehr gilt diese Beschränkung nicht. Diesen Grenzwert überschritt aber keine der untersuchten Pilzproben. www.bvl.bund.de Ethylen in Sesam, E401 in Gelee BVL-Bilanz 2020 zum Schnellwarnsystem RASFF Über das Europäische Schnellwarnsystem RASFF tauschen sich die EU-Staaten zu potenziell gesundheitsgefährdenden Lebens-, Futtermitteln und Lebensmittelkontaktmaterialien aus. Laut einer Auswertung des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) wurden 2020 über 3800 Original- und mehr als 11.000 Folgemeldungen geteilt. Der häufigste Warnungsgrund waren Rückstände von Ethylenoxid in Sesamsamen aus Indien. Indien war das meist genannte Herkunftsland, „Nüsse, Nussprodukte, Samen“ die häufigst gemeldete Produktkategorie, Pflanzenschutzmittelrückstände die häufigst genannte Gefahr. Seit Jahren werden Gelee-Süßwaren, sogenannte Jelly Cups, die meist in Asien hergestellt werden, in bunt bedruckten, kindgerechten Verpackungen auch in Europa zum Verkauf angeboten. Diese enthalten häufig Zusatzstoffe wie Natriumalginat (E401), Carrageen (E410), Johannisbrotkernmehl (E410) oder Konjak (E425). In der EU sind diese Stoffe für Gelee-Süßwaren in Minibechern verboten, da Konsistenz und Darreichungsform Erstickungsrisiken bergen. 2020 wurden zwölf Schnellwarnmeldungen erstellt und Rückrufe eingeleitet. Im RASFF landen 2020 auch acht Meldungen zu Salmonellen in Hundekauartikeln. Besonders brisant dabei: Die Gefahr für die Tiere, durch Kauartikel an einer tödlichen Salmonellose zu erkranken, ist relativ gering – für den Hundebesitzer aber birgt der enge Kontakt beim Verfüttern ein hohes Infektionsrisiko. www.bvl.bund.de Lebensmittelfarbe in Spraydosen: Vorsicht! Lebensmittelfarbe zum Sprühen ist üblich z.B. zum Dekorieren von Torten. Die Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe (BGN) warnt: Die Spraydosen stehen mächtig unter Druck – sie enthalten bis zu 10 l Flüssiggas. Und da bereits eine 2%-Mischung mit Luft brennbar ist, reiche dies bei ungünstigen Bedingungen für 500 Liter explosionsfähiges Gemisch. Die BGN rät deshalb, beim Verwenden der Spraydosen den Arbeitsplatz gut zu belüften, Beschäftigte zu unterweisen, Gebrauchsanweisungen zu beachten, eine Gefährdungsbeurteilung zu erstellen und sie nicht in engen Räumen, Nischen, Behältern und Waschbecken, in der Nähe offener Flammen oder glühender Oberflächen und in Richtung von Bodenabläufen und Schächten zu verwenden. www.bgn.de BfR: Mehrheit meidet Zusatzstoffe Entkeimungsvorrichtungen prüfen Farb- und Konservierungsstoffe, Emulgatoren, Süßungsmittel – in Zutatenlisten von Süßwaren, Getränken und anderen verarbeiteten Lebensmitteln sind häufig Zusatzstoffe enthalten. Eine repräsentative Befragung des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) zeigt: 55 Prozent der Bevölkerung versuchen, Zusatzstoffe beim Kauf von Lebensmitteln zu vermeiden. V.a. mögliche Unverträglichkeiten sowie die Förderung von Krebs und Übergewicht sind Risiken, die von den Befragten mit Zusatzstoffen verbunden werden. Die Ergebnisse zeigen weiterhin, dass die Bevölkerung ihr Wissen über Lebensmittelzusatzstoffe als gering einschätzt. Selbst häufig eingesetzte Stoffe sind vielen unbekannt. Jeweils über 40 Prozent der Befragten geben an, den Geschmacksverstärker Mononatriumglutamat und das Süßungsmittel Aspartam nicht zu kennen. Nicht allen ist auch die Funktion einzelner Stoffe bekannt: Zwar weiß die Mehrheit, dass Carotin als Farbstoff verwendet wird, bei Milchsäure weiß aber nur etwa ein Viertel, dass diese v.a. als Konservierungsstoff genutzt wird. Der Begriff Lebensmittelzusatzstoff wird in der Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 definiert. www.bfr.bund.de VDMA-Hygiene-Merkblatt für Abfüllmaschinen Das IVLV/VDMA-Merkblatt „Hygienische Abfüllmaschinen der Klasse V nach VDMA: Prüfung von Packmittelentkeimungsvorrichtungen auf deren Wirkungsgrad“ wurde überarbeitet. Es spezi fi ziert Testkeime für die Überprüfung von Entkeimungsvorrichtungen dieser Maschinenklasse und legt die Vorgehensweise bei Durchführung von Keimreduktionsbzw. End-Punkt-Tests fest. Dieses Merkblatt wurde 2002 unter dem Titel „Prüfung von Aseptikanlagen mit Packmittelentkeimungsvorrichtungen auf deren Wirkungsgrad“ im VDMA-Arbeitskreis „Schnittstellenproblematik bei Aseptikanlagen“ in Abstimmung mit der Industrievereinigung für Lebensmitteltechnologie und Verpackung erarbeitet. Die Fachverbandsschrift ist in deutscher und englischer Ausgabe verfügbar und kann auf der VDMA-Website heruntergeladen werden unter: www.vdma.org/viewer/-/v2article/render/31699074 Hier gibt es auch eine Übersicht aller Veröffentlichungen zur keimarmen/aseptischen Abfüllung mit Downloadlinks. 25
- Seite 1 und 2: ISSN 1618-2456 Internationale Fachz
- Seite 3 und 4: 5·21 Report Inhalt Editorial 4 9 1
- Seite 5 und 6: november schwerpunkt Das Tank-Über
- Seite 7 und 8: november schwerpunkt Kompromisslose
- Seite 9 und 10: november schwerpunkt Hygiene ist in
- Seite 11 und 12: ASR A1.5/1.2 R9 - R13 „Ein kleine
- Seite 13 und 14: november wissenschaft Mit „moleku
- Seite 15 und 16: november wissenschaft säure und Ri
- Seite 17 und 18: november wissenschaft Abb. 4: 3D-Da
- Seite 19 und 20: november hygienic design Schweißn
- Seite 21 und 22: november interview Hygiene, verknü
- Seite 23: november Aktuelles Desinfektionsmit
- Seite 27 und 28: november berufskleidung Vorgeschrie
- Seite 29 und 30: november qualitätsmanagement Effiz
- Seite 31 und 32: november schnellmethoden Fachkraft,
- Seite 33 und 34: november praxis Geschmackvoller Hyg
- Seite 35 und 36: november Fachforen/Messen Positiv g
- Seite 37 und 38: november produkte & Partner Steam H
- Seite 39 und 40: november produkte & Partner „Sich
- Seite 41 und 42: november veranstaltungen Mikrobiolo
Unangemessen
Laden...
Magazin per E-Mail verschicken
Laden...
Einbetten
Laden...