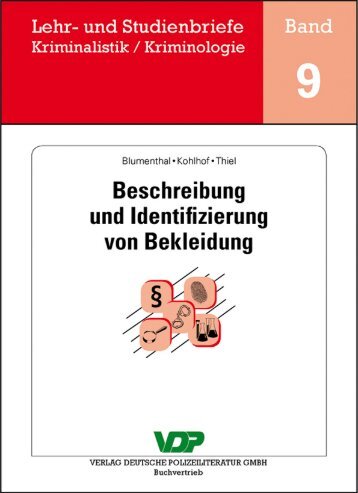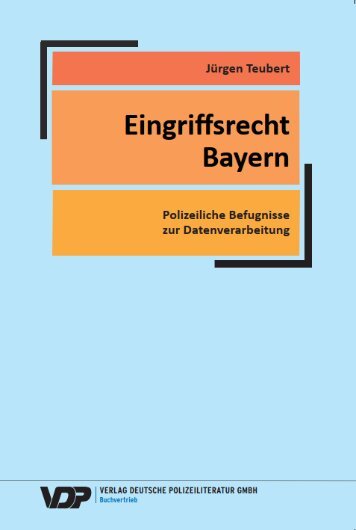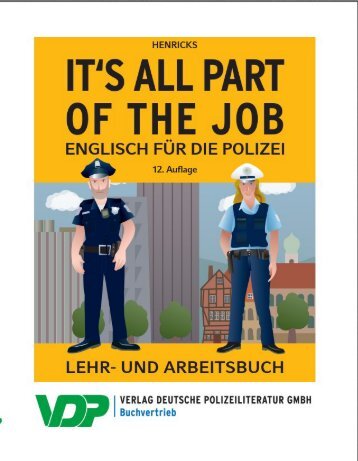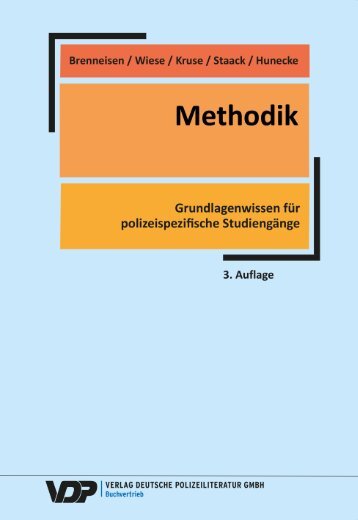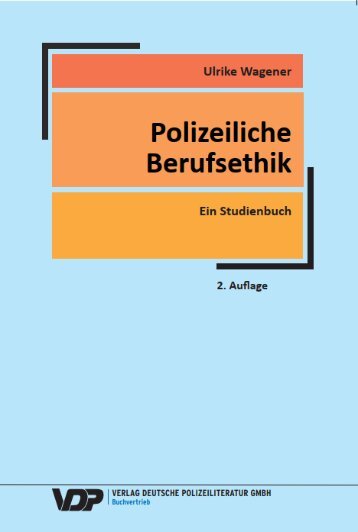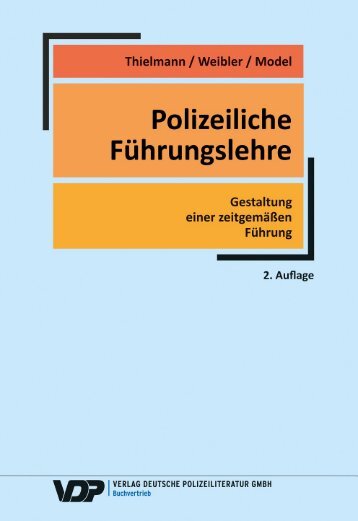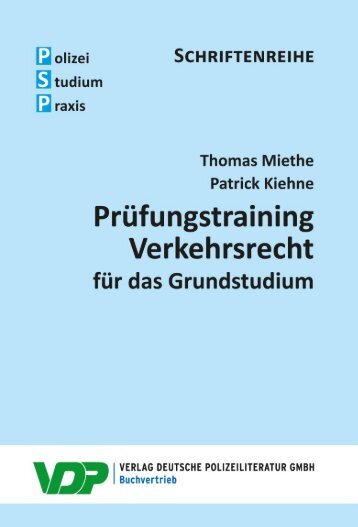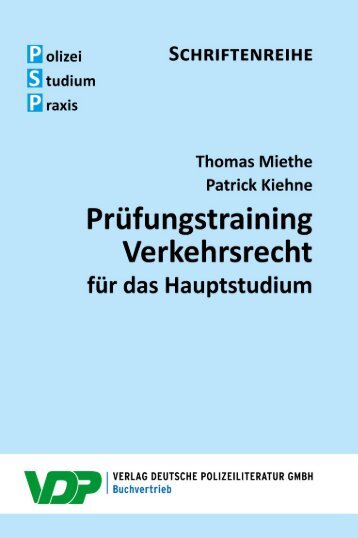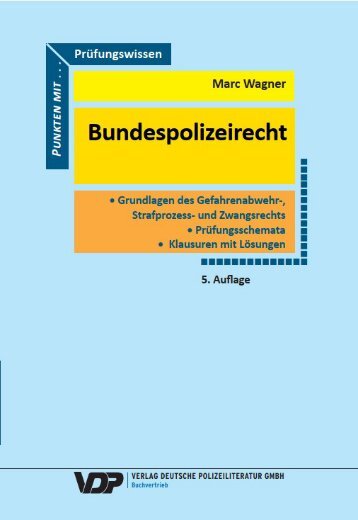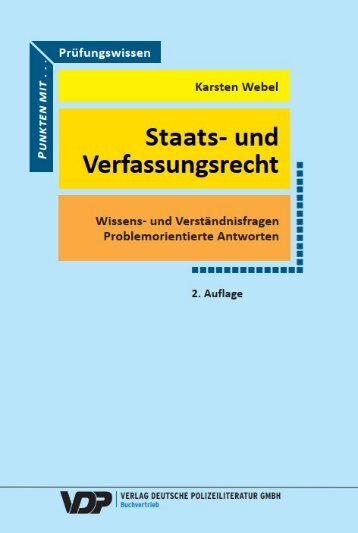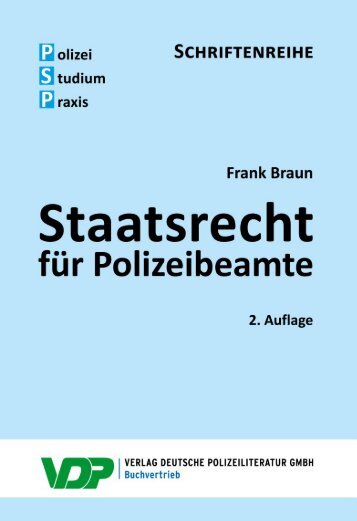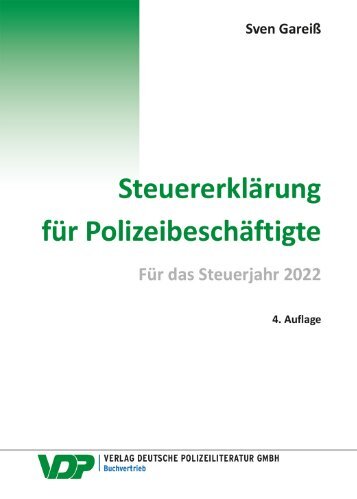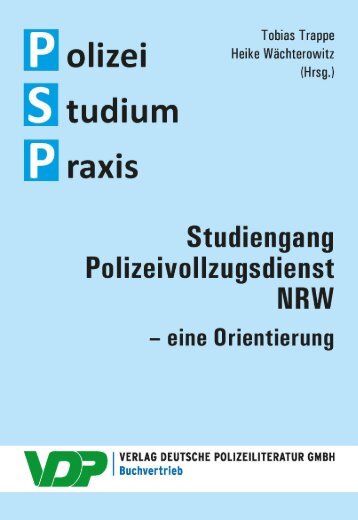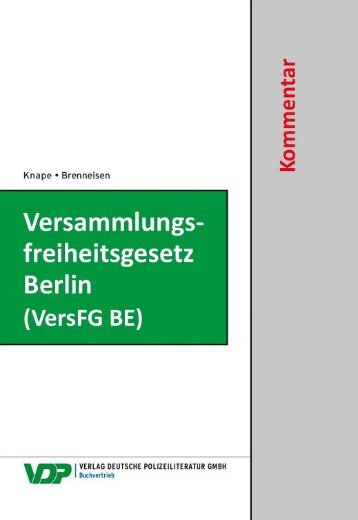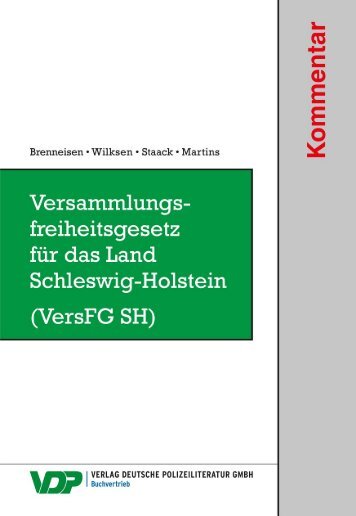VDP-BV Leseproben
Häusliche Gewalt - Leseprobe
- Text
- Gewalt
- Frauen
- Polizei
- Opfer
- Definition
- Initiativen
- Wohnungsverweisung
- Bmfsfj
- Strafverfolgung
- Handeln
Vereinte Nationen 1
Vereinte Nationen 1 Gesellschaftliche Wahrnehmung, gesellschaftspolitische Initiativen und staatliches Handeln 1.1 Allgemeines Die Bundesrepublik Deutschland ist ein aufgeklärtes, demokratisch verfasstes Gemeinwesen. Die unveräußerlichen Menschenrechte sind als Grundlage des gesellschaftlichen Zusammenlebens unmittelbar geltendes Recht. 1) Es gelten die Freiheitsrechte, daneben das Recht auf Gleichheit vor dem Gesetz und die Gleichberechtigung von Mann und Frau. 2) Doch es gibt auch Ungleichheiten. Beziehungsgewalt und häusliche Gewalt ist – nicht nur in Europa oder weltweit – überwiegend Gewalt gegen Frauen. Sie ist es auch in Deutschland. In der Präambel des im Mai 2011 verabschiedeten „Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt“ 3) (die sog. Istanbul-Konvention) wird dazu ausgeführt, dass „Gewalt gegen Frauen der Ausdruck historisch gewachsener ungleicher Machtverhältnisse zwischen Frauen und Männern ist, die zur Beherrschung und Diskriminierung der Frau durch den Mann und zur Verhinderung der vollständigen Gleichstellung der Frau geführt haben.“ Geschlechtsspezifische Gewalt hat danach strukturellen Charakter. Nicht in allen Ländern sind die ökonomischen und kulturellen Lebensbedingungen, die tradierten gesellschaftlichen Normen und Werte und die daraus resultierenden Benachteiligungen für Frauen gleich. So gibt es neben häuslicher Gewalt, sexueller Belästigung und Vergewaltigung in manchen Ländern und Gesellschaften auch Zwangsverheiratung, im Namen der „Ehre“ begangene Gewalttaten oder Genitalverstümmelung. Aber in fast allen Ländern der Welt kommt der Ächtung und Unterbindung all dieser Formen von Gewalt besondere Bedeutung zu. 1.2 Internationale Entwicklung 1.2.1 Vereinte Nationen Leseprobe Erst in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts rückte die vielfach von gesellschaftlicher Benachteiligung, Unterdrückung und Diskriminierung gekennzeichnete Lebenssituation von Frauen in der Welt, deren durchgängig fehlende rechtliche Gleichstellung sowie die Ausübung von physischer, psychischer und sexueller Gewalt gegen Frauen im familiären und gesellschaftlichen Kontext als eine zentrale gesellschaftliche Problematik in das Bewusstsein der Weltgemeinschaft. Für das Jahr 1975 rief die UNO-Generalversammlung das Internationale Jahr der Frau aus. Im gleichen Jahr richteten die Vereinten Nationen erstmals zum Internationalen Frauentag am 8. März eine Feier aus; in Mexiko-Stadt wurde die erste UN-Weltfrauenkonferenz abgehalten. 1) Art. 1 GG. 2) Art. 3 GG. 3) Europarat, 2011. 9
Gesellschaftliche Wahrnehmung, gesellschaftspolitische Initiativen und staatliches Handeln Seither ist Gewalt gegen Frauen in all ihren Formen als Verletzung der Menschenrechte geächtet sowie für staatliche und nichtstaatliche Organisationen zu einem wichtigen Thema von Intervention und Prävention sowie von sozialer Arbeit geworden. 1993 verabschiedete die Generalversammlung der UN als Grundlage für die Bekämpfung von Gewalttaten gegen Frauen eine Erklärung zur Beseitigung der Gewalt gegen Frauen und entwickelte in der Folge einen Aktionsplan (1995) mit dem strategischen Ziel der Gleichstellung von Mann und Frau. 2006 veröffentlichte der Generalsekretär der UN eine Untersuchung über Erscheinungsformen der Gewaltphänomene und die international geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen zum Phänomen. Andere über- bzw. zwischenstaatliche Organisationen griffen die Thematik auf. 4) 1.2.2 Europäische Union Auf europäischer Ebene und der Ebene der Nationalstaaten in Europa vollzogen sich jeweils im zeitlichen Kontext parallele Entwicklungen. So brachte der Europarat seit Beginn der 1990er-Jahre eine Reihe von Initiativen zur Förderung des Schutzes von Frauen vor Gewalt auf den Weg. Angestoßen durch die Ministerkonferenz zur Gleichstellung von Frauen und Männern im Jahr 1993, wurden Strategien und ein Aktionsplan für die Beseitigung der Gewalt gegen Frauen in der Gesellschaft erarbeitet. Dieser mündete 2002 in die Empfehlung des Ministerkomitees 5) , in der die Mitgliedstaaten erstmals aufgefordert wurden, in einem Gesamtkonzept den Schutz von Frauen vor Gewalt durch gesetzliche Maßnahmen zu gewährleisten, Maßnahmen unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der Opfer landesweit zu koordinieren sowie die Polizei und Justiz zur Verfolgung und Bestrafung von Gewalttätern anzuhalten. Im Anschluss an eine groß angelegte Kampagne zur Unterstützung der Umsetzung der Maßnahmen in den Mitgliedstaaten von 2006 bis 2008, die in verschiedenen Mitgliedstaaten durch wissenschaftliche Erhebungen zum Ausmaß der Gewalt gegen Frauen begleitet wurde, verabschiedete der Europarat im Mai 2011 das wegweisende „Übereinkommen zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt“ 6) . Darin wird häusliche Gewalt – ohne Beschränkung auf Gewalt an Frauen – explizit als eigenständiges Themenfeld ausgewiesen und geächtet. Leseprobe Mit der Ratifizierung des am 01.08.2014 in Kraft getretenen Übereinkommens verpflichten sich die Mitgliedstaaten verbindlich zu umfassenden Maßnahmen in allen darin geregelten Bereichen, z. B. zu Maßnahmen der Prävention, zu Unterstützungsangeboten und gesetzgeberischen Maßnahmen im Straf-, Zivil- und Ausländerrecht. 4) So beschloss 1994 die Organisation amerikanischer Staaten die „Interamerikanische Konvention über die Verhütung, Bestrafung und Beseitigung der Gewalt gegen Frauen“, die das Recht von Frauen betont, frei von häuslicher, gesellschaftlicher und staatlicher Gewalt zu sein, und den Staat verpflichtet, aktiv gegen die Gewalt vorzugehen und der Gewalt vorzubeugen. Die Afrikanische Union verabschiedete 2003 mit gleicher Intention zu dieser Thematik ein „Protokoll zur Afrikanischen Charta der Menschenrechte und der Rechte der Völker“ 5) Europarat, 2002. 6) Europarat, 2011. 10
- Seite 2 und 3: Lehr- und Studienbriefe Kriminalist
- Seite 4 und 5: Vorwort Vorwort Gewalt im sozialen
- Seite 6 und 7: Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichn
- Seite 8 und 9: Inhaltsverzeichnis 5.6.6.5 Überpr
- Seite 12 und 13: Staat und Gesellschaft Flankiert wi
- Seite 14 und 15: Polizei und Justiz Im Jahr 2004 wur
- Seite 16 und 17: Charakteristika der Gewaltbeziehung
- Seite 18 und 19: Begriffsbestimmungen der Länder od
Unangemessen
Laden...
Magazin per E-Mail verschicken
Laden...
Einbetten
Laden...