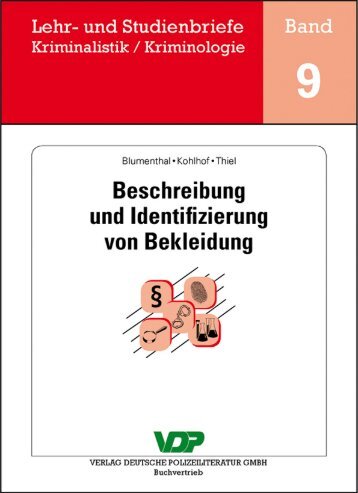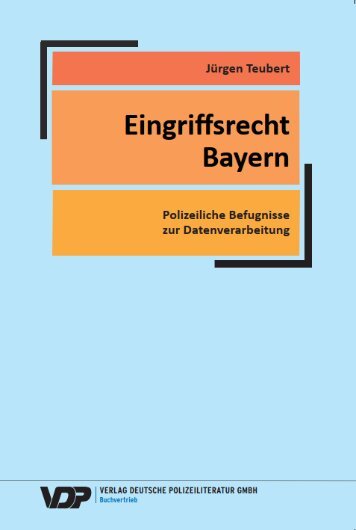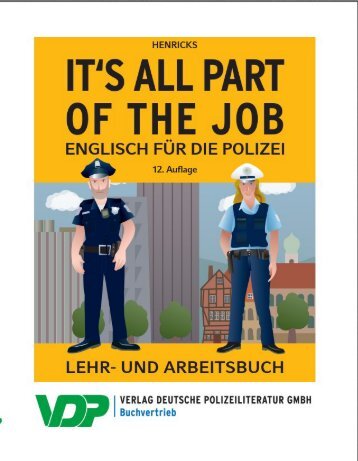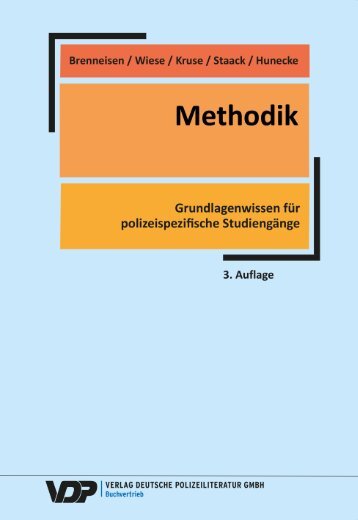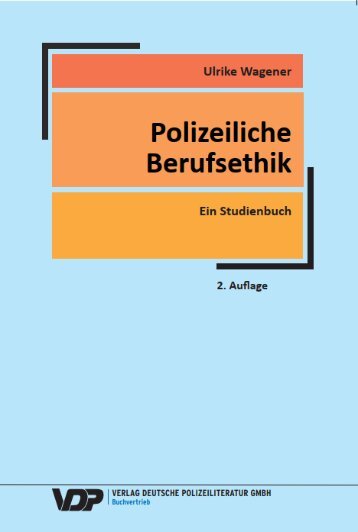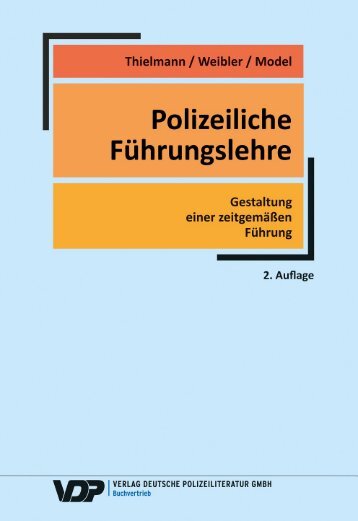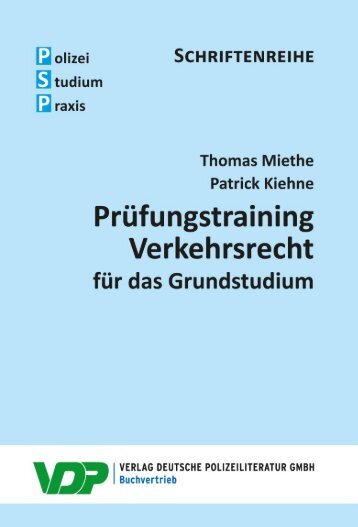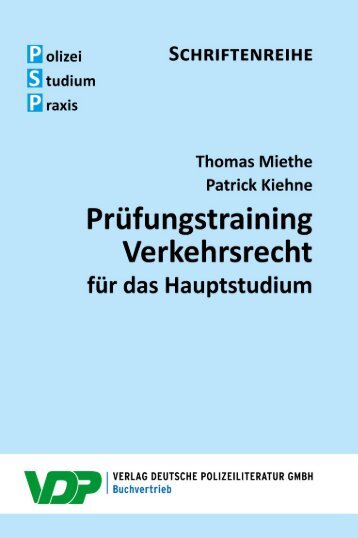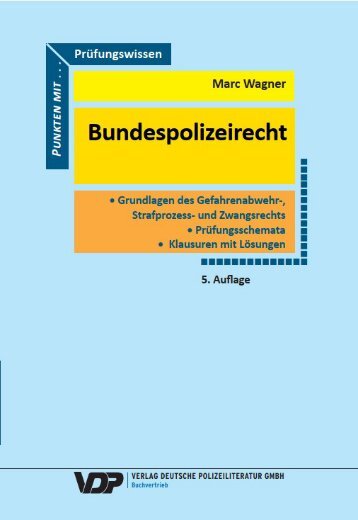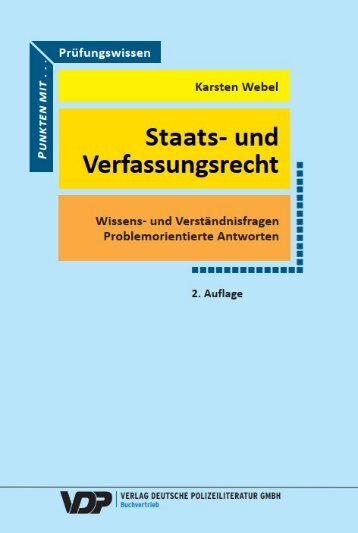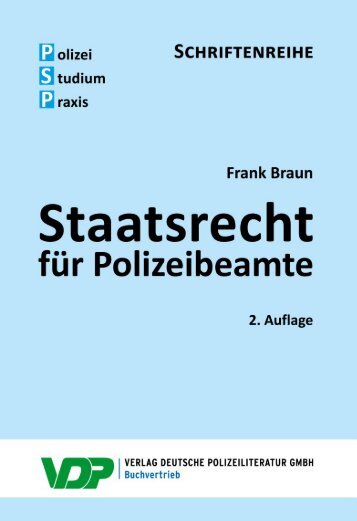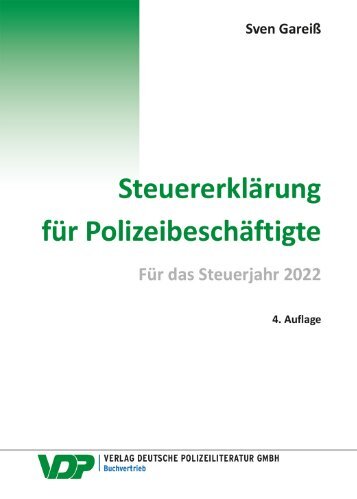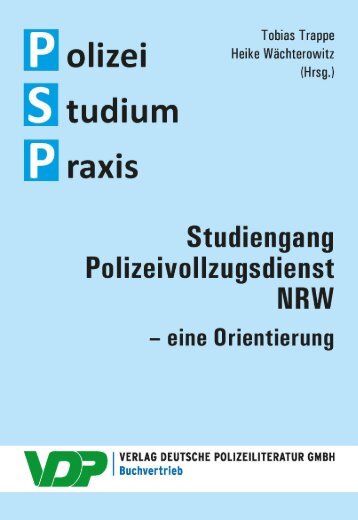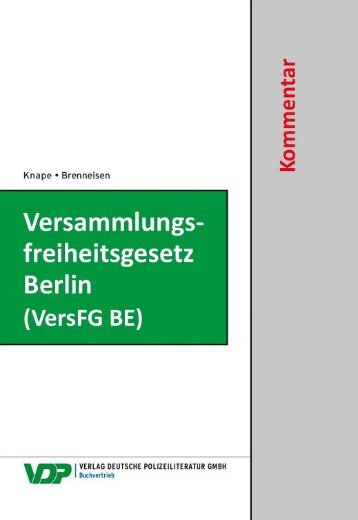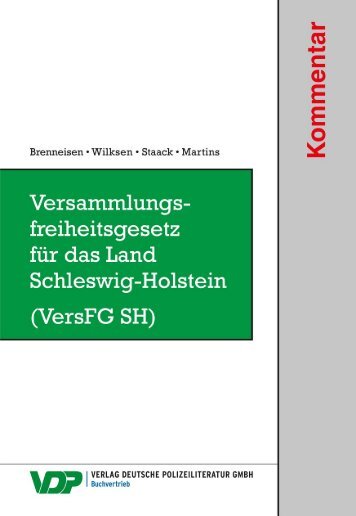VDP-BV Leseproben
Häusliche Gewalt - Leseprobe
- Text
- Gewalt
- Frauen
- Polizei
- Opfer
- Definition
- Initiativen
- Wohnungsverweisung
- Bmfsfj
- Strafverfolgung
- Handeln
Charakteristika der
Charakteristika der Gewaltbeziehung um durch konsequente polizeiliche Intervention weitere Gewalttaten zu verhindern. 37) Im Jahr 2015 griff sie das Thema mit weiteren Handlungsempfehlungen zum Management von Hochrisikofällen erneut auf 38) . 2 Charakteristika der Gewaltbeziehung Die Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Häusliche Gewalt“ beschreibt in ihrem Bericht 39) aus dem Jahr 2002 in dem Abschnitt „Männliche Gewalt an Frauen, Mädchen und Jungen in der Familie“ sehr präzise das, was nach der damaligen Wahrnehmung eine länger dauernde Gewaltbeziehung zwischen Mann und Frau und ihre Wirkungen ausmacht. „Frauen erfahren Gewalt häufig in engen sozialen Beziehungen durch den Ehemann oder den (Ex-)Partner. Sie geschieht meist zuhause und damit in einem Bereich, der eigentlich als privater Schutzraum empfunden wird. Von Seiten des gewalttätigen Mannes handelt es sich in aller Regel um ein komplexes, sich mit der Zeit verstärkendes System von Macht und Kontrolle, die mit physischer, sexualisierter und psychischer Gewalt, durch Zwang, Nötigung und Drohung, durch Demütigung und Isolation ausgeübt werden. Bei den betroffenen Frauen bewirken solche Gewalterfahrungen, zumal über einen längeren Zeitraum, eine Schwächung bis hin zur Zerstörung des Selbstwertgefühls. Dies verstärkt wiederum ihre Abhängigkeit vom Mann und die eigene Verstrickung in die Gewaltbeziehung. Aufgrund der besonderen Dynamik des Gewaltgeschehens verhalten sich Frauen in Misshandlungsbeziehungen häufig ambivalent hinsichtlich einer Trennung vom gewalttätigen Mann. Auch sprechen aus ihrer Sicht z.B. Faktoren wie die Verantwortung für gemeinsame Kinder, ökonomische Abhängigkeit und ein gesellschaftliches Umfeld, das Gewalt im häuslichen Bereich bagatellisiert oder der Frau selbst anlastet, gegen eine Trennung. Diese wird objektiv erschwert durch strukturelle Bedingungen wie z.B. in ihren jeweiligen Folgen für die Frauen nicht abschätzbare Bestimmungen des Sozialhilfe-, Ausländer- und Kindschaftsrechts, die zudem oftmals restriktiv ausgelegt werden. Nicht zuletzt ist die Gewaltbereitschaft von misshandelnden Männern in der akuten Trennungssituation am größten, so dass Frauen in dieser Zeit besonders gefährdet sind.“ Leseprobe Auch wenn sich einzelne Aspekte dieser Beschreibung aufgrund einer größer gewordenen Selbstständigkeit der Frauen und einer gewandelten gesellschaftlichen Sichtweise in der Tendenz verändert haben, sind die Charakteristika einer andauernden Gewaltsituation in einer Partnerschaft auch heute nicht grundsätzlich anders. Ein in Niedersachsen ressortübergreifend vorgelegter Rechtsratgeber für von häuslicher Gewalt betroffene Frauen „Ohne Gewalt leben – Sie haben ein Recht darauf!“ 40) umreißt in der Einleitung durch sehr konkrete Fragen das, was häusliche Gewalt ausmacht. 37) Innenministerkonferenz, 2005. 38) Innenministerkonferenz, 2015, TOP 8. 39) BMFSFJ, 2002. 40) Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung, 2014. 15
Definition häusliche Gewalt „Ihr Lebenspartner −− beleidigt Sie und macht Sie bei Freundinnen und Freunden oder Familienmitgliedern schlecht? −− hindert Sie, Ihre Familie oder Freundinnen und Freunde zu treffen? −− hält Sie davon ab, Ihr Haus zu verlassen? −− kontrolliert Ihre Finanzen? −− droht damit, Sie, Ihre Kinder, Verwandte, Freundinnen und Freunde, Ihre Haustiere oder sich selbst zu verletzen? −− wird plötzlich wütend und rastet aus? −− beschädigt Ihre Sachen? −− schlägt, stößt, schubst, beißt Sie? −− zwingt Sie zum Sex? −− akzeptiert nicht, dass Sie sich getrennt haben oder trennen wollen und verfolgt, belästigt oder terrorisiert Sie? Alles das sind Formen von Gewalt – und Sie müssen das nicht hinnehmen.“ Diese konkreten Formulierungen von denkbaren Verhaltensweisen schaffen für Opfer häuslicher Gewalt Klarheit, wo Gewalt in einer Beziehung beginnt und welche Verhaltensweisen sie umfasst. 3 Definition häuslicher Gewalt 3.1 Bundesebene Eine einheitliche und verbindliche Definition des Begriffs der häuslichen Gewalt gibt es im deutschen Recht nicht. Nach dem Wortlaut der Istanbul-Konvention bezeichnet der Begriff häusliche Gewalt − − „alle Handlungen körperlicher, sexueller, psychischer oder wirtschaftlicher Gewalt, die innerhalb der Familie oder des Haushalts oder zwischen früheren oder derzeitigen Eheleuten oder Partnerinnen beziehungsweise Partnern vorkommen, unabhängig davon, ob der Täter beziehungsweise die Täterin denselben Wohnsitz wie das Opfer hat oder hatte.“ 41) Damit ist der Begriff ausdrücklich nicht auf Gewalt von Männern an Frauen beschränkt. Das gilt auch für das deutsche Gewaltschutzgesetz, das die gerichtlichen Maßnahmen der Wohnungsverweisung sowie des Kontakt- oder Näherungsverbotes zum Schutz von Gewaltopfern ohne geschlechtsspezifische Beschränkungen an bestimmte tatsächliche Voraussetzungen knüpft. So hat das Gericht auf Antrag der verletzten Person zum Schutz vor Gewalt und Nachstellungen zur Abwendung weiterer Verletzungen erforderliche Maßnahmen zu treffen, −− wenn „eine Person vorsätzlich den Körper, die Gesundheit oder die Freiheit einer anderen Person widerrechtlich verletzt“ 42) hat 41) Europarat, 2011. 42) § 1 Abs. 1 Satz 1 Gewaltschutzgesetz vom 11. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3513). 16 Leseprobe
- Seite 2 und 3: Lehr- und Studienbriefe Kriminalist
- Seite 4 und 5: Vorwort Vorwort Gewalt im sozialen
- Seite 6 und 7: Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichn
- Seite 8 und 9: Inhaltsverzeichnis 5.6.6.5 Überpr
- Seite 10 und 11: Vereinte Nationen 1 Gesellschaftlic
- Seite 12 und 13: Staat und Gesellschaft Flankiert wi
- Seite 14 und 15: Polizei und Justiz Im Jahr 2004 wur
- Seite 18 und 19: Begriffsbestimmungen der Länder od
Unangemessen
Laden...
Magazin per E-Mail verschicken
Laden...
Einbetten
Laden...