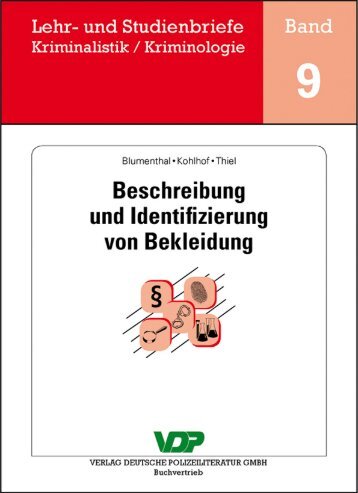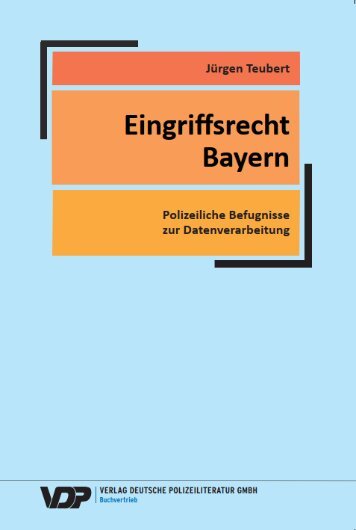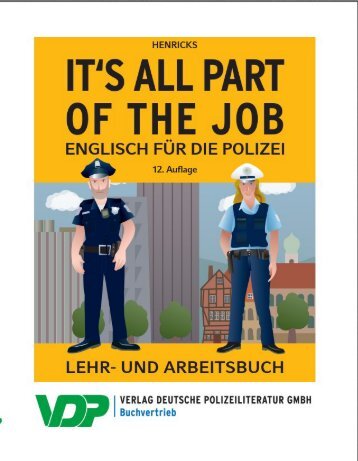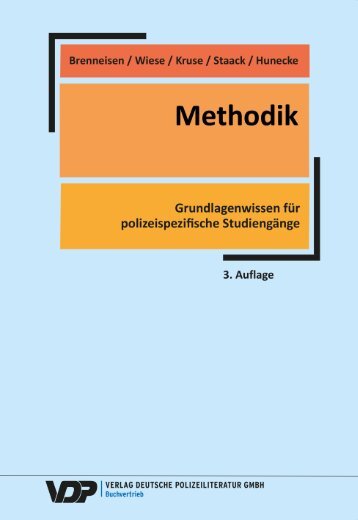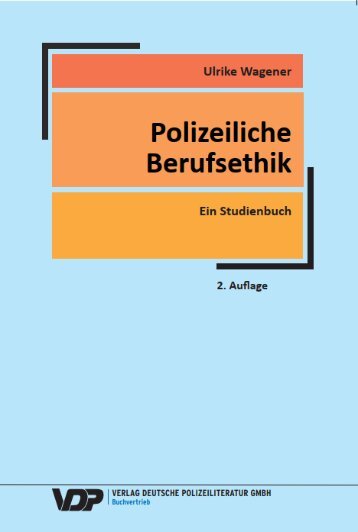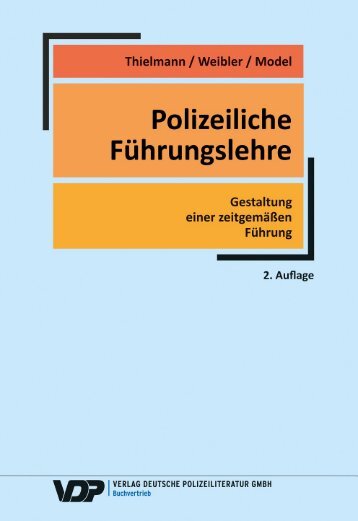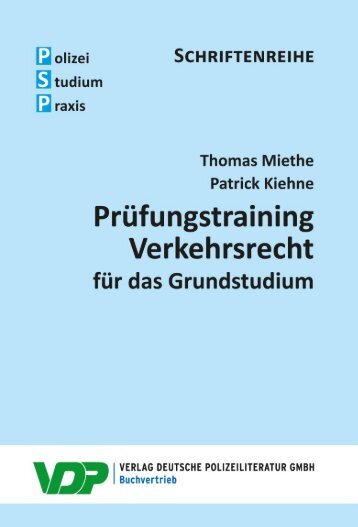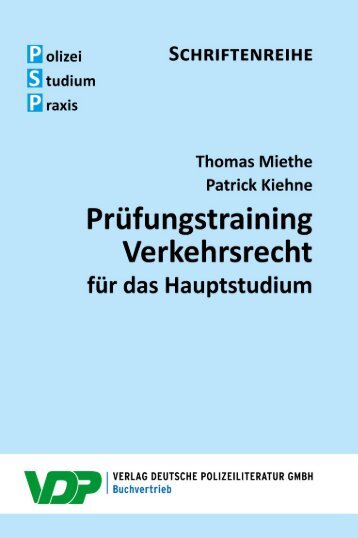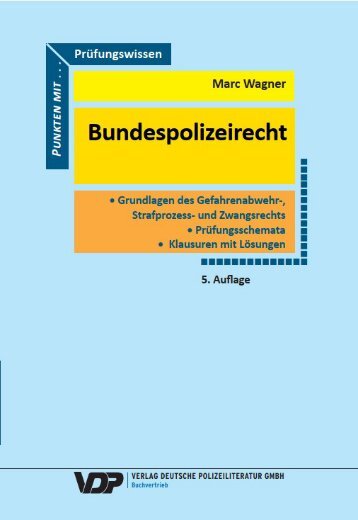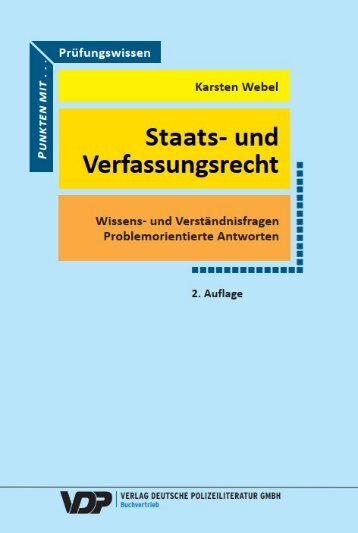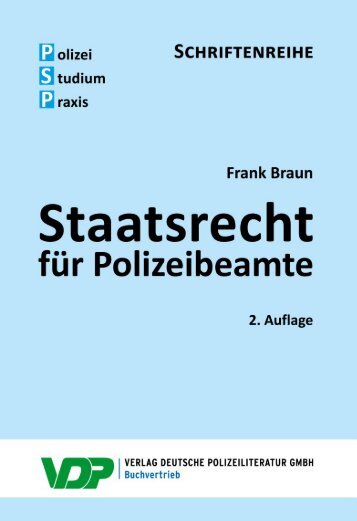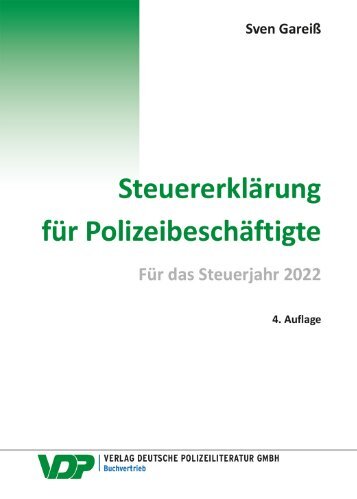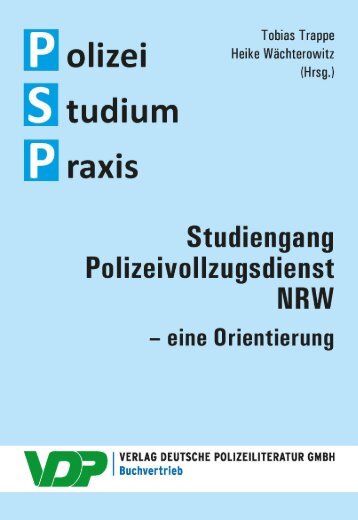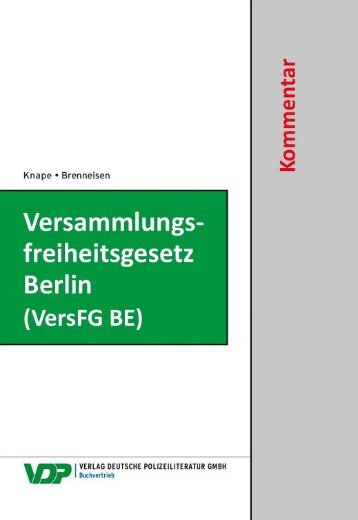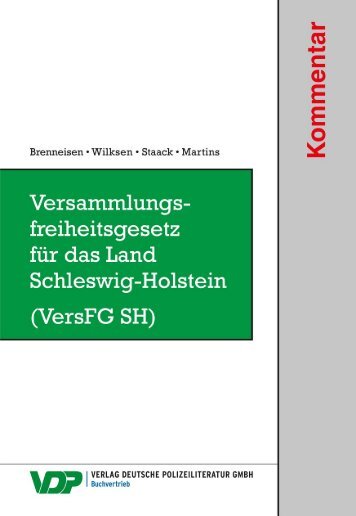VDP-BV Leseproben
Häusliche Gewalt - Leseprobe
- Text
- Gewalt
- Frauen
- Polizei
- Opfer
- Definition
- Initiativen
- Wohnungsverweisung
- Bmfsfj
- Strafverfolgung
- Handeln
Polizei und Justiz Im
Polizei und Justiz Im Jahr 2004 wurden Ergebnisse repräsentativer wissenschaftlicher Untersuchungen zur „Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in Deutschland 23) sowie zu Unterstützungspraxis, staatlicher Intervention bei häuslicher Gewalt und Täterarbeit im Kontext von Interventionsprojekten“ 24) vorgestellt. 2007 griff der Aktionsplan II der Bundesregierung 25) die Untersuchungsergebnisse insbesondere zu den Themen Schutz von Migrantinnen, von Frauen mit Behinderungen und von Frauen in Trennungssituationen auf. Einen umfassenden Überblick über Ausmaß und Risikofaktoren der Gewalt vermittelt die Studie „Gewalt gegen Frauen in Paarbeziehungen – Eine sekundäranalytische Auswertung zur Differenzierung von Schweregraden, Mustern, Risikofaktoren und Unterstützung nach erlebter Gewalt“ 26) aus dem Jahr 2008. Die fortschreitende Erkenntnislage und die Erfahrungen mit der Umsetzung der neuen polizeirechtlichen Maßnahmen führten auch in den Ländern zur Fortschreibung von Aktionsplänen, stellvertretend z.B. in Niedersachsen 27) und Baden-Württemberg 28) , von Handlungsempfehlungen bzw. -leitlinien 29) sowie Initiativen 30) . Diese bezogen zunehmend auch Männer als Opfer häuslicher Gewalt ein. 1.3.2 Polizei und Justiz Häusliche Gewalt in Deutschland ist auch heute noch geprägt durch die Gewalt von Männern gegenüber Frauen. Sie galt in Deutschland bis in die 1970er-Jahre gemeinhin noch als Privatangelegenheit und war damit staatlicher Reglementierung und Einflussnahme weitgehend entzogen. Das polizeiliche Handeln war entsprechend dem gesellschaftlich vorherrschenden Grundverständnis in der Regel darauf beschränkt, die akute Fortsetzung von Körperverletzungen, Beleidigungen oder Drohungen zu unterbinden, durch kurzfristige Trennung von Täter und Opfer den „Streit“ zu schlichten, für „Ruhe“ zu sorgen und die Ordnung wiederherzustellen. 31) Erwies sich dies, z.B. infolge von Alkoholkonsum oder weiterer Aggressivität des Täters, als schwierig oder nicht möglich, konnte die Polizei einen Platzverweis aussprechen oder den Täter vorübergehend in Gewahrsam nehmen. Leseprobe Zu einer Strafverfolgung kam es in der Regel nicht, da die verwirklichten Straftatbestände zumeist Antrags- und Privatklagedelikte waren. Die Kraft, eine Strafverfolgung des Partners einzuleiten und durchzusetzen, hatten aus vielfältigen und nachvollziehbaren Gründen die wenigsten Opfer. So unterblieben weithin auch die Spurensicherung zur Beweissicherung im Strafverfahren und eine statistische Erfassung des Sachverhalts. Ein Aufbrechen verfestigter Gewaltbeziehungen war auf diese Weise nicht möglich. Immer wieder kam es auch zu Tötungshandlungen, denen ganz überwiegend Frauen zum Opfer fielen. 23) BMFSFJ, 2004a. 24) BMFSFJ, 2004b. 25) BMFSFJ, 2007. 26) BMFSFJ, 2014. 27) Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und Integration, 2012. 28) Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren Baden-Württemberg, 2014. 29) Polizei Hessen, 2009. 30) Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen Berlin, 2013, 2014. 31) Lütgert, 2014. 13
Gesellschaftliche Wahrnehmung, gesellschaftspolitische Initiativen und staatliches Handeln Mit der zunehmenden Enttabuisierung und Ächtung von Beziehungsgewalt und dem wachsenden Bewusstsein um ihre gesellschaftliche Dimension und schädliche Wirkung begann ein Umdenken. Dies und der Wandel der rechtlichen Rahmenbedingungen führten Ende der 1990er-Jahre auch zu einer deutlich veränderten staatlichen Intervention bei häuslicher Gewalt. Dies galt zunächst insbesondere für die Polizei, die bei Einsätzen häuslicher Gewalt häufig das Ausmaß der Gewalt und die schwierige Situation der Opfer und betroffener Kinder erlebte. 32) Als erster wichtiger Schritt wurde in Nordrhein-Westfalen seit 1996 in allen Fällen häuslicher Gewalt die Strafverfolgung immer von Amts wegen durch Anzeige der Polizei eingeleitet, unabhängig von dem Strafantrag eines Opfers. 33) Zudem hat das Innenministerium NRW die Bearbeitung von Strafanzeigen häuslicher Gewalt im „Vereinfachten Verfahren zur Bearbeitung Ausgewählter Delikte“ 34) , das eine Äußerung der Verfahrensbeteiligten im schriftlichen Anhörungsverfahren vorsieht, ausgeschlossen. Ähnliche Regelungen ergingen in anderen Ländern. Für die Justiz waren die in Fällen häuslicher Gewalt anzuwendenden Voraussetzungen für die Strafverfolgung in den Richtlinien für das Strafverfahren und das Bußgeldverfahren (RiStBV) geregelt. Danach soll der Verweis auf den Privatklageweg bei entsprechenden Delikten im öffentlichen Interesse unterbleiben bzw. bei Körperverletzungsdelikten ein besonderes öffentliches Interesse an der Strafverfolgung auch ohne Strafantrag bestehen, wenn der verletzten Person aufgrund ihrer persönlichen Beziehung zum Täter nicht zuzumuten ist, die Privatklage zu erheben 35) oder Strafantrag zu stellen. 36) Zunehmend ging die Justiz dazu über, diese Vorschrift in Fällen häuslicher Gewalt anzuwenden. Für die Polizei vollzog sich seit 2002 mit dem Inkrafttreten der polizeilichen Befugnisse zu Wohnungsverweisung und Rückkehrverbot unter der Maxime „Wer schlägt, der geht“ ein Paradigmenwechsel in der Handlungspraxis. Unterstützt wurde er durch eine immer enger werdende Kooperation mit dem Unterstützungs- und Hilfenetzwerk für von häuslicher Gewalt betroffene Frauen bzw. Personen. Mit der Durchsetzung von Wohnungsverweisung und Rückkehrverbot ging das klare Signal an den gewalttätigen Partner, dass Gewalt in Beziehungen keine Privatangelegenheit ist und er zur Rechenschaft gezogen wird. Opfer häuslicher Gewalt wurden in dem Bewusstsein gestärkt, dass staatliche Stellen Hilfe leisten. Damit wurde den Opfern erstmals die Möglichkeit eröffnet, zur Ruhe zu kommen und ggf. nach Beratung und Unterstützung weitere Schritte zu unternehmen, um sich – oftmals mit Kindern – aus einer dauerhaft gewaltbelasteten Beziehung zu lösen. Vor dem Hintergrund immer wieder im Rahmen häuslicher Gewalt verübter schwerwiegender Misshandlungen oder Tötungen initiierte die Ständige Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder im Jahr 2005 u.a. zeitnahe Situations- und Gefährdungsanalysen sowie konsequente Gefährderansprachen, 32) BMFSFJ, 2004a. 33) Innenministerium NRW, 2007. 34) Innenministerium NRW, 1994. 35) RiStBV, Nr. 86 II. 36) RiStBV, Nr. 234 I. 14 Leseprobe
- Seite 2 und 3: Lehr- und Studienbriefe Kriminalist
- Seite 4 und 5: Vorwort Vorwort Gewalt im sozialen
- Seite 6 und 7: Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichn
- Seite 8 und 9: Inhaltsverzeichnis 5.6.6.5 Überpr
- Seite 10 und 11: Vereinte Nationen 1 Gesellschaftlic
- Seite 12 und 13: Staat und Gesellschaft Flankiert wi
- Seite 16 und 17: Charakteristika der Gewaltbeziehung
- Seite 18 und 19: Begriffsbestimmungen der Länder od
Unangemessen
Laden...
Magazin per E-Mail verschicken
Laden...
Einbetten
Laden...