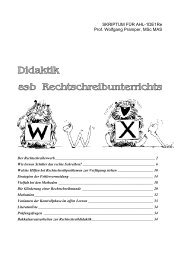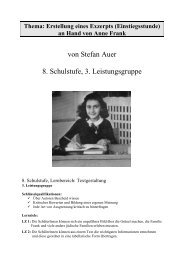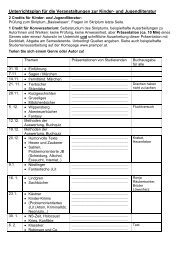1. Der Computer im Deutschunterricht - Wolfgang Pramper
1. Der Computer im Deutschunterricht - Wolfgang Pramper
1. Der Computer im Deutschunterricht - Wolfgang Pramper
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
S E M I N A R<br />
Skriptum für H-3-FDES-FD<br />
Prof. <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong>, MSc MAS<br />
D I D A K T I K D E S D E U T S C H U N T E R R I C H T S<br />
M I T D E M C O M P U T E R<br />
D E U T S C H<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
<strong>1.</strong> <strong>Der</strong> <strong>Computer</strong> <strong>im</strong> <strong>Deutschunterricht</strong>.................................................................................... 2<br />
2. Methodische Möglichkeiten für den Einsatz von PCs <strong>im</strong> <strong>Deutschunterricht</strong>..................... 6<br />
3. Übungen zu den methodischen Möglichkeiten .................................................................... 8<br />
4. Unterrichtsplanungen mit dem <strong>Computer</strong>.......................................................................... 10<br />
5. Zum Nachlesen.................................................................................................................... 11<br />
6. Anforderungen für die Testur............................................................................................. 13<br />
7. Prüfung................................................................................................................................ 14<br />
7. Literatur............................................................................................................................... 15
<strong>Computer</strong>unterstützter <strong>Deutschunterricht</strong> Prof. <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong>, MSc MAS Seite 2<br />
<strong>1.</strong> <strong>Der</strong> <strong>Computer</strong> <strong>im</strong> <strong>Deutschunterricht</strong><br />
<strong>1.</strong>1 Anmerkungen zum <strong>Computer</strong>einsatz <strong>im</strong> <strong>Deutschunterricht</strong><br />
Positive Erfahrungen<br />
• die hohe Motivation, die vom Arbeiten mit dem <strong>Computer</strong> ausgeht (längere<br />
Auseinandersetzung, höhere Konzentration, perfektere Ergebnisse)<br />
• die Möglichkeit zur Textrevision (auch für Form und Stil)<br />
• das <strong>im</strong>mer saubere Schriftbild (Lesbarkeit, Fehlerfinden)<br />
• selbstständiges Arbeiten wird gefördert, Entlastung der Lehrer, gegenseitige<br />
Partnerunterstützung der Schüler<br />
• Nähe zur Berufs- und Arbeitswelt<br />
• Layout und Typografie führen zu neuem Textbewusstsein, Produktorientierung<br />
• Ständiger und direkter Kontakt ist möglich, Mailkontakte, Tutorensystem<br />
Aber es gibt auch weniger gute Erfahrungen:<br />
• <strong>Der</strong> leichte Mail-Kontakt zum Lehrer kann zur Belästigung werden<br />
• Aufwand-Nutzen-Verhältnis: Raumwechsel, Zeitaufwand gerechtfertigt?<br />
• Dominierendes oder partnerschaftliches Verhalten durch unterschiedliche<br />
Bedienungskenntnisse?<br />
• Stehen Lerninhalte oder Bedienungsprobleme auf Dauer <strong>im</strong> Vordergrund?<br />
• Ist Einzelarbeit möglich? Gibt es sinnvolle und notwendige Partnerarbeiten?<br />
• Das Schreiben am PC geht langsam vor sich (die Gedanken und die<br />
schriftliche Umsetzung gehen nicht Hand in Hand)<br />
• Schüler-Korrekturen betreffen leider nach wie vor oft nur Tippfehler.<br />
• Mangelhafte und zu wenige Geräte (Gelder gehen an anderer Stelle ab).<br />
<strong>1.</strong>2 Die Neuen Medien verändern den Unterricht<br />
• Die Methodik ist <strong>im</strong> Umbruch. Von der Bringschuld der Lehrer <strong>im</strong><br />
Frontalunterricht kommt es zunehmend öfter zur Bringschuld der Schüler <strong>im</strong><br />
Offenen Unterricht.<br />
• Traditionelle Inhalte des (Deutsch)Unterrichts haben nach wie vor Bedeutung<br />
durch die Neuen Medien kommen aber neue Inhalte hinzu.<br />
• Es gibt einen nachweisbaren Mehrwert durch die Neuen Medien <strong>im</strong><br />
(Deutsch)Unterricht, der den finanziellen und organisatorischen Aufwand<br />
rechtfertigt.<br />
• E-Learning wird von den Lernenden gut angenommen, die Motivation ist -<br />
verglichen mit den traditionellen Methoden - mindestens genauso gut.<br />
In den letzten 25 Jahren hat eine enorme Veränderung des Unterrichts<br />
stattgefunden. Gab es 1975 noch getrennt geschlechtlichen Unterricht, den <strong>1.</strong> und 2.<br />
Klassenzug, Unterricht fast ausschließlich mit dem Buch, Spiritus-Arbeitsblättern,<br />
störanfälligen Filmprojektoren, so findet man heute als LehrerIn Video- und DVD-
<strong>Computer</strong>unterstützter <strong>Deutschunterricht</strong> Prof. <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong>, MSc MAS Seite 3<br />
Anlagen, PC´s in der Schule und zu Hause, bereits erste Whiteboards in der Klasse,<br />
Software zur Analyse von Lese- und Rechtschreibschwächen, Aufgaben werden mit<br />
Textverarbeitungsprogrammen erstellt und dem Lehrer/der Lehrerin per Diskette oder<br />
<strong>im</strong> Mailverkehr abgegeben, Online-Projekte finden die Zust<strong>im</strong>mung der SchülerInnen.<br />
Gespräch: Wo sind für Sie persönlich eklatante Weiterentwicklungen <strong>im</strong> Bereich der<br />
Unterrichtsmedien zu beobachten? Inwieweit führen die Medien zu veränderten<br />
Arbeitsweisen (Vor- und Nachteile) und beeinflussen Methoden und Inhalte?<br />
<strong>1.</strong>3 Entwicklung der Veränderung von Schule durch die Medien<br />
Jedes Medium ist an sich weder gut noch schlecht. Es funktioniert nur manchmal<br />
besser oder schlechter. Medien transportieren Kulturgut, Information, Manipulation<br />
und Unterhaltung in den verschiedensten Qualitätsstufen. Es stellt sich heute nicht<br />
mehr die Frage, ob der <strong>Computer</strong> genutzt wird, sondern nur mehr wie lange täglich<br />
noch verträglich ist.<br />
Wie die Untersuchung <strong>im</strong> Bild zeigt, besitzen bereits 2004 70% der Österreicher über<br />
14 Jahren einen <strong>Computer</strong>, bei den unter 14-Jährigen ist der Prozentsatz um einiges<br />
höher. Die Erwartung ist, dass nach 2010 an die 95% der 14-Jährigen einen PC zu<br />
Hause haben. <strong>Der</strong> Internetzugang hat sich in 4 Jahren von 30 auf 60% verdoppelt.<br />
Medien die Gesellschaft verändert haben.<br />
<strong>1.</strong>4 Veränderung <strong>im</strong> Lernbereich Schreiben<br />
Was bedeutet die Entwicklung der<br />
Medien für den <strong>Deutschunterricht</strong>?<br />
Inwieweit verändert die Medienumwelt<br />
das Lernen?<br />
Spontan ist man geneigt zu sagen:<br />
Warum sollten Medien die Inhalte des<br />
<strong>Deutschunterricht</strong>s beeinflussen.<br />
In den letzten Jahrzehnten hat eine<br />
enorme Veränderung des Unterrichts<br />
stattgefunden, in einem Tempo wie<br />
noch nie zuvor in der Geschichte. Die<br />
Methoden und Inhalte haben sich<br />
geändert, nicht zuletzt, weil sich die<br />
Medien verändert haben und weil die<br />
Das möchte ich mit der folgenden Übersicht zur Entwicklung <strong>im</strong> Lernbereich<br />
Schreiben verdeutlichen.<br />
1950-1975<br />
Bis 1958 noch Feder und Tintenfass in der<br />
VS. Danach Füllfeder mit Tintenfass in der<br />
regelmäßiges und längeres Schreiben wird<br />
erstmals möglich;
<strong>Computer</strong>unterstützter <strong>Deutschunterricht</strong> Prof. <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong>, MSc MAS Seite 4<br />
Schule<br />
Spiritusmatrizenkopie (ein- bis zwe<strong>im</strong>alig<br />
verwendbare Matrize) – wenig verwendet –<br />
viel vom Tafelbild abgeschrieben<br />
Das Jugendbuch war nur eine Freizeitlektüre<br />
(„Pippi“ ab 1950) in dt. Sprache.<br />
1960 wurden Leseerlebnisse bei den 10-14-<br />
Jährigen durch Texte von Stifter und<br />
Rosegger und durch Reklamhefte erreicht.<br />
Sie fanden in der 4. Klasse mit „König<br />
Ottokars Glück und Ende“ den didaktischen<br />
Höhepunkt des <strong>Deutschunterricht</strong>s. Texte<br />
wurden über Wochen <strong>im</strong> <strong>Deutschunterricht</strong><br />
gelesen.<br />
1975-2000<br />
Patronenfüller - Kuli<br />
Fernsehen<br />
Video - Filme<br />
Overhead<br />
teure Kopierer<br />
Schreiben als Prüfungsgegenstand<br />
(Schularbeit) wird in der Sekundarstufe<br />
eingeführt.<br />
Langsame Erzählweise der Medien (100<br />
Seiten bevor Robinson auf Insel strandet.)<br />
Erlebnis-Aufsatz mit langer Einleitung, einem<br />
Höhepunkt, Schluss = Stil der Bücher und<br />
Filme: (An einem schönen Sonntagmorgen …<br />
das war ein Erlebnis, das ich nicht vergessen<br />
werde.)<br />
anfangs keine Jugendliteraturerziehung<br />
sehr viel Tafelbildeintrag<br />
Rechtschreibtraining nach Phänomenen:<br />
Wörter mit d-t, v-f gegenübergestellt<br />
seitenweise Reihenbildungen<br />
Das schulische Schreiben orientiert sich am<br />
Fernsehen und Jugendbüchern, nicht nur an<br />
abenteuerhaften Jugendbüchern: kritische<br />
Magazine, Satirisches, Soziales durch Nöstlinger<br />
kam in die Wohnz<strong>im</strong>mer und Schulklassen.<br />
vielfältige Textsorten auch des Alltags, waren die<br />
Folge:<br />
kritisches, emanzipatorisches, kreatives Schreiben<br />
Erlebniserzählung ändert sich - mit unmittelbarem<br />
Einstieg (Kurzgeschichten-Stil mit direktem Beginn<br />
– heute <strong>im</strong> Kr<strong>im</strong>i üblich) und Perspektivenwechsel<br />
Kuli + ABL: Schriftbild verändert sich,<br />
Tafelbildeintragungen nehmen ab – ABL, <strong>Der</strong><br />
Gegenstand Schönschreiben wird abgeschafft<br />
Da weniger von der Tafel abgeschrieben wurde,
<strong>Computer</strong>unterstützter <strong>Deutschunterricht</strong> Prof. <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong>, MSc MAS Seite 5<br />
Gratisschulbuch<br />
Bibliotheken in Schulen<br />
wurde das Üben des Häufigkeitswortschatzes<br />
notwendig (Partnerdiktat, Laufdiktat,…)<br />
Jugendliteratur ist fest verankert, fast 60% der<br />
Bibliotheksbenützer sind Jugendliche.<br />
Das Neue an den Neuen Medien ist, dass die Schüler nun selbst die Medien wie<br />
einen <strong>Computer</strong>, Drucker oder das Internet auch in der Schule bedienen. Die Rolle<br />
des Lehrers, der Lehrerin verändert sich und entwickelt sich <strong>im</strong>mer mehr vom<br />
Informationsbringer zu der eines Lernberaters.<br />
2000-2025 Medien, die in der gegenwärtigen Epoche an Bedeutung gewinnen<br />
dürften<br />
Tastatur + Drucker + Textverarbeitung<br />
USB-Stick (Schlüsselanhänger) + Beamer (Ersatz für Overhead) (Unterrichtsvorbereitung)<br />
multifunktionale Kopierer (Farbe, doppelseitiger Druck, gebündelt und geheftet bzw.<br />
gelocht und mit einem Ringbinder versehen)<br />
mehr Klassen mit <strong>Computer</strong>n und besseren Geräten – mehr Lernsoftware<br />
Internet, Recherche, Mailing (Schüler-Lehrer)<br />
Whiteboard – interaktive, elektronische Tafeln, die mit einem Rechner verbunden sind.<br />
Lernplattformen<br />
In 20 Jahren wird die Nutzung, der oben angeführten Medien, in allen Bereichen bei<br />
100% liegen und andere „Neue“ Medien werden in die Schule drängen.<br />
<strong>1.</strong>5 „Die Schule der Zukunft“<br />
Die Neuen Medien verändern die Schule nachhaltiger anders als die früheren<br />
„Neuen Medien“. Es veränderte und verändert sich:<br />
• Die Rolle der Lehrenden – hin zum Lernberater, Lernorganisator<br />
• Die Lerninhalte, Aufgaben: neu sind das gezielte Recherchieren, die<br />
Bedeutung der Textgestaltung, das Training von Fachskills, Facharbeiten mit<br />
Quellenangaben, Hypertextarbeit, Planspiele,…<br />
• Die Unterrichtsmethode: Offenes Lernen, Selbstständiges Lernen, Freiarbeit,<br />
Wochenplanarbeit,…
<strong>Computer</strong>unterstützter <strong>Deutschunterricht</strong> Prof. <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong>, MSc MAS Seite 6<br />
• Die Didaktik: Individualisierung – jeder übt, was er braucht, arbeitet<br />
selbstständig an seinen Aufträgen;<br />
Übungen werden nach dem Zufallsprinzip gestellt – ein Abschreiben ist nicht<br />
mehr möglich, (Elektronische) Arbeitsblätter und intelligente Software (zuerst<br />
eine Defizitanalyse durchführen)<br />
Die Seitengestaltung eines Lernprogramms ist anders als bei einer Buchseite<br />
– Lernstrukturen müssen sofort auf kleinem Raum klar werden;<br />
Ergebnislisten – Kontrolle für Schüler und Lehrer<br />
Bestenlisten (Spiele für Partner- und Gruppenaufgaben)<br />
Quiz-Spiele<br />
• <strong>Der</strong> Lernertrag, die Motivation ist besser als bei traditionellen Medien<br />
(gezieltes Üben ist möglich, sofortiges Ausbessern, die Lernzeit wird extrem<br />
intensiv genutzt – Vorsicht vor Überforderung.<br />
• <strong>Der</strong> Jahrgangsunterricht wird auf Dauer in Frage zu stellen sein, der<br />
Präsenzunterricht ebenso.<br />
2. Methodische Möglichkeiten für den Einsatz von PCs <strong>im</strong><br />
<strong>Deutschunterricht</strong><br />
2. <strong>1.</strong> Arbeiten mit einem Textverarbeitungssystem<br />
E-learning in der Deutschstunde mit der Textverarbeitung WORD, Formatierungen<br />
kennen lernen, verschiedene Schreibaufgaben mit dem PC<br />
• Schreibspiele mit dem PC<br />
• E-learning Heft<br />
• Kreative Schreibprojekte<br />
2. 2 Üben mit einer Lernsoftware<br />
Programme, die den traditionellen Unterricht ergänzen besonders bei den Bereichen<br />
Rechtschreiben, Grammatik, Lesen.<br />
Elektronische Arbeitsblätter, bieten stets eine „neue“ Arbeitsvorlage, es braucht<br />
nur einer kurzen Einschulungszeit - lange Lernzeit sind möglich, ebenso<br />
differenziertes und individuelles Arbeiten, max<strong>im</strong>ale Ausnützung der Lernzeit!<br />
• Deutschstunde Online 1-4,<br />
• Sbx Deutschstunde 1-4<br />
• Lesefit<br />
2. 3. Analysieren, Üben, Testen, Spielen mit einer Lernsoftware:
<strong>Computer</strong>unterstützter <strong>Deutschunterricht</strong> Prof. <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong>, MSc MAS Seite 7<br />
Programme, die Lernschwächen analysieren und ein gezieltes Übungsprogramm<br />
anbieten. <strong>Der</strong> <strong>Computer</strong> bewältigt eine Analyse der Defizite, die LehrerInnen nicht<br />
in dem Tempo schaffen. SchülerInnen lernen das, was sie brauchen, in der<br />
kürzest möglichen Zeit!<br />
• Gut-besser-Deutsch<br />
• Rechtschreib- und Grammatik-Fit<br />
2. 4. Programme zur Unterstützung projektorientierter<br />
Unterrichtsvorhaben<br />
Planspiele wie „Die Titelseite einer Tageszeitung gestalten“ (DS Online 3)<br />
Informationen selbst recherchieren „Frühe Filme“ (DS Online 4)<br />
Jahresstoffe kontrollieren „Millionenspiel zur Deutschstunde“ (DS Online 4)<br />
Hypertext „<strong>Der</strong> Einbruch – ein Lesekr<strong>im</strong>i“ (DS Online 3)<br />
• Deutschstunde Sbx 3, 4<br />
2. 5. Online-Zeitung mit vorgegebener Formatierung<br />
• Online-Zeitung und Briefe zur Onlinezeitung [www.pramper.at / Medien/<br />
Projekte / Onlinezeitung]<br />
2. 6. Gruppenprojekte: Fotoromane<br />
• www.pramper.com / Projekte / Fotoroman 1-4<br />
• Lernplattform der Padl, [www.padl.ac / e-learning / PRW / Medienkunde1 /<br />
Material]<br />
2. 7. Internetrecherchen<br />
Gezielt Stichworte vorgeben, die vorher geprüft wurden. Aufgabe: Aus einigen Links<br />
Informationen entnehmen, vergleichen, die Information für einen Lerntext (1 Seite)<br />
verwenden, eigene Gliederungen einfügen, viele Formatierungen für<br />
Hervorhebungen.
<strong>Computer</strong>unterstützter <strong>Deutschunterricht</strong> Prof. <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong>, MSc MAS Seite 8<br />
3. Übungen zu den methodischen Möglichkeiten<br />
3. 1 Übungen zur Textverarbeitung<br />
� Schreibspiel: Mehrere Autoren arbeiten an mehreren Romanen gleichzeitig.<br />
� Kreatives Schreiben:<br />
a) Räuberbande Woissse (Partnerarbeit), aus „Kreatives Schreiben mit<br />
Bleistift und PC“, Veritas. [ www.pramper.at / Projekte / Kreatives Schreiben /<br />
Märchenlücken ergänzen]<br />
b) Gestaltung einer Titelseite für das Buch „Räuberbande“ und ein „Wanted-<br />
Plakat“ zu einem der Räuber (eigene Bilder verwenden)<br />
� Textgestaltung: Einen Text verkürzen und als gut gestalteten Lerntext<br />
auf einer Seite präsentieren. „Sind <strong>Computer</strong>programme bessere<br />
Rechtschreiblehrer“ auf [Laufwerk G: <strong>Computer</strong> Deutsch]<br />
(siehe dazu E-learning-Heft 11)<br />
<strong>1.</strong> Weniger Wichtiges löschen<br />
2. Wichtiges zu Aufzählungen verkürzen<br />
3. Gliederungen, Absätze einfügen<br />
4. Aufzählungszeichen, Symbole, Formatierungen (fett, gesperrt, unterstrichen,<br />
kursiv), Einrückungen, (Spalten), Absätze, Rahmen, Tabellen,… einfügen<br />
3. 2 Üben mit einer Lernsoftware (zum Beispiel die folgenden<br />
Übungen)<br />
„Sbx Deutschstunde 4“<br />
Konzentration: 3.2<br />
Begabungstraining: A<br />
Kombinieren: 3.1<br />
Memory: 6<br />
Vom Detail aufs Ganze: S 1<br />
Rechtschreibung: <strong>1.</strong>4 Schwierige Wörter nachschreiben<br />
„Übungs CD 3“<br />
A – Teste deine Vorkenntnisse, Fälle, Redensarten, Schreiben<br />
„Übungs CD 2“<br />
4 – Gespenster und Grammatik, Konzentration (Tetris)<br />
„Lesefit“<br />
Überfliegendes Lesen, Gelesenes verstehen: 4.8, 4.2<br />
Gedächtnistraining: <strong>1.</strong>1 Bildreihenfolgen merken
<strong>Computer</strong>unterstützter <strong>Deutschunterricht</strong> Prof. <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong>, MSc MAS Seite 9<br />
3. 3 Analysieren, Üben, Testen, Spielen mit einer Lernsoftware:<br />
(zirka 30 Minuten)<br />
Einzelarbeit:<br />
________________________________________________________________<br />
Defizitanalyse: „Gut-besser-Deutsch“ Vorkenntnisse testen z.B. Groß- und<br />
Kleinschreibung<br />
_______________________________________________________________<br />
Gezielt üben mit Hilfen: „Gut-besser-Deutsch“ Üben z.B. Groß- Kleinschreibung<br />
________________________________________________________________<br />
Testen mit Noten: „Gut-besser-Deutsch“ Testen z.B. Groß- Kleinschreibung<br />
________________________________________________________________<br />
Quizspiel zu Überprüfung eines Jahrgangsstoffes (Vierjahresstoffes):<br />
„Deutschstunde 4“ Projekt Millionenspiel<br />
________________________________________________________________<br />
Partner- und Klassenarbeit: (gemeinsames Arbeiten)<br />
Bestenliste: „Gut-besser-Deutsch“ Spiele z.B. Komma<br />
________________________________________________________________<br />
Spiele zu zweit, auch zwischen Klassen möglich: „Gut-besser-Deutsch“ Spiele zu<br />
zweit z.B. Kommasetzung<br />
_________________________________________________________________<br />
3. 4 Programme zur Unterstützung projektorientierter<br />
Unterrichtsvorhaben<br />
Hypertextarbeit: Projekt: Kr<strong>im</strong>i, am besten in Partnerarbeit (20 min) „Deutschstunde<br />
3“<br />
_________________________________________________________________<br />
Informationen selbst recherchieren: „Frühe Filme“ (DS Online 4) und testen<br />
_________________________________________________________________<br />
Planspiel: Titelseite einer Tageszeitung gestalten, Partnerarbeit „Deutschstunde 3“<br />
_________________________________________________________________<br />
3. 5 Online-Zeitung mit vorgegebener Formatierung
<strong>Computer</strong>unterstützter <strong>Deutschunterricht</strong> Prof. <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong>, MSc MAS Seite 10<br />
• www.pramper.com / Projekte / Online-Zeitung, Briefe zur Onlinezeitung<br />
3. 6 Gruppenprojekte: Fotoromane<br />
• www.pramper.com / Projekte / Fotoroman 1-4<br />
• Lernplattform der [PADL, /e-learning-Plattform / Medienkunde1 / Materialien]<br />
Produktion eines Fotoromans: Entweder Story und Fotos selbst herstellen oder<br />
vorhandene Bilder (www.pramper.com/Projekte für eine eigene Geschichte<br />
verwenden.<br />
Produktion eines Films, Fotoromans (Aufgabenstellung)<br />
Drehbuch: Brainstorming, Auswahl<br />
Fotoherstellung: 6- 10 Fotos, jeweils mehrfach, Kameraperspektiven<br />
(Vogelperspektive, Normalsicht, Froschperspektive)<br />
Einstellgrößen (Totale, Halbtotale, Halbnah, Groß, Detail)<br />
Kamerabewegungen<br />
Be<strong>im</strong> Texten der Fotoromane: Comic-Bildsprache, Information links oben in<br />
Kästchen, Sprechblasen, Gedankenblasen, Ausrufsymbole<br />
4. Unterrichtsplanungen mit dem <strong>Computer</strong><br />
4.1 Diese methodische Vorgangsweise <strong>im</strong><br />
Unterricht ist möglich:<br />
5 Min. Erklärungen des Lehrers, Starten der Geräte<br />
40 Min. Arbeit am PC, wenn jeder Schüler seinen eigenen<br />
PC hat. oder zwei Schüler arbeiten zusammen (Dominanz –<br />
Trittbrettfahrer-Problematik) oder<br />
20 Min. bei geteilten Arbeitsplätzen: Arbeit des einen<br />
Schülers am PC, der andere löst die Aufgaben <strong>im</strong> Heft;<br />
danach Wechsel<br />
5 Min. Vorzeigen der bearbeiteten Dateien, Ergebnisse, Speichern der Arbeiten,<br />
Schließen der Dateien und beenden des Programms.<br />
Nach jeder Arbeit am PC erfolgt die Kommunikation - das Ordnen, Begründen und<br />
Bewerten von Lösungen. Dazu verlassen die Schüler die Plätze vor den Schirmen<br />
oder drehen sich weg und gehen zu den Ausweichplätzen. Meist wird dies erst in der<br />
nächsten Stunde möglich sein. Opt<strong>im</strong>al für solche Arbeiten sind Doppeleinheiten.<br />
Um den Leistungsunterschieden begegnen zu können, ist es notwendig, dass<br />
LehrerInnen den Unterrichtsstoff differenziert anbieten. Den SchülerInnen müssen<br />
aber Mindestziele angegeben werden.
<strong>Computer</strong>unterstützter <strong>Deutschunterricht</strong> Prof. <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong>, MSc MAS Seite 11<br />
Bei manchen Aufgabenstellungen ist oft eine Zeitbegrenzung notwendig, um dem<br />
Partner ebenfalls die Arbeit am Gerät zu ermöglichen.<br />
5. Sind <strong>Computer</strong>lernprogramme bessere<br />
Rechtschreiblehrer?<br />
Problemlage<br />
<strong>Der</strong> Lernbereich Rechtschreiben gerät durch die Dichte des Lehrplanes Deutsch zunehmend<br />
ins Hintertreffen. Lehrer der weiterführenden höherer Schulen klagen oft über mangelnde<br />
Rechtschreibfertigkeiten. Begabte Schüler werden nicht ausreichend gefordert, da vielfach<br />
an schwächeren Schülern das Maß für Tempo, Umfang und Komplexität genommen wird.<br />
Andererseits zeigt die Untersuchung von Walter Rieder (vgl. in Schwarz, 1991), dass auch<br />
leistungsschwächere Schüler nicht ausreichend gefördert werden und selbst in elementaren<br />
Bereichen der Rechtschreibung große Mängel aufweisen. Die Untersuchung ergab, dass<br />
Berufsschülern bereits das fehlerfreie Schreiben eines einzigen Satzes Schwierigkeiten<br />
bereitet. Jede/r vierte SchülerIn wird aufgrund der Untersuchungsergebnisse auch als<br />
teilweiser Analphabet bezeichnet, da erhebliche Schwierigkeiten bei der Leserichtigkeit und<br />
Lesegeschwindigkeit vorliegen.<br />
Eine nahe liegende Erklärung dafür könnte sein, dass <strong>im</strong> Bereich des<br />
Rechtschreibunterrichtes individuelles Lernen kaum stattfindet. Schülerinnen lernen meist<br />
gemeinsam an einem Thema, ohne dass vorher der Lernbedarf erhoben wurde und ohne<br />
jede inhaltliche und zeitliche Differenzierung. Die Größe der Gruppen und die Orientierung<br />
am Sprachbuch erlauben keinen individuellen Rechtschreibunterricht.<br />
Mit der Entwicklung der Personalcomputer scheint hier ein entscheidender Durchbruch<br />
erfolgt zu sein.<br />
Schulsoftware ist prinzipiell für sämtliche Bereiche des <strong>Deutschunterricht</strong>s denkbar. Am<br />
geeignetsten scheint das Werkzeug <strong>Computer</strong> zunächst <strong>im</strong> Bereich Rechtschreiben zu sein,<br />
da dabei eindeutig richtige oder falsche Lösungen erforderlich sind. Das Üben mit<br />
<strong>Computer</strong>programmen hat darüber hinaus eine disziplinierende Wirkung, die für den<br />
Rechtschreibunterricht von Bedeutung ist. Jeder Fehler wird bei der Eingabe sofort entdeckt,<br />
er wird emotionslos gemeldet und muss eindeutig richtig korrigiert werden. Da Schüler sich<br />
zunehmend über Fehler ärgern, halten sie sich selbst zu steigender Sorgfalt an. (vgl. dazu<br />
Raun, 1987)<br />
Fehleranalyse für den Rechtschreibunterricht<br />
Auch für das Rechtschreibtraining mit dem <strong>Computer</strong> ist eine vorangehende Fehleranalyse<br />
notwendig, wenn dies nicht das Programm übern<strong>im</strong>mt. Dies geschieht zum Beispiel <strong>im</strong><br />
Programm „Gut-besser-Deutsch“ (<strong>Pramper</strong>, 2001)<br />
Zwei Fehlertypen werden unterschieden:<br />
Fehlertyp 1 bedeutet, dass ein Kind Fehler macht, weil es wirklich nicht weiß, wie das Wort<br />
geschrieben wird. Das kann daran liegen, dass dieses Kind das Wort noch nie geschrieben<br />
und deshalb noch nicht kennen gelernt hat.<br />
Hier geht es also zunächst um die Merkfähigkeit. Wenn die Merkfähigkeit be<strong>im</strong> Schreiben<br />
eines Wortes aus irgendeinem Grund versagt, kann das Kind ein anderes Mittel zu Hilfe<br />
nehmen. Es kann eine Rechtschreibregel anwenden, falls es sich bei dem Wort um einen<br />
Regelfall handelt. Natürlich muss das Kind die Regel gelernt und behalten haben – und es<br />
muss sie obendrein richtig anwenden. Somit wird seine Denkfähigkeit ebenfalls gefordert.<br />
Als letztes Hilfsmittel kann das Kind die akustische Wahrnehmung befragen. Jedes Wort<br />
hat einen ganz best<strong>im</strong>mten Klang. Um dieses Klangbild in seine einzelnen Bestandteile zu
<strong>Computer</strong>unterstützter <strong>Deutschunterricht</strong> Prof. <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong>, MSc MAS Seite 12<br />
zerlegen, braucht das Kind jedoch eine weitere Fähigkeit: die akustische<br />
Differenzierungsfähigkeit. Dazu muss es das richtige, also das hochdeutsche Klangbild eines<br />
Wortes kennen.<br />
„Jede Fertigkeit verlangt wieder und wieder Übung. Eine Rechtschreibübung kann also nicht<br />
in einer lediglich passiven Aufnahme der Wörter bestehen, sondern muss <strong>im</strong> Wesentlichen<br />
eine aktive Wiedergabe bedeuten. Rechtschreiben lernt ein Kind nur durch Üben!“<br />
(Schwinghammer, 1999)<br />
Nun mag der Eindruck entstanden sein, dass der Fehlertyp 1 ausschließlich durch rein<br />
intellektuelle Faktoren wie Lern-, Denk- oder Merkfähigkeit best<strong>im</strong>mt wird. Jedoch spielen<br />
be<strong>im</strong> Lernen, Denken und Behalten die Motivation und Gefühle eines Menschen eine<br />
entscheidende Rolle. Freude, Ärger oder Angst nehmen oft starken Einfluss auf die<br />
intellektuellen Fähigkeiten eines Menschen. Sie können das Lernen erschweren, das<br />
Denken blockieren und das Behalten schwächen.<br />
Bei Fehlertyp 2 beschäftigt man sich mit jenen psychologischen Ursachen, die zu Fehlern<br />
führen, die ein Kind macht, obwohl es eigentlich weiß, wie das Wort geschrieben wird.<br />
Man nennt diese Fehler „Flüchtigkeitsfehler“, weil die Gedanken des Kindes offenbar<br />
umherschweifen, nicht bei der Sache, kurzum flüchtig sind. Doch nicht <strong>im</strong>mer sind die<br />
Gedanken des Kindes abgelenkt. Im Gegenteil: Manchmal bemüht es sich ganz besonders<br />
darum, das Wort richtig zu schreiben und macht gerade deshalb einen Fehler, der – obwohl<br />
er wie ein Flüchtigkeitsfehler aussieht – alles andere als flüchtig, sondern Ausdruck eines<br />
quälenden Konflikts ist, der besonders häufig bei gerade leicht zu schreibenden Wörtern<br />
auftritt. Je ruhiger, verständnisvoller und geduldiger man auf die kleineren und größeren<br />
Fehlleistungen eines Kindes be<strong>im</strong> Rechtschreiben reagiert, desto geringer ist die Gefahr,<br />
dass es bei s<strong>im</strong>plen Wörtern Flüchtigkeitsfehler macht. (<strong>Pramper</strong>, 1999)<br />
Im folgenden Kapitel wird ein Forschungsprojekt <strong>im</strong> Auftrag des Bundesministeriums<br />
beschrieben, bei dem mit Hilfe von Lernsoftware die Rechtschreibung individuell gefördert<br />
werden sollte.<br />
Projektbericht: Sind <strong>Computer</strong>programme bessere Rechtschreiblehrer?<br />
Bericht über ein Forschungsprojekt aus dem Regelunterricht an der Übungshauptschule der<br />
Pädagogischen Akademie der Diözese Linz 1992:<br />
Zusammenfassung: In zwei leistungsgleichen Parallelklassen wurde ein Rechtschreibthema<br />
vom selben Lehrer <strong>im</strong> selben Zeitraum unterrichtet. In einer Klasse wurde ein<br />
<strong>Computer</strong>lernprogramm verwendet, in der anderen das Schulbuch. Die Fehlerzahl be<strong>im</strong><br />
abschließenden Test nach drei Übungseinheiten war bei der Klasse mit den<br />
<strong>Computer</strong>übungen nur halb so hoch wie bei der Vergleichsklasse. Zudem gingen nach<br />
Einschätzung der Test ausführenden Lehrer die SchülerInnen der <strong>Computer</strong>gruppe zügiger<br />
be<strong>im</strong> Test vor und waren schneller fertig.<br />
Diese Beobachtung deckt sich mit Untersuchungen in der Schweiz (Karl Frey, 1989), die<br />
ergaben, dass Lernprogramme kognitive Leistungen besser fördern als traditioneller<br />
Unterricht. Vor allem schwächere Schüler seien die Hauptnutznießer von Lernprogrammen<br />
(Vgl. dazu auch EDV/Informatik <strong>im</strong> österreichischen Bildungswesen). Daneben wurde auch<br />
eine Steigerung der Lern- und Arbeitsgeschwindigkeit festgestellt. Ähnliche Ergebnisse<br />
zeigten sich in den USA bei Pr<strong>im</strong>ar- und Sekundarschülern <strong>im</strong> Fach Mathematik. (Niemic &<br />
Walberg, 1985, Burns & Bozeman, 198<strong>1.</strong><br />
Forschungsrgebnis A: Lernertrag<br />
<strong>Der</strong> Ertrag be<strong>im</strong> Lernen mit dem <strong>Computer</strong> ist signifikant höher als mit dem Buch. Besonders<br />
kleine, gut abgegrenzte Lernbereiche, die stark von kognitivem Wissen (Rechtschreibregeln)
<strong>Computer</strong>unterstützter <strong>Deutschunterricht</strong> Prof. <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong>, MSc MAS Seite 13<br />
geleitet werden, sind mit dem <strong>Computer</strong> besser zu erlernen. Beispiel: Wortabteilung,<br />
Beistrich. Weniger deutlich ist der Vorteil des <strong>Computer</strong>s bei großen, weniger gut<br />
übersichtlichen Lernbereichen. Beispiel: Allgemeiner Wortschatz mit Dehnung, Schärfung, S-<br />
Schreibung.<br />
Im Durchschnitt verringert sich die Fehlerzahl bei der Arbeit mit dem Buch um ein Drittel bei<br />
einem Nachfolgetest, bei der Arbeit mit dem <strong>Computer</strong> jedoch um zwei Drittel bei gleicher<br />
Übungszeit.<br />
Forschungsergebnis B: Motivation<br />
Die Zufriedenheit mit dieser Unterrichtsform ist sehr hoch. Die Schüler trainieren sehr gerne<br />
mit dem <strong>Computer</strong>, sie bearbeiten in einer Lerneinheit erheblich mehr Übungen als mit dem<br />
Buch, sie gewinnen an Selbstvertrauen in die eigene Rechtschreibung. Die Lehrer fühlen<br />
sich entlastet und haben dabei das Gefühl, die Schüler mehr als sonst aktiviert zu haben.<br />
Forschungsergebnis C: Didaktik<br />
Die didaktischen Anforderungen - wie sie an Schulbücher gestellt werden - können von<br />
Lernsoftware gleichermaßen erfüllt werden. Aufgrund der Erfahrungen <strong>im</strong> Rahmen des<br />
Projektes haben sich folgende Merkmale der Lernsoftware als sehr effektiv erwiesen, sie<br />
können von Schulbüchern nicht erfüllt werden.<br />
Die Berechnungen in diesem Forschungsprojekt wurden von Uni. Prof. Johannes Mayr<br />
durchgeführt. Genauere Information gibt es dazu in der Veröffentlichung bei <strong>Pramper</strong>, 1992.<br />
Warum mit SbX (Schulbuch-Extra-Programmen) lernen?<br />
In den letzten 10 Jahren hat eine enorme Veränderung des <strong>Deutschunterricht</strong>s<br />
stattgefunden. Diese Entwicklung wird auch in den nächsten Jahren so weiter gehen. Schon<br />
bald werden nahezu alle Schüler einen PC und einen Internetzugang zu Hause haben.<br />
Bei den SbX-Programmteilen handelt es sich um eine Art elektronische Arbeitsblätter.<br />
Aber <strong>im</strong> Unterschied zu papierenen Arbeitsblättern gibt es bei den Online-Programmen<br />
ein sofortiges und hundertprozentiges korrektes Ausbessern der Fehler, was für den<br />
<strong>Deutschunterricht</strong> besonders wichtig ist.<br />
Ein falsches Einlernen findet daher nie statt. Bekommen Schüler eine verbesserte Aufgabe<br />
erst nach Tagen zurück, interessiert die richtige Lösung niemanden mehr. Die Chance auf<br />
eine Veränderung ist in diesem Fall nicht mehr sehr groß.<br />
In den meisten Programmen befinden sich große Datenbanken mit zum Teil sehr, sehr<br />
vielen Beispielen. Ruft man dieselbe Übung nochmals auf, kommen neue Beispiele, es wird<br />
daher nicht das Beispiel, sondern das Prinzip, die Regel gelernt.<br />
Lernprogramme können in Teilbereichen des <strong>Deutschunterricht</strong>s sehr einfach für eine<br />
Individualisierung und Differenzierung sorgen: Jeder lernt etwas anderes, nämlich das,<br />
was er braucht und in seinem Tempo.<br />
Mit Lernzeit wird damit ökonomisch umgegangen, weil sich der Übende auf das<br />
konzentriert, was er noch nicht kann und nicht Zeit mit Übungen vergeudet, die er ohnehin<br />
schon beherrscht. Jeder Übende bekommt <strong>im</strong>mer sofort Rückmeldung, in gleich bleibend<br />
freundlicher Weise, und sofort die Anregung, was er oder sie als nächstes machen soll.<br />
<strong>Der</strong> Lehrer kann sich während der Arbeit <strong>im</strong> <strong>Computer</strong>raum besser einzelnen Schülern<br />
widmen, die Hilfe brauchen. Die meisten Schüler arbeiten sehr intensiv, und das, obwohl<br />
der Lehrer gar nicht <strong>im</strong> Mittelpunkt des Unterrichts steht. Im Mittelpunkt stehen die<br />
Unterrichtshalte, und das ist gar nicht so schlecht, wie die Ergebnisse zeigen. In solchen<br />
Stunden haben Lehrer nicht die Rolle des Informationsbringers, sondern die eines<br />
Lernberaters.
<strong>Computer</strong>unterstützter <strong>Deutschunterricht</strong> Prof. <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong>, MSc MAS Seite 14<br />
6. Anforderungen für die Testur<br />
Arbeiten Sie zehn verschiedene Übungen zur Textverarbeitung aus und geben Sie<br />
diese zum Schluss ab!<br />
Mitarbeit in einer Gruppe bei der Entwicklung eines Fotoromans und Präsentation der<br />
PPP des Fotoromans.<br />
7. Prüfung<br />
Bitte bereiten Sie für die Prüfung folgende Fragestellungen vor!<br />
<strong>1.</strong> Methodische Fragen <strong>im</strong> Zusammenhang mit den Aufgaben von Punkt 1: Wie<br />
würden Sie diese Aufgaben durchführen lassen? (methodische Vorgangsweise)<br />
Welche Tipps würden Sie den Schüler geben? Welche alternativen Inhalte zu diesen<br />
Themen können Sie sich vorstellen?<br />
2. Was spricht für den <strong>Deutschunterricht</strong> mit dem PC? Was sind die Vorteile der<br />
Lernprogramme?<br />
3. Welche Problembereiche tauchen be<strong>im</strong> Unterricht mit dem PC auf?<br />
4. Wie hat sich der <strong>Deutschunterricht</strong> verändert und wie wir er sich weiter verändern?<br />
5. Welche Lernbereiche, Inhalte, Aufgaben eignen sich für die Arbeit mit dem PC und<br />
dem Internet, die für den <strong>Deutschunterricht</strong> relevant sind?<br />
6. Vergleichen Sie das Lernen mit und ohne <strong>Computer</strong>! Beziehen Sie dabei Ihre<br />
Erfahrungen mit Lernprogrammen ein!
<strong>Computer</strong>unterstützter <strong>Deutschunterricht</strong> Prof. <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong>, MSc MAS Seite 15<br />
7. Literatur<br />
bm:bwk, Hrsg. (1990). EDV/Informatik <strong>im</strong> österreichischen Bildungswesen (Redaktion: Lehner, K., Reiter, A.).<br />
Wien.<br />
Böck, M. (2000): Lesen in der neuen Medienlandschaft. Ergebnisse einer Befragung von 8- bis 14-Jährigen in<br />
Österreich. In: ide. zeitschrift für den deutschunterricht in wissenschaft und schule, 24. Jg.<br />
Brügelmann, H. (1987). <strong>Computer</strong> als Hilfe be<strong>im</strong> Lesen- und Schreibenlernen, In: Hameyer, U., u.a (Hrsg).:<br />
<strong>Computer</strong> an Sonderschulen, Weinhe<strong>im</strong>.<br />
Burns, P.K. & Bozeman, W.C.: <strong>Computer</strong>-assisted instruction and mathematics achievement: Is there a relationsship?<br />
Educational Technology.<br />
Claussen, C. (1995). Claussen, C. (1995). Handbuch Freie Arbeit. Konzepte und Erfahrungen. Weinhe<strong>im</strong> und Basel:<br />
Beltz.<br />
Dichanz, H. Hrsg. (1998) Handbuch Medien: Medienforschung. Bundeszentrale für politische Bildung. Bonn.<br />
Dittler, U. Hrsg.: (2002): E-Learning. Erfolgsfaktoren und Einsatzkonzepte mit interaktiven Medien. Oldenburg.<br />
München.<br />
Frey, K. (1989). Auswirkungen der <strong>Computer</strong>benutzung <strong>im</strong> Bildungswesen. Ein Überblick über den heutigen Stand<br />
des empirischen Wissens. Zürich.<br />
Fromme, J. (1999): Kinder, Freizeit und <strong>Computer</strong>. In: Spektrum Freizeit. Forum für Wissenschaft, Politik und<br />
Praxis, 2<strong>1.</strong> Jg. (1999), Heft 1, S. 56-76.<br />
Hentig, H. (1993). Die Schule neu denken. Eine Übung in praktischer Vernunft. München: Hanser Verlag.<br />
Hüffel, C. (1996) Die Massenmedien in unserer Gesellschaft. Buchklub, Wien.<br />
Jechle, Th. (2001). Didaktisches Design von Lernmedien, Skriptum Donau-Uni, Krems.<br />
Jürgens, E. (1994). Die ´neue´ Reformpädagogik und die Bewegung Offener Unterricht. Theorie, Praxis und<br />
Forschungslage. (<strong>1.</strong> Auflage). Sankt Augustin: Academia-Verlag.<br />
Kamper, G. (1989). Analphabetismus trotz Schulbesuchs – Strategien seiner Überwindung, Referats Expose´ für<br />
Enquete-Bericht, Wien, Hrsg.: Arbeiterkammer Wien.<br />
Kepser, M. (1999). Massenmedium <strong>Computer</strong>, D-Punkt. Bad Krozingen.<br />
Kl<strong>im</strong>sa, P. (1993): Lernpsychologische Perspektiven. Zur kognitions- und lernpsychologischen Voraussetzungen der<br />
Nutzung neuer Medien. In: Neue Medien und Weiterbildung. Weinhe<strong>im</strong>: Deutscher Studienverlag<br />
Lehmann, J & Lauterbach, R.: Die Wirkungen des <strong>Computer</strong>s in der Schule auf Wissen und Einstellungen. LOG IN,<br />
1985.<br />
Lehrplan 99; Deutsch (www.eduhi.at). Arbeitsgruppe des BmfUK. (1990).<br />
Mandl, H. & Hron, A. (1985). Förderung kognitiver Fähigkeiten und des Wissenserwerbs durch<br />
computerunterstütztes Lernen. In: Bosler U.(Hrsg), Mikroelektronik und neue Medien <strong>im</strong> Bildungswesen. u.a.<br />
Kiel. Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften.<br />
<strong>Pramper</strong>, W. (1992). <strong>Der</strong> <strong>Computer</strong> als der bessere Rechtschreiblehrer, Univ.-Veröffentlichung zum Referat in<br />
Kaposvar.<br />
<strong>Pramper</strong>, W. (1992). Neue Tendenzen und Technologien <strong>im</strong> <strong>Deutschunterricht</strong> der Zehn- bis Vierzehnjährigen in<br />
Österreich, Veritas.<br />
<strong>Pramper</strong>, W. (1997). Lehrerheft für die Deutschstunde. Veritas. Linz.<br />
<strong>Pramper</strong>, W. (1999). Die Rechtschreiblernmaschine. Methoden, Beispiele und Kopiervorlagen. Wien: Verlag Hölder-<br />
Pichler-Tempsky.<br />
<strong>Pramper</strong>, W. (2002). Deutsch kre@tiv mit dem PC. Linz: Veritas. .<br />
<strong>Pramper</strong>, W. (2002 11) . Didaktik des computerunterstützten <strong>Deutschunterricht</strong>s für die 7. und 8. Schulstufe. Linz:<br />
Veritas. .<br />
Raun, M. (1987). Lernbehinderte trainieren Rechnen und Rechtschreiben auf dem <strong>Computer</strong>. In: Hameyer, U., u.a<br />
(Hrsg).: <strong>Computer</strong> an Sonderschulen. Weinhe<strong>im</strong>.<br />
Reiter, A. / Rieder, A. (1990). Didaktik der Informatik. Informations- und kommunikationstechnische<br />
Grundbildung. Wien: Jugend und Volk.<br />
Staud, D. (1989). Beschreibung und Bewertung pädagogischer Software, Arbeitsgruppe EDV an Pädagogischen<br />
Akademien. BMUK, Wien.<br />
Tacke, G., Nock, H.& Staiber, W. (1987). Rechtschreibförderkurse in der Schule: Wie erfolgreich sind sie, und<br />
welche Faktoren tragen zur Leistungsverbesserung bei? Zeitschrift für Pädagogische Psychologie. Bern, Stuttgart,<br />
Toronto.