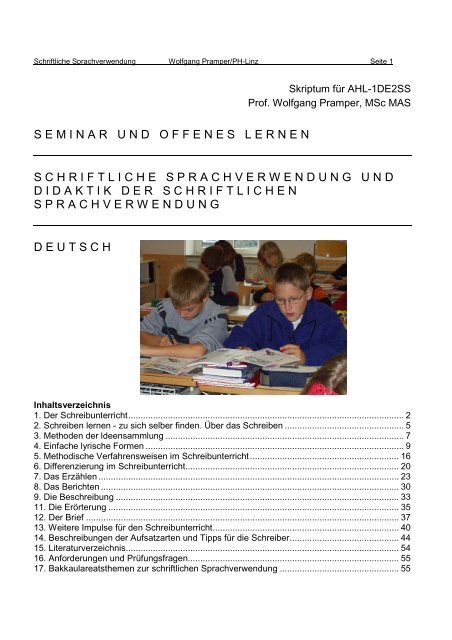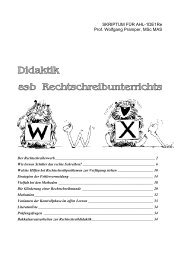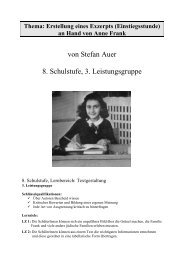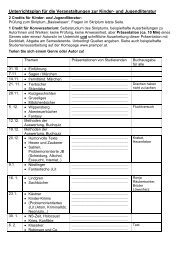SCHRIFTLICHE SPRACHVERWENDUNG - Wolfgang Pramper
SCHRIFTLICHE SPRACHVERWENDUNG - Wolfgang Pramper
SCHRIFTLICHE SPRACHVERWENDUNG - Wolfgang Pramper
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Schriftliche Sprachverwendung <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong>/PH-Linz Seite 1<br />
S E M I N A R U N D O F F E N E S L E R N E N<br />
Skriptum für AHL-1DE2SS<br />
Prof. <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong>, MSc MAS<br />
S C H R I F T L I C H E S P R A C H V E R W E N D U N G U N D<br />
D I D A K T I K D E R S C H R I F T L I C H E N<br />
S P R A C H V E R W E N D U N G<br />
D E U T S C H<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
1. Der Schreibunterricht............................................................................................................... 2<br />
2. Schreiben lernen - zu sich selber finden. Über das Schreiben ................................................ 5<br />
3. Methoden der ldeensammlung ................................................................................................ 7<br />
4. Einfache lyrische Formen ........................................................................................................ 9<br />
5. Methodische Verfahrensweisen im Schreibunterricht............................................................ 16<br />
6. Differenzierung im Schreibunterricht...................................................................................... 20<br />
7. Das Erzählen ......................................................................................................................... 23<br />
8. Das Berichten ........................................................................................................................ 30<br />
9. Die Beschreibung .................................................................................................................. 33<br />
11. Die Erörterung ..................................................................................................................... 35<br />
12. Der Brief .............................................................................................................................. 37<br />
13. Weitere Impulse für den Schreibunterricht........................................................................... 40<br />
14. Beschreibungen der Aufsatzarten und Tipps für die Schreiber............................................ 44<br />
15. Literaturverzeichnis.............................................................................................................. 54<br />
16. Anforderungen und Prüfungsfragen..................................................................................... 55<br />
17. Bakkaulareatsthemen zur schriftlichen Sprachverwendung ................................................ 55
Schriftliche Sprachverwendung <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong>/PH-Linz Seite 2<br />
1. Der Schreibunterricht<br />
1. 1 Geschichtliche und gegenwärtige Aspekte des Aufsatzunterrichts<br />
Punkt 1: Selbststudium<br />
(1) Imitationsaufsatz<br />
Im Mittelalter: Fleißiges Auswendiglernen und Anwenden sprachlicher Musterstücke.<br />
(2) Reproduktionsaufsatz<br />
Bis zum 19. Jhdt. Starres Gliederungsschema ist vorgegeben. Moralische Inhalte zur Belehrung der<br />
Zöglinge.<br />
(3) Produktionsaufsatz<br />
Anfang 20. Jhdt. Kind als „Künstler“ darf erstmals von seinen eigenen Erfahrungen berichten. Ein „freier“<br />
Aufsatz in einer „gebundenen“ Form. Einleitung, Hauptteil, Höhepunkt, Schluss<br />
(4) Sprachgestaltender Aufsatz<br />
20iger Jahre. Gedanklicher Entfaltungsraum, aber Beibehaltung der Grundgestaltungsformen: Bericht,<br />
Erzählung, Beschreibung, Schilderung, Erörterung. Synthese zwischen Inhalt und Form wird<br />
angestrebt.<br />
(5) Kommunikativer Aufsatz<br />
Formen und Stilvorgaben werden in Frage gestellt. Ein adressatenbezogener und situationsbezogener<br />
Aufsatzunterricht. Textsortenvielfalt angestrebt. Texte, die kindgemäß einzuüben sind.<br />
(6) Emanzipatorischer Aufsatz<br />
Aufsatzerziehung als Auftrag zur Gesellschaftskritik. Sehr kognitiv, viele appellative Texte, wenig<br />
emotional, wenig fabulative Texte.<br />
(7) Kreativer Aufsatzunterricht<br />
Angstfreies, schöpferisches Schreiben mit viel Zeit, Freiheit, Bestätigung, ohne Zwänge. Spiele mit<br />
Sprache, Phantasieaufsätze, Gedichte.<br />
(8) Kognitiver Aufsatzunterricht<br />
Ablehnung des kreativen Schreibens. Schreiben „für sich und über sich“. Sachbezogenes Schreiben<br />
(Inserate, Bewerbungsschreiben, Kontaktanzeigen, Notizen, „Ich-Hefte“.<br />
(9) Freies Schreiben<br />
Reform von unten, aus der Praxis (Freinet-Pädagogik), nicht von Sprachwissenschaftlern: Schreiben<br />
ohne jeden Zwang und ohne jede Formvorgabe. (Wo sie wollen, wann sie wollen, wie sie wollen)<br />
Projekte im Schreibunterricht. Klassenzeitungen. Mit dem Lehrplan schwer vereinbar.<br />
(10)Integrierender Aufsatzunterricht<br />
Der integrierende (integrative) Aufsatzunterricht versucht die positiven Ansätze seit den 70iger Jahren<br />
zusammenzufassen.<br />
Die einzelnen Ansätze in der Aufsatzerziehung haben einander nicht abgelöst, sondern in der jeweiligen<br />
Epoche durch neue Ideen ergänzt. Heute haben wir mit dem integrierenden Aufsatzunterricht eine<br />
sehr breite Vielfalt an Schreibhaltungen. Wichtig sind<br />
• kindgemäße Schreibanlässe (Erlebnisse in der Freizeit, Schule, Probleme, etc.),<br />
• kindgemäße Schreibformen (zu den herkömmlichen gebundenen Texten wie Erzählung, Bericht,<br />
Erörterung etc. kommen Leserbrief, Exzerpt, Gedicht, Fabel, Werbung, Märchen, Fabuliertes,<br />
auch Mischformen der verschiedenen Stile, etc.),<br />
• kindgemäßer Adressatenbezug (Schreiber selbst, Lehrer, Mitschüler, Eltern, Vertreter der<br />
Gemeinden, Unbekannte, etc.)<br />
• genaue Information über die Besonderheiten der Textsorte und Kenntnis vorbildhafter Texte.
Schriftliche Sprachverwendung <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong>/PH-Linz Seite 3<br />
1. 2 Die gegenwärtigen Schreibtheorien<br />
In den 80er Jahren entstand der „integrative Schreibansatz“. Dabei handelt es sich um die Überlegung,<br />
dass das Schreiben sowohl eine ständige Weiterentwicklung des Schreibers in bezug auf seine<br />
Selbsterfahrung als auch auf seine Schreibkompetenz bringt. Ziel ist somit der Prozess und nicht ein<br />
angestrebtes, aber vielleicht nie erreichbares Ziel.<br />
Das kreative Schreiben hat viele neue Techniken mit sich gebracht, die die Entwicklung des Schreibens<br />
wirkungsvoll unterstützen: Methoden der Themenfindung, besondere Schreibstimuli, vielfältige<br />
Schreibtechniken.<br />
Arbeitsschritte: 1. Textanregungen, 2. Schreiben, 3. Textarbeit, Überarbeitung.<br />
1. 3 Überarbeitungsphase<br />
Überarbeitung wird mit kritischer Kontrolle, Abwertung und Enttäuschung assoziiert. Die Phase muss<br />
zwar auf eine Verbesserung des sprachlichen Ausdrucks, Überprüfung des Satzbaus und des Aufbaus<br />
zielen, jedoch ist nicht zwangsläufig eine Beurteilung und Abwertung damit verbunden. Die „Erstfassung“<br />
eines Aufsatzes sollte immer als „Rohfassung“, die „Reinschrift“ als „Endfassung“ gesehen werden.<br />
Neben der Lehrerberatung soll auch die Kompetenz der Gruppe eingebracht werden.<br />
• Schüler beraten nach dem Vorlesen, wie der Text verbessert werden könnte.<br />
• Schüler notieren sich Gedanken, Formulierungen, Sätze beim sehr langsamen Vorlesen und fertigen<br />
dann eine schriftliches „Gutachten“ zur Verbesserung an.<br />
• Schüleraufsätze werden getauscht, der „Zweitleser“ korrigiert mit Bleistift Fehler, Stilmängel, etc. und<br />
bemüht sich, wie ein Lehrer einen kritischen, aber aufmunternden verbalen Kommentar drunter zu<br />
schreiben.<br />
• Nach dem Vorlesen versuchen einen „Verteidiger“ und ein „Ankläger“ die positiven und negativen<br />
Aspekte der Arbeit darzustellen.<br />
• Ein Schüler liest einen fremden Aufsatz vor und stellt sich der Kritik der Klasse. Der eigentliche Autor<br />
bleibt ungenannt.<br />
• Ein vorgelesener Text wird von jedem Schüler mit einem Satz kommentiert. Jeder Schüler liest, was<br />
vor ihm bereits geschrieben wurde, er darf nichts bereits Erwähntes schreiben. Zeitaufwendig, die<br />
Schüler müssen daneben eine andere Arbeit (Verbesserung, Übung) haben.<br />
• Ein „Zweitleser“ hat die Aufgabe alle Wörter in einem Text durchzustreichen, die ihm „nicht gefallen“<br />
(Rechtschreibung, Ausdruck, Stil, Wortwiederholung,..), mindestens 20 Wörter. Diese Wörter müssen<br />
bei der Überarbeitung ersetzt werden.<br />
1. 4 Freies Schreiben - befreiendes Schreiben<br />
Eine beherrschende Idee, was Literatur sein soll und welches Niveau sie haben soll, kann zum<br />
Schreibhindernis werden, anstatt zum Schreiben zu motivieren. Gerade mit der Orientierung an der<br />
„Hochliteratur“ erwirbt jeder Schulabsolvent ein literarisches Minderwertigkeitsgefühl, ein literarisches<br />
„Über-Ich“. Die Folge des Literatur- und Schreibunterrichts sind daher oft Schreibblockaden. Jürgen<br />
Scheidt gibt dazu folgende Aspekte an:<br />
1. Der ständige Zwang, fehlerlos zu schreiben, stellt die Form höher als den Inhalt.<br />
2. Schule ist ziel- und zweckorientiert und grenzt daher spielerische Phantasie aus.<br />
3. Noten zerstören eine kreative Unbefangenheit.<br />
4. Kreative Gruppenarbeit wird beim Schreiben kaum gepflogen, hingegen konkurrenzlerische<br />
Vereinzelung.
Schriftliche Sprachverwendung <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong>/PH-Linz Seite 4<br />
5. Die Arbeit in der Schule ist kopflastig, abstrakt, intellektuell. Die kreative linke Gehirnhälfte, der<br />
Körper, die Alltagssprache sind verpönt.<br />
(Vgl. Jürgen Scheidt: Kreatives Schreiben, Frankfurt 1989, 88ff)<br />
Formen des freien, kreativen, kooperativen Schreibunterrichts sind<br />
• Schreibprojekte (siehe „Ferien auf Burg Finstergrün“ in der „Deutschstunde 2“) • Märchen,<br />
Tiergeschichten schreiben • Kinderbücher schreiben • Hefte über Skikurse, Wien-Wochen, Literatur-<br />
Klassen-Hefte.<br />
Eine Form des freien, kreativen Schreibens ist das<br />
Therapeutisches Schreibspiel<br />
• Fremdes Tier. Stell dir vor, du wärst ein fremdes Tier, beschreibe sein Aussehen und was es mit<br />
seiner Familie erlebt!<br />
• Zaubergarten. Denk an einen Zaubergarten oder Zauberwald und beschreibe einen Weg durch ihn!<br />
• Neue Perspektive. Stell dir vor, du bist noch ganz klein. Beschreibe, wie du die Welt siehst und was<br />
du am Morgen erlebst!<br />
• Frühere Existenz. Stell dir vor, du hast schon einmal gelebt. Beschreibe dein früheres Leben!<br />
• Unsichtbar. Stell dir vor, du kannst dich unsichtbar machen. Beschreibe, was du dabei erlebst!<br />
• Angsttraum. Beschreibe einen schlimmen Angsttraum, und erfinde ein glückliches Ende dazu!<br />
• Zukunftstraum. Träume von deiner Zukunft und beschreibe sie!<br />
• Schlüssel. Du hast einen Schlüssel für eine geheime Tür. Öffne sie und beschreibe, was du dahinter<br />
findest!<br />
Diese Schreibspiele helfen bei der Rekonstruktion und Aufarbeitung der eigenen Lebensgeschichte. Sie<br />
machen wichtige Lebensphasen dem Bewusstsein wieder bekannt. Verdrängte Erfahrungen werden<br />
durch die Auseinandersetzung beim Niederschreiben aufgearbeitet. Nicht der Kommentar durch den<br />
Lehrer oder Mitschüler ist hier bedeutend, sondern die eigene Auseinandersetzung. Ähnlich wie das<br />
Schreiben eines Tagebuches, das heute leider viel zu wenig gefördert wird, besitzt diese Schreibformen<br />
eine psychohygienische Wirkung. (Redeweise: „sich etwas von der Seele schreiben“)<br />
(mehr in Lutz von Werder: Lehrbuch des kreativen Schreibens, 123ff)
Schriftliche Sprachverwendung <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong>/PH-Linz Seite 5<br />
2. Schreiben lernen - zu sich selber finden. Über das Schreiben<br />
2. 1 Zielsetzung<br />
Im Rahmen des Seminars Schriftliche Sprachverwendung soll vorwiegend eine<br />
Auseinandersetzung mit jenen Textsorten stattfinden, die Unterrichtsinhalt der Hauptschule<br />
sind. Dazu werden<br />
• beispielhafte Texte vorgestellt<br />
• Sprachmittel analysiert<br />
• und Texte produziert<br />
2. 2 Funktionen der Schrift und des Schreibens<br />
Wer? An wen?<br />
Sender Schreiber TEXT Leser Empfänger<br />
Absicht Wirkung<br />
THEMA<br />
Schrift dient der Kommunikation und der Konservierung von sprachlicher Information. Mit<br />
einem vereinbarten, festgelegten Zeichensystem werden Informationen auf einen Träger<br />
geschrieben und somit chiffriert und können von diesem wieder abgelesen, sprich dechiffriert<br />
werden. Vor der Entwicklung der Schrift war Jahrtausende lang die mündliche Überlieferung<br />
von wesentlichen Inhalten üblich. Sie barg schon immer gewisse Risiken in sich. Eine mögliche<br />
Sinnentstellung des ursprünglichen Quelleninhaltes und das Weglassen oder Hinzufügen von<br />
Inhalten sind in der mündlichen Vermittlung des jeweils einzelnen Erzählers immanent<br />
enthalten. Psychologische, soziale und kulturelle Faktoren spielen bei der mündlichen<br />
Überlieferung eine wesentliche Rolle. Die wortwörtliche Wiedergabe an nachfolgende<br />
Generationen trägt dazu bei, eigene Kultur und Werte zu bewahren, und charakterisiert zugleich<br />
eine Besonderheit dieser Kultur. Gemeinsam mit der Fähigkeit des Lesens bilden Schreiben,<br />
Schrift und Rechnen die Grundlage von Tradition, Kultur und Bildung durch die<br />
mittelbare Weitergabe von Wissen. Die Erfindung der Schrift gilt als eine der wichtigsten<br />
Errungenschaften der Zivilisation, da sie die Überlieferung von Wissen und kulturellen<br />
Traditionen über Generationen hinweg erlaubt, und deren Erhaltung (je nach Qualität des<br />
beschrifteten Materials) über einen langen Zeitraum garantiert.<br />
Schreiben dient auch der intrapersonalen Kommunikation, das verwendet wird, um ein Thema<br />
zu erfassen bzw. Klarheit zu gewinnen, um Gedanken für sich festzuhalten. In diesem Fall<br />
braucht man keine Rücksichten auf einen anderen Leser, die formalen Bedingungen und<br />
üblichen Textsortenkriterien zu nehmen, zB. bei Tagebuch, Mitschrift, Exzerpt, Einkaufszettel.<br />
Dabei kann jeder seinen eigenen Code entwickeln, wichtig ist nur, dass man selbst das<br />
Geschriebene selber wieder entschlüsseln kann.
Schriftliche Sprachverwendung <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong>/PH-Linz Seite 6<br />
2. 3 Darstellungsformen des Schreibens<br />
Der kommunikationstheoretische Ansatz geht von der Absicht (= lntention) aus, die der<br />
Schreiber verfolgt, wenn er ein Schriftstück verfasst. Je nach Absicht entstehen<br />
unterschiedliche Darstellungsformen.<br />
INTENTION DARSTELLUNGSFORM<br />
Informieren in Kenntnis setzen durch ästhetisch verändertes Darstellen:<br />
Erzählungen unterschiedlicher Art, Sprachspiele, Gedichte, Spieltexte,<br />
Literatur, …<br />
in Kenntnis setzen durch sachliches Berichten / Beschreiben:<br />
Unfallmeldung, Gebrauchsanweisung, Spielanleitung, Rezept,<br />
Steckbrief, Suchmeldung, Zeitungsbericht, Inhaltsangabe, Protokoll,<br />
Bericht,…<br />
Appellieren sich an jemanden mit Absichten wenden:<br />
Leserbrief, persönl. Brief, Bewerbungsschreiben, Werbetext, Gesuch,<br />
Wahlrede, Empfehlungsschreiben,…<br />
Kommentieren kognitives Darstellen und Bewerten:<br />
Erörterung, Interpretation, Glosse, Leitartikel, Kommentar, Rezension,<br />
Essay,…<br />
Je nach Inhalt, Adressat, situativem Zusammenhang oder Intention des Schreibers werden<br />
Texte in einer sachlichen, erlebnishaften oder bewertenden Sprache geschrieben. Diese<br />
traditionelle Beschreibungsform entspricht nicht immer ganz der Lebenswirklichkeit, für die<br />
Schulpraxis bietet sie immer noch sehr brauchbare Ansätze.<br />
2. 4 Textsorten für die Schule<br />
Bilderzählung,<br />
Bildgeschichten-Erzählung<br />
Buchbeschreibung,<br />
Inhaltsangabe<br />
Charakteristik<br />
Dialog<br />
Erörterung<br />
Erzählfortsetzung,<br />
Erzählkerne ausbauen<br />
Exzerpt<br />
Fabel<br />
Facharbeit (Sachtext mit ca.<br />
3 Quellen)<br />
Fantasie-Erzählung<br />
Filmkritik<br />
Gedicht (Elfchen,…)<br />
Gegenstandsbeschreibung<br />
Glosse<br />
Ich/Er/Sie- Erlebniserzählung<br />
Innerer Monolog<br />
Interview<br />
Kochrezept, Hexenrezept<br />
Kommentar<br />
Kurzgeschichte<br />
Lügengeschichte<br />
Märchen<br />
Märchenfortsetzungen<br />
Märchenumformungen,<br />
Slangmärchen,<br />
Verwirrmärchen<br />
Münchhausen-,<br />
Eulenspiegelgeschichte<br />
Nacherzählung<br />
Nachruf<br />
Normbriefe, Lebenslauf,<br />
Bewerbung<br />
Offener Schluss Geschichte<br />
Parodie<br />
Personsbeschreibung<br />
Perspektivenwechsel in<br />
Erzählungen<br />
privater Brief<br />
Rahmenthema<br />
Erlebniserzählung<br />
Rätsel (Tiere, Figuren,..)<br />
Reizwortgeschichte<br />
Erlebniserzählung<br />
Sage erfinden<br />
Spiel-, Betriebsanleitungen<br />
Steckbrief, Suchmeldung<br />
Textumformungen (Ballade in<br />
Erzählung,…)<br />
Tier-Erzählung,<br />
Verwandlungen (in ein Tier)<br />
Tierbeschreibung<br />
Wegbeschreibung<br />
Werbemärchen<br />
Zeitübertragungen<br />
(Sage/Märchen heute)<br />
Zeitungsbericht
Schriftliche Sprachverwendung <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong>/PH-Linz Seite 7<br />
3. Methoden der ldeensammlung<br />
In den 1970er Jahren wurden fast zur gleichen Zeit zwei heute grundlegende<br />
Kreativitätsmethoden entwickelt: Ab 1971 hat TONY BUZAN sein Mind Map-Konzept entwickelt<br />
und Anfang der 80er Jahre mit "Use your brain" einer breiteren Öffentlichkeit vorgestellt. Ebenfalls<br />
Anfang der 80er Jahre erschien "Writing the natural way" von GABRIELE L. RICO, in der sie<br />
einen Schreibkursus auf der Grundlage der von ihr entwickelten Clustermethode vorstellte.<br />
Beide Konzepte werden oft verwechselt: Im Zentrum steht jeweils ein umkreister Kernbegriff. Von<br />
diesem führen Linien zu weiteren Wörtern. Dabei kann ein weit verzweigtes System von Linien<br />
entstehen.<br />
Der Grundgedanke beider Methoden ist, das übliche lineare Denken aufzubrechen und durch den<br />
Einsatz grafischer Elemente begriffliches und bildliches Denken miteinander zu verbinden.<br />
Tony Buzan beruft sich beim Mindmapping auf die Erkenntnisse der neueren Hirnforschung. Die<br />
Methode orientiert sich daran, wie uns Ideen einfallen und wie wir Denkprozesse entwickeln:<br />
zunächst spontan und ungeordnet, dann logisch ordnend und weiterführend. Im Unterschied zum<br />
Cluster werden beide Hirnhälften in gleicher Weise aktiviert.<br />
Die Mindmap ist ein Sprungbrett für einen zu schreibenden Text. Mindmaps lassen sich für viele<br />
Zwecke einsetzen: zum Konzipieren längerer Texte oder ganzer Bücher, zum Visualisieren eines<br />
Referates in freier Rede oder als Lernhilfe. Alle Bereiche, in denen Kategorisierung,<br />
Hierarchisierung und Strukturierung nötig ist, sind prinzipiell mit einer Mindmap bearbeitbar.<br />
Beispiel:<br />
Die Erfinderin des Clusters, Gabriele L. Rico, geht davon aus, dass wir in unserem Gedächtnis<br />
unzählige Ereignisse, Gedanken, Gefühle, Ideen und Bilder gespeichert haben, an die wir durch
Schriftliche Sprachverwendung <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong>/PH-Linz Seite 8<br />
gezieltes Denken kaum herankommen. Durch die Cluster-Methode kann Verschüttetes und<br />
Vergessenes (Träume etwa) reaktiviert werden.<br />
http://www.berlinerzimmer.de/heins/heins_cluster.htm<br />
Ein Cluster soll ohne Zeitdruck entstehen, sodass auf der Basis des freien Assoziierens sich<br />
immer wieder neue Ideen entwickeln lassen.<br />
Das fertige Cluster dient als Grundlage für Gedichte und Prosatexte und wird vor allem beim<br />
kreativen Schreiben eingesetzt. — Dabei werden jene Begriffsbündel herausgegriffen, die einen<br />
stimmigen Text ergeben.<br />
Legen Sie zum Thema „Aufsatzerziehung in der Schule“ eine Mindmap an!<br />
Legen Sie zum Aufsatzthema „Überraschung“ einen Cluster an!
Schriftliche Sprachverwendung <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong>/PH-Linz Seite 9<br />
4. Einfache lyrische Formen<br />
A 1 Stellen Sie zu den Textbeispielen acht ähnliche Gedichte her! Gestalten Sie sie sauber<br />
als Handschrift oder mit dem PC!<br />
Das Neunerl besteht aus neun Wörtern:<br />
1.,2., 3., 4. Zeile: 2 Wörter<br />
5. Zeile: 1 Wort<br />
Das Stufengedicht:<br />
1. Zeile: 1 Wort (meist Nomen o.<br />
Pronomen)<br />
2. Zeile: 2 Wörter<br />
3. Zeile: 3 Wörter<br />
4. Zeile: 4 Wörter<br />
5. Zeile: 3 Wörter<br />
6. Zeile: 2 Wörter<br />
7. Zeile: 1 Wort<br />
Das Elfchen besteht aus elf Wörtern:<br />
1. Zeile: 1 Wort<br />
2. Zeile: 2 Wörter<br />
3. Zeile: 3 Wörter<br />
4. Zeile: 4 Wörter<br />
5. Zeile: 1 Wort<br />
Unerwartetes bitteres Ende<br />
Die ersten fünf Zeilen bestehen nur aus<br />
Adjektiv und Nomen,<br />
aber:<br />
dann die überraschende Wende.<br />
Mögliche Überschriften: Geburtstag, Füllfeder,<br />
neuer Fußball, Schule, Feiertag,...<br />
Traurige Geschichten<br />
Tausend Weisheiten<br />
Tollkühne Helden<br />
Tiefe Sehnsucht<br />
Bücher<br />
Dominic Latscha<br />
Ich<br />
lese gern<br />
ganz dicke Bücher,<br />
auch mit spannendem Inhalt.<br />
Dann kann ich<br />
nicht mehr<br />
aufhören.<br />
August<br />
Urlaubsfrische Lehrerin<br />
neuer Schwung<br />
tolle Ideen<br />
viel Kreide<br />
eine gelöschte Tafel<br />
aber:<br />
noch keine Schüler<br />
Dunja Holzer<br />
Gespräch<br />
leise Worte<br />
in der Dunkelheit<br />
zwei in der Nacht<br />
Mondschein<br />
Susanne Pumberger<br />
Ausflug<br />
Neues Rad<br />
blitzendes Chrom<br />
schöne Landschaft<br />
angenehme Temperaturen<br />
eine lustige Gruppe
Schriftliche Sprachverwendung <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong>/PH-Linz Seite 10<br />
Das Haiku ist eine seit dem 13. Jh. in<br />
Japan weit verbreitete Dichtungsform, die<br />
bis heute lebendig geblieben ist, ständig<br />
neu gestaltet und veröffentlicht wird. Es ist<br />
an folgenden Merkmalen erkennbar:<br />
1. Zeile: 5 Silben<br />
2. Zeile: 7 Silben<br />
3. Zeile: 5 Silben<br />
Inhalt sind Bilder, Bewegungen,<br />
Stimmungen aus dem Bereich der Natur<br />
im Wechsel der Jahreszeiten, die wie<br />
Augenblicksaufnahmen festgehalten<br />
werden. Der Zauber der Haiku-Dichtung<br />
liegt darin, innerhalb dieser streng<br />
festgelegten formalen Gestaltungsregel<br />
das Lebendige, Besondere und Einmalige<br />
des eingefangenen Augenblickes oder<br />
Bildes vor den Augen und Sinnen der<br />
Hörer/innen lebendig werden zu lassen.<br />
Mit knappen treffenden Worten wird so<br />
aus der Vielfalt der Natur ein Bild<br />
herausgehoben. Das Metrum ist frei, auf<br />
jegliche Form der Reimbildung wird<br />
verzichtet.<br />
Zeilenkomposition durch<br />
Zeilenumbrechen: die Verszeile als<br />
Gestaltungsmittel.<br />
Beim Zeilenumbrechen werden die<br />
Satzzeichen außer Acht gelassen!<br />
Gestalten Sie die zwei Texte unten<br />
nach eigenem Gutdünken!<br />
Humorlos<br />
Die Jungen werfen zum Spaß mit Steinen<br />
nach Fröschen. Die Frösche sterben im<br />
Ernst.<br />
Angst und Zweifel<br />
Zweifle nicht an dem, der dir sagt, er hat<br />
Angst. Aber hab Angst vor dem, der dir<br />
sagt, er kennt keinen Zweifel.<br />
Zusätzliche Bedingung<br />
Wichtig ist nicht nur, dass ein Mensch das<br />
aber:<br />
keine Luft im Reifen<br />
Im Reif am Bambus<br />
Im Morgenlichte plustert<br />
Der erste Spatz sich.<br />
Takehsi<br />
Sogar das Licht steht<br />
Ganz unbewegt und kreisrund:<br />
Die Winterstille.<br />
Jaha<br />
Humorlos<br />
Die Jungen<br />
werfen<br />
zum Spaß<br />
mit Steinen<br />
nach Fröschen<br />
die Frösche<br />
sterben<br />
im Ernst
Schriftliche Sprachverwendung <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong>/PH-Linz Seite 11<br />
Richtige denkt, sondern auch, dass der,<br />
der das Richtige denkt, ein Mensch ist.<br />
Rhythmus und Reim als Gestaltungsmittel<br />
Machen Sie aus diesem Text ein<br />
Gedicht mit Endreim!<br />
Das ästhetische Wiesel<br />
Ein Wiesel saß auf einem Kiesel inmitten<br />
Bachgeriesel. Wisst ihr weshalb? Das<br />
Mondkalb verriet es mir im Stillen: Das<br />
raffinierte Tier tat‘s um des Reimes willen.<br />
Christian Morgenstern<br />
Verszeilen ordnen<br />
Achtung, hier sind die Verszeilen<br />
durcheinander geraten! Schaffen Sie<br />
Ordnung!<br />
Im Park<br />
Ein ganz kleines Reh stand am ganz kleinen<br />
Baum<br />
Und da war es aus Gips.<br />
Das war des Nachts um elf Uhr zwei.<br />
Und dann kam ich um vier<br />
Und da träumte noch immer das Tier.<br />
Still und verklärt wie im Traum.<br />
Nun schlich ich mich leise — ich atmete kaum<br />
—<br />
Und gab dem Reh einen ganz kleinen Stips.<br />
Gegen den Wind an den Baum,<br />
Morgens vorbei.<br />
Joachim Ringelnatz<br />
Strophen richtig stellen<br />
Hier sind Strophen durcheinander geraten. Stellen<br />
Sie sie an den richtigen Platz!<br />
Gefunden<br />
Johann <strong>Wolfgang</strong> von Goethe<br />
Ich grub’s mit allen<br />
Den Würzlein aus.<br />
Zum Garten trug ich’s<br />
Am hübschen Haus.<br />
Im Schatten sah ich<br />
Ein Blümchen stehn,
Schriftliche Sprachverwendung <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong>/PH-Linz Seite 12<br />
Wie Sterne leuchtend,<br />
Wie Äuglein schön.<br />
Ich wollt es brechen,<br />
Da sagt es fein:<br />
Soll ich zum Welken<br />
Gebrochen sein?<br />
Und pflanzt es wieder<br />
Am stillen Ort;<br />
Nun zweigt es immer<br />
Und blüht so fort.<br />
Ich ging im Walde<br />
So für mich hin,<br />
Und nichts zu suchen,<br />
Das war mein Sinn.<br />
Verszeilen ergänzen<br />
In diesem Gedicht fehlen die gereimten<br />
Versenden. Ergänze Sie sie mit Hilfe der<br />
Wörter im Rahmen!<br />
springen � zerschmolz � zugefroren �<br />
stolz � breit � singen � Traum � verloren �<br />
Zeit � Raum<br />
Die Frösche<br />
Johann <strong>Wolfgang</strong> Goethe<br />
Ein großer Teich war ____________;<br />
Die Fröschlein, in der Tiefe __________,<br />
Durften nicht ferner quaken noch ______,<br />
Versprachen sich aber im halben ______:<br />
Fänden sie nur da oben ____________,<br />
Wie Nachtigallen wollten sie _________.<br />
Der Tauwind kam, das Eis __________,<br />
Nun ruderten sie und landeten ________<br />
Und saßen am Ufer weit und _________<br />
Und quakten wie vor alter ___________.<br />
Reimen mit Zahlen<br />
3 + 4 = 7<br />
Du hast mir einen Brief geschrieben<br />
7 + 1 = 8<br />
Der hat mich traurig gemacht.
Schriftliche Sprachverwendung <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong>/PH-Linz Seite 13<br />
8 + 2 = 10<br />
Willst mich nicht wiedersehen?<br />
10 – 6 = 4<br />
Es liegt dir nichts an mir!<br />
4 – 1 = 3<br />
OK, ich geb dich frei!<br />
3 - 2 = 1<br />
Aber Glück wünsche ich dir keins!<br />
Christine Nöstlinger<br />
Können Sie mit Zahlen reimen?<br />
Reimen mit Produktnamen<br />
Omo, Dash, Persil<br />
Radion, Fewa, Pril,<br />
Sunlicht, Tenn und Clu,<br />
und weiß bist du.<br />
Die Mutti in der Küche,<br />
der Papi trinkt sein Bier,<br />
die Omi vor dem Fernsehkasten,<br />
und wer spielt mit mir?<br />
Petersilie, Suppenkraut,<br />
wächst in unserm Garten.<br />
Parkplatz wird schon heut gebaut,<br />
Spielplatz kann noch warten.<br />
Wolf Harranth<br />
Gelingt Ihnen ein kleines Gedicht mit<br />
Produktnamen?<br />
Akrostikontechnik<br />
R i l k e<br />
G o e t h e<br />
K l e i s t<br />
B r e c h t<br />
H a n d k e<br />
Schreiben Sie solche Gedichte zu Kino,<br />
Lyrik, malen, Winter!<br />
Alphabetisches<br />
Was ich (nicht) mag<br />
Angeber
Schriftliche Sprachverwendung <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong>/PH-Linz Seite 14<br />
Bandwürmer<br />
Cliquen<br />
Dunkelkammer<br />
Extrawurst<br />
…<br />
Stellen Sie gegenüber: Was ich mag –<br />
nicht mag!<br />
Visuelle Poesie<br />
Die Wand<br />
Worte<br />
Worte<br />
Worte<br />
Worte<br />
Worte<br />
Worte<br />
Worte<br />
Worte<br />
Worte<br />
Worte<br />
Worte<br />
ICH Worte DU<br />
Gestalten Sie zu einem oder mehreren<br />
Begriffen ein visuelles Gedicht!<br />
Lift, Nicht alle Tassen im Schrank,<br />
Niemand zu Hause, einen in der Krone<br />
haben, Wurm in der Marille (Apfel),…<br />
Mundartgedichte<br />
I hob a radl griagd.<br />
A rods radl<br />
mid ana aufboganan lengstaungan<br />
und an stobliachd.<br />
Oba:<br />
Im hof kauni ned foan.<br />
Wegn da wesch vunda Schesdag<br />
und weus so schebad<br />
wauni ibas kaneugita foa."<br />
Christine Nöstlinger<br />
Verfassen Sie ein Mundartgedicht!
Schriftliche Sprachverwendung <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong>/PH-Linz Seite 15<br />
Für die Mundartschreibung gibt es weder Regeln noch Normen. In der Mundartdichtung haben<br />
sich zwei Schreibweisen etabliert.<br />
• Schreibung, die sich an den Schriftbildern der Standardsprache orientiert, soweit sie die<br />
Mundart nicht verfälscht. Die Lesbarkeit steht im Vordergrund.<br />
á steht bei Stelzhamer und in der traditionellen Mundartdichtung für das helle a (Mánderl,<br />
Bácherl [Bacharl])<br />
å steht für das dumpfe a (Wåsser [Woassa])<br />
• Schreibung, die das Schriftbild verfremdet und Schreibtraditionen bewusst missachtet. Ein<br />
neuer und bewussterer Zugang zu den Wörtern soll geschaffen werden, das<br />
Sprachspielerische steht im Vordergrund. Man bezeichnet diese Schreibung als<br />
phonetische Schreibung, da sie sich nach der tatsächlichen Artikulation der Laute<br />
orientiert. ([muada] für Mutter)<br />
Übertragen Sie diese Wörter in eine Form der Mundartschreibung!<br />
Vater, Wasser,<br />
lieb, Dieb, Knie,<br />
Gras<br />
fliegen<br />
meinen, heim,<br />
Stein, Ei, breit<br />
Wien, Riemen<br />
Bub, Mutter, gut,<br />
Blut<br />
träumen, nähen<br />
müde, Büchlein,<br />
Wald, elf, Bild,<br />
Glück, blühen<br />
Gold, Schuld,<br />
Schule<br />
Blümlein, grün böse, gewöhnen<br />
Harte Verschlusslaute werden an die weichen Verschlusslaute angeglichen, sodass es keinen<br />
Unterschied mehr gibt. (Die Ursache vieler Rechtschreibprobleme!)<br />
p > b Pech > Bech; Peter> Beda (oft kommt es aus einer Unsicherheit heraus auch zu<br />
hyperkorrekten Schreibungen wie im Ortsnamen Perg.<br />
t > d Tag > Dog; Wetter > Weda (Familiennamen verraten die Unsicherheit bei der Schreibung: Es<br />
gibt viele —torfer--- Eckerstorfer...)<br />
kn > gn Knödel > Gnel<br />
kr > gr Kragen > Grogn<br />
kl > gl klauben > glaum<br />
Weiche Verschlusslaute bleiben im Anlaut erhalten: beten,<br />
im Inlaut werden sie zu Reibelauten: Weiber > Weiwa, Weber > Wewa,<br />
im Auslaut verstummen sie ganz: Bub > Bua; Weib > Wei; genug > gnua;
Schriftliche Sprachverwendung <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong>/PH-Linz Seite 16<br />
5. Methodische Verfahrensweisen im Schreibunterricht<br />
UNBEKANNT<br />
Eingangsvoraussetzung: Die Textsorte ist dem Schüler<br />
einen idealen und typischen Text kennen lernen<br />
Analyse der Sprachmittel und Besonderheiten der<br />
Textsorte<br />
Einsicht in die Übertragbarkeit, Vorübungen zuerst<br />
mündlich, dann „halbschriftlich“; Wortfeldarbeit<br />
Produktion eines eigenen Textes<br />
Überarbeitung, Reinschrift<br />
BEKANNT<br />
5.1 Didaktische Gliederung einer Aufsatzstunde<br />
Erinnern an das Wichtigste der Textsorte<br />
Produktion eines eigenen Textes<br />
Präsentation. Beratung durch andere. Überprüfen, ob die<br />
besonderen Sprachmittel beachtet wurden<br />
Vergleich mit einem fremden Text dieser Textsorte<br />
Überarbeitung, Neugestaltung eines weiteren Textes<br />
1. Einstieg Motivation, Kennen lernen der Textsorte, Zielsetzung<br />
2. Vorbereitung Analyse der Sprachmittel, Übungen zu den Sprachmitteln, Vorbereiten<br />
des Inhaltes<br />
3. Textproduktion Angabe der Aufgabe, Differenzierung, Schreiben<br />
4. Weiterführung Überarbeitung, Lehrerkorrektur, Reinschrift, Weitere Textproduktionen<br />
ähnlicher Art<br />
5. 2 Unterrichtsbeispiel: Gedichte schreiben und vertonen<br />
Grobziel: Schüler erkennen die inhaltlichen und sprachlichen Gestaltungsmuster von Schlagern<br />
und können sie imitieren.<br />
Feinziele: Die Schüler zeigen im Unterrichtsgespräch kritische Distanz zum Schlagertext „Warum<br />
bin ich nicht geblieben?“ und reflektieren die eigene Liedliteratur.<br />
Die Schüler können an Beispielen die Unechtheit der Gefühle im Text aufzeigen, sie erkennen die<br />
Unterwertigkeit der Sprachverwendung, die Klischees und Reimkonstruktionen.<br />
Sie nehmen die wirtschaftlichen Interessen bei dem „Geschäft mit der Einsamkeit“ wahr.<br />
Sie erwerben Distanz zu unterwertiger Literatur, indem sie selbst unter Verwendung der<br />
erkannten Gestaltungsstrukturen ein kitschiges Liebesgedicht (Parodie) schreiben.
Schriftliche Sprachverwendung <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong>/PH-Linz Seite 17<br />
5. 3 Verlauf der Unterrichtseinheit<br />
1. Einstieg<br />
• Einstiegssituation: Ein kitschiges Liebeslied hören, bei dem die Distanzierung leicht fällt. Tonkassette:<br />
Darbieten des Liedes „Warum bin ich nicht geblieben?“ Kennen lernen der Textsorte: Lesen des Schlagers und<br />
kritisches Bewerten des Schlagers.<br />
Warum bin ich nicht geblieben?<br />
Warum bin ich nicht geblie-ie-ben?<br />
Wer wird mich noch einmal so lie-ieben?<br />
Mir ist erst heute klar.<br />
dass zuviel selbstverständlich war!<br />
Warum bin ich nicht gebie-ieben?<br />
Du hast mich nie abgeschrie-ieben!<br />
ich seh dich noch jetzt vor mir.<br />
wie du sagtest: „Bleib hier!"<br />
Es fiel im Moment nicht schwer,<br />
zu sagen: „Du. ich mag nicht mehr:<br />
dies ist aus, vorbei;<br />
es machte irgendwie nicht frei."<br />
Doch was du für mich wirklich bist<br />
und was für mich verloren ist,<br />
darüber denk ich nach und<br />
liege lange wach<br />
in einer Nacht wie heut.<br />
Sprecht über den Schlagertext!<br />
• Wirken die Gefühle echt? Begründe deine Einstellung zum Text! Fällt dir am Stil etwas auf? Z. B.: Reim, Zahl der<br />
Nomen, Füllwörter wie „irgendwie''. Warum werden solche Schlager geschrieben?<br />
Versucht diesen Schlager mit einer besonderen Stimme" zu lesen: weinerlich bzw. verärgert!<br />
• Zielsetzung: Auseinandersetzung mit den Hintergründen der Schlagerproduktion und Produktion eines<br />
eigenen Schlagertextes.<br />
Text: Geschäfte mit der Einsamkeit<br />
Interview mit Christian Anders<br />
Heiratsinstitute, Werbung und Schlagerstars machen mit der<br />
Einsamkeit Geschäfte. Einen Mann oder eine Frau fürs<br />
Leben vermittelt das Heiratsinstitut X - natürlich gegen ein<br />
kräftiges Honorar. Nie mehr allein, wenn man die Zahnpasta<br />
gegen Mundgeruch nimmt!, verspricht die Werbung. Fast alle<br />
Menschen fühlen sich irgendwann einsam, unverstanden,<br />
verlassen und minderwertig. Und so kann die Industrie viele<br />
Artikel verkaufen, die einem das Alleinsein zunächst<br />
erträglicher machen. Dazu gehören auch Schallplatten.<br />
Christian Anders verdient daran besonders gut, weil er seine<br />
Platten selbst produziert und singt. In Text und Musik macht<br />
er auf Einsamkeit und Romantik.<br />
Anders: Ich habe mir eine Traumwelt aufgebaut, denn ich<br />
finde die Welt der Romantik zehnmal schöner als die Welt<br />
der Realität! Auf die Welt pfeif ich, die interessiert mich gar<br />
nicht!<br />
Wüpper: Du kannst darauf pfeifen, weil du Geld hast. Aber<br />
die Leute, die deine Platten kaufen, müssen mit dieser Welt<br />
leben ...<br />
Anders: Und denen gefällt die Welt auch nicht. Viele davon<br />
sind unglückliche Menschen. Sie tun genau dasselbe, was ich<br />
tu: für diese drei bis sechs Minuten flüchten sie in eine<br />
absolute Traumwelt, aus der sie nachher - das gebe ich zu -<br />
vielleicht noch viel schlimmer erwachen. Das ist ein Problem,<br />
über das ich nicht nachdenke.<br />
Wüpper: Du siehst also auch für dich selbst keine<br />
Möglichkeiten, durch deine Arbeit eigene Probleme zu lösen?<br />
Anders: Es ist einfach so, dass ich vor der realen Welt<br />
schlichtweg Angst habe. Ich weiß keine Lösung aus den<br />
Problemen der Realität, weder für mich noch für andere. Es<br />
gibt für mich nur eine Lösung. Und das ist das Hineinflüchten<br />
in irgendeine Traumwelt. . .<br />
Christian Anders ist geschäftlich nicht so weltfremd, wie er sich<br />
gibt. Und er benutzt sehr gerne die Symbole des Reichtums. So<br />
fährt er im Rolls-Royce, goldmetallic, mit Chauffeur vor. Zum<br />
Wechseln hat er noch einen amerikanischen «Camaro». An<br />
Christian Anders ist nur eines anders: er gibt offen seine<br />
Masche zu. Er spielt einsam und romantisch auf Kosten der<br />
Leute, die seine Platten kaufen.<br />
• Erkenntnis: Aus wirtschaftlichen Interessen werden Minderwertigkeits- und Einsamkeitsgefühle beim Konsumenten<br />
(vor allem in der Werbung und Trivialindustrie) verstärkt, um den Absatz zu steigern.
Schriftliche Sprachverwendung <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong>/PH-Linz Seite 18<br />
Andere Konsumartikel, die auf ähnliche Bedürfnisse zielen (Deo, Seife, Hautcreme, Zahncreme, Wimmerlwasser,<br />
Zeitschriften, Medikamente, Filme,..)<br />
2. Vorbereitung<br />
• Analyse der Sprachmittel:<br />
Einfache Wortwahl (nur 2 Nomen), Füllwörter (irgendwie), Signalwörter (ich, du), rhetorische Fragen, erzwungene,<br />
holprige Reime, Alltagssprache (abgeschrieben), sinnentleerte Worthülsen (machte irgendwie nicht frei), Ausgleich<br />
der ungleichen Silbenzahl durch Dehnung (geblie-iben), Klischeehaftigkeit (abgegriffene, unechte Aussage;<br />
„Sehnsucht nach früher“)<br />
• Übungen zu den Sprachmitteln: Erkenntnis der Übertragbarkeit: Reimübungen<br />
geh'n<br />
wiederseh'n<br />
sehr<br />
wär'<br />
Strand<br />
dich<br />
kennt<br />
denk'<br />
• Vorbereiten des Inhaltes<br />
Eingrenzen der Themen von Schlagern. Liebesglück,<br />
Liebesunglück, Schmerz, Sehnsucht, Eifersucht<br />
Sammelt Ideen für besonders kitschige Schlager!<br />
Beispiele:<br />
• Zwei Socken haben sich fürs Leben gefunden<br />
• Liebeserklärung an das chromglänzende Fahrrad<br />
• Teddy muss Abschied nehmen<br />
______________________________________<br />
______________________________________<br />
______________________________________<br />
______________________________________<br />
Dichte weiter!<br />
Mein Herz gehört nur dir allein,<br />
In deinen Augen ich das fand,<br />
So einsam war der kleine rote Socken,<br />
Mein Teddy war das Liebste auf der Welt,<br />
3. Textproduktion<br />
Ein Liebesgedicht mit 10-14 Zeilen schreiben. Deutlich die Sprachmittel des trivialen Schlagers<br />
verwenden.
Schriftliche Sprachverwendung <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong>/PH-Linz Seite 19<br />
4. Weiterführung<br />
• Zuerst Partnerkontrolle, Fehlersuche. Dann Lehrerkontrolle, Überarbeitungshinweise. Danach Reinschrift<br />
mit Gestaltung (Rahmen).<br />
• Vertonen der Lieder als Partner HÜ, Musikunterricht. Differenzierung der Leistungsgruppen.<br />
• Weitere Textproduktionen ähnlicher Art. Beispiel: Bedauernswerte Tiere<br />
Der Panter<br />
Sein Blick ist im Vorübergehn der Stäbe so müd<br />
geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als<br />
ob es tausend Stäbe gäbe und hinter tausend<br />
Stäben keine Welt.<br />
Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte,<br />
der sich im allerkleinsten Kreise dreht, ist wie ein<br />
Tanz von Kraft um eine Mitte. in der betäubt ein<br />
starker Wille steht.<br />
Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille<br />
sich lautlos auf. — Dann geht ein Bild hinein, geht<br />
durch der Glieder angespannte Stille — und hört<br />
im Herzen auf, zu sein.<br />
Rainer Maria Rilke (Paris, 1908)<br />
Des grausliche Viech<br />
Sicha is a Schneckn ka schenes Tier,<br />
oba es kann ja salbst nix dafür.<br />
Mit de Katzerln modeln s' umadum,<br />
aber d' Schneckn bringan s' brutal oft um.<br />
Die Schneckn sekkiern s' und san zu erna<br />
gemein,<br />
weil s'n überall hinbickan, den grauslichen<br />
Schleim.<br />
Was täten wir machen,<br />
wann s' über uns lachen?<br />
Und nur weuf ma net die schenan san,<br />
uns glei umbringan tan!<br />
Da Herrgott hat alle Viacherl g'schaffen, drum soi<br />
ma a die schiachan leben lassen! Ja, sie hät's net<br />
leicht, njie schiache, bickate Schneckn!<br />
Andreas (13 Jahre, Hauptschule;<br />
Mundartgedicht)<br />
Kritische, höherwertige Liebeslieder: Stefanie Werger „Steppenwolf“, Udo Lindenberg „Ich lieb dich<br />
überhaupt nicht mehr“, Andre´ Heller: „Du, du, du“, Parodie: Fendrich „Zweierbeziehung“<br />
(<strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong> in: Deutsch 4, Veritas)<br />
A 2 Verfassen Sie ein Liebesgedicht oder ein Tiergedicht mit 10-14 Zeilen! Deutlich die Sprachmittel<br />
des trivialen Schlagers verwenden.
Schriftliche Sprachverwendung <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong>/PH-Linz Seite 20<br />
6. Differenzierung im Schreibunterricht<br />
Formen der Differenzierung im Schreibunterricht:<br />
a) durch die Sozialform (Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit)<br />
b) durch die Art der Hilfestellung (Lehrerhilfe, Tutorenhilfe, Impulse, zB. Textanfänge, WB)<br />
c) durch die Themen und Textsortenauswahl (Auswahlmöglichkeiten)<br />
ad a) Unterrichtsbeispiel zur Differenzierung durch die Sozialform<br />
Texte in Gruppenarbeit schreiben:<br />
Z.B. Kinderbücher für Volksschüler<br />
Vorbereitung: Kinderbücher lesen und analysieren.<br />
Feststellen der Themen, Sprachverwendung und<br />
Stilmittel.<br />
Die Aufgaben werden in den Gruppen verteilt:<br />
texten, schreiben, zeichnen, binden, überarbeiten,<br />
vortragend lesen, VS-Kindern vorstellen, Gespräche<br />
mit diesen führen.<br />
A 3 Gestalten Sie ein Kinderbuch!<br />
Zählt als vier Aufgaben!<br />
ad b) Beispiel 1: Unterrichtsbeispiel zur Differenzierung durch Textvorgaben<br />
A) Was wird geschehen? Setze die Geschichte fort!<br />
Gleich nach dem Mittagessen packte Kurt sein<br />
Badezeug zusammen und verabschiedete sich von<br />
seiner Mutter, „Sei bis spätestens sieben Uhr wieder<br />
zu Hause!" rief sie ihm noch nach. Er war auf dem<br />
Weg zum Bus, als er vor sich ein Auto sah, das<br />
offensichtlich Probleme hatte. Immer wieder versuchte<br />
der Fahrer, ein etwa vierzigjähriger, gut gekleideter<br />
Mann, das Fahrzeug zu starten. „Verdammt, so eine<br />
B) Vor einiger Zeit gab es in der Schule eine Bubenbande,<br />
die sich RATTLES nannte. Jeder Neuling, der<br />
in die Bande aufgenommen werden wollte, musste<br />
eine Mutprobe bestehen. Auch Martin, ein sehr ruhiger<br />
und braver Junge, hatte den großen Wunsch, Mitglied<br />
der Bande zu werden, Doch bisher hatten es ihm die<br />
anderen immer verwehrt, weil sie glaubten, er wäre für<br />
ihre Bande zu feige. Einmal in der Mathematikstunde<br />
bekam Martin einen Brief zugesteckt, in dem er<br />
aufgefordert wurde, am Nachmittag zu einer Mutprobe<br />
auf der Waldlichtung zu erscheinen. ...<br />
dumme Kiste", murmelte er, stieg aus und stemmte<br />
sich keuchend gegen den Wagen. Kurt, ein<br />
freundlicher, hilfsbereiter Junge, stand eine Weile<br />
daneben, dann half er mit, den schweren Wagen<br />
anzuschieben. Nach einigen Minuten begann der<br />
Motor stotternd zu laufen. „Danke", sagte der Mann,<br />
„das war sehr freundlich von dir. Weil du so nett warst,<br />
fahre ich dich dafür ins Bad. Du möchtest doch ins<br />
Schwimmbad, oder? Komm steig ein!"<br />
C) Es war in den Ferien. Mein Freund Georg und ich<br />
waren so richtig zu Streichen aufgelegt. Wir holten ein<br />
langes Stück Zwirn und eine Geldtasche, die wir mit<br />
kleinen Steinen prall füllten. Die Geldtasche<br />
befestigten wir an dem Faden und legten sie auf den<br />
Gehsteig, Hinter einem dichten Busch warteten wir mit<br />
dem Faden in der Hand ...
Schriftliche Sprachverwendung <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong>/PH-Linz Seite 21<br />
Beispiel 2: Der Würfel bestimmt das Ende der folgenden Geschichte.<br />
In einer dunklen Herbstnacht schlich ein Mann durch die kleine<br />
Tür in der Schlossmauer. Er sah sich mit scheuen Blicken um.<br />
Vielleicht lauerten sie dort zwischen den Bäumen im Park auf<br />
ihn? Unter seinem schwarzen Regenmantel drückte er ein<br />
kleines Bündel fest an sich. Seinen Schatz durften sie ihm nicht<br />
fortnehmen, eher würde er sein Leben dafür geben. Da hallte ein<br />
Schuss durch die Nacht. Der Mann schrie auf und fasste sich an<br />
die linke Schulter. Jetzt rannte er um sei Leben- Mit einem<br />
mächtigen Satz schwang er sich aufs Pferd und galoppierte auf<br />
das Tor zu ...<br />
Beispiel 3: Wie soll die Geschichte weitergehen?<br />
Du kannst selbst wählen oder den Zufall entscheiden lassen, wie die Geschichte weiter<br />
verlaufen soll. Trage die entsprechende Überschrift ein!<br />
geht spannend weiter und nimmt ein gutes Ende.<br />
Überschrift: Der einarmige Bandit<br />
verläuft sehr unglaubwürdig. Überschrift: Die Rache der<br />
Außerirdischen<br />
wird recht lustig. Überschrift: Ein Unglück kommt selten<br />
allein<br />
nimmt eine überraschende Wende. Überschrift; Die Krone<br />
des Zwergenkönigs<br />
erzählt von der Liebe zweier Blinder. Überschrift: Die<br />
Glocken läuten zur Hochzeit<br />
endet traurig, es gibt kein gutes Ende. Überschrift: Prinzessin<br />
Helga muss Trauerkleider tragen<br />
(<strong>Pramper</strong> aus: Deutschstunde 1, Veritas)<br />
Beispiel 4: Welche Geschichte möchtest du fortsetzen?<br />
Die Schule war zu Ende, und der erste Ferientag hatte begonnen. Ich hatte mir fest vorgenommen,<br />
jeden Tag zu genießen und möglichst viel zu erleben. Daher hatte ich meine Mutter gebeten, mich<br />
gleich zeitig in der Früh aufzuwecken, damit keine wertvolle Ferienzeit verloren gehe. Als ich<br />
aufwachte,<br />
stand mein<br />
Vater mit einer<br />
Riesenüberrasc<br />
hung in meinem<br />
Zimmer.<br />
lag eine mir<br />
unbekannte<br />
Katze auf<br />
meiner Decke<br />
und sagte zu<br />
mir: „Ich bin<br />
eine<br />
Zauberkatze.<br />
Wenn ..."<br />
A 5 Setzen Sie zwei unterschiedliche Anfänge fort!<br />
rief meine<br />
Mutter, dass Ich<br />
mich beeilen<br />
müsse, um den<br />
Schulbus noch<br />
zu erwischen ...<br />
fühlte ich einen<br />
stechenden<br />
Schmerz im<br />
Hals ...<br />
öffnete sich die<br />
Kinderzimmertü<br />
r, und herein<br />
kam ein<br />
reizendes<br />
Hundebaby ...
Schriftliche Sprachverwendung <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong>/PH-Linz Seite 22<br />
ad c) Unterrichtsbeispiel zur Differenzierung durch Themen- und Textsortenauswahl<br />
Z. B. drei Themen für eine Erlebniserzählung stehen zur Wahl. Oder ein Thema ist vorgegeben, die<br />
Textsorte kann gewählt werden; z.B. soll zu einer Bildgeschichte eine Erzählung, ein Leserbrief oder<br />
ein Zeitungsbericht verfasst werden.<br />
Beispiel 1: Textsortenaufschließung zur Bildgeschichte“ BONZO PLATZ!“<br />
TEXTSORTE SCHREIBER ADRESSAT INHALT<br />
Suchmeldung Hundehalter Radiohörer Beschreibung des<br />
Tieres<br />
Anzeige Tierfreund Bezirksgericht Beobachtung<br />
Grundlage jeder Textsortenaufschließung ist das von Karl Bühler entwickelte „Organon-<br />
Modell“. Organon = Mittler, die Sprache. Sender, Empfänger und Sachverhalt bilden die<br />
Positionen im Kommunikationsdreieck. Je nach Intention steht der Sender (Fabulieren;<br />
Erzählen und Mitteilen), der Empfänger (Appellieren) oder der Sachverhalt (Informieren) im<br />
Vordergrund.<br />
In der Jahresplanung ist darauf zu achten, dass keine Sprachintention vernachlässigt wird.<br />
Jedoch wird es zu Schwerpunktbildungen kommen. In den ersten Klassen wird das Erzählen<br />
und Fabulieren, in den folgenden Klassen das Informieren und Appellieren stärker vertreten<br />
sein.<br />
(<strong>Pramper</strong> aus: Deutschstunde 1, Veritas)
Schriftliche Sprachverwendung <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong>/PH-Linz Seite 23<br />
Beispiel 2: Thema und Textsorte sind vorgegeben, der Inhalt kann frei gewählt werden<br />
Tierrätsel – jeder Schüler kann ein Tier wählen<br />
Welches Tier ist das?<br />
Das Tier, das ich meine, ist ohne Zweifel eines der bekanntesten einheimischen Tiere. Außer in Europa kommt es auch in<br />
Nordamerika, Asien, Australien und Nordafrika vor. Als Lebensraum bevorzugt es deckungsreiches Gelände und für sich<br />
und seine Jungen Erdhöhlen, die meist mindestens zwei Ausgänge haben. Sein stets gepflegtes, kastanienbraunes Fell<br />
lässt es sich nur selten über die Ohren ziehen, da es sprichwörtlich schlau und einfaltsreich ist. Die spitze Nase und seine<br />
großen Ohren nehmen in seinem Revier jede Bewegung rasch wahr. Wir Menschen bekommen es nur selten zu sehen,<br />
da es sehr scheu ist. Ist es jedoch seuchenkrank, kann es sogar großen Tieren, wie Rindern und Pferden, aber auch uns<br />
Menschen gefährlich werden. Ansonsten müssen sich eher Mäuse, Fasane und Hasen in acht nehmen, um nicht von<br />
seinen scharfen Zähnen gerissen zu werden. Da es vor allem kranke und schwache Tiere reißt, trägt es den Namen<br />
„Gesundheitspolizei" mit Recht. Es wird zirka einen Meter lang, wobei ein Drittel sein buschiger Schwanz ausmacht, den<br />
es auch geschickt einsetzt, wenn es auf Honigraub geht. Obwohl seine Beine nur kurz sind, ist es blitzschnell, und daher<br />
habe ich auch noch keines einfangen können. Wie heißt das Tier?<br />
Auftrag: Schreibe ein ähnliches Tierrätsel und lese es deinen Mitschülern vor! Verschleiere dein Tier so geschickt, dass<br />
das Rätsel nicht zu leicht und nicht zu schwer lösbar ist!<br />
Hilfen für dein Tierrätsel:<br />
• Wähle ein Tier, über das du viel Wissenswertes in Erfahrung bringen kannst!<br />
• Verwende für dein Rätsel Biologiebücher, Lexika wie „ „Die Welt von A— Z" und Fachbücher!<br />
• Umschreibe geschickt das Aussehen, die Heimat und den Lebensraum, die Gewohnheiten, die Nahrung,<br />
Besonderheiten und Sprichwörtliches des Tieres!<br />
• Vermeide häufige Satzanfänge mit „Es" und „Das Tier"!<br />
A 6 Gestalten Sie ein Tierrätsel in einer der vorgestellten Arten!<br />
7. Das Erzählen<br />
zur Textcharakteristik siehe auch das Kapitel „Beschreibung der Aufsatzarten“.<br />
7. 1 Erzähltechniken<br />
So kann man bei Erzählungen anfangen<br />
• mit einem Vorwort beginnen (z.B. begründen, warum man erzählt)<br />
• Schritt für Schritt die Geschichte erzählen, meist bei Ich-Erzählungen<br />
• sachlich berichten, ohne Gefühle, aus der Sicht eines Beobachters, meist eine Er/Sie-Erzählung<br />
• mit dem Hauptereignis beginnen, die spannendste, traurigste, lustigste Stelle der Erzählung an den Beginn stellen<br />
• mit dem Schluss der Ereignisse beginnen, dann wird erzählt, wie es dazu kam (Rückblende)<br />
• sehr gefühlvoll erzählen, viele Stimmungen und Beobachtungen werden geschildert<br />
• mit einer wörtlichen Rede beginnen (Szene), viele direkte Reden kommen in der Erzzählung vor<br />
Beispiele für verschiedene Erzählanfänge<br />
__________________________________________________<br />
Bereits um 5:30 Uhr verließen wir am zweiten Ferientag unsere Wohnung und fuhren mit dem Auto zum Parkplatz, von<br />
dem wir zu unserer Bergtour aufbrachen. Der Anstieg zur Hütte war mit sechs Stunden geplant, aber aufgrund<br />
verschiedener Zwischenfälle wurden es deutlich mehr. Zunächst musste Papa umkehren, weil wir den Schlüssel zur<br />
Berghütte im Auto vergessen hatten. Die so erzwungene Rast nutzten wir für ein Frühstück. Nach einer Stunde ging es<br />
weiter, zunächst wanderten wir noch im Wald und in der Ebene. Zu Mittag wurde der Weg immer steiler. …<br />
__________________________________________________<br />
Die Sterne blitzten noch am blauschwarzen Himmel als wir in unser Auto stiegen. Durch eine menschenleere Stadt ging<br />
es auf eine Autobahn, die wie leergefegt schien. Schweigend und schlaftrunken saßen meine Schwester und ich während<br />
der Fahrt nebeneinander. Allmählich wurden die Umrisse der Berge deutlicher. Steil und mächtig ragten sie aus der<br />
Ebene empor. Die Gipfel waren noch in zarte Nebelschleier gehüllt. Langsam stieg die Sonne höher. Ihre Strahlen<br />
verliehen den Felswänden einen unnatürlichen rosa Farbton. Als wir den Parkplatz erreichten, stiegen wir aus dem Auto.<br />
Die kühle Frische des Waldes legte sich sogleich auf unsere Haut. …<br />
__________________________________________________<br />
„Raus aus den Betten, es ist schon spät!" Unbarmherzig weckte Papa meine Schwester Carola und mich auf. Gestern war<br />
es zwar etwas spät geworden, doch es half alles nichts. Murrend und gähnend schleppten wir uns ins Badezimmer. „Da
Schriftliche Sprachverwendung <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong>/PH-Linz Seite 24<br />
glitzern ja noch die Sterne, ich lege mich wieder nieder", rief Carola empört, als sie aus dem Fenster sah. Aber sie hatte<br />
nicht mit dem Tatendrang unseres Vaters gerechnet. „Aber nein, Caro, jetzt müssen wir los, sonst kommen wir in die<br />
heiße Mittagssonne!“…<br />
__________________________________________________<br />
Erschöpft sitzen wir vor der Hütte. Die Füße weit von uns gestreckt. Der Duft vom Abendessen strömt durch das offene<br />
Fenster. Erst jetzt bemerken wir, dass wir schon ziemlich hungrig sind. Von der Bank vor der Hütte sehen wir hinunter<br />
ins Tal. Dort unten muss irgendwo unser Auto stehen, von dem wir vor vielen Stunden losgegangen waren. Der Tag war<br />
ereignisreich und anstrengend. Unsere Wanderung hatte damit begonnen, dass Papa nach einer halben Stunde bemerkte,<br />
dass wir den Schlüssel für die Hütte im Auto vergessen hatten. ...<br />
Übungen zu Erzählanfängen<br />
Ordnen Sie die Bezeichnungen den vier Erzählanfängen zu und schreibe sie als Überschrift!<br />
• Eine gefühlvolle, stimmungsvolle Erzählform<br />
• Beginn mit dem Schluss<br />
• Der sachliche Erzählbericht<br />
• Beginn mit einer wörtlichen Rede<br />
A 7 Schreiben Sie drei verschiedenen Erzählanfänge in dein Heft! Wähle eines dieser Themen:<br />
• Eine gelungene Überraschung!<br />
• Ein böser Scherz!<br />
• Noch einmal gut gegangen!<br />
Tipp: Das sind eher ungeschickte Erzählanfänge<br />
• weit ausholendes Erzählen, Nebensächlichkeiten werden in der Einleitung zu genau ausgeführt, schlecht bei<br />
Schularbeiten, da man oft mit der eigentlichen Geschichte nicht fertig wird.<br />
• Sehr phrasenhafter Beginn, wirkt langweilig und anfängerhaft, kommt sehr häufig vor. (An einem schönen<br />
Sonntagmorgen….)<br />
Beispiel für ein überraschendes Ende mit Pointe<br />
So kannst du deine Zuhörer oder die Leser deiner Geschichte in „Stimmung" bringen:<br />
Völlig unerwartet schien hier der gefahrlose Weg zu Ende zu sein. Schlagartig war es dunkel geworden. Mein<br />
Nachbar klammerte sich mit schmerzendem Griff an meinen Arm. Von einer Sekunde auf die andere war das<br />
Gelächter in eine unheimliche Stille umgeschlagen. War da nicht eben ein Schatten in der Dunkelheit zu sehen?<br />
Panische Angst ergriff mich. Ich erstarrte und wagte nicht mich zu rühren. Etwas Großes bewegte sich im<br />
Dunkeln langsam auf mich zu. Ich saß wie versteinert im Wagen und starrte mit weit aufgerissenen Augen nach<br />
vor. In diesem Moment höchster Anspannung schwor ich mir: „Nie wieder fahre ich mit der Geisterbahn!"<br />
(<strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong>, Deutschstunde 1)<br />
A 8 Verfassen Sie eine kurze Geschichte mit einer überraschenden Wende! (zB.<br />
Fahrscheinkontrolle)<br />
b) mögliche Erzählformen<br />
• geschlossen: mit Einleitung und Schluss<br />
• offen: direkter Einstieg, kein Schluss<br />
c) Erzählperspektive<br />
personaler Erzähler: Ich – Erzähler; Erzählung in der dritten Person (aus der Sicht der Hauptfigur)
Schriftliche Sprachverwendung <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong>/PH-Linz Seite 25<br />
neutraler Erzähler: Das Geschehen scheint sich zu verselbständigen, der Leser hat keinen Bezug<br />
zum Erzähler. Das Geschehen läuft wie ein Film ab.<br />
auktorialer Erzähler: bringt sich selber als Erzähler ein, indem er das Geschehen bzw. seine<br />
Erzählweise kommentiert, Wertungen abgibt, den Leser einbezieht.<br />
d) zu den Erzählungen gehören:<br />
die Erlebniserzählung<br />
die Ich/Er/Sie-Erzählung<br />
die Fortsetzungserzählung<br />
die Rahmen-Erzählung<br />
die Reizwort-Erzählung<br />
die Bildgeschichte<br />
die Bilderzählung<br />
der innere Monolog<br />
die Fantasie-Erzählung<br />
6. 2 Die Ich-Erzählung<br />
Eine Ich-Erlebnis-Erzählung<br />
(Grafik aus der Perspektive eines Kindes, vor ihm der Bademeister mit der Blindschleiche, sie wird in der Faust des Bademeisters festgehalten, rund<br />
um ihn sind Badende, die Person aus deren Sicht erzählt wird steht auch im Kreis, etwas im Hintergrund, vor ihr sind Hinterköpfe zu sehen.)<br />
Textbeispiel einer Ich-Erzählung<br />
Die Giftschlange<br />
Im vorigen Sommer ging ich an einem der letzten schönen Tage in unser Freibad.<br />
Nachdem ich mich eine Zeit lang gesonnt hatte, bekam ich Lust auf eine<br />
erfrischende Abkühlung. Ich war erst wenige Minuten im Wasser, als ich eine<br />
grelle Stimme laut aufschreien hörte.<br />
Es hatte wie „Iiiih“ geklungen. Ich und die anderen Badegäste blickten in die<br />
Richtung aus der der Schrei kam, und wir sahen, wie zwei 12-jährige Mädchen<br />
ängstlich auf den Boden zeigten. _______________________________________<br />
_______________________________________________ Mit vielen Menschen<br />
bildeten wir einen Ring um ein gräuliches Untier, das sich im Gras dahin<br />
schlängelte. „Die Schlange wollte mich beißen!“, behauptete das eine Mädchen<br />
böse. Es zitterte am ganzen Körper und war kreidebleich im Gesicht. Das andere<br />
nickte heftig und schrie: „Die ist bestimmt giftig!“ Einige Buben hatten Stecken<br />
und Steine geholt, um die Schlange zu erschlagen. Als sie schon die ersten Steine<br />
werfen wollten, kam der Bademeister, rückte uns beiseite, sah sich die Schlange<br />
näher an und fasste sie dann mit bloßen Händen an. _____________________<br />
___________________________________ „Keine Aufregung, die geb’ ich schon<br />
weg!“ Ich bewunderte ihn, weil er die Schlange seelenruhig weg trug. Etwas<br />
verdattert standen wir alle da. Jetzt erst merkte ich, wie mir der kalte Schauer den<br />
Rücken hinunter lief und ich am ganzen Körper eine „Gänsehaut“ hatte.<br />
Einige Buben sagten noch etwas Freches zu den Mädchen, aber schon kurz danach<br />
verliefen sich alle wieder und freuten sich über den schönen Tag.<br />
Während des ganzen Tages fragte ich mich, was der Bademeister mit der Schlange<br />
gemacht hatte. ____________________________________________________<br />
„Ist die Schlange schon tot?“ Er lachte mich aus und meinte dann: „Aber Stefan,<br />
das war doch eine Blindschleiche, die ist erstens harmlos und zweitens nützlich!<br />
Ich hab´ sie auf der anderen Seite des Zaunes ausgelassen, damit sie vor euch<br />
„Totschlägern“ sicher ist!“ Ich wurde rot und schämte mich. Fast hätten wir ein<br />
nützliches Tier getötet, nur weil wir uns nicht auskannten.<br />
Ich nahm mir vor, in Zukunft nie voreilig zu handeln.<br />
Die Überschrift macht neugierig,<br />
verrät aber nicht zuviel.<br />
Die Einleitung erklärt kurz:<br />
WER? WANN? WO?<br />
Das WAS? beginnt!<br />
Der Hauptteil berichtet genau:<br />
WAS GESCHAH GENAU?<br />
WARUM? WIE? Die Spannung<br />
wird durch wörtliche Reden und<br />
Schilderungen über Gefühltes und<br />
Gedachtes erreicht.<br />
Der Höhepunkt der Geschichte<br />
löst die Spannung. Ein Ergebnis<br />
oder eine Lösung liegt vor.<br />
Der Schlussteil löst die Spannung<br />
auf. Er rundet die Geschichte ab.<br />
Hier wäre das Ende möglich.<br />
In besonders gelungenen<br />
Aufsätzen kann es auch einen<br />
Schlussteil mit Pointe geben.<br />
(Pointe = überraschende Wende)<br />
Der Schlusssatz – er muss nicht<br />
sein – gibt häufig an, was man<br />
daraus gelernt hat.
Schriftliche Sprachverwendung <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong>/PH-Linz Seite 26<br />
# Ergänzen Sie diese Sätze an der richtigen Stelle im Text!<br />
Er hob sie auf und sagte zu uns:<br />
Vor dem Nachhausegehen ging ich bei ihm vorbei und fragte ihn:<br />
Weil ich neugierig geworden war, lief ich zu ihnen hin.<br />
# Unterstreichen Sie alle wörtlichen Reden und Gedanken und in der Erzählung und unterwelle alle Gedanken und<br />
Gefühle!<br />
1 aus Erlebnisse erzählen von <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong>, Veritas-Verlag, #, Linz<br />
A 9 Verfassen Sie eine ähnlich strukturierte Ich-Erzählung zu einer dieser Überschriften:<br />
Die Prüfung, Unterwegs, Verliebt, Wie im falschen Film, Es reicht!<br />
7. 3 Er/Sie-Erzählung<br />
So wird aus der Geschichte von der „Giftschlange“ eine Er-Erzählung.<br />
Der Tierfreund<br />
Die folgende Geschichte zeigt, dass man nicht vorschnell handeln sollte. An einem schönen<br />
Badetag mitten im letzten Sommer sonnten sich zwei ungefähr zwölfjährige Mädchen im Freibad<br />
von Walding.<br />
Sie trieben allerhand Schabernack und waren bester Laune, als plötzlich eine der beiden ein<br />
sonderbares Gefühl an ihrem linken Fuß verspürte. Sie setzte sich auf, schaute nach und<br />
erschrak sehr über das, was sie da sah. Sie kreischte wie verrückt und sprang auf. Der Grund<br />
ihres Entsetzens war ein Reptil, das sich langsam über die Decke schlängelte. Durch das<br />
Geschrei wurden viele Badegäste aufmerksam und liefen herbei. Voller Ekel standen sie in<br />
einiger Entfernung rund um das kleine Tier. Schon kamen die ersten auf die Idee es an Ort und<br />
Stelle zu töten, damit es keinen Schaden anrichten könne. Denn viele waren überzeugt, dass es<br />
sich um eine Giftschlange handle. Doch als der Bademeister kam, nahm er zur Überraschung<br />
aller das Tier mit bloßen Händen und trug es weg. Die meisten schauten ihm bewundernd nach.<br />
Ein vorlauter Junge aber meckerte frech: „Da ist überhaupt nichts dabei, wenn man die<br />
Giftschlange schnell von hinten packt, dann kann gar nichts passieren. So eine hab ich schon oft<br />
angegriffen!“<br />
Kaum war der Bademeister außer Sichtweite, streichelte er das verängstigte Tier und sagte sanft:<br />
„Na, du kleine Blindschleiche, hast dich wohl verlaufen?“ Beim Zaun ließ er das Tier vorsichtig<br />
frei. Dabei achtete er darauf, dass es nicht mehr zurück auf die Liegewiese kroch. Zufrieden ging<br />
er zurück zu seinem Beobachtungsplatz und freute sich, einer harmlosen Blindschleiche das<br />
Leben gerettet zu haben.<br />
So fühlten sich alle Beteiligten erleichtert: die schreckhaften Mädchen, der vorlaute Junge, der<br />
besonnene Bademeister und natürlich auch die erschrockene Blindschleiche. (<strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong>,<br />
Erlebnisse erzählen)<br />
A 10 Führen Sie einen Perspektivenwechsel einer Ich-Erzählung durch. Schildern Sie die<br />
Ereignisse aus der Sicht einer anderen Person (Tier, Pflanze, Gegenstand) oder schildern<br />
Sie aus der Sicht einer anonymen Er/Sie-Erzählung! Dabei soll sich nicht nur die<br />
Personalform ändern: Es sollen die Sichtweise, Gedanken, Interessen geändert werden.
Schriftliche Sprachverwendung <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong>/PH-Linz Seite 27<br />
7. 4 Die Bild-Erzählung<br />
Treffpunkt Keller<br />
Da saßen sie nun und wussten sich keinen Rat. Hatte es denn überhaupt noch Sinn<br />
nachzudenken? Es war ja sowieso alles zu spät!<br />
Jeder blickte stumm vor sich hin. Thomas war besonders niedergeschlagen, denn er hatte als<br />
Erster von diesem Unglück erfahren. Zwei Jahre hausten sie nun schon in diesem Kellerraum in<br />
dem verfallenen Haus. Es war nicht besonders schön hier, doch ein alter Ofen wärmte den Raum<br />
jetzt im Herbst und Kisten genügten den Freunden als Sitzgelegenheiten. Von Zeit zu Zeit<br />
mussten sie die Kerze erneuern, die diesen Raum so gemütlich machte. Die vielen Bilder, die sie<br />
aufgehängt hatten, ließen den Raum fast wie einen richtigen Wohnraum erscheinen. Hier waren<br />
sie zu Hause und ganz unter sich. Bei jedem Wetter konnten sie hier spielen, niemand störte sie.<br />
Und nun sollte alles anders werden. Der Vater von Jochen, der bei einer Baufirma angestellt ist,<br />
hatte die Nachricht mit nach Hause gebracht, dass das alte Haus in Kürze abgerissen werden<br />
sollte. „Wann werden die wohl kommen?“, fragte Peter traurig. In diesem Moment hörten sie<br />
Schritte auf der Stiege. (<strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong>, Erlebnisse erzählen)<br />
A 11 Vielleicht fällt Ihnen eine ganz andere Geschichte zu diesem Bild ein oder zum<br />
folgenden Bild. Schreiben Sie sie auf!
Schriftliche Sprachverwendung <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong>/PH-Linz Seite 28<br />
7. 5 Die Bildgeschichte<br />
Herr Kaiser, sein Hund Willi und der Blumentopf<br />
Was der Hund Willi seinem Nachbarhund Caesar erzählt:<br />
Du wirst dich sicher fragen woher ich diesen Superknochen habe. Wahrscheinlich glaubst du,<br />
dass ich ihn gestohlen habe. Aber ich habe ihn mir ehrlich verdient, glaub mir! Gestern hatte<br />
unser Frauchen wieder so einen Putzfimmel, sie hat Oskar und mich aus dem schönsten<br />
Nachmittagsschläfchen gerissen und uns<br />
vor die Tür gesetzt, damit wir die frische<br />
Luft genießen. Kannst du mir sagen, was<br />
die Menschen an dieser stinkigen<br />
Stadtluft frisch finden? Na, von Luft<br />
verstehen sie mit ihren kleinen Nasen rein<br />
gar nichts. Wohl oder übel gingen wir die<br />
Landstraße entlang, als plötzlich, stell dir<br />
vor, ein Blumentopf mit einem<br />
Mordskracher mitten auf dem Kopf von<br />
Oskar landet. Ich hab geglaubt, die Welt<br />
geht unter, so einen Schreck hab ich<br />
bekommen. Klarerweise hab ich sofort<br />
wild zu bellen begonnen. Ich sag dir, ich<br />
war vielleicht aufgeregt, ich war zu allem<br />
entschlossen, nicht einmal der böse Bello<br />
von der Frau Wondraschek hätte mir in<br />
diesem Moment zu nahe kommen dürfen.<br />
Na, für uns gab‘s kein Halten mehr. Rein<br />
in das Haus, rauf in den ersten Stock und<br />
wie wild an die Tür getrommelt. Ich dachte<br />
schon, Oskar steht vor einem Herzinfarkt,<br />
so einen roten Kopf hat er gehabt. Da<br />
öffnet sich die Tür und eine<br />
wunderschöne Frau reicht mir diesen<br />
duftenden Superknochen heraus. Ganz<br />
zart hat sie mir den Kopf gestreichelt und
Schriftliche Sprachverwendung <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong>/PH-Linz Seite 29<br />
gesagt: „Na, du lieber Hund, sicher hast du Appetit auf einen leckeren Knochen.“ Natürlich hatte<br />
ich enormen Gusto, wie du dir denken kannst. Mir ist das Wasser nur so auf der Zunge<br />
zusammengelaufen. Oskar war vielleicht verdattert, sogar die Hand hat er ihr geküsst, als sie<br />
sagte: „Verzeihen Sie, lieber Herr Kaiser!“<br />
Tja, mein lieber Freund Cäsar, du siehst, der Knochen war ehrlich verdient. Vielleicht bringst du<br />
am nächsten Sonntag dein Herrchen so weit, dass es mit dir auf der Landstraße spazieren geht.<br />
A 12 Wählen Sie eine Bildgeschichte aus einem Sprachbuch und schreiben Sie Ihre<br />
Geschichte dazu! Achten Sie auf den ausgestalteten Erzählhöhepunkt mit Gedachtem,<br />
Gesagtem, Gefühltem!<br />
7. 6 Rahmenthema, Erzählkern<br />
Rahmenthemen beschreiben nur sehr vage das vorgegebene Thema. Schüler können hier sehr<br />
weit gefasste Erzählungen einbringen.<br />
Rahmenthemen können solche und ähnliche Vorschläge sein:<br />
Enttäuscht / Erlebnis mit einem Tier / Eine schlimme Verletzung / Glück gehabt<br />
Sinnvoll ist hier die Methode des Clusters zur Ideenfindung. Die Überschrift müssen die Schüler<br />
selbst finden. Es ist sinnvoll, die Überschrift erst zum Schluss zu verfassen.<br />
Rahmenthema: Überraschung / Überschrift: Versalzen<br />
Vor einigen Jahren bekamen wir Besuch von Onkel Franz, seiner Frau und ihren Kindern. Sie<br />
waren zur Nachmittagsjause eingeladen. Bei diesen Besuchen ging es immer recht lustig zu und<br />
jeder trug etwas zur ausgelassenen Stimmung bei. Diesmal hatte ich mir etwas ausgedacht, was<br />
gewissermaßen die Krönung des Nachmittags werden sollte.<br />
Bis auf meine Mama hatten wir uns schon alle im Wohnzimmer um den Tisch gesetzt und waren<br />
bereits bester Stimmung. Aus der Küche dufteten frischer Kaffee und Rosinenkuchen. „So, jetzt<br />
bin ich endlich fertig“, sagte meine Mutter, als sie mit dem vollen Tablett ins Wohnzimmer kam,<br />
„greift alle fest zu!“ Meine Mutter goss den Kaffee in die Tassen, reichte Milch und Zucker und<br />
schnitt den Kuchen an. Alle rührten eifrig in den Kaffeeschalen und ließen den herrlichen Duft in<br />
ihre Nasen steigen. Onkel Franz tat den ersten Schluck. Er bekam einen starren Blick und verzog<br />
den Mund. „Brrr, was ist das für eine scheußliche Sorte?“, sagte er und schüttelte sich dabei voller<br />
Grausen. Meine Mutter sah ihn ungläubig an und stotterte: „Wie... wieso? De... der ist doch ganz<br />
frisch und die Milch ist auch in Ordnung.“ Sie kostete vorsichtig aus ihrer Tasse. „Pfui“, rief sie<br />
erschrocken, „das schmeckt ja ekelhaft, das schmeckt, als ob Salz im Kaffee wäre!“ Ich starrte<br />
verlegen auf das bunte Tischtuch und spürte, wie mein Gesicht rot anlief. Onkel Franz feuchtete<br />
seine Fingerspitze an und tupfte in die Zuckerdose. „Tatsächlich, das ist Salz, du musst es<br />
verwechselt haben!“ Meine Mutter bebte vor Zorn, sie wusste genau, dass nicht sie etwas<br />
verwechselt hatte, sondern dass ich hinter diesem Streich steckte. „Schade um den guten Kaffee!<br />
Jetzt wo ich endlich in der Küche fertig bin, kann ich von neuem anfangen. Darüber sprechen wir<br />
beide noch!“, fauchte sie mich drohend an. Da wusste ich, dass der Streich nicht sehr lustig<br />
gewesen war. Ich wagte nicht aufzublicken.<br />
Dieser Nachmittag verging quälend langsam. Es wurde nicht mehr gelacht. Unsere Besucher<br />
sahen mich nicht an und die Gespräche waren ernster als sonst. Am Abend teilte mir meine
Schriftliche Sprachverwendung <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong>/PH-Linz Seite 30<br />
Mutter mit, dass sie mir den Preis einer Packung Kaffee von meinem Taschengeld abziehen<br />
würde. Ich spürte, dass sie sehr verärgert war, und ich lernte daraus, dass es lustige und weniger<br />
lustige Streiche gibt. (<strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong>, Deutschstunde 1, Zusatzteil A)<br />
Erzählkerne vorgeben.<br />
Hier wird der Kern einer Geschichte mit wenigen stichwortartigen Gedanken vorgegeben und die<br />
Schüler bauen sie zu einer umfangreichen Ich- oder Er-/Sie-Erlebniserzählung aus. Beispiel:<br />
Radausflug / Reifen platzte / Unglück knapp verhindert / kein Pickzeug dabei / mit dem Auto<br />
abgeholt<br />
A 13 Verfassen Sie zum Erzählkern von oben eine dramatische Erlebniserzählung!<br />
7. 8 Die Fantasie-Erzählung<br />
Zum Aufwärmen ein paar Vorübungen. Setzen Sie jeden Anfang mit zwei bis drei Sätzen<br />
fort!<br />
Als es klingelte, wusste ich sofort,…<br />
Und dann erzählte ich der wildfremden Person …<br />
Er warf mit einem Schlag die Tür zu und …<br />
Meine Mutter hielt mir eine Schachtel hin und sagte: „Das ist deine…“<br />
Plötzlich war dort, wo eben noch das alte Haus gestanden war,…<br />
Und ich Idiot hatte mich auch noch freiwillig zur Mannschaft des Kolumbus gemeldet…<br />
Wie soll die folgende Geschichte weitergehen? Setzen Sie sie mit einem Absatz fort!<br />
Endlich neue Jeans<br />
Vergangenes Wochenende hatte ich von meiner Oma Geld für neue Jeans bekommen. Gleich am<br />
Montag ging ich in ein bekanntes Großkaufhaus, um mir schöne Jeans auszusuchen. Bald hatte<br />
ich am Ständer einige gefunden, die mir gefielen. Ich nahm sie mit in die Umkleidekabine. Der<br />
Reihe nach probierte ich sie an und entschied mich für blaue, die mir besonders gut passten.<br />
Dann verließ ich die Kabine und betrat den Verkaufsraum. Plötzlich stand ich mutterseelenallein<br />
da. Niemand war zu sehen. Alles war ganz still, als ob ich taub geworden wäre. …<br />
A 14 Erfinden Sie einen ähnlichen fantastischen Erzählanfang!<br />
8. Das Berichten<br />
Der Zeitungsbericht: Neben der nötigen Information über aktuelle Ereignisse ist jeder Journalist<br />
bemüht, seine Berichte je nach Adressatenkreis interessant und lesbar zu gestalten.<br />
1. Wo erscheint er? Für welches Leserpublikum ist er gedacht?<br />
Boulevardblätter Publikum, das sich mit reiner Information nicht zufrieden<br />
gibt, es braucht zusätzlich<br />
• Unterhaltung (in Form von leicht lesbaren Storys)
Schriftliche Sprachverwendung <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong>/PH-Linz Seite 31<br />
überregionale<br />
Zeitungen mit<br />
Schwerpunkt<br />
Politik,<br />
Wirtschaft, Kultur<br />
• Einblick in die Intimsphäre (Voyeurismus)<br />
• außergewöhnliche Ereignisse, um die Sensationslust zu<br />
stillen<br />
• ein übersichtliches Layout, eine klare Gliederung<br />
Ein Leserpublikum, das Wert legt auf<br />
• Sachlichkeit<br />
• ev. auch witzig-geistvolle Darstellung, die die nötige<br />
Distanz schaffen kann.<br />
2. Die sprachlichen Mittel<br />
Die Leserschaft muss bei der Stange gehalten werden, um den Absatz zu garantieren.<br />
- Je reißerischer, desto weiter ist der Bericht von der tatsächlichen Information entfernt, desto<br />
weiter entfernt er sich von der Sachsprache.<br />
- Er will mehr unterhalten als informieren, um sein Publikum zufrieden zu stellen.<br />
- Vielfach soll auch der Bericht die Meinung des Lesers bestätigen.<br />
- In der Leserschaft soll ein Gruppenbewusstsein gebildet werden.<br />
- Rasch und leicht lesbare Texte kommen dem (eiligen) Leser entgegen.<br />
• Telegrammstil („Firmendirektor sah Puma“, „Bauer von Blitz erschlagen“)<br />
• Schlagwörter, meist in Form von Zusammensetzungen („Spuksalon“, „Killeroma“ „Bauriese“,<br />
‚Elefantenhochzeit“,...)<br />
• Metaphern (,‚Uns erwartete dort die Hölle“, „Der Ausbau der Bahn wurde verschlafen“<br />
• Keine Gliedsätze zweiten und dritten Grades.<br />
3. Inhalt: Mit folgenden Fragen beschäftigt sich ein Bericht:<br />
WAS? WER? WANN? WO? WIE? WARUM?<br />
4. Aufbau<br />
Schlagzeile ev. mit Anreißerzeile / Summary (Zusammenfassung) / Text / Bilder, Bildtext / Name<br />
des Redakteurs<br />
Im Text wird mit dem Wichtigsten begonnen. Längere Berichte behandeln gegen Ende immer<br />
mehr Unwesentliches, immer mehr Details.<br />
A 15 Verfassen Sie einen Zeitungsbericht zu einem der Themen! Verwenden Sie dazu den<br />
Raster mit Blocksatz oder eine selbst gestaltete Vorlage!<br />
Katzenkiller von Mödling erhält letzte Chance<br />
Hundebesitzer muss nach Gerichtsurteil dafür sorgen, dass Hund keine Katzen mehr jagt + + + Exklusiv-<br />
Interviews mit dem Hundebesitzer und Katzenbesitzern der Umgebung + +<br />
Durchfall an Schule<br />
In der Schulküche wurde ranziges Fett verwendet + + + Peinliche Szenen im Unterricht + + -4 Schüler und<br />
Lehrer betroffen + + + Direktor gibt zwei Wochen schulfrei + + + - -.<br />
Papagei kann lesen<br />
Sprechende Papageien gibt es viele + + + Dieser kann mehrere Fremdsprachen fließend sprechen + + +<br />
begann mit Leseunterricht + + + Am liebsten liest er Tierbücher + + +
Schriftliche Sprachverwendung <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong>/PH-Linz Seite 32
Schriftliche Sprachverwendung <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong>/PH-Linz Seite 33<br />
9. Die Beschreibung<br />
9. 1 Personenbeschreibungen und Charakteristik<br />
Je nach Textsorte und Intention sind sie unterschiedlich gestaltet. (Gebrauchstexte anders als<br />
literarische Texte.)<br />
Man findet sie in<br />
• in literarischen Texten (Schilderung, Charakteristik)<br />
• in Biografien<br />
• in Partnerschaftsanzeigen<br />
• in Todesanzeigen (zumindest Elemente davon)<br />
• in Nachrufen<br />
• in Künstler-, Politiker-, Starporträts (Bild und Text mit viel Werbung)<br />
• in Steckbriefen (bei der Polizei mit einem Phantombild: Täterbeschreibungen)<br />
• Gegenstands- Weg-, Spiel, Tierbeschreibung, Inseraten<br />
Die Personenbeschreibung als literarische Form<br />
Personenbeschreibungen geben auch über den Beschreibenden Auskunft, seine persönliche<br />
Sichtweise und sein VerhäItnis zum Beschriebenen.<br />
Max Frisch gibt zum Beispiel Einblick in Stillers Verhältnis zu seiner Frau, wenn er seinen Helden<br />
Folgendes ins Tagebuch schreiben lässt:<br />
„Ihre Haare sind rot, der gegenwärtigen Mode entsprechend sogar sehr rot, jedoch nicht wie<br />
Hagebutten - Konfitüre, eher wie trockenes Menning-Pulver. Sehr eigenartig. Und dazu ein sehr<br />
feiner Teint; Alabaster mit Sommersprossen. Ebenfalls sehr eigenartig, aber schön. Und die<br />
Augen? Ich würde sagen: glänzend, sozusagen wässerig, auch wenn sie nicht weint, und<br />
bläulich-grün wie die Ränder von farblosem Fensterglas, dabei natürlich beseelt und also<br />
undurchsichtig. Leider hat sie die Augenbrauen zu einem dünnen Strich zusammenrasiert, was<br />
ihrem Gesicht eine graziöse Härte gibt, aber auch etwas Maskenartiges, eine fixierte Mimik von<br />
Erstauntheit. Sehr edel wirkt die Nase zumal von der Seite, viel unwillkürlicher Ausdruck in den<br />
Nüstern. Ihre Lippen sind für meinen Geschmack etwas schmal, nicht ohne Sinnlichkeit, doch<br />
muss sie zuerst erweckt werden, und die Figur (in einem schwarzen Tailleur) hat etwas Knappes,<br />
etwas Knabenhaftes auch, man glaubt ihr die Tänzerin, vielleicht besser gesagt: etwas<br />
Knabenhaftes, was bei einer Frau in ihren Jahren einen unerwarteten Reiz hat. Sie raucht sehr<br />
viel. Ihre sehr schmale Hand, wenn sie die noch lange nicht ausgerauchte Zigarette zerquetscht,<br />
ist keineswegs ohne Kraft, keineswegs ohne eine beträchtliche Dosis unbewusster<br />
Gewalttätigkeit, wobei sie sich selbst, scheint es, ganz und gar zerbrechlich vorkommt Sie spricht<br />
sehr leise, damit der Partner nicht brüllt. Sie spekuliert auf Schonung.<br />
Auch dieser Kniff, glaube ich, ist unbewusst. Dabei duftet sie sehr betörend, wie Knobel schon<br />
gemeldet hat; es muss eine gediegene Marke sein, man denkt sofort an Paris, an die Parfümerien<br />
bei der Vendome.“<br />
Max Frisch „Stiller“, Frankfurt 1962, S. 71f<br />
Im Text wird deutlich, dass der Autor mit den Widersprüchlichkeiten der beschriebenen Person<br />
nicht zurechtkommt. Immer hat die Personenbeschreibung in der Literatur verweisende Funktion.<br />
Die Figuren bestimmen den Textfortgang und Zusammenhänge innerhalb eines Textes.
Schriftliche Sprachverwendung <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong>/PH-Linz Seite 34<br />
Die Personenbeschreibung und Charakteristik im Deutschunterricht<br />
In der ersten Klasse wird es vor allem eine einfache Personenbeschreibung sein, bei der äußere<br />
Kennzeichen im Vordergrund stehen. In der 4. Klasse die komplexere Charakteristik.<br />
Reale Personen schriftlich beschreiben zu lernen und fiktive Personen schreibend zu erschaffen<br />
kann dazu beitragen, sich intensiver mit anderen Personen und mit sich selbst zu befassen.<br />
Spiegel lügen nicht<br />
Bei der Kreuzung, bei der Straßenbahnhaltestelle, ist eine Passage. Spiegel Krachmann - Luster, Lampen<br />
und SpiegeI für den modernen Geschmack. Anika geht in die Passage. Ganz nach hinten. Vorne stehen<br />
die Leute, die auf die Straßenbahn warten. Anika starrt in den Spiegel, Marke Kristall Extra Modell Desiree.<br />
Der Spiegel muss schief hängen, denn Anika schaut unheimlich dünn aus. Anika schaut sich an. Die<br />
schäbigen Ringellocken beiderseits des Mittelscheitels stehen wie ein Riesenschnurrbart ab. Die übrigen<br />
Haare hat der Wind zu zackigen Strähnen geklebt. Zwischen den Strähnen schauen Anikas Ohren hervor.<br />
Die Ohren sind groß und an den Rändern vom Wind rot gefärbt .Anikas Hose ist um zwei Fingerbreit zu<br />
kurz und um eine Handbreit zu eng. Die Absätze der Schuhe sind schief getreten. An einem Absatz hängt<br />
der Lederüberzug weg. Anikas Jacke war voriges Jahr modern. Jetzt tragen nur mehr die letzten<br />
Menschen sowas. Anika holt den halben Kamm aus der Jackentasche. Dem halben Kamm fehlen drei<br />
Zähne. Anika kämmt Haare über die Ohren, zerrt am ringellockigen Schnurrbart. Der Kamm bleibt im<br />
Schnurrbart stecken. Der vierte Zahn bricht ab.<br />
In einer Hosentasche sollten zwei Haarklammern sein. Weil die Hose um eine Handbreit zu eng ist, ist es<br />
schwer bis zum Grund der Hosentasche zu greifen. Anika findet nur eine Haarklammer. Eine Haarklammer<br />
nützt nichts. Verändert den Schnurrbart nur einseitig. Anika zieht sich einen Seitenscheitel. Im Spiegel<br />
sieht Anika eine Frau, die hinter ihr steht. Die Frau beobachtet Anika und grinst dabei. Die Frau hat keinen<br />
Schnurrbart, die Frau hat einen guten Friseur. Anika streckt dem Spiegel, der Frau, die Zunge heraus. Die<br />
Frau dreht sich um. Wahrscheinlich grinst sie jetzt noch blöder. Der Schnurrbart, auf eine Seite<br />
zusammengeworfen, sträubt sich ratlos. Anika steckt ihn mit der Haarklammer am Kopf fest, kämmt Haare<br />
über die Klammer. Die Ohren mit den roten Rändern schauen schon wieder zwischen den Haaren hervor.<br />
Anika schüttelt den Kopf, schüttelt die Haare, damit die Ohren in Deckung gehen. Anika zerrt die Hose die<br />
Hüften abwärts, bis zwischen den Schuhen und den Hosenbeinen kein Stückchen Socken mehr zu sehen<br />
ist. Anika starrt Anika wütend an. Gestern Abend, im dreiteiligen Spiegelschrank betrachtet, war Anika<br />
hübsch. Ungeheuer hübsch sogar. Das war kein Irrtum. Sie hat genau hingesehen. Über zehn Minuten<br />
lang. Sie hat die Haare zur Seite gebürstet, hoch gesteckt, Mittelscheitel gekämmt, Haare ins Gesicht<br />
fallen lassen, immer war sie hübsch gewesen, ungeheuer hübsch. Kann man in zwanzig Stunden hässlich<br />
werden? Hat sich der dreiteilige Spiegelschrank geirrt? (aus: Nöstlinger: Stundenplan)<br />
Das Verfassen von Personenbeschreibungen hat folgende Ziele:<br />
• Genaues Beobachten<br />
• Versprachlichen von Wahrnehmungen (äußeres Erscheinungsbild, Eigenschaften, Charakter,<br />
Verhaltensweisen, Betätigungsfelder, Stellenwert bei den Mitmenschen)<br />
• Erweiterung der Menschenkenntnis, d.h. sich selbst (Warum sehe ich diesen Menschen so?)<br />
und andere Menschen besser kennen lernen.<br />
A 16 Beschreiben Sie eine auffällige unbekannte Person, zB. der Sie auf Weg nach Hause<br />
begegnen oder deren Bild Sie im Internet gefunden haben!
Schriftliche Sprachverwendung <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong>/PH-Linz Seite 35<br />
10. Die Tierbeschreibung, Suchmeldung<br />
Inserate verfassen<br />
Wer will mich? Krokodil aus bestem Haus sucht…<br />
Gefunden wurde!<br />
_______________________________________________________<br />
_______________________________________________________<br />
_______________________________________________________<br />
_______________________________________________________<br />
_______________________________________________________<br />
____________________________________________________________________________<br />
A 17 Verfassen Sie eine realistisch gestaltet Suchmeldung (Form, Abrisszettelchen,…) von<br />
einem außergewöhnlichen Tier (mit Bild) und einem eher parodistischen Inhalt!<br />
Das besondere Inserat<br />
In der Zeitung „Der korrekte Verkauf“ kann man außergewöhnliche Sachen zum Verkauf anbieten<br />
oder per Inserat etwas suchen, was man schon lange möchte.<br />
einen alten Radiergummi, abgewetzten Fahrradschlauch, einen Gartenzwerg mit Reh, einen<br />
Kubikmeter feinsten Meeressand, drei junge Goldfische, die OriginalSportschuhe eines Sportlers,<br />
ein Hufeisen als Glücksbringer, einen besonders scharfen Wachhund!, Käfig für Hamsterpärchen,<br />
A 18 Verfassen Sie ernst gemeinte Anzeigen: in denen Sie den gesuchten bzw.<br />
angebotenen Gegenstand möglichst verlockend beschreiben (Verwendungszweck,<br />
Zustand, Preis, Nutzen, Besonderheit…).<br />
11. Die Erörterung<br />
Der Adressat soll in einer Erörterung von einer Aussage, Behauptung oder Forderung überzeugt<br />
werden. Wichtig sind dabei<br />
• Eine klar formulierte Forderung (Was will ich?)<br />
• gute Argumente (= Begründungen) und<br />
• Beispiele (= Beweise)<br />
Wir brauchen einen größeren Parkplatz. (Behauptung, Forderung)<br />
Die vorhandenen Plätze reichen nicht mehr aus. (Begründung, Argument)
Schriftliche Sprachverwendung <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong>/PH-Linz Seite 36<br />
Wegen langwieriger Parkplatzsuche kommen Studierende oft zu spät. (Beweis / Beispiel)<br />
Zur Vorbereitung eignet sich gut eine Mindmap! Die Gliederung einer Erörterung: Einleitung<br />
(Eingehen auf das Thema), Hauptteil mit mehreren Pro- und Kontra-Argumenten,<br />
Schlussfolgerung, persönlicher Standpunkt.<br />
Viele Jugendliche geben eine Menge Geld für teure Markenkleidung aus. Was hältst du<br />
davon?<br />
Fast täglich kann man beobachten, dass Mitschülerinnen und Mitschüler mit neuester<br />
Markenkleidung protzen und sich über andere, die sich diesen teuren Spaß nicht leisten können<br />
oder wollen, lustig machen. Zwar kennen wir alle die Redewendung „Kleider machen Leute“, aber<br />
trotzdem ist es fraglich, ob man sich diesem Trend unterwerfen soll oder nicht. Daher will ich im<br />
Folgenden die Vor- und Nachteile gegenüberstellen und bewerten.<br />
Zunächst einmal lässt sich sagen, dass sich der Kauf von Markenkleidung lohnt, weil ein<br />
Markenzeichen symbolisiert, dass das betreffende Kleidungsstück von guter Qualität ist. Man<br />
muss zwar mehr Geld investieren, Markenkleidung kann aber wesentlich länger getragen werden<br />
als herkömmliche Billigware. Bei meinem letzten Einkauf konnte ich mich nicht nur auf die<br />
einheitlichen Größen verlassen, wodurch sich auch die Anprobe erübrigte, sondern ich hatte auch<br />
die Garantie, eine moderne und hochwertige Hose erworben zu haben.<br />
Für das Tragen von Markenkleidung spricht auch, dass man durch sie seine finanziellen<br />
Möglichkeiten und damit den gesellschaftlichen Rang demonstrieren kann. Das gibt zwar kaum<br />
jemand zu, aber wahr ist es doch. Da jeder die Marken und auch deren Preis kennt, kann man<br />
von der Kleidung auf das Budget schließen. So weiß wahrscheinlich jeder, dass Schuhe von<br />
einem bestimmten Designer kaum weniger als 200 Euro kosten.<br />
Des Weiteren gehört man mit Markenkleidung zu einer Gruppe und es ist ein gutes Gefühl, wenn<br />
man spürt, dass man zu einer Gemeinschaft gehört.<br />
Dem gegenüber ist jedoch zu bedenken, dass Markenkleidung im Vergleich zu No-Name-<br />
Kleidung“ oftmals viel zu teuer ist. Der Mehrpreis wird meist nur für den Namen aufgeschlagen,<br />
trotzdem ist die Qualität oft nicht besser. Manchmal ist die Qualität der Billigmarken sogar der von<br />
Markenprodukten überlegen.<br />
Wegen des Mehrpreises werden Menschen, die finanziell sparsamer haushalten müssen,<br />
benachteiligt und vielleicht sogar ausgeschlossen. Die Türsteher mancher Diskotheken gewähren<br />
nur besser — das heißt teurer — gekleideten Leuten Einlass.<br />
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die verloren gegangene Individualität derjenigen, die<br />
Markenkleidung tragen. Wenn man aufmerksam durch die Straßen geht, bemerkt man, dass sich<br />
die Menschen in ihrem äußeren Erscheinungsbild kaum noch voneinander unterscheiden. Alle<br />
richten sich nach denselben Modetrends. Die eigene Persönlichkeit kommt dabei nicht zur<br />
Geltung, da viele nicht mehr das anziehen, was ihnen gefällt oder was zu ihrem Typ passt,<br />
sondern nur Idole nachahmen.<br />
In Anbetracht der oben genannten Aspekte komme ich zu dem Schluss, dass Markenkleidung<br />
zwar qualitativ hochwertig sein kann, was aber bei sorgfältiger Auswahl auch bei anderen<br />
Produkten der Fall sein kann.<br />
Das Image, das Markenkleidung verleiht, ist ziemlich zweifelhaft, da man einen Menschen nicht<br />
nach seiner Kleidung bewerten sollte.<br />
Daraus ergibt sich für mich, dass Markenkleidung nicht unbedingt notwendig ist und die Vorteile<br />
den Mehrpreis eigentlich nicht rechtfertigen.
Schriftliche Sprachverwendung <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong>/PH-Linz Seite 37<br />
Wenn man glaubt, mit dem Erwerb eines Markenprodukts hochwertige Qualität gekauft zu haben,<br />
kann man sich auch irren. Denn oft gelangen minderwertige Imitationen zum Verkauf.<br />
Schließlich aber soll es jeder und jedem selbst überlassen sein, für welches Qutfit sie oder er<br />
Geld ausgibt. Wenn es jemandem Spaß macht, sich modisch und mit Markenprodukten zu<br />
kleiden, und die Eltern bereit sind diese Wünsche zu sponsern, spricht auch nichts gegen<br />
Markenprodukte.<br />
Ich werde beim Kaufen von Fall zu Fall entscheiden, zu welchen Produkten ich greife. (<strong>Wolfgang</strong><br />
<strong>Pramper</strong>, Deutschstunde 4)<br />
Beschriften Sie im Text oben die Gliederungsteile!<br />
A 19 Schreiben Sie eine Erörterung (gilt als zwei Aufgaben) zu einem der folgenden<br />
Themen:<br />
• Auf dem Land (in der Stadt) lebt es sich besser!<br />
• Kinder brauchen mehr/weniger Freiraum<br />
• Die Einhaltung der Maulkorbpflicht bei Hunden (beim Nikotin- und Alkoholverkauf an Kinder)<br />
sollte strenger (weniger genau) überprüft werden.<br />
12. Der Brief<br />
12. 1 Der persönliche Brief,<br />
Einladungen<br />
Private Briefe unterliegen keinen Regeln.<br />
Verschiedene Gestaltungspunkte wie<br />
Anrede und Schlussformel haben sich<br />
eingebürgert. Die Form sagt viel über den<br />
Schreiber und der Wertschätzung für den<br />
Adressaten aus. Schreibaufträge<br />
beinhalten oft das Thema Einladungen<br />
oder Brieffreundschaften. Ebenso kann<br />
das Beraten und Trösten in der Form der<br />
Beantwortung von Kummerbriefen geübt<br />
werden.
Schriftliche Sprachverwendung <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong>/PH-Linz Seite 38<br />
A 20 Gestalten Sie mit Handschrift oder PC eine Einladung zu Ihrer Diplomfeier, Hochzeit,<br />
Kindstaufe oder Seminargruppen-Wiedersehensfeier.<br />
12. 2 Der Normbrief, Geschäftsbrief, Einladung<br />
Bewerbungsschreiben, Lebenslauf, Reklamation sind wichtige Textsorten der 4. Klasse. Siehe<br />
dazu auch die Sprachbücher der 4. Klasse.<br />
A 21 Gestalten Sie mit dem PC ein ausführliches Bewerbungsschreiben für die Aufnahme<br />
an eine private HS. Legen Sie auch einen Lebenslauf bei!<br />
A 22 Gestalten Sie als Klassenvorstand mit dem PC eine Einladung für die Eltern einer<br />
ersten Klasse zum Elternabend! Geben Sie neben Formalen wie „Wahl zum<br />
Elternsprecher“ auch eine Programmübersicht an.<br />
12. 3 Reklamieren, sich beschweren<br />
A 23 Sie haben bei einer Ebay-Auktion von einer Elektrovertriebsfirma eine Dolby Surround<br />
Anlage gekauft und stellen nach dem Aufbau fest, dass wahrscheinlich ein Wackelkontakt<br />
bei zwei Lautsprechern vorliegt. Möglichweise haben Sie auch einen Fehler beim Aufbau<br />
gemacht.<br />
Schreiben Sie der Firma oder dem Hersteller ein Mail, erklären<br />
Sie die Situation, fragen Sie, ob der Fehler beim Aufbau liegen<br />
kann und teilen Sie mit, was Sie im Schadensfall<br />
möchten!<br />
Dolby Surround ist ein System, um Raumklang auch zu<br />
Hause zu erleben. Kinofeeling im Wohnzimmer. Egal<br />
ob mit High-End Surround-Boxen oder Sound der<br />
Extraklasse über Kopfhörer. Hören Sie den Sound über<br />
Ihre Kopfhörer in Stereo.<br />
12. 4 Der Leserbrief<br />
A 24 Untersuchen Sie zwei Leserbriefe zu einem Thema, am besten aus zwei sehr<br />
unterschiedlichen Zeitungen! Stellen Sie die Unterschiede in Inhalt und Darstellung<br />
gegenüber! Nehmen Sie dann in einem eigenen Leserbrief dazu Stellung! Beachten Sie die<br />
Gliederung! (Gilt als zwei Aufgaben)<br />
Problemfall Schule: Falsch<br />
verstandene Chancengleichheit<br />
An negativen Meldungen über Schule, Lehrer und Schüler mangelt es nicht. Vor allem die Lehrer müssen
Schriftliche Sprachverwendung <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong>/PH-Linz Seite 39<br />
damit rechnen, dass ihnen nicht nur zunehmend Erziehungsaufgaben aufgeladen werden, sondern dass<br />
sie in Problemfällen auch noch als Prügelknaben herhalten müssen.<br />
Die Belastung bleibt nicht ohne Folgen: In Wien gibt es keinen Hauptschullehrer mehr, der erst mit 60<br />
Jahren in Pension geht. Diagnose für viele Frühpensionen: „Burn-out-Syndrom“.<br />
„Lehrer hat keine erzieherischen Mittel“<br />
Szene aus einer oberösterreichischen Hauptschule:<br />
Die Lehrerin ertappt einen Buben aus der vierten Klasse beim Rauchen. Sie nimmt ihm die Zigaretten weg<br />
und schreibt im Mitteilungsheft an die Eltern, sie könnten sich die Zigaretten in der Schule abholen. Die<br />
Mutter schreibt zurück: Die Lehrerin soll die Zigaretten gefälligst dem Buben zurückgeben.<br />
„Der Pflichtschullehrer“, sagt Dr. Wolf Weitzenböck von der Pädagogischen Akademie, „hat keine<br />
erzieherischen Mittel mehr.“ Mit anderen Worten: Er kann keine „Strafaufgaben“ anordnen, wenn der<br />
Schüler und seine Eltern nicht wollen. Wenn ein Schüler seine Aufgabe trotz dreimaliger Aufforderung<br />
nicht bringt, hat der Lehrer eben Pech gehabt, und er muss auch mit schlechten Notenvorsichtigsein.<br />
Das einzige Mittel, das ein Pflichtschullehrer heute hat, ist die positive Motivation. Das heißt, er muss für<br />
die Schüler ein „lässiger“ Typ“ sein, eine Art Showmaster, der den Stoff fesselnd bringt. Das schaffen viele<br />
gute Lehrer, aber auch sie bekommen langfristig Probleme, weil auf Dauer nie alle Schüler mitspielen.<br />
Es herrscht geradezu eine neurotische Angst vor „inhumanen“ Prüfungen und vor Selektion. Und es gibt<br />
eine missverstandene Chancengleichheit.“ Das beginnt in den Pädaks, aus denen dank weicher Prüfungen<br />
zum Teil ungeeignete Lehrer kommen.<br />
Ursache für dieses weiche Klima, das sagt auch der Präsident des Landesschulrates, könnte ein gut<br />
gemeintes, humanistisches Denken sein, das zunehmend negative Seiten zeigt. Wo niemand härter<br />
angefasst werden darf, gibt es keine Grenzen mehr für jene, die humanistische Einstellung und<br />
demokratisches Denken missbrauchen.<br />
Ob ein Schüler auf die Uni geht oder Lehrling wird, er wird sich in jedem Fall einer Selektion stellen<br />
müssen. Wenn er sich nicht eignet, fliegt er hinaus.<br />
Nur für die Lehrer gilt das nicht, bekrittelt Weitzenböck. Ein von Anfang an ungeeigneter Lehrer kann,<br />
sofern er den eigenen Leidensdruck aushält, weiterwursteln. Das führt zu überdurchschnittlich hohen<br />
Krankenständen, durch die die guten Lehrer zusätzlich belastet werden.<br />
Maßnahmen auch gegen ungeeignete Eltern<br />
Als Gegenmaßnahme versuchen die Schulbehörden etwas, das Weitzenböck „Verpsychologisierung“<br />
nennt. Wo immer Probleme bis hin zur Gewalt in der Schule auftauchen, werden Psychologen in Marsch<br />
gesetzt. Dass das an den Problemen etwas ändert, glaubt Weitzenböck nicht. Für wesentlich wirksamer<br />
hielte der Schulmann rechtliche Handhaben gegen Eltern, die absolut nichts zur Erziehung ihrer Kinder<br />
beitragen wollen und alle Probleme auf die Schule abschieben. Ein Vorschlag, der sicherlich als ketzerisch<br />
empfunden wird: „Zum Beispiel könnte man solchen Eltern zehn Prozent weniger Kinderbeihilfe zahlen.“<br />
(OÖNachrichten)<br />
A 25 Nehmen Sie in einem eigenen Leserbrief zum Zeitungsbericht von unten Stellung!<br />
Beachten Sie die Gliederung! Siehe Textsortenbeschreibung.
Schriftliche Sprachverwendung <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong>/PH-Linz Seite 40<br />
13. Weitere Impulse für den Schreibunterricht<br />
13. 1 Die Satire<br />
Ihr Reisebüro empfiehlt Ihnen diesmal:<br />
STINKENDORF AN DER DONAU<br />
Stinkendorf — die verträumte Industriestadt an der<br />
grauen Donau- Andere mögen in der ungesunden<br />
Höhenluft der Alpen auf gefährlichen<br />
Wandersteigen ihr Leben riskieren oder in<br />
überfüllten Seebädern ihre Haut zum Erröten<br />
bringen: Sie wählen die Alternative — Sie haben es<br />
besser.<br />
DER ZEiTGEMÄSSE URLAUB: Stinkendorf — es<br />
gibt nichts Erholsameres. Tausende<br />
Sommerfrischler schwören darauf! Jährlich werden<br />
es mehr.<br />
Beachten Sie auch unsere preiswerten<br />
Lungenkurangebote für die Nachsaison!<br />
Künstlerisch empfindsamen Gästen wird der<br />
ungefilterte Fabriksrauch in den schillerndsten<br />
Farben ein unvergessliches Erlebnis sein. Auf verwöhnte Feinschmecker warten die letzten<br />
Original-Donaukarpfen. Diese werden des feinen Geschmackes wegen durch so genannte<br />
Umweltgifte geködert. Der gesundheitsbewusste Gast kann in der chemisch klaren Industrieluft<br />
seine angegriffenen Bronchien ausheilen oder einem hartnäckigen Husten Lebewohl sagen.<br />
Schon nach 4 Tagen hat Ihre Haut einen feinen silbergrauen Schimmer mit blassgelben Tupfen.<br />
Ihre daheim gebliebenen Freunde werden Sie beneiden.<br />
Gönnen Sie sich einen Urlaub in einer der letzten unberührten Großindustrien!<br />
Kommen Sie mit Ihrer Familie und zeigen Sie Ihren Lieben diesen einmaligen Fleck unserer Erde!<br />
A 26 Schreiben Sie zu einem der folgenden Themen eine Satire! Gilt als zwei Aufgaben.<br />
• Unser Papi ist der beste Koch<br />
• Ein Abend ohne Fernsehen<br />
• Endlich sind die Ferien zu Ende<br />
• Die armen Schüler im Jahr 2050<br />
13. 2 Literarische Vorbilder<br />
Sturz aus 3000 m Höhe überlebt<br />
Das gemahnt fast an ein Wunder: Die -I5-jährige amerikanische Fallschirmspringerin Susan Kluger hat<br />
am Dienstag in Daytona Beach, USA, einen Sturz aus 3000 Meter Höhe überlebt. Nach einem freien Fall<br />
von 2500 Meter zog Susan die Reißleine, aber ihr Fallschirm öffnete sich nicht. Mit einer Geschwindigkeit<br />
von 64 Stundenkilometern schlug das Mädchen auf einer Rasenfläche auf. Sie erlitt verschiedene<br />
Knochenbrüche und liegt nun im Spital. (Kurier)
Schriftliche Sprachverwendung <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong>/PH-Linz Seite 41<br />
Die allerunglaublichsten Geschichten aber erzählte ein Baron seinen Stammtischfreunden vor nunmehr<br />
250 Jahren. Er hieß Karl Friedrich mit Vornamen und soll die ganze Welt gesehen haben und sogar<br />
zweimal den Mond besucht haben. Der Bibliothekar Erich Raspe hörte die Geschichten, schrieb sie<br />
heimlich nieder und ließ sie drucken. Die Erzählungen machten den Baron weithin berühmt, wenngleich sie<br />
doch stark angezweifelt werden. Ob jemals gewagt wurde, ihm ins Gesicht zu sagen, dass er lüge, ist nicht<br />
bekannt. Eine seiner Geschichten handelt davon, dass er auf einer Kanonenkugel geritten sei, wobei er<br />
den ungläubigen Zuhörern sogar noch versicherte, im Flug auf eine in die Gegenrichtung fliegende Kugel<br />
umgestiegen zu sein. Aus diesen Buchstaben kannst du den Namen des Barons bilden: HCÜUSEAMNHN<br />
Sein Name: __________________<br />
(<strong>Pramper</strong> aus: Lesestunde 1)<br />
Schülerbeispiel: Die Urenkel von Münchhausen erzählen<br />
Ich bin ein stolzer Nachfahre des berühmten Barons von Münchhausen. Meine Abenteuer sind<br />
nicht weniger aufregend als die meines Ururgroßvaters. Nur Baron nenne ich mich nicht mehr,<br />
denn diese altmodischen Titel passen nicht in unsere Zeit. Heute erzähle ich, wie es geschah,<br />
dass ich im Orient ein berühmter Mann wurde und in Bagdad sogar zum Ehrenbürger ernannt<br />
wurde. Es war auf einer meiner Reisen durch den wilden Orient. Ich wollte gerade den Kalifen von<br />
Bagdad besuchen und ihm meine Dienste anbieten, als ich kurz vor der Stadt eine dichte<br />
Nebelwand vorfand. Es mag unglaublich klingen, aber der Nebel war so dicht, dass man kaum die<br />
eigene Nasenspitze erkennen konnte. Und das mitten in der Wüste. Nur ein einheimischer Führer<br />
war in der Lage, mich zum Palast des Kalifen zu bringen. Ansonsten hätte ich den Palast wohl nie<br />
gefunden. Bitterlich weinte der Kalif und klagte mir sein Leid, dass er schon seit Wochen keine<br />
Sonne mehr gesehen habe. Da konnte ich nicht anders, als dem armen Manne zu helfen. Auf<br />
meine Anordnung wurden in der Stadt alle Fischernetze zusammengebunden und in einem<br />
Halbkreis außerhalb der Stadt aufgelegt. Dann befestigte ich am unteren Ende schwere Steine<br />
und am oberen einen großen Schwärm Rebhühner. Als es soweit war, musste die Bevölkerung<br />
von Bagdad Krach erzeugen, um die Rebhühner aufzuscheuchen. Was soll ich euch sagen, in<br />
kurzer Zeit war die Stadt vom Nebel befreit und ich durfte ein Jahr lang Gast des Kalifen sein.<br />
Danach wurde ich, mit Geschenken überhäuft, verabschiedet. Dieser goldene Dolch war ein"<br />
Ehrengeschenk der Bürger Bagdads. Übrigens ist der Nebel nie wiedergekehrt. Davon könnt ihr<br />
euch noch heute überzeugen.<br />
Robert von Münchhausen<br />
A 26 Verfassen Sie einen Text zum Thema: Ein Urururenkel von Münchhausen erzählt!
Schriftliche Sprachverwendung <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong>/PH-Linz Seite 42<br />
13. 3 Texte mit hohem Motivationscharakter<br />
Rätsel (Versteckte Tiere, Entdeckungen,..), Parodien (Grabrede auf<br />
einen Gegenstand, Weltrekorde,... ), Gedichte(Schüttelreime)<br />
Viel Spaß mit der Sprache Spaß mit Tierrätseln<br />
Der Jagufant<br />
Erik Newhost, der bekannte englische Forscher, hat von seiner<br />
letzten Expedition in Borneo sensationelle Berichte und Fotos<br />
mitgebracht. Endlich ist es gelungen, das seit Jahrhunderten<br />
geheimnisumwitterte Lebewesen, den Jagufanten, über längere Zeit<br />
zu beobachten und zu fotografieren. Es handelt sich dabei<br />
offensichtlich um die Kreuzung eines Jaguars, eines Kängurus und<br />
eines Elefanten- Dieses aufrecht gehende, fleischfressende<br />
Raubtier bringt meist zwei Junge zur Weit. Die recht<br />
wollknäuelartigen und blinden Jungtiere verbringen die ersten<br />
Lebenswochen im Kängurubeutel. Der Jagufant geht häufig im<br />
Morgengrauen zur Jagd auf Rebhühner und Kaninchen. Danach<br />
nimmt er ein erfrischendes Bad, staubt seinen Körper mit trockener<br />
Steppenerde ein und verbringt den Rest des Tages in einer<br />
Baumkrone kauernd. Dabei sind schnurrende Laute des<br />
Wohlbehagens zu hören.<br />
Der Jagufant — fotografiert in Borneo am 1. 4. 1988<br />
Wahrscheinlich bist auch du schon recht außergewöhnlichen Tieren begegnet. Berichte über ihr Aussehen<br />
und ihre Lebensgewohnheiten! Bei der Namensgebung können dir folgende bereits entdeckte<br />
Tiergattungen hilfreich sein:<br />
Kro/ko/dil, E/le/fant, Ka/ka/du, Zie/gen/bock, See/lö/we, Schim/pan/se, Pan/da/bär, Ja/gu/ar<br />
Suche die versteckten Tiere!<br />
Am selben Vormittag wollte sich Erich ein Fahrrad anschaffen. Obwohl zuerst sein Papa geizte, kaufte er<br />
doch von einem befreundeten Sensal am anderen Tag ein Rad. Bei seiner ersten Ausfahrt in den<br />
Seilergraben sah er neugierige Leute auf dem Aussichtsturm. Auf der Straße kam ihm der Advokat Zenka<br />
und Freiherr von Bernhard in Erlangen entgegen. Bei einem Meilenstein bockte ein Ross vor dem Radler<br />
und wurde scheu. Ein Wächter mit Energie ging an seine Seite, und es gelang ihm, tapfer den Wagen zu<br />
halten. Das bärenstarke Ross war jedoch auf dem eisernen Kanalgitter gestürzt und kam elend um. Ein<br />
gewaltiger Krach war bis zum Dachstuhl des angrenzenden Hauses zu hören. Steine sah man fliegen, und<br />
es lag ein Mensch lange ausgestreckt da.<br />
A 28 Erfinden Sie einen Text mit versteckten Tieren, Küchengeräten oder Schulsachen.<br />
Zuerst legen Sie eine entsprechende Wörterliste an, dann erst beginnen Sie mit einer<br />
Geschichte!
Schriftliche Sprachverwendung <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong>/PH-Linz Seite 43<br />
13. 4 Parodien<br />
Westernparodie (von Monika Helndl)<br />
Hilflos war er ihm ausgeliefert. Verdammt, er<br />
hätte auf sein Gefühl vertrauen und in seinen<br />
sicheren vier Wänden bleiben sollen. Jetzt war<br />
es zu spät. Mit funkelnden Augen, seiner Beute<br />
sicher, stand ihm der Weiße gegenüber. Mit<br />
diesem Kerl war nicht zu spaßen, ein Meister in<br />
der Handhabung der Waffe, die in seiner<br />
Rechten funkelte und langsam näher kam. Hinter<br />
ihr ein teuflisches Grinsen. George erkannte<br />
seine Ohnmacht. Schweiß perlte von seiner<br />
Stirn. Da gab er jeden Widerstand auf und legte<br />
sich kampflos hin. Der Weiße war einfach der<br />
Stärkere. Der Triumph der Überlegenheit sprühte<br />
aus dessen Antlitz. Jetzt konnte er George fertig<br />
machen. Der riesige Kerl hatte schon mit<br />
teuflischem Spürsinn bemerkt, was in ihm<br />
vorging. Mit betont ruhigem Tonfall sägte der<br />
Weiße: „Sie brauchen nicht nervös zu sein.<br />
Machen Sie bitte den Mund weit auf, damit ich<br />
den Unruhestifter untersuchen kann."<br />
Lebewohl,<br />
ich werde dich nie vergessen! Du hast mir lange<br />
gedient. Du hast dich nicht wichtig gemacht, du<br />
warst wichtig!<br />
Du hast dich für mich aufgeopfert. Weißt du<br />
noch, wie oft ich dich misshandelt habe? Du<br />
wurdest in eine Ecke geschleudert, wenn ich<br />
wütend war. Du wurdest sinnlos bekritzelt, und<br />
manchmal strafte ich dich mit Verachtung.<br />
Wochenlang würdigte ich dich keines Blickes.<br />
Meine Reue kommt zu spät, denn vor einem<br />
halben Jahr bemerkte ich das Schreckliche: Du<br />
wurdest mager, immer magerer. Mit jeder<br />
Woche, die verging, wurdest du dünner und<br />
dünner. Kein Arzt konnte dir mehr helfen. Du<br />
nahmst deine Schmerzen klaglos und tapfer auf<br />
dich. Nach langer Krankheit, die du mit großer<br />
Geduld ertragen hast, bist du nun am 31.<br />
Dezember um 0.00 Uhr verstorben' Meine Trauer<br />
kennt keine Grenzen. Mein Herz bebt vor<br />
Schmerz. Du, mein lieber Kalender, wirst immer<br />
in meiner Erinnerung bleiben.<br />
A 29 Gestalten Sie eine ähnliche Parodie mit einer überraschenden Wende!<br />
13. 5 Zweizeiler<br />
Zweizeiler mit Vornamen<br />
Die Michi von der Heide,<br />
ist eine Augenweide.<br />
Ganz anders ist die Barbara,<br />
die steht auf hübsche Hawara.<br />
Astrid, meistens leicht verträumt,<br />
hat in Mathes viel versäumt.<br />
Bauernregeln<br />
Geht der Traktor aus dem Leim,<br />
bleibt der Bauer halt daheim.<br />
Kommt der Bauer mit den Krücken,<br />
hat er´s wieder mit dem Rücken.<br />
Scheint im Juni sehr viel Sonne,<br />
braucht man keine Regentonne.
Schriftliche Sprachverwendung <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong> Seite 44<br />
Schreiben über sich<br />
Der Zauberspiegel<br />
Als ich 14 war, gefiel ich mir überhaupt nicht, nichts an mir passte mir. Ich wollte so schön sein wie Jessica Alba aus<br />
dem Fernsehen. Meine Mutter aber sagte immer, ich solle froh sein, dass ich nicht eine Schauspielerin sei, weil ich<br />
dann nicht in Ruhe leben könnte. Andauernd werden sie von Fotografen und Reportern verfolgt, versuchte sie mir zu<br />
erklären. Gerade das aber stellte ich mir herrlich vor, wenn Fotos und Berichte von mir täglich in allen Zeitungen und<br />
Zeitschriften wären.<br />
Es war an einem Sonntag. Ich wollte einen Film mit Brad Pitt im Kino<br />
sehen. Beim Weggehen warf ich einen Blick in den Spiegel. Wie<br />
angewurzelt blieb ich stehen. Aus dem Spiegel blickte mir jemand<br />
entgegen, der so aussah wie Jessica Alba. Ich zwickte mich in die<br />
Wange bis es schmerzte. Ich war Jessica Alba! Mein Traum war<br />
Wirklichkeit geworden. Meine Schönheit war wirklich<br />
bewundernswert.<br />
Als ich auf dem Weg ins Kino war, blickten mir viele Menschen nach.<br />
Sie tuschelten und wunderten sich, dass diese berühmte und schöne<br />
Frau in unserer kleinen Stadt war. Die Frauen bewunderten meine<br />
Frisur und meine Kleidung, die Männer meine Figur. Bald tauchten die<br />
ersten Fotografen auf. Sie riefen mir zu, weil sie mich fotografieren<br />
wollten. Auch Zeitungsreporter kamen. Sie stellten mir viele Fragen,<br />
auf die ich keine rechte Antwort wusste. Die Menschen auf der Straße<br />
umringten mich. Sie baten um ein Autogramm. Ich lehnte ab und bat sie, mich weiter gehen zu lassen, weil ich doch<br />
den Film sehen wollte. Aber sie hörten nicht auf und bedrängten mich immer heftiger. Einige bettelten sogar<br />
aggressiv um Geld. Ich konnte mich kaum noch wehren. Schließlich sagte ich, dass ich gar nicht Jessica sei. Niemand<br />
glaubte mir. Irgendwie gelang es mir dann doch, den vielen Menschen zu entkommen. So schnell ich konnte, lief ich<br />
nach Hause. Dort angekommen verzog ich mich unbemerkt auf mein Zimmer und schloss mich ein. Irgendwann<br />
schlief ich erschöpft ein.<br />
Als ich mich am nächsten Morgen aufstand, war mein erster Weg zum Bad. Bevor ich in den Spiegel blickte, musste<br />
ich all meinen Mut zusammennehmen. Hatte ich alles nur geträumt? Mein Leben stand an einer entscheidenden<br />
Wende.<br />
(Nach Bunte Schreibwerkstätte, <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong>, Veritas-Verlag)<br />
A 30 Überarbeite Sie den Aufsatz! Das Schülerbeispiel ist gut, aber es würde noch besser<br />
wirken, wenn wörtliche Reden, Gefühltes und Gedachtes im Erzählhöhepunkt eingearbeitet<br />
wären!<br />
Neue Jeans<br />
Vergangenes Wochenende hatte ich von meiner Oma Geld für neue Jeans bekommen. Gleich am Montag ging ich in<br />
ein bekanntes Großkaufhaus, um mir schöne Jeans auszusuchen. Bald hatte ich einige gefunden, die mir gefielen. Ich<br />
nahm sie mit in die Umkleidekabine. Der Reihe nach probierte ich sie an und entschied mich für eine eigenartig<br />
schimmernde blaue, von der ich das Gefühl hatte, dass sie mir besonders gut passen würde. Dann verließ ich die<br />
Kabine und betrachtete mich zufrieden im Spiegel. Irgendwie schien es, als würde mich die Hose verändern. Ich<br />
fühlte mich selbstsicher und zu allerlei Unfug aufgelegt. Mit jeder Bewegung vor dem Spiegel gefiel ich mir mehr.<br />
Noch nie zuvor hatte ich mich so gut proportioniert und schön gesehen. Ich beschloss die Hose zu kaufen und zog<br />
mich in der Kabine um. Auf dem Weg zur Kassa warf ich im Vorbeigehen einen Blick in den Spiegel. Da war zu<br />
meiner Überraschung wiederum nur das von mir zu sehen, was ich schon tausende Male zuvor gesehen hatte. Ein<br />
pummeliger Körper, strähnige Haare und ein Durchschnittsgesicht. …
Schriftliche Sprachverwendung <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong> Seite 45<br />
Wie geht es weiter?<br />
Welche Erklärungen kann es dafür geben? Spukspiegel? Schabernack oder Test? Wie werde ich zu Hause mit<br />
der Hose aussehen?<br />
A 31 Wie kann es weiter gehen? Setze den Textanfang fort! Schildere die Gefühle des Ich-<br />
Erzählers!<br />
14. Beschreibungen der Aufsatzarten und Tipps für die Schreiber<br />
Bericht<br />
Der Bericht ist eine sachliche, genaue und knappe Darstellung eines besonderen Ereignisses.<br />
Die Berichterstatterin, der Berichterstatter tritt in den Hintergrund.<br />
Beim Bericht ist die Angabe aller Einzelheiten wichtig. Auf eine treffende Wortwahl ist zu achten.<br />
Tipps für Schülerinnen und Schüler<br />
• Stelle das Ereignis sachlich und mit vielen Informationen dar!<br />
• Beantworte die wichtigen W-Fragen: Was? Wer? Wann? Wo? Warum? Welche Folgen?<br />
• Die Sprache soll sachlich sein, deine persönliche Meinung ist nicht erkennbar.<br />
• Bau keinen Spannungshöhepunkt wie bei der Erlebniserzählung ein!<br />
• Gib wörtliche Reden indirekt wieder!<br />
So kannst du deinen Bericht gliedern:<br />
• Einleitung: Wann, wer, was, wohin, warum?<br />
• Hauptteil: sachlicher Bericht, was geschah alles, Wichtiges interessant und genau erklären<br />
• Schluss: ein Resümee (zusammenfassende Bewertung) geben<br />
Bewerbungsschreiben<br />
Das Bewerbungsschreiben ist in der Art eines Normbriefes abzufassen.<br />
Im Bewerbungsschreiben wird der Empfänger genau und richtig über die Voraussetzungen und<br />
Fähigkeiten des Bewerbers, der Bewerberin unterrichtet.<br />
Der Form und dem Inhalt kommen für den Erfolg große Bedeutung zu, daher sollte das Schreiben sehr<br />
sorgfältig geplant und ausgeführt werden.<br />
Gliederung:<br />
• Bezug nehmen, z.B. auf ein Inserat<br />
• Interesse am Beruf bekunden<br />
• Gegenwärtige Schulsituation und Lebensplanung beschreiben<br />
• Vorsätze im Fall einer Aufnahme<br />
• Um Antwortbrief und/oder Gespräch ersuchen<br />
Tipps für Schülerinnen und Schüler<br />
• Du bekundest dein Interesse an der Arbeitsstelle und erklärst, warum du dich dafür geeignet fühlst (Anführen<br />
der Ausbildung).<br />
• Du informierst ehrlich und genau und zeigst deinen guten Willen. Du würdest dich bestmöglich einsetzen.<br />
Keine Übertreibungen!<br />
• Achte auf die Schreibung der Anredefürwörter: höfliche Anrede eines Erwachsenen (Sie, Ihnen …) groß,<br />
vertraute Anrede (du, dein …) klein!<br />
• Beachte die Form des Briefes (Ränder, Absätze, gut leserliche Handschrift oder Computerausdruck)!
Schriftliche Sprachverwendung <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong> Seite 46<br />
Bildgeschichte<br />
Eine Bildgeschichte ist im Stil einer Erlebniserzählung abzufassen.<br />
Die meist 3 bis 6 Bilder – mit einer Pointe – geben ein Erlebnis, einen Vorfall wieder.<br />
Die Schreiberin, der Schreiber muss zwar den vorgegebenen Inhalt beachten, soll aber durchaus selbst<br />
Namen,<br />
Zeit, Ort, eine Vorgeschichte und eventuell auch eine Nachgeschichte mit kreativen, eigenen Ideen<br />
ergänzen.<br />
Die Bildgeschichte kann als Ich- oder Er/Sie-Erzählung abgefasst werden.<br />
Tipps für Schülerinnen und Schüler<br />
• Der Leser, die Leserin soll die Geschichte verstehen, auch ohne die Bilder zu kennen.<br />
• Ergänze keine neuen Inhalte, aber Ausschmückungen (Namen, Orte, Zeiten, Situationen, Vor- und<br />
Nachgeschichte)!<br />
• Überlege, welche Bilder den Hauptteil darstellen, beschreibe diese Bilder besonders genau!<br />
Erzähle den Höhepunkt der Geschichte in Zeitlupe!<br />
• Überlege, bevor du zu schreiben beginnst, was deine Geschichte lebendig machen könnte!<br />
Deine Geschichte ist nicht bloß eine Nacherzählung der Bilder, eigene Ideen machen die Geschichte lebendig<br />
und einzigartig. Gib an, was sich „zwischen” den Bildern ereignet!<br />
• Finde eine passende Überschrift, einen interessanten Beginn und Schluss und vielleicht sogar eine<br />
Rahmenhandlung!<br />
• Gib den Personen Namen! Beschreibe auch, was du jeweils aus dem Gesichtsausdruck der einzelnen<br />
Personen „ablesen“ kannst und was ihre Gesten aussagen!<br />
Brief<br />
Der persönliche oder private Brief ist heute an keine festen Vorschriften gebunden.<br />
Für Anrede- und Grußformel gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Der Aufbau sollte jedoch gegliedert<br />
sein.<br />
In der Einleitung wird der Anlass des Schreibens deutlich. Im Hauptteil werden die Einzelheiten übermittelt,<br />
hier sollte man auch als Schreiber/in mit bedenken, was die Leserin, der Leser fragen könnte.<br />
Im Schlussteil sollte die Leserin, der Leser noch einmal persönlich angesprochen werden.<br />
Es wirkt unhöflich, wenn das Ende überraschend erfolgt.<br />
Tipps für Schülerinnen und Schüler<br />
• Vermeide Ausbesserungen!<br />
• Achte darauf, dass ein Rand um den Text frei bleibt (zwei Finger breit)!<br />
• Vergiss nicht auf Anrede, Ort und Datum, Grußformel!<br />
• Höfliche Anredefürwörter („Sie“) für Erwachsene sind groß zu schreiben; die vertraute Anrede („du“)<br />
wird klein geschrieben.<br />
Buchkritik<br />
Eine Buchkritik bringt zunächst eine kurze Inhaltsangabe oder Nacherzählung, dann eine Aussage über<br />
die Sprachgestaltung und zuletzt eine persönliche Bewertung.<br />
Unter Sprachgestaltung versteht man:<br />
• Um welche Textart handelt es sich: Kurzgeschichte, Liebesroman, Krimi, Science fiction, …<br />
• Erzählform: Ich-Erzähler, Er/Sie-Form), Erzählverhalten, Erzählperspektive<br />
• Wird Wirklichkeit, Vergangenes oder reine Fantasie dargestellt?<br />
• Wie ist die Einleitung gestaltet, die Personenvorstellung, der Spannungshöhepunkt, der Schluss<br />
Tipps für Schülerinnen und Schüler<br />
• Zuerst gib in einer Inhaltsangabe das Wichtigste der Handlung an! (Inhaltsangabe im Präsens,<br />
Nacherzählung im Präteritum)
Schriftliche Sprachverwendung <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong> Seite 47<br />
• Dann beschreib Sprachgestaltung Textart, Erzählform, Wirklichkeitsdarstellung! Weiters kannst du<br />
auch untersuchen, wie die Einleitung, die Personenvorstellung, die Hinführung zum Spannungshöhepunkt<br />
und der Schluss gestaltet sind.<br />
• Abschließend bewerte das Buch! Gib an, wie es dir gefallen hat, was besonders interessant, spannend,<br />
lustig war, was dir weniger gut gefallen hat. Vergleiche den Inhalt mit dir bekannten ähnlichen Büchern!<br />
Versuche auch deine Bewertung zu begründen!<br />
Charakteristik<br />
Die Charakteristik stellt eine Erweiterung der Personenbeschreibung dar.<br />
In der Charakteristik wird zunächst das Äußere einer Person beschrieben (siehe Personenbeschreibung)<br />
und anschließend deren Charaktereigenschaften, die Erfahrungen, die den Schreiber, die Schreiberin mit<br />
der beschriebenen Person verbinden sowie Dauer und Verlauf der Beziehung.<br />
Danach sollen die Zukunftspläne der charakterisierten Person, ihre Familienumstände und das Verhalten<br />
in außergewöhnlichen Situationen angegeben werden.<br />
Zuletzt kann man angeben, wie man die zukünftige Entwicklung der Person und der Beziehung erwartet.<br />
Tipps für Schülerinnen und Schüler<br />
• Zuerst gib an, um wen es sich bei deiner Beschreibung handelt (Name, Geschlecht, Alter, Größe), dann<br />
beschreibe die äußeren Merkmale genau und gehe in einer bestimmten (z. B. von oben nach unten)<br />
Reihenfolge vor (Körperbau, Gesichtsform, Haare, Haut, Kleidung …)!<br />
• Anschließend gib Informationen über die Wirkung der Person (Haltung, Bewegungen, Gewohnheiten,<br />
Gesichtsausdruck, Stimme …), gib auch Auffälligkeiten und Besonderheiten an, die die Person von anderen<br />
unterscheiden (Brille, Narbe …)!<br />
• Die zweite Hälfte widme den Charaktereigenschaften der beschriebenen Person! Erkläre auch, was dich mit ihr<br />
verbindet, ihre Zukunftspläne, Familienumstände und ihr Verhalten in außergewöhnlichen Situationen!<br />
• Zuletzt gib an, wie du die weitere Entwicklung der Person und der Beziehung einschätzt!<br />
Erlebniserzählung<br />
In der Erlebniserzählung werden nicht nur Informationen über den Hergang einer möglichen oder<br />
tatsächlich erlebten Geschichte gegeben, sondern auch Empfindungen mitgeteilt. Die Gliederung soll die<br />
beabsichtigte Wirkung beim Zuhörer (Freude, Mitleid, Angst) fördern.<br />
Gliederung:<br />
Die Überschrift macht neugierig, aber verrät nicht zu viel.<br />
Die Einleitung informiert kurz über das Wer?, Wann?, Wo? des Ereignisses. Das Was? beginnt.<br />
Der Hauptteil wird von Zeile zu Zeile spannender, interessanter, lustiger.<br />
Wörtliche Reden, Gefühle, Gedanken wiedergeben!<br />
Der Höhepunkt löst die Spannung. Die Lösung der Geschichte liegt vor.<br />
Der Schlussteil rundet die Geschichte ab, es kann auch eine überraschende Wende geben (Pointe).<br />
Der Schlusssatz hält oft fest, was man aus dem Erlebnis gelernt hat.<br />
Tipps für Schülerinnen und Schüler<br />
• Achte auf abwechslungsreiche Satzanfänge! (Nicht immer „Ich“, „Er“ oder „Dann“!)<br />
• Verbinde kurze Gedanken zu einem längeren Satz! Vermeide aber lange komplizierte Sätze! Eine gute<br />
Mischung wirkt interessant. Kurze Sätze ziehe zusammen! Zu lange Sätze trenne dort, wo ein neuer Gedanke<br />
beginnt<br />
• Vermeide unnötige Wortwiederholungen und gleiche Satzanfänge! Suche nach Ersatzwörtern, wenn knapp<br />
hintereinander dasselbe Wort vorkommt!<br />
• Erzähle so, dass es für den Leser interessant oder spannend ist: Beschreibe den Höhepunkt der Geschichte<br />
sehr genau, gib auch Gefühltes und Gedachtes an!<br />
• Die Erlebniserzählung wird im Präteritum geschrieben, im Höhepunkt kann das so genannte szenische<br />
Präsens verwendet werden.<br />
• Verwende nur sehr selten Wörter wie „machen“, „tun“, „sagen“, „gehen“!
Schriftliche Sprachverwendung <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong> Seite 48<br />
Erzählkern zu einer Erzählung ausgestalten<br />
Textsorten-Charakteristik<br />
Eine Erzählkern-Ausgestaltung ist wie eine Erlebniserzählung abzufassen. Erzählkerne sind knappe,<br />
interessante, aussagekräftige Berichte, die das Gerüst des Handlungsverlaufes darstellen. Sie geben<br />
Personen, Ort und Zeit vor. Die Vorgaben sind genau zu beachten, sie können durch eigene Ideen<br />
erweitert, aber nicht verfremdet werden.<br />
Die Erzählperspektive (Sicht, aus der erzählt wird) kann frei gewählt werden: Ich-Erzählung (Person,<br />
Tier, Sache) oder Er/Sie-Erzählung.<br />
• Ich-Form – erzählt wird aus der Sicht der Hauptfigur oder einer beteiligten Person in der Geschichte,<br />
eines Tieres oder eines Gegenstandes.<br />
• Er/Sie-Form – erzählt wird aus der Sicht einer beobachtenden, allwissenden Person, die in der<br />
Geschichte nicht erwähnt wird.<br />
Tipps für Schülerinnen und Schüler<br />
• Lege die Sichtweise fest, aus der die Geschichte erzählt wird. (Ich- oder Er/Sie-Erzählung)<br />
• Oft enthalten die Erzählkerne noch keinen Schluss, den kannst du selbst erfinden.<br />
• Erfinden sollte man auch eine ideenreiche Vorgeschichte<br />
Erzählfortsetzung<br />
Erzählfortsetzungen sind wie Erlebniserzählungen abzufassen. Zum vorgegebenen Erzählanfang oder -<br />
ende soll eine entsprechende Fortsetzung gefunden werden, die möglichst nahtlos an der Vorgabe<br />
ansetzt.<br />
Der vorgegebene Textteil stellt für die SchreiberInnen eine Erleichterung dar, weil sie kein Thema finden<br />
müssen, aber er beinhaltet auch die Aufgabe, den Stil der Vorgabe und die Form (Ich- oder Er/Sie-<br />
Erzählung) beizubehalten.<br />
Originelle eigene Ideen sind erwünscht, wenn sie nicht gegen den Inhalt der Vorgabe laufen.<br />
Der Schreiber, die Schreiberin muss selbst eine Überschrift wählen, am besten nach erfolgter<br />
Textproduktion.<br />
Tipps für Schülerinnen und Schüler<br />
• Lies die Vorgabe mehrmals durch, achte auf inhaltliche Einzelheiten!<br />
• Beachte den Stil der Sprachverwendung, erkenne die Merkmale!<br />
• Stelle die Erzählsicht (Ich/Er-/Sie-Erzählung) fest und führe sie weiter!<br />
Erörterung<br />
Erörtern heißt, zu einer noch unentschiedenen Frage Stellung nehmen, indem die unterschiedlichen<br />
Standpunkte zur Sprache kommen. Der Schreiber begründet nicht nur die Standpunkte, er bewertet sie<br />
auch. Die Ansichten stützen sich auf die Sachkenntnis der Tatsachen (Beobachtungen, Berichte,<br />
statistische Daten, Internetrecherchen, Aussagen von Fachleuten, allgemein anerkannten Normen und<br />
Werten). Die Schlussfolgerungen müssen logisch begründet sein. Gliederung:<br />
Einleitung: Darlegen, worum es geht. (aktueller Anlass, Bedeutung des Themas, Begriffsbestimmung)<br />
Hauptteil: a) mehrere eigene und allgemeine Argumente (Standpunkte + Begründungen) darlegen,<br />
b) erwartete Widersprüche aufzeigen und widerlegen<br />
Schluss: Schlussfolgerungen, Auswirkungen der jeweiligen Standpunkte bewerten, eigene Forderungen,<br />
Wünsche nennen<br />
Tipps für Schülerinnen und Schüler<br />
• Gib an, warum das Thema allgemein und für dich persönlich wichtig ist!<br />
• Gib deine Standpunkte an und begründe sie!<br />
• Führe mögliche Gegenargumente an und entkräfte sie!<br />
• Zeige Zukunftsaussichten und wünschenswerte Entwicklungen auf!<br />
• Gliedere die Erörterung gut und füge Absätze ein!
Schriftliche Sprachverwendung <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong> Seite 49<br />
Exzerpt<br />
Das Exzerpt stellt eine Arbeitstechnik dar, bei der stichwortartig, rationell, zusammenfassend<br />
Informationen aus einem längeren meist sachlichen Text entnommen werden. Die Hauptaussagen des<br />
Textes müssen im Exzerpt enthalten sein. Zur Vorbereitung des Exzerptes wird der Text gelesen,<br />
Unverständliches geklärt, wichtige Fakten und Begriffe unterstrichen, durch Pfeile werden Beziehungen<br />
zwischen Textstellen hergestellt, Teilüberschriften werden gesucht in die das Wichtigste zusammenfassen<br />
eingeordnet wird. Mit Farbe und anderen Gestaltungsmittel kann auch optisch die Übersicht verbessert<br />
werden.<br />
Tipps für Schülerinnen und Schüler<br />
Ein Exzerpt muss die wichtigsten Informationen des zu exzerpierenden Textes enthalten.<br />
Beim Exzerpieren gehe so vor:<br />
• Unterstreiche das Wesentliche und Allgemeingültige, stelle mit Pfeilen Beziehungen her!<br />
• Schreibe Stichwörter und Wortgruppen (keine Sätze) heraus!<br />
• Ordne das Herausgeschriebene übersichtlich, lege Teilüberschriften an, fasse den Inhalt in Wortgruppen oder<br />
sehr einfachen Sätzen zusammen!<br />
• Mit Farbe und anderen Gestaltungen (fett, unterstrichen, Blockschrift) kannst du die Übersichtlichkeit weiter<br />
verbessern.<br />
Fantasieerzählung<br />
Die Fantasieerzählung ist eine frei erfundene Erzählung, die ein unwahrscheinliches Thema behandelt.<br />
Abzufassen ist sie wie eine Erlebniserzählung. Die Geschichte ist zwar fantastisch, besitzt aber eine innere<br />
Logik. Nur einige wenige Gesetze der Wirklichkeit werden in der Geschichte außer Kraft gesetzt. Die<br />
Geschichte wirkt besser, wenn nur ein kleiner Teil fantasievoll ausgeschmückt ist. Meist handelt es sich um<br />
eine Ich-Erzählung.<br />
Tipps für Schülerinnen und Schüler<br />
• Gib bei Verwandlungen an, wie es dazu gekommen ist, was du erlebt hast und wie sich der Zustand wieder<br />
geändert hat!<br />
• Manchmal eignet sich auch ein offenes Ende gut, denn der Leser, die Leserin kann Vermutungen anstellen,<br />
wie es weitergeht.<br />
• Übertreibe mit Augenmaß!<br />
• Skizziere vor Schreibbeginn den Verlauf der Geschichte und ihr Ende!<br />
Gegenstandsbeschreibung<br />
Die Gegenstandbeschreibung ist die sachliche Darstellung der besonderen Merkmale eines Gegenstands,<br />
eines Raumes oder Hauses.<br />
Die LeserInnen sollen sich ein genaues Bild vom Gegenstand machen können, ohne ihn zu kennen.<br />
Gliederung:<br />
• Benennung, Größe, Farbe, Lage<br />
• Einzelheiten (von außen nach innen, vom Auffälligen zum Besonderen oder umgekehrt)<br />
• Material, Farben<br />
• Verwendungszweck…<br />
Tipps für Schülerinnen und Schüler<br />
• Zuerst gib genau an, worum es sich handelt und wo sich der Gegenstand, das Zimmer etc. befindet!<br />
• Dann erkläre Schritt für Schritt alle Einzelheiten!<br />
• Wähle einen sehr sachlichen und knappen Stil, aber achte auf die Vollständigkeit!<br />
Beschreibe anschaulich, wie sich das Material angreift, welche Farben es hat, manchmal auch, wie etwas<br />
riecht!<br />
• Vergiss nicht auf die Beschreibung des Gesamteindrucks und der Bedeutung, den der Gegenstand für dich<br />
hat!
Schriftliche Sprachverwendung <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong> Seite 50<br />
Interview<br />
ReporterInnen versuchen in einem Interview möglichst viel Interessantes von der jeweiligen<br />
Gesprächspartnerin, vom jeweiligen Gesprächspartner zu erfahren.<br />
Fragen werden vermieden, auf die man nur mit Ja oder Nein antworten kann.<br />
Einige Fragen sind vorbereitet und während des Gespräches werden weitere formuliert, die auf die<br />
Antworten Bezug nehmen (Nachstoßfragen). Gute ReporterInnen vermeiden den Eindruck, dass sie bei<br />
den Antworten, die sie bekommen, nicht mitdenken, sie werden aber auch die Interviewten nicht<br />
bloßstellen.<br />
Tipps für Schülerinnen und Schüler<br />
• In einem Interview sollen zwei bis drei Themen zur Sprache kommen. Das heißt aber nicht, dass nur<br />
zwei oder drei Fragen gestellt werden.<br />
• Formuliere jeweils weitere Fragen auf Grund der Antworten zu einem Themenkreis!<br />
• Das Interview soll eine Einleitung (Was Thema ist, was man vorhat) und einen Schluss haben<br />
(Danken für das Gespräch).<br />
• Verwende keine Anführungszeichen, auch wenn es sich hier um wörtliche Reden handelt!<br />
Kochanleitungen<br />
Die Kochanleitung ist die sachliche Darstellung von jederzeit wiederholbaren Vorgängen. Darin<br />
unterscheidet sie sich vom Bericht. Die genaue zeitliche Reihenfolge des Vorganges ist wichtig.<br />
Gliederung:<br />
• Einleitung: Material, Zutaten, Werkzeug, Geschirr, etc.<br />
• Hauptteil: genaue Beschreibung der einzelnen Vorgänge.<br />
• Schluss: Angabe des Ziels, der Ergebnisse, Bewertung, Zweck.<br />
Tipps für Schülerinnen und Schüler<br />
• Zuerst gib genau an, was für den Kochvorgang notwendig ist (Zutatenliste)!<br />
• Dann erkläre in der richtigen Reihenfolge, was zu machen ist!<br />
• Wähle einen sehr sachlichen und knappen Stil, aber achte auf Vollständigkeit!<br />
Gib auch Einzelheiten und „Extras“ an!<br />
• Das Kochrezept kann auf verschiedene Weise geschrieben werden:<br />
mit dem unpersönlichen Fürwort „man“ und im Passiv mit „wird“ oder „ist“ oder mit dem Imperativ.<br />
Kurzgeschichten<br />
Kurzgeschichten sind im Stil von Erlebniserzählungen abzufassen. Jedoch stellen<br />
Kurzgeschichten die künstlerische Wiedergabe eines entscheidenden Lebensabschnittes<br />
(Schicksalsbruches) dar. Zur Charakteristik der Kurzgeschichte gehört ein unmittelbarer Beginn,<br />
ohne lange Erklärungen. Ursachen und Folgen einer Entwicklung bleiben im Dunkeln, die<br />
erzählte Zeit umfasst nur eine kurze Zeitspanne, eine neutrale Erzählhaltung herrscht vor. Die<br />
Hauptpersonen sind keine Helden, sondern Außenseiter der Gesellschaft oder einfache<br />
Menschen. Oft kommt es zu einer überraschenden Wende und meist zu einem plötzlichen Ende<br />
ohne Schlussteil. Ein offenes Ende im Text, soll die gedankliche Weiterführung des Lesers<br />
anregen.<br />
Kriminalgeschichten<br />
Kriminalgeschichten gehören zu den fantastischen Erzählungen.<br />
Sie können entweder als Bericht oder als Kurzgeschichte gestaltet werden. Das heißt, bei einem<br />
Bericht kommt es darauf an, dass möglichst genau (siehe W-Fragen) und chronologisch (der<br />
Reihe nach) bis zur Aufklärung des Falls berichtet wird.
Schriftliche Sprachverwendung <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong> Seite 51<br />
Bei einer Kurzgeschichte kann z.B. mit einem szenischen Einstieg begonnen werden, die<br />
Geschichte wird dann in der Form einer Rückblende aufgerollt und mit einem offenen Ende wird<br />
sie abgeschlossen.<br />
Lebenslauf<br />
Der Lebenslauf ist ein wichtiger Bestandteil einer Bewerbung.<br />
Er soll handschriftlich ausgeführt werden und sachlich die Fakten der Lebensstationen berichten.<br />
Die Tabellenform ist unpersönlicher als die erzählende Form.<br />
Gliederung:<br />
• Zunächst die persönlichen Daten (Name, Geburtsdatum, -ort, Eltern, Geschwister) nennen.<br />
• Danach folgen Angaben über Schul- und Berufsausbildung, ev. berufliche Tätigkeiten.<br />
• Abschließend: private Interessen, Berufswünsche, Zukunftspläne.<br />
Tipps für Schülerinnen und Schüler<br />
• Verfasse deinen Lebenslauf handschriftlich, fehlerfrei, sauber, mit freiem Rand!<br />
• Vermeide Korrekturen!<br />
• Berichte zuerst deine persönlichen Daten, die Familiensituation,<br />
• dann deine Lebens- und Schulstationen, deine Ausbildungs- und Berufsziele<br />
• und zuletzt von deinen schulischen Interessen, Fähigkeiten und privaten Hobbys!<br />
Leserbrief<br />
Der Leserbrief macht es möglich, mit persönlichen Äußerungen zu aktuellen Themen an die Öffentlichkeit<br />
zu treten. Die Medien und politisch Verantwortliche erfahren so von der Wirkung der Berichterstattung bei<br />
den LeserInnen.<br />
Gliederung:<br />
1. Die Überschrift und eine kurze Einleitung geben das Thema an. Bezug zu einem Ereignis<br />
oder Zeitungsbericht oder Kommentar.<br />
2. Die eigene Meinung wird in klaren Argumenten dargelegt.<br />
3. Vorschläge zur Änderung, Aufforderung, Appell.<br />
4. Unterschrift (Adresse)<br />
Tipps für Schülerinnen und Schüler<br />
• Wähle ein Thema, das von allgemeinem Interesse ist und über das du einigermaßen Bescheid weißt!<br />
• Versuche nicht mit deiner persönlichen Lebenssituation zu argumentieren, sondern so, dass es für viele zutrifft!<br />
(Nicht: Ich gehe in die 4. Klasse, daher will ich…)<br />
• Schreib zu Beginn, worauf du dich beziehst! Erkläre, wie die Situation ist!<br />
• Was sollte sich ändern, wie sollte es sein? Formuliere deine Standpunkte und deine Begründungen!<br />
• Was kann und sollte jeder dazu beitragen? Fordere zu etwas (z.B. so soll es werden oder so soll es bleiben)<br />
auf!<br />
Märchen<br />
Realistisches und Magisches liegt beim Märchen auf einer Ebene, Übernatürliches geschieht wie<br />
selbstverständlich, die Umwelt bleibt ausgeblendet.<br />
Das Märchen ist durch einen bestimmten, immer wiederkehrenden Handlungsverlauf, durch das Auftreten<br />
bestimmter Personen und Gegenstände sowie häufig durch altertümliche Sprache gekennzeichnet. In<br />
vielen Märchen werden die LeserInnen gewarnt (eine Lehre steht am Ende).<br />
Neben den traditionellen Märchen gibt es auch Umkehrmärchen, Verwirrmärchen, Fortsetzungsmärchen,<br />
Werbemärchen, Märchen mit Vorgaben (Würfelmärchen), Rätselmärchen etc.<br />
Gliederung:<br />
• Ausgangslage (Mangel, Not)<br />
• Die Schwierigkeiten werden häufig in einem Dreischritt bearbeitet.<br />
• Der Charakter der handelnden Personen entscheidet über ihr Schicksal.<br />
Tipps für Schülerinnen und Schüler
Schriftliche Sprachverwendung <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong> Seite 52<br />
• Vergiss nicht auf den typischen Märchenanfang und -schluss!<br />
• Bei Orten, Personen und Tieren im Märchen handelt es sich um „Typen“. Oft kommt ein Zauberwesen, ein<br />
Zauberding vor, eventuell ein Zauberspruch. Am Schluss steht oft eine Lehre.<br />
• Gliederung: Problem – Lösung – Die Guten erleben ein Happyend, die Bösen werden vernichtet<br />
(Schwarzweiß-Malerei).<br />
Normbrief, Geschäftsbrief<br />
Ein Normbrief (Geschäftsbrief) richtet sich nicht an eine private Adresse, sondern an eine Firma, eine<br />
Organisation, eine Behörde…<br />
Die richtige Gestaltung des Briefkopfs und der (fett gedruckten) Betreffzeile sollen bewirken, dass das<br />
Anliegen des Schreibers, der Schreiberin rasch zur zuständigen Stelle kommt.<br />
Die Platzverteilung von AbsenderIn, Anschrift, Ort, Datum, Anrede und Schlussformel ist genau geregelt.<br />
Der Stil des Briefes soll sachlich und knapp in der Darstellung sein, damit die Bearbeitung erleichtert wird.<br />
Der Text soll zuerst den Sachverhalt darlegen und dann das Anliegen erklären, das anschließend zu<br />
begründen oder beweisen ist.<br />
Tipps für Schülerinnen und Schüler<br />
• Achte auf die Schreibung der Anredefürwörter: höfliche Anrede eines Erwachsenen (Sie, Ihnen …) groß, die<br />
vertraute Anrede (du, dein …) klein!<br />
• Beachte die Form des Briefes: Ränder, Absätze, Vollständigkeit des Briefkopfes, der Anrede und<br />
Schlussformel, gut leserliche Handschrift oder Computerausdruck!<br />
• Verfasse einen klaren, aussagekräftigen, höflichen Briefinhalt!<br />
• Verbinde die Sätze geschickt, vermeide zu viele Sätze, die mit „Ich“ beginnen!<br />
• Beschrifte das Kuvert richtig, beachte dabei Platzverteilung, Reihenfolge der Zeilen …!<br />
Personenbeschreibung<br />
Die Personenbeschreibung ist die sachliche Beschreibung der sichtbaren Merkmale einer Person.<br />
Die Person soll so genau beschrieben werden, dass sie von anderen wiedererkannt wird.<br />
Über den Charakter der Personen wird nichts gesagt.<br />
Gliederung:<br />
• allgemeine Information: Geschlecht, Alter, Kleidung, Haare, Körperbau<br />
• Ausdrucksmerkmale: Haltung, Körperbewegung, Gesichtsausdruck, Stimme<br />
• Besonderheiten, die die Person von anderen unterscheiden: Brille, Narbe, Gewohnheiten<br />
Tipps für Schülerinnen und Schüler<br />
• Zuerst gib an, um wen es sich bei deiner Beschreibung handelt (Name, Geschlecht, Alter, Größe)!<br />
• Dann beschreibe die äußeren Merkmale genau und gehe in einer bestimmten (z. B. von oben nach unten)<br />
Reihenfolge vor (Körperbau, Gesichtsform, Haare, Haut, Kleidung …)!<br />
• Anschließend gib Informationen über die Wirkung der Person (Haltung, Bewegungen, Gewohnheiten,<br />
Gesichtsausdruck, Stimme …)!<br />
• Wähle einen sehr sachlichen und knappen Stil, aber achte auf Vollständigkeit!<br />
• Gib auch Auffälligkeiten und Besonderheiten an, die die Person von anderen unterscheiden (Brille, Narbe…)!<br />
Sage<br />
Im Wesentlichen unterscheidet man zwischen Volks- und Heldensagen.<br />
Die Volkssage berichtet von außergewöhnlichen Ereignissen aus der Geschichte der Heimat.<br />
Oft geht es dabei um Stadtgründungen (Lindwurm von Klagenfurt), eigenartige Felsformationen (Frau Hitt),<br />
um Ereignisse rund um besondere Bauwerke (Der Türmer vom Stephansdom) oder Landschaften (Der<br />
Neusiedler See). Obwohl wie im Märchen übernatürliche Wesen vorkommen (Nixen, Zwerge, Drachen,<br />
Teufel), stehen doch meist einfache Menschen im Vordergrund, deren Schicksal sich im Lauf der Sage<br />
zum Guten oder Bösen wenden kann.<br />
Manches an der Sage kann wahr sein, viele Sagen sind spannend, manche sogar gruselig. Auch heute<br />
entstehen Sagen, sie verbreiten sich lange Zeit mündlich, oft in vielen Ländern gleichzeitig, bis sie eines<br />
Tages aufgeschrieben werden.
Schriftliche Sprachverwendung <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong> Seite 53<br />
Tipps für Schülerinnen und Schüler<br />
So wird eine Sage gegliedert:<br />
• Zuerst erfährt man, wo und wann sich die Geschichte zugetragen hat.<br />
• Einfache Menschen (z. B. Handwerker; ihre Namen werden genannt) stehen im Mittelpunkt, übernatürliche<br />
Wesen stellen sie oft auf die Probe.<br />
• Am Höhepunkt entscheidet sich das Schicksal für oder gegen die Menschen.<br />
• Zuletzt erfährt man, was heute noch an die Sage erinnert.<br />
Spielanleitung<br />
Die Spielbeschreibung ist die sachliche Darstellung von einem wiederholbaren Vorgang.<br />
Die genaue zeitliche Reihenfolge der Vorgänge ist wichtig.<br />
Gliederung:<br />
• Einleitung: Titel, Material, Thema bzw. Art des Spiels.<br />
• Hauptteil: genaue Beschreibung wie das Spiel vor sich geht. Reihenfolge genau beachten.<br />
• Schluss: Ziel des Spieles, persönliche Bewertung.<br />
Tipps für Schülerinnen und Schüler<br />
• Zuerst gib genau an, was für die Durchführung notwendig ist (Materialliste)!<br />
• Dann erkläre in der richtigen Reihenfolge, was zu machen ist!<br />
• Wähle einen sehr sachlichen und knappen Stil, aber achte auf Vollständigkeit!<br />
Gib auch Einzelheiten und „Extras“ an!<br />
• Vergiss nicht auf die Beschreibung des Ziels!<br />
• Die Spielanweisung kann auf verschiedene Weise geschrieben werden:<br />
mit dem unpersönlichen Fürwort „man“ (Man stellt den ersten Spielstein auf das Startfeld.)<br />
im Passiv mit „wird“ oder „ist“ (Der erste Spielstein wird auf das Startfeld gestellt.)<br />
mit dem Imperativ (Stell den ersten Spielstein auf das Startfeld!)<br />
Tierbeschreibung<br />
Die Tierbeschreibung ist eine sachliche Darstellung, die der Personenbeschreibung sehr ähnlich ist.<br />
Der Stil der Beschreibung ist nüchtern und prägnant.<br />
Die Tierbeschreibung wird im Präsens verfasst.<br />
Gliederung:<br />
• Einleitung: Rasse, Name, Alter, Geschlecht, Größe, ungefähres Gewicht…<br />
• Hauptteil: genaue Beschreibung der Merkmale wie Fell, „Zeichnung“, Farben, Körperbau…<br />
• Schluss: außergewöhnliche Merkmale des Tieres wie besondere Gewohnheiten, Verhaltensauffälligkeiten…<br />
Tipps für Schülerinnen und Schüler<br />
• Zuerst gib an, um welches Tier es sich bei deiner Beschreibung handelt (Rasse, Name, Geschlecht, Alter,<br />
Größe, ungefähres Gewicht, …)!<br />
• Dann beschreib die äußeren Merkmale genau und gehe in einer bestimmten (z. B. von oben nach unten)<br />
Reihenfolge vor (Fell, „Zeichnung“, Farben, Körperbau, …)!<br />
• Anschließend gib Informationen über außergewöhnliche Merkmale des Tieres (besondere Gewohnheiten,<br />
Verhaltensauffälligkeiten …)!<br />
Nenne Besonderheiten, die das Tier von anderen unterscheiden!<br />
• Wähle einen sachlichen und knappen Stil, aber achte auf die Vollständigkeit!<br />
Werbung<br />
Textsorten-Charakteristik<br />
Diese Teile soll eine Werbung enthalten:
Schriftliche Sprachverwendung <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong> Seite 54<br />
• Slogans, gut einprägsame Sprüche und Symbole (Firmen-Logos)!<br />
• sachliche und überzeugende Informationen mit bildhaften Ausdrücken, Wortneuschöpfungen,<br />
Wortspielen und einer Aufforderung aktiv zu werden.<br />
• Kontaktadressen, E-Mail-, Telefon-, Fax-Adresse.<br />
• Häufige Wiederholungen des Namens und hervorgehobene Schrift prägen sich gut ein.<br />
• Der Werbung hilft ein Mitmachen bekannter Persönlichkeiten, Humor sorgt für eine gute Stimmung.<br />
Wegbeschreibung<br />
Die Wegbeschreibung ist die sachliche Darstellung, bei der der Weg von einem Ausgangspunkt zu einem<br />
Zielpunkt beschrieben wird. Die genaue Reihenfolge der Anweisungen und die Beschreibung zur<br />
Orientierung ist wichtig.<br />
Gliederung:<br />
• Ausgang: Angaben über Ausgangspunkt, Orientierung im Umfeld, Himmelsrichtung<br />
• Hauptteil: genaue Beschreibung der einzelnen Abschnitte auf dem Weg, Hinweise auf auffällige Stellen<br />
• Ziel: Angaben zur Beschreibung und Lage des Zieles<br />
Tipps für Schülerinnen und Schüler<br />
• Zuerst gib genau an, wo du dich befindest und in welche Richtung du gehen musst!<br />
• Erkläre in der richtigen Reihenfolge, wie man von Wegabschnitt zu Wegabschnitt kommt!<br />
• Gib viele Einzelheiten und gut sichtbare Auffälligkeiten an! Verwende die Himmelrichtungen, Umstandswörter<br />
des Ortes (links, oberhalb, schräg, seitwärts,..), aber auch Umstandswörter der Zeit (danach, hinterher, jetzt,..)<br />
• Vergiss nicht auf die Beschreibung des Ziels, damit man sich sicher gehen kann, es erreicht zu haben!<br />
Zeitungsbericht<br />
Der Zeitungsbericht ist eine sachliche, genaue, detaillierte und doch knappe Darstellung eines besonderen<br />
Ereignisses. Daher kommt es im Zeitungsbericht zu sehr langen informationsdichten Sätzen. Das<br />
Wichtigste des Berichtes steht am Beginn, zum Ende hin verliert die Information an Bedeutung. Der<br />
Berichterstatter tritt in den Hintergrund. Auf eine treffende Wortwahl ist zu achten. Zeitform: Präteritum.<br />
Gliederung:<br />
• Anreißerzeile (erklärt die Hauptschlagzeile genauer)<br />
• Hauptschlagzeile (Headline)<br />
• Zusammenfassung (Summary – das Wichtigste in Kürze, meist fett gedruckt)<br />
• Bericht (Story)<br />
• Name des verantwortlichen Redakteurs<br />
• Bild<br />
• Bildtext<br />
15. Literaturverzeichnis<br />
Beat Mazenauer, Severin Perrig: Wie Dornröschen seine Unschuld gewann, Kiepenheuer, 1995, II 14.787<br />
Buzan, T.: Das kleine Mind-Map Buch, mvg-Verlang, 2005, Landsberg.<br />
DOSTAL, Karl: Aufsatzschreiben leichtgemacht II, Veritas, III/5354<br />
ELLWANGER, W. u. GRÖMMINGER, A. (1977). Märchen - Erziehungshilfe oder Gefahr? Freiburg: Herder.<br />
FETSCHER, I. (1972). Wer hat Dornröschen wachgeküßt? Das Märchenverwirrbuch. Frankfurt: Fischer.<br />
Leimeier, Walter: Einherrenloses Damenfahrrad, Schöningh, Paderborn, 1997.<br />
Mosler, B., Herzolz, G.: Die Musenkussmischmaschine, Verlag Neue deutsch Schule, Essen, 1992, II/12415<br />
<strong>Pramper</strong>, W. u.a.: Deutschstunde 1, 2, 3, 4, Veritas, 2007, Linz.<br />
<strong>Pramper</strong>, W. u.a.: Materialien für den Deutschunterricht 1- 4, Veritas, 2004.<br />
<strong>Pramper</strong>, W. u.a.: Übungsbuch zur Deutschstunde 1, 2, 3, 4, Veritas, 2005, Linz.<br />
<strong>Pramper</strong>, W., u.a.: Deutsch: Mit Bleistift und Papier, Veritas, 2002, Linz.<br />
<strong>Pramper</strong>, W.: Aktiv lernen: Briefe schreiben / Bunte Schreibwerkstätte / Erlebnisse erzählen, Veritas, 2005, Linz.<br />
Rico, G. Garantiert schreiben lernen, Rowohlt, 2004,
Schriftliche Sprachverwendung <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong> Seite 55<br />
Riedel, F.X.: Aufsatz lustig leicht gemacht, Auer, Donauwörth, IV/9062a<br />
Sauter, H., Pschibul, M.: Vom Aufsatzunterricht zur sprachlichen Kommunikation, Auer,1976.<br />
Schreiner, Kurt: Der Deutschaufsatz, Falken, 1987, IV/7724<br />
Söllinger, P.: Aufsatzdidaktische Positionen, Erz. und Unterr., 9/83.<br />
Söllinger, P.: Die Deutschschularbeit, Hpthek<br />
Syme, Chr. Kreativer Schreiben, Verlag an der Ruhr, IV/9307<br />
Traxler, H.: Die Wahrheit über Hänsel und Gretel, Rororo, 1978, Reibeck, I/6023<br />
Werder, Lutz von: Lehrbuch des kreativen Schreibens, Schibri Verlag, Berlin, 1993, II/13.750,<br />
16. Anforderungen und Prüfungsfragen<br />
Für die Note im Rahmen des Offenen Unterrichts:<br />
a) Abgabe von 12 frei gewählten Schreibaufträgen in einer nett gestalteten Mappe mit<br />
Deckblatt, Inhaltsverzeichnis,… am letzten Unterrichtstag.<br />
b) schriftliche Prüfung zum Skriptumsteil „Textsortenbeschreibung“:<br />
1. Sie wissen über die Charakteristik und die Besonderheiten der wesentlichen Textsorten,<br />
die in der Hauptschule behandelt werden, Bescheid!<br />
2. Sie sind imstande, Schülern Tipps zu den Schreibaufgaben zu geben!<br />
Für die Note Präsenzunterricht: Mündliche oder schriftliche Prüfung<br />
Prüfungsfragen<br />
1. Stellen Sie die historische Entwicklung des Schreibunterrichtes dar, und beschreiben Sie jenes<br />
Spannungsfeld, in dem der neue Lehrplan zur Aufsatzerziehung entstanden ist!<br />
2. Beschreiben Sie die Idee des „Freien Schreibens“ an Beispielen und begründen Sie die Entwicklung!<br />
3. Zeigen Sie am Thema Ferien die Vielfalt der Möglichkeiten zur Textsortenproduktionen auf!<br />
4. Zeigen Sie die unterschiedlichen Möglichkeiten der methodischen Verfahrensweisen im<br />
Schreibunterricht!<br />
5. Zählen Sie die Gliederungsschritte einer Aufsatzeinheit auf! Erörtern Sie die Schritte an einem<br />
Unterrichtsbeispiel!<br />
6. Stellen Sie verschiedene Formen der Differenzierung im Schreibunterricht vor. Geben Sie dazu<br />
Unterrichtsbeispiele!<br />
7. Geben Sie Beispiele für Schreibimpulse, die zum kreativen Schreiben führen.<br />
17. Bakkaulareatsthemen zur schriftlichen Sprachverwendung<br />
Schreibwerkstätte für Schüler…<br />
• Märchen (Sagen, Fabeln) Gewalt in Märchen, die Sprache der Märchen, Märchen für Kinder,<br />
Märchenprojekte<br />
• Schreibwerkstatt zu verschiedenen Projekten der Lese- und Aufsatzerziehung mit Fabeln,<br />
Kurzgeschichten, Münchhausen, Märchen, ....<br />
• Projektunterricht in der Aufsatzerziehung (Schüler schreiben Hörspiele, Kriminalgeschichten,<br />
Kinderbücher ,...)<br />
• Schüler schreiben Lyrik (Gedichte, Lieder, Balladen, moderne Lyrik)<br />
• Die Zeitung im Unterricht - Unterrichtsprojekte, Lernspiele, Textproduktionen, Unterrichtsbeispiele zum<br />
Thema Zeitung.