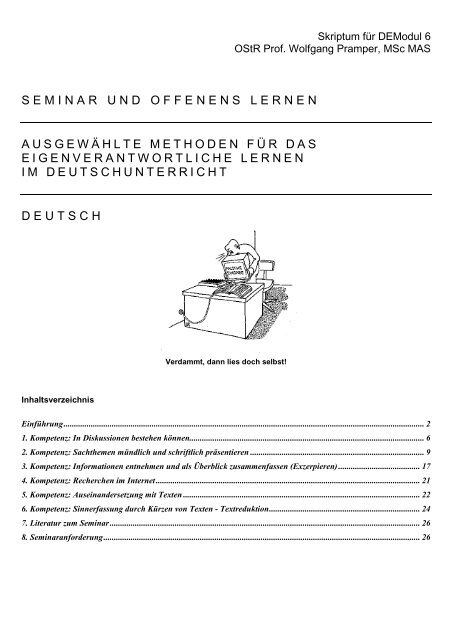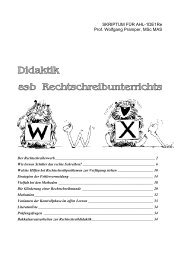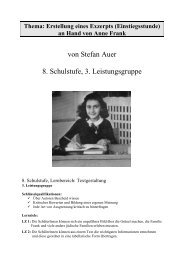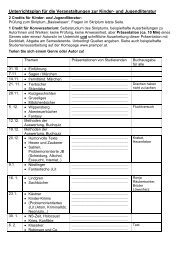3. Kompetenz - Wolfgang Pramper
3. Kompetenz - Wolfgang Pramper
3. Kompetenz - Wolfgang Pramper
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
S E M I N A R U N D O F F E N E N S L E R N E N<br />
A U S G E W Ä H L T E M E T H O D E N F Ü R D A S<br />
E I G E N V E R A N T W O R T L I C H E L E R N E N<br />
I M D E U T S C H U N T E R R I C H T<br />
D E U T S C H<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
Verdammt, dann lies doch selbst!<br />
Skriptum für DEModul 6<br />
OStR Prof. <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong>, MSc MAS<br />
Einführung............................................................................................................................................................................ 2<br />
1. <strong>Kompetenz</strong>: In Diskussionen bestehen können................................................................................................................ 6<br />
2. <strong>Kompetenz</strong>: Sachthemen mündlich und schriftlich präsentieren ................................................................................... 9<br />
<strong>3.</strong> <strong>Kompetenz</strong>: Informationen entnehmen und als Überblick zusammenfassen (Exzerpieren)....................................... 17<br />
4. <strong>Kompetenz</strong>: Recherchen im Internet.............................................................................................................................. 21<br />
5. <strong>Kompetenz</strong>: Auseinandersetzung mit Texten ................................................................................................................. 22<br />
6. <strong>Kompetenz</strong>: Sinnerfassung durch Kürzen von Texten - Textreduktion........................................................................ 24<br />
7. Literatur zum Seminar.................................................................................................................................................... 26<br />
8. Seminaranforderung....................................................................................................................................................... 26
Ausgewählte Methoden des Deutschunterrichts <strong>Pramper</strong> Seite 2<br />
Einführung<br />
Der Gegenstand<br />
„Ausgewählte Methoden des eigenverantwortlichen Lernens im Deutschunterricht” ist das Thema des<br />
Seminars, wobei es natürlich auch in allen anderen Gegenständen der Fachdidaktik um die speziellen<br />
Methoden des jeweiligen Fachdidaktik-Lernbereichs geht.<br />
So werden beispielsweise in der „Fachdidaktik Schreiben” empfehlenswerte Methoden vorgestellt, um bei 10-<br />
14-Jährigen Schreibanlässe zu initiieren, des weiteren auch in der Veranstaltung „Schrifliche<br />
Sprachverwendung” und im Angebot „Schreibwerkstätte”.<br />
Was ist also beim Thema „Ausgewählten Methoden eigenverantwortlichen Lernens im Deutschunterricht” zu<br />
erwarten?<br />
Schwerpunkt des Seminars ist das das eigenverantwortliche Lernen der Schüler. Zum einen sollen einzelne<br />
Methoden genauer betrachtet und selbst eingeübt weden, zum anderen soll hier Zeit für eine Reflexion und<br />
eigene Weiterentwicklung geboten werden.<br />
Die PISA-Studien und andere Untersuchungen bewiesen leidvoll, dass das traditionelle Lernen, wie es in<br />
Österreich über Jahrzehnte gepflogen wurde, einer deutlichen Weiterentwicklung bedarf.<br />
Hartmut von Hentig formuliert seine Kritik an der bestehenden Methodik:<br />
Sie fördert,<br />
Rechtschreibung, still sitzen statt Bewegung im Raum<br />
Fächergrenzen statt assoziierender Verbindung von Gegenständen<br />
Definieren und Entschlüsseln von statt intuitivem Erfassen von Bildern, Begriffen<br />
Gedächtnis statt Erraten, Erfinden, Erhoffen<br />
„Die Schule verhindert die Ausbildung der ganzen Person! – Und hieran beginnt die Menschheit zu leiden.“<br />
(nach Hartmut von Hentig (1998) in “Kreativität”, München Hanser)<br />
Gewiss wäre die Schule “der rechten Spalte” eine andere als die jetzige. Aber nicht sicher ist, ob die Eltern,<br />
Nachfolgeinstitutionen, Wirtschaft damit zufrieden wären und gesichert ist auch nicht, ob die PISA-Ergebnisse<br />
besser ausfallen würden.<br />
Schule und Methodik ist letztlich immer ein Abbild der jeweiligen Gesellschaft. Die Schule vermag im selben<br />
Ausmaß für Bildung zu interessieren, wie das Interesse dafür in der Gesellschaft vorhanden ist.<br />
Nicht nur in Österreich, sondern weltweit werden derzeit die Bildungseinrichtungen kritisch betrachtet. Die<br />
Wirtschaft beklagt das Fehlen zukunftsgerechter „Schlüsselqualifikationen“ wie Selbstständigkeit, Flexibilität,<br />
Eigeninitiative, Problemlösungsvermögen, Kommunikationsfähigkeit und Teamfähigkeit. Die<br />
Bildungsverantwortlichen in Bund und Ländern fordern besseren Unterricht und ein höheres Leistungsniveau<br />
und hoffen entweder auf die Selbsterneuerungsfähigkeit der Schulen im differenzierten Schulsystem oder in<br />
einem neuen Schulsystem, der Gesamtschule. Die Eltern befürchten, dass ihre Kinder auf die aktuellen<br />
Anforderungen im Beruf und im Studium nur unzureichend vorbereitet sind und reagieren höchst allergisch u.<br />
a. auf jedwede Art von Unterrichtsausfall. Didaktiker sehen die Notwendigkeit eines Methodenwandels: Von<br />
der Bringschuld der Lehrer und Lehrerinnen im Frontalunterricht soll es zur Bringschuld der Schüler im<br />
Offenen Unterricht kommen.<br />
Die unterschiedlichen Ansichten von oben zur Befindlichkeit der Schule sollen Sie zum Nachdenken bringen,<br />
in welche Richtung diese Revision gehen soll:<br />
Nachdenk- und Diskussionsaufgaben für Studierende<br />
Wie wird/soll das Lernen im Deutschunterricht in der Zukunft (2030) sein?<br />
Welche Methoden werden in Zukunft eine Rolle spielen?<br />
Welche Themen werden ihrer Meinung nach bedeutungsvoll sein?<br />
Welche Themen der Gegenwart werden an Bedeutung verlieren?<br />
Welche Themen der Gegenwart werden weiterhin Bedeutung haben?<br />
Welche <strong>Kompetenz</strong>en sollen die Schüler 2030 erwerben?
Ausgewählte Methoden des Deutschunterrichts <strong>Pramper</strong> Seite 3<br />
Der Wandel des <strong>Kompetenz</strong>begriffes<br />
<strong>Kompetenz</strong> zu zeigen, war die zentrale Aufgabe der Lehrer und Lehrerinnen bisher. Wenn der Erwerb von<br />
<strong>Kompetenz</strong>en auf die Schüler übergehen soll, müssen die Lehrkräfte ihr Rollenverständnis entsprechend<br />
erweitern und sich sehr stärker als bisher als „Trainer“ verstehen.<br />
Viele Lehrer tun dies bereits, andere sind auf dem Weg, manche sind davon noch nicht überzeugt.<br />
In vielen Schulen haben Begiffe wie Wochenplanarbeit 1 , offenes Lernen, Stationenbetrieb, Projektarbeit,<br />
selbstgesteuertes Lernen, Selbstkontrolle und vieles mehr längst Einzug gehalten. Das sind deutliche<br />
Zeichen einer Veränderung der Lerndidaktik. <strong>Kompetenz</strong>lernen verlangt ein gezieltes Einüben, Reflektieren<br />
und Bewusstmachen grundlegender Lern- und Arbeitstechniken im Unterricht. Lehrer und Lehrerinnen<br />
bereiten Übungen vor, moderieren und stehen mit Rat und Tat zur Seite.<br />
(Grafik: Das „neue” Haus des Lernens von Heinz Klippert<br />
(Klippert (2005) Eigenverantwortliches Lernen)<br />
Geübt werden soll keineswegs abgehoben und fachfremd,<br />
sondern sehr wohl fach-, themenbezogen. Insofern<br />
stehen Methodenlernen und fachliches Lernen auch<br />
nicht in einem Konkurrenzverhältnis zueinander, sondern<br />
sie sind mittel- und langfristig komplementär. Der<br />
wesentliche Unterschied zwischen reinen stoff- und<br />
methoden- zentrierter Unterrichtsarbeit:<br />
Eigenverantwortliches Arbeiten und<br />
Lernen<br />
ist eine Methode, um bei Schülern die<br />
Schlüsselqualifikationen Selbstständigkeit,<br />
Methodenkompetenz, Kommunikationsfähigkeit,<br />
Teamfähigkeit, Kreativität, Eigeninitiative,<br />
Zielstrebigkeit, Verantwortungsbewusstsein möglichst<br />
wirksam zu fördern.<br />
Diese Erkenntnis ist unter Pädagogen seit langem<br />
bekannt und wurde in den letzten Jahren vor allem in<br />
Deutschland von Heinz Klippert unter diesem Begriff<br />
systematisiert und vermarktet.<br />
Diese Qualifikationen können nur schwer von Schülern erworben werden, wenn ausschließlich der Lehrer<br />
exzerpiert, strukturiert, interpretiert, analysiert, argumentiert, organisiert, Probleme löst oder den Unterricht in<br />
sonstiger Weise managt und dominiert.<br />
Die Intensivierung des eigenverantwortlichen Arbeitens und Lernens setzt voraus, dass Schüler über<br />
tragfähige methodische <strong>Kompetenz</strong>en und Routinen verfügen, die ihnen persönlichen Erfolg sichern und<br />
nachhaltige Motivationen aufbauen helfen.<br />
Basiskompetenzen<br />
wie gängige Lern- und Arbeitstechniken (Markieren, Exzerpieren, Strukturieren und Visualisieren),<br />
grundlegende Argumentations- und Kommunikationstechniken und die systematische Kultivierung von<br />
Teamfähigkeit müssen also gelernt, geübt und im Regelunterricht ständig gepflegt werden. Erst diese<br />
1 Die Arbeit mit dem Wochenplan ist ein Konzept der Unterrichtsorganisation. Die Schüler erhalten zu Beginn<br />
eines bestimmten Zeitraumes (z.B. eine Woche) einen schriftlichen Plan, der Aufgaben verschiedenen Typs<br />
aus verschiedenen Inhaltsbereichen enthält. In den dafür vorgesehenen Unterrichtsstunden (z.B. eine Stunde<br />
täglich) erarbeiten die Schüler diesen Plan selbstständig - alleine oder in Partnerarbeit. Sie nehmen Hilfe in<br />
Anspruch, soweit notwendig. Nach der Bearbeitung einzelner Aufgaben sollen diese von den Schülern selbst<br />
kontrolliert und auf dem Plan als erledigt eingetragen werden. Die Arbeit mit dem Wochenplan besteht<br />
gewissermaßen in einer Zusammenfassung und Ausweitung der sonst über die Woche verstreuten<br />
Kurzphasen von Still-, Partner- und Gruppenarbeit. (nach Wikipedia, Wochenplanunterricht, 2007)
Ausgewählte Methoden des Deutschunterrichts <strong>Pramper</strong> Seite 4<br />
Sockelqualifikationen (Methodentraining, Kommunikationstraining und Teamentwicklung) bilden das<br />
solide Fundament für EVA.<br />
Rolle des Lehrers/der Lehrerin<br />
Wenn man voraussetzt, dass neben der Fachkompetenz auch das Erlernen von Teamfähigkeit, das Erwerben<br />
methodischer und kommunikativer <strong>Kompetenz</strong> notwendig ist, muss der Lehrer seine Rolle neu überdenken.<br />
Er ist nicht mehr der Initiator, nicht mehr der alleinige Instrukteur, sondern mehr Moderator, Berater und<br />
Arrangeur. (nach Wikipedia, Eigenverantwortliches Arbeiten, 2007)<br />
Lehrer/innen, die sich zuerst als Beobachter und Helfer verstehen, werden Selbstständigkeit vermitteln<br />
können.<br />
In diesem Sinne sind auch die Anforderungen (siehe letzte Seite) für das Seminar und das offenen Lernen zu<br />
verstehen.<br />
Haben Sie in Ihrer bisherigen Praxisausbildung eigenverantwortliches Lernen von Schülern erlebt? Berichten<br />
Sie von Erfahrungen und Eindrücken?<br />
Methode: Offener Unterricht<br />
Die lernenden Individuen bestimmen selbst:<br />
• organisatorisch<br />
zeitlich: wann sie an einem Thema arbeiten<br />
räumlich: wo sie an einem Thema arbeiten<br />
kooperativ: mit wem sie an einem Thema arbeiten<br />
• methodisch<br />
Wie sie ihr Thema bearbeiten. Welchen methodischen Zugang zum Thema sie wählen.<br />
• inhaltlich<br />
Woran sie arbeiten/an welchem Thema sie arbeiten.<br />
• sozial<br />
Die Regeln und den Ablauf des Klassenlebens, die Konsequenzen, die sich in Problemfällen ergeben.<br />
• persönlich<br />
Welche Werte und Prioritäten sie für ihr Leben wählen<br />
Analysieren Sie die Methodenkompetenz nach Klippert, Seite 5:<br />
a) Welche Begriffe sind Ihnen unbekannt!<br />
b) Welche Methoden beherrschen Sie selbst einigermaßen? blau markieren!<br />
c) Haken Sie rot an, welche Methoden Sie selbst in der Praxis erlebt haben?<br />
d) Markieren Sie mit einer dritten Farbe, welche Sie Ihren Schülern unbedingt beibringen möchten!
Ausgewählte Methoden des Deutschunterrichts <strong>Pramper</strong> Seite 5<br />
Beispiel eines allgemeinen Methodenüberblicks für den Deutschunterricht:<br />
(Quelle: http://www.gymkaki.de; Vier-Kanal-Methode: Lern durch Sehen (Lesen), (Zu)hören, Erklären, Üben (Schreiben)<br />
Vertraut sein mit zentralen<br />
Methoden<br />
— Gruppenarbeit<br />
— Planspiel<br />
— Metaplanmethode<br />
— Fallanalyse<br />
— Problemlösendes<br />
Vorgehen<br />
— Projektmethode<br />
— Leittextmethode<br />
— Schülerreferat<br />
— Facharbeit<br />
— Unterrichtsmethodik<br />
— Feedback-Methoden<br />
Methodenkompetenz<br />
Beherrschung elementarer<br />
Lern- und Arbeitstechniken<br />
— Lesetechniken<br />
— Markieren<br />
— Exzerpieren<br />
— Strukturieren<br />
— Nachschlagen<br />
— Notizen machen<br />
— Karteiführung<br />
— Protokollieren<br />
— Gliedern/Ordnen<br />
— Heftgestaltung<br />
— Visualisieren/Darstellen<br />
— Bericht schreiben<br />
— Arbeitsplanung (z. B.<br />
Schularbeiten vorbereiten)<br />
— Arbeit mit Lernkartei<br />
— Mnemo-Techniken<br />
— Arbeitsplatzgestaltung<br />
Beherrschung elementarer<br />
Gesprächs- und<br />
Kooperationstechniken<br />
—Freie Rede<br />
— Stichwortmethode<br />
— Rhetorik<br />
(Sprach-Vortragsgestaltung)<br />
— Fragetechniken<br />
— Präsentationsmethoden<br />
— Diskussion/Debatte<br />
— Aktives Zuhören<br />
— Gesprächsleitung<br />
— Gesprächsführung<br />
— Zusammenarbeiten<br />
— Konfliktmanagement<br />
— Metakommunikation<br />
(Heinz Klippert (2004) Methodentraining)
Ausgewählte Methoden des Deutschunterrichts <strong>Pramper</strong> Seite 6<br />
1. <strong>Kompetenz</strong>: In Diskussionen bestehen können<br />
Gruppendynamisches Diskussionsspiel: Was braucht Robinson auf seiner<br />
einsamen Insel?<br />
Ein heftiger Sturm tobt über das Meer. Turmhohe Wellen werden gegen das lecke Schiff geschleudert. Jeden<br />
Moment kann es entzwei brechen, dann ist die wertvolle Ladung für immer verloren. In dieser Situation<br />
versucht der einzige Überlebende der Schiffskatastrophe noch möglichst viel vom Schiff an Land zu retten. In<br />
Sekundenbruchteilen muss der Schiffbrüchige entscheiden, was er aus dem Laderaum an sich raffen soll.<br />
Dabei kommt es darauf an, zwischen sehr wichtigen und weniger wichtigen Sachen zu unterschieden.<br />
Und jetzt stelle dir vor, du wärst dieser Schiffbrüchige. Ordne die folgenden 15 Gegenstände nach ihrer<br />
Wichtigkeit für dein weiteres Leben auf der Insel. Reihe an Platz 1., was am wichtigsten ist. Du wirst rasch<br />
merken, dass man sehr viele Überlegungen bei der Reihung anstellen muss. Was brauchst du zum<br />
Überleben, wofür kann man die Gegenständen sonst noch verwenden, …<br />
Bedenke die Notwendigkeit für das Überleben: Trinken, Essen, geschützte Behausung<br />
Diese Gegenstände stehen zur Verfügung<br />
Vorderladergewehr, Nägel, Hammer, Buch, großer Kochtopf, Kiste mit Schwarzpulver und<br />
Bleikugeln, Säbel, 20 m 2 Leinwand, 20 m Tau, Messer, Spiegel, 2 Kilo getrocknetes Ziegenfleisch, 1<br />
Flasche Alkohol, Axt, Seekarte.<br />
Einzelreihung Kleingruppenreihung Klassenreihung<br />
1. _______________<br />
2. _______________<br />
<strong>3.</strong> _______________<br />
4. _______________<br />
5. _______________<br />
6. _______________<br />
7. _______________<br />
8. _______________<br />
9. _______________<br />
10. _______________<br />
11. _______________<br />
12. _______________<br />
1<strong>3.</strong> _______________<br />
14. _______________<br />
15. _______________<br />
1. _______________<br />
2. _______________<br />
<strong>3.</strong> _______________<br />
4. _______________<br />
5. _______________<br />
6. _______________<br />
7. _______________<br />
8. _______________<br />
9. _______________<br />
10. _______________<br />
11. _______________<br />
12. _______________<br />
1<strong>3.</strong> _______________<br />
14. _______________<br />
15. _______________<br />
1. _______________<br />
2. _______________<br />
<strong>3.</strong> _______________<br />
4. _______________<br />
5. _______________<br />
6. _______________<br />
7. _______________<br />
8. _______________<br />
9. _______________<br />
10. _______________<br />
11. _______________<br />
12. _______________<br />
1<strong>3.</strong> _______________<br />
14. _______________<br />
15. _______________<br />
Diskutiert nun in der Gruppe und versucht euch auf eine gemeinsame Reihenfolge zu einigen! Lasst bei der<br />
Diskussion alle Meinungen zu und bedenkt die Argumente gut. Entscheidet euch immer für die besten<br />
Argumente, das muss nicht die zuvor allein gefasste Meinung sein.
Ausgewählte Methoden des Deutschunterrichts <strong>Pramper</strong> Seite 7<br />
Die Fishbowl-Diskussionsform<br />
Wenn es um das Erlernen des Diskutierens und mündlichen Argumentierens geht, ist die „Fishbowl-<br />
Diskussions-Form“ neben dem „Kugellager“ (auch „Zwiebelschale genannt) und der „Club 2<br />
Diskussionsform“ (eine Rollendiskussionsform) eine interessante Variante. Wie in einem Aquarium sitzen<br />
die Diskutierenden in der Mitte des Klassenraums und werden von Mitschülern beobachtet. Wer<br />
mitdiskutieren will, kann in das Aquarium steigen.<br />
Die Vorbereitung<br />
* Bildet einen Innenkreis aus sieben Stühlen und einen Außenkreis für alle übrigen Schülerinnen und<br />
Schüler.<br />
* Besetzt zwei Stühle im Innenkreis für den PRO-Standpunkt und zwei Stühle für den KONTRA-Standpunkt.<br />
* Ein/e Diskussionsleiter/in wird bestimmt (anfangs wird das eure Lehrerin/euer Lehrer sein) und besetzt den<br />
fünften Stuhl.<br />
* Die beiden übrigen Stühle im Innenkreis bleiben unbesetzt und können von den Zuhörerinnen und<br />
Zuhörern genutzt werden, die zu einzelnen Aspekten mitdiskutieren wollen.<br />
Die Durchführung<br />
* Die vier Diskutierenden im Innenkreis beginnen ihre Diskussion ohne Zeitdruck. Der Diskussionsleiter oder<br />
die Leiterin achtet auf ein faires Gesprächsverhalten.<br />
* Zuhörerinnen oder Zuhörer, die in die Diskussion mit einer Frage oder einer Aussage eingreifen wollen,<br />
besetzen je nach Standpunkt einen der freien Stühle. Sobald sie ihren Platz eingenommen haben, haben<br />
sie Redevorrecht. Wenn sie ihre Aussagen gemacht oder ihre Fragen gestellt haben, kehren sie in den<br />
Außenkreis zurück. Die Diskutierenden im Innenkreis nehmen die neuen Fragen oder Argumente in ihr<br />
Gespräch auf.<br />
* Wenn die Diskussion eine Weile gedauert hat und der Eindruck entsteht, dass keine neuen Gedanken<br />
mehr zu erwarten sind, kann der Diskussionsleiter oder die Leiterin die Diskussion beenden.<br />
Geeignet sind Themen, die unter den 10-14-Jährigen besonders strittig sind. Zum Beispiel:<br />
Welche TV-Serien (oder Musikgruppen, Moden, Zeitschriften, Handys, Sportler, Filmstars) sind bei euch<br />
„in“, welche „out“? Sollen Wildtiere in Österreich wieder angesiedelt werden? Thema für Studierende:<br />
Gesamtschule, Bekleidungsvorschriften an Schulen, Männer bevorzugt als Lehrer anstellen?<br />
Nach der Diskussion soll besprochen werden, was gut war, und was eher unergiebig war.<br />
Die Schüler sollen auch Vorschläge machen, die zur Verbesserung der nächsten Diskussion beitragen<br />
sollen!<br />
Der heiße Stuhl<br />
Bei dieser Diskussionsform stellt sich einer/eine mit seiner Meinung gegen den Rest der Klasse. Es ist nicht<br />
leicht hier standzuhalten und auch nicht jedermanns/frau Sache.<br />
Einfacher ist die Variante: eine Person wird von allen anderen zu einem Thema (z.B. Hobby) befragt. Diese<br />
Form wird auch „Loch in den Bauch fragen“ genannt.
Ausgewählte Methoden des Deutschunterrichts <strong>Pramper</strong> Seite 8<br />
Projekt: Diskussionsspiel<br />
Welche Ortsumfahrung soll Kleindorf bekommen?<br />
Die Kleindorfer wollen schon lange eine Ortsumfahrung, die den Durchzugsverkehr vom Dorf fern hält. An<br />
manchen Tagen ist für sie der Verkehr kaum mehr auszuhalten. Lärm, Erschütterungen durch LKW´s,<br />
Gefährdung durch rücksichtslose Raser und stinkende Abgase sind die Hauptkritikpunkte. Jetzt will die<br />
Gemeinde mit Unterstützung des Landes und des Bundes (jeder steuert ein Drittel bei) eine Ortsumfahrung<br />
bauen. Aber welche?<br />
Bedenke bei deiner Entscheidung:<br />
• Der Gemeinde stehen jährlich nur 2,5 Mio. Euro für alle Bauvorhaben zur Verfügung. So sollen in der<br />
nächsten Zeit auch ein Kindergarten und eine Feuerwehrwache neu gebaut werden.<br />
• Schulden kosten Zinsen.<br />
• Die Bevölkerung Steinbergs wünscht sich Ruhe, Verkehrssicherheit, Erhaltung denkmalwürdiger<br />
Bauwerke, Landschaftsschutz.<br />
• Nicht alle Wünsche werden sich erfüllen lassen. Entscheide dich!<br />
Übernehmt die Funktion des Gemeinderates und stellt in Kleingruppen die Kosten und die Vor- und<br />
Nachteile einander gegenüber! Listet sie in einer solchen Tabelle auf. Erst dann diskutiert in der Kleingruppe<br />
und entscheidet euch für eine Variante!<br />
Variante 1 Variante 2 Variante 3<br />
PA Zuletzt diskutiert in der Großgruppe, dem Gemeinderat, und stimmt nach der Diskussion ab! Vielleicht<br />
kommen auch neue Varianten zur Sprache und es können Kompromisse erzielt werden.
Ausgewählte Methoden des Deutschunterrichts <strong>Pramper</strong> Seite 9<br />
2. <strong>Kompetenz</strong>: Sachthemen mündlich und schriftlich<br />
präsentieren<br />
Text für Schüler: Das ist schon klar: Niemand fällt seiner Lehrerin oder seinem Lehrer um den Hals, wenn<br />
der Auftrag gegeben wird, über ein bestimmtes Thema zehn Minuten zu sprechen oder einen Sachtext über<br />
mehrere Seiten auszuarbeiten. Aber keine Angst: Referieren kann man lernen. Du hast sicher bemerkt, wie<br />
du dich seit der ersten Klasse auf diesem Gebiet verbessert hast. Es ist wie so oft im Leben: Je öfter man<br />
etwas übt, umso besser lernt man es.<br />
Gut reden können möchte jeder: Man braucht es beim Erklären einer Spielregel genauso wie beim<br />
Erzählen eines Witzes oder eines Erlebnisses, beim Präsentieren einer Gruppenarbeit und nicht zuletzt<br />
beim sachorientierten Referat. Gut reden können wird geschätzt – privat und im Beruf.<br />
Leitfaden für die Vorbereitung eines Sachreferates<br />
• Thema finden: Was interessiert mich - was interessiert auch andere?<br />
• Material zusammentragen: Wo finde ich Informationsquellen?<br />
• Material studieren, ordnen, auswählen: Welche unterschiedlichen Materialien wähle ich aus?<br />
• Vortragsplan entwickeln: Was sollen die Zuhörerinnen und Zuhörer am Ende wissen? Was erkläre ich?<br />
Was zeige ich? Was erzähle ich? Was bringe ich wortwörtlich? In welcher Reihenfolge trage ich vor?<br />
Die Vorbereitung eines Referates<br />
Beispiel: Schüler-Mind-Map bei der Vorbereitung auf das Thema Eisenbahn.<br />
in England: James<br />
Watt, Stephensons<br />
erste Bahn in<br />
Österreich<br />
Semmering – erste<br />
Gebirgsbahn der<br />
Welt<br />
Anfänge<br />
Kohle<br />
Geschichte der<br />
Eisenbahn<br />
Antriebssysteme<br />
Diesel<br />
Bahn heute<br />
Strom<br />
Lege zu deinem Thema eine Mind Map (Gedankenkarte) an! Dafür brauchst du ungefähr eine Stunde Zeit,<br />
hilfreich wären jetzt auch schon erste Recherchen in Sachbüchern und dem Internet! Beachte dabei das<br />
Inhaltsverzeichnis und Stichwortregister am Ende eines Sachbuches bzw. stelle dir eine Stichwortliste für<br />
deine Suche im Internet zusammen!<br />
Einen persönlichen Bezug herstellen<br />
Was mich daran besonders interessiert! Was ich davon gelernt habe!<br />
Wie ich dazu gekommen bin! Was ich noch vorhabe!<br />
Einen Bezug zu den Zuhörerinnen und Zuhörern herstellen<br />
Das ist neu für euch, es ist interessant!<br />
Das hat mich überrascht, euch wird es vielleicht auch so ergehen.<br />
Wieso, woher, warum glaubt ihr ...? Das war so ...<br />
Magnet<br />
Eisenbahnnetz in<br />
Österreich<br />
Hochgeschwindigk<br />
eitszüge<br />
Neue Bahnhöfe in<br />
Österreich<br />
Zukunft der Bahn
Ausgewählte Methoden des Deutschunterrichts <strong>Pramper</strong> Seite 10<br />
Wenn ihr mehr wissen wollt, stehe ich zur Verfügung!<br />
Die Vorbereitung eines Referates<br />
• Rechtzeitig beginnen, damit du mit der inhaltlichen Vorbereitung lange vor dem Termin fertig bist.<br />
• Für die Präsentation solltest du gleich viel Vorbereitungszeit verwenden.<br />
• Alle Vortragsarten brauchen eine intensive und unterschiedliche Vorbereitung!<br />
Vortragsarten<br />
WIE WAS? WOMIT?<br />
Referieren Hauptteil der Redeübung, Bericht über<br />
das eigentliche Thema<br />
Umfangreiche Stichwortliste<br />
Demonstrieren Zahlen, Daten, Fakten Overhead-Folien, Grafiken, Tabellen,<br />
Fotos, Gegenstände, Tafelbilder<br />
Erzählen Erlebnisse, Erfahrungen (Stichwortzettel)<br />
Vorlesen Zitate bekannter Personen, kurze, Bücher, Zeitschriften, Kopien<br />
informative Fakten, Berichte anderer<br />
Personen, kurze Zeitungsausschnitte<br />
(entsprechende Stellen markieren!)<br />
Vor und am Beginn der Präsentation<br />
• Ein Schluck Wasser in der Pause bringt zusätzliche Energie.<br />
• Gegen einen trockenen Mund hilft eine kreisende Massage der Wangen an der Stelle, an der die<br />
Zahnreihe endet.<br />
• Alles vorher ruhig herrichten, Materialien griffbereit legen, Zeit lassen, die Hektik ablegen.<br />
• Breitbeinig hinstellen, Zeit lassen, sich bewegen, nicht steif sitzen oder stehen.<br />
• Das Publikum direkt anschauen, vertraute, helfende Gesichter suchen, aber nicht an einer Person hängen<br />
bleiben.<br />
• Auf ruhigen Atem warten, auf Blickkontakt und Ruhe in der<br />
Klasse warten.<br />
Während der Präsentation<br />
• Lächeln provoziert eine gute Stimmung, wirkt für alle<br />
entspannend.<br />
• Klare, deutliche, langsame, freundliche Sprache, eintöniges<br />
Herunterlesen vermeiden.<br />
• Pausen machen, Tempowechsel: manches zügig – manches<br />
betont und langsam.<br />
• Durch die Sprache Sicherheit und Fachwissen ausstrahlen, zu interessieren versuchen.<br />
• Wenn Bilder gezeigt werden, Zeit geben, erklären, was darauf zu sehen ist.<br />
Verwende die vorangegangene Übersicht als Checkliste und hake ab, was du in der Vorbereitung bereits<br />
beachtet hast und was du unbedingt während des Vortrages beachten willst!
Ausgewählte Methoden des Deutschunterrichts <strong>Pramper</strong> Seite 11<br />
Ein Sachthema schriftlich präsentieren – der Fachaufsatz<br />
Der Fachaufsatz ist der erste Schritt zu einer wissenschaftlichen Arbeitsmethode, wie man sie in der<br />
Oberstufe und auch an der Universität anwendet. Die Verfasserin/Der Verfasser sammelt zu einem Thema<br />
Informationen aus verschiedenen Quellen (d.h. aus Büchern, Zeitschriften, aus dem Internet ...) und zitiert<br />
die Quellen korrekt. Die gesammelten Informationen müssen geordnet und in sinnvolle Teilbereiche<br />
gegliedert werden (vgl. dazu auch die Gliederungsvorschläge zum Referat). Eine Facharbeit soll etwa zehn<br />
Seiten umfassen. Wenn ihr euch mit eurer Lehrerin/eurem Lehrer darauf einigt, kann die Facharbeit auch<br />
eine Schularbeit ersetzen.<br />
Gliederung eines Fachaufsatzes:<br />
• Deckblatt mit dem Namen der Verfasserin/des Verfassers und dem Titel der Arbeit, eventuell einem Foto,<br />
Jahr und Klasse<br />
• Inhaltsverzeichnis mit Seitenangabe und einem<br />
Verzeichnis der verwendeten Quellen (Bücher,<br />
Zeitschriften, Internetadressen)<br />
• Text mit Teilüberschriften und einer Gliederung<br />
(1., 1.1, 1.2, ...), Bilder könnten eingescannt<br />
werden. Wichtig ist, dass immer angegeben ist, wer<br />
der geistige Urheber eines Textabschnittes oder<br />
eines Bildes ist.<br />
• Nachwort mit Begründung der Themenwahl,<br />
Bericht über die Vorgangsweise und was man bei<br />
der Auseinandersetzung gelernt hat.<br />
Quellenangaben so vermerken:<br />
Buch: Autorin/Autor, Erscheinungsjahr, Titel des<br />
Buches, Verlag<br />
Beispiel: <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong> und andere (2009)<br />
Deutschstunde 4, Veritas-Verlag<br />
Zeitschrift: Name der Autorin/des Autors, Titel des Artikels, Titel der Zeitschrift, Jahrgang, Heftnummer<br />
Beispiel: Dr. Ortner (2008) Rat und Hilfe, Topic, 2008/7<br />
Internetlink: Autorin/Autor oder Webmaster(in), Titel, Datum des Abrufs, URL (Internetadresse)<br />
Beispiel: <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong> (2008), Deutschstunde Online-Material,<br />
http://www.veritas.at/ekatalog/products/7089<br />
CD-ROM: Autor(in), Erscheinungsjahr, Titel, Suchbegriff, Verlag,<br />
Beispiel: <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong> (2008) Rechtschreib- und Grammatik-fit, Lernsoftware, Veritas-Verlag<br />
Häufige Schülerreferate sind:<br />
Atomkraft, ehemaliges Konzentrationslager Mauthausen, Bericht über ein Arbeitslosenzentrum, Geschichte<br />
des Flugzeugs, Suchtgifte, eine Stadt, Mumien, Alkohol, Gentechnik, Online-Spiele, Olympia, Geschichte<br />
der Schule, ... der Schifffahrt, ... des Spielzeugs, ... des Heimatortes, ... der Zahlungsmittel, Sportstars, Aids,<br />
Zivildienst, Mode, Kriminologie, berühmte Bauwerke,…
Ausgewählte Methoden des Deutschunterrichts <strong>Pramper</strong> Seite 12<br />
Material für Referate oder Fachaufsätze sammeln und auswerten<br />
Die richtige „Quelle“ für Informationen suchen<br />
Die Möglichkeiten bei der Suche nach der richtigen „Quelle“ für ein Sachthema scheinen unerschöpflich zu<br />
sein. Zu jedem Thema gibt es eine Menge an Veröffentlichungen in Büchern, Zeitschriften und<br />
Internetportalen, um nur einige Medien zu nennen. Aber wo und wie findet man das „Richtige“?<br />
Wo und wie suche ich?<br />
A) In der Bibliothek:<br />
Mit Stift, Papier und Kleingeld (für Kopien) ausgerüstet geht man in die Schul-, Gemeinde- oder<br />
Stadtbibliothek und sucht Informationen zum gewählten Thema. Bibliotheksangestellte helfen, wenn du<br />
Schwierigkeiten hast, dich in der Bibliothek zurechtzufinden. Sie helfen dir auch, Bücher zu deinem Thema<br />
zu finden.<br />
Spätestens jetzt aber, musst du selbst entscheiden, welches Material für dich brauchbar ist und welches<br />
nicht. Trifft das Buch dein Thema wirklich? Ist es verständlich geschrieben, oder gar für Wissenschaftler<br />
gedacht?<br />
Überfliege Klappentext, Inhaltsverzeichnis und blättere das Buch durch.<br />
Ist das Buch für dich interessant, notiere Buchtitel und Stichworte, die die Quelle charakterisieren.<br />
Eventuell schreibe auch schon ganz wichtige Stellen (Zitate) auf oder kopiere sie. Das betrifft auch<br />
Abbildungen und Statistiken für deine Materialsammlung.<br />
Sehr brauchbare Bücher leihe sofort aus, damit du sie zu Hause noch genauer auswerten kannst.<br />
Anschließend gestalte mit deinen Notizen eine MindMap, um zu sehen, in welche Richtung sich deine<br />
Unterlagen entwickeln. Eventuell brauchst du auch noch andere Quellen für dein Thema.<br />
# Bei der Suche nach einem geeigneten Buch für ein Referat fallen dir mehrere Bücher ins Auge. Diese<br />
Erstinformationen stehen dir zur Verfügung. Bewerte den Wert der Informationen für deine Auswahl: von<br />
sehr wichtig (1) bis weniger wichtig (7)<br />
Name des Autors/der Autorin<br />
Buchtitel<br />
Titelbild<br />
Klappentext<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
Verlagsbeschreibung in einem Werbefolder<br />
Empfehlung von einem Leser/einer Leserin<br />
Der Klappentext ist eine knapp zusammengefasste Angabe über den Inhalt eines Buches. Der Klappentext<br />
befindet sich auf der Schutzhülle im eingeschlagenen Teil oder auf der Rückseite des Buches. Er gibt<br />
Information über den Inhalt und möchte zum Lesen verlocken.<br />
B) Im Internet: Suchmaschinen, die für dich suchen<br />
Sicher hast du in der Schule oder sogar zu Hause einen Internet-Anschluss. Erstelle eine Liste von<br />
Suchbegriffen für dein Thema und gib sie als Suchauftrag in eine Suchmaschine wie http://www.google.at/<br />
ein. Das Programm wird dir eine riesige Titelliste anbieten, die du einzeln anklicken kannst, um sie<br />
durchzulesen. Nur wenn dir ein Text sehr brauchbar erscheint, drucke ihn aus oder noch besser, kopiere ihn<br />
in eine WORD-Datei. Das scheint eine sehr bequeme Art der Informationssuche zu sein, aber sie ist mit<br />
etlichen Fallen verbunden. Wie kann man schon unter Tausenden Linkvorschlägen sagen, welche der<br />
richtige ist? Wer garantiert dir, die Richtigkeit der angebotenen Information? Schon besser ist es, in den<br />
folgenden Internetportalen nach Stichworten zu suchen. Diese Suchmaschinen sind ohne Werbung und auf<br />
Bildungsthemen für Lernende spezialisiert.<br />
www.eduhi.at www.kidsweb.at www.helles-koepfchen.at Kindernetz@swr.de www.blinde-kuh.at,<br />
Hilfreich können auch diese Links sein:
Ausgewählte Methoden des Deutschunterrichts <strong>Pramper</strong> Seite 13<br />
Die Gutenberg-DE Textsammlung (http://www.gutenberg2000.de/) ist mit 4,5 Millionen abgerufener Texte<br />
pro Monat die wohl meistgenützte Site für klassische und moderne Texte. Gesucht werden kann nach<br />
Themen und Autoren.<br />
Wikipedia (de.wikipedia.org), die kompetente Suchmaschine zu allen Wissensgebieten, wird weltweit von<br />
Usern ständig weiter entwickelt.<br />
Nicht vergessen werden soll auch der Hinweis darauf, dass es „fertige“ Referate im Internet gibt.<br />
Unterlagen für Referate gesucht? Hier wird „du“ geholfen mit allen Problemen von fremd übernommenen<br />
Manuskripten. Und wie im Internet oft üblich: wirklich Brauchbares ist kostenpflichtig! Daher, Vorsicht!<br />
Vor allem für den Hinweis auf fertige Referate gelten diese fünf goldenen Regeln<br />
Lernen mit Links - für Dummies<br />
Goldene Regel Nummer 1<br />
Grundsätzlich ist heute der Erwerb von Wissen mit dem Herunterladen von Files abgeschlossen. In früheren<br />
längst überholten Zeiten mussten die Schüler die Texte noch durchlesen oder noch schrecklicher:<br />
verstehen!<br />
Goldene Regel Nummer 2<br />
Grundsätzlich stimmt alles, was man aus dem Internet bezieht. Fehler macht man nur selber.<br />
Goldene Regel Nummer 3<br />
Lade grundsätzlich nie mehr als eine Datei zu einem Thema herunter. Eine zweite oder gar dritte würde dich<br />
nur verwirren.<br />
Goldene Regel Nummer 4<br />
Was besonders kompliziert klingt und mit Fremdwörtern gespickt ist, ist hundertprozentig für dich und deine<br />
Mitschüler geeignet. Jeder freut sich über eine Unterbrechung der Langeweile beim Referat, wenn du über<br />
unaussprechliche Fremdwörter stolperst.<br />
Goldene Regel Nummer 5<br />
Besonders auf Downloads von Universitätstexten fahren deine Mitschüler und Lehrer total ab. Die<br />
Spannung erreicht garantiert einen Höhepunkt, wenn du solch Unverständliches herunter liest.<br />
Schreibe die satirisch gemeinten „Links für Dummies“ so um, dass sie als „Links für helle Köpfchen“<br />
veröffentlicht werden können!<br />
Wie sind diese Sätze zu bewerten?<br />
# Handelt es sich bei den Sätzen um wahre oder falsche Aussagen? Gib an: W für<br />
Wahres, ein F für Falsches!<br />
Mit 6 Jahren ist jedes Kind schulreif.<br />
Auch Tiere träumen manchmal.<br />
Nicht nur die Reichen, sondern auch die Armen haben Sorgen.<br />
Kluge Eltern können keine unbegabten Kinder haben.<br />
Beim Schifahren geht es nur darum, der Schnellste zu sein.<br />
Der Mensch trägt Schuld am Aussterben vieler Tierarten.<br />
Die Zeit vergeht oft langsam.
Ausgewählte Methoden des Deutschunterrichts <strong>Pramper</strong> Seite 14<br />
Die Referatsvorbereitung<br />
Bei diesem Beispiel haben zwei Schülerinnen zum Thema Anne Frank<br />
und ihre Zeit zusammengearbeitet. Sie haben sich die Aufgaben geteilt<br />
und auch beim Referat abwechselnd gesprochen. Eine Schülerin sprach<br />
über für das Buch „Tagebuch der Anne Frank“, die andere präsentierte die<br />
dazupassenden Sachinformationen.<br />
(Wenn Platz, Foto mit zwei Schülerinnen beim Vortrag)<br />
Das Tagebuch der Anne Frank und ihre Zeit<br />
→ herzeigen: Bild der Anne Frank<br />
Ich habe das Tagebuch der Anne Frank vor einiger Zeit gelesen und weil es mich so beeindruckt hat, habe<br />
ich es als Referatsthema gewählt und weitere Recherchen dazu angestellt.<br />
Mich hat die schreckliche Zeit, in der dieses Buch geschrieben wurde, sehr interessiert, deshalb habe ich<br />
mich damit auseinander gesetzt und Informationen zusammengetragen.<br />
An Quellen für unser Referat haben wir verwendet:<br />
→ herzeigen: Buch: „Anne Frank Tagebuch“ von Anne Frank (2001)übersetzt von Mirjam Pressler und<br />
→ herzeigen: Buch „Geschichten der Geschichte“ von Georg Markus (1992).<br />
Außerdem haben wir im Internet verschiedene Sites zu Anne Frank und unser Geschichtsbuch<br />
durchgesehen.<br />
Zur Person Anne Frank<br />
Anne Frank wird am 12. Juni 1929 als Tochter des Bankiers Otto und seiner Frau Edith Frank in Frankfurt<br />
am Main geboren. Die jüdische Familie flüchtet 1933 nach Amsterdam, wo sie bis nach dem Einmarsch<br />
deutscher Truppen in Freiheit lebt. 1942 tauchen die Franks in einem Versteck unter, wo Anne ihre Gefühle<br />
und Erlebnisse in ihrem Tagebuch festhält. Nach zwei Jahren im Untergrund wird die Familie verraten. Anne<br />
und ihre Schwester sterben im März 1945 im KZ. Auch die Mutter stirbt im KZ. Heute wäre Anne Frank zirka<br />
80 Jahre alt.<br />
Jetzt zu ihrem Buch<br />
„Es beengt mich, dass wir gar nicht mehr heraus können, und ich habe Angst, dass wir entdeckt und<br />
erschossen werden.“<br />
Diese Worte hat die 13-jährige Anne Frank in ihr Tagebuch geschrieben.<br />
Die Vorahnung hat sich erfüllt, sie ist mit 16 Jahren im<br />
Konzentrationslager. gestorben. Anne Frank ist ein überaus fröhliches,<br />
aufgewecktes Kind gewesen, das mit seinen Eltern und seiner<br />
Schwester in Frankfurt am Main ein glückliches Leben in einer<br />
glücklichen Familie geführt hat. Aber 1933 ist mit Hitlers<br />
Machtübernahme alles anders geworden. Die Familie Frank ist ins<br />
neutrale Holland geflüchtet, hat eine Wohnung in Amsterdam gemietet,<br />
und der Vater hat eine Vertretung für Marmeladengelatine aufgebaut.<br />
Die Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 in Deutschland führte nicht nur zum Verlust der<br />
Demokratie, sondern auch zu zahlreichen Einschränkungen der jüdischen Mitbürger. Nach und nach<br />
verloren sie Rechte und ihr Eigentum und immer zahlreicher wurden die Verschickungen in<br />
Konzentrationslager. Dort mussten sie unter schrecklichen Zuständen Zwangsarbeit leisten. 1938 wurde<br />
Österreich an das Deutsche Reich angeschlossen, 1939 große Teile der Tschechoslowakei. Dann folgte der<br />
Krieg gegen Polen und 1940 der Krieg gegen Dänemark und Norwegen. Am 10. Mai 1940 kommt es auch<br />
in Holland zur Katastrophe. Hitlers Truppen überfallen das Land, Königin Wilhelmina und ihre Regierung<br />
flüchten nach London. Aber vielen Juden ist die Ausreise nicht mehr möglich. So wie der Familie Frank geht<br />
es zirka 15.000 weiteren Juden aus Deutschland und Österreich, die in Holland Zuflucht gefunden haben.<br />
(Wenn Platz, Karte Deutsches Reich – Holland)<br />
An ihrem 1<strong>3.</strong> Geburtstag bekommt Anne ein Tagebuch mit rotkariertem Umschlag geschenkt, in das sie von<br />
nun an regelmäßig schreibt. Sie schreibt es in niederländischer Sprache. Mit diesem Tagebuch schafft sie<br />
eine eindruckvolle und berührende Erinnerung an diese Zeit. Die darin geschilderten Erlebnisse sind sehr
Ausgewählte Methoden des Deutschunterrichts <strong>Pramper</strong> Seite 15<br />
beklemmend und zeigen das Ausmaß der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft. Vor allem von<br />
Jugendlichen wird das Buch sehr häufig gelesen.<br />
→ herzeigen:Buch und Foto vom Originaltagebuch<br />
„Es ist mein liebster Wunsch, dass ich eine berühmte Schriftstellerin werde“, schreibt sie. „Ob ich diese<br />
(größenwahnsinnige?) Neigung je zur Ausführung bringen werde, wird sich noch herausstellen, aber<br />
Themen habe ich schon“, schrieb sie in ihrem Tagebuch.<br />
Tatsächlich zeigen Annes Erinnerungen, dass sie scharf beobachten konnte und eine große literarische<br />
Begabung hatte.<br />
„Nun begann das Elend“, so beginnt ihre Schilderung über die Besetzung Hollands durch die<br />
Nationalsozialisten. „Ein diktatorisches Gesetz folgte dem anderen, Juden mussten den Stern tragen, ihre<br />
Fahrräder abgeben, durften nicht mehr mit der Elektrischen fahren, von Autos gar nicht zu reden, sie durften<br />
weder ins Theater noch ins Kino gehen, keinen Sport treiben. Unter diesem Druck stand von nun an unser<br />
ganzes Leben.“<br />
Doch es ist noch viel schlimmer geworden. Als Annes um drei Jahre ältere Schwester Margot Anfang Juli<br />
1942 aufgefordert wird, sich „zum Arbeitseinsatz zu melden“, ist der Familie klar, was das bedeutet: die<br />
Deportation ins KZ.<br />
Da beschließen die Franks, gemeinsam in den Untergrund zu gehen, das heißt sich zu verstecken. Die<br />
Vorbereitungen sind längst getroffen gewesen, da man mit einer solchen Situation bereits gerechnet hat.<br />
Hinter Herrn Franks Büro befindet sich ein leer stehendes Lager, in das eine als Aktenschrank getarnte<br />
Geheimtür eingebaut wird. Das Lager dient der Familie als Notunterkunft, in die sie nun einzieht.<br />
Hilfe durch eine Wienerin<br />
Eine Wienerin hat ihnen in den folgenden zwei Jahren beim Überleben in dem Hinterhaus<br />
in der Amsterdamer Prinsengracht Nr. 263 geholfen. Hermine Gies ist nach dem Ersten<br />
Weltkrieg mit anderen hungernden Kindern von Österreich nach Holland gebracht worden<br />
und dann bei ihren Adoptiveltern in Amsterdam geblieben.<br />
→ herzeigen Foto von Frau Gies<br />
Zuletzt hat sie als Otto Franks Sekretärin gearbeitet. Die jüdische Familie vertraut ihr<br />
bedingungslos. Und Hermine Gies hat dieses Vertrauens nicht enttäuscht. Sie und ihr<br />
holländischer Mann setzten Tag für Tag ihr Leben aufs Spiel, um die Franks mit<br />
Lebensmitteln zu versorgen. Bald kommen vier weitere Juden dazu, die in dem winzig<br />
kleinen Versteck Zuflucht finden.<br />
„Aus dem Fenster schauen dürfen wir natürlich nie“, notiert Anne. Zwischen 9 und 17 Uhr<br />
konnten weder Wasserhahn noch Toilette benutzt werden, da man sonst in den<br />
benachbarten Büros auf die Flüchtlinge aufmerksam geworden wäre. Noch ärger war es, an die Schicksale<br />
vieler Freunde denken zu müssen: „Ich sehe sie oft im Geiste vor mir, gute, unschuldige Menschen mit<br />
weinenden Kindern, kommandiert von ein paar furchtbaren Kerlen, geschlagen und gepeinigt und<br />
vorwärtsgetrieben, bis sie umsinken. Niemand ist ausgenommen. Alte, Babys, schwangere Frauen, Kranke,<br />
Sieche, alles, alles, muss mit in diesem Todesreigen.“<br />
(Wenn Platz Foto vom Haus)<br />
Das Ende<br />
Am 1. August 1944 setzt sich Anne in ihr Buch mit dieser kindlichen Überlegung auseinander: „Wie ich mich<br />
verhalten würde, wenn keine anderen Menschen auf der Welt wären“. Es ist ihre letzte Eintragung. Drei<br />
Tage später fliegt das Versteck auf, wobei bis heute nicht geklärt ist, wer es verraten hat. Alle acht<br />
Bewohner werden verhaftet und ins KZ geschickt. Mutter Edith stirbt in Auschwitz, Anne und ihre Schwester<br />
landen im KZ Bergen-Belsen, wo sie wenige Wochen vor Kriegsende an Typhus elend zugrunde gehen.<br />
Vater Otto Frank überlebt als Einziger. Er stirbt 1980.<br />
Auschwitz war das größte Konzentrationslager der Nationalsozialisten, zum Schluss war es nur mehr ein<br />
Vernichtungslager, in das die Menschen zur Tötung und Verbrennung gebracht wurden. Über eine Million<br />
Menschen wurden dort vernichtet.<br />
Typhus ist eine schwere Erkrankung, bei der es zu Durchfall mit hohem Fieber kommt. Hervorgerufen wird<br />
die Krankheit durch Salmonellen, die in unhygienischen Zuständen entstehen.
Ausgewählte Methoden des Deutschunterrichts <strong>Pramper</strong> Seite 16<br />
Bergen-Belsen war ein KZ in Deutschland, in der Nähe von Hannover. Es war zuerst ein Kriegsgefangenlager und<br />
wurde später ein KZ. Am 15. April, also einen Monat nach dem Tod von Anne und ihrer Schwester, wird das Lager<br />
von den Engländern befreit. Im Internet ist von dem britischen Sanitätsoffizier Glyn-Hughes zu lesen:<br />
"Die Zustände im Lager waren wirklich unbeschreiblich; kein Bericht und keine Fotografie kann den grauenhaften<br />
Anblick des Lagergeländes hinreichend wiedergeben; die furchtbaren Bilder im Innern der Baracken waren noch viel<br />
schrecklicher. An zahlreichen Stellen des Lagers waren die Leichen zu Stapeln von unterschiedlicher Höhe<br />
aufgeschichtet; einige dieser Leichenstapel befanden sich außerhalb des Stacheldrahtzaunes, andere innerhalb der<br />
Umzäunung zwischen den Baracken. Überall im Lager verstreut lagen verwesende menschliche Körper. Die Gräben<br />
der Kanalisation waren mit Leichen gefüllt, und in den Baracken selbst lagen zahllose Tote, manche sogar zusammen<br />
mit den Lebenden auf einer einzigen Bettstelle….“<br />
Annes Tagebuch ist bei der Festnahme in dem Versteck geblieben. Hermine Gies hat die Aufzeichnungen<br />
gerettet und übergibt sie Annes Vater nach dessen Rückkehr aus dem KZ. Für die Wienerin ist es „ganz<br />
selbstverständlich gewesen, zu helfen“, sagt sie. Die Erinnerungen lassen sie auch nach 60 Jahren nicht<br />
los, die Bilder aus dem Hinterhaus verfolgen sie immer noch. „Annes Schicksal macht uns den immensen<br />
Verlust, den die Welt durch den Holocaust erlitten hat, begreifbar“, sagt Frau Gies. „Wir müssen uns<br />
bewusst sein, was Anne und die Millionen anderen Opfer zu unserer Gesellschaft beigetragen hätten, wenn<br />
sie hätten überleben dürfen.“<br />
Im Mai 1944 hat Anne Frank aufgeschrieben: „Nach dem Krieg möchte ich auf jeden Fall ein Buch mit dem<br />
Titel Das Hinterhaus, herausbringen, ob das gelingt, bleibt die Frage, aber mein Tagebuch wird dafür dienen<br />
können.“<br />
Das Hinterhaus ist wirklich 1947 von ihrem Vater veröffentlicht worden. Später wird es mit dem Titel Das<br />
Tagebuch der Anne Frank, in viele Sprachen übersetzt und 25 Millionen Mal verkauft. In vielen Ländern wird<br />
es kam als Bühnenstück zur Aufführung gebracht und es ist mehrmals verfilmt worden.<br />
Ihr „liebster Wunsch“ ist in Erfüllung gegangen. Anne Frank ist „eine berühmte Schriftstellerin“ geworden —<br />
eine weltberühmte sogar. Nur erleben — selbst erleben, durfte sie das nicht mehr.<br />
Wir hoffen, wir haben euch ein bisschen für das Thema interessieren können. Das Buch und das Thema<br />
waren für uns sehr wichtig. Wir verstehen nicht, dass es heute noch Menschen gibt, die Nazisprüche<br />
klopfen. Denen würden wir das Buch sehr empfehlen. Danke für eure Aufmerksamkeit!<br />
PA Bewertet die Referatsvorbereitung der beiden Schülerinnen! Wie gut haben sie das Thema getroffen?<br />
Wie sehr haben sie die richtige „Sprache“ für Schüler getroffen? Haben sie - wie bei der mündlichen<br />
Sprachverwendung üblich - die Zeitformen Präsens und Perfekt verwendet? Wie passend waren die Bilder?<br />
Welche Tipps nimmst du von diesem Beispiel mit? Was wirst du dir von diesem Text für deine<br />
Referatsvorbereitung abschauen?<br />
# Die Schülerinnen haben den ersten Teil ihrer Vorbereitung bereits mit gelben Markierungen der<br />
Stichwörter versehen. Blau haben sie wortwörtliche Textstellen (Zitate) markiert. Setze diese Arbeit fort!<br />
# Was würdest du zum Thema noch wissen wollen? Formuliere Fragen an das Thema!<br />
_____________________________________________________________________________________<br />
_____________________________________________________________________________________<br />
_____________________________________________________________________________________<br />
# Die beiden Schülerinnen möchten noch eine kurze Zusammenfassung ihres Referates an die Mitschüler<br />
und Mitschülerinnen weitergeben. Das ist nun deine Aufgabe: Fasse das Allerwichtigste in einem 100<br />
Wörter-Text zusammen. Verwende auch Farben für Hervorhebungen! Im Merktext soll die Zeitformen der<br />
schriftlichen Sprachverwendung Präteritum und Plusquamperfekt verwendet werden!<br />
A Arbeiten Sie ein beispielhaftes Referat aus, so wie sie es später Schülern präsentieren könnten!<br />
(10 min, zu einem Thema, das langfristig aktuell ist und Schüler/innen interessieren kann.) Stellen<br />
Sie auch die entsprechenden Materialien, Bilder bereit.
Ausgewählte Methoden des Deutschunterrichts <strong>Pramper</strong> Seite 17<br />
<strong>3.</strong> <strong>Kompetenz</strong>: Informationen entnehmen und als Überblick<br />
zusammenfassen (Exzerpieren)<br />
Wie man Informationen aus Sachtexten entnimmt<br />
1. Schritt: Erstes überfliegendes „Lesen“ - Verschaff dir einen Überblick!<br />
2. Schritt: Gründliches Lesen – Textmarker und Bleistift verwenden, Wichtiges hervorheben, Unbekanntes in<br />
Randnotizen klären.<br />
<strong>3.</strong> Schritt: Mit eigenen Worten die wesentlichen Aussagen zusammenfassen, auf eine einfache, gut verständliche<br />
Sprache achten.<br />
4. Schritt: Abschließendes Vergleichen – eine Reinschrift anlegen, Farben, Symbolen Unterstreichungen und<br />
Teilüberschriften verwenden.<br />
# Lies zuerst den Text still und markiere Wichtiges und Unklares!<br />
Der bedrohte Regenwald<br />
nach Barbara Veit<br />
Viele Länder Asiens, Südamerikas und Afrikas sind reich an Gold und anderen Bodenschätzen. Aber ihr größter<br />
Reichtum sind die tropischen Regenwälder.<br />
Es ist ein Reichtum anderer Art. Natur in ihrem ursprünglichen Zustand, wie es sie vor Jahrmillionen gegeben hat,<br />
kann man nur noch in diesen Ländern erleben. [...]<br />
In ihnen leben mindestens die Hälfte aller Tier- und Pflanzenarten der Erde. Bäume des Regenwaldes werden bis zu 60<br />
m und mehr hoch. Durch Brandrodung für Viehzucht, Pflanzenanbau und Tierhaltung wird Jahr für Jahr der Regelwald<br />
reduziert. Industrien, Brennholzeinschlag und Holzkohleproduktion tragen ebenso dazu bei. Der Bestand von<br />
Tropenholz für die Möbel- und Fußbodenherstellung ist bereits weltweit bedroht.<br />
Das Holz das im Regenwald gerodet wird ist häufig Wegbereiter für die weitere Zerstörung, da der Raubau über<br />
Straßen zugänglich gemacht werden muss. Laut der Vereinten Nationen wurden 1989 17 Mio ha Regenwald zerstört.<br />
Die Auswertung von Satellitenphotos ergab für 1990 sogar eine Fläche von 20 Mio ha.<br />
40% der erfolgten Abholzung entfielen auf Südamerika, 30% auf Asien und 30% auf Afrika.<br />
Die Zerstörung ist eine der größten Umweltkatastrophen unserer Zeit. Folgen hieraus ergeben sich nicht nur für die<br />
örtliche Tier- und Pflanzenwelt (Artensterben), die Nahrungsgrundlagen der dort lebenden Menschen und die gesamte<br />
Ökologie. Die Abtragung lockerer Bodenteile wird als Erosion. bezeichnet. Diese hat Auswirkung auf das gesamte<br />
Klima der Welt. Aus diesen Gründen fordern viele Umweltgruppen einen Boykott von Tropenholz und eine<br />
Einschränkung des Fleischkonsums.<br />
Fernsehbilder, die wir vom tropischen Regenwald kennen, bieten trotz ihrer Farbenpracht nur einen müden Eindruck<br />
von der Wirklichkeit.<br />
Etwas ganz anderes ist es, mitten im Dschungel zu stehen, ganz klein unter den Kronen von fünfzig Meter hohen<br />
Baumriesen, umgeben von Dämmerlicht und feuchter Luft, die das Atmen schwer macht.<br />
Wenn man still dasteht und lauscht, hört man das Knistern und Krabbeln von Millionen Insekten.<br />
An Pfützen und Tümpeln versammeln sich Hunderte von bunten Schmetterlingen in allen Größen. Die Wunder des<br />
Regenwaldes kommen vor allem von der Vielfalt der Pflanzen und Tiere. Forscher haben herausgefunden, dass allein<br />
in einem Hektar Wald, das sind 10 000 Quadratmeter, 227 verschiedene Baumarten stehen können. Aber das ist nur ein<br />
Teil der unendlichen Pflanzenvielfalt: Lianen und andere Kletterpflanzen ranken sich zwischen den Stämmen. An den<br />
Ästen wachsen Orchideen, Farne und Bromelien. Moose und Flechten bedecken die Stämme. Wissenschafter schätzen,<br />
dass es zwei Millionen verschiedene Arten von Pflanzen im tropischen Regenwald gibt.<br />
Bearbeite jetzt den Text!<br />
a) Lies ihn nochmals gründlich durch, verwende Textmarker und Bleistift, kläre Unbekanntes jetzt.<br />
b) Lege eine Zusammenfassung mit den wichtigsten Informationen an!<br />
A Lege eine sauber gestaltete Reinschrift deiner Zusammenfassung mit Farben, Symbolen<br />
Unterstreichungen und Teilüberschriften in deinem Heft an!
Ausgewählte Methoden des Deutschunterrichts <strong>Pramper</strong> Seite 18<br />
Wissen ordnen<br />
Lies zuerst die interessanten Informationen über den menschlichen Körper und verschaffe dir einen<br />
Überblick!<br />
Der Mensch in Zahlen<br />
(ansprechende Gestaltung wie Jugendlexikon, Seite mit heller Farbe unterlegen, wenn möglich Doppelseite)<br />
Der menschliche Körper ist ein faszinierendes und komplexes Kunstwerk. Wie eine verlässlich laufende<br />
Maschine arbeitet er ohne Pause. Die Leistungen, die Organe und Systeme in jeder Sekunde vollbringen,<br />
sind großartig. Und inzwischen auch messbar. Hier die interessantesten Zahlen und Fakten aus unserem<br />
Inneren:<br />
Zellen: Ein erwachsener Mensch besteht aus 100 Billionen<br />
einzelner Zellen. Es gibt 200 verschiedene Zellarten, die<br />
durchschnittlich nur 40 Tausendstel Millimeter klein sind.<br />
Sämtliche Zellen aneinandergereiht, würden eine Strecke von<br />
vier Millionen Kilometern ergeben und 100-mal um die Erde<br />
reichen.<br />
Bei einem Erwachsenen sterben in jeder Sekunde etwa 50<br />
Millionen Zellen ab und fast eben so viele werden neu gebildet.<br />
Die Bilanz ist nicht ganz ausgeglichen — der älter werdende<br />
Mensch baut nach und nach ab. Die Lebensdauer der Zellen ist<br />
unterschiedlich. Die Schleimhautzellen des Dünndarms etwa<br />
bestehen 1,4 und Hautzellen 19,2 Tage. Rote Blutkörperchen<br />
werden 120 und Leberzellen 222 Tage alt. Die Nervenzellen<br />
wiederum arbeiten lebenslang.<br />
Gehirn: Hier arbeiten etwa 20 Milliarden Nervenzellen, die mehr als 100 Billionen Querverbindungen haben.<br />
Täglich gehen 50.000 bis 100.000 Nervenzellen verloren, was aber nur der Größe eines Fliegenhirns<br />
entspricht. 200.000 Impulse, die mit 290 km/h weitergeleitet werden, kann eine Nervenzelle gleichzeitig<br />
verarbeiten. Das Gehirn macht 2 Prozent der Körpermasse aus, benötigt aber 20 Prozent des<br />
aufgenommenen Sauerstoffs.<br />
Atmen: Etwa 21.000-mal am Tag atmen wir und bewegen damit 10.000 Liter Luft beim Ein- und Ausatmen<br />
durch die Lunge. Diese Menge reicht aus, um 40 Zwei-Mann-Schlauchboote aufzublasen. Mit 900 km/h<br />
pustet die Lunge die Luft beim Husten durch die Atemwege, beim Niesen sind es lediglich 170 km/h. Beim<br />
Schlafen atmen wir etwa 5 Liter Luft pro Minute ein und aus, beim Spazierengehen 14 und heim laufen 170<br />
Liter.<br />
Ohren: Das Trommelfell hat einen Durchmesser von lediglich 9 mm und eine Fläche von 88 mm2. Die sich<br />
anschließenden Gehörknöchelchen (Hammer, Amboss und Steigbügel) verstärken die Schwingungen des<br />
Trommelfells um das Zwanzigfache. Ein gesundes Ohr kann eine männliche Stimme in normaler Lautstärke<br />
noch aus 180 Metern Entfernung hören. Ab einer Dauerbelastung von 90 Dezibel entstehen Hörschäden. 90<br />
Dezibel entsprechen einem in 5 Metern Entfernung vorbeifahrenden Lkw. In Discos werden 100 Dezibel und<br />
auch mehr erreicht.<br />
Nervenfasern: Die Gesamtlänge aller Nervenfasern des Menschen beträgt 768.000 km. Das entspricht der<br />
Strecke von der Erde zum Mond und wieder zur Erde.<br />
Augen: Babys aller Länder haben bei der Geburt blaue Augen. Schon Stunden danach kann sich die<br />
Augenfarbe ändern. Nach dem Tod ist die Augenfarbe aller Menschen grün-braun. Die Augenlinse ist 4 mm<br />
dick und wiegt 174 mg. Sie besteht zu 65 Prozent aus Wasser und zu 35 Prozent aus Eiweiß. Jedes Auge<br />
hat 127 Millionen Sehsinnzellen, die es ermöglichen, 200 Farbtöne zu unterscheiden. Alle 20 Sekunden<br />
kommt es zu einem Augenlidschlag. 8 Prozent der Männer sind farbenblind (Frauen: 0,4 Prozent).<br />
Nase: Die gesamte Oberfläche der Nasenschleimhaut beträgt 140 bis 160 cm2. Die Schleimschicht<br />
erneuert sich alle 10 Stunden. Mit den etwa 30 Millionen Riechsinneszellen kann der Mensch 10.000 Düfte<br />
unterscheiden. Allerdings können 40 Prozent der Bevölkerung Urin nicht wahrnehmen, Malz 36, Sperma 20,<br />
Fisch 7 und Schweiß 2 Prozent.
Ausgewählte Methoden des Deutschunterrichts <strong>Pramper</strong> Seite 19<br />
Muskeln: Im Körper befinden sich etwa 640 Muskeln und machen 40 bis 50 Prozent des Körpergewichts<br />
aus. Beim Lachen bewegen wir 15 und beim Stirnrunzeln 43 verschiedene Muskeln. Muskelfasern sind<br />
zwischen 1 mm und 15cm lang. Täglich entfalten die Muskeln so viel Kraft wie ein Kran, der einen 6-<br />
Tonnen-Lkw 50 Meter in die Höhe hebt.<br />
Knochen: Die Knochen sind die wichtigsten Bestandteile des menschlichen Skelettes und machen 10<br />
Prozent des Körpergewichts aus. Ein Erwachsener hat 215 Knochen. 5 Prozent aller Männer in Europa<br />
haben eine zusätzliche Rippe. Der größte Knochen ist der Oberschenkelknochen, der im Durchschnitt 46<br />
cm lang ist und 1,65 Tonnen tragen kann. Kleinster Knochen ist der Steigbügel im Mittelohr (2,6 bis 3,4<br />
mm).<br />
Verdauung: Der Darm eines Erwachsenen ist zwischen 5 und 8,5 m lang. Damit erreicht er die Maße einer<br />
ausgewachsenen Anakonda. Auseinandergebreitet hätte das Darmsystem eine Oberfläche von 400 m2.<br />
Mehr als 400 verschiedenen Arten von Bakterien bietet der Darm Lebensraum. Jeder Mensch produziert<br />
täglich 600 Milliliter Darmgase. Rechnet man die ganze Weltbevölkerung zusammen, macht das eine<br />
Menge aus, mit der man täglich 13 Hindenburg Zeppeline füllen könnte.<br />
Leber: Die Leber ist das zentrale Organ des gesamten Stoffwechsels und die größte Drüse des Körpers.<br />
Die wichtigsten Aufgaben sind die Produktion lebenswichtiger Eiweißstoffe, Verwertung von<br />
Nahrungsbestandteilen und der Abbau und Ausscheidung der Nährstoffe, die aus dem Darm ins Blut<br />
aufgenommen werden. Täglich entgiften 2000 Liter Blut die Leber, die pro Tag 700 Milliliter Galle produziert.<br />
10 Stunden braucht die Leber, um etwa die Bestandteile von 1 Liter Rotwein abzubauen.<br />
Nieren: Die Nieren eines Erwachsenen produzieren bei normaler Flüssigkeitsaufnahme bis zu 4 Liter Harn<br />
pro Tag. Dabei verbrauchen sie etwa 30 Liter Sauerstoff. Täglich fließen 1700 Liter Blut durch die Nieren.<br />
Fallen beide aus, kann der Mensch nur noch 36 Stunden leben.<br />
Haut und Haare: Der Mensch wird je nach Größe von 1,5 bis 1,8 m2 Haut umhüllt. Sie wiegt 11 bis 15 kg.<br />
Auf der Kopfhaut wachsen pro cm2 200 bis 320 Haare, insgesamt sind es zwischen 90.000 und 150.000.<br />
Kopfhaare wachsen pro Tag um 0,35 mm, Augenbrauen nur um 0,16 mm. Jugendliche verlieren 40,<br />
Erwachsene 90 Haare am Tag.<br />
Kreislauf: 5 bis 6 Liter Blut fließen in unseren Adern und machen 6 bis 8 Prozent des Körpergewichts aus.<br />
Es dauert 20 bis 60 Sekunden, bis das gesamte Blut ein Mal die Runde durch den Körper geschafft hat. Pro<br />
Tag transportiert das Blut 500 Liter Sauerstoff, bei Sportlern bis zu 1000 Liter. Anzahl der roten<br />
Blutkörperchen (Erythrozyten): 25 Billionen. Pro Tag werden 208 Milliarden rote Blutkörperchen neu<br />
gebildet. Weiße Blutkörperchen (Leukozyten) sind mit 25 bis 100 Milliarden vertreten. Die Blutgruppe 0 ist<br />
mit 46 Prozent die häufigste der Welt.<br />
Herz: Das Herz ist so groß wie die geballte Faust seines Trägers oder etwa 15 cm lang und 10 cm breit. Bei<br />
einem Erwachsenen schlägt es in Ruheposition 60- bis 70-mal in der Minute. Bei extremer körperlicher<br />
Anstrengung können es bis zu 200 Schläge in der Minute sein. 3 Milliarden Mal schlägt es im Laufe eines<br />
70 Jahre dauernden Lebens. In Ruhe pumpt es 5 Liter Blut pro Minute durch die Adern, in der Stunde etwa<br />
290, an einem Tag 7000 und in einem Jahr 2,5 Millionen Liter.<br />
Ernährung: So viel isst ein Durchschnittseuropäer in seinem ganzen Leben, in dem er etwa 100.000<br />
Mahlzeiten zu sich nimmt: 3 Rinder, 10 Schweine, 2 Kälber, 2 Schafe, 350 Hühner, 2000 Fische, 10.000<br />
Eier, 1000 Kilo Käse, 100 Säcke Erdäpfel, 80 Säcke Mehl und Zucker, 5000 Brote, 6000 Stück Butter, 750<br />
Kilo Margarine, 425 Liter Speiseöl sowie 100 Torten und Kuchen. Hinunter gespült mit 50.000 Litern<br />
Flüssigkeit — dem Fassungsvermögen eines kleinen Swimmingpools.<br />
A Jetzt sollst du aus diesem Text zu diesen Sachthemen die Informationen entnehmen!<br />
Die Sinnesorgane – Markiere alles blau, was zu diesem Thema passt<br />
Der Kopf – Markiere alles grün, was zu diesem Thema passt<br />
Das Blut – Markiere alles rot, was zu diesem Thema passt<br />
Stelle die Information zu einem dieser Themen in einer Zusammenfassung vor. Verwende auch<br />
Teilüberschriften dafür!<br />
(aus Konrad Kunsch und Dr. Steffen Kunsch: „Der Mensch in Zahlen“, Spektrum Akademischer Verlag)
Ausgewählte Methoden des Deutschunterrichts <strong>Pramper</strong> Seite 20<br />
Texte kürzen – Biografien erstellen<br />
A Kürze den Text auf die allerwichtigsten Informationen. Dazu markiere zuerst das Allerwichtigste,<br />
anschließend schreibe es mit eigenen, stichwortartigen Beschreibungen heraus. Zuletzt gestalte die<br />
Zusammenfassung als saubere Reinschrift mit Farbe in deinem Heft!<br />
Wie die Dresdner Hausfrau Melitta Bentz den Kaffeefilter erfand<br />
Im Orient war die Wirkung der Kaffeebohne schon lange bekannt, als im 17. Jahrhunderts in Europa die<br />
Stunde der Kaffeebohne schlug. Und es dauerte noch viel länger, bis ihr bitteres Aroma bei allen Schichten<br />
angenommen war. Doch bis zu Beginn unseres Jahrhunderts waren die Zubereitungsarten für die<br />
gemahlenen Bohnen eher mangelhaft. Entweder wurden Pulver und Wasser fünf Minuten gekocht und<br />
anschließend vorsichtig geschlürft, um den Kaffeesatz nicht aufzuwirbeln. Oder das Gebräu wurde durch ein<br />
Leinensäckchen abgegossen. Für Genießer war beides ein Gräuel: Mal verstopften die Säckchen, mal<br />
wurde der Kaffee kalt oder es blieb ein körniger Bodensatz, der mit dem letzten Schluck dann doch<br />
unweigerlich gegen die Lippen schwappte.<br />
Erst im Jahre 1908 nahte Abhilfe dank einer umtriebigen Hausfrau. Am Anfang ihrer Überlegungen stand<br />
eine Tat der Zerstörung. Mit Hammer und Nagel schlug Melitta Bentz ein Dutzend Löcher in einen<br />
Messingtopf. Hernach holte sie Löschblätter aus den Schulheften ihrer zwei Söhne, zerschnitt das Papier<br />
und legte es in das siebartige Gefäß. Nach zwei, drei Probedurchläufen während eines Kaffeekränzchens<br />
war der Beweis erbracht: Frau Bentz hatte einen Filter erfunden, der einen satzfreien Kaffee liefert.<br />
Melitta Bentz wusste vom bleibenden Wert ihres ramponierten Topfes. Sie beantragte<br />
Gebrauchsmusterschutz, der vom kaiserlichen Patentamt auch innerhalb weniger Tage bewilligt wurde.<br />
Geschützt waren das „Filtrierpapier“ und der „Kaffeefilter“, ausgestattet „mit auf der Unterseite gewölbtem<br />
und mit Vertiefung versehenem Boden sowie schräg gerichteten Durchflusslöchern“, so war es im<br />
Patentblatt vom 8. Juli 1908 zu lesen. Damit fiel der Startschuss für eine außergewöhnliche Karriere. Aus<br />
der 35-jährigen Hausfrau wurde eine Unternehmerin. Noch im Jahr der Erfindung gründete sie eine Firma<br />
auf ihren Namen.<br />
Magere 73 Reichspfennig betrug das Grundkapital. Das ehrgeizige Ehepaar Bentz musste die Produktion<br />
notgedrungen im Abstellraum ihrer Vierzimmerwohnung aufnehmen. In Handarbeit stellten sie die ersten<br />
Filter selbst her, verpackten und verschickten die Fracht, unter Mithilfe der minderjährigen Kinder. Der<br />
Vater, ehemals Abteilungsleiter in einem Dresdner Kaufhaus, bewährte sich im Außendienst. Mit einem<br />
Bollerwagen karrte er über die holprigen Straßen, um die Erfindung seiner Frau den Kundinnen vor Ort zu<br />
demonstrieren.<br />
Der Umsatz wuchs schnell. 1929, als die Produktionskapazitäten in Dresden längst nicht mehr ausreichten,<br />
zog man nach Minden in Ostwestfalen, wo der Firmensitz bis heute geblieben ist. Gleichzeitig baute man<br />
eine Papier- und eine Porzellanfabrik. Nun konnte im großen Stil produziert werden. Mit<br />
Improvisationsgeschick und Geschäftssinn überstand das Unternehmen Geldentwertung, Krieg und<br />
Zerstörung. Am Ende des Zweiten Weltkriegs stand Melitta, mit zuletzt 2000 Mitarbeitern, freilich fast wieder<br />
am Anfang: Die zwischenzeitlich in Düren eröffnete Papierfabrik war zerstört, die Porzellanmanufaktur in<br />
Karlsbad an die Tschechoslowakei gefallen und das Mindener Hauptwerk wurde von den Engländern als<br />
Kaserne genutzt.<br />
Also verlegte man die Produktion in eine alte Ziegelei und ein ehemaliges Wehrmachtsdepot. Als Melitta<br />
Bentz, 1950 starb, war ihr Vorname als Markenartikel in deutschen Haushalten fest etabliert; wer keinen<br />
Kaffee trank, kannte wenigstens das Logo, einen elegant geschwungenen Schriftzug auf rotem Grund — bis<br />
heute unverändert.<br />
Heute hat die „Unternehmensgruppe Melitta“ 4600 Mitarbeiter und einen Jahresumsatz von knapp einer<br />
Milliarde Euro.1967 hat Melitta außerdem den Fruchtsafthersteller Granini übernommen. Von den insgesamt<br />
in Deutschland verbrauchten 10 Milliarden Filterbeuteln pro Jahr verkauft Melitta immerhin 4,5 Milliarden —<br />
die Dresdner Hausfrauen-Idee hat reiche Früchte getragen.<br />
(nach Jürgen Bräunlein in „Die Zeit“, 26. 4. 96, Seite 12-13)<br />
A Auch der Erfinder von Microsoft, Bill Gates, hat klein begonnen und gilt heute als einer der<br />
reichsten Menschen der Welt. Recherchiere im Internet seinen Lebenslauf und stelle das Ergebnis<br />
als gut gestaltete Zusammenfassung mit Farbe und Hervorhebungen von ca. 500 Wörtern vor!
Ausgewählte Methoden des Deutschunterrichts <strong>Pramper</strong> Seite 21<br />
4. <strong>Kompetenz</strong>: Recherchen im Internet<br />
Zielgerichtete Internetrecherche<br />
Du nutzt die Vorteile des Internets und benützt es immer öfter zum Auffinden von Information zu<br />
Sachthemen. Aber bemerkst du selbst, dass dir so wie vielen Schülern das zielgerichtete und zeitsparende<br />
Suchen schwer fällt. Oft vergeudest du viel Zeit mit „leeren Kilometern“..<br />
Es ist verständlich, wenn du nicht sofort die richtige Suchstrategie für eine effektive Computer-Recherche<br />
beherrscht. Denn auch das muss man üben. In deiner Zukunft wird dein „Suchtalent“ jedoch von großer<br />
Bedeutung sein!<br />
Ein erfolgloses Beispiel:<br />
Clemens möchte morgen baden gehen, aber geht das vom Wetter überhaupt?<br />
Mit Suchbegriffen wie „morgen“ und „baden“ recherchiert Clemens in der Suchmaschine google. Er stößt<br />
gleich auf die Radiosendung „Guten Morgen, Baden Württemberg“, dann auf „Guten-Morgen-SMS-Sprüche“<br />
usw. Es ist wohl klar, dass Clemens kaum in absehbarer Zeit zu einen zufrieden stellenden Ergebnis<br />
kommt.<br />
Die Fragestellung müsste besser so lauten:<br />
Wie wird das Wetter morgen in meinem Bundesland sein?<br />
Im google und den Suchbegriffen „wetter“ „salzburg“ oder orf „wetter“ gelangt man schnell zur gewünschten<br />
Information.<br />
Bevor du mit einer Recherche beginnst, sollst du dir diese Fragen stellen:<br />
1. Welches Thema will ich wirklich untersuchen? Ja klarer du das Thema definierst, umso effektiver<br />
gehst du weiter vor.<br />
2. Wo schlagst du am besten nach? google? yahoo? wikipedia? eduhi? orf? Das hängt ganz vom<br />
Thema ab.<br />
<strong>3.</strong> Welches sind deine Fragen zum Thema? Daraus ergeben sich die Stichworte zur Internetrecherche.<br />
4. Was möchtest du mit den gefundenen Informationen anfangen, wofür brauchst du sie? Kopieren,<br />
abspeichern, ausdrucken oder genügt die bloße Auskunft?<br />
A Suchaufgabe 1: Wieder einmal mit Freunden nach Wien (oder nach Klagenfurt) zu fahren, das<br />
wäre nett, aber wie kommt ihr dort hin? Was kostet das und welche Vergünstigungen habt ihr, wenn<br />
ihr zu sechst fahrt?<br />
Das Recherchethema: Welche Verbindung von deinem Heimatort gibt es mit einem öffentlichen<br />
Verkehrsmittel nach Wien am kommenden Tag, das vor 15 Uhr am Ziel ankommt? Was bringt die<br />
Gruppenermäßigung beim Tarif für Jugendliche?<br />
Rechercheportal: www.öbb.at<br />
A oder Suchaufgabe 2: Du hast gehört, eine Olympus Digitalkamera soll gut sein. Wo findet man die<br />
vergleichbar günstigste, wenn man max. 150 Euro für eine neue ausgeben möchte??<br />
Recherchiere die Markenauswahl und die Preisvergleiche unter www.Geizhals.at, www.Ebay.at Sofortkauf<br />
und bei www.amazon.at.<br />
A oder Suchaufgabe 3: Unlängst ist beim Sport eine unangenehme Geschichte mit einem Armbruch<br />
passiert. Du hast nicht gewusst, wie du helfen kannst. Das soll dir nicht mehr passieren.<br />
Das Recherchethema: Wie leistet man Erste Hilfe bei Knochenbrüchen?<br />
a. Welche Arten von Brüchen gibt es? b. Wann muss geschient werden? c. Wann darf nicht geschient<br />
werden?<br />
PLUS Wie leistet man Erste Hilfe bei Verbrennungen?<br />
a. Art der Verbrennung — mögliche Folgen von Verbrennungen<br />
b. Was bei Verbrennungen zu tun ist:<br />
c. Was man bei Verbrennungen auf keinen Fall tun darf:
Ausgewählte Methoden des Deutschunterrichts <strong>Pramper</strong> Seite 22<br />
5. <strong>Kompetenz</strong>: Auseinandersetzung mit Texten<br />
Gezielt lesen - nach Antworten suchen<br />
A Lassen sich diese sechs Fragen durch den Text beantworten? Das weißt du erst, wenn du die<br />
Fragen und den Text aufmerksam gelesen hast. Wenn sich die Fragen beantworten lassen, markiere<br />
die entsprechenden Textstellen mit Farbe!<br />
1. Wie viel Sauerstoff verbraucht das Verbrennen von Plastiktaschen?<br />
2. Ist es sinnvoll einen Fernseher zu recyceln?<br />
<strong>3.</strong> Wie viel Papier verbraucht jeder von uns?<br />
4. Um wie viel Energie verbraucht man mehr bei der Produktion einer Aluminiumdose im<br />
Vergleich zu einer Mehrwegflasche?<br />
5. Wie viel Wasser verbraucht jede/r Österreicher/in für die Papierherstellung?<br />
6. Welches Giftgas entsteht beim Verbrennen von Plastikmüll?<br />
Müll<br />
Man kann ihn verbrennen, in der Erde vergraben oder im Meer versenken. In jedem Fall belastet er die<br />
Umwelt – und das viel länger, als die Sachen dem Menschen genützt haben. Sondermüll sind alle Stoffe,<br />
die für Menschen, Tiere und Pflanzen, für Wasser, Luft und Boden gefährlich werden können.<br />
Schau einmal nach, wie viel Plastik an einem Tag in euren Abfall wandert. Auf Deponien nehmen<br />
Plastikstoffe viel Platz ein, beim Verbrennen können Dioxine, das sind extrem giftige Gase, entstehen. Vier<br />
Plastiksackerln verbrauchen beim Verbrennen so viel Sauerstoff, wie ein Mensch an einem Tag zum Atmen<br />
braucht. Flüssiger Sondermüll wird leider noch immer zu oft in Flüsse geleitet oder von Schiffen auf hoher<br />
See ins Wasser gekippt. Meerespflanzen und -tiere leiden sehr darunter. Schwermetalle wirken schon in<br />
geringen Mengen verheerend: Algen, die Nahrung vieler Wassertiere, sterben, Fische nehmen das Gift auf<br />
und geben es in der Nahrungskette an den Menschen weiter.<br />
Sammeln und Wiederverwerten ist sinnvoll, aber nicht alles lässt sich „recyceln“. Oft bestehen Gegenstände<br />
aus verschiedenen Materialien, man müsste sie zerlegen und sortieren. Das Sortieren der Teile eines<br />
Fernsehers beispielsweise würde mehr kosten, als das Gerät neu kostet. Zur Herstellung einer einzigen<br />
Aluminiumdose braucht man so viel Energie wie zur Herstellung von 22 Mehrwegflaschen. Wenn aus<br />
Altglas neue Flaschen gemacht werden, dann braucht man 43 % weniger Energie als bei Flaschen ohne<br />
Altglas. Eine Mehrwegflasche wird durchschnittlich 24-mal benutzt, ehe sie eingeschmolzen wird. Aus<br />
Altpapier kann man wieder neues Papier machen. Man braucht 90 % weniger Wasser dafür, nur 50 % der<br />
Energie und keinen Baum.<br />
Jede Österreicherin und jeder Österreicher verbraucht im Jahr zirka 200 Kilogramm Papier. Zur Herstellung<br />
dieser Menge braucht man 73 000 Liter Wasser. Damit könnte man vier Jahre lang eine Waschmaschine<br />
betreiben. Daher ist es wichtig, dass Altpapier zu einer Sammelstelle gebracht wird.<br />
Kleider, Spielzeug und Sportschuhe sind ebenfalls nicht unproblematisch, da sie Erdölprodukte enthalten.<br />
Durch die ständig wechselnde Mode wächst unser Müllberg beträchtlich. Gute Stücke sollte man daher,<br />
wenn man sie nicht mehr tragen möchte, zur Altkleidersammlung bringen, damit sie wieder verwertet<br />
werden können. Sammeln und Wiederverwerten des Mülls ist gut, Vermeiden ist noch besser.<br />
Nicht alles in einem Text ist gleich wichtig. Unterstreiche das Wichtigste in diesem Text! Anschließend<br />
schreibe wichtige Informationen in einfachen Sätzen heraus!<br />
Beispiel: Sondermüll belastet die Umwelt, er kann verbrannt, vergraben, versenkt werden.
Ausgewählte Methoden des Deutschunterrichts <strong>Pramper</strong> Seite 23<br />
Das Lesespiel — wer hat den Text wirklich gelesen?<br />
Problem:<br />
Die Schüler stöhnen, weil schon wieder Fragen zum Leseverständnis gestellt werden.<br />
Ziel:<br />
Spielen Sie mit den Schülern ein Spiel, bei dem sie genau auf Details achten und einen Text<br />
aufmerksam analysieren müssen und bei dem trotzdem Spannung und Unterhaltung nicht zu kurz<br />
kommen.<br />
So geht‘s:<br />
Drei Schüler treten als Wettbewerbskandidaten an. Zwei von ihnen haben einen kurzen Text<br />
gelesen, der Dritte hat lediglich eine Zusammenfassung des Textes gehört. Es geht darum, dass<br />
die Schüler der Klasse herauszufinden, wer den Text nicht gelesen hat. Hier sind die Spielregeln:<br />
1. Drei Schüler verlassen den Klassenraum mit zwei Kopien eines kurzen Textes, den sie noch<br />
nicht kennen. Der Lehrer bestimmt (ohne dass die Klasse es mitbekommt!), die beiden Leser. Der<br />
Dritte darf den Text nicht sehen, sondern bekommt eine mündliche Zusammenfassung von den<br />
beiden Lesern. Er darf Fragen stellen, die von den Lesern ehrlich beantwortet werden müssen.<br />
2. Der Rest der Klasse liest den kurzen Text und bereitet Fragen vor, um den „Nicht-Leser“ zu<br />
entlarven. Die Schüler sollen neben inhaltlichen Fragen auch solche einbauen, bei denen der<br />
Befragte werten und schlussfolgern muss. Inhaltliche Fragen kann man mit Informationen<br />
beantworten, die direkt im Text stehen. Fragen, bei denen man schlussfolgern muss, kann man nur<br />
mit gründlicher Kenntnis von Textdetails beantworten. Zur Beantwortung bewertender Fragen<br />
muss man die Wirkung oder die Qualität des Textes beurteilen können. Geeignete Fragen zu<br />
formulieren, fällt vielen Schülern schwer — dies zu üben, hilft, die Aufmerksamkeit auf Textdetails<br />
zu lenken.<br />
Am Ende des Spiels stimmt die Klasse darüber ab, wer der „Nicht-Leser“ ist<br />
Um die Aktivität zu beenden, lassen Sie die drei Schüler berichten, was sie bei dem Spiel gelernt<br />
haben. Mit großer Wahrscheinlichkeit sagen die Schüler, dass sie in Zukunft besser auf Textdetails<br />
achten werden.<br />
Handelt es sich bei den Sätzen um eher Gedachtes oder eher Gefühltes? Gib an: D<br />
für Gedachtes, F für Gefühltes!<br />
Die Hose ist mir zu eng.<br />
Nächstes Jahr werde ich eine andere Schule besuchen.<br />
An einer Pilzvergiftung kann man auch sterben.<br />
Die Grippe ermattet meinen ganzen Körper.<br />
Für manche Jugendliche sind Horrorfilme eine Art Mutprobe.<br />
Schreiende Babys machen mich hilflos.<br />
Der Sessel ist sehr bequem.
Ausgewählte Methoden des Deutschunterrichts <strong>Pramper</strong> Seite 24<br />
6. <strong>Kompetenz</strong>: Sinnerfassung durch Kürzen von Texten -<br />
Textreduktion<br />
Beifügungen machen jeden Text anschaulicher. Wenn sie jedoch fehlen, ist der Inhalt des Textes<br />
noch immer vollständig.<br />
A Kürze den Text, indem du Beifügungen (Attribute) streichst, die nicht unbedingt notwendig sind!<br />
Kleine Mädchen entführten neues Brüderchen vom Spielplatz seines<br />
Kindergartens<br />
Weil sie sich ein eigenes Brüderchen wünschten, entführten zwei kleine Mädchen in<br />
Frankfurt einen süßen Fünfjährigen aus dem Kindergarten seines Wohnortes. Das<br />
unglückliche und reizende Opfer wurde nach einer großen Fahndung der Polizei<br />
wenige Stunden später auf einer alten Parkbank einer belebten Einkaufsstraße<br />
entdeckt und seinen sorgenvollen Eltern wohlbehalten übergeben. Wie ein<br />
informierter Polizeisprecher berichtete, hatten die beiden Mädchen den armen<br />
Jungen auf dem Spielplatz seines Kindergartens gesehen und ihn kurz entschlossen<br />
mitgenommen. Als eigentliches Motiv hatten sie später angegeben, sie wünschten<br />
sich einen kleinen Bruder.<br />
L #<br />
A Kürze den folgenden Text, indem alles streichst, das dir nicht unbedingt notwendig erscheint!<br />
Konzentriere dich auf die Versteigerung des Säbels. Fasse den verbleibenden Text in deinem Heft<br />
zusammen!<br />
Säbel Napoleons für fast 5 Millionen Euro versteigert<br />
Der letzte Säbel Napoleons in Privatbesitz wurde am Sonntag in Paris für 4,81 Millionen Euro versteigert.<br />
Das sei Weltrekord für eine Waffe und für ein Andenken an den ersten französischen Kaiser, teilte das<br />
Auktionshaus Osenat in Paris mit. Vor der Auktion war die Waffe aus blauem Stahl mit Elfenbeingriff auf 1,5<br />
Millionen Euro geschätzt worden. Napoleon Bonaparte zog als 1. Konsul mit dem Säbel am 14. Juni 1800 in<br />
die Schlacht von Marengo. Er hatte damals die schon verloren geglaubte Schlacht gegen die Österreicher<br />
im letzen Moment noch gewendet. Später schenkte Napoleon den Säbel seinem Bruder Jérôme. Neben der<br />
Waffe versteigerte Osenat auch einen Gehstock Napoleons aus seiner Verbannungszeit auf Sankt Helena<br />
und eine Haarlocke seiner Frau Joséphine.<br />
(Nach Krone Online Bericht vom12. 6. 2007)
Ausgewählte Methoden des Deutschunterrichts <strong>Pramper</strong> Seite 25<br />
LERNTYPEN-TEST nach Heinz Klippert<br />
A Im Folgenden findest du verschiedene „Lernwege“. Trage in die zugehörigen Kästchen rechts eine<br />
3 ein, wenn du auf dem jeweiligen Lernweg viel behältst; eine 2 wenn du einiges behältst, und eine<br />
1, wenn du wenig behältst! Berechne anschließend für die unten angegebenen Lerntypen „Hören“,<br />
„Sehen” und „Handeln“ die entsprechenden Zahlenwerte!<br />
LERNWEGE<br />
(a) Ich mache mir zu einem Sachtext eine Tabelle □<br />
(b) Der Lehrer hält einen Vortrag zum Unterrichtsthema □<br />
(c) Ich sammle in Biologie verschiedene Pflanzen, klebe sie in eine Mappe und<br />
schreibe kurze Erläuterungen dazu □<br />
(d) Unsere Lehrerin zeigt uns in Sozialkunde einen Zeichentrickfilm zur<br />
Bundestagswahl (ohne Kommentar) □<br />
(e) Eine Mitschülerin liest einen Text aus dem Schulbuch vor □<br />
(f) Ich schaue mir die Bilder und Zeichnungen im Schulbuch an □<br />
(g) Ich fertige mir zu einem Lernstoff eine Zeichnung an □<br />
(h) Ich höre mir eine Englisch-Übungskassette an □<br />
(i) Der Lehrer zeigt uns Dias zum tropischen Regenwald □<br />
(j) Der Lehrer erklärt mir, wie der Bundeskanzler gewählt wird □<br />
(k) Ich schreibe die zu lernenden Vokabeln auf einen Zettel □<br />
(1) Ich schaue mir im Museum eine Ausstellung an □<br />
(m) Ich lese mir einen Text im Schulbuch durch □<br />
(n) Eine Mitschülerin trägt das Ergebnis ihrer Arbeitsgruppe vor □<br />
(o) Ich führe im Chemieunterricht einen einfachen Versuch durch □<br />
(p) Ich höre im Radio eine Reportage zu einem aktuellen Thema □<br />
(r) Ich betrachte ein Bilderbuch zum Alltagsleben in Afrika □<br />
(s) Ich schreibe mir zu einem Text das Wichtigste heraus □<br />
Addiere die oben eingetragenen Ziffern!<br />
LERNTYP HÖREN: Ziffern (b) + (e) + (h) + (j) + (n) + (p) = _________<br />
LERNTYP SEHEN: Ziffern (d) + (f) + (i) + (1) + (m)+ (r) = __________<br />
LERNTYP HANDELN: Ziffern (a) + (c) + (g) + (k)+ (o) + (s) = _________
Ausgewählte Methoden des Deutschunterrichts <strong>Pramper</strong> Seite 26<br />
Literatur zum Seminar<br />
Antons, K.: Praxis der Gruppendynamik, Hogrefe, 1976.<br />
Claussen, Claus: Unterrichten mit Wochenplänen. Weinheim und Basel 1997<br />
Feigenwinter, M.: Gesprächserziehung – konkret, Benzinger, 1985<br />
Heinz Klippert: Eigenverantwortliches Arbeiten und Lernen, 2004<br />
Huschke, Peter: Grundlagen des Wochenplanunterrichts. Von der Entdeckung der Langsamkeit. Weinheim<br />
und Basel 1996<br />
Kochan, B.: Rollenspiel als Methode sprachlichen uns sozialen Lernens, Scriptor, 1974.<br />
Lehmann, J.: Simulationsspiele und Planspiele, Klinkhardt, 1977.<br />
Meyer, Hilpert: Unterrichtsmethoden, Cornelsen. Berlin. 2004<br />
Peschel, F.: „Offener Unterricht in der Evaluation Teil I“ Schneider Verlag Hohengehren: Baltmannsweiler<br />
2006 2. Auflage.<br />
Ploier, E.: Gesprächsleitung, Veritas, 1989.<br />
<strong>Pramper</strong>, W. u. a. Deutschstunde 1-4, Veritas, 2007.<br />
<strong>Pramper</strong>, W. u. a. Materialien zur Deutschstunde 1-4, Veritas, 2007.<br />
<strong>Pramper</strong>, W. u. a. Texte besser verstehen 1-2, Veritas, 2007.<br />
Vaupel, Dieter: Das Wochenplanbuch für die Sekundarstufe. Weinheim und Basel 1995<br />
Seminaranforderung<br />
Für Note und Testur zum Seminar und Offenem Lernen<br />
Bearbeiten Sie sieben Aufgaben aus dem Skriptum! Siehe A …<br />
Auch diese Aufgabe ist möglich:<br />
Arbeiten Sie mit einem/er Partner/in zu einem selbst gewählten Thema und selbst gewählten<br />
Lernbereich des Deutschunterrichts ein größeres Unterrichtsvorhaben oder Materialien für einen<br />
Stationenbetrieb aus. Die ersten Seiten des Skriptums können eine Anregung dafür sein.<br />
• Der Lehrgang soll Informationen für Schüler (Merkstoff, Regeln) beinhalten.<br />
• Einfache und differenzierte Übungen (4 Seiten).<br />
• und eine abschließende Lernkontrolle, zirka 1 Seite.<br />
Es soll sich dabei um eine persönliche Vertiefung und Spezialisierung in einem kleinen Bereich des<br />
Deutschunterrichts handeln. Im Mittelpunkt soll die Erweiterung der Methodenkompetenz der Schüler<br />
stehen.