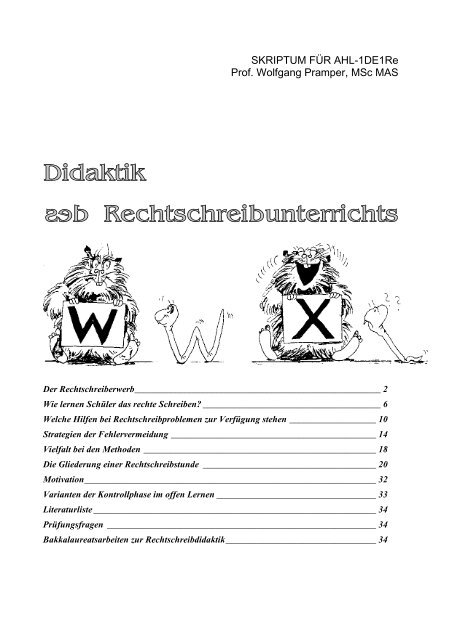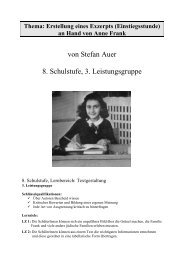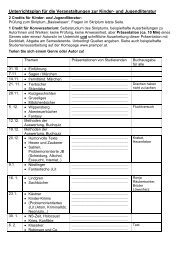SKRIPTUM FÃR AHL-1DE1Re Prof. Wolfgang Pramper, MSc MAS
SKRIPTUM FÃR AHL-1DE1Re Prof. Wolfgang Pramper, MSc MAS
SKRIPTUM FÃR AHL-1DE1Re Prof. Wolfgang Pramper, MSc MAS
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>SKRIPTUM</strong> FÜR <strong>AHL</strong>-<strong>1DE1Re</strong><br />
<strong>Prof</strong>. <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong>, <strong>MSc</strong> <strong>MAS</strong><br />
Der Rechtschreiberwerb______________________________________________________ 2<br />
Wie lernen Schüler das rechte Schreiben? _______________________________________ 6<br />
Welche Hilfen bei Rechtschreibproblemen zur Verfügung stehen ___________________ 10<br />
Strategien der Fehlervermeidung _____________________________________________ 14<br />
Vielfalt bei den Methoden ___________________________________________________ 18<br />
Die Gliederung einer Rechtschreibstunde ______________________________________ 20<br />
Motivation________________________________________________________________ 32<br />
Varianten der Kontrollphase im offen Lernen ___________________________________ 33<br />
Literaturliste ______________________________________________________________ 34<br />
Prüfungsfragen ___________________________________________________________ 34<br />
Bakkalaureatsarbeiten zur Rechtschreibdidaktik_________________________________ 34
Rechtschreibdidaktik <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong> 2<br />
D e r R e c h t s c h r e i b e r w e r b<br />
Wer nähmlich schreibt..., ist dämlich!<br />
Ist er/sie es wirklich? Diese gut gemeinte Eselsbrücke soll Kindern aus ihrer Rechtschreibnot<br />
heraushelfen. Indes lässt die Redewendung tief blicken. Noch immer gilt die Rechtschreibung<br />
als Indiz für die Intelligenz eines Menschen. Tatsächlich kennen wir alle Schüler, die<br />
rechtschreibschwach sind, in anderen Gegenständen aber sehr gut. Und umgekehrt, sehr<br />
rechtschreibsichere Kinder, die wir auf anderen Gebieten als nicht intelligent schätzen. Zwar ist<br />
– zumindest unter Lehrern – längst bekannt, dass eine Rechtschreibschwäche nur wenig über<br />
das übrige Leistungsprofil eines Schülers aussagt, aber der Status von schlechten<br />
Rechtschreibern ist auch in der Schule nach wie vor sehr gering.<br />
Das Kreuz mit der Orthographie<br />
Absolute Fehlerfreiheit in allen Bereichen kann kein Ziel der Pflichtschule sein. Und wer verfügt<br />
schon darüber? Ich habe schon bemerkt, wie exzellente Spezialisten der Orthographie Fehler<br />
übersehen haben. Aber selbst wer über die perfekte Rechtschreibsicherheit verfügt, könnte er<br />
(sie) auch behaupten, alle Formen von erlaubten Andersschreibungen des Wörterbuches zu<br />
beherrschen?<br />
Rechtschreibreform: Frust durch Zick-Zack-Wechsel:<br />
Alte Rechtschreibung Rechtschreibung Rechtschreibung neu neu<br />
neu 1996:<br />
2006:<br />
Du (in Briefen) du Du oder du<br />
Es wird dir leid tun. Leid tun leidtun<br />
recht haben Recht haben recht haben oder Recht haben<br />
Rad fahren Rad fahren Rad fahren<br />
Eislaufen Eis laufen Eislaufen<br />
Erlaubte Mehrfachschreibungen – aber nicht immer<br />
zugrunde liegend / zu Grunde liegend / zugrundeliegend<br />
schwarzmalen / schwarz malen<br />
die schwarze / Schwarze Kunst<br />
ABER NUR schwarzarbeiten<br />
ABR NUR die schwarze Magie<br />
„Lustige“ Duden-Varianten, gelb markiert ist jeweils die Vorzugsvariante<br />
unter Du: per du oder per DU sein<br />
unter per: per du oder per DU sein<br />
wohl riechend wohlriechend ABER übel riechend, übelriechend
Rechtschreibdidaktik <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong> 3<br />
Ist eh schon alles ?<br />
ÖWB vor 2006 Wurst, ab 2006 wurscht (egal)<br />
Duden: Wurscht (Powidl, P/Blunzen)<br />
Duden ab 2006: wurst oder wurscht (gleichgültig)<br />
Zur Verwirrung tragen auch noch Unterschiede zwischen österreichischen und deutschen<br />
Wörterbüchern bei, sowie ganz besonders unzählige erlaubte Varianten von Schreibungen.<br />
Testen Sie sich selbst!<br />
Gehören Sie zu den beneidenswerten Menschen, die über eine perfekte Rechtschreibung<br />
verfügen? Oder kämpfen auch Sie immer wieder hartnäckig mit „Rechtschreibfallen“, vielleicht<br />
sogar immer wieder mit denselben? Könnte es aber auch sein, dass Sie zwar Fehler machen,<br />
Ihr starkes Selbstbewusstsein diese Möglichkeit jedoch gar nicht in Betracht zieht?<br />
Finden Sie in jedem Abschnitt die Fehler und korrigieren Sie ohne Wörterbuch!<br />
Grundwortschatz:<br />
Maschine, Verteidiger, todschießen, Vanillepudding, überhaupt, Tankwart, telefonieren,<br />
spüren, spühlen, Schnitzel, wahrscheinlich, sämtliche, nämlich, grüßen, Rächer,<br />
Patient, praktisch, interessieren, er erschrack, Maßband, Liptauer, Larve, Kriminalität,<br />
Komissar, Kredit, Kräuterlimonade, Kaffee, jämmerlich, Hobby, Verwandte, gewöhnlich,<br />
Fotoapparat, passiert, er bewies, mühselig, reißend, schwül, Abendteuer.<br />
Fremdwörter:<br />
Vitalität, Volleyball, Terrasse, korregieren, Kassette, Karussell, Vehikel, Toilette,<br />
Tablette, Souvenir, Ouvertüre, Slogan, Operation, injizieren, Reperatur, Injektion,<br />
Kommentar, Reserve, resozialisieren, Turbiene, Restaurant, Quittung, primitiv, positiv,<br />
Medaillen, Lyrik, Journalist, Geographie, Chauffeur, Gendarmerie, Margerine,<br />
Restaurant, Lottarie, Kompass, Scheck, Gitarre, Akkusativ, Bibliothek, deprimiert<br />
Zweifelsfälle:<br />
der einzelne, er ist schuld, eines Abends, hier parken müssen, ein viertel Liter Milch,<br />
einen Achter aufschreiben, die vereinten Nationen, nichts Wesentliches, ein Hunderter,<br />
ein ständiges hin und her, nicht riskant überholen, schnelles Fahren, sein Hobby ist<br />
Lesen, ein scheußliches blau, der Stille Ozean, etwas Vorlesen lassen, er schwankte<br />
dauernd auf und ab, Schweigen ist Gold, die anderen, es war am teuersten.<br />
Fortsetzung nächste Seite
Rechtschreibdidaktik <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong> 4<br />
Horrorwörter:<br />
Standarte, Stratosphäre, Chrysantheme, Hyazinthe, Recherche, Kathedrale,<br />
Symphatie, Rhythmus, Orthographie, Synthese, liquidieren, Okkultismus, Rhombus,<br />
Rhethorik, Forsythie, Plisee, Koexistenz, Rhabarber, Annonce, Korrespondenz,<br />
prähistorisch, Champignon, Kanibale, Kapriole, Kyrie, Limousine, Lumberjack, Moräne,<br />
nachgewiesenermaßen, das In-Kraft-Treten, Aperitif, das nie Erwartete trat ein, der<br />
Österreichische Raiffeisenverband, die künstliche Intelligenz, Protegee.<br />
Die „schonungslose“ Erkenntnis über die eigene Rechtschreibfertigkeit, die man selbst oft nur<br />
verklärt wahrnimmt, sollte zu einem realistischen Blick auf die Ziele für den<br />
Rechtschreibunterricht der Schüler führen. Welche Rechtschreibfertigkeit kann man von<br />
Rechtschreibanfängern erwarten? Über welche Rechtschreibfertigkeit sollen sie am Ende der<br />
Pflichtschulzeit verfügen?<br />
In Frage kommen für den Rechtschreibunterricht an der Hauptschule nur bescheidene<br />
Lernziele, wenn sie im Schulalltag einigermaßen erreichbar sein sollen:<br />
Der Schüler soll seinen aktiven Wortschatz im Großen und Ganzen fehlerfrei beherrschen. Das<br />
ist der Grundwortschatz mit den geläufigsten Fremdwörtern, insgesamt zirka 5.000 Wörter.<br />
Weiters soll er die wichtigsten Regeln und Signale kennen, z. B. für die Großschreibung von<br />
Verben und Adjektiven.<br />
Er soll sensibel sein für Rechtschreibfallen und Strategien entwickeln, wie ihnen durch<br />
Umschreibungen oder Nachschlagen aus dem Weg gegangen werden kann.<br />
Er soll zu einer klaren, flüssigen und individuellen Handschrift gelangen.<br />
Wie steht es um die Rechtschreibung der heutigen Generation? Sehr schlecht, wenn man der<br />
allgemeinen Meinung traut.<br />
Der Mythos vom „Tja, früher konnte man noch besser ....“<br />
Bevor Sie den folgenden Abschnitt lesen geben Sie an, ob es sich um eine richtige oder falsche<br />
Aussage handelt!<br />
a) Die Rechtschreibleistung der Schüler wird immer schlechter.<br />
b) Die Rechtschreibleistung wird durch die Schichtzugehörigkeit beeinflusst.<br />
c) Zwischen Rechtschreibleistung und Geschlechtszugehörigkeit besteht ein<br />
Zusammenhang.<br />
d) Zwischen Rechtschreibleistung und „Lern-Atmosphäre“ besteht kein<br />
Zusammenhang.<br />
e) Zwischen Rechtschreibleistung und Methode besteht ein Zusammenhang.<br />
f) Bei Stille lernt man besser.<br />
richtig / falsch
Rechtschreibdidaktik <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong> 5<br />
Auswertung:<br />
ad a: Entgegen der landläufigen Meinung gibt es keine einzige Untersuchung, aus der hervorgeht,<br />
dass die Rechtschreibleistung der Schülergeneration von heute schlechter abschneidet als die<br />
vorangegangener Generationen. (Menzel W. Rechtschreibunterricht. Aus Fehlern lernen. Friedrich<br />
Seelze, 1985)<br />
Zur subjektiven Meinung von der allgemeinen Verschlechterung dürfte es gekommen sein, da<br />
heute die etwa vierfache Zahl an Schülern zur Matura bzw. Abitur kommt als noch vor 30<br />
Jahren. Gemessen an der Gesamtschülerzahl ist die Rechtschreibleistung aber besser als früher.<br />
(Brügelmann Hans, Rechtschreibleistungen in: Am Rande der Schrift: Libelle, Lengwil, 1995) Dazu<br />
kommt die getrübte Wahrnehmung der (eigenen) Vergangenheit, die alles in einem sentimental<br />
verklärten Licht erscheinen lässt. Vergleicht man Maturathemen der letzten 50 Jahre, dann ist<br />
festzustellen, dass die Aufgabenstellungen immer anspruchsvoller wurden.<br />
ad b: Zwischen Rechtschreibleistung und Schichtzugehörigkeit ist ein Zusammenhang<br />
nachzuweisen. Vereinfachend kann gesagt werden: Je höher die Schicht, desto besser die<br />
Rechtschreibung. Wer von klein auf mit den Normen der Gesellschaft besser vertraut gemacht<br />
wird, nimmt leichter die Regeln der Rechtschreibung auf. (Rigol Rosemarie: Schichtzugehörigkeit<br />
und Rechtschreibung, in Spitta u.a. Rechtschreibunterricht, Bd. 5, Westermann, Braunschweig<br />
1977 und Fischer H-.-D.: Handbuch Deutschunterricht Bd. 1. Schwann, Düsseldorf, 1983)<br />
Auch die Verwendung der Standardsprache bzw. einer ihr angenäherten Umgangssprache in der<br />
Familie führt zu einem leichteren Einstieg in Rechtschreibung, da sie sich an der<br />
Standardsprache orientiert.<br />
ad c: Es kann gesagt werden, dass zwischen Rechtschreibleistung und<br />
Geschlechtszugehörigkeit ein Zusammenhang besteht. Mädchen machen rund ein Viertel<br />
weniger Fehler als gleich alte Buben. Sie sind den Buben im Durchschnitt um mindestens ein<br />
Schuljahr voraus. (Plickart H. Lernerfolg und Trainingsformen im Rechtschreibunterricht.<br />
Klinkhardt, Bad Heilbrunn, 1979)<br />
ad d: Interessant, aber nicht gerade überraschend ist die Tatsache, dass die folgenden Faktoren<br />
beim Rechtschreiberwerb auch eine Rolle wichtige spielen:<br />
• die konsequente und regelmäßige Kontrolle der schriftlichen Arbeiten durch den Lehrer, ohne<br />
jedoch Angst zu erzeugen, führt zu einer vergleichsweise besseren Rechtschreibleistung<br />
• Ebenso ein Vertrauensverhältnis und Sympathie zwischen Lehrendem und Lernendem!<br />
Gerade die Rechtschreibung wird aber oft als Disziplinierungsmittel vom Schüler empfunden und<br />
ist mit Angstgefühlen verbunden.<br />
ad e: Zwischen Rechtschreibleistung und Methode besteht ein Zusammenhang.<br />
In den 50iger und 60iger Jahren war der Rechtschreibunterricht von einer Regel-Lern-Methode<br />
geprägt, die die logische Funktion des Rechtschreiberwerbs überbetonte. Dem steht heute eine<br />
kindgemäßere Lernmethode gegenüber, die trachtet, möglichst viele Eingangskanäle<br />
anzusprechen und die kreatives Übungsmaterial beinhaltet.<br />
Extrem schlecht wirken sich langweilige und langatmige Unterrichtsmaterialien auf die<br />
Rechtschreibleistung aus. Sie werden nur noch übertroffen von einem nicht motivierten<br />
Lehrer, der selten die Übungen persönlich kontrolliert und keine überprüfbaren Ziele setzt.<br />
Kopierer sind das Gift des Rechtschreiberwerbs! Beispiel: DDR – BRD. Nach dem Fall der<br />
Mauer stellte sich heraus, dass die DDR Schüler über eine bessere Rechtschreibung verfügen als<br />
die Schüler der BRD. „Lag es an der Methode?“, fragten sich die Didaktiker. Das Ergebnis war<br />
verblüffend einfach: In der DDR gab es kaum Kopierer in den Schulen. Die Schüler mussten vor<br />
allem in den Realiengegenständen wesentlich mehr von der Tafel
Rechtschreibdidaktik <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong> 6<br />
abschreiben als in der BRD. (Augst in einem Referat 1994 bei den Wiener Gesprächen zur<br />
Rechtschreibreform)<br />
Das Medium Computer ist mit entsprechender Lernsoftware hervorragend geeignet, die<br />
Rechtschreibfertigkeit zu verbessern. Im Vergleich zum Unterricht mit traditionellen Medien<br />
lernen Schüler mit dem Computer schneller und besser. Die Vorteile des PC´s sind:<br />
Motivation, begleitende Kontrolle, gesichertes Ausbessern, Wiederholen der Fehler, Ehrgeiz, es<br />
beim nächsten Mal besser zu machen. (<strong>Pramper</strong> W. Neue Tendenzen und Technologien im<br />
Deutschunterricht der Zehn- bis Vierzehnjährigen in Österreich, Univ.-Veröffentlichung zum<br />
Referat in Kaposvar 1992, Lehrerheft zu Deutschstunde 2, Veritas 1995)<br />
ad f: Bei Stille lernt man besser! Dass eine ablenkungsfreie Lernatmosphäre das Lernen<br />
unterstützt, kann man beim folgenden Versuch erproben. Lernt man beispielsweise Wörter<br />
auswendig und hört dabei laute, sehr rhythmische Musik, dann ist die Merkleistung bei den<br />
meisten Menschen um ein Drittel schlechter als ohne Musik. Die Ergebnisse werden noch deutlich,<br />
wenn man längere Zeit an einer Aufgabe arbeitet und einen Pop-Sender nebenbei laufen hat, der<br />
neben Musik auch noch Nachrichten, Wetter, Sport und Verkehrsfunk bringt.<br />
W i e l e r n e n S c h ü l e r d a s r e c h t e S c h r e i b e n ?<br />
Im Wesentlichen sind beim Rechtschreiberwerb zwei Prozesse zu unterscheiden:<br />
• der Prozess der Aufnahme der Wortbilder ins Gedächtnis und<br />
• der Prozess der Wiedergabe und Kontrolle.<br />
Damit wird deutlich, dass beim Rechtschreiberwerb weniger soziale oder kreative Intelligenz ein<br />
Rolle spielen, sondern vor allem die Gedächtnisleistung. Schüler, die sehr leicht auswendig lernen,<br />
sind hier bevorzugt, sie sind in der Regel gute Rechtschreiber.<br />
Machen Sie einen weiteren Test zur Selbsterfahrung zum Thema Lernen!<br />
Test: Wie gut ist Ihr Gedächtnis?<br />
Wenn Sie jetzt nicht auf das Zifferblatt Ihrer Uhr sehen, wissen Sie auswendig, wie die Ziffern Ihrer Uhr<br />
aussehen?<br />
Wieso fällt vielen Menschen diese Aufgabe schwer, obwohl sie täglich viele Male auf die Uhr<br />
blicken?<br />
Das hat zwei Gründe:<br />
• Wenn wir auf die Uhr blicken, gilt das Interesse der Zeit und nicht dem Aussehen des<br />
Zifferblattes und<br />
• zum zweiten blickt man nur sehr kurz auf das Zifferblatt.<br />
Aus diesen beiden Gründen wird ein „Abspeichern“ einer nebensächlichen Beobachtung im<br />
Langzeitgedächtnis verhindert.<br />
Soll eine Beobachtung dauerhaft und gut auffindbar im Gedächtnis deponiert werden, sind<br />
Interesse und Zeit notwendig. Wer etwas lernen will, muss sich dafür ausreichend Zeit nehmen<br />
und sich der Sache ganz widmen.
Rechtschreibdidaktik <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong> 7<br />
Wie geht die Aufnahme ins Gedächtnis vor sich?<br />
Mit der Geburt ist unser „Gehirnapparat“ so gut wie fertig. Während andere Körperteile noch<br />
wachsen, verändert sich die Größe des Gehirns bis zum Tod kaum mehr. Unser Gedächtnis<br />
besteht aus zirka 15 Milliarden Nervenzellen, und jede kann sich etwas merken. Um die<br />
Möglichkeit des Gedächtnisses zu veranschaulichen, sei dieses ein Beispiel angeführt:<br />
Angenommen, jeder Buchstabe dieses Buches würde einer Nervenzelle entsprechen, dann<br />
müsste man Bücher in der dreifachen Höhe des Stephansdomes übereinander legen, um zu<br />
zeigen, was sich das Gedächtnis merken kann. Es ist also „Speicherplatz“ in Hülle und Fülle<br />
vorhanden. Ganz im Gegenteil: Wir würden sehr darunter leiden, wenn wir uns wirklich alles „gut<br />
merken“ würden. Das meiste dieser Informationen ist zwar im Gedächtnis, aber auf einer Art<br />
„Gedächtnismüllhalde“, in der wir<br />
nur sehr schwer das Gesuchte<br />
finden. Wir sprechen dann vom<br />
Vergessen, obwohl es eher ein<br />
„Nicht-finden-Können“ ist. Jeder<br />
kennt das Gefühl, wenn einem<br />
etwas bekannt vorkommt, aber<br />
man weiß nicht mehr woher.<br />
Manchmal will einem auch ein<br />
bekannter Begriff nicht und nicht<br />
einfallen, er liegt sprichwörtlich „auf<br />
der Zunge“. In diesem Fall ist es<br />
am besten, die bewusste<br />
Suchtätigkeit einzustellen und die weitere Suche dem Unterbewusstsein zu überlassen. Es ist<br />
erstaunlich, wie geradezu „nebenbei“ der gesuchte Begriff plötzlich auftaucht.<br />
Vor dem Langzeitgedächtnis befindet sich eine Art Filter. Informationen, die dem Gedächtnis<br />
wichtig genug erscheinen, werden hier ausgesondert, der<br />
Rest kommt auf die Gedächtnismüllhalde.<br />
Zeit: Ich beschäftige mich mindestens 20 Sekunden mit<br />
der Information,<br />
Motivation: Ich finde die Information interessant bzw.<br />
wichtig und will sie beherrschen,<br />
Konzentration: Ich habe für die Zeit des Lernens nur<br />
Augenmerk für diese eine Sache.<br />
Wörter „lernen“<br />
lernen willst<br />
Sehen – Merken – Kontrollieren – Schreiben – Kontrollieren – Einprägen<br />
dir Zeit nimmst<br />
Du lernst, wenn du<br />
ungestört bist<br />
hast!<br />
Schau dir das Wort genau an!<br />
Schließ die Augen und stell es dir vor!<br />
Schreibe das Wort auf!<br />
Überprüfe, ob du es richtig geschrieben<br />
nach!<br />
Überprüfe deine Vorstellung!<br />
Ziehe die gefährliche Stelle mit Farbe
Rechtschreibdidaktik <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong> 8<br />
Nur nicht hudeln!<br />
Aber auch nicht brodeln! In jeder Schulstufe ist es wichtig, für Lernprozesse ausreichend Zeit<br />
vorzusehen. Der Lehrer soll nicht aufs „Tempo drücken“, er soll vielmehr auffordern, besonders in<br />
der Rechtschreibung konzentriert und genau zu arbeiten. Vor allem aber in der Grundschule, darf<br />
nicht gehudelt werden. Die Qualität der Arbeit geht vor der Quantität! Das Einüben der<br />
elementaren Lernmethode ist eine wichtige Voraussetzung für den späteren selbstständigen<br />
Wissenserwerb. Der Zeitbedarf ist von Schüler zu Schüler sehr verschieden. Er kann bei einer<br />
Übung bis zum Sechsfachen innerhalb einer Klasse variieren. In der Regel braucht aber selbst bei<br />
„homogenen“ Gruppe der langsamste Schüler doppelt so lange wie der schnellste. Welcher Lehrer<br />
kennt das nicht: Die schnellsten Schüler sind fertig und langweilen sich, die langsamsten sehen<br />
sich ständig unter Zeitdruck und machen schon deshalb auch noch zusätzlich Fehler. Aus diesem<br />
Grund sieht sich der Lehrer oft als Dompteur, der die einen antreibt und die anderen im Auge<br />
behält, damit sie nicht zu stören beginnen. Alleine deshalb wird deutlich, wie wichtig das offene<br />
Lernen ist, bei dem nicht alle Schüler wie im traditionellen Unterricht das Gleiche zur selben Zeit<br />
im selben Tempo machen müssen.<br />
Viele kleine Portionen sind besser als eine große!<br />
Lernende, die sich viel Zeit für eine große Portion Lernstoff nehmen, sind schlecht beraten. Mit<br />
dieser Methode stellt man das Gedächtnis vor große Probleme - man bringt alles leicht<br />
durcheinander und vergisst den Stoff wieder schnell. Verteilt man dieselbe Stoffmenge auf<br />
mehrere Termine, merkt man sich mehr und merkt es sich länger.<br />
Ähnliche Fälle nie gleichzeitig behandeln!<br />
Kommen Information, die sich sehr ähnlich sind (wider - wieder, das - dass, Tod - tot, viel - fiel,<br />
Laib - Leib) zur selben Zeit im Gedächtnis an, werden sie fortan leicht verwechselt. Man spricht<br />
von der Ranschburgschen Hemmung. Besser ist es, wenn in der Problembegegnungsphase und<br />
der Übungsphase eine Zeit zwischen den ähnlichen Informationen liegt, mindestens 20 Minuten. In<br />
der Kontrollphase können ähnliche Fälle gegenübergestellt werden. Bei Kleinkindern kann man<br />
das Phänomen gut beim Thema „rechte und linke Hand“ beobachten. Wird zunächst nur eine<br />
Hand bezeichnet, tritt in der Folge keine Verwechslung auf, wenn später einmal die zweite<br />
dazugelernt wird. Benennt man beide gleichzeitig, legt man bei vielen Kindern den Grundstock für<br />
eine langjährige Unsicherheit bei der Zuordnung.<br />
Im Rechtschreibunterricht herrscht immer noch die Tendenz vor, gleich und ähnlich klingende Wörter mit verschiedener Schreibweise<br />
gegenüberzustellen. Beliebte Themen des Rechtschreibunterrichts heißen deshalb: "das oder dass?" "s oder ss?" Die unterrichtliche<br />
Behandlung geschieht obendrein sehr häufig als vorbereitende Übung für ein Diktat. Daraus resultieren bei den Schülern und<br />
Schülerinnen sehr häufig Verwechslungsfehler. Bereits im Jahre 1900 konnten die Psychologen Müller und Pilzecker experimentell<br />
nachweisen, dass das Behalten eines Lernstoffes A durch die unmittelbare Folge von Lernstoff B beeinflusst wird. Diese<br />
Interferenzerscheinung wurde danach von dem Psychologen Ranschburg weiter ausdifferenziert: Je größer die Ähnlichkeit zwischen<br />
zwei Lernaufgaben ist, desto stärker wirkt sich auch die Interferenz aus (sogenannter Rauschburg-Effekt) Dieses Phänomen wird als<br />
Ähnlichkeitshemmung bezeichnet. Kurz: Ähnliches wird verwechselt, wenn gleichzeitig gelernt wird, unabhängig von Lerninhalt und<br />
Struktur.<br />
Konsequenzen für den Unterricht am Beispiel „das - dass"<br />
Vier Lerneinheiten an vier verschiedenen Tagen, je zirka 20 Minuten<br />
1. Lerneinheit: Begegnung und Übung mit das (Artikel und Pronomen) an Sätzen wie diesen: „das<br />
Mädchen, das... • ich glaube, das wird die Sache erleichtern“<br />
2. Lerneinheit: Begegnung und Übung mit dass (Konjunktion) an Sätzen wie diesen: „ich hoffe,<br />
dass ich..“<br />
3. Lerneinheit: Üben von das und dass, aber in getrennten Aufgabenstellungen - eine Übung nur<br />
für das, eine nur für dass.<br />
4. Lerneinheit: Lernkontrolle - das und dass sind in einer Aufgabenstellung vermischt<br />
einzusetzen.<br />
Auf „Rechtschreibfallen“ hinweisen!
Rechtschreibdidaktik <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong> 9<br />
Für den Rechtschreiberwerb gilt: In Rechtschreibfallen, die nie thematisiert wurden, fällt man<br />
leicht, denn die Einsicht in Problemstellen kommt nicht von selbst. Die meisten<br />
„Rechtschreibfallen“ nimmt der Schüler beim Lesen selbst wahr und lernt, ihnen auszuweichen.<br />
Gerade schwächere Schüler erkennen jedoch oft gar nicht die Problemstellen schwieriger Wörter.<br />
Das beginnt schon damit, dass ihnen beim Lesen viele Ratefehler unterlaufen und es dabei zu<br />
Hinzufügungen und Weglassungen kommt.<br />
Testen Sie sich selbst! Wie genau schauen Sie wirklich hin?<br />
Schreiben Sie den Namen jener japanischen Automarke, die mit M beginnt so auf, wie sie ihn<br />
schon tausendmal am Heck dieser Autos gelesen haben! Es kommt auf das genaue<br />
Nachschreiben an!<br />
_______________________________<br />
Vermutlich ist Ihnen bisher die Rechtschreibeigentümlichkeit entgangen weil Ihre Aufmerksamkeit<br />
nicht auf die Rechtschreibung gerichtet war, sondern nur die Sinnentnahme im Vordergrund stand.<br />
Jetzt, wo Ihnen die Besonderheit der Schreibung anschaulich bewusst wurde, ist sie für immer in<br />
Ihrem Gedächtnis. Ja, es wird sogar so sein, dass Sie immer, wenn Sie in Zukunft das Heck eines<br />
Mazdas sehen, sofort die Schreibweise überprüfen werden. Die Behaltenskraft würde noch weiter<br />
zunehmen, wenn wir die Schreibung begründen könnten: mazDa (Heißt es übersetzt etwa<br />
„schönes Auto?") oder wurde diese Schreibweise gewählt, um die geschlossene, kompakte Form<br />
des Autos auch in der Schrift wiederzugeben? Wurde aus diesem Grund die Oberlänge des „d“<br />
vermieden.<br />
Werden wir auf eine Falle hingewiesen, ist die Chance groß, dass wir ihr in Zukunft ausweichen.<br />
• nämlich wird ohne h geschrieben, weil es von namentlich (Name) kommt.<br />
• Kommissar - Es gibt nur wenige Wörter, die die Besonderheit von zwei Doppelkonsonanten<br />
haben: Zu den weiteren häufigen Fehlerwörtern gehören diese: Kassette, Terrasse.<br />
• Abenteuer (nichts Abendteuer) – man kann auch am Morgen ein Abenteuer erleben<br />
• Signalwörter (Begleiter) wie zu und zum beeinflussen den folgenden Anfangsbuchstaben: zu<br />
lernen, zu halten: zum Lernen, zum Halten<br />
• fiel - beim Wort fiel denke daran, dass etwas herunterfällt, die Falllinie ist im f sichtbar.<br />
• Unterscheide: schwer (Gewicht, unangenehm) - schwierig (kompliziert)<br />
Konsequenzen für den Unterricht:<br />
Fehler sollten möglichst oft zum Thema des Unterrichts gemacht werden, z. B. bei der Nacharbeit<br />
von Schularbeiten. Erklärungen des Lehrers, warum Wörter so geschrieben werden und Tipps,<br />
wie sie leichter gemerkt werden können, helfen dem Schüler beim Einprägen. Dabei kann der<br />
Lehrer sehr frei formulierte Rechtschreibhilfen angeben und Tipps auch aus seiner eigenen<br />
(Schüler)Erfahrung wiedergeben.<br />
Lehrer: Diese Fehler sind mir bei der Korrektur der Schularbeit, des Diktates besonders<br />
aufgefallen: Die linke Spalte der OH-Folie wird präsentiert. Ich zeige dir worauf du besonders<br />
achten musst. Beispiele für Tipps<br />
Anschließend wird die linke Spalte abgedeckt und die rechte gezeigt. Die Schüler sollen in<br />
Einzelarbeit die Wortstrukturen ergänzen, es handelt sich um dieselben Wörter, aber in anderer<br />
Reihenfolge.
Rechtschreibdidaktik <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong> 10<br />
ziemlich<br />
nämlich<br />
verdrießen<br />
nä...ch<br />
verd....en<br />
zi....ch<br />
Die Theorie – „Fehlerwörter dürfen nie präsentiert werden, da sie eine verheerende einprägende<br />
Wirkung haben“ – wird nicht nur durch den vorangegangenen Test über die japanische Automarke<br />
widerlegt. Nach diesem Dogma müssten Lehrer die schlechtesten Rechtschreiber sein, da sie<br />
ständig mit falsch geschriebenen Wörtern zu tun haben.<br />
Fehler sollte man zwar nicht „feiern“, indem sie an der Tafel farbig herausgehoben werden, aber<br />
fehlerhafte Texte können zur Fehlersuche ohne weiters Schülern vorgelegt werden. Diese<br />
Aufgabenstellung erreicht man auch bei Partnerdiktaten oder dem gegenseitigen Verbessern von<br />
Aufsätzen: das ist sinnvoll und zudem ein soziales Lernziel.<br />
ÜBUNG: Im folgenden Text befinden sich sieben Wortbildfehler. Kannst du sie finden?<br />
Die Sinne der Katze<br />
| Sieben Sinne hat die Katze: Sehen, Hören, Riehen, Schmecken, Tasten, dazu kommen der Gleich<br />
| gewichts- und der Temperatursinn. Viele ihrer Sinne sind wesehntlich besser als beim Menschen<br />
| entwickelt. Außergewönlich ist das Auge der Katze. Dort wo der Mensch vor Dunkelheit nichts mehr<br />
| sieht, kann sich eine Katze sehr gut zurechtfinden. Sie kann sechsmal schwechere Lichtquelen als<br />
der Mensch wahrnehmen. Allerdings geht das auf Kosten der Sehschärfe. Katzen sehen nur die Mitte<br />
| ihres Blickfeldes scharf, die Randflächen sind sehr verschwomen. Mäuse machen sich das zunutze:<br />
| Bei Gefahr verharen sie wie gelähmt, um nicht entdeckt zu werden. Auch sieht die Katze die Farben<br />
anders als wir Menschen. Sie kann die Farbe Rot nicht von Blau und Grün unterscheiden.<br />
W e l c h e H i l f e n b e i R e c h t s c h r e i b p r o b l e m e n z u r<br />
V e r f ü g u n g s t e h e n<br />
Vier Funktionen des Gehirns tragen zum Rechtschreiberwerb bei:<br />
• Merken durch Sehen,<br />
• Merken durch Hören,<br />
• Merken durch Schreiben,<br />
• Merken durch Erinnern des Regelwissens.<br />
Diese Funktionen sind von Schüler zu Schüler verschieden stark wirksam, außerdem haben sie<br />
einen unterschiedlichen Nutzen bei der Lösung von Rechtschreibproblemen. Eine Frage der<br />
Großschreibung eines Verbs wird über eine andere Entscheidungsschiene geklärt als die Frage<br />
nach einem Dehnungs-h.<br />
Die optische Funktion, das Ableiten von Wortbildern<br />
Wörter werden als Wortbilder wahrgenommen und im Gedächtnis als sogenannte<br />
Wortbildschemata gespeichert. Fehler, die auf die Kategorie Wortbild zurückzuführen sind,<br />
beruhen auf einer Schwäche der Gestaltwahrnehmung und Speicherungsfähigkeit. Der Anteil der<br />
optischen Funktion ist im Vergleich zu den folgenden am bedeutendsten für den<br />
Rechtschreiberwerb. Das Vorschreiben von Varianten kann vor allem dann erfolgreich<br />
herangezogen werden, wenn es um ein Ober- oder Unterlängenproblem geht.<br />
Bei solchen Problemstellen ist das „Gefühl“ oft erfolgreich: überhaupt, Lepra, Wohnung, Ebbe,<br />
Larve, Wanze, optimal, nehmen, Dame.
Rechtschreibdidaktik <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong> 11<br />
Bei den folgenden Problemfällen hilft das Vorschreiben von Varianten nicht: Hund/t, Kasse/a, im<br />
b/Besonderen, das/ss, wen/nn<br />
Die akustische Funktion, das Ableiten von Hörbildern<br />
Da das Klangbild der deutschen Sprache in vielen Fällen über keine vollständige Lauttreue verfügt,<br />
ist dies eine problematische Funktion.<br />
Im Allgemeinen jedoch kann die akustische Funktion gut mithelfen, Wörter richtig zu schreiben.<br />
Manchmal kann das deutliche Vorsprechen sogar eine entscheidende Hilfe sein.<br />
Etwa bei diesen Wörtern: Arzt - jetzt • spannt - verwandt.<br />
Die akustische Hilfe wird vor allem bei der Verlängerungsprobe deutlich: Land (gesprochen als t) -<br />
aber in der Verlängerung Länder • gib (gesprochen p) - aber geben<br />
und bei der Dehnung und Schärfung: raten : Ratten • rasen, hassen (Punkt unter a)<br />
Stellvertretend für die mangelnde Lauttreue seien die folgenden Beispiele genannt:<br />
Gleicher Buchstabe, obwohl anderer Laut: Vase [Wase] : vor • Weg : weg [wek] • sprechen<br />
aber [schprechen], stechen aber [schtechen] • loben : lobt [lopt] • brausen : aus [auß]<br />
Gleicher Laut, obwohl anderer Buchstabe. Bei einer langen Liste von Problemfällen kann das<br />
leise Vorsprechen eine völlige Irreführung hervorrufen. Einige Beispiele: der Biss : bis • Kuss •<br />
isst : ist • aus : außen • das : dass • lies : ließ • spülen : wühlen • mehr : Meer • nehmen :<br />
nämlich • Vetter : fett • Vater : Fahne • Eltern : älter • ab : knapp<br />
Die motorische Funktion, das Ableiten von Schreibbewegungen<br />
Der Ablauf der Schreibbewegung wird zwar gespeichert, aber das „Gefühl“ ist als<br />
Entscheidungsratgeber ist bei Schreibbewegungen nur wenig hilfreich. Andererseits wissen wir<br />
vom Schreiben auf Tastaturen, dass wir auf Tippfehler schon „gefühlsmäßig“ aufmerksam werden,<br />
ehe wir das getippte Wort gesehen haben. Dass die Handschrift selbst einen hohen Anteil beim<br />
Erwerb der Rechtschreibung darstellt, wird später noch ausführlich dargestellt.<br />
Die logische Funktion, das Ableiten von ähnlichen Rechtschreibfällen oder Regeln<br />
Der Rechtschreibung liegt ein System zugrunde: die sogenannten Prinzipien der Orthographie.<br />
Manche dieser Prinzipien sind für Schüler einsichtig (z. B. das etymologische (Stamm-) Prinzip,<br />
Häute weil es von Haut kommt), andere nur schwer zu durchschauen (z. B. das historische Prinzip<br />
Schuh weil früher [Schuoch] und andere wirken für Laien oft unlogisch (z. B. das ästhetische<br />
Prinzip sprechen statt schprechen, Dame ohne Dehnungs-h, aber Sohn mit Dehnungs-h).<br />
Der Schreiber kann von einem ihm vertrauten Wort auf ein verwandtes oder ähnliches schließen,<br />
das geht auf seine Fähigkeit zur Assoziation zurück. Regeln werden von Schülern im<br />
vorpubertären Alter nur wenig genutzt. Vielmehr haben gefühlsmäßige Entscheidungen bei<br />
Kindern im Pflichtschulalter eindeutig Vorrang vor rationalen Lösungswegen. Rechtschreibregeln,<br />
die von Sprachwissenschaftlern zur Beschreibung gemeinsamer Phänomene entwickelt wurden,<br />
helfen den Schülern in freien Schreibsituationen nicht. Besonders verwirrend wirken auf sie<br />
Begriffe wie stimmlos und stimmhaft, bezeichnet und unbezeichnet, gehaucht, gesummt, gedehnt,<br />
geschärft, denominalisiert oder attributive Adverbien.<br />
Rechtschreibregeln bedeuten für 10-14-jährige Schüler oft keine wesentliche Hilfe beim<br />
Erwerb der Rechtschreibsicherheit.
Rechtschreibdidaktik <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong> 12<br />
Am Beispiel der folgenden allgemein bekannten Rechtschreibregel wird dies deutlich: Vor l, m, n, r<br />
werden lang gesprochene Vokale durch ein Dehnungs-h gekennzeichnet.<br />
Beispiele:<br />
Rahmen, fahren, wühlen, nehmen<br />
Was aber ist mit diesen Wörtern?<br />
Dame, sparen, spülen, nämlich<br />
Untersucht man Wörter des Grundwortschatzes, die über einen gedehnt gesprochenen Vokal<br />
verfügen, macht man folgende Entdeckung:<br />
a lang gesprochen: 8 Wörter werden mit aa gekennzeichnet, 45 mit ah, nicht gekennzeichnet sind<br />
266 Wörter;<br />
o lang gesprochen: 5 mit oo, oh 41, nicht gekennzeichnet sind 160<br />
e lang gesprochen: 12 mit ee, eh 33, nicht gekennzeichnet sind 306<br />
Die „Regel“ beschreibt also die Ausnahme. Nur im Verhältnis 20:80 werden Wörter mit langem<br />
Vokal mit einem Dehnungs-h Kennzeichnung geschrieben. Die Regel müsste richtig heißen:<br />
Nur vor den Buchstaben l, m, n, r kann ein gedehnt gesprochener Vokal durch ein<br />
Dehnungs-h gekennzeichnet werden.<br />
Was aber habe ich von einer solchen Regel? Abgesehen davon: Wer wendet schon eine solche<br />
Regel im Stress eines Diktates oder einer Schularbeit an?<br />
Alleine die Terminologie bei Regeln ist für den durchschnittlichen Schüler verwirrend: So ist etwa<br />
bei der s-Schreibung von folgenden Begriffen die Rede: scharfer, gehauchter, gesummter,<br />
gezischter, stimmhafter, stimmloser s-Laut, bezeichnet, unbezeichnet nach langem, kurzem,<br />
betontem, unbetontem Vokal.<br />
Ziel der Reform war es, die vielen Ausnahmen zu beseitigen.<br />
Aber nach wie vor gibt es Ausnahmen von Regeln (und Ausnahmen von den Ausnahmen):<br />
Regelbeispiel: die Übrigen (Artikelprobe)<br />
Ausnahme: die anderen, etwas anderes Regel: Die vier Zahladjektive eine, andere, viel (mehr,<br />
meisten), wenig werden auch dann klein geschrieben, wenn sie als Nomen verwendet werden.<br />
Ausnahme von der Ausnahme: etwas ganz Anderes, ein ganz Anderer<br />
Daher kommt es zu solch kuriosen Gegenüberstellungen:<br />
der Einzelne ABER der eine<br />
die Letzten ABER die vielen<br />
das Ganze ABER das meiste<br />
es ist das Beste, wenn ABER es wäre am besten, wenn<br />
Den Kometen haben Unzählige gesehen. (unbest. Zahladjektiv)<br />
Den Kometen haben die beiden gesehen. (Indefinitpronomen)<br />
Oder es wird dem Schreiber frei gestellt, wie er schreibt<br />
Es kamen viele d/Dutzende Zuschauer ABER Es kamen drei Dutzend Zuschauer.<br />
aufs h/Herzlichste begrüßen ABER aufs Äußerste gefasst sein, ...<br />
heute Abend ABER heute früh (Duden, da Adverb)<br />
Deshalb sollte im Unterricht von Rechtschreibregeln, die schwer verständliche Begriffe zur<br />
Grundlage haben oder mit Ausnahmen gespickt sind, nicht allzu viel an Hilfe erwartet werden.<br />
Denn Rechtschreibsicherheit wird von Schülern nicht von Regeln abgeleitet, sondern von
Rechtschreibdidaktik <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong> 13<br />
Deshalb sollte im Unterricht von Rechtschreibregeln, die solche Begriffe zur Grundlage haben,<br />
nicht allzu viel an Hilfe erwartet werden. Denn Rechtschreibsicherheit wird von Schülern nicht von<br />
Regeln abgeleitet, sondern von<br />
• grammatikalischen und lexikalischen Mustern, die eingeprägt wurden und<br />
• Strategien der Fehlervermeidung, die eingeübt wurden.<br />
Auch Erwachsene sprechen im Zusammenhang mit Rechtschreibproblemen oft davon: „Das hat<br />
man im Gefühl.“ „Das spürt man.“ „Ich bin mir sicher, dass es so gehört, aber ich weiß nicht<br />
wieso.“ „Ich kann mir nicht vorstellen, dass es anders geschrieben werden soll.“<br />
Grammatikalische Muster<br />
Stark vereinfachende grammatikalische Muster wie die folgenden benützen Schüler. Ausnahmen<br />
werden selten berücksichtigt.<br />
• Signalwörter (Begleiter) wie zu und zum beeinflussen den folgenden Anfangsbuchstaben: zu<br />
lernen, zu halten : zum Lernen, zum Halten<br />
• Signalwörter (Begleiter) wie als, weil, um, ob, dass, denn, wenn, nachdem,.. haben einen<br />
Beistrich im Satz.<br />
• Das Wort, auf das sich ein Artikel bezieht, wird groß geschrieben:<br />
der Baum, eine schöne Braut, die Schöne kam, eine weitere wichtige Aufgabe<br />
• Die Buchstaben „m“ und „s“ sind ein Signal für die nachfolgende Großschreibung einer<br />
Nennform:<br />
beim Gehen, zum Leben, im Wesentlichen, vom Arbeiten, am Lernen hindern, ...<br />
das Gehen, schnelles Gehen, fürs Spielen, ans Aufgeben denken,...<br />
• Nach dem Signalwort etwas (und ähnlichen Wörtern) folgt eine Großschreibung:<br />
etwas Gutes, etwas sehr Schreckliches (Fehlerquelle: etwas gut können, etwas kaufen)<br />
• Person (oder Fürwort) + Verb bedeutet Großschreibung:<br />
Herrn Hubers Schreiben, sein Singen, unser Lernen, Mutters Arbeiten<br />
• (Modal-) Verb + Verb bedeutet Kleinschreibung:<br />
kann gehen, soll kommen, muss arbeiten, will lernen,...<br />
• Redewendungen werden groß geschrieben:<br />
im Allgemeinen, im Dunkeln tappen, Folgendes, ohne weiteres, ...<br />
• Wortverlängerungen mit „s“ sind ein Signal für Kleinschreibung:<br />
Flug - flugs, Sonntag - sonntags, Fall - falls, Abend - abends, Montag - montags<br />
Grammatikalischen Muster werden durch solche Reihenbildungen im<br />
Rechtschreibunterricht gefördert:<br />
Ich behaupte, dass ... schnelles Fahren die Kranken<br />
Ich hoffe, dass ... lautes Schreien die Armen<br />
fernsehen 4 beim Fernsehen - bei dem Fernsehen<br />
klettern 4 vom ___________ - ____________<br />
ausleihen 4 durchs _______ - ____________<br />
häufig waschen - durch häufiges Waschen - das häufige Waschen<br />
schnell wachsen - ____________________________ - ___________________________<br />
hastig trinken - ____________________________ - ___________________________<br />
rasch wiederholen - ____________________________ - ___________________________
Rechtschreibdidaktik <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong> 14<br />
Lexikalische Muster<br />
Wer die Silbe „fahr“ richtig schreiben kann, schreibt auch Fahrer, Gefahr, gefährlich,<br />
Verfahren, Gefährte, fuhr und alle anderen Ableitungen richtig.<br />
Die „Bausteine“ der Wörter<br />
Die kleine Zahl von zirka 200 Morphemen (Stammsilben) stellt den wichtigsten<br />
Baustoff für die Wörter des deutschen Grundwortschatzes dar. Andere Baumaterialien<br />
sind Präfixe (Vorsilben) und Suffixe (Nachsilben).<br />
Morpheme: leb, dank, schreib, geh, nehm, seh, bring, halt,...<br />
Präfixe: ver-, ent-, ge-, un-, voll-, be-, auf-, zer-, ...<br />
Suffixe: -ung, -heit, -ig, -lich, -er, -sam., -en, -end,..<br />
Übungen zum Thema „lexikalische Muster“ sollen am besten als Partner- oder<br />
Kleingruppenarbeit durchgeführt werden. Dadurch wird die Erweiterung des<br />
Wortschatzes gefördert.<br />
1. Möglichst viele Bausteine sammeln!<br />
Vorsilben: ent-, vor-, ..<br />
Nachsilben: -ung, -end,...<br />
Stammsilben: nehm, geh,..<br />
2. Zu vorgegebenen Silben möglichst viele<br />
Wörter durch Abwandeln und Anfügen von<br />
Vor- und Nachsilben sammeln!<br />
Beispiel:<br />
-- fahr (fähr)--<br />
Fahr-er........<br />
fah-bar........<br />
Auf-fahrt.............<br />
Ge-fahr..............<br />
ver-fahr-en.........<br />
ge-fähr-lich........<br />
Fahr-bahn ....<br />
Auto-fahr-er...........<br />
Auf-fahr-un-fall....<br />
Morphem + Suffix<br />
Morphem + Suffix<br />
Präfix + Morphem<br />
Präfix + Morphem + Suffix<br />
Zusammensetzungen von<br />
zwei Morphemen<br />
zwei Morpheme + zwei Präfixe<br />
S t r a t e g i e n d e r F e h l e r v e r m e i d u n g<br />
Oft wenden Lehrer selbst andere Lösungsstrategien an, als sie den Unterrichtenden vermitteln.<br />
Das ist zum einen auf den hohen Stellenwert, den Regeln in der Schule genießen, zurückzuführen,<br />
zum anderen auf die selbst auferlegte Wirkungsabsicht: ein Deutschlehrer kennt keine<br />
Rechtschreibprobleme. Dabei wäre es für Schüler durchaus hilfreich zu erfahren, wie erfahrene<br />
Schreiber mit Rechtschreibproblemen umgehen oder wie sie als Schüler damit umgingen.<br />
So vermeidet man Fehler:<br />
Gefährlichen Wörtern ausweichen!<br />
Der erfahrene Schreiben kennt seine Schwachstellen und versucht ihnen mehr oder weniger<br />
geschickt aus dem Weg zu gehen. Er ersetzt das kritische Wort durch ein anderes (ähnlich der
Rechtschreibdidaktik <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong> 15<br />
Thesaurus-Funktion in der Textverarbeitung) statt Appetit schreibt er Hunger, statt kaputt -<br />
zerstört, statt Kapelle - kleine Kirche. Oder er verdeutlicht eine Fügung und baut damit die<br />
Unsicherheit ab. Anstelle von: „Mein Hobby ist Lesen“ schreibt er “mein Hobby ist das Lesen“.<br />
Gezielt Informationen über kritische Wörter einholen!<br />
Dazu gehört das Nachschlagen im Wörterbuch, das gezielte Befragen einer kompetenten Person<br />
oder die Zuhilfenahme der Rechtschreibprüfung einer EDV-Textverarbeitung .<br />
Schüler sollten innerhalb von 30 Sekunden jedes Wort im Wörterbuch finden können. Beim<br />
Einholen von Information über ein Rechtschreibproblem sollte der Schüler nicht so fragen: „Wie<br />
schreibt man das Wort?“, sondern so: „Schreibt man Vaseline mit V oder F?“ „Schreibt man<br />
Interesse mit Doppel-r oder Doppel-s?“ Diese Fragehaltung fördert das rasche und gezielte<br />
Nachschlagen.<br />
Test: Wie schnell sind Sie beim Nachschlagen im Wörterbuch?<br />
1. Können Sie bei den folgenden 10<br />
Wörtern unter 5 Minuten bleiben?<br />
Vehikel<br />
Uhu<br />
Verfall<br />
Zweck<br />
Wurm<br />
Teil<br />
Spray<br />
Fuß<br />
Paddel<br />
Mammut<br />
Seite<br />
Spalte<br />
Bei Rechtschreibproblemen mehrere Entscheidungshilfen heranziehen!<br />
* Varianten eines Wortes vorschreiben und miteinander vergleichen:<br />
Hauptsache / Hauptsache Haubtsache<br />
* die Verlängerungsprobe anwenden:<br />
er wir?d/t - wird, weil die Verlängerung wer[d]en) heißt,<br />
* die Verkürzungsprobe anwenden:<br />
B?äu/eume - Bäume, weil die Verkürzung Baum heißt,<br />
* Wörter mit ähnlichen Problemstellen suchen:<br />
g?ei?ßen: gießen, weil auch fließen, schießen<br />
eili?g: eilig, weil auch traurig, lebendig<br />
za?hm: zahm, weil auch lahm, Rahm<br />
* verwandte Wörter suchen:<br />
er rei?s/ßt - reist, weil es von reisen kommt;<br />
* langsam vorsprechen:<br />
Arzt - jetzt, gespannt - verwandt, Ofen - offen (Punkt unter o), alle - Allee,
Rechtschreibdidaktik <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong> 16<br />
ÜBUNG: Ableitungen bilden. Ergänze Wörter mit gleichen Silben!<br />
-ig: hartnäckig, tollpatschig, ____________________________________________<br />
-lich: ähnlich, verlässlich, ______________________________________________<br />
-keit: _________________________________________________________________<br />
-eist: ______________________________________________________________<br />
-ießt: ______________________________________________________________<br />
ÜBUNG: Bilde Reimwörter!<br />
Fe _____________ G ___________ Schü _____________ Bi _____________<br />
K _____________ K _____________ Schl _____________ w _____________<br />
N _____________ Kl _____________ R _____________ m _____________<br />
S _____________ M _____________ K _____________<br />
Individuelle Fehlerschwerpunkte analysieren<br />
Immer wieder überrascht das Ergebnis einer Fehleranalyse. Selbst bei Schülern, die auf den<br />
ersten Blick an einer großen „allgemeinen" Rechtschreibschwäche leiden, löst sich in den meisten<br />
Fällen dieser „Beurteilung“ als falsche Hypothese auf. Vielmehr zeigt sich bei einer genaueren<br />
Untersuchung, dass sich eindeutige Fehlerschwerpunkte herauskristallisieren, während andere<br />
Rechtschreibbereiche größtenteils fehlerfrei sind.<br />
Leicht erkannt werden Fehlerhäufungen von<br />
• Fehlern bei der Großschreibung von Substantivierungen (beim lernen, viel gutes - mit 30% aller<br />
Fehler die Hauptfehlerquelle),<br />
• das - dass (die häufigste Fehlerquelle eines einzelnen Wortes, alleine 8,5% gehen auf diesen<br />
beiden Wörter zurück. Hans-Heinrich Plickat in Lernerfolg und Trainingsformen im<br />
Rechtschreibunterricht, Klinkhardt, 1978) 1)<br />
• fälschliche Kleinschreibungen (haus, besprechung, nur 2,4% aller Fehler gehen auf diese<br />
Quelle zurück)<br />
• fälschliche Großschreibungen (zu Trinken, die Beiden, etwas Nehmen, er kauft: Grüne Socken,<br />
blaue..)<br />
• Lautierungsfehler:<br />
a) Schärfungsfehler (Weter, vergist / die Reiße, bekammen)<br />
b) Dehnungsfehler (nemen, fülen / währe, nähmlich)<br />
c) Aussprache (Apperat, wahrscheindlich)<br />
• Wortbildfehler, anhand der falschen oder fehlenden Ober- oder Unterlänge müsste der Fehler<br />
erkannt werden (kabutt, forsicht, die Reiße, nähmlich)<br />
• andere Fehler wie Buchstabenverdrehungen (zielmich), Auslassungen (nich), nicht erkannte<br />
Ableitungen (Beume)<br />
Schade, dass die Rechtschreibreform die große Fehlerquelle „dass“ nicht beseitigt hat. Das<br />
Argument, dass mit dem „das“ alleine, Wörter verschiedener Wortarten zusammengeworfen<br />
würden, ist vernachlässigbar. Es entstünden keine Verständnisprobleme, wenn die
Rechtschreibdidaktik <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong> 17<br />
Rechtschreibung über kein „dass“ verfügt – ebenso wenig wie sie bei ähnlichen Fällen der Fall<br />
sind. Etwa beim folgenden Beispiel:<br />
Individuelle Fehlerwörter sammeln und üben!<br />
Als günstig erweist sich dabei das Anlegen einer Fehlerliste (eventuell in einem Registerheft mit<br />
alphabetischer Ordnung) oder noch besser einer Fehlerkartei. Diese Fehlersammlung sollte mehrere Jahre<br />
geführt werden. Die Schüler üben die Fehlerwörter von Zeit zu Zeit und verwenden das Wortmaterial für<br />
Partneransagen.<br />
Tipp: Die aktuellen Fehler sollten Schüler am besten auf kleinen Zetteln beim Schreibzeug, der Pinwand<br />
oder dem Schreibtisch aufbewahren. Ein origineller Platz dafür wäre auch der Umschlag der Deutschhefte!<br />
Orthographische Sprichwörter („Eselsbrücken“) kennen!<br />
Beispiele für Eselsbrücken:
Rechtschreibdidaktik <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong> 18<br />
Zu den eigenen Fehlerwörtern Merkhilfen (Eselsbrücken) erfinden!<br />
Wer von einem bestimmten Fehler immer wieder gequält wird, der wird ihn auch durch Übungen<br />
wie „Schreib das Wort dreimal richtig auf!“ nicht mehr los. Es scheint wie verhext zu sein: Die<br />
entsprechende Stelle im Wörterbuch ist schon ganz abgegriffen. Man wendet viel Zeit und<br />
Engagement auf und scheitert doch immer wieder daran. Das kritische Wort ist vermutlich auf<br />
mehrere Schreibweisen bereits fest im Gedächtnis verankert, und es gelingt nicht, die falsche<br />
Schreibweise zu löschen. In solchen Fällen ist es sinnvoll, eine individuelle Eselsbrücke zu<br />
erfinden. Das Nachdenken darüber, wie ein solcher Spruch aussehen könnte, damit er leicht<br />
gemerkt wird, ist der eigentliche Lernprozess: Damit wird das Wort auf einem neuen Weg im<br />
Gedächtnis verankert.<br />
Beispiel einer individuellen Eselsbrücke:<br />
„Appetit war lange mein persönliches Horrorwort, die Schärfung hörte ich fälschlicherweise im t. Jahre lang<br />
quälte mich dieses Wort, dessen Schreibung ich mir nicht merken konnte. Denkvorgänge, wie „Es ist genau<br />
umgekehrt, als du glaubst!“, führten zu keiner befriedigenden Problemlösung. Das Wort Applaus bereitete<br />
mir keine Probleme. Ich verband es mit dem Problemwort zu einer Eselsbrücke. Wenn ich an das Wort<br />
Appetit denke, fällt sie mir automatisch ein: Ich habe mir einen Applaus verdient, wenn ich Appetit richtig<br />
schreiben kann. Appetit wie Applaus schreiben!“<br />
Test: Können Sie zu einem Ihrer Problemwörter eine Eselsbrücke erfinden?<br />
Oder - wenn Sie keines haben - zu einem dieser Fehlerwörter von Schülern: wahrscheinlich, fiel,<br />
er las, überhaupt, Maschine, Injektion<br />
V i e l f a l t b e i d e n M e t h o d e n<br />
Zwar ist für die meisten Menschen die optische Funktion für das Rechtschreiblernen am<br />
bedeutsamsten, aber selbst bei ausgeprägt optischen Lerntypen spielen auch andere Funktionen<br />
eine nicht unwesentliche Rolle. Deshalb ist die Methodenvielfalt im Unterricht eine wichtige<br />
Grundlage für einen erfolgreichen Rechtschreibunterricht. Je variantenreicher und motivierender<br />
die Übungen sind, umso besser sprechen sie die vier Funktionen des Rechtschreiberwerbs an. Die<br />
Übungen sollen zudem eher kurz gehalten sein und abwechslungsreich gestaltet sein.<br />
Beispiele abwechslungsreicher, kreativer Übungsaufgaben<br />
Immer Ärger mit dem s-Laut<br />
Wohin gehören die Wörter?<br />
das • Bus • Vase • Spaß •<br />
Fraß • Speise • Ausweis •<br />
Zeugnisse • begießen • grausam<br />
• Schubs • lassen •<br />
Wiese • Esel • Fuß<br />
Der s-Laut kann so<br />
geschrieben werden;<br />
1. als s wie in Gras, lesen<br />
2. als ss wie in Wasser; Pass<br />
3. als ß wie in Fuß, grüßt
Rechtschreibdidaktik <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong> 19<br />
15 Wörter kannst du entdecken, wenn du den Rösselsprung aus dem Schachspiel anwendest. (Es ist eine<br />
Hilfe, wenn du die Teile der gefundenen Wörter durchstreichst!)<br />
Schen Ba par Pfle kt verlän<br />
tan ge trin nk ken Gramma<br />
tränk kel ken kt gern verren<br />
Ge ngs Bli kra tik krän<br />
nker Ge schenk allerdi ken nk<br />
Hier stimmt einiges nicht. Die Wörter wurden falsch zusammengesetzt! Kannst du sie richtigstellen?<br />
Ochsenbaum der Ochenschwanz Weichselschwanz4 ____________________<br />
Arztbau 4 _______________________________<br />
Volksfahrer 4 _________________________<br />
Tintenpraxis 4 ____________________________ Dachswaren 4 ________________________<br />
Luchsklecks 4 ____________________________ Textilaugen 4 _________________________<br />
Taxitheater 4 _____________________________<br />
Wie heißen diese Wörter?<br />
Gegensätzliche Auffassungen in der modernen Rechtschreibdidaktik<br />
Das zu lernende Wort im Text üben, da<br />
viele Fehler vom Kontextabhängig<br />
sind , z.B. Groß- und Kleinschreibung<br />
Diktate sind wichtig, sie dienen<br />
der Übung und der Kontrolle<br />
Rechtschreibspezifische Texte<br />
sind sinnvoll, weil sie die<br />
Rechtschreibprobleme konzentriert<br />
vorführen.<br />
Das Wörterbuch soll immer verwendet<br />
werden.<br />
Lückentexte sollen verwendet werden<br />
(Worte oder Buchstaben einsetzen)<br />
Das zu lernende Wort ist in Wortlisten<br />
zu üben, 2/3 der Fehler sind<br />
vom Kontext unabhängig<br />
Diktate fördern die Rechtschreibsicherheit<br />
nicht<br />
Die Künstlichkeit dieser<br />
Pseudotexte ist abzulehnen<br />
Das Wörterbuch darf bei Schularbeiten<br />
und Tests nicht<br />
verwendet werden<br />
Keine Lückentexte verwenden, da Wortbilder<br />
nicht eingeprägt werden.
Rechtschreibdidaktik <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong> 20<br />
Auch seltene Wörter üben.<br />
Alle Schüler üben dasselbe.<br />
Gleichartige Rechtschreibfälle<br />
nicht gegenüberstellen<br />
(Ranschburgsche Hemmung:<br />
Laib:Leib).<br />
Auf den Grundwortschatz konzentrieren.<br />
Individuelle Rechtschreibübungen.<br />
An der Gegenüberstellung lernen<br />
(vom Sinn auf die Rechtschreibung<br />
schließen: Lid:Lied).<br />
D i e G l i e d e r u n g e i n e r R e c h t s c h r e i b s t u n d e<br />
Methodische Gliederung eines Rechtschreibthemas (Groß- Kleinschreibung ca. 5-7 Std.)<br />
Einstieg, PB<br />
Regelwissen<br />
Übungen<br />
Differenz. Üben<br />
Lernkontrolle<br />
Bereitschaft zum Wissenserwerb wecken,<br />
das Thema und Ziele bekannt geben<br />
Einsichten in Problemlösungen<br />
Rechtschreibregeln an Beispielen erklären,<br />
ev. Merkstoff notieren, Farbe verwenden<br />
erste Übungen gemeinsam durchführen<br />
verschiedenartige, zum Denken anregende, kurze Übungen,<br />
Selbst- Partner- oder Lehrerkontrolle<br />
Übungen im Rahmen des offenen, selbstständigen Lernens<br />
wiederholende leichte Ü. für schwache Schüler,<br />
weiter führende Ü. für gute Schüler.,<br />
Hausübungen, Übungen mit PC<br />
zwischendurch LK: variantenreiche kurze Aufgabenstellungen,<br />
Rückmeldung über richtige Lösungen,<br />
Diktat mit Note<br />
Unterrichtsbeispiel zum Thema Gliederung einer Rechtschreibstunde<br />
Fremdwörter richtig gebrauchen<br />
1 Ein Missgeschick mit Fremdwörtern<br />
Fred möchte auf Ilse einen guten Eindruck machen und versucht, sich<br />
besonders gewählt auszudrücken. Aber, oh Schreck! Hier läuft einiges schief.<br />
Erklärt die falsch verwendeten Fremdwörter! Nennt die treffenden Fremdwörter!<br />
Kleiner Fremdwörtertest: Streiche die falschen Worterklärungen durch!<br />
Karussell: Fleischstück / Ringelspiel / ausgestorbene Tierart<br />
Dilettant: Kunststoff / Nichtfachmann / entfernte Verwandte<br />
Ministrant: Messdiener / Ministeriumsbeamter / kleiner Strand
Rechtschreibdidaktik <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong> 21<br />
2 Fremdwörter „übersetzen"<br />
4:3 — Austria spielte groß auf!<br />
Der Coach nach dem Match:<br />
„Die unfairen Attacken des Gegners haben uns nicht<br />
verunsichert. Austria hat sehr diszipliniert und fair gespielt.<br />
Das Resultat ist für mich mehr als akzeptabel.<br />
_____________________________<br />
_____________________________<br />
_____________________________<br />
_____________________________<br />
Experten werden mir bestätigen, dass wir 90 Minuten dynamischen _____________________________<br />
Fußball gezeigt haben, der dem Cup zu einem positiven<br />
Image verhilft. Unser Goalie hat<br />
sich speziellen Applaus verdient.<br />
Dem Finale sehe ich optimistisch entgegen."<br />
_____________________________<br />
_____________________________<br />
_____________________________<br />
_______________________________<br />
# Unterstreiche in jeder Zeile die Fremdwörter!<br />
# Trage die entsprechende deutsche Worterklärung auf den Leerzeilen ein!<br />
annehmbar, anständig, Torhüter, selbstbeherrscht, Angriffe, Mannschaftsbetreuer, Endspiel,<br />
Fachleute, Ergebnis, besonderen, unkameradschaftlichen, Spiel, Gutes erwartend, Ansehen,<br />
Wettbewerb, schwungvollen, guten, Beifall<br />
3 Woher Fremdwörter kommen<br />
Zu allen Zeiten wurden Wörter aus anderen Sprachen in die deutsche Sprache aufgenommen. Besonders<br />
neue Erfindungen und Entdeckungen wurden aus anderen Sprachen in der Erstbezeichnung übernommen.<br />
Dadurch kann man auch heute noch erkennen, von welchen Ländern Entwicklungen ausgingen.<br />
# Ordne die unten angegebenen Fremdwörter den Ursprungssprachen zu! Schlage in Zweifelsfällen im<br />
ÖWB nach!<br />
Italienisch Französisch Englisch Lateinisch Griechisch<br />
Bankwesen Musik Militär Mode Sport Speisen Technik Schulwesen Wissenschart<br />
Pudding, Trainer, Artillerie, Tenor, Rabatt, Friseur, Geographie, Student, Toast, Foul, Jet, Violine,<br />
Leutnant, Kostüm, Mathematik, Sandwich, Start, Direktion, Taille, Karabiner, bankrott, Arie, Anatomie,<br />
Lektion, Playback, Konto, Stewardess
Rechtschreibdidaktik <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong> 22<br />
4 Fremdwörter richtig schreiben<br />
# Setze die Fremdwörter in den Raster ein!<br />
Beachte die Wortlänge!<br />
Attraktion (Glanznummer)<br />
Reklamation (Beschwerde)<br />
Emanzipation (Gleichstellung)<br />
Korrektur (Verbesserung)<br />
Lektion (Lernaufgabe)<br />
Allergie (Überempfindlichkeit)<br />
Akku (Stromspeicher)<br />
Cousin (männliches Geschwisterkind)<br />
Serum (Impfstoff)<br />
Spaghetti (Teiggericht)<br />
Allee (zwei Baumreihen)<br />
Spalier (Ehrenreihe)<br />
Firma (Geschäftsunternehmen)<br />
Terrarium (Behälter für Schlangen und Echsen)<br />
Saphir (Edelstein)<br />
Dioptrie (Lichtbrechungskraft optischer Linsen)<br />
Diwan (gepolstertes Liegemöbel)<br />
Sultan (mohammedanischer Herrscher)<br />
Entente (Staatenbündnis)<br />
5 Gesucht: Fremdwörterquizmeister<br />
Zwei Schüler bilden ein Quizteam. Mindestens ein Wörterbuch soll vor Beginn des Spieles auf eurem<br />
Platz liegen. Arbeitet möglichst leise zusammen! Ihr könnt das Spiel ohne und mit Zeitbegrenzung (20<br />
min) durchführen. Für jede richtige Lösung gibt es einen Punkt.<br />
A) Welche fünf Fremdwörter wurden falsch verwendet? Schreib sie heraus!<br />
Falsch verwendet:____________________________________________________________<br />
In einer halben Stunde kommt die nächste Patrouille. Die Couch wird in Südamerika durch das Anzapfen der<br />
Mahagonibäume gewonnen. Das Gartenhäuschen steht auf der dritten Parzelle. Im Karmin lodert das Feuer. Eine<br />
ölige Maut bedeckte den verschmutzten See. Das Epizentrum des Erdbebens lag in der Türkei. Der Tyrann herrscht<br />
mit eiserner Faust. Alle Konkurrenten blieben auf der Strecke. Der Kanon feuerte ununterbrochen. Der Instinkt im<br />
Stall war unerträglich. Der Tresor war aufgebrochen und leer.<br />
B) Schlagt die Wörter im Wörterbuch nach und erklärt das Fremdwort!<br />
<br />
Promenade =________________________ Gobelin = ________________________<br />
Antitoxin =________________________ Stipendium = ________________________<br />
Samum =________________________ Insulaner = ________________________<br />
Taxameter =________________________ Gelübde = ________________________<br />
Konfitüre =________________________ Maniküre = ________________________<br />
C) Sucht die drei Rechtschreibfehler in den folgenden Wörtern und schreibt sie heraus:<br />
Vanille, Gymnastik, Physik, Teenager, Bastei, Pädagoge, Austronaut, Visage, Skai, Stola, Statist, Skalpell,<br />
Silhouette. Püjama, Schatulle, Samariter, Sextant, Sentimentalität, Scharmützel, Ruin, Rotor, Pulover,<br />
Amphibium<br />
<br />
Richtig geschrieben:_______________________________________________
Rechtschreibdidaktik <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong> 23<br />
D) Sucht die versteckten 10 Fremdwörter im Zauberquadrat! Schreibt sie heraus'<br />
j e t x ss Achtung: Manche Wörter sind von rechts nach links, manche diagonal zu lesen!<br />
0 e i m e<br />
b f a i r<br />
a g e n t<br />
m u r e s<br />
Gesamtsumme:_____<br />
Zum Vergleich: 28 Punkte = Fremdwörterquizmeister!<br />
25—27 Punkte = Phantastisch! Ihr kennt euch sehr gut aus.<br />
22—24 Punkte = Prima! Ihr kennt euch gut aus.<br />
19—21 Punkte = Alle Achtung! Ihr kennt viele Fremdwörter.<br />
15—18 Punkte = Gut! Aus euch könnte ein Fremdwörterspezialist werden<br />
<br />
Didaktische Grundsätze des Rechtschreibunterrichts<br />
Viel schreiben<br />
Vor allem durch regelmäßiges Schreiben werden Schüler rechtschreibsicher. Daher sollen im<br />
Unterricht möglichst viele Gelegenheiten zum Schreiben angeboten werden: abschreiben, frei<br />
schreiben, zusammenfügen und aufschreiben, schreiben nach Ansagen, Texte überarbeiten<br />
und „reinschreiben“, auswendig lernen und aufschreiben.<br />
Dazu ein Beispiel, bei dem Wortmaterial gesichert wird:<br />
gs, x, chs, ks und cks!<br />
Wörter mit x, gs, ks, cks und chs werden gleich gesprochen. Um solche Wörter richtig zu schreiben,<br />
musst du überlegen, ob du ein stammverwandtes Wort kennst. Beispiel: anfangs - kommt von anfangen,<br />
er wächst – kommt von wachsen. Keinesfalls gilt: Schreib Wie du sprichst!<br />
Ordne die Wörter in deinem Heft nach ihrer Schreibung:<br />
Ochse • Arztpraxis • Knicks • knacksen • Klecks • Luchs • Axt • keineswegs • schnurstracks • längst •<br />
mittags • Gewächs • Taxi • rings • kraxeln • mixen • Hexe • wachsen • wächst • wechseln • Weichsel •<br />
allerdings • sechs • Nixe • zwecks «anfangs • fix und fertig • Baumwuchs • links • Eidechse • Volkstheater<br />
• mucksen • boxen • ein Sechstel • Koks • Dachs • Faxen machen • flugs • rücklings • Textilwaren •<br />
Deichsel<br />
Schreibe fünf Sätze, in denen jeweils zwei Wörter des Wortkastens vorkommen!<br />
Beispiel: Die Eidechse wird bis zum kommenden Frühjahr nur wenig wachsen.<br />
Schreibe die folgenden Wörter mit dem Artikel auf!<br />
Lexikon • Lachs • Mucks • Knacks • Wachs • Ochse • Klecks • Axt Hexe • Deichsel • Gewächs • Taxi<br />
Nixe • Baumwuchs • Eidechse • Volkstheater • Dachs<br />
Gesucht sind die zwölf Wörter der Übung 3. Ergänze die fehlenden Buchstaben!<br />
T... • ..t • ....e • ..xe • .i.. • ......e. • ....w...s•..ch •.i....... • ...ks........ • ....k. • ..w....
Rechtschreibdidaktik <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong> 24<br />
Aber nicht nur die Quantität ist beim Üben entscheidend, auch die Qualität. Gedankenloses<br />
Schreiben darf nicht gefördert werden, ebenso wenig schlampiges Schreiben. Mangelhaftes<br />
Ausfüllen in Arbeitsbüchern wirkt kontraproduktiv, ebenso das Schreiben mit einem<br />
Kugelschreiber. Auch der leichtfertige Auftrag an Schüler „Schreibt es auf einen Zettel!“ wirkt für<br />
sie als Signal, schlampig und damit fehlerhaft zu schreiben.<br />
Die deutlich gegliederte Schrift als Ziel<br />
Lehrer beobachten oft, dass Schrift und Schreibrichtigkeit in einer engen Verbindung stehen.<br />
Oft scheint es so zu sein: Je lesbarer die Schrift, desto besser die Rechtschreibung. Bei<br />
Schwierigkeiten schwindelt sich der unsichere Schreiber gerne durch Undeutlichkeit hinweg,<br />
damit strapaziert man das Gedächtnis zusätzlich.<br />
Wer schlampig, ungegliedert und unleserlich schreibt,<br />
lernt schwerer rechtschreiben.<br />
Ein deutliches Schreiben mit erkennbaren Ober- und Unterlängen der Schrift, das<br />
Beachten der Grundlinie und der Abgrenzung der Buchstaben voneinander, erleichtert<br />
das Erlernen der Rechtschreibung.<br />
Damit ist keineswegs ein „Schönschreiben“ gemeint; der Schüler soll durchaus im Laufe der<br />
Pflichtschulzeit seine individuelle Handschrift entwickeln. Anhand der folgenden Beispiele ist<br />
nicht zu übersehen, dass die Handschrift entweder eine Hilfe bei der Fehlersuche im eigenen<br />
Text darstellt oder im ungünstigen Fall das Fehlerfinden bedeutend erschwert.<br />
Beispiel einer schlechten Schrift: die Grundlinie wird verlassen, Wortenden sind verwaschen,<br />
Buchstaben können umgedeutet werden, l als t, a als o, r als n,..<br />
Die Größe dieser Schrift und die „Schnörkelhaftigkeit“ lässt nur eine langsame Handschrift zu.<br />
Die Schülerin wird bei Schularbeiten meist nicht fertig und kommt bei Ansagen nicht mit.<br />
Die Entwicklung einer Schrift von der 5. zur 8. Schulstufe<br />
Hier ist die Entwicklung einer idealen Handschrift zu sehen. Die Schülerin hat den Sprung von
Rechtschreibdidaktik <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong> 25<br />
einer sauberen, kindlich „malenden“ Handschrift (5. Schulstufe) zu einer flüssigen, gut lesbaren,<br />
individuellen Handschrift (8. Schulstufe) geschafft. Die Buchstaben sind nicht mehr mit<br />
Aufstrichen miteinander verbunden, jeder Buchstabe ist deutlich erkennbar, die Schrift ist<br />
mittelgroß und gleichmäßig und kommt ohne Schnörkel aus.<br />
Obwohl die äußere Form nicht bewertet werden darf, kann der Lehrer einer gut lesbaren und<br />
formklaren Schrift Bedeutung verleihen, indem er Schüler lobt, ihnen und ihren Eltern den<br />
Zusammenhang mit dem Rechtschreiberwerb darstellt, von einer Kugelschreiber-Schrift abrät,<br />
die Sauberkeit und Gestaltung der Hefte beachtet und honoriert und Texte nicht nur<br />
abschreiben lässt, sondern auch immer wieder zur sauberen und schönen Gestaltung<br />
auffordert. Sinnvoll ist es in diesem Zusammenhang, immer wieder Partnerkontrollen<br />
anzuregen. Schüler geben ihren Mitschülern direkte und ungeschminkte Rückmeldung, wenn<br />
sie etwas nicht lesen können.<br />
Reinschriften<br />
Im Rahmen der Aufsatzerziehung sollte daher nicht nur das Entwerfen von Texten, sondern<br />
auch das saubere und fehlerfreie Gestalten von Reinschriften eine bedeutende Rolle<br />
spielen. Für dieses Unterrichtsvorhaben eigenen sich besonders gut Gedichte, Plakate,<br />
Einladungen, Kinderbuchprojekte, Werbungen, Briefe, Textsammlungen mit Bildern etc. , wie<br />
die folgenden Beispiele zeigen:<br />
Beispiele für Reinschriften:<br />
Aufsatzmappe<br />
Das Anlegen einer Aufsatzmappe, die über mehrere Jahre geführt wird, unterstützt das schön<br />
gestaltete Schreiben. Außerdem entsteht damit eine Textsammlung, die gerne aufgehoben<br />
wird.<br />
Mandalas<br />
In diesem Zusammenhang sei auch auf das Ausmalen von Mandalas verwiesen. Diese<br />
Tätigkeit wirkt beruhigend und wertvoll auf das psychische Gleichgewicht, verfeinert auch die<br />
Motorik der Finger und schult das ästhetische Auge für Schönes und Harmonisches.<br />
Beispiele für Mandalas:
Rechtschreibdidaktik <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong> 26<br />
Deutliches Sprechen und genaues Lesen<br />
Sprechen und Lesen stehen in einer engen Beziehung mit dem Rechtschreiben. Rechtschreibund<br />
Leseschwächen treten häufig gemeinsam bei Schülern auf. Unschärfen bei visuellen<br />
Wahrnehmungen führen zu Lesefehlern und in späterer Folge auch zu Schreibfehlern. Es wäre<br />
so schön, könnte man das Rechtschreiben über den einfachen Weg des Mehr-Lesens<br />
verbessern. W. Wieczerkowski weist in einer Untersuchung nach, dass die Verbesserung bei<br />
einem Diktat nach vorangegangener Leseübung, bei der die Vertrautheit mit dem Text<br />
hergestellt werden sollte, nur um magere 6,3% gegenüber der Vergleichsgruppe besser ist, als<br />
mit der Gruppe, die das Diktat ohne Leseübung schrieb.<br />
(W. Wieczerkowski in Plickat, Lernerfolg und Trainingsformen im Rechtschreibunterricht, Klinkhardt,<br />
1978)<br />
Zwar fördert das Lesen weniger als weithin angenommen das Rechtschreiben, aber der Wille<br />
zum genauen Lesen ist eine förderliche Einstellung für das richtige Schreiben. Jahrzehntelang<br />
hat man das Hauptkriterium der Leseerziehung im Lesetempo der jeweiligen Schulstufen<br />
gesehen. Tabellen haben darüber Auskunft gegeben, welches Tempo in den Schulstufen vom<br />
Schüler erreicht werden soll. Heute muss gesagt werden, das überhastetes, fehlerhaftes Lesen<br />
weder für die Sinnentnahme noch für das Leseerlebnis vorteilhaft ist - und schon gar nicht für<br />
die Rechtschreibfertigkeit. Daher sollte man in Zukunft weniger dem Tempo, sondern mehr der<br />
Exaktheit Bedeutung verleihen. Dabei erhöht das leise Lesen die Vertrautheit mit dem Text<br />
mehr als das laute Lesen.<br />
Gerade schwer lesbare Texte, wie beispielsweise „Der Zipferlake“, sind gut geeignet, das<br />
genaue Lesen zu trainieren.<br />
Der verdrehte Schmetterling<br />
Mira Lobe<br />
Ein Metterschling<br />
mit flauen Bügeln<br />
log durch die Fluft.<br />
Er war einem Computer entnommen,<br />
dem war was durcheinander gekommen,<br />
irgendein Drähtchen,<br />
irgendein Rädchen.<br />
Und als man es merkte, da war's schon zu<br />
spätchen,<br />
da war der Metterschling schon feit wort,<br />
wanz geit.<br />
Mir lut er Teid.<br />
Blaukraut bleibt Blaukraut!<br />
Brautkleid bleibt Brautkleid!<br />
Ein irres Gedicht<br />
Mittags, wenn die Raben traben,<br />
Knaben sich an Waben laben,<br />
nachts, wenn Gans und Gemsen gurren,<br />
Schnabeltier und Schnecken schnurren,<br />
Pfau und Sau gemeinsam balzen.<br />
Aal und Wal zusammen walzen<br />
und ein Löwe lacht im Laub ...<br />
Ei, dann mach dich aus dem Staub<br />
Denn den irren, wirren Graus<br />
hältst du ungestraft nicht aus.
Rechtschreibdidaktik <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong> 27<br />
Übungen zur Denk- und Konzentrationsförderung und zum Training des Gedächtnisses<br />
Die Rechtschreibfähigkeit wird durch die Merkleistung des<br />
Gedächtnisses wesentlich beeinflusst. Lese- und<br />
Schreibschwierigkeiten gehen meistens mit einer<br />
Schwäche des Langzeitgedächtnisses Hand in Hand.<br />
Daher sollten immer wieder konzentrationsfördernde und<br />
gedächtnisstärkende Übungen angeboten werden, die die<br />
Denk- und Merkleistung des Gehirns trainieren.<br />
Übungen zur Verbesserung der Konzentration:<br />
Deinen Gehirnzellen macht es Spaß, Aufgaben wie die folgende zu lösen:<br />
Das Tierhaus besteht aus fünf Käfigen. Vier davon sind bewohnt, einer steht leer. Welcher?<br />
Der Käfig des Elefanten ist kleiner als der der Giraffe,<br />
Der Käfig der Giraffe grenzt an den des Löwen.<br />
Der Käfig des Löwen grenzt an drei andere Käfige.<br />
Der Käfig des Löwen ist gleich groß wie der des Affen.<br />
Kannst du in drei Minuten jene Buchstabenkombinationen herausfinden, die doppelt vorkommen?<br />
Schreibe sie auf!<br />
urks skur kurs kurr krus surk krus sukk kurs urks skru ukrs ruks sruk rksu uksr<br />
ksrs ksur ksus rsku ruks usrk uskr krsr<br />
Strategien, die den Rechtschreiberwerb unterstützen<br />
Wie Rechtschreiben am erfolgversprechendsten zu lehren ist, lässt sich nicht verallgemeinernd<br />
beantworten. Erschwert wird eine allgemein gültige Methodik, da offensichtlich die Schüler einer<br />
Klasse sehr unterschiedliche Zugänge zur Rechtschreibung finden und diese Zugänge sich<br />
auch noch mit dem Wechsel der Lebensabschnitte ändern. Neben den traditionellen<br />
Übungsaufgaben im Rechtschreibunterricht sind die folgenden Aufgabenstellungen als<br />
bedeutsam einzustufen:<br />
1. Konzentration auf den Grundwortschatz und nicht auf Spitzfindigkeiten der Orthographie -<br />
stärkt das Selbstbewusstsein, gibt Sicherheit.<br />
2. Wortlistentraining und Übung mit individuellen Fehlerlisten - beseitigt die individuellen<br />
Fehlerschwerpunkte.<br />
3. Diktate in verschiedenen Varianten - bedeuten jene Abwechslung, die belebt.<br />
4. Spielerische Formen des Lernens - sorgen für Motivation und Ansporn.<br />
Konzentration auf den Grundwortschatz<br />
Angesichts der Kompliziertheit der deutschen Rechtschreibung und des gewaltigen<br />
Wortmaterials scheint es aussichtslos, in der Schule der 10-14-Jährigen auf eine vollständige<br />
Beherrschung der Rechtschreibung zu zielen. Ein Unterricht, der diese Zielsetzung verfolgt,<br />
geht an der Aufnahmefähigkeit der Schüler vorbei.<br />
Einige Fakten zum Nachdenken:<br />
3 Wörter machen 10 Prozent eines Textes aus. Es sind die Wörter die, der, und.<br />
66 Wörter decken bereits die Hälfte jedes normalen Textes ab.<br />
1300 Wörter machen 90 Prozent eines Alltagsgespräches aus.
Rechtschreibdidaktik <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong> 28<br />
2000 Wörter reichen für alltägliche schriftliche Verständigungen aus und sind zugleich der<br />
Grundwortschatz für das Erlernen einer Fremdsprache.<br />
4000 Wörter bedeuten 95 Prozent des schriftlichen Gebrauchswortschatzes.<br />
6000 Wörter gehören zum aktiven Wortschatz eines Schülers am Ende der Pflichtschulzeit.<br />
10.000 Wörter stellen den aktiven Wortschatz des durchschnittlichen Erwachsenen dar.<br />
250.000 Wörter gehören zum allgemeinen Wortschatz von lexikalischer Bedeutung.<br />
Mehrere Millionen machen den Gesamtwortschatz aus. Hierher gehören Wörter wie Synthese,<br />
liquidieren, Hyazinthe,...<br />
Quelle: Die Zeit, Nr. 45, 4.11.1988; und: Peter Eisenberg, Angelika Linke: Wörter, in Praxis Deutsch, Heft 139, 1996.<br />
Ziel der Pflichtschule muss es daher sein, dass ihre Abgänger die wichtigsten 5. - 6.000 Wörter<br />
richtig schreiben können. Bereits 1913 erhob L. Habrich im „Lexikon der Pädagogik“ die<br />
Forderung für den Vorrang des Wichtigen im Rechtschreibunterricht, Nebensächliches<br />
soll nicht zur Hauptsache gemacht werden. (Adrion D. Praxis des Rechtschreibunterrichts,<br />
Herder, 1978) So einleuchtend die Forderung auch ist, so hat sie doch viele Jahrzehnte<br />
gebraucht, bis sie auf den Rechtschreibunterricht durchschlug. Das Üben von solchen<br />
Horrorwörtern, wie sie noch 1982 in einem Arbeitsbuch für die 8. Schulstufe zu finden waren,<br />
führt nicht zu mehr Rechtschreibsicherheit, sondern überfordert Schüler:<br />
Stanniolpapier, Standarte, Stratosphäre, Chrysantheme, Hyazinthe, Kathedrale, liquidieren,<br />
Okkultismus, Rhetorik, Plissee, Koexistenz, Rhabarber, Kannibale, Kapriole, Moräne, Aperitif,<br />
Protege´, Synthese, liquidieren, rhombisch, Forsythie, Rhododendron, demissionieren,......<br />
(Killinger, Arbeitsbuch Deutsch 1982)<br />
Besser hätte man die Lernzeit damit genutzt, Schüler dafür zu sensibilisieren, bei der<br />
Verwendung solcher und ähnlicher Wörter prinzipiell im Wörterbuch nachzuschlagen.<br />
Wortlistentraining mit Wörtern des Gebrauchswortschatzes vermittelt auch den schwachen<br />
Schülern sowohl kurzfristigen als auch längerfristigen Erfolg.<br />
Insgesamt steigt bei dieser Übungsform bei allen Schülern die positive Einstellung zum<br />
Rechtschreibunterricht. Hingegen vermehrt die Konzentration auf besondere<br />
Rechtschreibprobleme und Spitzfindigkeiten im Rechtschreibunterricht die Unsicherheit der<br />
Lernenden, vor allem der rechtschreibschwachen Schüler. Es ist zweckmäßig, vorrangig jene<br />
Wörter zu üben, die der Schüler tatsächlich selbst in seinen verwendet.<br />
Wortlistentraining und individuelle Fehlerlisten<br />
Wortlistentraining ist eine sehr effiziente Methode, den gesicherten Wortschatz von Schülern<br />
rasch und nachhaltig zu erhöhen. Besonders Wörter des Grundwortschatzes und Fremdwörter<br />
können so eingeübt werden. Im Bereich der Groß- und Kleinschreibung, der Getrennt- und<br />
Zusammenschreibung sind Wortlisten eine weniger wirksame Methode.<br />
Listen mit "wichtigen Wörtern", wie sie im Sprachbuch „Deutschstunde 1 - 4“ zu finden sind,<br />
eignen sich zum wöchentlichen Training.<br />
Beispiel einer Wortliste:<br />
Einige deutsche Wörter haben sich in die Fremdwörterliste geschwindelt. Streiche sie durch! Ergeben sie<br />
einen Sinn?<br />
• STOPP • WICHTIGE WÖRTER • STOPP • WICHTIGE WÖRTER • STOPP •<br />
Adresse • Alkohol • Apotheke • Immer diese Ausländer • Apparat • Appetit • Artikel • Arzt • Athlet • die •<br />
Automat • nehmen • Baby • Banane • Benzin • uns • Bibliothek • die • Büro • besten Plätze • Camping • im
Rechtschreibdidaktik <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong> 29<br />
Satz • Charakter • Chef • weg • Demokratie • Weißt du • Demonstration • nicht • Diktatur • dass es •<br />
diktieren • auch • Diktat • direkt • deutsche Wörter • Doktor • gibt • Drogerie • elektrisch • die • Elektrizität •<br />
Energie • im Ausland • Fabrik • Figur • Firma • Formular • Fotoapparat • Fotograf • leben? • fotografieren<br />
• STOPP • WICHTIGE WÖRTER • STOPP • WICHTIGE WÖRTER • STOPP •<br />
Hier finden Sie weitere Wortlisten:<br />
aus: Deutschstunde 4<br />
<strong>Pramper</strong>, W., u.a.: Materialien zur Deutschstunde 1 - 4. In der neuen Rechtschreibung. Veritas, 1997.<br />
<strong>Pramper</strong>, W, Hammerschmid, H.: Rechtschreibkönig, Lernspiel mit Lernkartei für 12-15-Jährige in der neuen<br />
Rechtschreibung. Veritas, Linz. 1996, Lernspiel Schatzsuche, für 8-12-Jährige, Veritas Linz. 1995.<br />
Rieder, W. , Bauer, G.: Rechtschreibunterricht an der Schule der 10-15jährigen, Inn Verlag, 1986.<br />
Sennlaub, G.: So wird´s gemacht. Grundwortschatz, Dieck, 1987<br />
Meier, H.: Deutsche Sprachstatistik. Olms verl. Hildesheim: 1978.<br />
Übungsformen für die Arbeit mit Grundwortschatzlisten:<br />
Im Vordergrund steht nicht das Prüfen, sondern das kontinuierliche Üben über mehrere Jahre.<br />
Der Schüler erhält dabei für eine Woche „Wortlistentraining“ 40-80 Wörter. Diese Wörter soll er<br />
so gut vorbereiten, dass er bei der Ansage (eine Auswahl von 20 Wörtern wird ihm angesagt)<br />
möglichst keinen Fehler macht. Ist die Übungsform einmal eingespielt, erreichen 40 bis 70<br />
Prozent einer Klasse dieses Ziel. In den höheren Schulstufen sind die Ergebnisse besser, falls<br />
es eine Unterstützung durch Eltern gibt ebenso. Am besten trainiert man anfangs diese<br />
Übungsform im Unterricht, bevor man sie später als Hausaufgabe gibt.<br />
Übungsreihe mit einer Grundwortschatzliste<br />
• Kennen lernen: Wortliste durchlesen<br />
• Üben: schwierigere Wörter abschreiben<br />
• vollständige Wortliste ansagen lassen<br />
• Fehlerwörter neu schreiben, Problemstelle rot nachziehen<br />
• Fehlerwörter nochmals ansagen lassen oder auswendig aus dem Gedächtnis aufschreiben<br />
• ganze Wortliste nochmals durchlesen<br />
• Kontrolle: die Wortliste wird angesagt<br />
Varianten des Diktates<br />
Der Diktatunterricht von früher ist in jedem Fall heute nicht mehr zeitgemäß. Bei dieser<br />
Unterrichtsmethode wurde nur zum Schaden des Schülers festgestellt, was nie gründlich<br />
gelehrt wurde - oder noch schlimmer - noch überhaupt nicht gelehrt wurde. Die Texte wurden<br />
meist aus sogenannten Diktatsammlungen entnommen, die Rechtschreibschwierigkeiten<br />
extrem verdichtet beinhalteten. Sie bewiesen dem Schüler nachhaltig seine<br />
Rechtschreibschwächen. Seine Frustration und Abneigung gegenüber dem<br />
Rechtschreibunterricht stieg und behinderte damit die notwendige positive Einstellung zur<br />
Rechtschreibung, die Voraussetzung für eine Verbesserung ist.<br />
Das Diktat<br />
Diktate im traditionellen Sinn sind keine Übungsform. Ihr Einsatz ist sinnvoll:<br />
• Zur Analyse von Rechtschreibschwächen – damit individuelle Übungsaufgaben im offenen<br />
Unterricht besser gesteuert werden können – und zur Einstufung in Leistungsgruppen. Mehr<br />
dazu finden Sie in den „Materialien zur Deutschstunde 3 und 4“, Veritas Verlag.<br />
• Zur Lernkontrolle als Abschluss einer längeren Auseinandersetzung mit einem<br />
Rechtschreibthema. Dabei ist darauf zu achten, dass ausschließlich eine Überprüfung des
Rechtschreibdidaktik <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong> 30<br />
Lernstoffes stattfindet. Damit wird sichergestellt, dass auch ein schwächerer Schüler zu<br />
einem Erfolgserlebnis kommen kann, wenn er die Übungen des vorangegangenen<br />
Unterrichts gut durchgeführt hat. Werden außerdem die gesetzlichen Bestimmungen<br />
beachtet (30 Minuten im Semester, rechtzeitige Ankündigung), ist das Diktat eine sinnvolle<br />
Ergänzung zum Rechtschreibunterricht.<br />
Wie diktiert werden soll<br />
Die Unsitte, dass manche Lehrer durch eine besondere Aussprache dem Schüler Hilfestellung<br />
geben wollen, ist abzulehnen. Es soll möglichst deutlich, aber ohne besondere Hervorhebungen<br />
diktiert werden. Beim Diktieren von Wortlisten wiederholt man das angesagte Wort nochmals,<br />
ev. mit einer Fügung (diskutieren - die Politiker diskutieren miteinander - diskutieren). Bei der<br />
Ansage von Sätzen oder eines Textes ist darauf zu achten, dass nicht schwierige Wörter<br />
„dazwischen rutschen“, die vorher nicht Gegenstand der Übung waren.<br />
Alternativen zum Diktat - Aufgaben, die dem Üben dienen<br />
Selbstdiktat - Es werden kurze Abschnitte auswendig gelernt, dann aus dem Gedächtnis<br />
aufgeschrieben und anschließend selbst kontrolliert. Es eignen sich jeweils 3 - 5 Wörter einer<br />
Wortliste, Fügungen oder ganze Sätze. Schüler sollen darauf hingewiesen werden, dass sie<br />
von der Methode des „Wort-für-Wort-Abschreibens“ zur Aufnahme von Wortgruppen und zuletzt<br />
ganzer Sätze kommen sollen. Nach dem Abschreiben der Wortliste soll zur Verstärkung bei der<br />
Einprägung die schwierige Stelle im Wort mit Farbe nachgezogen werden.<br />
Anfang nächste Woche<br />
Angst und Bange machen<br />
auf das Herzlichste begrüßen<br />
auf Deutsch sagen<br />
auf einmal erschrecken<br />
auf erklärliche Art und Weise<br />
aufs Genaueste angeben<br />
außer Acht lassen<br />
backfrische Semmel verkaufen<br />
bei Bedarf helfen<br />
beieinander stehen<br />
beim Essen stören<br />
Bücher zum Lachen<br />
bunt gefiederte Federn<br />
da bin ich mir sehr sicher<br />
da kannst du Kopf stehen<br />
dahinter kommen<br />
das Augenlid schließen<br />
das Auto abschleppen<br />
das Doppelte bekommen<br />
das erste Mal<br />
das fällt mir nicht leicht<br />
davon ununterbrochen<br />
sprechen<br />
deine letzten Worte waren<br />
Abschied nehmen<br />
das Beste geben
Rechtschreibdidaktik <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong> 31<br />
Partnerdiktat - Ein kurzer Text wird zunächst langsam und möglichst aufmerksam<br />
durchgelesen und so zum Diktat vorbereitet, schwierige Wörter können dabei auch<br />
unterstrichen werden. Dann arbeiten zwei Schüler leise zusammen, sie diktieren jeweils eine<br />
Hälfte des Textes. Der Ansager macht auf Fehler sofort und freundlich aufmerksam.<br />
Variante: Ein schwächerer und besserer Schüler arbeiten zusammen. Zuerst sagt der<br />
schwächere Schüler den ganzen Text an, dann diktiert der bessere.<br />
Im Vogelpark<br />
I. Zum vierzehnten Geburtstag lud Herr Fink II. Es fiel nicht schwer, von den gefiederten Tieseine<br />
Tochter Vera zu einer Fahrt in einen<br />
ren begeistert zu sein. Manche flogen sogar frei<br />
Vogelpark ein. Er hatte ihr diesen Ausflug<br />
umher. Die Vielfalt an Vögeln war überwälschon<br />
lange versprochen, aber bisher noch<br />
tigend. Vera machte viele Fotos und die Zeit<br />
keine Zeit dazu gefunden. An einem Freitag im verstrich wie im Flug. Bei einem überfüllten<br />
November holte er sie nach der Klavierstunde Büfett machten sie Rast, um Vanillepudding zu<br />
bei einer Privatlehrerin ab und fuhr mit ihr zum essen. Der Vater versprach ihr, weil sie so brav<br />
Vogelparadies nahe von Villach. Von nah und war, vielleicht in vier bis fünf Wochen wieder zu<br />
fern kamen dort Leute herbei,<br />
kommen.<br />
Zweistufendiktat - Der Lehrer sagt einen Text oder eine Wortliste an. Anschließend haben die<br />
Schüler Zeit und dürfen Hilfsmittel ihrer Wahl (Wörterbuch, Sprachbuch) zur Richtigstellung<br />
verwenden. Diese Form des Diktates kommt den privaten und beruflichen Schreibsituationen<br />
nach der Schulzeit sehr nahe.<br />
Variante: Die Schüler arbeiten partnerweise zusammen, anschließend wird eine Reinschrift<br />
angefertigt, die dem Lehrer zur Korrektur vorgelegt wird.<br />
Blitzdiktat - Den Schülern wird Zeit eingeräumt, einen sehr kurzen, aber schwierigen Text<br />
durchzulesen. Dann wird er angesagt. „Fehlerfrei“ ist das ehrgeizige Ziel, für das eine<br />
„Belohnung“ ausgesetzt wird.<br />
Einmal konzentriert durchlesen, dann nach Ansage aufschreiben!<br />
Ein Igel ging nach Dienstschluss an einem Büffet vorbei. Auf einem<br />
Schild stand: Billige Limonaden und Biere für den Riesendurst! „Bitte,<br />
gib mir eine Limo!", rief das durstige Tier zum Biber. Der servierte ihm eine riesige Limo. Als der Igel<br />
einen Schluck machen wollte, kriegte er einen ziemlicher Schrecken. „Da schwimmt ja eine Fliege!", rief<br />
er. „Na wenn schon", bekam er zur Antwort, „die trink dir doch nicht viel weg!"<br />
0 Fehler sind das Ziel<br />
Laufdiktat - Der Lehrer verteilt Zettel mit Sätzen an mehreren Stellen im Klassenraum. Der<br />
Schüler geht zu einem Satz, lernt ihn auswendig, läuft zum Platz zurück und schreibt ihn auf.<br />
Anschließend Selbstkontrolle mit Hilfe des Overheads. Die Reihenfolge der Zettel wird vom<br />
Lehrer beliebig verteilt und von den Schülern willkürlich gewählt. Die Sätze geben in der<br />
richtigen Reihenfolge einen geschlossenen Text. Daher ordnen die Schüler - nach der<br />
Rechtschreibprüfung der Sätze - die Sätze nach der logischen Reihenfolge und schreiben sie<br />
geordnet auf.<br />
Puzzlediktat, Dosendiktat - Der spätere Ansagetext muss zuerst erarbeitet werden. Zum<br />
Beispiel müssen Satzteile auf Papierstreifen in die richtige Reihenfolge gebracht werden. Oder<br />
ein lückenhafter Text oder eine „unfertige“ Wortliste müssen zuerst vervollständigt werden.
Rechtschreibdidaktik <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong> 32<br />
Nach der Selbstkontrolle, die sicherstellen soll, dass die Vorbereitung auf das Diktat richtig ist,<br />
wird das Wort- oder Satzmaterial vom Lehrer angesagt.<br />
Schrecklich schwierige Wörter<br />
schließlich kam er noch • ein hässliches Bild • ein süßlicher Duft •<br />
ein bisschen Heimweh • wissbegierige Eltern • vergessliche<br />
Kinder • der Versuch misslang • bloß drei Schilling haben •<br />
großzügig mit Geld umgehen • er vergaß zu grüßen<br />
Erkennst du die gefährlichen Wörter aus der Wortliste wieder? ____-<br />
ssc_____ • -__ßz____ • ___ß • __ßl_____ • __ssb________ •_--g__ • _-<br />
____ssl___ • __ssl___ • _____ss|____ • _ssl_____<br />
Kontrolliertes Abschreiben - Das Abschreiben aus Büchern oder von<br />
der Tafel ist eine wesentliche Trainingsform für den Erwerb der<br />
Rechtschreibung. Es sollte zur selbstverständlichen Angewohnheit<br />
werden, dass der Schüler seine Hefteintragung kontrolliert, ebenso jeden<br />
Text, den er abgibt.<br />
Wettdiktat mit Rechtschreib-Schwerpunkt - Ein umfangreicherer Text, der gezielt ein oder<br />
mehrere Rechtschreibthemen behandelt, wird in einer intensiven Lernphase durch Durchlesen,<br />
Herausschreiben zur Ansage vorbereitet. Die Wette: Durch sie kommt Spannung auf, Ehrgeiz<br />
wird aktiviert.<br />
Variante 1) Der Schüler wettet mit sich selbst. Vor dem Diktat schätzt der Schüler, wie viele<br />
Fehler ihm passieren werden. Ziel ist es, die Schätzung zu unterbieten bzw. nicht zu<br />
überschreiten. Anschließend Partnerkontrolle.<br />
Variante 2) Der Schüler wettet mit dem Lehrer und bietet einen Wetteinsatz an, z. B. dass<br />
er für den Fall, dass er die Wette verliert alle weiteren Beispiele abschreibt oder das<br />
Übungsblatt ausfüllt. Der Lehrer könnte auch einen Wetteinsatz anbieten für den Fall, dass<br />
nicht mehr als xx Fehler gemacht werden.<br />
Variante 3) Der Lehrer wettet mit der Klasse, dass sie zusammen mehr als xx Fehler bei der<br />
Ansage machen. Unterschreitet die Klasse die Wettvereinbarung, darf sie den Wetteinsatz, den<br />
der Lehrer anbietet, konsumieren, z. B. keine Hausübung. Überschreitet die Klasse, muss sie<br />
ihren Einsatz einlösen. Bei dieser Arbeit könnte man Partnerarbeit erlauben.<br />
M o t i v a t i o n<br />
Wer hört es nicht gerne, wenn seine Arbeit gelobt wird? Wir alle brauchen Anerkennung, sie ist<br />
der Ansporn für neue Initiativen und gibt Kraft für das Durchhalten in anstrengenden<br />
Situationen. Bis zum Ende der Pflichtschulzeit erweisen sich selbst einfachste Formen der<br />
„Fleiß-Honorierung“ als sehr motivierend für Schüler und tragen wesentlich zu einer<br />
Leistungssteigerung bei.
Rechtschreibdidaktik <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong> 33<br />
Positive Verstärker (Belohnungen) kann der Deutschlehrer vergeben für: gute Leistungen,<br />
bei der Erarbeitung neuer Stoffe, bei der Wiederholung von bereits Gelerntem, für „tolle“ Ideen,<br />
Null Fehler bei Ansagen, für freiwillige (Plus-)Aufgaben, soziale Verhaltensweisen, sichtbaren<br />
Fleiß bei Arbeiten in der Schule und zu Hause, für besonders schöne Ausarbeitungen, zur<br />
Aufmunterung bei Misserfolgen,...<br />
Als Belohnungen (Rückmeldungen) bewähren sich: Verbale und schriftliche<br />
Rückmeldungen, Gutscheine, Pickerl, Stempel,...<br />
Gutscheine sind gewissermaßen schriftliche Bestätigungen, die ein Schüler für eine sehr gute<br />
Leistung oder für seinen Fleiß bekommen kann. Diese Gutscheine kann der Lehrer auch für<br />
den Beurteilungsbereich „Ständige Beobachtung der Mitarbeit“ heranziehen. In diesem Fall<br />
sammelt der Schüler im Laufe des Semesters möglichst viele Gutscheine und gibt sie am<br />
Semesterende ab.<br />
V a r i a n t e n d e r K o n t r o l l p h a s e i m o f f e n L e r n e n<br />
Der gezielte Rechtschreiberwerb braucht eine verlässliche Kontrolle der geübten Wörter und<br />
Texte, und das möglichst sofort, damit sich Fehler nicht festsetzen können. Während des Übens<br />
„läuft“ das Gehirn auf Hochtouren, es ist sozusagen „heiß“ und möchte die Bestätigung oder<br />
Korrektur schnell erhalten. Erfolgt die Rückmeldung über richtig oder falsch erst lange nach der<br />
Übungsphase, ist das Gehirn in dieser Angelegenheit „erkaltet“ und die Rückmeldung wird<br />
nahezu interesselos aufgenommen, auf jeden Fall aber folgenlos. Eine Änderung eines falsch<br />
eingeübten Stoffes ist bei verzögerter Rückmeldung nur schwer möglich.<br />
Wer es genau wissen möchte: Abnahme der Fehlerzahl bei unmittelbarer Rückmeldung mit<br />
Selbstkorrektur 33%, bei verzögerter Korrektur durch den Lehrer 28%, ohne Fehlerrückmeldung<br />
4,7%<br />
(Horst Nickel in Plickat, Lernerfolg und Trainingsformen im Rechtschreibunterricht, Klinkhardt, 1978)<br />
Varianten der Kontrolle:<br />
Selbstkontrolle<br />
rasche Durchführung,<br />
aber Fehler werden oft übersehen,<br />
ob korrekt ausgebessert wird, bleibt unüberprüft.<br />
Partnerkontrolle<br />
Probleme mit der Lesbarkeit,<br />
Streitereien der Schüler können auftreten,<br />
Fehler werden gar nicht selten übersehen.<br />
Lehrerkontrolle<br />
eine sichere Form der Überprüfung und<br />
Ausbesserung, aber zeitaufwendig,<br />
Fehler können übersehen werden.<br />
Programmierte Kontrolle durch Lernsoftware<br />
eine hundertprozentige Form der Kontrolle,<br />
Fehler werden sofort ausgebessert, nie „eingeübt“ und nie übersehen.<br />
Leider erst nach einem Raumwechsel möglich.<br />
Wie Lösungsunterlagen für die Selbst- und Partnerkontrolle präsentiert werden können<br />
Die Kontrollunterlage wird zentral für alle zur<br />
selben Zeit präsentiert:<br />
Medium: Overhaed-Folie, Tafel<br />
+ einfach, kostengünstig<br />
- behindert individuelles Arbeiten<br />
Jeder Schüler hat die Kontrollunterlage bei seinem<br />
Arbeitsplatz:<br />
Medium: eigener Lösungszettel oder auf der<br />
Rückseite des Arbeitsblattes, Lösungsseite im Buch<br />
+ individuelles Arbeiten wird gefördert<br />
- aufwendig, für jeden Schüler Lösungskopien
Rechtschreibdidaktik <strong>Wolfgang</strong> <strong>Pramper</strong> 34<br />
L i t e r a t u r l i s t e<br />
Berg, M.: Texte verfassen und dabei richtig schreiben, in Diskussion Deutsch Jg 81/85.<br />
Bergk, M.: Rechtschreibfälle als Rechtschreibfalle und mögliche Auswege , in Diskussion Deutsch Nr. 74, 1983.<br />
Brenninger Helga: Jeder kann schreiben lernen, Beltz.<br />
Deutsch üben Bd 1-6, ; Verlag für Deutsch<br />
Diktate zum täglichen Üben; Schroedel<br />
Endres <strong>Wolfgang</strong>: Diktate mit Spaß, Loewes<br />
Endres <strong>Wolfgang</strong>: Spaß an der Rechtschreibung, Loewes<br />
Eppert, F.: Grundwortschatz Deutsch, Übungen und Tests. Klett, 1972. II/12.053<br />
Feiks, Dieter, u.a.: Training Rechtschreibung I, II, III, Klett, 1990.<br />
Firnhaber Mechthild: Legasthenie, Wie Eltern und Lehrer helfen können, Fischer<br />
Glas, Wilhelm: Untersuchung zur orthographischen Sicherung eines Gebrauchswortschatzes, BMUK, Klagenfurt,<br />
1987, (IV/5577)<br />
Jägel, W.: Der sichere Weg zur Rechtschreibung, Schöning, 1981. III/5384.<br />
Juna Johanna: Legasthenie - gibt’s die?<br />
K. Sczyrba: Rechtschreibolympiade, Bange<br />
Knifflige Rechtschreibrätsel 7.-10. Klasse; Schroedel<br />
Meier, H.: Deutsche Sprachstatistik: Olms Verl. Hildesheim: 1978. IV/8221<br />
Menzel, <strong>Wolfgang</strong>: Zur Didaktik der Orthographie, in Praxis Deutsch, 2/86.<br />
Naegele Ingrid: Lese Rechtschreibschwäche in den Klassen 1-10, Beltz<br />
Plickat, Hans-Heinrich und Wieczerkowski, Wilhelm: Lernerfolg und Trainingsformen im Rechtschreibunterricht, Bad<br />
Heilbrunn, Kinkhardt, 1979.<br />
<strong>Pramper</strong>, W, Hammerschmid, H.: Rechtschreibkönig, Lernspiel mit Lernkartei für 12-15-Jährige in der neuen<br />
Rechtschreibung. Veritas, Linz. 1996, Lernspiel Schatzsuche, für 8-12-Jährige, Veritas Linz. 1995.<br />
<strong>Pramper</strong>, W, u.a.: Materialien zur Deutschstunde 1.-4. In der neuen Rechtschreibung. Veritas, Linz. 1996/1997.<br />
<strong>Pramper</strong>, W. Deutsch: Sehr gut 5 u. 6., 7., 8. Schulstufe. Lernsoftware, Veritas, 1997, neue RS.<br />
<strong>Pramper</strong>, W. Kommatrainer. Lernsoftware, Veritas, 1997, neue RS.<br />
Praxis Deutsch Heft 4 (1974) und 32 (1978): Orthographie I und II.<br />
Rieder, W: Rechtschreibunterricht an der Schule der 10-15jährigen, Inn Verlag, Innsbruck, 1986.<br />
Rieder, Walter u.a.: Rechtschreibunterricht an der Schule der 10-14jährigen, Inn Verlag, Innsbruck, 1978.<br />
Schenk Danzinger: Legasthenie - Cerebrale Funktionsstörungen<br />
Schreiner, Kurt: Deutsche Rechtschreibung und Grammatik, Falken, 1990, IV/7725<br />
Schülerduden: Übungen zur deutschen Sprache I und II; Dudenverlag<br />
Sennlaub, G.: So wird´s gemacht. Grundwortschatz, Dieck, 1987, II/12.104<br />
Sirch, Karl: Rechtschreibunterricht, Stuttgart, Klett, 1977.<br />
Sommer Norbert: Lese- Rechtschreibschwierigkeiten vorbeugen und überwinden, Cornelsen<br />
Soremba, Edith-Maria: Legasthenie muss kein Schicksal sein, Herder<br />
Stadler, B.: Sprachspiele in der Grundschule, Donauwörth, 1986. II/12.034<br />
Stadler, B.: Sprachspiele in der Hauptschule, Donauwörth, 1986. II/12.035<br />
Watzke, Oswald: Rechtschreibunterricht in der Primarstufe, München, 1976.<br />
P r ü f u n g s f r a g e n<br />
1. Sprechen/Schreiben Sie über Mythen der Orthographie!<br />
2. Erläutern Sie, wie Schüler rechtschreiben lernen!<br />
3. Beschreiben Sie, welche Hilfen bei Rechtschreibproblemen zur Verfügung stehen!<br />
4. Nennen Sie Strategien der Fehlervermeidung!<br />
5. Stellen Sie gegensätzliche Auffassungen in der Rechtschreibdidaktik gegenüber und beziehen Sie selbst<br />
begründete Stellung!<br />
6. Erläutern Sie die Gliederung einer Rechtschreibstunde anhand der Unterrichtsschritte zu einem selbst gewählten<br />
Rechtschreibthema!<br />
7. Sprechen Sie über den Grundwortschatz und wie damit geübt werden kann!<br />
8. Zeigen Sie verschiedene Formen des Übens und Kontrollierens im Rechtschreibunterricht auf!<br />
9. Nennen Sie didaktische Grundsätze des Rechtschreibunterrichts!<br />
10. Nennen Sie verschiedene Beispiele für Lernspiele im Rechtschreibunterricht! (Lernkartei)<br />
B a k k a l a u r e a t s a r b e i t e n z u r R e c h t s c h r e i b d i d a k t i k<br />
Kreativ rechtschreiben lernen * den Grundwortschatz lernen * Legasthenie - die Lese-Rechtschreib-Schwäche *<br />
Lernspiele und Quizspiele für den Rechtschreibunterricht * wie Schüler eine lesbare, individuelle Handschrift<br />
erwerben * Gedächtnistraining und Rechtschreiberwerb * Gehirnfunktionen besser für das Rechtschreiben nutzen