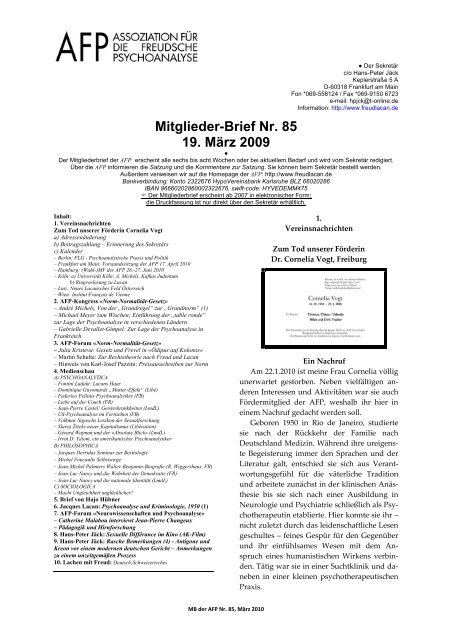Mitglieder-Brief Nr. 85 19. März 2009 - freudlacan
Mitglieder-Brief Nr. 85 19. März 2009 - freudlacan
Mitglieder-Brief Nr. 85 19. März 2009 - freudlacan
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
● Der Sekretär<br />
c/o Hans-Peter Jäck<br />
Keplerstraße 5 A<br />
D-60318 Frankfurt am Main<br />
Fon *069-558124 / Fax *069-9150 6723<br />
e-mail: hpjck@t-online.de<br />
Information: http://www.<strong>freudlacan</strong>.de<br />
<strong>Mitglieder</strong>-<strong>Brief</strong> <strong>Nr</strong>. <strong>85</strong><br />
<strong>19.</strong> <strong>März</strong> <strong>2009</strong><br />
●<br />
Der <strong>Mitglieder</strong>brief der AFP erscheint alle sechs bis acht Wochen oder bei aktuellem Bedarf und wird vom Sekretär redigiert.<br />
Über die AFP informieren die Satzung und die Kommentare zur Satzung. Sie können beim Sekretär bestellt werden.<br />
Außerdem verweisen wir auf die Homepage der AFP: http://www.<strong>freudlacan</strong>.de<br />
Bankverbindung: Konto 2322676 HypoVereinsbank Karlsruhe BLZ 66020286<br />
IBAN 96660202860002322676, swift-code: HYVEDEMM475<br />
Der <strong>Mitglieder</strong>brief erscheint ab 2007 in elektronischer Form;<br />
die Druckfassung ist nur direkt über den Sekretär erhältlich.<br />
Inhalt:<br />
1. Vereinsnachrichten<br />
Zum Tod unserer Förderin Cornelia Vogt<br />
a) Adressenänderung<br />
b) Beitragszahlung – Erinnerung des Sekretärs<br />
c) Kalender<br />
‒ Berlin: FLG - Psychoanalytische Praxis und Politik<br />
‒ Frankfurt am Main; Vorstandssitzung der AFP 17. April 2010<br />
‒ Hamburg: (Wahl-)MV der AFP 26.-27. Juni 2010<br />
‒ Köln: a) Universität Köln: A. Michels, Kafkas Judentum<br />
b) Ringvorlesung zu Lacan<br />
‒ Linz: Neues Lacansches Feld Österreich<br />
‒ Wien: Institut Français de Vienne<br />
2. AFP-Kongress «Norm-Normalität-Gesetz»<br />
‒ André Michels, Von der „Grundregel“ zur „Grundnorm“ (1)<br />
‒ Michael Meyer zum Wischen: Einführung der „table ronde“<br />
zur Lage der Psychoanalyse in verschiedenen Ländern<br />
‒ Gabrielle Devallet-Gimpel: Zur Lage der Psychoanalyse in<br />
Frankreich<br />
3. AFP-Forum «Norm-Normalität-Gesetz»<br />
‒ Julia Kristeva: Gesetz und Frevel in «Ödipus auf Kolonos»<br />
‒ Martin Schulte: Zur Rechtstheorie nach Freud und Lacan<br />
‒ Hinweis von Karl-Josef Pazzini: Preisausschreiben zur Norm<br />
4. Medienschau<br />
A) PSYCHOANALYTICA<br />
‒ Fontini Ladaki: Lacans Haar<br />
‒ Dominique Guyomards „Mutter-Effekt“ (Libé)<br />
‒ Federico Fellinis Psychoanalytiker (FR)<br />
‒ Liebe auf der Couch (FR)<br />
‒ Jean-Pierre Castel: Geisteskrankheiten (LmdL)<br />
‒ US-Psychoanalyse im Fernsehen (FR)<br />
‒ Volkmar Siguschs Lexikon der Sexualforschung<br />
‒ Slavoj Žižeks neuer Kapitalismus (Libération)<br />
‒ Gérard Wajman und der «Absolute Blick» (LmdL)<br />
‒ Irvin D. Yalom, ein amerikanischer Psychoanalytiker<br />
B) PHILOSOPHICA<br />
‒ Jacques Derridas Seminar zur Bestiologie<br />
‒ Michel Foucaults Selbstsorge<br />
‒ Jean-Michel Palmiers Walter-Benjamin-Biografie (R. Wiggershaus, FR)<br />
‒ Jean-Luc Nancy und die Wahrheit der Demokratie (FR)<br />
‒ Jean-Luc Nancy und die nationale Identität (LmdL)<br />
C) SOCIOLOGICA<br />
‒ Macht Ungleichheit unglücklicher?<br />
5. <strong>Brief</strong> von Hajo Hübner<br />
6. Jacques Lacan: Psychoanalyse und Kriminologie, 1950 (1)<br />
7. AFP-Forum «Neurowissenschaften und Psychoanalyse»<br />
‒ Catherine Malabou interviewt Jean-Pierre Changeux<br />
‒ Pädagogik und Hirnforschung<br />
8. Hans-Peter Jäck: Sexuelle Différance im Kino (AK-Film)<br />
9. Hans-Peter Jäck: Rasche Bemerkungen (4) - Antigone und<br />
Kreon vor einem modernen deutschen Gericht – Anmerkungen<br />
zu einem unzeitgemäßen Prozess<br />
10. Lachen mit Freud: Deutsch-Schweizerisches<br />
MB der AFP <strong>Nr</strong>. <strong>85</strong>, <strong>März</strong> 2010<br />
1.<br />
Vereinsnachrichten<br />
Zum Tod unserer Förderin<br />
Dr. Cornelia Vogt, Freiburg<br />
Ein Nachruf<br />
Am 22.1.2010 ist meine Frau Cornelia völlig<br />
unerwartet gestorben. Neben vielfältigen an‐<br />
deren Interessen und Aktivitäten war sie auch<br />
Fördermitglied der AFP, weshalb ihr hier in<br />
einem Nachruf gedacht werden soll.<br />
Geboren 1950 in Rio de Janeiro, studierte<br />
sie nach der Rückkehr der Familie nach<br />
Deutschland Medizin. Während ihre ureigens‐<br />
te Begeisterung immer den Sprachen und der<br />
Literatur galt, entschied sie sich aus Verant‐<br />
wortungsgefühl für die väterliche Tradition<br />
und arbeitete zunächst in der klinischen Anäs‐<br />
thesie bis sie sich nach einer Ausbildung in<br />
Neurologie und Psychiatrie schließlich als Psy‐<br />
chotherapeutin etablierte. Hier konnte sie ihr ‒<br />
nicht zuletzt durch das leidenschaftliche Lesen<br />
geschultes ‒ feines Gespür für den Gegenüber<br />
und ihr einfühlsames Wesen mit dem An‐<br />
spruch eines humanistischen Wirkens verbin‐<br />
den. Tätig war sie in einer Suchtklinik und da‐<br />
neben in einer kleinen psychotherapeutischen<br />
Praxis.
Ihr Interesse für die Sprache führte sie auch<br />
auf eine AFP‐Tagung mit Lucien Israël. Dies<br />
war auch ihr Einstieg in die Beschäftigung mit<br />
der lacanschen Psychoanalyse als einem Denk‐<br />
system, dessen Grundlage nicht nur durch die<br />
Philosophie, sondern vor allem durch Textana‐<br />
lysen gebildet wird. So hat sie zunächst von<br />
weitem, dann als Zaungast und schließlich als<br />
Fördermitglied sich der AFP angenähert.<br />
Ihr Tod reißt ein tiefes Loch in mein Leben<br />
und das unserer zwei Söhne. Mit Cornelia ha‐<br />
be ich nicht nur eine warmherzige, vielseitig<br />
interessierte und begeisterungsfähige Lebens‐<br />
begleiterin, sondern auch eine beinahe ideale<br />
Gesprächspartnerin verloren.<br />
Nicht einmal 60‐jährig ist sie wohl ge‐<br />
schwächt durch ihre teils lebensgefährliche,<br />
aber dennoch diagnostisch nicht zu bestim‐<br />
mende Blutkrankheit, gegen die sie jahrzehnte‐<br />
lang tapfer ankämpfte, nach einem Herzversa‐<br />
gen während eines Spazierganges urplötzlich<br />
tot zusammengebrochen.<br />
Thomas Vogt<br />
Der Vorstand der AFP hat mit Bestürzung vom plötzlichen<br />
Tod von Dr. Cornelia Vogt erfahren. Wir verlieren<br />
durch sie eine langjährige und engagierte Förderin unserer<br />
Sache der Psychoanalyse. Unsere Gedanken und unser<br />
Beileid gelten ihrem Mann, unserem verdienten Mitglied<br />
Thomas, und den beiden Kindern, für die dieser<br />
Tod, der uns eine liebe Freundin und Förderin genommen<br />
hat, eine unerwartete und schmerzliche Lücke gerissen<br />
hat.<br />
Für den Vorstand der AFP<br />
André Michels<br />
1. Vorsitzender,<br />
im Januar 2010<br />
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐<br />
a) Adressen‐Änderungen<br />
‒ Neue e‐mail:<br />
‐ Dieter Nitzgen<br />
dieter@nitzgen.info<br />
‐ Hiltrud Amuser Burger<br />
clinica@kurklinikum.com<br />
‒ Adressenänderung<br />
‐ Prof. Dr. Hermann Lang: Institut für Psychothera‐<br />
pie und Medizinische Psychologie, Klinikstraße 3,<br />
97070 Würzburg, privat: Steinbachtal 63, 97070<br />
WÜRZBURG<br />
Fon 0931‐31‐82710, Fax 0931‐31‐86080,<br />
Handy 0173‐5673627, privat 0931‐882930<br />
e‐mail: h.lang@uni‐wuerzburg.de,<br />
URL www.psychotherapie.uni‐wuerzburg.de<br />
‒ Michael Meyer zum Wischen: Fon in Frankreich:<br />
0033‐[1]6861‐28899; neue Faxnummer in Köln: 0221‐<br />
5949 2659<br />
b) Beitragszahlung <strong>2009</strong>!<br />
Zur Erinnerung: Einige <strong>Mitglieder</strong> bzw.<br />
Förderer sind mit ihrem Beitrag für <strong>2009</strong> in<br />
2<br />
MB der AFP <strong>Nr</strong>. <strong>85</strong>/<strong>März</strong> 2010<br />
Verzug, der Sekretär behält sich deshalb vor,<br />
in diesen Fällen bis auf Weiteres die Liefe‐<br />
rung des <strong>Mitglieder</strong>‐<strong>Brief</strong>s einzustellen.<br />
d.sekr.<br />
c) Kalender<br />
‒ Berlin<br />
Pratique psychanalytique et politique /<br />
Psychoanalytische Praxis und Politik<br />
Eine Tagung der Assoziation Ferenczi après Lacan<br />
mit freundschaftlicher Unterstützung vom<br />
Tagung mit zweisprachiger Übersetzung<br />
Berlin, 13. – 16. Mai 2010<br />
Institut Français Berlin (Maison de France)<br />
Kurfürstendamm 211 ‐ 10719 Berlin‐Charlottenburg<br />
Programm<br />
Bei unseren vorangegangenen Tagungen haben wir begonnen, eine<br />
lacanianische Lektüre der Psychoanalytiker, denen in der Geschichte der<br />
Psychoanalyse ein bedeutender Platz zukommt, wieder aufzunehmen<br />
(Ferenczi in Budapest, Winnicott in London). Mit einer Tagung in Berlin<br />
können wir an weitere Psychoanalytiker zu erinnern, die als direkte Schü‐<br />
ler Freuds zur psychoanalytischen Theorie beigetragen haben, beson‐<br />
ders, aber nicht ausschließlich Karl Abraham. Wenn seine Theorie der<br />
Stufen auch als zu systematisch erscheinen mag, behaupten sich noch<br />
heute seine Theorie der Melancholie und der Platz, den er dem Objekt<br />
zuweist, sowie seine Verortung der sozialen Dimension des Triebs. Zu be‐<br />
rücksichtigen ist auch, dass Melanie Klein ihm einen Teil der Begriffe ver‐<br />
dankt, die für die Entwicklung der Klinik des Kindes notwendig waren.<br />
Wir bleiben jedoch nicht dabei stehen, denn besonders in Berlin hat die<br />
Psychoanalyse sich zwei der wesentlichsten Fragen ihres Bestands stellen<br />
müssen:<br />
1. Die Ausbildung von Praktikern. Dort entstand, im Zusammenhang mit<br />
einer Poliklinik, die erste « Lehranstalt der Psychoanalyse ».<br />
2. Ihr Verhältnis zur politischen Macht. Zwar hat die Psychoanalyse sich<br />
dort entwickeln und zahlreiche benachteiligte Psychoanalytiker aus Zent‐<br />
raleuropa aufnehmen können, doch wurde sie seit der Machtergreifung<br />
durch die Nazis angegriffen, und die Weise, auf die sie diese Aggression<br />
beantwortete, gibt uns noch heute Fragen auf. Es geht um den Platz der<br />
analytischen Bewegung in der Welt und um die Diskurse, in denen sie<br />
sich ansiedelt.<br />
Diese beiden Fragen haben etwas gemeinsam. Sie bringen die Politik mit<br />
sich, in der die psychoanalytische Institution und die Kur selbst ihren Part<br />
spielen. Es wird nicht darum gehen, diese schlicht historisch zu behan‐<br />
deln. Die psychoanalytische Praxis, die uns vor allem betrifft, ist heute of‐<br />
fensichtlich nicht gegen die kombinierte Wirkung von kognitiven Verhal‐<br />
tenstherapien und Psychotherapeutengesetzen sowie der zugrundelie‐<br />
genden Diskurse gefeit.<br />
Wissenschaftliches Komitee : Claude Boukobza, Michel Bousseyroux,<br />
Jean Clam, Roland Gori, Anita Izcovich, Patrick Landman, Jean‐Pierre Leb‐<br />
run, Martine Lerude, Charles Melman, André Michels, Claus‐Dieter Rath,<br />
Moustapha Safouan, Marc Strauss, Bernard Toboul, Jean‐Jacques Tyszler,<br />
Johanna Vennemann<br />
Organisationskomitee : Roland Chemama, Françoise Gorog, Jean‐Jacques<br />
Gorog, Christian Hoffmann, Alain Vanier, Catherine Vanier<br />
(Zertifizierung der Tagung durch die Psychotherapeutenkammer Berlin<br />
beantragt.)<br />
Donnerstag, 13. Mai, Nachmittag Gesprächsleitung Roland Chemama<br />
14h15 Eröffnung der Tagung durch Claus‐Dieter Rath und einen Vertreter<br />
der Französischen Botschaft<br />
14h40 Christian Hoffmann, Introduction aux journées : psychanalyse, or‐<br />
ganisation, recherche (Einleitung : Psychoanalyse, Organisation, For‐<br />
schung)<br />
15h05, Claus‐Dieter Rath, Der Widerstand gegen das Politische (La résis‐<br />
tance au politique)<br />
15h30 Diskussion<br />
16h Pause<br />
16h15 Anita Izcovich De la formation de l'analyste à la passe (Von der<br />
Analytikerausbildung zur ‘passe’)<br />
16h40 Martine Lerude, Avons‐nous un mur dans la tête ? (Haben wir eine<br />
Mauer im Kopf ?)<br />
17h05 André Michels, Institution psychanalytique et principe de souve‐<br />
raineté (Psychoanalytische Institution und Souveränitätsprinzip) 17h30
Diskussion<br />
Freitag, 14. Mai, Vormittag Gesprächsleitung Catherine Vanier<br />
9h Claude Boukobza, Le rapport d’Anna Freud à Max Eitingon Anna<br />
Freuds Beziehung zu Max Eitingon)<br />
9h25 Joël Birman, La psychanalyse, l’institution psychanalytique et<br />
l’université (Psychoanalyse, psychoanalytische Institution und Universi‐<br />
tät)<br />
9h50 Annie Tardits, Théodor Reik et ses deux séjours à Berlin (Theodor<br />
Reik und seine zwei Aufenthalte in Berlin) 10h15 Diskussion 10h45 Pause<br />
11h Gesprächsleitung Claus‐Dieter Rath<br />
Jean‐Jacques Tyszler, Quid aujourd’hui du dialogue Freud Abraham ?(Der<br />
Dialog Freud‐Abraham aus heutiger Sicht)<br />
11h25 Françoise Gorog, Karl Abraham, de l’incertitude du rôle sexuel<br />
dans la mélancolie à la sexualité féminine (Karl Abraham – von der Unbe‐<br />
stimmtheit der Geschlechtsrolle in der Melancholie zur weiblichen Se‐<br />
xualität) 11h50 Diskussion<br />
Freitag, 14. Mai, Nachmittag Gesprächsleitung André Michels<br />
14h15 Bernard Toboul, Le temps de l’esprit, l’esprit du temps (Zeit des<br />
Geistes, Geist der Zeit)<br />
14h40 Sophie de Mijolla, la psychanalyse et le politique (Die Psychoana‐<br />
lyse und das Politische)<br />
15h05 Patrick Landman, L’analyse peut‐elle être laïque par rapport au<br />
discours politique ? (Kann die Psychoanalyse gegenüber dem politischen<br />
Diskurs einen Laienstatus halten ?) 15h30 Diskussion 16h Pause<br />
16h15 Gesprächsleitung Jean‐Jacques Rassial<br />
Jean Clam, Le manque d’être. Sur la centralité d’un motif philoso‐<br />
phique/existentialiste dans la psychanalyse (Der Seinsmangel. Über die<br />
Zentralität eines philosophisch‐ existenzialistischen Motivs in der Psy‐<br />
choanalyse)<br />
16h40 Achim Perner, Gott ist tot. Über das Ichideal und den Terrorismus<br />
(Dieu est mort, l’idéal du moi et le totalitarisme)<br />
17h05 Jean‐Jacques Moscovitz, Le malaise du sujet dans la civilisation,<br />
1929‐<strong>2009</strong>, un troisième tour entre psychanalyse et politique. (Das Un‐<br />
behagen des Subjekts in der Kultur 1929‐<strong>2009</strong>. Eine dritte Runde zwi‐<br />
schen Psychoanalyse und Politik)<br />
17h30 Marc Strauss Germe d'un clivage dans la psychanalyse (Keim einer<br />
Spaltung in der Psychoanalyse) 17h55 Diskussion<br />
Freitag, 14. Mai, Abend : Empfang zu einem Umtrunk in der Französi‐<br />
schen Botschaft<br />
Sonntag, 16. Mai, Vormittag Gesprächsleitung Françoise Gorog<br />
9h Karl‐Josef Pazzini, Einige Erfahrungen bei der Konzeption der Bildung<br />
des Analytikers in Deutschland (Quelques expériences au sujet de la<br />
formatipn de l’analyste en Allemagne)<br />
9h25 Muriel Drazien, La loi italienne sur les psychothérapies et son enjeu<br />
pour la psychanalyse (Das italienische Psychotherapiegesetz und seine<br />
Auswirkungen auf die Psychoanalyse) 9h50 Diskussion 10h20 Pause<br />
11h Gesprächsleitung Alain Vanier<br />
Gérard Pommier, La psychanalyse a‐t‐elle un effet sur la politique ?<br />
(Wirkt die Psychoanalyse sich auf die Politik aus?)<br />
11h25 Colette Soler, La politique avec l’inconscient (Die Politik mit dem<br />
Unbewussten)<br />
11h50 Roland Chemama, L’éthique psychanalytique implique‐t‐elle une<br />
politique ? (Impliziert die psychoanalytische Ethik eine Politik ?) 12h15<br />
Diskussion und Schlussworte (R. Chemama, F. Gorog, J‐J. Gorog, C. Hoff‐<br />
mann, A. Vanier, C. Vanier)<br />
Samstag, 15. Mai, Vormittag, Raum A Gesprächsleitung Jean Clam<br />
Cornelius Tauber, Psychoanalyse in der Stadt (Psychanalyse dans la ville)<br />
Jean‐Richard Freymann, Les névroses post‐traumatiques sont‐elles ana‐<br />
lysables ? (Sind die posttraumatischen Neurosen analysierbar ?)<br />
Olivier Douville, De l’introduction de la psychanalyse dans le traitement<br />
des névroses de guerre (Über die Einführung der Psychoanalyse in die<br />
Behandlung der Kriegsneurosen)<br />
Bernhard Schwaiger, « Die eingesperrte Psychoanalyse » : Der Diskurs<br />
der Psychoanalyse in der Institution und die Frage nach Wirksamkeit und<br />
Wahrheit (« La psychanalyse enfermée » : le discours de la psychanalyse<br />
en institution et la question de l’efficacité et de la vérité)<br />
Maria Izabel Oliveira Szpacenkopf, Sur la notion de caractère chez Freud<br />
et quelques considérations quant à la pratique psychanalytique actuelle<br />
(Über den Begriff des Charakters bei Freud und einige Bemerkungen zur<br />
aktuellen psychoanalytischen Praxis)<br />
Samstag, 15. Mai, Vormittag, Raum B Gesprächsleitung Johanna<br />
Vennemann<br />
Maya Malet, Norme et légitimité. Sauver sa peau, sauver la psychana‐<br />
lyse ? (Norm und Legitimität. Seine Haut retten, die Psychoanalyse ret‐<br />
ten ?)<br />
Marc Morali, La fin d’une éthique scientifique (Das Ende einer wissen‐<br />
schaftlichen Ethik)<br />
Michèle Benhaïm, Le maternel dans les textes de Karl Abraham (Das<br />
Mütterliche in den Texten Karl Abrahams)<br />
Anna Tuschling, Ist die Kulturwissenschaft möglicher Mitstreiter für eine<br />
politische Psychoanalyse ? (Pour une psychanalyse politique : est‐ce que<br />
les études de « Culture et Civilisation » sont un partenaire ?)<br />
Anne Ropers, Liens et croisements entre le théâtre expressionniste et la<br />
psychanalyse – le thème du meurtre du père (Hanns Sachs) (Verbindun‐<br />
gen und Kreuzungspunkte zwischen dem expressionistischen Theater<br />
3<br />
MB der AFP <strong>Nr</strong>. <strong>85</strong>/<strong>März</strong> 2010<br />
und der Psychoanalyse – das Thema Vatermord (Hanns Sachs))<br />
Samstag, 15. Mai, Nachmittag, Raum A Gesprächsleitung Jean‐Jacques<br />
Gorog<br />
Dominique Janin‐Pilz, La question de l’étranger dans les associations psy‐<br />
chanalytiques (Das Fremde in den psychoanalytischen Assoziationen)<br />
Hélène Godefroy, De Vienne à Berlin, l’étranger de la psychanalyse (Von<br />
Wien nach Berlin. Das Fremde der Psychoanalyse)<br />
Jean‐Jacques Blévis, La pratique psychanalytique, entre langue et poli‐<br />
tique. Vienne, Berlin, et Jérusalem, entre Freud, Zweig, et Eitingon (Die<br />
psychoanalytische Praxis zwischen Sprache und Politik. Wien, Berlin und<br />
Jerusalem, zwischen Freud, Zweig und Eitingon)<br />
Radu Turcanu, La politique du « retour à Freud ». Le discours du<br />
psychanalyste entre Berlin et l’Amérique (Die Politik der « Rückkehr zu<br />
Freud ». Der Diskurs des Psychoanalytikers zwischen Berlin und Amerika.)<br />
Samstag, 15. Mai, Nachmittag, Raum B Gesprächsleitung Bernhard<br />
Schwaiger<br />
Susanne Gottlob, Enttäuschung des Politischen. Thesen zur Gewalt (La<br />
déception du politique. Thèses sur la violence)<br />
Alain Harly, Peut‐on parler d’un sujet postcommuniste ? (Kann man von<br />
einem post‐kommunistischen Subjekt sprechen ?)<br />
Gorana Bulat‐Manenti, Analyser et transmettre : clinique et transfert(s)<br />
(Analysieren und übermitteln : Klinik und Übertragung(en))<br />
Muriel Mosconi, Du contrôle : Lacan et le débat Budapest‐Berlin. (Über<br />
die Kontrollanalyse : Lacan und die Debatte Budapest‐ Berlin)<br />
Andrée Lehmann, titre non communiqué (Ohne Titel)<br />
Samstag, 15. Mai, Abend, Darstellung der Entwicklung der Berliner Archi‐<br />
tektur im Lauf der letzten Jahrzehnte<br />
‒ Frankfurt am Main<br />
Vorstandssitzung der AFP am 17. April 2010<br />
‒ Hamburg<br />
(WAHL‐)MV der AFP, Fr.‐Sa. 25.‐26. Juni 2010<br />
in Hamburg im Warburg‐Haus; Organisato‐<br />
rin: Susanne Gottlob, HH., e‐mail.<br />
s.gottlob@web.de<br />
‒ Köln<br />
a) André Michels, Kafkas Judentum, 26. April<br />
2010, 16‐17.30 Uhr, Hörsaal B IV (Gebäude der<br />
Universitätsbibliothek), Lehrstuhl für Literaturwis‐<br />
senschaft und Medientheorie. ‒ Was jüdisch an<br />
Kafka ist, gehört zu den schwierigsten und noch<br />
ungeklärten Fragen. Wie soll man ein Judentum de‐<br />
finieren, das weder religiös noch politisch gelebt<br />
wird? Eine Frage, die bereits Freud an eine noch zu<br />
kommende Wissenschaft gestellt hat.<br />
b) textura ‐ Freud Lacan Gruppe Köln in Kooperation<br />
mit dem Englischen Seminar der Universität zu Köln<br />
(Prof. Dr. Beate Neumeier)<br />
Veranstaltungen im Sommersemester 2010<br />
jeweils donnerstags um 20h im Hörsaal XVIII<br />
Hauptgebäude der Universität zu Köln:<br />
RINGVORLESUNG - EINFÜHRUNGEN IN DIE<br />
PSYCHOANALYSE JACQUES LACANS<br />
06.05.2010 Jacques Lacans Psychoanalyse: Wissenschaft<br />
und Häresie. Die Rückkehr des Freudschen<br />
Dings aus der Zukunft I - Dr. Michael Meyer<br />
zum Wischen<br />
20.05.2010 Jacques Lacans Psychoanalyse: Wissenschaft<br />
und Häresie. Die Rückkehr des Freudschen<br />
Dings aus der Zukunft II - Dr. Michael Meyer<br />
zum Wischen<br />
01.07.2010 Weshalb erscheint Draculas Bild nicht<br />
im Spiegel? Psychoanalytische Überlegungen zu<br />
Bram Stokers Romanfigur Graf Dracula - Lic.-<br />
Psych. Cristina Burckas<br />
‒ Linz<br />
NEUES LACANSCHES FELD ÖSTERREICH<br />
Ausgehend von Lacans Text `Meine Lehre` werden wir bei die‐<br />
sem Seminar unter anderem folgende Fragen besprechen:
‐ Was ist lehrbar, was ist übermittelbar, was ist übersetzbar,<br />
was ist übertragbar in der Psychoanalyse von Freud und Lacan?<br />
‐ Was geht dabei verloren und wie kann dieser Verlust genutzt<br />
werden?<br />
‐ Was muss sich der Analytiker aneignen, damit er es vergessen<br />
und als Nichtwissender in der analytischen Stunde zuhören<br />
kann?<br />
‐ Wie handeln, damit Lacans Lehre als Effekt des Rests wirken<br />
kann?<br />
‐ Was passiert beim Werden zum Analytiker mit dem Wissen?<br />
‐ Was sind die klinischen Konsequenzen (anhand von Fallvignet‐<br />
ten)?<br />
Dies ist nur ein Teil der Fragen, die Lacans Text aufwirft und mit<br />
denen wir uns beschäftigen werden.<br />
Bis jetzt zugesagte Beiträge von<br />
Claus Dieter Rath, Karl Josef Pazzini, Avi Rybnicki, Gerhard<br />
Zenaty, <strong>Mitglieder</strong> des Kartells zu `Meine Lehre` und es werden<br />
noch andere folgen<br />
Texte zur Vorbereitung:<br />
‐ Jacques Lacan: Meine Lehre. Turia+Kant, Wien 2008<br />
‐ Claus Dieter Rath: Überraschung. Kritik der Weitergabe. In:<br />
Wie ist Psychoanalyse lehrbar? Jahrbuch für Klinische Psycho‐<br />
analyse ‐ Band 8, Edition Diskord, Tübingen 2008<br />
Ort: Linz, Katholisch‐Theologische Universität,<br />
Bethlehemstrasse 20<br />
Zeit: Samstag 12.6.2010, 10:00 bis 19:00 Uhr<br />
Kosten: € 80.‐ (Tagungsgebühr inkl. Mittagessen und Pausenge‐<br />
tränke)<br />
Anmeldung direkt: www.lacanfeld.at oder via Email:<br />
lacanfeld@gmx.at<br />
Bankverbindung: Neues Lacansches Feld Österreich Sparkasse,<br />
BLZ 20330, Kto.<strong>Nr</strong>. 02104001298 nähere Informationen auf<br />
www.lacanfeld.at<br />
TAGUNG zum Thema EIN UNMÖGLICHER BE‐RUF<br />
ÜBERTRAGUNG ‐ ÜBERMITTLUNG ‐ ANALYTIKER WERDEN<br />
Das Ziel meiner Lehre, nun ja, das wäre, Psychoanalytiker zu<br />
machen, die der Funktion gewachsen wären, die sich das Sub‐<br />
jekt nennt. (Lacan, Meine Lehre, 53)www.lacanfeld.at<br />
‒ Wien<br />
Institut Français de Vienne:<br />
Vorträge zu Geneviève Morel, Das Gesetz der Mutter:<br />
20. <strong>März</strong> 2010 – 14:00 Uhr<br />
Dr. Gabrielle Devallet‐Gimpel – Psychoanalytikerin, Toulouse<br />
„Das Reale des Körpers am Ende der psychoanalytischen Kur.<br />
Kann der Körper die Rolle eines trennenden Elements über‐<br />
nehmen?“<br />
Welche Rolle spielt der Körper außer in Angstzuständen,<br />
Somatisations‐ oder Konversionssymptomen? Welche Stütze<br />
bildet er, wenn am Ende der psychoanalytischen Kur das Sub‐<br />
jekt ohne Einbindung in die Signifikantenkette auskommen<br />
muss, wenn das Subjekt an einem Signifikanten stehenbleibt,<br />
der nur auf Abwesenheit von Sinn hinweist? Angesichts dieser<br />
Sinnesleere, Bedeutungsleere, ist die Konsistenz des Symboli‐<br />
schen geschwächt ( „abgenutzt bis auf die Kette“): der Körper<br />
kann die Furche des Realen ausheben.<br />
Kann das Reale des Körpers, wenn das Fantasma am Ende der<br />
Kur an Konsistenz verliert ( die „psychische Realität“ bei Freud),<br />
eine Stütze für das Subjekt bilden? Kann ein psychosomatisches<br />
Phänomen die verschiedenen Konsistenzen des Realen, Symbo‐<br />
lischen und Imaginären zusammenhalten wie es vorher das<br />
Fantasma tat?<br />
Wir werden zusätzlich zu „Das Gesetz der Mutter“ eine Arbeit<br />
von Jeanne Granon‐Laffont heranziehen, die in diesem Zusam‐<br />
menhang von einer Verdoppelung der realen Konsistenz, von<br />
einem „zusätzlichen“ Realen spricht, das eine zusätzliche Ver‐<br />
knotung im Borromäischen Knoten ermöglicht oder auch eine<br />
„Reparation“ im Sinne einer „Stellvertretung“ (suppléance).<br />
24. April 2010 – 14:00 Uhr<br />
Regula Schindler – Psychoanalytikerin, Zürich<br />
„Symbolische Mutter, realer Vater“<br />
Ist die „symbolische Mutter“ ein Auslaufmodell? Diese frühe<br />
Setzung Lacans (1957/58 im Seminar IV „Relation d’ objet“) mag<br />
im späteren Werk nicht mehr als solche auftauchen, behält je‐<br />
doch ihre Gültigkeit schon insofern, als sie die in manchen Krei‐<br />
4<br />
MB der AFP <strong>Nr</strong>. <strong>85</strong>/<strong>März</strong> 2010<br />
sen stets noch virulente Zuordnung Vater =symbolischer Agent,<br />
Mutter = real/imaginäre Agentin, sprich „Krokodil“, verbietet.<br />
Wir werden das Schema „Frustration/ Privation/ Kastration“,<br />
wo die Mutter als symbolische Agentin der realen Frustrati‐<br />
on/Versagung auftaucht (Sem. IV, 6. 2.1957) als Vorläufer‐<br />
Modell des Knotens R/S/I lesen, und das Schicksal dieser symbo‐<br />
lischen Agentin, und ihres Kumpans, des „realen Vaters“, wei‐<br />
terverfolgen: im Spätwerk Lacans (Sem. RSI, Le Sinthome), in<br />
ausgewählten literarischen Texten, in Fallbeispielen aus der<br />
Praxis.<br />
<strong>19.</strong> Juni 2010 – 14:00 Uhr<br />
Marta Pérez Valverde – Psychoanalytikerin, Wien: «Wege aus<br />
dem Wahnsinn»<br />
Es werden zwei Fälle mit psychotischer Struktur präsentiert. In<br />
einer ersten Vignette entwickelte sich das Sinthom erst im Laufe<br />
der Kur. Die zweite Falldarstellung zeigt, wie eine Patientin im<br />
Verlauf der Analyse ein Sinthom ausarbeiten konnte, mit dem<br />
sie bereits in die Praxis gekommen war.<br />
2.<br />
AFP-Kongess<br />
«Norm-Normalität-Gesetz»<br />
Beiträge auf dem Kongress der AFP<br />
‒ André Michels<br />
Von der „Grundregel“ zur „Grundnorm“<br />
Zur Kritik der normativen Vernunft<br />
1.Teil<br />
Meine These lautet: Die Psychoanalyse ist<br />
vorwiegend Kritik an der normativen Ver‐<br />
nunft. Aus dieser Kritik ist sie hervorgegan‐<br />
gen. Sie ist also kein theoretisches Anhängsel,<br />
sondern wesentlicher Bestandteil der analyti‐<br />
schen Arbeit. Als solcher kommt ihr der Cha‐<br />
rakter der Notwendigkeit zu. Diese These ist<br />
nur haltbar, wenn der dabei verwendete<br />
Normbegriff nicht von außen her als gesell‐<br />
schaftlicher, juristischer, ethischer oder wis‐<br />
senschaftlicher Anspruch, an die Psychoanaly‐<br />
se herangetragen wird, sondern wenn er sich<br />
als eine genuine Leistung des Unbewussten<br />
erweist, wenn er sich erst aufgrund der Arbeit<br />
des und am Unbewussten ergibt. Bei diesem<br />
Thema geht es also um die Eigenständigkeit<br />
(Autonomie) der Psychoanalyse anderen Dis‐<br />
kursen gegenüber. Darüber hinaus gibt es ei‐<br />
nen direkten Bezug zum Thema der „Arbeit“,<br />
mit dem sich der letzte AFP‐Kongress vor 2<br />
Jahren befasst hat, ebenso wie zu jenem der<br />
„Technik“, dem vor genau 20 Jahren ein ande‐<br />
rer Kongress, ebenfalls auch in Karlsruhe, ge‐<br />
widmet war.<br />
Grundregel<br />
Relevant an der Technik ist, dass sie einer<br />
Regel – und zwar der Grundregel – unterliegt.<br />
Diese steht im Zentrum unseres Themas, und<br />
deshalb möchte ich mit ihr anfangen. Die<br />
Grundregel begründet die analytische Praxis.<br />
Die eigentlich spannende Frage ist, wie sie sich<br />
zu Norm und Normativität verhält. Um darü‐
er mehr zu erfahren und einen Vergleich auf‐<br />
stellen zu können, möchte ich zuerst nach dem<br />
Gebrauch der Regel bei Wittgenstein fragen,<br />
etwa in der Darstellung eines Robert B. Bran‐<br />
dom, einem der führenden angelsächsischen<br />
Philosophen der Gegenwart. Er unterscheidet<br />
drei Anwendungsbereiche der Regel bei Witt‐<br />
genstein: einmal sagen die Regeln „explizit,<br />
was man zu tun hat“; zum zweiten besagt Re‐<br />
gel „alles, was diejenigen leitet …, deren Ver‐<br />
halten beurteilt wird, gleichgültig, ob es dis‐<br />
kursiv oder begrifflich gegliedert ist“; schließ‐<br />
lich ist von Regel die Rede, „wenn ein Verhal‐<br />
ten Gegenstand normativer Beurteilung ist,<br />
wenn also eine Verantwortlichkeit zugewiesen<br />
wird, gleichgültig, ob derjenige sich dessen<br />
bewusst ist, wenn er entscheidet, was zu tun<br />
ist.“1 Ich will diese Darstellung nicht weiter<br />
diskutieren. Ähnliche Fragen stellen sich bei<br />
der Formulierung der Grundregel, für die der<br />
Bezug zur Sprache, ebenso wie bei Wittgens‐<br />
tein, ausschlaggebend ist. Es handelt sich um<br />
die Bedingungen der Ausübung der Psycho‐<br />
analyse schlechthin.<br />
Eine erste Formulierung der Grundregel<br />
finden wir bereits in den „Studien über Hyste‐<br />
rie“, eine Vorstufe eigentlich, deren Wortlaut<br />
aber sich in der Folge nicht wesentlich geän‐<br />
dert hat. Freud versucht die Hypnose, die an<br />
die Grenzen der Erinnerungsfähigkeit des Pa‐<br />
tienten gestoßen war, durch einen „kleinen<br />
technischen Kunstgriff“ zu ersetzen oder zu<br />
„verstärken“, wie er annimmt, indem er einen<br />
Druck auf die Stirn des Patienten ausübt und<br />
ihn dazu auffordert, das Bild oder den Einfall,<br />
der sich einstellt, mitzuteilen, „was immer das<br />
sein möge. Er dürfe es nicht für sich behalten,<br />
weil er etwa meine, es sei nicht das Gesuchte,<br />
das Richtige, oder weil es ihm unangenehm<br />
sei, es zu sagen. Keine Kritik, keine Zurückhal‐<br />
tung, weder aus dem Affekt noch aus Gering‐<br />
schätzung! Nur so könnten wir das Gesuchte<br />
finden, so fänden wir es aber unfehlbar.“2 Be‐<br />
merkenswert an der Formulierung ist, das sie<br />
fast gleichbleibend, mit nur kleinen Varianten,<br />
Freuds Werk durchzieht. Der Wortlaut insti‐<br />
tuiert, wie ein Basisaxiom, die Grundregel als<br />
das eigentlich Invariante des psychoanalyti‐<br />
schen Diskurses, der Psychoanalyse als Dis‐<br />
kurs. Sie ist der gemeinsame Bezugspunkt, bei<br />
1 Robert B. Brandom (1994), Expressive Vernunft, Suhrkamp<br />
Verlag, Frankfurt a. M. 2000, S.1<strong>19.</strong><br />
2 Sigmund Freud (1895), Studien über Hysterie, G.W. I, S.270.<br />
5<br />
MB der AFP <strong>Nr</strong>. <strong>85</strong>/<strong>März</strong> 2010<br />
den mannigfaltigsten Orientierungen der Psy‐<br />
choanalyse in mehr als einem Jahrhundert.<br />
Die Grundregel pro‐<br />
duziert den Einfall, eine Funktion des Neuen,<br />
unter der Voraussetzung der „Aufrichtigkeit“<br />
und „Kritiklosigkeit“ dessen, was sich bisher<br />
der Erinnerung und dem Wissen entzogen hat.<br />
Wie konnte Freud jedoch annehmen, dass da‐<br />
bei etwas Anderes als bloßer Unsinn heraus‐<br />
komme? Seine Antwort, die uns noch heute in<br />
Staunen versetzt, besteht in der Umkehrung<br />
der logischen Wertigkeit: der Unsinn ist der<br />
beste Beweis, der Hinweis nämlich, dass wir<br />
das Gesuchte gefunden haben; Freud meint:<br />
das „Richtige“. Es geht um das Finden, Auf‐<br />
finden und um das Richtige, Wahre. Die Psy‐<br />
choanalyse wird von Anfang an als eine Heu‐<br />
ristik definiert, deren Bedingungen die Grund‐<br />
regel festlegt, ein für allemal, wie es scheint. Es<br />
ist der Grundpfeiler, der die Psychoanalyse im<br />
Realen verankert; alles Andere ist theoretischer<br />
Überbau in den verschiedensten Ausrichtun‐<br />
gen. Damit meine ich, dass die Entwicklung<br />
einer Logik des Unbewussten und einer Ethik<br />
der Psychoanalyse stets eine Heuristik voraus‐<br />
setzt.<br />
Die Psychoanalyse ist Erfindungskunst, be‐<br />
vor sie zur Deutungskunst wird. Die eine ist<br />
ohne die andere nicht denkbar. Ihr oberstes<br />
Prinzip ist die Auffindung des Neuen, und nur<br />
unter dieser Bedingung findet Deutung statt.<br />
Wahrscheinlich ohne es zu wissen, jedenfalls<br />
ohne es je hervorgehoben zu haben, macht sich<br />
Freud die talmudische Inspiration zu eigen:<br />
chidush, die Auffindung des Neuen, ist die ein‐<br />
zige Sicherheit, über die wir bei der Deutung<br />
verfügen. Nur unter dieser Voraussetzung fin‐<br />
det sie statt. Es „kann“ also nicht alles gedeutet<br />
werden, ganz im Gegensatz zur Behauptung<br />
eines Karl Popper, der die Psychoanalyse der
Pseudowissenschaftlichkeit bezichtigt hat.<br />
Aber es „darf“ alles gesagt werden. Darf es?<br />
Freud rekonstituiert und reinstituiert das<br />
oberste Prinzip der mündlichen Überlieferung,<br />
die, der Tradition nach, bis auf den Sinai zu‐<br />
rückgeht, d.h. auf die Gabe des Gesetzes<br />
(matanat thora). Es liegt zwar ein Text vor, der<br />
von dem ursprünglichen Ereignis, der Urszene<br />
zeugt, der aber ohne die mündliche Überliefe‐<br />
rung wenig aussagekräftig wäre.<br />
Die Dialektik von Sprache und Schrift, von<br />
mündlicher und schriftlicher Tradition, steckt<br />
das Feld ab, in dem wir uns bewegen. Beiden<br />
geht eine Gabe voraus, ein Eingabe sozusagen,<br />
die – wie „gottgegeben“, im übertragenen Sinn<br />
– den Einfall bedingt. „Gottgegeben“ ist weni‐<br />
ger der Einfall selbst, als das Vertrauen, das<br />
Freud in ihn setzt. Es verleiht dem Einfall nicht<br />
nur die Qualität des „Neuen“, sondern auch<br />
des „Richtigen“, nach dem Prinzip der antizi‐<br />
pierten Sicherheit. Freud bezeichnet es als „un‐<br />
fehlbar“. Unfehlbar ist sein Vertrauen in die<br />
Dimension des Anderen, sein „Zutrauen zur<br />
Strenge der Determinierung im Seelischen“3,<br />
das an der Wende von der Hypnose zur Psy‐<br />
choanalyse wesentlich beteiligt war.<br />
Die Determinierung oder Überdeterminie‐<br />
rung steht an der Wiege der Psychoanalyse.<br />
Sie bestimmt die „Richtigkeit“ des Einfalls, der<br />
wie aus einer höheren Inspiration stammt, und<br />
dem „Fortschritt in der Geistigkeit“ Genüge<br />
leistet, den Freud, wenn ich den „Mann Moses“<br />
richtig lese, auch für sei Lebenswerk, die Psy‐<br />
choanalyse beansprucht.4<br />
Einfall<br />
Was also ist der Einfall? Vom Einfall, als<br />
Produkt der Grundregel erwarten wir uns ei‐<br />
nigen Aufschluss über die „Determinierung im<br />
Seelischen“, sowohl über die Funktionsweise<br />
des psychischen Apparates als auch über die<br />
Logik des Unbewussten. Logik aber besteht im<br />
Verbinden und Schließen, also zunächst in der<br />
Schaffung eines Mittelgliedes (meson, bei Aris‐<br />
toteles). Nichts Anderes erfahren wir über den<br />
Einfall. Er ist nicht immer die „ vergessene “<br />
oder verdrängte Erinnerung, sondern häufiger<br />
„in Mittelglied… in der Assoziationskette…<br />
oder reine Vorstellung, die den Ausgangs‐<br />
3 Sigmund Freud (1923) Psychoanalyse und Libidotheorie, G. W.<br />
XIII, S.214.<br />
4 Sigmund Freud (1939), Der Mann Moses und die monotheistische<br />
Religion, G.W. XVI, S.219-223.<br />
6<br />
MB der AFP <strong>Nr</strong>. <strong>85</strong>/<strong>März</strong> 2010<br />
punkt einer neuen Reihe von Gedanken und<br />
Erinnerungen bildet.“5<br />
Der Einfall selbst ist das Produkt einer logi‐<br />
schen Verflechtung. Während die Assoziation<br />
selbst nicht frei ist, sondern der „Strenge der<br />
Determinierung“ unterliegt, drängt sich die<br />
Frage auf, wie neu denn das Neue ist. Was ist<br />
neu an ihm? Was erlaubt uns vor allem, etwas<br />
als neu zu erkennen? Oder sollten wir eher sa‐<br />
gen: wiederzuerkennen?<br />
Es ist der „Zusammenhang“, d.h. der Kon‐<br />
text oder Text, von dem es mehrere Stufen<br />
oder Schichten gibt, wie bei einem Palimpsest.<br />
Es ist zunächst der Zusammenhang, der „in<br />
Vergessenheit geraten“ war, jedoch „über be‐<br />
kannte Erinnerungen“ wieder zugänglich ge‐<br />
macht wird. Auf einer anderen Stufe bringt die<br />
Grundregel Einfälle, d.h. Erinnerungen hervor,<br />
die längst aus jedem Zusammenhang gerissen<br />
oder gefallen waren, „welche seit vielen Jahren<br />
der Assoziation entzogen waren, aber noch als<br />
Erinnerungen erkannt werden können“. Die<br />
nächste Stufe bezeichnet Freud als „höchste<br />
Leistung der Reproduktion“, nämlich Gedan‐<br />
ken, die der Analysant „niemals als die seini‐<br />
gen anerkennen will, die er [streng genom‐<br />
men] nicht erinnert [und die dennoch] von<br />
dem Zusammenhange unerbittlich gefordert<br />
werden…“. Er fügt hinzu, „dass gerade diese<br />
Vorstellungen den Abschluss der Analyse und<br />
das Aufhören der Symptome herbeiführen“.6<br />
Was den letzten Punkt anbelangt, so sind<br />
wir etwas vorsichtiger geworden und nehmen<br />
im Gegenteil an, dass vom Symptom stets ein<br />
Rest übrigbleibt, vielleicht das Wesentlichste.<br />
Der Abschluss einer Analyse entspricht eher<br />
einer „Umschreibung“, „Überschreibung“ des<br />
Symptoms, als einer Auflösung. Er wird „auf‐<br />
gehoben“, d.h. in seine Teile zerlegt und als<br />
Fragment erhalten, als Ruine einer vergange‐<br />
nen Zeit, die noch vom alten, längst<br />
vergegangenen Ruhm zeugt. Es bleiben also<br />
Spuren vom vergangenen Genießen übrig, die<br />
jedoch nicht alle in die Sprache des Subjekts<br />
übersetzt werden können.<br />
Welches ist dieser Zusammenhang, d.h.<br />
dieser Kontext, der so unerbittlich fordert?<br />
Woher stammt die Kraft der Determinierung,<br />
die an die Stelle der Vordeterminierung tritt,<br />
nicht als Vorschrift, wie die einer Norm, son‐<br />
dern als das, was zu schreiben nicht aufhört (ce<br />
5 Sigmund Freud (1895) Studien über Hysterie, ebd., S.271.<br />
6 Ebd., S.272-273.
qui ne cesse pas de s’écrire) – Lacans Definition<br />
der Notwendigkeit. Der Einfall, der zunächst<br />
wie ein Zufall erscheint, erweist sich demnach<br />
mit einer unerbittlichen Notwendigkeit, als ei‐<br />
ne Forderung des Textes, eine Funktion der<br />
Schrift. Diese drängt mit einer konstanten<br />
Kraft, wie der Trieb. Es ist die eigentliche<br />
Schreibkraft, die über uns verfügt, und zwar<br />
unentwegt, die wir uns aber verfügbar zu ma‐<br />
chen suchen. Sie lässt uns nicht zur Ruhe<br />
kommen, wie Freud im Jahr 1932 schreibt:<br />
„…das Unbewusste schläft vielleicht niemals.“<br />
Der Grund dazu ist unser Triebleben: „Alles,<br />
was sich in unserem Seelenleben tummelt und<br />
was sich in unseren Gedanken Ausdruck<br />
schafft, ist Abkömmling und Vertretung der<br />
mannigfachen Triebe, die uns in unserer leibli‐<br />
chen Konstitution gegeben sind; aber nicht alle<br />
diese Triebe sind gleich lenkbar und<br />
ertziehbar, sich den Anforderungen der Au‐<br />
ßenwelt und der menschlichen Gemeinschaft<br />
zu fügen. Manche von ihnen haben ihren ur‐<br />
sprünglich unbändigen Charakter bewahrt;<br />
wenn wir sie gewähren ließen, würden sie uns<br />
unfehlbar ins Verderben stürzen.“7 „Unfehl‐<br />
bar“ ist die Not in die uns der Trieb versetzt,<br />
sowie die logische Notwendigkeit des Den‐<br />
kens, die sich uns aufdrängt. Wir denken sozu‐<br />
sagen „in Vertretung“ der Triebe, nicht eigen‐<br />
ständig.<br />
Die ganze Denkanstrengung Freuds und<br />
der Psychoanalyse gilt aber dem Erringen die‐<br />
ser Eigenständigkeit, der „Trockenlegung der<br />
Zuyderzee“, d.h. der Urbarmachung der vom<br />
Trieb erschlossenen und beherrschten Gebiete,<br />
um sie in Kulturlandschaften zu verwandeln.<br />
Das oberste Anliegen der Psychoanalyse ist es,<br />
Denken, Sprechen, Handeln der Beherrschung<br />
durch die Triebe zu entreißen. Das Instrument,<br />
über das sie verfügt, ist die Grundregel und<br />
das Mittel die Sprache. Der Übergang vom<br />
Einfall zur Sprache ist eine Hürde, die nicht je‐<br />
der schafft und die nicht in jedem Augenblick<br />
zu schaffen ist. Die Hürde ist eine Folge des‐<br />
sen, was sich im Sagen einschreibt (ce qui s’écrit<br />
dans ce qui se dit), auf das zu hören uns die<br />
Grundregel auffordert. Sie steht am Anfang<br />
der mündlichen Überlieferung, die gleich ur‐<br />
sprünglich mit der schriftlichen ist.<br />
Von der letzten Assoziationsstufe, die erst<br />
in der Endphase einer Analyse zur Sprache<br />
7 Sigmund Freud (1932), Meine Berührung mit Josef Popper-<br />
Lynkeus, G.W. XVI, S.263.<br />
7<br />
MB der AFP <strong>Nr</strong>. <strong>85</strong>/<strong>März</strong> 2010<br />
kommt oder verarbeitet wird, geht eine „uner‐<br />
bittliche Anforderung“ aus, die sich rückwir‐<br />
kend auf die ganze Assoziationskette auswirkt<br />
und darauf hinweist, wie unfrei die „freie As‐<br />
soziation“ ist. Wie ist ihr gegenüber das Neue<br />
des Einfalls zu verstehen? Es ist ein Produkt<br />
der Differenz , die sich aus dem Kontext ergibt<br />
und über ihn hinausführt, in Bezug auf das<br />
kleinste Konstituens des Textes, den Buchsta‐<br />
ben, insofern er die Differenz zu sich selbst<br />
aushält. Das Neue geht aus dieser ursprüngli‐<br />
chen Differenz hervor. Aus dem Schnitt des<br />
Buchstabens, der in jedem Einfall mitwirkt,<br />
mitschreibt und ihm, so zufällig er auch sein<br />
mag, den Charakter der Notwendigkeit ver‐<br />
leiht. Die Grundregel erhebt die Kontingenz in<br />
den Status der logischen Notwendigkeit. Der<br />
Einfall ist jeweils eine Entscheidung und damit<br />
ein Verlust, ein Verzicht auf Welten – so<br />
kommt es dem Analysanten vor –, die nicht<br />
zur Sprache kommen. Es ist die besondere<br />
Schwierigkeit des sogenannten Zwangsneuro‐<br />
tikers, dem oft nichts einfällt, weil er sich nicht<br />
entscheiden kann und so eine Folge von<br />
nichtssagenden oder normierten Aussagen<br />
trifft. Die isoliert betrachtete Norm wäre also<br />
eine Form des Nichts‐Sagens?<br />
Dadurch, dass etwas gesagt wird, kann,<br />
zumindest im gleichen Augenblick, alles An‐<br />
dere nicht gesagt werden. Die Grundregel be‐<br />
fiehlt demnach „alles Ander “ nicht zu sagen,<br />
um den Einfall zu ermöglichen. Er beruht auf<br />
der Negation des Allfaktors. Was zur Sprache<br />
kommt ist eine Ausnahme zu einer der Spra‐<br />
che innewohnenden Norm. Die Negation des<br />
Allfaktors, nämlich alles zu sagen, instituiert<br />
erst die Möglichkeit eines Sagens, das kein<br />
bloßes Sprechen ist. Über die Unmöglichkeit,<br />
nicht alles sagen zu können, stolpert der Psy‐<br />
chotiker. Nicht alles zu sagen macht ihm das<br />
Sagen unmöglich, während es jenes des Neu‐<br />
rotikers erst ermöglicht. Der Einfall als eine lo‐<br />
gische Funktion des „pas‐tout“ (nicht‐Alles)<br />
unterliegt dem Imperativ der Grundregel, das<br />
jenes der Deutung ist, und widersetzt sich der‐<br />
art der normativen Vernunft. Die Vorausset‐<br />
zungen dazu sind „Aufrichtigkeit“ und „Kri‐<br />
tiklosigkeit“.<br />
Aufrichtigkeit<br />
Die Aufforderung an den Analysanten,<br />
„aufrichtig“ und „kritiklos“ zu sein, erweist<br />
sich als die Grundbedingung der analytischen<br />
Praxis. Mit einer erstaunlicher Regelmäßigkeit<br />
tritt sie in Freuds Schriften – von den „Studien
über Hysterie“ (1895) bis zum „Abriss der Psy‐<br />
choanalyse“ (1938) auf. Dort fordert er erneut:<br />
„volle Aufrichtigkeit“, unter der Bedingung<br />
der Kritiklosigkeit: „mit dem Neurotiker<br />
schließen wir also den Vertrag: volle Aufrich‐<br />
tigkeit gegen strenge Diskretion.“8 Es ist die<br />
Voraussetzung der Grundregel auf Seiten des<br />
Analytikers wie des Vertrauens, das ihm der<br />
Analysant entgegenbringt: „… denn wir wol‐<br />
len von ihm nicht nur hören, was er weiß und<br />
vor anderen verbirgt, sondern er soll uns auch<br />
erzählen, was er nicht weiß.“ Was heißt aber<br />
hier: „soll“? Wie kann man von jemandem<br />
fordern, das zu sagen, was er nicht weiß? Die‐<br />
sem Sollen liegt das tiefe „Zutrauen zur Stren‐<br />
ge der Determinierung“ zugrunde. Es ist fast<br />
„wie ein religiöser Glaube“, wie es ein Analy‐<br />
sant formulierte, der einige Schwierigkeiten<br />
empfand, sich auf die Bedingungen der Analy‐<br />
se, d.h. der Grundregel einzulassen. Eine Ana‐<br />
lysantin sagte: „Was Sie von mir verlangen ist<br />
seelischer Striptease.“ Eine andere meinte: „Sie<br />
möchten, dass ich negativ über meinen Vater<br />
rede.“ Wobei sie schon viel mehr gesagt hatte,<br />
als ihr lieb war und sie zu dem Augenblick zu<br />
sagen bereit war.<br />
Das tiefe „Zutrauen“ (emuna) Freuds öffnet<br />
das Tor zu einer anderen Form der Rationali‐<br />
tät, die sich von jener der Naturwissenschaften<br />
strikt unterscheidet. Aufrichtigkeit gilt hier als<br />
Vertrag, deal oder Geschäft: du gibst mir so‐<br />
viel, ich gebe dir soviel zurück. Die „vollste<br />
Aufrichtigkeit“ erhebt Freud 1923 zur<br />
„Pflicht“9<br />
Sie ist nicht zu verwechseln mit der Wahr‐<br />
haftigkeit, aber die Bedingung, dass einer Aus‐<br />
sage etwas Wahres abgewonnen werden kann.<br />
Was ist aber von der Forderung zu erwar‐<br />
ten: „Du sollst nicht lügen!“ oder hebräisch:<br />
„Du wirst nicht lügen!“ Ein Satz, der sich in<br />
die Folge der anderen Sprüche einreiht: „Du<br />
wirst nicht töten! Du wirst nicht begehren das<br />
Haus, den Ochsen, die Frau Deines Nach‐<br />
barn!“ Diese Sprüche – zehn an der Zahl – sind<br />
wie zehn Kategorien des „Triebverzichts“, ei‐<br />
nes Grundgesetzes, das für alle Zeiten und für<br />
alle Menschen gilt: „Geltung“, meint Kelsen,<br />
ist die Form der Existenz der Norm.10 Diese<br />
8 Sigmund Freud (1938), Abriss der Psychoanalyse, G.W. XVII,<br />
S.99.<br />
9 Sigmund Freud (1923), Psychoanalyse und Libidotheorie, ebd.,<br />
S.214.<br />
10 Hans Kelsen, Allgemeine Theorie der Normen, Manz-Verlag,<br />
Wien, 1979, S.101.<br />
8<br />
MB der AFP <strong>Nr</strong>. <strong>85</strong>/<strong>März</strong> 2010<br />
Sprüche haben die Form oder die Struktur des<br />
Zuspruchs. Sie richten sich an ein Du, an Dich<br />
allein: „Du wirst nicht lügen!“ gilt für Dich,<br />
nur für Dich, wie die Tür zum Gesetz bei Kaf‐<br />
ka. Sie steht offen, nur für Dich, an Dir, die Ge‐<br />
legenheit zu ergreifen. Normativ ist die Schaf‐<br />
fung einer individuellen Norm, die nur für<br />
diesen Fall (casus) gilt, aber allgemeinen Prin‐<br />
zipien entspricht. Die Singularität des Zu‐<br />
spruchs: Du wirst nicht…! ist subjektivierend,<br />
insofern es die Unterwerfung unter die<br />
Sprachregel, die eine Spruchregel ist, verlangt.<br />
(Fortsetzung folgt.)<br />
‒ Michael Meyer zum Wischen<br />
Einleitende Worte zur «table ronde»:<br />
Die Lage der Psychoanalyse in verschiedenen<br />
Ländern ‐ „Standardisierung und Normierung<br />
in Psychoanalyse und Psychotherapie“<br />
Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe<br />
Freundinnen und Freunde,<br />
Ende des Jahres 2008 erfuhren wir in der<br />
Kölner Freud‐Lacan Gruppe textura von unse‐<br />
ren englischen Freunden in London, dass in<br />
Großbritannien eine weitgehende Regulierung<br />
und Standardisierung der psychotherapeuti‐<br />
schen, wie psychoanalytischen Praxis bevor‐<br />
steht. So hörten wir, dass zukünftig die analy‐<br />
tische Praxis mit Hilfe nationaler Standards<br />
reguliert und kontrolliert werden soll, wozu<br />
mehr als 450 Einzelregelungen ausgearbeitet<br />
wurden. Zu diesen Bestimmungen gehören<br />
Regulierungen, die quasi alle Aspekte des<br />
Rahmens, der Interventionen und des Stils<br />
festlegen. So geht es zum Beispiel um den<br />
Zeitpunkt, an dem eine Intervention erfolgen<br />
soll, um Vorschriften zur Äußerung „ange‐<br />
messener Gefühle“ bis hin zur Zielsetzung der<br />
Kur. Angesichts der europäischen Dimension<br />
der in Großbritannien drohenden Verschär‐<br />
fung der Rahmenbedingungen unserer Arbeit<br />
haben wir uns in Köln damals entschlossen,<br />
einen Aufruf zur Unterstützung der britischen
Kolleginnen und Kollegen zu formulieren. Wir<br />
schrieben, dass die zur Debatte stehenden<br />
Entwicklungen verkennen, „dass es der Psy‐<br />
choanalyse nicht um das statistisch<br />
Normierbare, das schnell Fassbare und Fixier‐<br />
bare geht, sondern um das Einzigartige des<br />
Sprechens in der Begegnung von Analysant<br />
und Analytiker, die sich dabei auf Spielregeln<br />
bezieht, „die ihre Bedeutung aus dem<br />
Zusammenhange des Spielplans schöpfen<br />
müssen.“ (Sigmund Freud: Zur Einleitung der<br />
Behandlung (1913), GW VIII, S.454). Der Unter‐<br />
schied zwischen der analytischen Kur und ei‐<br />
ner normierten und standardisierten Therapie<br />
besteht nicht zuletzt in einem je anderen Ver‐<br />
hältnis zum Benennbaren. Lacan sagt dazu im<br />
zweiten Seminar: „Das Begehren, die zentrale<br />
Funktion für jede menschliche Erfahrung, ist<br />
Begehren nach nichts Benennbaren. Und es ist<br />
dieses Begehren, das gleichzeitig an der Quelle<br />
jeglicher Lebendigkeit ist.“ 11 Wie also könnte<br />
ein solcher lebendiger Prozess wie die analyti‐<br />
sche Kur domestiziert werden?<br />
Wir haben unseren Appell auf verschie‐<br />
densten Wegen an die Öffentlichkeit versandt<br />
und waren überrascht und erfreut, dass<br />
schließlich fast 400 Personen die Resolution<br />
unterschrieben. In den folgenden Monaten ha‐<br />
ben wir über verschiedene Aspekte dessen ge‐<br />
sprochen, was der Normierung unserer Arbeit<br />
entgegensteht: so zum Beispiel, dass das Krite‐<br />
rium der Übereinstimmung, das in Normie‐<br />
rungsprozessen eine große Rolle spielt, für<br />
psychoanalytisches Arbeiten nicht gelten kann.<br />
Denn dies dreht sich gerade um das, was nicht<br />
übereinstimmt, nicht zur Korrespondenz<br />
kommt und der Komplementarität entgeht. So<br />
kann die Übereinstimmung zwischen Analyti‐<br />
ker und Analysant sogar Hinweis auf einen<br />
Widerstand gegen das Fortschreiten der Ana‐<br />
lyse sein. Eine Übereinstimmung der Kur mit<br />
einem Ideal für ihren Ablauf würde den Ana‐<br />
lysanten der Möglichkeit berauben, sein eige‐<br />
nes Symptom als singuläre Erfindung auszu‐<br />
arbeiten. Wie sollte man zudem das Auftreten<br />
von Fehlleistungen oder unbewusste Inszenie‐<br />
rungen regulieren, wie einen Standard für die<br />
vielfältigen Verwicklungen der Übertragung<br />
finden? Wenn zum Beispiel ein Patient, der<br />
sich in analytischer Psychotherapie befindet,<br />
11 Jacques, Lacan (1991): Das Seminar, Buch II: Das Ich in der<br />
Theorie Freuds und in der Technik der Psychoanalyse (1954/55).<br />
Übersetzung ins Deutsche durch Hans-Joachim Metzger.<br />
Quadriga Verlag, Weinheim, Berlin, S.284.<br />
9<br />
MB der AFP <strong>Nr</strong>. <strong>85</strong>/<strong>März</strong> 2010<br />
im Rahmen einer standardisierten Befragung<br />
einer Krankenkasse zur Entwicklung der The‐<br />
rapie angäbe, dass er Abbruchgedanken habe,<br />
so kann dies für die Psychoanalyse auf ver‐<br />
schiedenes hinweisen und nicht nur darauf,<br />
dass diese Arbeit schlecht läuft. Man müsste<br />
vor allem die Assoziationen des Patienten zum<br />
Wort „Abbruch“ hören, dieses als Signifikant<br />
aufnehmen und nicht als Zeichen für einen de‐<br />
finierbaren Stand des Prozesses, in dem sich<br />
Analysant und Analytiker in der Übertragung<br />
befinden. Die Psychoanalyse geht also von ei‐<br />
ner Kluft aus, nicht von einer Harmonie. Ein<br />
neu auftretendes Symptom, das als Störung<br />
bezeichnet werden könnte, hat uns etwas zu<br />
sagen. Im elften Seminar spricht Lacan von der<br />
Diskontinuität, die das Unbewusste und seine<br />
Bildungen ausmacht. Das Unbewusste mani‐<br />
festiert sich als „Anecken, Misslingen,<br />
Knick“ 12 , als Straucheln. Es sind diese Kenn‐<br />
zeichen des Unbewussten, die zu den Überra‐<br />
schungen und Erfindungen jeder einzelnen<br />
Kur führen, die sich der Standardisierung ent‐<br />
ziehen. Es geht, wie Lacan mit Bezug auf<br />
Theodor Reik unterstrich, um das Überra‐<br />
schende dessen, „was sich in dieser Kluft pro‐<br />
duziert.“ 13 Reglementierung und Standardisie‐<br />
rung widersetzen sich als solche der Überra‐<br />
schung und haben für das Scheitern nichts üb‐<br />
rig – wobei das Scheitern des Unbewussten,<br />
wie der späte Lacan in einer Homophonie an‐<br />
klingen lässt, die Liebe ist.<br />
Diese Überlegungen betreffen auch die<br />
zentrale Bedeutung der Übertragung für die<br />
analytische Kur. Eine an einer Normalität ori‐<br />
entierte Übertragung bestünde darin, sie zum<br />
Maßstab der Realitätsanpassung des Patienten<br />
zu machen und die Dimension des Realen, ei‐<br />
nes Jenseits des Sinns, völlig auszuklammern.<br />
Dies hieße also, die Übertragung auf die Reali‐<br />
tät zurückzuführen, „deren Repräsentant der<br />
Analytiker ist“ und würde dazu führen, wie es<br />
Lacan 1958 formulierte, „das Objekt in der<br />
Treibhausluft einer geschlossenen Situation<br />
heranreifen zu lassen“. 14 Lacan fragt: „Und<br />
was hat die absurde Hymne an die Harmonie<br />
des Genitalen mit dem Realen zu tun? Ist es an<br />
uns Eros, den schwarzen Gott, umzufrisieren<br />
12 Lacan, J. (1996): Das Seminar, Buch XI: Die vier Grundbegriffe<br />
der Psychoanalyse (1964). Übersetzung ins Deutsche durch<br />
Norbert Haas. Quadriga Verlag, Weinheim, Berlin, S.31.<br />
13 Ibid.<br />
14 Lacan, J. (1996): Die Ausrichtung der Kur und die Prinzipien<br />
ihrer Macht. In: Schriften I. Übersetzung ins Deutsche von<br />
Norbert Haas. Quadriga Verlag, Weinheim, Berlin, S.197.
zum Lockenschaf des guten Hirten?“ 15 Zu ei‐<br />
nem solchen droht jedoch der Analytiker zu<br />
werden, wenn er die an einer normativen Rea‐<br />
lität orientierten Irrungen seiner Schäflein zu<br />
korrigieren aufgerufen wird. Der beste Hirte<br />
wäre dann der, der zu belegen vermag, dass<br />
seine Herde genau das blökt, was in der jewei‐<br />
ligen Einzäunung seiner Stallungen als Anzei‐<br />
chen guter Gesundheit gehört und bewertet<br />
wird.<br />
In Zusammenarbeit mit Anna‐Elisabeth<br />
Landis sprachen wir in Köln angesichts der<br />
Evaluierungsdebatte über die Herausforde‐<br />
rung, nicht einfach in einer defensiven Position<br />
zu verharren, sondern selber Qualitätskriterien<br />
psychoanalytischer Arbeit zu entwickeln. Es<br />
scheint mir wichtig, unsere Kritik an Standar‐<br />
disierung und Reglementierung nicht mit der<br />
Notwendigkeit zu verwechseln, darüber zu<br />
sprechen, was die Qualität psychoanalytischer<br />
Arbeit ausmacht. Dies entspricht dem Freud‐<br />
schen Junktim von Heilen und Forschen. 16<br />
In einer weiteren Etappe der Vorbereitung<br />
dieser Karlsruher Tagung wurde deutlich, dass<br />
es auch innerhalb der Psychoanalyse normie‐<br />
rende Tendenzen geben kann. Auch die lacan‐<br />
sche Theorie und Praxis ist vor solchen Gefah‐<br />
ren nicht gefeit. Vor allem scheint mir das<br />
Konzept der symbolischen Verankerung des<br />
Subjekts durch die Struktur, die Lacan den<br />
„Namen‐des‐Vaters“ nennt, zu onto‐<br />
logisierenden, theologisierenden und naturali‐<br />
sierenden Fehldeutungen Anlass geben zu<br />
können, die den Psychoanalytiker zu einem<br />
Symbolisierungsbeauftragten machen würden.<br />
Eine solche Schieflage scheint mir nicht nur auf<br />
eine ungenaue Lektüre auch des frühen Lacan<br />
hinzuweisen, sondern vor allem sein Spätwerk<br />
außer Acht zu lassen, das die Äquivalenz der<br />
drei Register des Realen, Symbolischen und<br />
Imaginären unterstreicht und als Ziel der Kur<br />
eine je singuläre Verknotung dieser drei Di‐<br />
mensionen anvisiert. Dazu gehört die Relati‐<br />
vierung der symbolisch‐väterlichen Dimensi‐<br />
on, die durchaus auch zu deletären Folgen für<br />
das Subjekt führen kann, wenn sie nicht in ei‐<br />
ner Art Zurückhaltung bleibt. Ich zitiere aus<br />
RSI: „Nicht die Normalität ist die herausra‐<br />
gende väterliche Tugend, sondern einzig das<br />
richtige Mi‐dieu, im Moment gesagt, also das<br />
richtige Nicht‐Gesagte...nichts Schlimmeres als<br />
15 Ibid..., S.196.<br />
16 Freud, S. (1927): Zur Frage der Laienanalyse. In: GW XIV,<br />
S.293.<br />
10<br />
MB der AFP <strong>Nr</strong>. <strong>85</strong>/<strong>März</strong> 2010<br />
der Vater, der über alles das Gesetz verlauten<br />
lässt – vor allem kein Erzieher Vater, eher noch<br />
einen, der jenseits einer jeden Machtausübung<br />
steht.“ 17<br />
Das Spätwerk Lacans hat seine von Anfang<br />
an zentrale Behauptung, dass das Ziel der<br />
Analyse nicht in der Identifizierung mit dem<br />
Analytiker bestehen könne, weiter ausgearbei‐<br />
tet. Im Seminar „LʹInsu...“ geht Lacan soweit,<br />
auch das Unbewusste als Referenzpunkt der<br />
Identifizierung zurückzuweisen, da dies die<br />
Abhängigkeit vom großen Anderen als Ort der<br />
Signifikanten perpetuieren würde. Er sagt:<br />
„Also worin besteht diese Verortung, die die<br />
Analyse darstellt? Wäre es, wäre es nicht, sich<br />
zu identifizieren, sich zu identifizieren unter<br />
Vorsichtsmaßnahmen, einer Art Distanz, sich<br />
zu identifizieren mit seinem Symptom?“ 18 Die‐<br />
se 1976 von Lacan eingenommene Position war<br />
bereits zuvor in RSI mit einer wichtigen For‐<br />
mulierung vorbereitet worden: „Ich definiere<br />
das Symptom durch die Art, wie ein jeder das<br />
Unbewusste genießt, insofern das Unbewusste<br />
ihn bestimmt.“ 19 Am Ende der Analyse kann<br />
sich das Subjekt, so es gut geht, mit der Art<br />
und Weise identifizieren, wie es des Unbe‐<br />
wussten genießt, eines Unbewussten, das ihn<br />
zugleich durch die Signifikanten bestimmt.<br />
Dies ist ein Prozess, in dem sich für das Sub‐<br />
jekt ein Eichmaß, eine Norma, produziert, was<br />
jedoch eine Normierung durch den Analytiker<br />
ausschließt. Weder der gute Hirte, noch der<br />
Erzieher, noch der Gesetzgeber sind also Refe‐<br />
renzpunkte des Analytikers.<br />
Gerade das Werk Jacques Lacans macht auf<br />
die Gefahr aufmerksam, dass wir unsere Ana‐<br />
lysanten auf die scheinbar „normale Begier‐<br />
den“ zu orientieren suchen. So schreibt er:<br />
„Wer heute den Traum als Instrument für die<br />
Analyse verschmäht, hat, wie wir sehen konn‐<br />
ten, sicherere und direktere Wege gefunden,<br />
den Patienten auf gute Grundsätze zurückzu‐<br />
führen und auf normale Begierden, die den<br />
wahren Bedürfnissen Genüge tun. Welchen?<br />
Den Bedürfnissen von jedermann, mein Lieber.<br />
Wennʹs das ist, was Dir Angst macht, so ver‐<br />
traue Deinem Analytiker, steig auf den Eiffel‐<br />
turm und sieh, wie herrlich Paris ist. Schade<br />
17 Lacan, J. (1974/75): Das Seminar, Buch XXII: RSI. Arbeitsmaterialien<br />
2 des Lacan Archiv Bregenz, S.24.<br />
18 Lacan, J. (1976/77): Das Seminar, Buch XXIV: L'insu que sait<br />
de l'une bévue s'aile à mourre, Arbeitsmaterialien 4 des Lacan<br />
Archivs Bregenz. Übersetzung ins Deutsche durch Max Kleiner,<br />
S.2.<br />
19 Lacan, J. (1974/75): Das Seminar, Buch XXII: RSI..., S.37.
nur, dass schon einige von der ersten Etage<br />
aus über die Brüstung springen, und justament<br />
solche, deren Bedürfnisse sämtlich auf das<br />
richtige Maß zurückgeführt worden sind. Ne‐<br />
gative therapeutische Reaktion, nennen wir<br />
das. Gott sei Dank geht die Verweigerung<br />
nicht bei allen so weit. Das Symptom bricht<br />
ganz einfach wieder durch wie wildes Gras:<br />
Wiederholungszwang.“ 20 Aus diesen Worten<br />
Lacans hören wir, dass es uns nicht nur um ei‐<br />
ne Kritik der von gesellschaftlichen Instanzen<br />
kommenden Normierungstendenzen gehen<br />
kann, sondern um eine ständige Befragung un‐<br />
serer eigenen Arbeit. Nicht so selten stellen<br />
sich hartnäckig insistierende Symptome unse‐<br />
rer Analysanten oder gar bedrohliche acting<br />
outs als Folgen der Widerstände des Analyti‐<br />
kers dar, nicht zuletzt seinen Ideen von Nor‐<br />
malität. Die in Kontrollen, Supervision und<br />
klinischen Gruppen erfolgende Erforschung<br />
der Kur und der Interventionen des Analyti‐<br />
kers mit ihren Folgen ist ein besonders wichti‐<br />
ges Moment einer analytischen Qualitätssiche‐<br />
rung. Es geht dabei immer wieder um die vom<br />
Analytiker ausgehenden Widerstände und La‐<br />
can wurde nicht müde zu unterstreichen, dass<br />
„der Analytiker Widerstand leistet, wenn er<br />
nicht versteht, womit erʹs zu tun hat…“ 21<br />
Angesichts der vielfältigen Strebungen der<br />
Standardisierung der psychoanalytischen Pra‐<br />
xis und den Versuchen, das Ende einer analy‐<br />
tischen Arbeit festzulegen, erscheint mir be‐<br />
sonders wichtig, gerade dieser Frage weiter<br />
nachzugehen. Der Ruf nach Reglementierung<br />
wird vielleicht gerade dann lauter, wenn wir<br />
selber uns zu wenig über unsere Begriffe, un‐<br />
sere Theorie und die sich daraus ergebenden<br />
Konsequenzen im Klaren sind. Das heißt auch,<br />
Lacans düsteres Diktum ernst zu nehmen:<br />
„Das Abstumpfen der Technik durch fort‐<br />
schreitenden Theorieverlust kennt keine Gren‐<br />
ze.“ 22 So gibt es wichtige Fragen, die das Ende<br />
der Kur betreffen, an denen weiterhin zu arbei‐<br />
ten ist, zum Beispiel was wir unter einer ver‐<br />
änderten Libidoökonomie am Ende der Kur<br />
verstehen, was es heißt, wie Lacan es im XI.<br />
Seminar sagte, „den Trieb zu leben?“ 23 Diese<br />
20 Ibid., S.215.<br />
21Jacques, Lacan (1991): Das Seminar, Buch II: Das Ich in der<br />
Theorie Freuds und in der Technik der Psychoanalyse (1954/55),<br />
S.290.<br />
22 Lacan, J. (1996): Die Ausrichtung der Kur und die Prinzipien<br />
ihrer Macht..., S.199.<br />
23 Lacan, J. (1996): Das Seminar, Buch XI: Die vier Grundbegriffe<br />
der Psychoanalyse (1964)..., S.288.<br />
11<br />
MB der AFP <strong>Nr</strong>. <strong>85</strong>/<strong>März</strong> 2010<br />
Frage ist vermutlich auch für alle regulieren‐<br />
den Instanzen, wo immer sie lokalisiert sein<br />
mögen, eine Frage der Angst.<br />
Wir haben im Vorfeld der Tagung eine<br />
Sammlung von Fragen erstellt, die wir unseren<br />
Gästen vorgelegt haben. Ein jeder wird sich zu<br />
den ihm oder ihr besonders wichtigen Aspek‐<br />
ten zuerst in einem kurzen Statement äußern.<br />
Diese Fragen beziehen sich auf die in den un‐<br />
terschiedlichen Ländern (Deutschland, Frank‐<br />
reich, Großbritannien und Israel) geltenden<br />
gesetzlichen Regelungen für Psychoanalyse<br />
und Psychotherapie, ihren Einfluss auf die<br />
analytische Praxis und darauf, welche Konflik‐<br />
te sie für die Analytiker hervorrufen können.<br />
Wir interessierten uns aber auch dafür, welche<br />
anderen gesellschaftlichen Normierungspro‐<br />
zesse außerhalb staatlicher Regulierung Ein‐<br />
fluss auf die Kur nehmen könnten und wenn ja<br />
in welcher Weise. Nicht zuletzt wollten wir<br />
gerne wissen, welche Rolle bei diesen Schwie‐<br />
rigkeiten den analytischen Assoziationen,<br />
Schulen und anderen Gesellungen zukommt<br />
und wieweit in ihnen selbst Normierungspro‐<br />
zesse stattfinden.<br />
Ich freue mich also nun sehr über das, was<br />
wir aus den verschiedenen Ländern hören<br />
werden, auf den Austausch untereinander und<br />
mit Ihnen, die zu unserer Tagung gekommen<br />
sind.<br />
Michael Meyer zum Wischen, Köln/Paris<br />
‒ Gabrielle Devallet‐Gimpel<br />
Zur Lage der Psychoanalyse in Frankreich<br />
Fragen:<br />
1. Welche Wirkungen und welche Folgen<br />
haben Gesetze und gesetzliche Regelungen in<br />
Ihrem Land auf Ihre Tätigkeit als Psychoanaly‐<br />
tiker oder Psychotherapeut?<br />
Die gesetzliche Regelung der Ausbildung<br />
der Psychoanalytiker und der Ausübung der<br />
Psychoanalyse in Frankreich kann schwerwie‐<br />
gende Folgen haben: es hängt davon ab, ob die
neue gesetzliche Regelung angewandt wird<br />
und wie sie angewandt wird.<br />
Im Artikel 52 des Gesetzes vom 9. August<br />
2004 erscheint zum ersten Mal in der französi‐<br />
schen Geschichte das Wort „Psychoanalyse“ in<br />
einem Gesetzestext (Das Gesetz <strong>Nr</strong>. 2004‐806<br />
und das Dekret <strong>Nr</strong>. XXX, siehe: Marie‐Noël<br />
Godet, „Des Psychothérapeutes d’Etat à l’Etat thé‐<br />
rapeute“, Paris, L’Harmattan, <strong>2009</strong>, S.43 u. 63).<br />
Seit der Abgeordnete Accoyer am 8. Okto‐<br />
ber 2003 seinen Vorschlag zur Revidierung des<br />
Gesetzes gemacht hatte, um den Titel „Psycho‐<br />
therapeut“ gesetzlich zu schützen und damit<br />
die französische Bevölkerung vor Scharlatanen<br />
und Sekten zu bewahren, ging eine hitzige<br />
Diskussion durch die psychoanalytische Ge‐<br />
meinschaft Frankreichs: ist die Psychoanalyse<br />
von einem Psychotherapie‐Gesetz betroffen?<br />
Gehört sie zu den Psychotherapien? gehört die<br />
psychoanalytisch ausgerichtete Psychotherapie<br />
zur Psychoanalyse? Auf jeden Fall kann sie<br />
nur von ausgebildeten Psychoanalytikern aus‐<br />
geführt werden. Die Psychotherapie, sagt La‐<br />
can in „Télévision“, tamponiert mit Sinn, um<br />
den Schmerz zu lindern, schläfert aber das<br />
Subjekt ein (zitiert in: Geneviève Morel, „La loi<br />
de la mère“, Paris, Economica, 2008, S.200). Die<br />
französischen psychoanalytischen Vereinigun‐<br />
gen traten aufgesplittert in die Verhandlungen<br />
mit dem Gesundheitsministerium ein.<br />
Der Vorschlag Accoyer (2003) sah vor, dass<br />
die verschiedenen Arten von Psychotherapien<br />
durch Erlass vom Gesundheitsministerium<br />
festgesetzt würden, dass sie nur von Psychia‐<br />
tern, Ärzten oder diplomierten Psychologen<br />
ausgeübt werden dürften. Die Psychothera‐<br />
peuten, die schon seit fünf Jahren tätig seien,<br />
die weder Mediziner noch Diplompsychologen<br />
seien, müssten sich drei Jahre nach der Be‐<br />
kanntgabe des Gesetzes einer Prüfung unter‐<br />
ziehen und ihre theoretischen und praktischen<br />
Kenntnisse von einer Jury bewerten lassen<br />
(évaluer). Das Gremium würde durch Erlass<br />
vom Gesundheitsministerium ernannt.<br />
Von Oktober 2003 bis Ostern 2004 spielte<br />
sich darauf in Frankreich „Der verfehlte Tot‐<br />
schlag der Psychoanalyse» ab (siehe: Agnès<br />
Aflalo, „L’assassinat manqué de la psychanalyse“,<br />
Nantes, Editions Cécile Defaut, <strong>2009</strong>). Die Psy‐<br />
chotherapie und die Psychoanalyse sollten der<br />
Medizin ein‐ und untergeordnet werden. Die<br />
Zulassungsgremien sollten aus Universitäts‐<br />
medizinern bestehen. Ein Bericht des INSERM<br />
(Institut national de la santé et de la recherche<br />
12<br />
MB der AFP <strong>Nr</strong>. <strong>85</strong>/<strong>März</strong> 2010<br />
médicale) schloss auf die höhere Effizienz der<br />
Verhaltenstherapie, die Methode dieser Unter‐<br />
suchung wurde anschließend kritisiert und der<br />
Bericht vom Gesundheitsminister selbst zu‐<br />
rückgenommen. 2005 erschien „Das Schwarz‐<br />
buch der Psychoanalyse“ („Le livre noir de la<br />
psychoanalyse“). Die Ärzte erhielten Richtlinien<br />
zur Behandlung psychischer Störungen von<br />
der Haute Autorité en Santé mit der ausschliess‐<br />
lichen Indikation von Verhaltenstherapien für<br />
alle neurotischen Angstzustände, ohne Aus‐<br />
nahme.<br />
2. Das Gesetz vom 9. August 2004 definiert<br />
die Berechtigung, den Titel „Psychotherapeut“<br />
zu tragen, der Titel ist von nun an für die Be‐<br />
rufstherapeuten (professionnels) reserviert, die<br />
im nationalen Register der Psychotherapeuten<br />
eingetragen sind. Diese Liste wird vom Präfekt<br />
regelmäßig aktualisiert und der Öffentlichkeit<br />
zugänglich gemacht. Sie enthält die Ausbil‐<br />
dungen und Qualifikationen der Fachkräfte<br />
(professionnels). Rechtens können eingeschrie‐<br />
ben werden: die Ärzte, die Diplompsycholo‐<br />
gen und die Psychoanalytiker, die regelmäßig<br />
in den <strong>Mitglieder</strong>listen ihrer Vereinigungen<br />
aufgeführt sind. Dieses Zugeständnis wurde<br />
nach langem Streit den Psychoanalytikern ge‐<br />
macht. Und erhob weitere Fragen, wie zum<br />
Beispiel: wer beurteilt welche Vereinigung ihre<br />
<strong>Mitglieder</strong>liste vorlegen darf?<br />
Die praktischen Verfügungen (modalités<br />
d’application) sollen noch durch ein weiteres<br />
Dekret definiert werden: die Bestimmungen<br />
über die theoretische und praktische Ausbil‐<br />
dung in klinischer Psychopathologie der zu‐<br />
künftigen staatlich geprüften Psychotherapeu‐<br />
ten, was mit dem Dekret vom 5. <strong>März</strong> <strong>2009</strong> ge‐<br />
regelt werden sollte.<br />
Eine Folge dieses Textes war, dass die psy‐<br />
chotherapeutischen Vereinigungen ihren Titel<br />
um „…und Psychoanalyse“ verlängerten und<br />
dadurch zu den „Rechtens“ gezählt werden<br />
wollten. Die Frage erhob sich, ob die Zulas‐<br />
sung der <strong>Mitglieder</strong>listen die Bildung einer<br />
Psychoanalytikerkammer benötigt. An diesem<br />
Zeitpunkt hatten die öffentlichen Behörden<br />
(pouvoir public) erkannt, dass die Ausübung<br />
der Psychoanalyse weder medizinisch noch<br />
universitär erfasst werden könnte.<br />
Das Dekret vom 5. <strong>März</strong> <strong>2009</strong> bestimmt zu‐<br />
sätzlich, dass die Ausbildung in klinischer<br />
Psychopathologie der zukünftigen Psychothe‐<br />
rapeuten den Ärzten und Diplompsychologen<br />
mit einem Master 2 in Psychologie oder Psy‐
choanalyse vorbehalten ist. Die Ärzte, Psycho‐<br />
logen und regelmäßig auf <strong>Mitglieder</strong>listen re‐<br />
gistrierten Psychoanalytiker können teilweise<br />
oder ganz von dieser Ausbildung in klinischer<br />
Psychopathologie befreit (dispensé) werden.<br />
Für die „weder‐noch“ gibt es Übergangslö‐<br />
sungen(?). Die Ausbildungsinstitute werden<br />
gesetzlich zugelassen. Die Psychotherapeuten‐<br />
Vereinigungen beantragen ihre Genehmigung<br />
als Ausbildungsinstitut. Die ursprüngliche Ab‐<br />
sicht, die Bevölkerung vor Scharlatanen und<br />
Sekten zu schützen, scheint nicht ganz erfüllt<br />
zu sein. Die Ausbildung zum Psychoanalytiker<br />
und seine Anerkennung liegen in den Händen<br />
der Universität und in den Händen der großen<br />
psychoanalytischen Assoziationen. Die Psy‐<br />
choanalytiker, die nicht der illegalen Aus‐<br />
übung der Psychotherapie angeklagt werden<br />
wollen, müssen in einer „anerkannten“ psy‐<br />
choanalytischen Vereinigung unterkommen.<br />
Das Psychologiestudium ist entwertet. Wo<br />
bleibt die „Laienanalyse“? Was natürlich hin‐<br />
derlich war und bleibt, ist der Mangel an Ver‐<br />
ständigung und Austausch unter den psycho‐<br />
analytischen Assoziationen in Frankreich!<br />
Wenn Sie in Ihrem Land zu einer Zulas‐<br />
sung zum öffentlichen Gesundheitssystem<br />
verpflichtet sind, führt dies für Sie zu Konflik‐<br />
ten als Psychoanalytiker oder Psychothera‐<br />
peut?<br />
Bisher besteht noch die Möglichkeit, die<br />
Psychoanalyse „uneingeschrieben“ auszuüben.<br />
Wie lang noch?<br />
3. Führt Ihre theoretische oder ethische<br />
Ausrichtung als Analytiker oder Psychothera‐<br />
peut zu Konflikten mit der staatlichen Autori‐<br />
tät oder mit den Krankenkassen?<br />
Die staatlich vorgeschriebene Ausbildung<br />
in klinischer Psychopathologie wird zeigen,<br />
wie groß der Unterschied sein wird.<br />
Zurzeit gibt es in Frankreich verschiedene<br />
Zusatzversicherungen (z.B. Die MGEN), die<br />
einen kleinen Teil der Honorare für psycho‐<br />
analytische Sitzungen zurückerstatten. Dazu<br />
braucht der Patient eine psychiatrische oder<br />
pediatrische Verschreibung, und der Psycho‐<br />
analytiker muss auf der präfektoralen Liste<br />
stehen! (Wie kann ein Psychiater eine Psycho‐<br />
analyse verschreiben?)<br />
4. Beobachten Sie soziale oder staatliche<br />
Tendenzen zur Entwicklung und Zwangsein‐<br />
führung weiterer restriktiver Normen in Ihrer<br />
Tätigkeit? Beeinflussung aus dem wissen‐<br />
schaftlichen Diskurs, aus der Politik, bestehen<br />
13<br />
MB der AFP <strong>Nr</strong>. <strong>85</strong>/<strong>März</strong> 2010<br />
Veränderungen in der Haltung oder den Wer‐<br />
ten im sozialen Umfeld und in Ihren Patien‐<br />
ten?<br />
Eine starke Tendenz ist die Evaluation (ein<br />
Bewertungsprinzip, eine Art Qualitäts‐ und<br />
Verlaufskontrolle), die sich in den Kranken‐<br />
häusern und heilpädagogischen Einrichtungen<br />
breitmacht. Anfangs (Regierung Rocard,<br />
Gesundheitsminister Evin) ging es darum, das<br />
Gesundheitswesen effizienter zu machen, den<br />
spärlicher werdenden Finanzen anzupassen,<br />
die Willkür einzelner Chefärzte einzugrenzen,<br />
den Heilberufen die Verantwortung aufzuer‐<br />
legen, die Steuergelder nicht zu verschwen‐<br />
den. Kurz: die Verwaltung sollte das letzte<br />
Wort haben. (Wie viel kostet ein Tag Kranken‐<br />
hausaufenthalt?)<br />
Mit epidemiologischen Mitteln sollte die<br />
Wirksamkeit von Behandlungen geprüft wer‐<br />
den: die Behandlung einer psychotischen Ent‐<br />
gleisung wie die Behandlung eines Herzin‐<br />
farkts: eine Art Qualitätskontrolle der psychi‐<br />
atrischen Behandlung. Wie in der Industrie<br />
oder im Lebensmittelbereich. Ein neues Mana‐<br />
gement breitet sich in den Heilanstalten (Insti‐<br />
tutionen) aus: alle „nicht‐produktive“ Zeit wie<br />
Versammlungen (réunion), Essen‐zubereiten<br />
und Miteinander‐ essen auf Kinderstationen<br />
wird überflüssig. Es handelt sich um Rentabili‐<br />
tät.<br />
Das Subjekt findet in diesem Konzept kei‐<br />
nen Platz: im finanziellen, quantifizierbaren<br />
Diskurs wird es als „subjektives“ abgetan, als<br />
unzuverlässig, unfassbar abgelehnt. (Siehe:<br />
Bernhard Schwaiger, „Die Psychoanalytische<br />
Klinik als Sub‐Version der Institution“, Freud‐<br />
Lacan‐Gesellschaft Berlin, Dezember 2003).<br />
Gleichzeitig erscheint eine Wendung von<br />
der „psychischen Krankheit, Geisteskrankheit“<br />
(die behandelt werden kann) zur „psychischen<br />
Gesundheit, Geistesgesundheit“ (als Präventi‐<br />
on), die seit 1978 von der Organisation mondiale<br />
de la Santé (OMS) angestrebt wird. Die psychi‐<br />
sche Gesundheit ist mit naturwissenschaftli‐<br />
chen Mitteln nicht fassbar, es handelt sich um<br />
das Genießen, um den Mehrwert, um das Ob‐<br />
jekt (a) Lacans. Jedes Subjekt hat seine eigene<br />
Weise, dem Objekt‐Grund des Begehrens<br />
(cause du désir) entgegenzugehen, dieses Objekt<br />
ist für immer verloren und kann daher auf<br />
Fragebogen nicht formuliert werden. Der na‐<br />
turwissenschaftliche Determinismus ist auf das<br />
Genießen nicht anwendbar, es ist gesetzlos,<br />
gehört auch dem Todestrieb an. Diese Schwie‐
igkeit wird umgangen, indem der statistische<br />
Mittelwert zur Norm und anschließend zur<br />
Normalität erhoben wird. So gleitet die Norm<br />
zum Normativen. Ein Schritt weiter wird der<br />
Mensch, der von dem statistischen Mittelwert<br />
abweicht, a‐normal: abweichend! So werden<br />
neue Pathologien geschaffen: die „Dys“ (gra‐<br />
phie, lexie, praxie, etc) bei Kindern, von der<br />
„Hyperaktivität“ ganz zu schweigen. Die Ju‐<br />
gend Frankreichs wird so ausgegrenzt, ausge‐<br />
schlossen, disqualifiziert. Diese Norm hat mit<br />
dem psychoanalytischen Symptom nichts ge‐<br />
mein: das Symptom ist ‐in psychoanalytischer<br />
Sicht‐ ein Sprachfaktum, das eine zu entschlüs‐<br />
selnde Wahrheit beinhaltet. Die Evaluation in<br />
den Abteilungen für Kinderpsychiatrie stellt<br />
einen Kodex wie eine binäre Sprache auf: alles<br />
ist erfassbar. Wir haben alles, was Sie brauchen<br />
vorrätig! So gibt es keinen Mangel mehr, die<br />
Kinder können ihre Frage nicht stellen, weil<br />
die normative Antwort schon vorgegeben ist,<br />
bevor sie zum Sprechen kommen. Die psycho‐<br />
analytische Praxis hält sich an die Regel, dass<br />
jeder Fall einzeln angehört werden muss. (Der<br />
passage‐à‐l’acte und das acting‐out; Beispiele für<br />
Gewalttaten in Institutionen)<br />
Die Evaluation, die vorgibt, Qualität durch<br />
Quantifizierung zu bewerten, lässt den Betei‐<br />
ligten vorschweben, dass es eine Metasprache<br />
gibt, die alles erfasst. Die Sprache ist aber un‐<br />
endlich durch ihre bildlichen Ausdrücke<br />
(métaphorisation) und ihre Doppelsinnigkeit,<br />
keine Begrenzung zeichnet sich durch eine<br />
Ausnahme von der Regel ab. Es gibt kein<br />
übergreifendes Prinzip, keine Metasprache, die<br />
über die Zweideutigkeit entscheiden könnte.<br />
Den „Anderen des Anderen“ gibt es nicht.<br />
(siehe Geneviève Morel, „La loi de la mère“, Pa‐<br />
ris, Economica, Anthropos, 2008, S.327).<br />
5. Hat sich Ihre psychoanalytische Tätigkeit<br />
in der Vergangenheit durch die Änderung der<br />
Haltung und Werte verändert, insbesondere<br />
von Ihren Patienten ausgehend? Können Sie<br />
diese Änderungen beschreiben?<br />
Die Mutter eines zwölfjährigen Mädchens,<br />
das ich für verschiedene Phobien empfang,<br />
fragte mich anlässlich einer gemeinsamen Sit‐<br />
zung fünfmal (!): „Wie können Sie die Fort‐<br />
schritte der Therapie meiner Tochter bewer‐<br />
ten?“ Sie bestand in Anwesenheit ihrer Tochter<br />
auf einem wissenschaftlich medizinischen Dis‐<br />
kurs, als ob die Entwicklung des anwesenden<br />
Kindes wie ein lebloses Objekt quantifiziert<br />
werden könne. Die Therapeutin sollte ihre Ar‐<br />
14<br />
MB der AFP <strong>Nr</strong>. <strong>85</strong>/<strong>März</strong> 2010<br />
beit rechtfertigen, ihre Arbeit wurde bei dieser<br />
Gelegenheit auch beurteilt. Es war eine Art<br />
Qualitätskontrolle durch den Kunden, seine<br />
Kundenbefriedigung. Und dass diese Sitzun‐<br />
gen bei einer Ärztin stattfanden, stellte keine<br />
„Garantie“ dar. Die Autorität der Ärzte, der<br />
Wissenschaftler und der Lehrer wird bis auf<br />
Universitätsebene in Zweifel gezogen. Nach‐<br />
dem die an der Universität tätigen Psychiater<br />
sich als „richtige“ Mediziner verstehen wollten<br />
und sich in den Neurowissenschaften und der<br />
Pharmakologie wohler fühlten als in der Diag‐<br />
nostik psychischer Erkrankungen, nachdem<br />
die epidemiologischen Mittel als Notwendig‐<br />
keit in Kauf genommen wurden, um die Pro‐<br />
duktivität des Gesundheitssystems zu verbes‐<br />
sern, frisst jetzt die rationalisierende Revoluti‐<br />
on ihre Kinder und wertet das Universitäts‐<br />
wissen selbst ab. (Zusätzliches Beispiel: die<br />
Expertise von Anne T.: eine Liste von medizi‐<br />
nischen Symptomen ohne Diagnose DSM und<br />
CIM).<br />
5. Welche Rolle spielen die psychoanalyti‐<br />
schen Gesellschaften in Ihrem Land, was die<br />
oben genannten Probleme und Fragen betrifft?<br />
Besteht eine offene Diskussion über diese Fra‐<br />
gen, finden Sie Unterstützung für eine kriti‐<br />
sche Beleuchtung, oder existiert im Gegenteil<br />
eine Tendenz, weitere restriktive Normen still‐<br />
schweigend hinzunehmen?<br />
Die französischen psychoanalytischen Ver‐<br />
einigungen haben die Öffentlichkeit schnell<br />
alarmiert und viel Unterstützung in der Presse<br />
erfahren. „Le Manifeste pour la Psychanalyse“<br />
organisierte öffentliche Versammlungen. Auf<br />
Universitätsebene wurde Stellung genommen.<br />
Gleichzeitig zu dieser Kontroverse haben Be‐<br />
wegungen für die Klinik (Sauvons la clinique!),<br />
gegen die Evaluation der drei‐jährigen Kinder<br />
in der Vorschule (Pas de zéro conduite!), für die<br />
psychiatrische Versorgung (La nuit sécuritaire)<br />
und gegen die Sicherheitshaft (Non à la<br />
perpétuité sur ordonnance) stattgefunden.<br />
Die Bücher von Marie‐Noël Godet und von<br />
Agnès Aflalo sind stimulierend, erfrischend.<br />
A. Aflalo hat unter anderem der Unterschei‐<br />
dung des Triebs von Freud und dem<br />
konditionnierten Reflex von Skinner ein langes<br />
Kapitel gewidmet (S.56ff.).<br />
Die Befürchtungen für die Zukunft sind:<br />
Dass der medizinischen und immer weni‐<br />
ger humanistischen Psychiatrie die Verschrei‐<br />
bung der Psychotherapien und der Psychoana‐<br />
lyse zukommt, dass der Meisterdiskurs allein
herrscht. Dass die Ausbildung der Psychoana‐<br />
lytiker zu einer schulischen Ausbildung wird<br />
und dass sie von Ausbildern ermächtigt wer‐<br />
den (siehe das Angebot an Ausbildungen der<br />
großen Assoziationen selbst, siehe: „Les forma‐<br />
tions cliniques des Forums du champ Lacanien“).<br />
Dass die Psychotherapeuten und die Ärzte<br />
zu den Garanten der öffentlichen sozialen<br />
Ordnung werden, dass sie zur kollektiven<br />
Normalisation beitragen sollen.<br />
Hoffen wir, dass die Hysterie weiterhin den<br />
Platz für das Subjekt des Unbewussten offen<br />
hält!<br />
***<br />
Uwe Lausen: Ich bin das Gesetz, 1967<br />
3.<br />
AFP-Forum: Norm-Normalität-Gesetz<br />
‒ Julia Kristeva:<br />
König Ödipus und der unsichtbare Frevel<br />
(abjection) *<br />
Das ebenso tragische wie erhabene Schick‐<br />
sal von Ödipus lässt die mythische Beschmut‐<br />
zung, die die Unreinheit dieser unberührbaren<br />
«anderen Seite» darstellt, in eins fassen und<br />
zugleich verschieben ‒ dieses «andere Ge‐<br />
schlecht», am Rande des Körpers ‒ die Lamelle<br />
des Begehrens ‒ und, vor allem in der Frau als<br />
Mutter, den Mythos der Fülle der Natur. Um<br />
das überzeugend zu finden, müssen wir den<br />
Spuren des sophokleischen König Ödipus und<br />
vor allem des Ödipus auf Kolonos folgen.<br />
Obgleich Ödipus Herrscher ist und zu‐<br />
gleich derjenige, der die logischen Rätsel zu lö‐<br />
sen weiß, ist er trotzdem ahnungslos gegenüber<br />
seinem eigenen Schicksal; denn er weiß nicht,<br />
dass er selbst derjenige ist, der seinen Vater<br />
Laios getötet und seine Mutter Jokaste geheira‐<br />
tet hat. Dieser Mord als auch das Begehren<br />
* abjection, dt. Schmach, Frevel, Schandtat, Niedertracht, Gemeinheit.<br />
AdÜ.<br />
15<br />
MB der AFP <strong>Nr</strong>. <strong>85</strong>/<strong>März</strong> 2010<br />
bleibt ihm verborgen, beide wären allerdings ‒<br />
wider besseres Wissen ‒ die Kehrseite seiner<br />
logischen Macht und deren politische Folgen.<br />
Der Frevel wird erst sichtbar, als Ödipus ‒ der<br />
durch sein Begehren nach Wissen an die Gren‐<br />
ze seiner selbst gelangt ‒ als Herrscher das Be‐<br />
gehren und den Tod entdeckt. Und dann<br />
schreibt er diesen beiden ebendieselbe Fülle<br />
der Macht, deren Erkenntnis und deren Ver‐<br />
antwortung zu. Nichtsdestoweniger bleibt die<br />
Lösung in König Ödipus nicht vollkommen<br />
dem Mythos überlassen: sie entwickelt sich<br />
durch Ausschluss, so wie wir das in der Logik<br />
anderer mythischer und ritueller Systeme ge‐<br />
sehen haben.<br />
Zunächst ein räumlichen Ausschluss: Ödi‐<br />
pus muss ins Exil, d.h. den eigentlichen Ort<br />
verlassen, an dem er König ist; er muss die Be‐<br />
fleckung entfernen, damit die Grenzen des<br />
contrat social in Theben fortbestehen.<br />
Zugleich aber ist das auch ein Ausschluss<br />
des Blick: Ödipus wird blind, weil er den Blick<br />
auf die Objekte seines Begehrens und seines<br />
Mords nicht sieht (das Gesicht seiner Frau,<br />
seiner Mutter, seiner Kinder). Wenn es stimmt,<br />
dass diese Erblindung mit der Kastration<br />
gleichzusetzen ist, so bedeutet sie weder eine<br />
Entmannung noch den Tod. Diesen beiden ge‐<br />
genüber ist das Blind‐Werden ein symboli‐<br />
scher Ersatz, es ist dazu bestimmt, eine Mauer<br />
zu bauen, einen Damm, der die Schande, die<br />
als solche etwas ist, was nicht abgestritten<br />
werden kann, sondern als etwas Fremdes be‐<br />
zeichnet werden muss. Sie ist demnach eine<br />
Figur einer gespaltenen Blindheit: mit dem<br />
Makel der Beschmutzung kennzeichnet sie zu‐<br />
gleich auch den Körper und die eigene Verän‐<br />
derbarkeit ‒ sie ist die Narbe am Ort eines of‐<br />
fenkundigen, zugleich aber auch unsichtbaren<br />
Frevels. Die Unsichtbarkeit des Frevels. Indem<br />
dieser für die Stadt und die Macht steht, kön‐<br />
nen beide weiterfortbestehen.<br />
Das Pharmakon als Zwiespältiges<br />
Heben wir noch einmal die tragische Bewe‐<br />
gung in König Ödipus hervor: versinnbildlicht<br />
das nicht eine mythische Variante des Frevels?<br />
Indem Ödipus eine unreine, eine von einem<br />
Miasma gezeichnete Stadt betritt, wird er<br />
selbst zum agos, zur Beschmutzung, die er zu<br />
reinigen hat, um katharmos zu werden. Ein<br />
Reiniger ist er also allein dadurch, dass er agos<br />
ist. Sein Frevel nährt sich durch diese bestän‐<br />
dige Zwiespältigkeit der Rollen, die er, ohne es<br />
zu wissen, annimmt, während er doch zu‐
gleich meint zu wissen. 24 Und genau diese Dy‐<br />
namik der Umkehrungen ist es, die aus ihm<br />
sowohl einen Frevler als auch ein pharmakos<br />
macht, einen Sündenbock, der durch seinen<br />
Ausschluss die Stadt von der Befleckung rei‐<br />
nigt. Die Triebfeder der Tragödie liegt dem‐<br />
nach in dieser Zwiespältigkeit 25 : Verbot und<br />
Ideal treffen sich in einer einzigen Person; das<br />
bedeutet, dass das sprechende Wesen keinen<br />
eigenen Raum hat, sondern sich an einer fragi‐<br />
len Schwelle aufhält, wie am Ort einer unmög‐<br />
lichen Markierung. Wenn das die Logik des<br />
pharmakos katharmos ist, der Ödipus selbst ist,<br />
so muss man festhalten, dass das Theaterstück<br />
von Sophokles das Packende nicht nur aus<br />
diese Mathesis der Zweideutigkeit zieht, son‐<br />
dern aus den ganz und gar semantischen Wer‐<br />
ten, denen es den gegensätzlichen Begriffen<br />
verleiht. Und welche „Werte“ sind das?<br />
Theben ist ein Miasma an Unfruchtbarkeit,<br />
Krankheit, an Tod. Ödipus ist agos, weil er<br />
durch den Vatermord und den Inzest mit der<br />
Mutter die Kette der Reproduktion [des Le‐<br />
bens] gestört und unterbrochen hat. Die Befle‐<br />
ckung bedeutet ein Anhalten des Lebens: (wie)<br />
eine Sexualität ohne Reproduktion (die aus<br />
dem Inzest geborenen Söhne des Ödipus wer‐<br />
den umkommen, die Töchter werden nur in<br />
einer anderen Logik überleben, nämlich in ei‐<br />
nem symbolischen Vertrag oder in einer sym‐<br />
bolischen Existenz, wie wir das in Ödipus auf<br />
Kolonos noch sehen werden). Eine bestimmte<br />
Sexualität ‒ die in der griechischen Tragödie<br />
nicht die Bedeutung besitzt, die sie für uns<br />
Moderne hat, ja die sich nicht einmal durch<br />
Lust bemerkbar macht, sondern durch Souve‐<br />
ränität und Wissen ‒ entspricht der Krankheit<br />
und dem Tod. Die Befleckung vermischt sich<br />
darin ebenfalls: sie besteht hauptsächlich da‐<br />
rin, dass Hand an die Mutter gelegt wurde.<br />
Die Befleckung, das ist der Inzest als Über‐<br />
schreitung der Grenzen des Eigenen.<br />
Wo also verläuft die Grenze, die erste<br />
fantasmagorische Schwelle, die das Eigene des<br />
sprechenden und/oder sozialen Menschenwe‐<br />
sens ausmacht? Zwischen Mann und Frau?<br />
Oder zwischen Mutter und Kind? Oder viel‐<br />
leicht zwischen Frau und Mutter? Die Antwort<br />
auf den Ödipus‐pharmakos auf Seiten der Frau<br />
24 J.P. Vernant hat diese Logik analysiert in „Ambigüité et renversement.<br />
Sur la structure énigmatique d’Œdipe roi“, in: J.P.<br />
Vernant/P. Vidal-Naquet, Mythe et Tragédie, Paris (Maspero)<br />
1973, S.101ff.<br />
25 Vgl. ibid., doch auch die Arbeiten von L. Gernet.<br />
16<br />
MB der AFP <strong>Nr</strong>. <strong>85</strong>/<strong>März</strong> 2010<br />
ist Jokaste, wie Janus selbst zwiespältig und<br />
umstürzlerisch, in derselben Gestalt, in dersel‐<br />
ben Rolle, in derselben Funktion. Ein Janus,<br />
wie vielleicht jede Frau, da jede Frau zugleich<br />
ein Wesen des Begehrens ist ‒ d.h. ein spre‐<br />
chendes Wesen ‒ und ein Wesen, das die Re‐<br />
produktion verkörpert ‒ d.h. eines, das sich<br />
von seinem Kind trennen kann. Ödipus hat<br />
vielleicht nur diese Spaltung der Jokaste gehei‐<br />
ratet: das Mysterium, das Rätsel der Weiblich‐<br />
keit. Letztlich ist diejenige, die den Frevel ohne<br />
Hoffnung auf Reinigung personifiziert ‒ die<br />
Frau! «Jede Frau», die «ganze Frau»; der Mann<br />
selbst trägt den Frevel nur zur Schau und weiß<br />
davon, wodurch er selbst wiederum zum Rei‐<br />
niger wird. Jokaste ist das Miasma, der agos ‒<br />
das ist selbstverständlich. Doch allein Ödipus<br />
ist pharmakos. Er kennt und schließt das mythi‐<br />
sche Universum, das aus der Frage nach der<br />
(sexuellen) Differenz entsteht; er beschäftigt<br />
sich mit der Teilung der beiden Mächte: Re‐<br />
produktion/Produktion, Weiblichkeit / Männ‐<br />
lichkeit. Ödipus vollendet dieses Universum<br />
dadurch, dass er es in die Partikularität eines<br />
jeden Individuums einführt, das dann unwei‐<br />
gerlich selbst zum pharmakos und universell<br />
zum tragischen Helden wird.<br />
Doch damit diese Internalisierung stattfinden<br />
kann, bedarf es eines [räumlichen] Übergangs:<br />
von Theben nach Kolonos: die Ambiguität und<br />
die Umkehrung der Differenzen werden zum<br />
Vertrag.<br />
Die Reinigung in Kolonos<br />
Ganz anders ist demnach der Ödipus auf Ko‐<br />
lonos. Der Ort hat sich geändert. Und auch<br />
wenn die göttlichen Gesetze ihre Strenge nicht<br />
eingebüßt haben, so hat doch Ödipus seine<br />
Haltung ihnen gegenüber verändert. Tatsäch‐<br />
lich hat eine Transformierung der politischen<br />
Gesetze zwischen diesen beiden Werken statt‐<br />
gefunden: Zwischen 420 vuZ. ‒ dem Jahr des<br />
König Ödipus ‒ und 402 vuZ. ‒ dem Jahr der<br />
ersten Vorstellung von Ödipus auf Kolonos<br />
(nach dem Tode des Sokrates 406‐405) ‒ fand<br />
ein Übergang von der Tyrannis zur Demokra‐<br />
tie statt. Doch die Tatsache, dass ein demokra‐<br />
tisches Prinzip das Alterswerk von Sophokles<br />
beherrscht, ist vielleicht nur einer der Gründe,<br />
die diesen Wechsel in der Auffassung der gött‐<br />
lichen Gesetze im Verlauf des Ödipus auf Kolo‐<br />
nos erklären können. Im Gegensatz zu dem<br />
durch seine Schandtat niedergeschmetterten,<br />
ruinierten, zerbrochenen Herrscher und Sou‐<br />
verän Ödipus, haben wir es hier mit einen
Ödipus zu tun, der kein König ist, alles in al‐<br />
lem also ein „Subjekt“ ‒ ein Unterworfener ‒<br />
Ödipus, der seine Unschuld lauthals hinaus‐<br />
schreit. Allerdings nicht ohne Einschränkung.<br />
Nachdem er zuerst daran gedacht hat, Theseus<br />
die Hand zu drücken und ihn zu umarmen,<br />
gesteht er ein, dass er ebenso unrein wie ohne<br />
Verantwortung ist:<br />
„Darf in meinem Elend ich<br />
verlangen, einem Manne mich zu nahn, an dem<br />
kein Makel haftet einer Schmach! Ich darf es nicht<br />
und lass‘ es auch nicht zu. Nur wer vertraut ist mit<br />
der Schmach, darf Anteil haben an dem Leid.“ (1132-1136) * )<br />
Von Beginn seines schicksalhaften Endes an<br />
schreit er es hinaus:<br />
„Denn mein Leib<br />
und meine Taten sind’s doch nicht: die Taten sind<br />
ja mehr von mir erlitten als verübt…“ (265-267)<br />
„Unwissend nämlich erschlug ich und tötete,<br />
kam ahnungslos dazu, dem Gesetz nach schuldlos…“ (548-549)<br />
Halten wir bei dieser Offenbarung inne: Sie<br />
ist weder ein Schuldbekenntnis (confession)<br />
noch eine Bitte um Anerkennung der Schuld‐<br />
losigkeit infolge der zahlreich erduldeten Lei‐<br />
den; dieser Satz weist auf ein Hinübergleiten<br />
des König Ödipus zum Ödipus als Subjekt hin.<br />
„…dem Gesetz nach schuldlos“, bedeutet zu‐<br />
nächst einmal: „ahnungslos“ gegenüber dem Ge‐<br />
setz. Derjenige, der die logischen Rätsel löst, kennt<br />
das Gesetz nicht, und das heißt wiederum: Ich, der<br />
weiß, bin nicht das Gesetz. Hier also findet eine<br />
erste Änderung zwischen dem Wissen und<br />
dem Gesetz statt, die den Souverän aus dem<br />
Lot bringt. Wenn das Gesetz im Anderen ist,<br />
dann ist mein Schicksal weder meine Macht<br />
noch mein Begehren, es ist ein verändertes<br />
Schicksal: mein Schicksal ist der Tod!<br />
Der Frevel des Königs Ödipus ist mit Wissen<br />
und Begehren unvereinbar, beide zeigen eine<br />
allmächtige Wirkung im Menschenwesen.<br />
Der Frevel des Ödipus auf Kolonos wird vom<br />
Sprachwesen nicht gewusst, und dieses Wesen<br />
ist das Subjekt zum Tode und gleichzeitig das<br />
Subjekt einer symbolischen Allianz.<br />
Denn an der Schwelle des Todes, als Ödi‐<br />
pus erklärt, dass er das Gesetz nicht kennt,<br />
geht er eine Allianz mit einem Fremden ein.<br />
Das Exil, das er zuerst gewünscht hat, das ihm<br />
dann von seinen Söhnen verweigert wurde,<br />
war zunächst eine Abweisung, ein Verweis,<br />
bevor es sich für Ödipus zur symbolischen Wahl<br />
und Transmission verwandelte. Denn in frem‐<br />
dem Land und an einen fremden Helden, The‐<br />
seus nämlich, dem symbolischen Sohn, über‐<br />
* Sophokles: Tragödien, München (Dtv/Artemis) 1990, übersetzt<br />
von Wilhelm Willige u.a.<br />
17<br />
MB der AFP <strong>Nr</strong>. <strong>85</strong>/<strong>März</strong> 2010<br />
antwortet er zugleich seine Töchter und das<br />
Geheimnis seines Todes[orts]. Ohne eine Süh‐<br />
ne und ohne einer Errettung zu sein, ist sein<br />
Tod als solcher auch dem Wohle der anderen,<br />
der Fremden bestimmt: für Theseus und die<br />
Athener.<br />
In diesem Zusammen‐<br />
hang ist es Ismene, jene oft so stumme Tochter<br />
‒ die aber trotzdem zur Sprache findet, um ih‐<br />
re Missbilligung der doch recht ödipalen<br />
Kämpfe der Brüder zum Ausdruck zu bringen<br />
‒, die auch sein, des Ödipus‘ Heil durch die<br />
Götter verkündet: „Die Götter, die dich erst<br />
gestürzt, erhöhn dich jetzt.“ (394) Diese Erhö‐<br />
hung erklärt sich aus der Unschuld des Ödi‐<br />
pus gegenüber dem Gesetz (s. 549); doch um<br />
das zu konkretisieren, muss er die Reinigungs‐<br />
riten auf Kolonos durchmachen (466‐492); es<br />
sind Reinigungsriten, die in der klassischen Li‐<br />
teratur hier einzigartig deutlich dargestellt<br />
werden.<br />
Nach der Aufhebung des Frevels:<br />
der symbolische Vertrag<br />
Auf Kolonos hat der Frevel also sein<br />
Schicksal verändert. Er wird weder ausge‐<br />
schlossen noch blind entfremdet, er wird auf‐<br />
grund eines Unwissens in ein „Subjekt zum<br />
Tode“ gelegt. Der Frevel ist nichts anderes<br />
mehr als ein Fehl der unmöglichen Souveräni‐<br />
tät des Ödipus, ein Fehl in seinem Wissen.<br />
Wenn die Riten zu seiner Reinigung angerufen<br />
werden, so geschieht es im Sprechen des Ödi‐<br />
pus, angesichts des göttlichen Gesetzes wie<br />
angesichts von Theseus, der diese Reinigung<br />
übernimmt. Es handelt sich keineswegs um ein<br />
Schuldeingeständnis: der Frevel in diesem<br />
Griechenland, das auf dem Wege zur Demo‐<br />
kratie ist, wird als Last aufgenommen durch<br />
den, der spricht, der sich als sterblich erkennt<br />
(insofern er der Nachwelt keinen männlichen<br />
Erben hinterlässt) und als Subjekt des Symbo‐<br />
lischen (man beachte die nominelle Übertra‐<br />
gung seines Genießens am Tode auf dem<br />
Fremden, Theseus).
Hier wird die Brücke zu einer anderen Lo‐<br />
gik des Frevels geschlagen: es gibt nun keine<br />
Befleckung mehr, die ausgeschlossen werden<br />
muss wie der andere Rand der (sozialen, kul‐<br />
turellen, eigenen) Heiligen, sondern eine Über‐<br />
schreitung des Gesetzes aufgrund von dessen<br />
Unkenntnis.<br />
König Ödipus hat für Freud und seine Nach‐<br />
folger das Beispiel der Macht des (inzestuösen)<br />
Begehrens und des Begehrens nach dem Tode<br />
(des Vaters) offenbart. Wie frevlerisch auch<br />
immer diese Arten von Begehren sein mögen,<br />
die die Integrität des Individuums und der Ge‐<br />
sellschaft bedrohen, sie sind keineswegs sou‐<br />
verän: das ist die blind‐machende Klarheit, die<br />
Freud, nach Ödipus, in den Frevel hineinge‐<br />
dacht hat; und er hat uns dazu eingeladen, uns<br />
darin zu erkennen, ohne dass wir uns die Au‐<br />
gen ausstechen müssen.<br />
Doch was erspart uns letzten Endes diese<br />
entscheidende Geste? Die Antwort findet sich<br />
vielleicht im Ödipus auf Kolonos, der indessen<br />
Freud nicht zu interessieren scheint! Diesem<br />
Rand, der Schwelle zwischen Frevel und Hei‐<br />
ligem, zwischen Begehren und Wissen, zwi‐<br />
schen Tod und Gesellschaft kann man ins Ge‐<br />
sicht sehen, man kann ihn ansprechen ohne<br />
falsche Unschuld, ohne schamhafte Aus‐<br />
löschung, unter der Bedingung dass man darin<br />
ein partikuläres menschliches Ereignis sieht,<br />
das zugleich tödlich ist und spricht. „Es gibt<br />
den Frevel“, das heißt ab nun: „Ich bin frevle‐<br />
risch, d.h. sterblich und ich spreche.“ Diese<br />
Unvollständigkeit und diese Anhängigkeit<br />
vom [großen] Anderen erlauben es ihm, Ödi‐<br />
pus, seine dramatische Spaltung weiterzuge‐<br />
ben; freilich machen sie deshalb den begeh‐<br />
renden und mörderischen Ödipus lange nicht<br />
unschuldig! Die Weitergabe geschieht für ei‐<br />
nen fremden Helden und sie eröffnet dadurch<br />
die nicht zu entscheidende Möglichkeit für ei‐<br />
nige wirklichen Momente der Wahrheit. Unse‐<br />
re Augen können jetzt weiter offen bleiben, un‐<br />
ter der Bedingung, dass wir anerkennen, dass<br />
wir schon immer durchs Symbolische verän‐<br />
dert worden sind: und zwar mittels der Spra‐<br />
che. In der Sprache ‒ und nicht im anderen,<br />
nicht im anderen Geschlecht ‒ können wird<br />
das ausgestochene Auge, die Wunde, die<br />
grundlegende Unvollständigkeit hören, die die<br />
unendliche (indéfinie) Suche in der Signifikan‐<br />
tenkette darstellt. Das heißt zugleich, wir kön‐<br />
nen die Wahrheit der Verdoppelung (Fre‐<br />
vel/Heiliges) genießen. Und hier eröffnen sich<br />
18<br />
MB der AFP <strong>Nr</strong>. <strong>85</strong>/<strong>März</strong> 2010<br />
zwei Wege: der Weg der Sublimierung und<br />
der Weg der Perversion.<br />
Und ihre Kreuzung: die Religion.<br />
Dafür brauchte Freud nicht nach Kolonos<br />
zu gehen. Er hatte Moses, der ihm vorausge‐<br />
gangen war bei der Umkehrung der Befle‐<br />
ckung in eine Unterwerfung (sujétion) unter<br />
das symbolische Gesetz. Aber Ödipus auf Kolo‐<br />
nos weist vielleicht ‒ neben anderen Entwick‐<br />
lungen der griechischen Kultur ‒ darauf hin,<br />
auf welchem Wege der Hellenismus auf die<br />
Bibel hat verzichten können.<br />
Aus: Julia Kristeva, Pouvoirs de l’horreur,<br />
Paris (Seuil) 1980, S.99‐105. ‒<br />
Aus dem Französischen von H.‐P. Jäck.<br />
‒ Martin Schulte:<br />
Impulse einer psychoanalytischen<br />
Rechtstheorie nach Freud und Lacan<br />
(Zusammenfassung)<br />
Abschließend soll noch einmal die Frage<br />
aufgeworfen werden, welche Impulse die Psy‐<br />
choanalyse in Bezug auf das Verständnis des<br />
Rechts geben kann. Dabei spielt der Umgang<br />
mit den Mythen eine entscheidende Rolle,<br />
denn hier zeigt sich besonders deutlich, wie<br />
unbewusste Phantasmen die subjektive Bezie‐<br />
hung zum Recht steuern. Anders als Legendre<br />
es proklamiert, führt die hier vertretene, un‐<br />
mittelbar an Lacan und Freud orientierte Ana‐<br />
lyse zu einer kritischen Betrachtung der My‐<br />
then und damit auch der libidinösen Beset‐<br />
zung der rechtlichen Beziehungen. Das liegt<br />
insbesondere daran, dass die Objektbeziehung<br />
– konkret zum objet petit a und dem Ding – bei<br />
Legendre keine nennenswerte Rolle spielt. Ge‐<br />
rade an der Objektbeziehung manifestiert sich<br />
aber das phantasmatische Supplement der<br />
Rechtsdiskurse, welches ihnen oft einen patho‐<br />
logischen Charakter verleiht. Die unbewusste<br />
Objektfixierung steht im engen Zusammen‐<br />
hang mit den mythischen Fiktionen, durch<br />
welche der pathologische Einschlag des objet<br />
petit a initiiert oder zumindest gestützt wird.<br />
Aus ethischer Sicht muss es gerade darum ge‐<br />
hen, den „unheimlichen Exzess des Genie‐<br />
ßens”, der nach Zizek durch den Todestrieb<br />
bezeichnet wird und den das Subjekt (auch)<br />
über das Recht als Objekt‐Ursache des Begeh‐<br />
rens veranstaltet, zu durchbrechen. Und zwar<br />
durch die gegenseitige Anerkennung als Man‐<br />
gelwesen.<br />
An dieser Stelle bietet sich ein weiterer<br />
Verweis auf Nietzsche an, der sich wie kaum
ein zweiter um ein aufgeklärtes Verständnis<br />
gegenüber der Vaterreligion, welche auch das<br />
für das Recht dominierende mythische Phan‐<br />
tasma enthält, bemüht hat. Nietzsche ging es<br />
um eine Entmythisierung insgesamt, also auch<br />
in Bezug auf Vernunft und Moral. Als „post‐<br />
humer Philosoph” beschreibt er die „Tötung<br />
Gottes” als das für den – aus seiner Perspekti‐<br />
ve kommenden – Zeitgeist zentrale Ereignis. 26<br />
Indem er die unbedingte Verknüpfung von<br />
Grammatik und Gottesglauben mit der einher‐<br />
gehenden Dekonstruktion des idealistischen<br />
(affektbefreiten) Vernunftbegriffes prokla‐<br />
miert, wird schon das angedeutet, was Lacan<br />
später mit der Position des Namens‐des‐Vaters<br />
– dem Pendant des toten Vaters in der diskur‐<br />
siven Kommunikation – beschreibt. Unbe‐<br />
wusste Phantasmen und libidinöses Begehren<br />
sind — um noch einmal die psychoanalytische<br />
Perspektive von der philosophischen abzu‐<br />
grenzen – aus der Operation der Vernunft<br />
nicht extrahierbar. Was bei Lacan eher als Be‐<br />
standsaufnahme und Analyse des status quo<br />
erscheint, ist bei Nietzsche bereits Gegenstand<br />
einer fundamentalen Kritik: Sowohl die Be‐<br />
schwörung des „toten Gottes”, als auch seine<br />
Sprachkritik, welche er in einem untrennbaren<br />
Zusammenhang sieht, kann als Ausgangs‐<br />
punkt der Forderung betrachtet werden, sich<br />
von dem Anderen der Liebe bzw. von dem<br />
ödipalen Signifikanten zu lösen. So wird das<br />
Verständnis von „Gott” als grammatikalisch<br />
strukturierte Sprachfunktion nirgendwo deut‐<br />
licher als in der Götzen‐Dämmerung:<br />
„Die „Vernunft” in der Sprache: oh was für ei‐<br />
ne alte betrügerische Weibsperson! Ich fürchte, wir<br />
werden Gott nicht los, weil wir noch an die Gram‐<br />
matik glauben.“ 27<br />
Das Dilemma, das Nietzsche in der Religi‐<br />
on als System des Vaterdogmas sieht, wird<br />
auch bei Legendre – nämlich als die „erotische<br />
Anbindung” des Subjekts an die Rechtsinstitu‐<br />
tionen – beschrieben, wobei Legendre diese<br />
Faszination im Gegensatz zu Nietzsche unkri‐<br />
tisch sieht. Nietzsches neue „Morgenröte”<br />
kann man als Hoffnung auf eine Zeit verste‐<br />
hen, die das „Vertrauen zur Moral” als das ul‐<br />
timative Symptom der phantasmatischen Va‐<br />
26 Vgl. Nietzsche, Die fröhliche Wissenschaft. Drittes Buch,<br />
Sentenz 125 (Der tolle Mensch).<br />
27 Nietzsche, Götzen-Dämmerung oder Wie man mit dem<br />
Hammer philosophirt. Die „Vernunft” in der Philosophie,<br />
Sentenz 5.<br />
19<br />
MB der AFP <strong>Nr</strong>. <strong>85</strong>/<strong>März</strong> 2010<br />
terbeziehung erkennt, 28 deren peinigenden<br />
Charakter die sublimierte Schuld für das ver‐<br />
drängte Urverbrechen aus Freuds metaphori‐<br />
schen Mythen widerspiegelt, hinter sich lässt.<br />
Liest man Nietzsche mit Lacan, erfordert dies<br />
eine neue Form der Verknüpfung der Register<br />
von Subjektivität, in der das Sinthôme den<br />
Namen‐des‐Vaters ersetzen soll. 29 Im Kern<br />
geht es Lacan darum, dieses Sinthôme, das die<br />
drei subjektiven Sphären des Realen, Imaginä‐<br />
ren und Symbolischen zusammenhält und es<br />
dem Subjekt damit erst zu leben ermöglicht,<br />
indem es die „Stütze seines Daseins bildet”, als<br />
nicht interpretierbaren Kern des Subjekts und<br />
seines Genießens anzuerkennen (d.h. gerade<br />
nicht über die Analyse zu versuchen, es „auf‐<br />
zulösen”) und die Identifikation mit ihm zu<br />
ermöglichen. 30<br />
Die hier eingeschlagene Richtung ist aller‐<br />
dings eine zwiespältige, denn es geht auch um<br />
die Dekonstruktion derjenigen Moral, welche<br />
sich an dem Namen‐des‐Vaters orientiert und<br />
damit auf fundamentalen psychischen Kau‐<br />
salitäten beruht. Silvia Ons unterstreicht, dass<br />
Nietzsches Nähe zu Lacan in seiner Beschrei‐<br />
bung von Wahrheit innerhalb einer strukturel‐<br />
len Parallele zur Fiktion liegt. Wahrheit „er‐<br />
scheint”, und dieser Status der Erscheinung ist<br />
die Folge ihrer fiktionalen Struktur, dem<br />
grammatikalischen Bruch in der Sprache, in<br />
der neue Werte produziert werden. So entsteht<br />
ein Pragmatismus, der nicht zuletzt auch aus<br />
der Demontage oder Entmythisierung der Me‐<br />
taphysik und der Konzeptionierung von<br />
jouissance als nicht gleichbedeutend mit Lust<br />
oder Wohlergehen folgt. 31 Das Subjekt steuert<br />
28 Vgl. Nietzsche. Morgenröthe. Gedanken über die moralischen<br />
Vorurtheile, Vorrede, Sentenz 2.<br />
29 Voruz, The Topology of the Subjekt of Law: The Nullibiquity<br />
of the Fictional Fith, in: Ragland/Milovanovic, Lacan, Topologically<br />
Speaking, S.296ff.<br />
30 Zizek, Liebe Dein Symptom wie Dich selbst, S.26.ff.<br />
31 Ons, Nietzsche, Freud, Lacan, in: Zizek, Lacan – The Silent<br />
Partners, S.80.
zwanghaft und fortwährend auf die jouissance<br />
zu, weil es der Grammatik nicht entfliehen<br />
kann, die es fest an das Phantasma des ambi‐<br />
valenten Vaters bindet. Dieser Vater steht hin‐<br />
ter der universellen Fassade des Anderen, der<br />
als An‐derer des Rechts sowohl im Bild oder in<br />
den Symbolen des säkularen und werteorien‐<br />
tierten Vaters Staat als auch des alttestamentli‐<br />
chen Gottes auf‐tritt. Wahrheit wird immer<br />
dort vermutet, wo sie als jouissance verwertet<br />
werden kann. Wie qualvoll diese pragmatische<br />
Wahrheit ist, zeigt sich in den biblischen Lei‐<br />
den des Volkes Israel an den Gesetzen des<br />
Herrn im Exodus und Leviticus genauso wie<br />
in dem täglichen Kampf um das Recht bzw.<br />
des Ringens um Signifikanz im demokrati‐<br />
schen Rechtsstaat. Was bei Nietzsche als plaka‐<br />
tiver Kampf mit dem Christentum erscheint,<br />
den er — wenn auch weniger oft zitiert —<br />
auch gegen das Vernunftideal Kants und<br />
schließlich die Grammatik selbst geführt hat,<br />
ist bei Lacan die radikale Analyse und implizi‐<br />
te Kritik an dem der jouissance unterworfenen<br />
Subjekt.<br />
Ein mögliches Fazit aus den psychoanalyti‐<br />
schen Rechtsbetrachtungen ist damit schon bei<br />
Nietzsche angelegt. Dieses liegt in der rechts‐<br />
ethischen Forderung nach einer Lösung von<br />
der phantasmatischen, „erotischen” Beziehung<br />
zum Anderen der Liebe und des Rechts. Ob es<br />
sich dabei um eine utopische oder realisierbare<br />
Vorstellung handelt, kann hier nicht entschie‐<br />
den werden. Psychoanalytische Parameter er‐<br />
möglichen es aber, und das könnte als erster<br />
Schritt in Richtung einer „Befreiung des Be‐<br />
gehrens” betrachtet werden, manche der un‐<br />
bewussten Phantasmen innerhalb unserer<br />
Rechtsordnung zu reflektieren und damit auf<br />
ihre Dekonstruktion hinzuwirken. Man sollte<br />
aber nicht vergessen, dass in den Phantasmen<br />
der jouissance eine — wenn auch schmerzliche<br />
— aber drängende Form des Genießens liegt,<br />
die den Abschied hiervon deutlich erschwert.<br />
Dass man das Zentrum dieses Phantasmas als<br />
ödipalen Signifikanten bezeichnet, ist sicher‐<br />
lich nicht zwangsläufig, lässt sich aber mit La‐<br />
can begründen. So kann man auf dieser<br />
Grundlage vertreten, dass der Wunsch nach<br />
einem „toten Gott” bei Nietzsche eben dem<br />
Leiden an eben diesem „väterlichen Signifi‐<br />
kanten” entspringt.<br />
Der progressive Impuls der hier dargestell‐<br />
ten psychoanalytischen Rechtstheorie kann<br />
damit schließlich im Sinne einer Neuorientie‐<br />
20<br />
MB der AFP <strong>Nr</strong>. <strong>85</strong>/<strong>März</strong> 2010<br />
rung auf das Lacanschen Sinthôme formuliert<br />
werden. Konkret heißt dies, der jouissance,<br />
welche der phantasmatischen Identifikation<br />
mit dem — um noch einmal die Freudsche Me‐<br />
tapher zu gebrauchen — an) guten oder bösen<br />
Vater leidenden Brüderclan entspringt, zu ent‐<br />
sagen. In diesem Sinne muss das Recht einen<br />
Weg finden, dem Subjekt das von libidinösen<br />
Implikationen befreite Gefühl zu vermitteln, in<br />
seinem ureigensten Kern Anerkennung durch<br />
den Anderen zu finden, ohne ihn dabei aber<br />
zu einem Genießen auf Kosten seines Nächsten<br />
oder zu einem Genießen aus einem Schuld‐<br />
komplex heraus zu verleiten. Dabei geht es<br />
insbesondere um die Vermittlung eines<br />
Rechtsverständnisses, das sich von dem patho‐<br />
logischen Genießen der jouissance nicht nur<br />
löst, sondern bewusst distanziert. Der Rechts‐<br />
diskurs ist oft von der hysterischen Vermu‐<br />
tung durchsetzt, dass ein anderes Subjekt an<br />
einem Mehr‐Genießen teilhat. Zu diesem<br />
möchte man sich entweder selbst — über das<br />
Recht — Zugang verschaffen oder zumindest<br />
dem anderen Subjekt den Zugang unterbin‐<br />
den. Dieses ominöse Mehr‐Genießen wird bei<br />
Lacan an Objekt‐Ursachen (objet petit a) fest‐<br />
gemacht, wobei — aufgrund der trügerischen<br />
Natur dieser Objekte — regelmäßig verkannt<br />
wird, dass dieses ein bloßer Schein, eine trans‐<br />
zendente Leerstelle ist.<br />
Die psychoanalytische Betrachtung der<br />
Entstehung und der diskursiven Erscheinungs‐<br />
formen des Rechts zeigt, dass das Recht von<br />
einem Leiden geprägt ist, welches in der Struk‐<br />
tur des ödipalen Signifikanten begründet liegt.<br />
Recht dient dem Subjekt dazu, seinen Mangel<br />
zu verhandeln und ihm (partielle) Befriedi‐<br />
gungserlebnisse zu verschaffen. Zentral ist da‐<br />
bei die omnipräsente Fixierung auf die Objekte<br />
des Begehrens, welche in Wahrheit aber re‐<br />
gelmäßig — wie Lacan betont — nur Objekt‐<br />
Ursachen und damit ein bloßer Schein, Teil ei‐<br />
nes Phantasmas sind. Bedeutung, Wahrheit<br />
und Vernunft treten auf, wenn das Subjekt sich<br />
dem Objekt bzw. dem Ding anzunähern<br />
glaubt. Diese Annäherung wird im Recht dis‐<br />
kursiv vermittelt. Ein Rechtsakt wird als ge‐<br />
recht erfahren, wenn er dem Subjekt ein<br />
(phantasmatisches) Näheverhältnis zum Ob‐<br />
jekt seines Begehrens vermittelt. Die hier vor‐<br />
geschlagene psychoanalytische Rechtstheorie<br />
stellt ein System und Vokabular vor, mit dem<br />
dieses Begehren innerhalb der einzelnen<br />
Rechtsakte identifiziert und der spezifische
Objektbezug offengelegt werden kann. Wird<br />
so ein Ausweg aus dieser Spirale eröffnet?<br />
Kann ein neues, progressives Rechtsverständ‐<br />
nis über die Psychoanalyse vermittelt werden?<br />
Ein solches Unternehmen steht vor dem Prob‐<br />
lem, dass es sich um unbewusste — und damit<br />
kaum zugängliche, verschlüsselte — Prozesse<br />
handelt, die ihren Ursprung in der frühkindli‐<br />
chen Entwicklung des Subjekts haben. Das<br />
primäre Ziel einer „psychoanalytischen Auf‐<br />
klärung” liegt also darin, den pathologischen<br />
Charakter dieser Objektfixierung in das Be‐<br />
wusstsein der Rechtssubjekte zu übertragen<br />
und ihnen damit den Grund für ihr Leiden am<br />
Recht verständlich zu machen. Dieses Leiden<br />
ist essentiell ein Leiden an der Sprache, deren<br />
Struktur uns dazu zwingt (oder zu zwingen<br />
scheint), uns auf den Mangel zu konzentrieren<br />
und die Welt aus der Perspektive der Gespal‐<br />
tenheit heraus zu erfahren. Wir vermuten den<br />
Grund für den Mangel im Anderen.<br />
Das symbolische Universum mit seiner Fül‐<br />
le an Rechtszeichen lässt uns den Mangel kon‐<br />
kret erfahren, und wir versuchen über den<br />
Rechtsdiskurs, diesen Mangel im Anderen<br />
„zurecht” zu rücken. Die Mythen bieten eine<br />
Form, innerhalb der sich das Subjekt auf<br />
phantasmatischer Ebene in den Zustand der<br />
Ungespaltenheit versetzen kann und sie wer‐<br />
den glaubwürdiger, wenn sie sich innerhalb<br />
einer bestimmten Tradition historisch verfes‐<br />
tigt haben. Deshalb sollte man – ungeachtet<br />
des Vorgesagten – den Mythos auch nicht vor‐<br />
schnell abtun, denn es besteht eine begründba‐<br />
re Notwendigkeit für die glaubensstärkende<br />
institutionelle Vermittlung eines Referenz‐<br />
punktes: Solange es ein universelles Phantas‐<br />
ma gibt, idealerweise gestützt durch eine an‐<br />
erkannte Dogmatik, ist das System zumindest<br />
nicht instabil und bietet weitgehende Identifi‐<br />
kationsmöglichkeiten, die für die Existenz ei‐<br />
nes Rechtsstaates wohl conditio sine qua non<br />
sind. Sobald eine Beziehung zum Ursprung<br />
hergestellt werden kann, wird der Mangel<br />
ausgeblendet, denn der Ursprung ist der Zu‐<br />
stand der Ungespaltenheit, da er sich auf der<br />
Ebene des Unbewussten auf die pränatale Ein‐<br />
heit – die Zeit vor dem Einschnitt der symboli‐<br />
schen Kastration – bezieht, welcher durch den<br />
ödipalen Signifikanten des Namens‐des‐Vaters<br />
verursacht wird. Diese Bindung darf aber nicht<br />
in eine Abhängigkeit führen, die dem Subjekt<br />
geistige Freiräume verschließt, die es ebenso<br />
nötig hat. Die Geschichte belegt diesen Drang,<br />
21<br />
MB der AFP <strong>Nr</strong>. <strong>85</strong>/<strong>März</strong> 2010<br />
sich von den jeweils dominierenden Manifes‐<br />
tationen der Mythen (sei es eine Religion oder<br />
ein politisches System) zu lösen, vielfältig,<br />
zeigt aber auch, dass die Prozesse von Distan‐<br />
zierung und Annäherung zyklisch verlaufen.<br />
Offen bleibt damit, wie ein Rechtssystem<br />
konkret strukturiert sein muss, um die dem<br />
Begehren entspringende libidinöse Investition<br />
der Teilnehmer der Rechtsdiskurse zu vermei‐<br />
den oder zumindest zu reduzieren. Ob dies<br />
praktisch überhaupt möglich ist oder ob es da‐<br />
zu vielleicht Nietzsches „Über‐Menschen” be‐<br />
darf, muss an anderer Stelle beantwortet wer‐<br />
den. Die Erkenntnis des Unbewussten allein<br />
kann aber schon einen Autonomiegewinn<br />
bringen, der die Möglichkeit eines von patho‐<br />
logischen Symptomen befreiten Rechtsver‐<br />
ständnisses eröffnet.<br />
Aus: Martin Schulte, Das Gesetz des Unbe‐<br />
wussten im Rechtsdiskurs: Grundlinien einer psy‐<br />
choanalytischer Rechtstheorie nach Freud und La‐<br />
can, Berlin (Duncker&Humblot), Schriften zur<br />
Rechtstheorie, 2010, S.230‐234.<br />
‒ Ein Hinweis von Karl‐Josef Pazzini:<br />
Normung: DIN-Preise<br />
Nachwuchsförderung - Andere Förderinstitutionen - Preise + Wettbewerbe<br />
- Geistes- und Gesellschaftswissenschaften, Kunst - Natur-<br />
und Ingenieurwissenschaften, Mathematik - Lebenswissenschaften<br />
(Agrarwissenschaften, Biologie, Medizin)<br />
Preise des Deutschen Instituts für Normung e. V.: Der DIN-Preis<br />
„Nutzen der Normung“ prämiert Beiträge, die Anhand eines<br />
überzeugenden Beispiels den Nachweis eines signifikanten, konkreten<br />
Nutzens aufzeigen. Dieser Wettbewerb steht allen interessierten<br />
Kreisen offen.<br />
Ziel des Wettbewerbes ist es, der Öffentlichkeit die breite Wirkung<br />
der Normung im wirtschaftlichen Kontext mittels konkreter Beispiele<br />
aus der Praxis verstärkt ins Bewusstsein zu bringen.<br />
Preisgeld: 15.000 Euro, 7.500 Euro, 2.500 Euro<br />
Der DIN-Preis „Junge Wissenschaft“ zeichnet studentische Arbeiten<br />
(Diplom, Studien-, Semesterarbeiten) aus, die Fragen der<br />
Normung oder Standardisierung behandeln. Insbesondere sollen<br />
Fragen, die mit Effizienzsteigerung verbunden sind, im Vordergrund<br />
stehen, wobei möglichst auch der Praxisbezug mittels Beispielen<br />
darzustellen ist.<br />
Preisgeld: 500 Euro<br />
Die Bewerbungsunterlagen sind formlos spätestens bis zum 31.<br />
August einzureichen.<br />
Weitere Informationen:<br />
http://www.din.de/cmd?level=tplunterrubrik&menuid=47392&cmsareaid=$areaId&cmsrubid=DIN-<br />
Preise&menurubricid=DIN-<br />
Preise&cmssubrubid=47471&menusubrubid=47471&languageid=d<br />
ehttp://www.din.de/sixcms_upload/media/2896/PDF_NdN.pdfht<br />
tp://www.din.de/cmd?level=tplunterrubrik&menuid=47392&cmsareaid=$areaId&cmsrubid=DIN-<br />
Preise&menurubricid=DIN-<br />
Preise&cmssubrubid=47472&menusubrubid=47472&languageid=d<br />
ehttp://www.din.de/sixcms_upload/media/2896/PDF_JW.pdf
4.<br />
Medienschau<br />
A) PSYCHOANALYTICA<br />
‒ Fotini Ladaki zu Lacans Haa<br />
Nach Lacans Stenografin: Endlich! Lacans Friseur!<br />
Zur Empfehlung des Buchs der AFP‐Förderin Fotini Ladaki<br />
Im Anfang war das Haar<br />
Ich weiß, was Sie denken. Sie denken:<br />
Hatte Einstein überhaupt einen Friseur?<br />
Robert L. Wolke<br />
Und ich weiß, was auch Sie denken, weil<br />
Sie es denken müssen. Sie denken: „Hatte La‐<br />
can überhaupt einen Friseur?” Ja, er hatte ei‐<br />
nen, Karlos Kambelopoulos, Friseur, Maler<br />
und Bildhauer, in La Maison de Beauté Carita.<br />
Dieser Friseur hat es der Öffentlichkeit offen‐<br />
bart, am 26. <strong>März</strong> des Jahres 2008, in einer<br />
ARTE‐Reportage mit dem Thema „Gesichter<br />
Europas”. Damit gab er den Stachel für diesen<br />
Text, der ohne diese Wunder‐Sagung weder<br />
erdacht, noch zustande gebracht worden wäre.<br />
Drum gilt Karlos Kambelopoulos vor allen<br />
Anderen ein großer Dank. Zehn Jahre lang, je‐<br />
den zehnten Tag, meistens inmitten der Wo‐<br />
che, besuchte Lacan diesen Salon. Denn auch<br />
Lacan war jenseits des Mythos seines<br />
Psychismus, den er erfand und mit aller Kraft<br />
kolportierte, eine öffentliche Person, die vom<br />
esse est percipi nicht lassen wollte. In seiner<br />
Theorie begann er erst zu ahnen, wie prekär<br />
und suspekt die Beziehung des Subjekts zu<br />
seinem Körper sein kann. Die Formen seiner<br />
katastrophischen Wirkungen aber waren<br />
wahrscheinlich auch ihm noch dicht gänzlich<br />
bekannt. Vielmehr schien er mit den Katastro‐<br />
phen zu experimentieren, um sie besser ermes‐<br />
sen zu können. Nach seiner Definition der lo‐<br />
gischen Zeit stand Lacan selbst noch in dem<br />
Augenblick des Öffnens und Sammelns. Des‐<br />
wegen traute er sich womöglich, sich selbst<br />
dem obskuren Diskurs „Ich komme vom Fri‐<br />
seur” zu stellen. Kam es ihm womöglich wie<br />
gerufen, dass das Spitzenprodukt der Kosme‐<br />
tiklinie des renommierten Hauses Carita in<br />
seiner Glanzzeit Beauté de Carita hieß? Zu dem<br />
Wasser der Gnade muss man pilgern, um ge‐<br />
heiligt oder geweiht zu werden. Ob dieses<br />
Wasser jedoch das Salz in der Geschichte wer‐<br />
den kann, ist ungewiss. Vielleicht kann es aber<br />
das Haar in der Suppe werden. Denn um das<br />
22<br />
MB der AFP <strong>Nr</strong>. <strong>85</strong>/<strong>März</strong> 2010<br />
Haar wird es hier gehen und um die Kunst mit<br />
den schönen Frisuren und Perücken. Aber<br />
denken Sie keinen Augenblick an die<br />
Trikotillomanie. Wie wäre es mit dem Musical<br />
Hair, das sich wie Herr anhört? Und ist dieses<br />
Musical nicht zum Symbol der Hippie‐<br />
Bewegung geworden, die gegen das Militäri‐<br />
sche und Unnatürliche in der Gesellschaft pro‐<br />
testierte? […]<br />
Karolos Kambelopoulos: Minotaure<br />
Der Figaro von Lacan hat einen Namen, ein Dop‐<br />
pelleben und zwei goldene Hände<br />
Karolos Kambelopoulos wurde 1930 in Kai‐<br />
ro geboren. Mit elf Jahren verlor er seine Mut‐<br />
ter. Von da an hatte er das Gefühl, auf sich al‐<br />
lein gestellt zu sein. Mit neun‐zehn Jahren<br />
wurde er zum Friseur der königlichen Familie<br />
in Ägypten. Mit Anfang Zwanzig verließ er<br />
Kairo. Er wollte nach Paris, um Karriere zu<br />
machen. Über vierzig Jahre lang arbeitete er in<br />
der Maison de Beauté der Schwestern Carita. Sie<br />
legten Wert auf goldene Hände und nicht so<br />
sehr auf Berufszertifikate. Karlos<br />
Kambelopoulos wurde nachgesagt, er führe<br />
ein Doppelleben, da er abends in seinem Ateli‐<br />
er seine Kunst betrieb. Dort entstanden be‐<br />
rühmte Köpfe von Maria Callas, Silvia Mont‐<br />
fort, Melina Mercouri, Nikos Kazanzakis, And‐<br />
reas Papandreou, Pournara, Ritsos, Voutsinas,<br />
Jack Lang. Seine Keramikarbeiten haben einen<br />
Hauch von Zen‐Buddhismus. Sein „Minotaure”<br />
scheint wie aus drei Keramiksträngen gebogen<br />
zu sein, als wären sie den borromäischen Kno‐<br />
ten entsprungen.<br />
Nach seiner Pensionierung entschied sich<br />
Karlos Kambelopoulos nach Griechenland zu<br />
gehen. Denn auch er war die ganze Zeit im<br />
undefinierbaren Exil. Er kaufte sich auf der In‐<br />
sel Kreta ein mittelalterliches Kloster. Venezia‐<br />
nische und arabische Prägungen und Stilele‐<br />
mente wurden mit besonderer Sorgfalt her‐<br />
ausgestellt. In diesem Anwesen sind heute eine<br />
Bibliothek, Atelierräume, Konferenzräume, ei‐
ne Friseurschule, ein Theater, Ausstellungs‐<br />
räume und ein Café untergebracht. Das Anwe‐<br />
sen dient als Ort der Kultur.<br />
Das Kloster trägt den Namen<br />
„Karolos Kloster”, war aber einst unter dem<br />
Namen Santa Maria della Misericordia bekannt.<br />
Aus: Fotini Ladaki: Lacan und sein Friseur, Wien (Passagen)<br />
<strong>2009</strong>, 106 S.<br />
„Der Text versteht sich als schillernde Metapher, die sich an<br />
Lacans Fogaro entzündet und eine Vielzahl von Signifikanten<br />
aufwirbelt, die der fundamentalen Wahrheit des menschlichen<br />
Seins unterliegen.“ (Aus der Ankündigung)<br />
Inhaltsverzeichnis: Einführung - Im Anfang war das Haar -<br />
Hair-regie, Häresie und RSI - Die genichtete Haar-monie - Von<br />
der Kunst Locken auf Glatzen zu drehen - Die Perücken des<br />
Borromäers - Haarscharf den Signifikanten entlang sucht Lacan<br />
einen Salon - Ist die Haar-kur auch eine Kur? - Was Sie immer<br />
haarklein wissen wollten - Die Glatze des Genießens und die<br />
Zöpfe des Begehrens - Das Haar von Objekt klein a zum Ding<br />
erheben - Wo sich immer ein ungeordneter Haufen von Abfällen<br />
findet, gibt es Mensch - Wie Köpfe machen bei den Azephalen?<br />
- Der Figaro von Lacan war ein Selbstgelehrter - Wie<br />
Lacan mit Hellenisieren den Signifikanten des Figaro in die Irre<br />
führte - Non serviam oder Das Ende der Kur - Eine Sardine<br />
im Schönheitsbassin oder Die Parallaxe – Epilog - Das leere<br />
Versprechen - Die leere Geste - Der Figaro von Lacan hat einen<br />
Namen, ein Doppelleben und goldene Hände<br />
‒ Der «Mutter‐Effekt» von Dominique Guyomard<br />
Dominique Guyomard: L’effet‐mère. L’entre mère et fille. Du<br />
lien à la relation, Paris (PUF, Petit Bibliothèque de Psychana‐<br />
lyse) 2010, 212 S., 12 Euro<br />
Die Autorin ist Mitglied einer Gruppe von<br />
Psychoanalytikerinnen (wie Michèle<br />
Montrelay oder Monique Schneider), die sich<br />
mit der Frage des „dunklen Kontinents“ der<br />
Weiblichkeit auseinandersetzen, der bei Freud<br />
noch als Rätsel empfunden wurde. Die Schat‐<br />
tenseite, die in diesem Buch erkundet wird, ist<br />
die der Mutterschaft: Anhand einer Reihe von<br />
Fällen von Patientinnen untersucht die Auto‐<br />
rin mit großer Sorgfalt die Schwierigkeiten des<br />
Mutter‐Seins, das mit Identitäts‐ und narzissti‐<br />
schen Schwierigkeiten verbunden sein kann,<br />
aber auch mit Problemen, die die Analytikerin<br />
als „Fehlschläge der Übertragung“ bezeichnet.<br />
So schreibt sie: „Mütterlichkeit heißt nicht nur<br />
Mutter und Tochter, sondern das ist eine ganze<br />
Geschichte!“ Das Kapitel über den „Baby‐<br />
Blues“ schildert in einfachen Worten, dass<br />
nichts für die Zeit der Niederkunft vorherbe‐<br />
stimmt ist; dieser Augenblick ist einer Art „an‐<br />
gehaltener Zeit“ gleichzusetzen, bevor sich die<br />
werdende Mutter der Phase der mütterlichen<br />
Bindung, d.h. der Mütterlichkeit im eigentli‐<br />
23<br />
MB der AFP <strong>Nr</strong>. <strong>85</strong>/<strong>März</strong> 2010<br />
chen Sinne zuwendet. Die Aktivität der Phan‐<br />
tasien erscheint „gesättigt durch eine erstaun‐<br />
liche Realität“, nämlich die Realität von zwei<br />
Körpern, d.h. der Körper einer gebärenden<br />
Frau und der Körper eines kleinen werdenden<br />
Menschenkinds.“ Denn die in die Mutterschaft<br />
(im Sinne einer Wohnstatt) tretende Frau ist<br />
das Eine, der Austritt aus ihr, ist ein Zweites.<br />
Das mag zu Unrecht eine Banalität sein… Aber<br />
es kommt hier zu einer „psychischen Zeit der<br />
Mutter als einer höchstwichtigen Phase, näm‐<br />
lich dem Mutter‐Effekt. Eine Zeit, die ebenso<br />
einmalig wie vergänglich ist!“ Dort lässt sich<br />
entdecken, wie viele Fallstricke in der mütter‐<br />
lichen Funktion und der Mutterrolle (capacité<br />
maternante) den Weg der Mutterschaft säumen.<br />
Das mündet schließlich und endlich in ein Sta‐<br />
dium, in dem sich die Mutter von einer Schuld<br />
befreien möchte. Geneviève Delaisi de Parseval<br />
Aus: Libération, Livres, vom 25. Februar<br />
2010, S.IV. ‒ Aus dem Französischen von H.‐P.<br />
Jäck.<br />
‒ Federico Fellinis Psychoanalytiker<br />
Der Weg zu den Traumwelten ‐ Federico Fel‐<br />
linis Austausch mit seinem Psychoanalytiker<br />
Ernst Bernhard – Von Regine Igel<br />
Federico Fellini hatte die Gewohnheit, aller‐<br />
lei Zettel mit Notizen in seiner Jackentasche<br />
aufzubewahren. Eines Tages, im Spätsommer<br />
1960, zieht der Regisseur zufällig einen davon<br />
her‐aus, auf dem nur eine Telefonnummer<br />
steht. Die könnte von einer Frau sein. Er wählt<br />
sie an. Doch es antwortet Ernst Bernhard.<br />
Der Mann, der ihm kurze Zeit später die<br />
Tür in der Via Gregoriana No.12, gleich neben<br />
der Piazza Spagna mitten in Rom öffnet,<br />
scheint ihm ein orientalischer Geistlicher zu<br />
sein, ruhig, warmherzig, strahlend. Der schon<br />
weltberühmte Filmkünstler fühlt sich da sofort<br />
heimisch. „Er hörte meinen unzusammenhän‐<br />
genden Bekenntnissen, Träumen und Lügen<br />
zu. Mit einem freundlichen Lächeln, voll liebe‐<br />
voller Ironie. Er wurde zu dem wichtigsten<br />
Menschen in meinem Leben”, erzählt Fellini<br />
Jahre später.<br />
Beide verbindet sofort mehr als nur die<br />
passende Chemie: eine ausgeprägte Sensibilität<br />
für die Welt der Bilder und des Traums, für<br />
das Unbewusste und dessen Grenzbereiche<br />
wie die Parapsychologie und den Spiritismus.<br />
Zwei gebildete Anti‐Intellektuelle entdecken<br />
einander. Fellini ist nur allzu empfänglich für<br />
Bernhards Affinität zum Taoismus, zum I Ging<br />
und zur Yoga‐Philosophie.
Schon der kleine Federico lebte in intensi‐<br />
ven Traumwelten, war von Zauberern, Hexen<br />
und Magiern fasziniert. Am Abend konnte er<br />
es kaum erwarten, ins Bett zu gehen. Die vier<br />
Ecken seines Bettes hatte er nach den Kinos in<br />
Rimini benannt: Fulgor, Savoia, Opera<br />
Nazionale Balilla und Sultano. Die Vorführung<br />
begann, sobald er die Augen schloss.<br />
Doch darüber<br />
sprach er mit niemandem. Vertraute gab es<br />
nicht. Er befürchtete, man würde ihn für ver‐<br />
rückt erklären, und er wollte nicht eingesperrt<br />
werden. War sein Vater, Handelsreisender für<br />
Olivenöl und Salami, einmal zu Hause, ärgerte<br />
der sich, dass sein Sohn zeichnete und nicht<br />
Fußball spielte.<br />
In der Traumanalyse mit Bernhard wird er<br />
sich gewahr, dass das Gefühl der Fremdheit zu<br />
den Eltern keineswegs in allen Familien be‐<br />
steht. Ein Traum:<br />
„Ich war im „Grand Hotel” in Rimini abge‐<br />
stiegen, ging zum Empfang und füllte das<br />
Formular aus, das man mir entgegenstreckte.<br />
Der Portier blickte auf meinen Namen und<br />
sagte: „Fellini? Hier sind schon Leute, die ge‐<br />
nauso heißen”. Er deutete zur Terrasse und<br />
sagte: „Schauen Sie, da sind sie.” Ich schaute.<br />
Es waren mein Vater und meine Mutter. Ich<br />
sagte gar nichts. „Kennen Sie sie?” fragte er<br />
mich. Ich verneinte, und er sagte: „Möchten Sie<br />
sie gern kennen lernen?” Ich sagte noch ein‐<br />
mal: „Nein. Nein, danke.”<br />
Familiäre Verbundenheit findet der Filme‐<br />
macher am Set. Mit Bernhard schüttelt er die<br />
Vorwürfe der Eltern und Lehrer ab. Auch den<br />
Spott der Kinder, die ihm das Gefühl eingru‐<br />
ben, unterlegen zu sein, weil er sich anders<br />
fühlte.<br />
Wohl gab es in der Kindheit Freunde. Ein‐<br />
sam blieb er trotzdem. Fellini lernt, seine<br />
Träume zu beachten, darüber sein Blickfeld zu<br />
erweitern, sie als lebendige Realisierung seines<br />
Selbst zu sehen. Durch die Sitzungen nehmen<br />
„8 ½” und „Julia und die Geister” in seinen<br />
Gedanken Form an: „Die Idee war, das Innen‐<br />
24<br />
MB der AFP <strong>Nr</strong>. <strong>85</strong>/<strong>März</strong> 2010<br />
leben der Protagonisten auf eine Weise zu be‐<br />
handeln, dass das Bewusstsein und das Unbe‐<br />
wusste sich ausbreiten wie Rauchringe.”<br />
Bis zum Tode des Psychoanalytikers im Ju‐<br />
ni 1965 treffen sie sich fast fünf Jahre lang jede<br />
Woche, auch schon mal wie Freunde im Cafe<br />
unten am Platz. Erst 2008 wird das fast 600 Sei‐<br />
ten umfassende Traumtagebuch Fellinis veröf‐<br />
fentlicht. Angeregt von Bernhard, hat er seine<br />
Träume skizziert und kommentiert. Ein kost‐<br />
bares Kaleidoskop nicht nur seiner Seele, Lei‐<br />
den und Gelüste, auch seiner gesellschaftli‐<br />
chen Kreise.<br />
Anders als in deutscher Geisteswelt äußern<br />
sich bekannte Persönlichkeiten in Italien ohne<br />
Scheu öffentlich über ihre Psychoanalyse. So<br />
wie Fellini gegenüber seinen Biographen spra‐<br />
chen auch die Schriftsteller Natalia Ginzburg<br />
und Giorgio Manganelli über Bernhard voller<br />
Wertschätzung.<br />
Doch wer war dieser Magier, der so viele<br />
zum Blühen brachte und ihnen innere Welten<br />
öffnete? Ernst Bernhard emigriert 1936 mit sei‐<br />
ner zweiten Frau von Berlin nach Rom. Mit<br />
sich bringt er die Ideen C.G. Jungs, hält Vor‐<br />
träge über den therapeutischen Effekt der<br />
Traumanalyse und die Unterschiede zu Sig‐<br />
mund Freud. 1940 wird er aus dem Einleben in<br />
Italien abrupt herausgerissen. Die von Musso‐<br />
lini übernommenen Rassegesetze zwingen ihn,<br />
ein Jahr in einem Internierungslager in Kalab‐<br />
rien zu verbringen.<br />
Durch Beziehungen befreit, kann Bernhard<br />
nach Rom zurückkehren. Er erleidet aber einen<br />
plötzlichen Gedächtnisverlust, muss sich ver‐<br />
steckt halten, in einem Verschlag neben der<br />
Wohnung. Dort erfährt er vom Tod des Vaters<br />
in einem Konzentrationslager in Polen und<br />
vom Selbstmord der Mutter in Paris.<br />
Nach Kriegsende melden sich neue Patien‐<br />
ten. Er wird zum Geheimtipp in der römischen<br />
Kultur‐ und Intellektuellenwelt.<br />
Notizen Ernst Bernhards zu seinem Leben<br />
und seine ganz eigenen Gedanken zum „Indi‐<br />
viduationsprozess” werden posthum, auch<br />
übersetzt, in dem kleinen Band<br />
„Mythobiografie” veröffentlicht.<br />
Darin findet sich ein kleines Juwel: ein Es‐<br />
say, wie eine Psychoanalyse mit Italienern ab‐<br />
zuhalten sei. Er fühlte sich heimisch im „Land<br />
der großen Mittelmeer‐Mutter”. „Hier konnte<br />
ich meine preußische Erziehung abstreifen und<br />
jüdisch‐mediterrane Wurzeln aufleben lassen.”
Patienten von Bernhard hörten schon von<br />
der ersten Analysestunde an, dass die Seiten,<br />
die sie in ihrer Persönlichkeit als die problema‐<br />
tischsten, schwierigsten in ihrer Lebensge‐<br />
schichte empfanden sich als Lichtseiten erwei‐<br />
sen können. Daran gelte es, zu arbeiten und<br />
die eigene Individualität wie der zu finden,<br />
den eigenen individuellen Kern. Auch gegen<br />
di Macht des Kollektivs.<br />
Nach dem Tod Bernhard schlägt Fellini sich<br />
zwei Jahr lang mit Albträumen herum, steckt<br />
fest in einer Schaffenskrise. Das geplante Film‐<br />
projekt „Mastorna” wird nie realisiert. Später<br />
dann singt der Regisseur ein Hohelied auf die<br />
Psychoanalyse. Schulfach solle sie werden:<br />
„Denn welches andere Abenteuer könnte so<br />
faszinierend sein wie die Reise in unsere inne‐<br />
ren Dimensionen, die Erforschung des unbe‐<br />
kannten Teils an uns?”<br />
Aus: Frankfurter Rundschau vom<br />
16.‐17. Januar 2010, S.38.<br />
‒ Martin Altmeyer zur Traumaforschung<br />
Martin Altmeyer: Erfrierungen der Seele<br />
Eine Frankfurter Tagung zur Traumaforschung<br />
Kriege, Massenvertreibungen, ethnische<br />
„Säuberungen”, Terroranschläge, Amokläufe,<br />
Folter, Vergewaltigungen, Misshandlungen in<br />
der Familie — Gewalterfahrungen jeder Art<br />
haben neben den körperlichen auch seelische<br />
Folgen. Erschüttert von Empfindungen pani‐<br />
scher Angst, tiefer Verzweiflung und absoluter<br />
Hilflosigkeit werden nicht nur die Opfer, son‐<br />
dern häufig auch diejenigen, die als emotional<br />
teilhabende Zeugen das Geschehen miterleben.<br />
Wenn solche Erschütterungen eine mentale<br />
Belastungsgrenze überschreiten und den inne‐<br />
ren Reizschutz aufheben, wird ein grundle‐<br />
gendes Sicherheitsgefühl verletzt. Dann spre‐<br />
chen wir von einem Psychotrauma, einer seeli‐<br />
schen Verletzung. Psychische Traumatisierung<br />
bedeutet stets einen massiven Zugriff der Au‐<br />
ßen‐ auf die Innenwelt, der tiefe Spuren im Ge‐<br />
füge von Wahrnehmung, Denken und Fühlen<br />
hinterlässt, psychische Funktionen vorüberge‐<br />
hend oder auf Dauer stört und das Vertrauen<br />
zu sich selbst wie zur Umwelt untergräbt.<br />
Mit diesem hochaktuellen Thema beschäf‐<br />
tigte sich eine internationale Forschungskonfe‐<br />
renz, zu der das Frankfurter Sigmund Freud‐<br />
Institut anlässlich seines fünfzigjährigen Be‐<br />
stehens eingeladen hatte. Da außerdem die<br />
1910 gegründete Internationale Psychoanalyti‐<br />
sche Vereinigung ihren hundertsten Geburts‐<br />
25<br />
MB der AFP <strong>Nr</strong>. <strong>85</strong>/<strong>März</strong> 2010<br />
tag feierte und die Konferenz zum zwanzigs‐<br />
ten Mal stattfand, hatte die Wissenschaft vom<br />
Unbewussten gleich dreifachen Anlass, über<br />
„Lange Schatten früher und später Traumati‐<br />
sierungen” zu diskutieren.<br />
In klassischer Weise betrachtete Charles<br />
Hanly (Toronto) bereits die normale frühkind‐<br />
liche Entwicklung als Kumulation traumati‐<br />
scher Verlusterfahrungen – vom Geburtsakt<br />
über die Entwöhnung von der Mutterbrust bis<br />
zum ödipalen Drama. Gegen ein<br />
intrapsychisch reduziertes Traumakonzept er‐<br />
hob Werner Bohleber (Frankfurt) sogleich Ein‐<br />
spruch, während Horst Kächele (Ulm) Hanlys<br />
entwicklungspsychoanalytische Kausalitäts‐<br />
annahme unter Hinweis auf die bei Freud<br />
schon erwogene, von den modernen Kogniti‐<br />
onswissenschaften in‐zwischen bestätigte<br />
„Nachträglichkeit” von Traumakonstruktionen<br />
bestritt.<br />
Traumakonzepte wurzeln ihrerseits in un‐<br />
bewussten Theorien von Psychoanalytikern,<br />
die sie therapeutisch anwenden – diese ebenso<br />
irritierende wie erhellende These demonstrier‐<br />
te Peter Fonagy (London) am Gebrauch von<br />
Metaphern im Traumadiskurs: Das häufig<br />
verwendete Bild vom Trauma als einem „ein‐<br />
gefrorenen” Seelenzustand könnte das Unbe‐<br />
wusste des Therapeuten widerspiegeln, der<br />
angesichts der grauenvollen Realität, von der<br />
der Patient berichtet, in seinem eigenen Den‐<br />
ken und Fühlen (und womöglich auch in sei‐<br />
ner Gestik und Mimik) „einfriert”, weil er<br />
selbst traumatisiert wird.<br />
Dass und wie traumatische Erfahrungen<br />
von Eltern an ihre Kinder weitergegeben wer‐<br />
den, zeigte Bohleber an Psychoanalysen von<br />
Holocaust‐Überlebenden der zweiten Genera‐<br />
tion, die über den Mechanismus der unbe‐<br />
wussten Identifizierung am Schicksal der ers‐<br />
ten Generation teilhaben. Dazu trug Kurt<br />
Grünberg (Frankfurt) ein erschütterndes Fall‐<br />
beispiel aus dem Jüdischen Beratungszentrum<br />
vor, ergänzt durch szenische Videoanalysen<br />
aus Interviews mit hospitalisierten Holocaust‐<br />
Überlebenden (Dorf Laub, Yale; Andreas<br />
Hamburger, München).<br />
Inzwischen thematisieren solche generatio‐<br />
nenübergreifenden Forschungsprojekte nicht<br />
mehr nur die Spätfolgen der Shoah, sondern<br />
auch Gewalterfahrungen, denen Menschen in<br />
totalitären Gesellschaften kommunistischer<br />
Provenienz ausgesetzt waren; so untersuchte<br />
Tomas Plänkers (Frankfurt) mentale Auswir‐
kungen der chinesischen Kulturrevolution.<br />
Und Marianne Leuzinger‐Bohleber, die rühri‐<br />
ge Direktorin des veranstaltenden Freud‐<br />
Instituts, berichtete aus klinischen Langzeit‐<br />
studien, in welcher Weise auch die depressi‐<br />
ven Kinder einer deutschen „Tätergeneration”<br />
noch an den traumatischen Folgen von Natio‐<br />
nalsozialismus und Weltkrieg leiden.<br />
Welche inneren und äußeren Ressourcen<br />
stehen zur Verfügung, um Traumafolgen psy‐<br />
chisch zu bewältigen? Für diese von der For‐<br />
schung als „Resilienz” bezeichnete Bewälti‐<br />
gungskompetenz haben sich soziale Bindungs‐<br />
erfahrungen als entscheidend erwiesen. Eine<br />
Erkenntnis, über deren heilsamen Nutzen für<br />
die sekundärpräventive Katastrophenpsycho‐<br />
logie und ‐psychiatrie Sverre Varvin (Oslo) be‐<br />
richtete: neben der medizinischen Versorgung<br />
seien die persönliche Zuwendung und die<br />
Schaffung einer sicheren Umgebung für die<br />
Betroffenen überlebenswichtig.<br />
Am Ende ließ der Primatenforscher Ste‐<br />
phen Suomi (Bethesda) seine Rhesus‐Affen<br />
buchstäblich vorführen, wie „gute Bemutte‐<br />
rung” eine innere Sicherheit vermittelt, die vor<br />
Gefahren der Außenwelt schützt, die Expressi‐<br />
on „schlechter” Gene unterdrückt und sogar<br />
dazu beitragen kann, dass das Sicherheitsge‐<br />
fühl als traumaimmunisierendes Erbe epigene‐<br />
tisch an die nächste Generation weitergegeben<br />
wird.<br />
Offen blieb dabei, ob dieses aus dem Sozi‐<br />
algefüge einer uns nahe verwandten Tiergat‐<br />
tung gewonnene Wissen auch einer Men‐<br />
schenwelt nützt, die rapide zusammenwächst,<br />
zugleich jedoch aus den Fugen zu geraten<br />
droht: Ist eine globale Traumavorbeugung<br />
durch interkulturelle Bindungen und gemein‐<br />
sam geschaffene Sicherheitsverhältnisse denk‐<br />
bar?<br />
Aus: Frankfurter Rundschau vom 11. Februar<br />
2010, S.31.<br />
‐ Liebe auf der Couch<br />
Frauke Haß: „Als ob es plötzlich Liebe wäre”<br />
Zwölf Prozent der männlichen Psychotherapeuten räumen sexu‐<br />
elle Kontakte zu Patientinnen ein / Schwere Traumata bei den<br />
Missbrauchten sind die Folge<br />
Edith war am Ende. „Ich konnte keine Be‐<br />
ziehung eingehen, 30 hatte Angst, vor Leuten<br />
zu sprechen. Warum? Meine Mutter wurde<br />
jahrelang missbraucht und en konnte meine<br />
Nähe nicht ertragen. So wurde aus mir ein<br />
26<br />
MB der AFP <strong>Nr</strong>. <strong>85</strong>/<strong>März</strong> 2010<br />
traumatisiertes Kind.” Dann kam der Tag, en<br />
an dem etwas passieren musste.<br />
Edith (Name von der Red. geändert) wand‐<br />
te sich bedürftig und verzweifelt im Sommer<br />
2004 an einen Therapeuten — zunächst mit Er‐<br />
folg: „Keiner verstand mich, so wie er, er gab<br />
mir Sicherheit und Rückhalt und ich übertrug<br />
meine Sehnsucht auf ihn.” Schon nach weni‐<br />
gen Monaten Therapie an ging es Edith deut‐<br />
lich besser. Sie begann sogar das Studium, das<br />
sie sich rund 15 Jahre zuvor — nach dem Abi‐<br />
tur — nicht zugetraut hatte. „Und dann lag ich<br />
auf einmal mit ihm auf der Couch. Als ob es<br />
plötzlich Liebe wäre.”<br />
Warum nicht, könnte man denken. Und als<br />
Laie vermuten, dass an so etwas nun einmal<br />
vorkommen kann: Dass sich auch ein Thera‐<br />
peut in eine Patientin, ein Patient in seine The‐<br />
rapeutin verlieben kann. Oder?<br />
Kann schon, sagt die Psychotherapeutin<br />
und ‐analytikerin Monika Becker‐Fischer. Aber<br />
dann komme es darauf an, wie man damit<br />
umgeht. „Es darf dann nicht zur sexuellen<br />
Handlung kommen, und die Gefühle müssen<br />
therapeutisch bearbeitet werden”, erläutert Be‐<br />
cker‐Fischer. „Denn einer therapeutischen Si‐<br />
tuation unterliegt auch immer ein Machtver‐<br />
hältnis, weil sich die Patientin ja immer aus ei‐<br />
ner hilflosen Lage heraus an den Therapeuten<br />
wendet. Wenn dieser das Machtgefälle zu ei‐<br />
gennützigen Zwecken ausnutzt, ist das Miss‐<br />
brauch”, befindet die Autorin des Buchs „Se‐<br />
xuelle Übergriffe in Psychotherapie und Psy‐<br />
chiatrie”. Das Buch fußt auf den Ergebnissen<br />
einer Studie, die Becker‐Fischer mit ihrem<br />
Mann Gottfried Fischer im Auftrag des Bun‐<br />
desfamilienministeriums Mitte der 90er Jahre<br />
vornahm. Sie sorgte schließlich 1998 für eine<br />
Strafgesetzänderung: Therapeuten, die sich an<br />
ihren Patientinnen vergreifen, droht nun eine<br />
Gefängnisstrafe von bis zu fünf Jahren.<br />
„Aber leider gilt als sexuelle Handlung im<br />
juristischen Sinn nur die Spannbreite vom Be‐
ühren erogener Zonen bis zum sexuellen Akt<br />
an sich”, kritisiert Becker‐Fischer. „Missbrauch<br />
in der Therapie ist aber viel weiter zu fassen.<br />
Es reicht schon, wenn der Therapeut — zu 90<br />
Prozent verursachen männliche Therapeuten<br />
die Übergriffe — eine private Beziehung ein‐<br />
geht, und so seine Interessen in den Vorder‐<br />
grund stellt. Das ist emotionaler Missbrauch.”<br />
Welch fatale Folgen solch unprofessionelles<br />
Verhalten haben kann, hat Mathilde S. (Name<br />
geändert) erlebt, die sich in ihren Therapeuten<br />
verliebte und ihm das nach wochenlangem ge‐<br />
genseitigem Flirt schließlich gestand — was<br />
die Therapie sofort beendete. „Er sagte, dass<br />
aus uns natürlich nichts werden könne, wegen<br />
des Arzt/Patienten‐Verhältnisses. Es sei mög‐<br />
lich, dass wir uns in einigen Wochen mal auf<br />
einen Kaffee irgendwo treffen könnten. Er ver‐<br />
sprach, dass wir uns wiedersehen würden:<br />
„Ich halte mein Wort!ʹ Vier Wochen vergingen,<br />
und ich schrieb ihm mehrmals. Aber es kam<br />
keine Antwort. Ich war inzwischen wieder in<br />
meiner Depression, fühlte mich verlassen und<br />
ausgenutzt, war einfach nur verwirrt. Ich<br />
schrieb ihm von meiner Verzweiflung und<br />
auch von den Selbstmordgedanken, aber er re‐<br />
agierte nicht mehr.”<br />
Obwohl der Therapeut offenbar selbst<br />
kaum aktiv wurde, hätte er Monika Becker‐<br />
Fischer zufolge seine Patientin auf keinen Fall<br />
allein lassen dürfen. „Wenn er merkt, dass sich<br />
ein Interesse an der Patientin regt, muss er auf<br />
jeden Fall eine Supervision machen und seine<br />
Gefühle klären, bei Bedarf das Geschehene in<br />
einer eigenen Therapie aufarbeiten.” Die The‐<br />
rapie abzubrechen, sei meist richtig. „Aber er<br />
muss seine Patientin an einen anderen Thera‐<br />
peuten vermitteln. Er darf sie nicht einfach fal‐<br />
len lassen, sonst ist sie doppelt verlassen: Ihre<br />
Hoffnung auf Heilung und auf eine private<br />
Beziehung werden enttäuscht.”<br />
Wie bei Mathilde, die in der Folge fürchter‐<br />
lich litt: „Er wusste ja, wie schwer ich mich mit<br />
Vertrauen tue, wie oft ich in meinem Leben be‐<br />
reits im Stich gelassen wurde. Und gerade er<br />
reißt diese Wunde wieder auf. Für mich ging<br />
es von da an stetig bergab. Ich war wieder sehr<br />
depressiv und ich konnte meinen Alltag nicht<br />
mehr bewältigen. Ich habe dann meine Schule<br />
abgebrochen, bin wieder zurück zu meinen El‐<br />
tern gezogen. Ich habe mich vollkommen von<br />
der Welt abgeschottet, und es hat eineinhalb<br />
Jahre gedauert, bis ich nicht mehr jede Nacht<br />
geweint habe.”<br />
27<br />
MB der AFP <strong>Nr</strong>. <strong>85</strong>/<strong>März</strong> 2010<br />
Drei von vier Missbrauchsopfern in der<br />
Therapie sind traumatisiert, hat Christiane Ei‐<br />
chenberg, Psychologin an der Uni Köln und<br />
Autorin einer aktuellen Studie zum Thema<br />
(PPmP, Band 59, S.337‐344, <strong>2009</strong>) herausge‐<br />
funden. Symptome seien: emotionaler Rück‐<br />
zug, Misstrauen, Depression, Schlaf‐ und Kon‐<br />
zentrationsstörungen, Selbstmordgedanken,<br />
Angst. „Bei 60 Prozent der von ihr 77 im Inter‐<br />
net Befragten verstärkten sich die Beschwer‐<br />
den, wegen derer sie in Therapie gegangen<br />
waren, bei 60 Prozent kamen neue Symptome<br />
hinzu.” Eichenberg empfiehlt, schon frühzeitig<br />
auf Warnsignale zu reagieren.<br />
Eine Grenzüberschreitung sei es schon,<br />
wenn der Therapeut von seinem Privatleben<br />
berichte, „Termine in die Abendstunden legt,<br />
häufig anruft, Stunden überzieht, die Patientin<br />
bittet, auf die Kinder aufzupassen, mit ihr ins<br />
Restaurant geht”.<br />
Der Therapeut sei aus Sicht der Patientin<br />
eine Elternperson, an die sich das hilflose Kind<br />
in seiner Not wende: „Deshalb ist der Miss‐<br />
brauch so traumatisch wie für ein Kind”, sagt<br />
Becker‐Fischer, „sein Vertrauen wird zutiefst<br />
erschüttert.”<br />
Anders als bei Mathilde war Ediths Bezie‐<br />
hung zu ihrem Therapeuten ausgeprägt sexua‐<br />
lisiert: „Wir haben uns monatelang regelmäßig<br />
getroffen und wurden immer intim.” Ange‐<br />
fangen habe alles ganz subtil. „Er hat mir sug‐<br />
geriert, ich würde meine Sexualität in der Ehe<br />
nicht ausleben und dass meine Ängste damit<br />
zusammenhingen.” Den Sex lieferte er dann<br />
gleich selbst. Die Zudringlichkeiten des Thera‐<br />
peuten sorgten zunächst einmal dafür, dass<br />
Edith abstürzte und Psychopharmaka brauch‐<br />
te: „Es ging mir richtig schlecht: Ich stand vor<br />
dem Spiegel und sagte mir: Es kann doch nicht<br />
sein, dass ein Arzt so etwas tut.” Und dann:<br />
„Du hast Dich prostituiert und wirst mit Tab‐<br />
letten bezahlt.”<br />
Erst nach Monaten und einer Recherche im<br />
Internet wurde Edith so richtig klar, „dass ein<br />
Therapeut das nicht darf”. Sie stellte ihn zur<br />
Rede und er rief die Polizei, weil sie sich wei‐<br />
gerte zu gehen. „Er sagte mir, ich hätte einen<br />
Schizophrenie‐Schub gehabt, um mir zu sug‐<br />
gerieren, ich sei verrückt, und mir glaube ja<br />
sowieso keiner. Das Schlimme ist: Ich fühlte<br />
mich ja auch total verrückt.” Am nächsten Tag<br />
ging sie in die Psychiatrie statt zur Polizei.<br />
Ein Einzelfall? Keineswegs. Befragungen<br />
zufolge gibt fast jeder neunte männliche The‐
apeut zu, schon einmal mit einer Patientin in‐<br />
tim gewesen zu sein, betont Eichenberg.<br />
Triebfedern der meisten regelmäßig miss‐<br />
brauchenden Therapeuten sind laut Becker‐<br />
Fischer Wunscherfüllung oder Rache. Vieles<br />
spreche dafür, „dass bei bestimmten Thera‐<br />
peuten in der Begegnung mit sexuell ausge‐<br />
beuteten Patienten eigene Traumata aus der<br />
Kindheit reaktiviert werden”. Viele seien Wie‐<br />
derholungstäter, älter, sehr erfahren, „sie sit‐<br />
zen oft in Führungspositionen, sind Lehrthe‐<br />
rapeuten oder gar <strong>Mitglieder</strong> von Ethikkom‐<br />
missionen.”<br />
Möglich ist das nur wegen der begleitend<br />
auftretenden Persönlichkeitsspaltung: „Der er‐<br />
fahrene, oft renommierte Therapeut realisiert<br />
nicht, was seine andere Seite Stunden später<br />
mit der Patientin auf der Couch macht. Es ist<br />
ihm nicht unbewusst, aber er kann das nicht<br />
zusammenführen.”<br />
Es sei alarmierend, dass Traumatisierungen<br />
der angehenden Therapeuten in deren Lehr‐<br />
therapien offenbar nicht oft genug auffallen,<br />
sagt Becker‐Fischer: Viele hätten Angst, dass<br />
sie nicht Therapeut werden können, wenn sie<br />
zu‐geben, dass sie Schlimmes erlebt haben.<br />
„Die Ausbildungsinstitute müssen hier auf‐<br />
merksamer werden.” Doch Becker‐Fischer<br />
kennt viele schwarze Schafe unter den Institu‐<br />
ten: „Man weiß, dass Grenzüberschreitungen<br />
dort an der Tagesordnung sind”.<br />
Auch Eichenberg berichtet von einem Fall,<br />
wo der Lehranalytiker „mit einer Lehranaly‐<br />
sandin et‐was angefangen hat: Als sie sich<br />
verwirrt an einen Kollegen wandte, empfahl<br />
der ihr, das Institut zu wechseln.” Ärgerlich<br />
nennt sie das: „So wird verschleiert.”<br />
Becker‐Fischer fordert deshalb dringend,<br />
„eine bessere Aufklärung des gesamten Be‐<br />
rufsstandes der Psychotherapeuten und Psy‐<br />
choanalytiker, eine Sensibilisierung für grenz‐<br />
wertiges Verhalten und klare Regeln, was zu<br />
tun ist, sobald man vom Missbrauch im Kolle‐<br />
genkreis erfährt”. Außerdem appelliert sie an<br />
ihre Kollegen, Patientinnen, die von sexuellem<br />
Missbrauch in der Therapie berichten, künftig<br />
mehr Glauben zu schenken.<br />
Wie Edith, der von ihrer Folgetherapeutin<br />
so lange zugesetzt wurde, bis sie ihren Thera‐<br />
peuten vor Gericht entlastete und prompt<br />
wieder in ein Verhältnis mit dem Mann rutsch‐<br />
te. Sie brauchte vier Monate in einer Klinik, bis<br />
sie wie‐der Lebensfreude empfinden konnte.<br />
„Man muss den Täter zwingen, Verantwor‐<br />
28<br />
MB der AFP <strong>Nr</strong>. <strong>85</strong>/<strong>März</strong> 2010<br />
tung zu über‐nehmen, seine eigenen Traumata<br />
aufzuarbeiten. Ich habe zu lange gedacht, ich<br />
könnte ihn mit meiner kindlichen Liebe heilen,<br />
aber das ist Schwachsinn.”<br />
Monika Becker‐Fischer, Gottfried Fischer: Sexuelle Übergriffe<br />
in Psychotherapie und Psychiatrie, Asanger Verlag 2008, 222<br />
Seiten<br />
Bei Befragungen von Psychotherapeuten, ob sie in ihrem Leben je<br />
sexuelle Kontakte zu Patienten hatten, bejahen das rund zwölf<br />
Prozent der männlichen Therapeuten und etwa drei Prozent der<br />
weiblichen Therapeuten, so die Psychotherapeutin Monika Becker-<br />
Fischer. US-Haftpflichtversicherer schätzen, dass rund 20 Prozent<br />
der Therapeuten mindestens einmal in ihrer Laufbahn sexuelle Intimitäten<br />
mit Patienten aufnehmen. „Wir gehen davon aus, dass<br />
mindestens zehn bis 20 Prozent der Patientinnen mindestens einmal<br />
Opfer von sexuellem Missbrauch sind”, so Becker-Fischer. 90<br />
Prozent der missbrauchen-den Therapeuten seien Männer. In einer<br />
Studie der Psychologin Christiane Eichenberg, die auf der Forschung<br />
Becker-Fischers fußt, gaben fast 30 Prozent der Befragten<br />
an: „Die Täter waren Frauen.”<br />
Fast immer seien die Täter selbst traumatisiert. Hier gibt es<br />
zwei Tätertypen:<br />
Rache steht bei einem Teil der Täter im Vordergrund: „Er<br />
wehrt sein Kindheitstrauma ab, indem er sich mit dem damaligen<br />
Täter identifiziert und schützt sich so vor der Erinnerung an die<br />
eigene Hilflosigkeit und Ohnmacht”, so Becker-Fischer. Ihn beherrsche<br />
die Wunschphantasie des Allmächtigen, der nie in eine verletzende<br />
Lage geraten kann. Deshalb meidet er intensivere Beziehungen.<br />
Eichenberg zufolge neigt er zu Gewalt.<br />
Der Wunscherfüllungstypus verwickelt die Patientin in eine<br />
exklusive Zweierbeziehung und teilt mit ihr die Phantasie, dass<br />
nur er sie retten kann. Im Gegenzug rutscht er allmählich selbst in<br />
die Rolle des Hilfsbedürftigen und macht die Patientin zu seinem<br />
Rettungsengel - sexuelle Hilfeleistung inbegriffen.<br />
Nicht immer müssen laut Becker-Fischer Traumata bei den<br />
Tätertherapeuten zugrunde liegen: Machtbedürfnisse, sadistische<br />
Neigungen oder auch Naivität und Unerfahrenheit seien in einzelnen<br />
Fällen Hintergrund der Taten.<br />
Mit Haft bis zu fünf Jahren können Therapeuten belegt werden,<br />
die sexuelle Kontakte mit Patienten haben. Das steht seit 1998<br />
im Strafgesetzbuch. Eichenbergs Studie belegt: „Die meisten Betroffenen<br />
wissen nichts von dem Gesetz.”<br />
Missbrauch in der Therapie muss dringend in den Lehrplan<br />
der Psychotherapeuten-Ausbildung, fordert Eichenberg. An Beispielen<br />
müsse Patienten per Handzettel klar gemacht werden, welches<br />
Verhalten unethisch und welches in Ordnung sei. Auch fehle in<br />
Deutschland eine Anlaufstelle nach dem Vorbild der Lizenzbehörden<br />
in den USA. fra<br />
Eine Infobroschüre gibt es im Internet: www.<br />
bmfsfj.de/Kategorien/Publikationen/Publikationen,did=25588.html<br />
Aus: Frankfurter Rundschau vom<br />
23.‐24. Januar 2010, S.14‐15.<br />
‒ Pierre‐Henri Castel: Krankheit des Geistes<br />
Manche reduzieren den Wahnsinn auf eine neuronale<br />
Disfunktion. Andere sehen sie in Beziehung zur Macht. Einen dritten<br />
Weg schlägt Pierre-Henri Castel in einem subtilen Essai vor.<br />
Pierre‐Henri Castel: L’Esprit malade ‒ Cerveaux, folies, indivi‐<br />
dus, Paris (Ithaque «Philosophie, anthropologie, psychologie»)<br />
2010, 353 S., 25 Euro<br />
Das neue Buch des Philosophen und Psy‐<br />
choanalytikers Pierre‐Henri Castel leitet eine<br />
neue Reihe im Verlag Ithaque ein, und zwar in<br />
jeglicher Beziehung: es ist hierzu das erste<br />
Werk, doch man könnte auch glauben, dass es<br />
den Beginn eines neuen Stils in der französi‐<br />
schen Philosophie des Geistes ankündigt. Zu‐<br />
nächst allerdings scheint diese Essai‐<br />
Sammlung mit dem Titel L’Esprit malade nur
der Versuch einer erneuten und unendlichen<br />
Aufklärung über eine Tautologie zu sein, was<br />
sich folgendermaßen zusammenfassen ließe:<br />
im Falle der «mentalen Krankheit» ist … das<br />
Mentale krank»; oder, wenn man das lieber<br />
hört: der Geist. Das ist sicherlich eine Tautolo‐<br />
gie, aber nichts weniger als evident!<br />
Denn diese These steht der herrschenden<br />
Position in den Neurowissenschaften konträr<br />
gegenüber, für die der Geist nichts weiter als<br />
ein Ensemble neuronaler Aktivitäten ist.<br />
Castels These lehnt zugleich aber auch die<br />
umgekehrte, einschränkende Hypothese ab,<br />
die im Wahnsinn die Wirkung der gesell‐<br />
schaftlichen Macht sieht und die gesamte Psy‐<br />
chiatrie als Pseudo‐Wissenschaft geißelt, die<br />
nichts weiter tue als «die Geisteskrankheit …<br />
als einen Gegenstand zu reproduzieren, auf<br />
den sie ihre normative Kraft ausüben kann».<br />
Hier stellt sich der Autor explizit gegen Michel<br />
Foucault und nimmt ihm gegenüber eine be‐<br />
merkenswert deutliche Gegenposition ein.<br />
Nach Castel müsste man dagegen «die Fra‐<br />
gen einer Philosophie des Geistes auf den Ar‐<br />
beitstisch der Psychiater legen» und das «Men‐<br />
tale» als solches in seinem theoretischen und<br />
praktischen Zusammenhang verstehen, der<br />
sich zwischen dem Zerebralen und der sozia‐<br />
len Einbettung des Subjekts abspielt. Es ist si‐<br />
cherlich, den Geist mit dem Gehirn gleichzu‐<br />
setzen. Doch umgekehrt darf man aber auch<br />
nicht glauben, dass die Mentalitäten und die<br />
Vorstellungen «wie der Geist Gottes über den<br />
Wassern des Realen» der neuro‐biologischen<br />
Mechanismen schweben. Das Buch lässt sich<br />
demnach kurz so zusammenfassen: L’Esprit<br />
malade «versucht beide Enden einer Kette zu‐<br />
sammenzuhalten; es bewegt sich zwischen ei‐<br />
nem molekularen und genetischen Determi‐<br />
nismus und dem Leben als einer Beziehung<br />
der Menschen untereinander.»<br />
Die Gelehrsamkeit und die Subtilität, mit<br />
denen der Autor dieses Forschungsprogramm<br />
entfaltet, sind stupend. Man denke nur an das<br />
erste Kapitel, das Tierbeispiele untersucht, die<br />
in der Bio‐Psychiatrie benutzt werden, um die<br />
rein organischen Ursprünge bestimmter<br />
menschlicher Pathologien zu erklären. Oder an<br />
den Essai über das Gilles‐de‐la‐Tourette‐<br />
Syndrom. Oder auch an die packende Umwer‐<br />
tung der Debatte über die komplexen Mecha‐<br />
nismen, die bei den Schizophrenen «die nor‐<br />
male Vorstellung, sich selbst zu sein» und das<br />
Bewusstsein hemmen, der Autor der eigenen<br />
29<br />
MB der AFP <strong>Nr</strong>. <strong>85</strong>/<strong>März</strong> 2010<br />
Handlungen zu sein, die dann wiederum der<br />
erschreckenden Erfahrung ausgesetzt sind,<br />
dass man durch einen Anderen «zur Tat ge‐<br />
trieben» wird.<br />
Doch wohl am besten zeigt sich die Metho‐<br />
de des Autors in dem Kapitel mit dem Titel<br />
«Die nicht zu verbergende Scham». Er geht hier<br />
zunächst von einer in gewissem Sinne natura‐<br />
listischen Position aus, die die Scham, diesen<br />
eminent moralischen Affekt, auf bloßes psy‐<br />
chobiologisches Verhalten zurückführt, das<br />
seinen Ursprung im «Unterwürfigkeitsverhal‐<br />
ten» der Primaten besitze. Danach untersucht<br />
er einige ziemlich reduktionistischen Entwick‐<br />
lungen dieser These, die sich abmühen, die<br />
Scham auf einen rein neurophysiologischen<br />
Mechanismus zurückzuführen ‒ der z.B. mit<br />
der Schwankung des Serotoninspiegels zu‐<br />
sammenhängt. Ganz nebenbei lässt Castel da‐<br />
bei durchblicken, dass, wenn man an einer sol‐<br />
chen Erklärung festhält, man die gesamte Be‐<br />
deutung des Begriffs ‚Scham‘ entleert, der<br />
doch, ob man will oder nicht, ein Teil unserer<br />
Sprache ist und darin sogar eine höchst zentra‐<br />
le Stelle einnimmt. «Alles in allem: wenn die<br />
natürlichen Bedingungen die Scham determi‐<br />
nieren würden, dann gäbe es an sich keine<br />
Scham, über die man sich zu schämen brauch‐<br />
te!» Es würde nichts nützen, wenn man zum<br />
Beispiel alles, was uns die Ethnologie und die<br />
Neurobiologie an Hinweisen über unsere Ge‐<br />
fühle erbringen, strikt abweisen würde. Und<br />
wenn man dieses Wissen über die tatsächli‐<br />
chen Wirkungen dieses Begriffs nicht einer<br />
gründlichen logischen und linguistischen Un‐<br />
tersuchung unterzöge, käme das einem Ver‐<br />
zicht gleich zu begreifen, «welche Funktion ich<br />
der Scham in meinen Interaktionen mit meinen<br />
Mitmenschen, oder, noch schlimmer, in mei‐<br />
nem eigenen moralischen Bewusstsein beimes‐<br />
sen muss».<br />
Man versteht nun, dass Castel auf einem<br />
dünnen Seil balanciert. Denn er zwingt sich<br />
zum einem zur Analyse einzelner Gegen‐<br />
standbereiche und zugleich auch zur Analyse<br />
eines Netzes von Begriffen, die äußerst ver‐<br />
schiedenen Faktoren entstammen: rein materi‐<br />
alistische Kausalitäten, die die mentalen Stö‐<br />
rungen an neurologischen Dysfunktionen<br />
festmachen (und hier vermutlich an ihren<br />
Wurzeln in der Evolutionsbiologie); das logi‐<br />
sche, von Klinikern erstellte Klassifikationssys‐<br />
tem der Symptome; die «Grammatik» (im Sinne<br />
Wittgensteins), nach der die Klagen der Patien‐
ten ausgedrückt werden; die kollektiven sym‐<br />
bolischen Systeme, mit denen sich die Kranken<br />
herumschlagen und über die wiederum andere<br />
(und hier vor allem die Therapeuten) ihren<br />
«Deutungen» Sinn zu geben versuchen; oder<br />
auch die sozialen Institutionen, die diese Be‐<br />
ziehungen regeln und die die Sprechakte kon‐<br />
stituieren.<br />
Das ist ein riesiges Unterfangen. Es geht<br />
demnach nicht nur um eine strenge Theorie,<br />
sondern auch um die Wirksamkeit, ja sogar<br />
um die Ethik der Behandlung. Wenn man<br />
glaubt, das psychische Leiden sei nur der äu‐<br />
ßere Ausdruck substanzieller Veränderungen<br />
in den Nervenbahnen, dann würde man den<br />
Wahnsinnigen auf sein Gehirn reduzieren und<br />
völlig vergessen, auf seine Stimme, auf sein<br />
Wort zu hören und damit «den machtvollen<br />
Ruf in der psychotischen Erfahrung glattho‐<br />
beln». Sieht man aber, umgekehrt, in der «An‐<br />
kündigung eines Wahns» nur Wirkungen ge‐<br />
sellschaftlicher Kräfte und Mächte, wie das in‐<br />
nerhalb einer bestimmten Foucault’schen Or‐<br />
thodoxie getan wird, dann würde das verken‐<br />
nen, dass die Psychiatrie eben nicht ausschließ‐<br />
lich durch soziale oder politische Normen be‐<br />
stimmt, wenn nicht durch diese sogar manipu‐<br />
liert ist: Sie trägt auch zur Konstruktion wis‐<br />
senschaftlicher Normen bei. Beide symmetri‐<br />
schen Irrtümer, so Castel, verkennen den Sinn,<br />
den die Hauptakteure ihren Handlungen bei‐<br />
messen.<br />
Das Ineinander so vieler Disziplinen und<br />
Hilfskonstruktionen machen die Gedanken‐<br />
gänge des Buches manchmal zu einem regel‐<br />
rechten Labyrinth und die Lektüre wird von<br />
daher oft anstrengend und erfordert große<br />
Geduld, auch wenn Castels Diskurs dabei<br />
niemals in der Sackgasse einer Konfusion lan‐<br />
det. Ganz im Gegenteil: seine Darlegungen<br />
sind meist treffend, oft auch langatmig, sie<br />
finden aber zu dem ihnen innewohnenden Zu‐<br />
sammenhang in der Art und Weise, wie er be‐<br />
harrlich bestimmte zentrale traditionellen<br />
Probleme der reinen Philosophie herausarbei‐<br />
tet, die er zugleich neu denkt. So etwa auch die<br />
alte Frage des Zusammenhangs von Körper<br />
und Geist (der neuerdings im Angelsächsi‐<br />
schen unter dem Begriff «mind‐body‐problem»<br />
fungiert), die Natur des Selbstbewusstseins<br />
oder auch der Zusammenhang von Denken<br />
und Sprache. Das lässt sich nicht besser als in<br />
den Worten von Henri‐Pierre Castel selbst<br />
formulieren: wenn «die Menschheit ein fortge‐<br />
30<br />
MB der AFP <strong>Nr</strong>. <strong>85</strong>/<strong>März</strong> 2010<br />
setztes Experiment ist», wie er schreibt, dann<br />
ist das auch der Fall mit der wirklichen Philo‐<br />
sophie. Stéphane Legrand<br />
Aus: Le monde des livres vom 12. Februar<br />
2010, S.6. ‒ Aus dem Französischen von H.‐P.<br />
Jäck.<br />
‒ Slavoj Žižeks neue Sicht auf den Kapitalismus<br />
Éric Aeschimann: Slavoj Žižek und der Aus‐<br />
weichschritt des Kommunismus ‐ Die Affäre<br />
Madoff, der chinesische Boom… der slovenischePhilosoph<br />
wirft einen schrägen Blick auf den Kapitalismus und entdeckt<br />
dessen fetischistischen Kern<br />
Slavoj Žižek: Après la tragédie: la farce! ou comment<br />
l’histoire se répète, Paris (Flammarion, Bibliothèques<br />
des savoirs) 2010, 141 S., 20 Euro<br />
Der slovenische Philosoph und Neo‐<br />
Kommunist Slavoj Žižek ist allseits wegen sei‐<br />
ner Witzchen bekannt, mit denen er seine Vor‐<br />
träge und Bücher krönt. Aber ein wenig sind<br />
es inzwischen immer dieselben, endlos taucht<br />
dabei der allgemeine Gedanke von der umge‐<br />
kehrten Welt immer wieder auf: dass eine Sa‐<br />
che ohne Weiteres in ihr Gegenteil umschlagen<br />
kann. Auch in seinem neuen Buch «Après la<br />
tragédie, la farce!» greift er die alte Anekdote<br />
vom Fetisch (ohne sie, wie wir noch sehen<br />
werden, kindisch zu finden!) wieder auf, wo‐<br />
nach sich ein Gast überrascht zeigt, als er ein<br />
Hufeisen an der Eingangstür des Landhauses<br />
des berühmten Physikers findet, der ihm na‐<br />
türlich sagt, dass er keinesfalls abergläubisch<br />
sei, aber: «Ich habe mir sagen lassen, dass das<br />
trotzdem wirkt, auch wenn man nicht daran<br />
glaubt!» So gehe das, nach Meinung von Žižek,<br />
auch mit dem Kommunismus: niemand glaubt<br />
mehr daran, aber es könnte vielleicht dennoch<br />
funktionieren!<br />
Žižek ist von seiner Ausbildung her<br />
Lacanianer; sein Doktorvater war Jacques‐<br />
Alain Miller. Der Glaube ist für ihn der Eck‐<br />
stein des menschlichen Geistes, das<br />
alleranfänglichste Begehren, das die Wünsch<br />
zu Worten werden lässt, ihnen Gestalt und<br />
Kraft verleiht. Es ist gerade der Zyniker, der an<br />
nichts glaubt, der sich täuscht ‒ wie etwa Hen‐<br />
ry Kissinger, der sich im Sommer 1991 mit den<br />
Putschisten gegen Gorbatschow treffen wollte,<br />
und nicht wissen konnte, dass dieser Putsch<br />
nach drei Tagen jämmerlich in sich zusam‐<br />
menbrach. «Als die sozialistischen Regime mehr<br />
tot als lebendig waren, glaubte dieser Kissinger, ei‐<br />
nen langfristigen Pakt mir ihm eingehen zu kön‐<br />
nen! […] Die Zyniker sind die „non‐dupes qui<br />
errent“; ihnen entgeht der symbolische Effekt der<br />
Illusionen. […] Was ihnen entgeht, ist ihre eigene
Naivität.» Diese Art von Umkehrung ist die Il‐<br />
lustration eines Ausspruchs von Lacan, der<br />
genauso berühmt wie dunkel ist: «le non‐dupe<br />
erre!» ‒ «le nom‐du‐père».<br />
Ein Lacanianer als Kommunist? Alain Ba‐<br />
diou hat schon diese «Hypothese über den<br />
Kommunismus» aufgestellt 32 und Žižek nimmt<br />
den Ball nochmals auf, kehrt aber den Sinn um<br />
und macht daraus ein leeres Feld: Nach Žižek<br />
ist der Kommunismus eine Art Idee vom<br />
«Notausstieg», der sich anhand von vier Prob‐<br />
lemen des heutigen Kapitalismus stellt, sog.<br />
«vier Antagonismen»: ökologische Bedrohung,<br />
Einbahnstraße des geistigen Eigentums, Gen‐<br />
manipulation und, zuletzt, die Vervielfälti‐<br />
gung von Mauern und territorialen<br />
Segregierungen. Alle vier werfen die Frage<br />
nach dem „gemeinen“, dem „communis“ auf,<br />
d.h. nach dem, woraus der Mensch wirklich<br />
besteht, was seine «Substanz» ausmacht (Ran‐<br />
cière nennt das «le sensible»). Der Kapitalismus<br />
neigt demnach dazu, die Substanz zu privati‐<br />
sieren: «Die Wiederbelebung des Begriffs Kommu‐<br />
nismus […] erlaubt es, den „Ausschluss“ als einen<br />
Proletarisierungsprozess all jener zu verstehen, die<br />
ihrer eigenen Substanz beraubt sind.»<br />
Bei Žižek erscheint der Kommunismus als ei‐<br />
ne Art Dezentralisierung des Blicks, eine «Pa‐<br />
rallaxe», um den Titel seines letzten Buches<br />
aufzugreifen. 33 Eine Art Ausfallschritt, die ihn<br />
verschiedene Figuren in anderem Lichte be‐<br />
trachten lässt, deren widersprüchliche Struktu‐<br />
ren er dann enthüllen kann. So kann er die Fi‐<br />
nanzkrise, die Affäre Madoff, das Marketing<br />
von Starbucks, den chinesischen Boom oder<br />
auch die Erinnerungen an einige ehemaligen<br />
amerikanischen Präsidenten kommentieren.<br />
Dabei sind die Verkettungen rein assoziativ<br />
und zufällig, alles erscheint wie ein Spazier‐<br />
gang durch einen Freizeitpark, der einem nur<br />
die einzige Sicherheit bietet, alles sei bloßer<br />
Schein.<br />
So kann Žižek schreiben, dass Nixon «der<br />
letzte authentisch‐tragische US‐Präsident war […].<br />
Ein Schurke, doch ein Schurke als Opfer der Kluft,<br />
die seine Ideale und seinen Ehrgeiz von der Realität<br />
und seinen wirklichen Taten trennte». Er be‐<br />
schreibt Reagan als einen «post‐ödipalen […],<br />
postmodernen […] Teflon‐Präsidenten», von dem<br />
32 Alain Badiou/Slavoj Žižek, L‘Idée du communisme; ein<br />
Sammelband mit Beiträgen von Rancière, Nancy, Negri,<br />
Hardt, Vattimo u.a. über eine Tagung vom <strong>März</strong> <strong>2009</strong> in London;<br />
Édition Lignes, 336 S., 20 Euro.<br />
33 Fayard 2008.<br />
31<br />
MB der AFP <strong>Nr</strong>. <strong>85</strong>/<strong>März</strong> 2010<br />
man nicht glauben sollte, er «klebe» an seinem<br />
Programm und sei jeder Kritik gegenüber un‐<br />
empfänglich gewesen: seine sei Popularität mit<br />
jedem seiner Schnitzer gestiegen. Das Modell,<br />
für alles verantwortlich zu sein, um nichts<br />
mehr verantworten zu müssen, floriere von<br />
Bush bis Berlusconi immer mehr.<br />
Ein Wort trifft den Neo‐Kapitalismus am<br />
besten: Fetischismus. In «Parallaxe» analysierte<br />
Žižek den Übergang des Kapital, wo Marx ge‐<br />
zeigt hat, wie die Waren den Menschen erset‐<br />
zen und schließlich untereinander ‒ menschli‐<br />
che! Beziehungen eingehen. Dieser Prozess be‐<br />
rührt nun die Ideologien selbst, die immer<br />
noch nicht zu ihrem Ende gefunden haben,<br />
sondern selbst zu Fetischen geworden sind. Es<br />
tauchen nun zwei Verhaltensweisen auf: Ei‐<br />
nerseits praktiziert man den Fetischismus, oh‐<br />
ne daran zu glauben: wie der Liberale, der<br />
«permissive Zyniker», der langfristig zum Aus‐<br />
sterben verurteilt ist, aber kurzfristig zum poli‐<br />
tischen Parteifreund geworden ist: für Žižek<br />
üben selbst die formalen, fetischisierten Men‐<br />
schenrechte Wirkung auf das Reale aus. Ande‐<br />
rerseits begeht man umgekehrt denselben Irr‐<br />
tum: man glaubt kritiklos, man verwechselt<br />
das Reale mit dem Symbol, das es repräsen‐<br />
tiert. Hier haben wir den Fundamentalisten,<br />
den Populisten, und auch manchmal den<br />
Linksradikalen, und zwar immer dann, wenn<br />
sich dieser im Protest ergeht, d.h. sich mit dem<br />
Islamisten nach dem Motto «der Feind meines<br />
Feindes ist mein Freund» verbündet (ein auf<br />
die Freundschaft angewendeter Fetischismus).<br />
«Der gefährlichste Philosoph des Abendlandes»<br />
zitiert ihn der Buchumschlag, nach einem Zitat<br />
aus der amerikanischen Zeitschrift New<br />
Republic. Hier trägt man aus verkaufstechni‐<br />
schen Gründen ein wenig zu dick auf, denn im<br />
Grunde ist Žižek ein Moralist ‒ im Sinne eines<br />
Chronisten der Sitten der Zeit ‒ und wird<br />
deswegen unterschätzt. Moralist ist er zum<br />
Beispiel, wenn er der Linken vorwirft, sich<br />
«dem Narzissmus als einer verlorenen Sache»<br />
hinzugeben, nicht mehr auf ein universales<br />
Wunder zu warten ‒ denn das Universale, das<br />
ist jeder von uns: «Wir sind das, was wir erwar‐<br />
ten!» Das Beispiel: Die Sklaven von Haiti, die<br />
sich im Namen derselben Ideale der französi‐<br />
schen Revolution gegen die französischen Ko‐<br />
lonialherrn aufgelehnt haben. Das war wieder<br />
eine Umkehrung, und sie verweist wiederum<br />
auf eine andere, denn, nach Susan Buck‐Morse,<br />
inspirierte ebendieselbe haitianische Revolte
die Dialektik von Herr und Knecht, den<br />
Grundstein der Hegel’schen Philosophie. Hier<br />
zeigt sich eine unerwartete Begegnung des<br />
deutschen Idealismus und karibischem Postko‐<br />
lonialismus, aus der Žižek am Ende eine Defi‐<br />
nition ableitet, die in der gegenwärtigen Zeit<br />
ein besonderes Echo findet: «“Hegel und Haiti“<br />
[…], das ist die knappste Formel des Kommunis‐<br />
mus.»<br />
Zupančič jenseits des heutigen Moralisierens<br />
Die slovenische Philosophin und nahe Be‐<br />
kannte von Žižek, Alenka Zupančič, beschäf‐<br />
tigt sich wie er mit dem Diskurs der heutigen<br />
Moral auf dem Hintergrund vergangener Me‐<br />
taphysik. In ihrem neusten Buch entziffert sie,<br />
wie der aktuelle moralische Diskurs (ethische<br />
Gesetze, Obsessionen des Bösen, Verwerfung<br />
des Absoluten, Verlangen nach Autorität, Ma‐<br />
nipulationen mit falschen Dilemmata) das<br />
ethisch Gute als Lager unveränderlicher<br />
Wahrheiten begreift, die man auf alle Situatio‐<br />
nen bloß noch anzuwenden braucht. Bei Kant<br />
aber, zu dessen Auffassung von der Moral<br />
man sich allseits bekennt, ist das ethisch Gut<br />
etwas ganz anderes: eine stets von neuem zu<br />
erzeugende Haltung, eine endlose Bewegung<br />
zum Realen hin, ein unmöglicher und vitaler<br />
Trieb ‒ letztlich also ein Äquivalent zu Lacans<br />
Begehren. Der Pragmatismus der Liberalen<br />
fordert von jedem, niemals sein «Wohlergehen<br />
einer bloßen Idee zu opfern», die Gesetze nur<br />
für seine eigenen Interessen zu benutzen, nie‐<br />
mals das Unmögliche zu wollen, «freiwillig<br />
seine Unfreiheit zu wählen». Zupančič gibt<br />
hier in einem mit großer Eleganz geschriebe‐<br />
nen Buch offen kund, dass die Ethik im Gegen‐<br />
teil dazu ein Experiment der Freiheit ist, der<br />
man ‒ wie dem Begehren ‒ nachgehen, aber<br />
nie nachgeben muss. É.A.<br />
Aus: Libération Livres vom 21. Januar 2010,<br />
S.VII. ‒ Aus dem Französischen von H.‐P. Jäck.<br />
‒ Gérard Wajman und die Tyrannei des Blicks<br />
Leute, zittert, denn ihr filmt euch selbst! ‐ Der<br />
Psychoanalytiker Gérard Wajman beschreibt die<br />
neue Tyrannei des Blick zwischen Videoüberwa‐<br />
chung und Ideologie der Transparenz<br />
In einem Pariser Mietshaus wurde kürzlich<br />
eine Vorrichtung zur totalen Videoüberwa‐<br />
chung installiert. Die Bewohner können von<br />
ihren Fernsehgeräten aus den Gebäudekom‐<br />
plex beobachten. Dank eines solchen «Closed<br />
Circuit TV» (CCTV), das in Großstädten (vor<br />
allem in London) wie Pilze aus dem Boden<br />
32<br />
MB der AFP <strong>Nr</strong>. <strong>85</strong>/<strong>März</strong> 2010<br />
schießt, kann jeder sein Treppenhaus, ja sogar<br />
sein eigenes Wohnzimmer überwachen. «Die<br />
Bedeutung des «closed circuit» über Fernsehen<br />
lässt sich hier klar erkennen: es ist der «closed<br />
cicuit»‐Blick, der vollständige und allumfas‐<br />
sende Blick. Das führt letztlich dazu, dass der<br />
Zuschauer sich selbst auf seinem Fernsehgerät<br />
betrachtet, wie er sich betrachtet und sich da‐<br />
bei selbst überwacht!», kommentiert Gérard<br />
Wajman.<br />
Das ist eines der Symptome, die zum klini‐<br />
schen Bild gehören, das der Psychoanalytiker<br />
und der Schriftsteller von einer Epoche zeich‐<br />
net, die sich mit Haut und Haaren dem Kult<br />
einer neuen Tyrannei verschrieben hat: L’ŒIL<br />
ABSOLU ‒ Das absolute Auge. Die Diagnose<br />
ist beängstigend: «Ein Auge ohne Lider wacht<br />
über die Welt. Der Blick ist der neue Levia‐<br />
than. Es geht darum, alles zu sehen und alles<br />
sichtbar werden zu lassen.» Mit Hilfe der Un‐<br />
tersuchung einer Reihe von «Vermischtem»<br />
aus Tageszeitungen wird hier ein alarmieren‐<br />
der Kommentar vorgelegt über Ereignisse wie<br />
das Reality‐TV oder die Bilder des 11. Septem‐<br />
ber, aber auch über den digitalen Taumel eines<br />
Zooms von Google Earth, das Ergebnis des Sa‐<br />
tellitenauges von allerhöchster Präzision, dem<br />
GPS.<br />
Jenseits allen technologischen Fortschritts<br />
verweisen uns diese Tatsachen auf einen<br />
Wandel der Zivilisation insgesamt, so konsta‐<br />
tiert der Universitätsprofessor. Willkommen in<br />
der «hypermodernen Gesellschaft», in einer<br />
Art Wohnstatt, in der man heute «wie früher<br />
das Wasser und das Gas, nun auch den Blick<br />
auf alle Etagen geliefert bekommt». So vergrö‐<br />
ßert sich, im selben Maße wie das Ozonloch,<br />
auch das Schlüsselloch im XXI. Jahrhundert.<br />
Schon in Hitchcocks Film «Vertigo», so der Au‐<br />
tor, gab die Hauptdarstellerin Stella zu beden‐<br />
ken, dass im Grunde das Hauptproblem allein<br />
im Fenster liege. Und mit der theoretischen<br />
Beschäftigung in der Renaissance anhand der<br />
Perspektive, hat das Fenster eine Öffnung auf<br />
die Welt hergestellt, zugleich aber auch den<br />
Raum für Intimität, den Raum als «Recht auf<br />
Verborgenheit» zum Thema gemacht.<br />
Doch die Hypermoderne ersetzt das Fens‐<br />
ter durch Mauern aus Bildschirmen und das<br />
Full TV. Deshalb hätte hier auch der Psycho‐<br />
analytiker ein Wort mitzureden: es geht hier‐<br />
bei um die Ideologie der Transparenz [‒ die<br />
Ideologie des gläsernen Menschen]. Gerade die<br />
Psychoanalyse ‒ und hier vor allem Jacques
Lacan ‒ hat sich unaufhörlich mit der Schat‐<br />
tenseite des menschlichen Subjekts beschäftigt;<br />
sie ist zum Schluss gekommen, dass ausge‐<br />
hend von dieser Seite, das Reale selbst nie<br />
transparent sein kann. Es lässt sich nur über<br />
das Fantasma zugänglich machen. Wajman<br />
kritisiert deshalb offen jegliche Anstrengungen<br />
der Neurowissenschaften, das menschliche<br />
Gehirn auf einen «sichtbaren» Mechanismus<br />
zurückführen zu wollen. Darunter versteht er<br />
aber auch bestimmte «Vorhersehbarkeiten»<br />
menschlichen Verhaltens, wie z.B. die Vorher‐<br />
sicht von Verbrechen auf der Basis der «Be‐<br />
obachtung» unserer Allerjüngsten bis hin zur<br />
Datenerfassung der gesamten Bevölkerung. Er<br />
illustriert diese Logik mit Hilfe von Science‐<br />
fiction‐Filmen, wie z.B. Minority Report von<br />
Steven Spielberg. Die Originalität dieses Essais<br />
beruht in der Tat auf den Rückgriff auf die<br />
Analyse von Kinofilmen und amerikanischen<br />
Fernsehserien, die, wie in einer hypermoder‐<br />
nen Mythologie, die neuen Gestalten einer<br />
Medusa oder eines alles sehenden Argus, dem<br />
Riesen mit hundert Augen, deutlich werden<br />
lassen.<br />
«L’ŒIL ABSOLU» müsste demnach noch<br />
genauer bestimmt werden, doch es dürfte klar<br />
sein, dass es sich wesentlich von jenem be‐<br />
rühmten Modell des «Panopticon» eines Ben‐<br />
tham unterscheidet, das von Foucault in Über‐<br />
wachen und Strafen genauer untersucht worden<br />
ist: Im Zentrum des Panoptikums sitzt der<br />
Herr und sieht alles; doch sein Blick bleibt den<br />
Blicken des Subjekts, das er überwacht, ver‐<br />
borgen. Das ist nun heute in unseren «Kont‐<br />
rollgesellschaften» nicht mehr der Fall: der<br />
Blick hat es nicht mehr nötig, verborgen zu<br />
bleiben, um seine Gewalt auszuüben. Er ist<br />
mitten unter uns, könnte man sagen. Walter<br />
Benjamin hatte das schon auf seine Art vor‐<br />
hergesehen, als er von einer Menschheit ge‐<br />
sprochen hat, die sich selbst beobachtet, nach‐<br />
dem sie nicht mehr unter dem Blick göttlicher<br />
Transparenz stand.<br />
Dennoch scheint Gérard Wajman in dieser<br />
«Gesellschaft des Blicks» mehr als ein Bild zu se‐<br />
hen; er skizziert ein Paradox: wenn die Kamera<br />
gottähnlich geworden ist, so deshalb weil sich<br />
Gott die Kamera hat stehlen lassen. Anders ge‐<br />
sagt: es bleibt aufzuklären, warum ein «absolu‐<br />
tes Auge» seine Macht ohne einen bestellten Big<br />
Brother auszuüben vermag. Es geht demnach<br />
um die kollektive Aneignung der Visionsin‐<br />
strumente, da jeder sich gleichzeitig vor und<br />
33<br />
MB der AFP <strong>Nr</strong>. <strong>85</strong>/<strong>März</strong> 2010<br />
hinter der Kamera befindet. So etwas bedürfte<br />
allerdings eines kreativen opaken Bildpotenzi‐<br />
als, hinter dem man sich von neuem gegen die<br />
durstige Begierde eines «absoluten Auges» nach<br />
Transparenz verbergen könnte. Einige hierzu<br />
zitierten Künstler, wie etwa Bruce Nauman<br />
und seine Installationen zur Enttäuschung des<br />
Narzissmus (man schreitet voran und glaubt<br />
sein eigenes Bild zu sehen, doch das entfernt<br />
sich von uns…), könnten diese Möglichkeit er‐<br />
hellen. Neben dieser Apokalypse des im vollen<br />
Lichte stehenden Blicks, wie sie Wajman be‐<br />
schreibt, bliebe demnach noch eine politische<br />
Theorie der Eklipse zu schreiben. David Zerbib<br />
Hinzuweisen ist noch auf den Essai von Markos Zafiropoulos:<br />
L’ŒIL DÉSESPÉRÉ PAR LE REGARD, Paris (Éd. Arkhè), 128 S.,<br />
14,90 Euro, der einen anderen psychoanalytischen Zugang zum<br />
heutigen «Blick» als solchem und zum «skopischen Trieb» im<br />
Besonderen eröffnet.<br />
Aus: Le monde des livres vom 12. Februar<br />
2010, S.6. ‒ Aus dem Französischen von H.‐P.<br />
Jäck.<br />
‒ Irvin D. Yalom, Psychoanalytiker, USA<br />
Ein guter Therapeut braucht selbst Therapie<br />
Der US‐amerikanische Autor und Psychiater Irvin D.<br />
Yalom spricht über Nietzsches Tränen, Lou Salomé,<br />
Freud, Breuer und den Tod<br />
Sie haben in zwei Bereichen Karriere gemacht ha‐<br />
ben – als Psychotherapeut und als Schriftsteller:<br />
Was macht einen guten Schriftsteller aus, und wo<br />
treffen Therapeut und Schriftsteller aufeinander?<br />
Gute Frage! Ich habe eine persönliche Re‐<br />
gel, an die ich mich beim Schreiben halte: Ich<br />
schreibe nie über etwas, das ich selbst nicht<br />
ganz verstehe.<br />
Tun das Ihrer Meinung nach viele andere Autoren?<br />
Es gibt doch einige, die eine unnötig kom‐<br />
plizierte und hermetische Prosa schreiben. Ein<br />
sehr gutes Beispiel dafür ist Martin Heidegger.<br />
Von ihm stammen viele tiefe Einsichten, aber<br />
er schreibt in einem unzugänglichen Stil. Die‐<br />
sen Zugang zum Schreiben verstehe ich nicht.<br />
Ich denke darüber im Moment viel nach, weil<br />
ich gerade einen Roman über Spinoza schreibe,<br />
der sehr schwer zu fassen ist, weil er so unend‐<br />
lich komplex ist. Ich selbst möchte im Schrei‐<br />
ben klar und konzise sein. Und ich bemühe<br />
mich darum, interessante Geschichten zu er‐<br />
zählen. Auch in meinen Lehrbüchern wie<br />
„Theorie und Praxis der Gruppenpsychothe‐<br />
rapieʺ...<br />
…das sich allein in den USA über 700 000 Mal<br />
verkauft hat...<br />
Ja, es ist einer meiner größten Erfolge. Der<br />
Grund ist, glaube ich, dass es für die Studenten
eine anregende Lektüre ist. Das liegt an den<br />
vielen Geschichten, mit denen ich es vollge‐<br />
packt habe. Ich habe immer wieder gehört, es<br />
lese sich wie ein Roman und nicht wie trocke‐<br />
ne Theorie.<br />
Sie haben einmal geschrieben, dass es Ihre Liebe zur<br />
Literatur war, die Sie die medizi‐<br />
nisch‐psychiatrische Karriere hat einschlagen las‐<br />
sen. Wie das?<br />
Ich bin im russischen Immigrantenmilieu<br />
meiner Eltern in Washington D.C. aufgewach‐<br />
sen. Dort wusste man nicht viel über Berufe.<br />
Zwei Dinge kamen für mich in Frage: Ge‐<br />
schäftsmann oder Arzt. Auch weil die größten‐<br />
teils farbige Nachbarschaft für einen kleinen,<br />
jüdischen Jungen wie mich ein gefährliches<br />
Pflaster war, hielt ich mich vor allem drinnen<br />
auf und wurde zu einem leidenschaftlichen<br />
Leser. Und die Medizin schien mir bedeutend<br />
näher an Tolstoj und Dostojewski als die Ge‐<br />
schäftswelt. Ich wusste auch, dass ich mich in<br />
dem Gebiet der Medizin spezialisieren wollte,<br />
das der Literatur am nächsten liegt — und das<br />
ist sicher die Psychiatrie.<br />
Weil die groß en Autoren auch als große Meister<br />
der Psychologie gelten?<br />
Sie waren tatsächlich geniale Psychologen<br />
und Psychiater und hatten ungeheuer tiefen<br />
Einblick in die menschliche Seele. Wir müssen<br />
von ihnen lernen. Freud zum Beispiel hat das<br />
getan.<br />
In Ihrem Roman „Als Nietzsche<br />
weinte” erzählen Sie die — fiktive — Geschichte<br />
des Zusammentreffens zweier historischer Figuren:<br />
des renommierten Wiener Arztes und Freud‐<br />
Mentors Josef Breuer und des Philosophen Fried‐<br />
rich Nietzsche. Warum haben Sie gerade diese bei‐<br />
den zusammengespannt?<br />
Die Jahre zwischen 1881 und 1882, in denen<br />
Josef Breuer die Hysterikerin Bertha Pappen‐<br />
heim behandelte, die später als der berühmte<br />
Fall „Anna O.” die Grundlage für seine und<br />
Freuds „Studien zur Hysterie” bildete, waren<br />
zu‐fällig auch eine schreckliche Zeit für Fried‐<br />
rich Nietzsche. Er war nie näher am Selbst‐<br />
mord, den er damals in <strong>Brief</strong>en auch dezidiert<br />
als Möglichkeit erwähnt. Unter anderem ging<br />
es dabei um das Ende seiner Beziehung zu Lou<br />
Salomé.<br />
34<br />
MB der AFP <strong>Nr</strong>. <strong>85</strong>/<strong>März</strong> 2010<br />
...die in Ihrem Buch das erste Treffen zwischen<br />
Breuer und dem suizidgefährdeten und unter<br />
schwerster Migräne leide‐den Nietzsche einfädelt.<br />
Die echte Lou Salome wurde später eine Schülerin<br />
Freuds.<br />
Die Beziehung zu Lou Salomé war einer<br />
der Gründe für Nietzsches schlechten Zustand.<br />
Jedenfalls dachte ich mir: Es wäre doch toll<br />
gewesen, wenn Nietzsche in dieser Zeit tat‐<br />
sächlich zu einem Therapeuten hätte gehen<br />
können.<br />
Nur dass es damals keine Therapeuten im heutigen<br />
Sinn gab?<br />
Es gab ein bisschen Arbeit mit Hypnose in<br />
Frankreich, aber der einzige, der damals tat‐<br />
sächlich in Frage gekommen wäre, war Josef<br />
Breuer in Wien.<br />
Für Freud selbst war es noch ein paar Jahre<br />
zu früh.<br />
Am Ende ist nicht mehr klar, wer Patient ist und<br />
wer Therapeut. Einen solchen Rollentausch gibt es<br />
auch in Ihrem Roman „Die rote Couch”. Was inte‐<br />
ressiert Sie so an diesem Motiv?<br />
Ich will damit zeigen, dass jede Psychothe‐<br />
rapie ein Kooperationsprozess ist. Indem ich<br />
beschreibe, wie Breuer langsam auf den Ge‐<br />
danken kommt, dass er mit seinen Problemen<br />
auch ein bisschen Hilfe gebrauchen könnte,<br />
zeige ich außerdem, wie wichtig Therapie ist.<br />
Dazu kommt noch: Will man ein guter Thera‐<br />
peut sein, braucht man selber ebenfalls Thera‐<br />
pie, um die Rolle des Patienten aus eigener<br />
Anschauung zu kennen.<br />
Todesangst und Todessehnsucht spielen eine be‐<br />
trächtliche Rolle in Ihrem Buch über Nietzsche. Be‐<br />
schäftigt Sie der Tod sehr?<br />
Ich halte die Beschäftigung mit dem Tod<br />
für eine der Grundvoraussetzungen für ein ge‐<br />
lungenes, erfülltes Leben. Das ist ein uralter<br />
Gedanke, den ich teile. Durch den Tod wird<br />
einem bewusst, dass man nur eine bestimmte<br />
Zeit zur Verfügung hat. Außerdem kann man<br />
ihn ohnehin nicht ignorieren: Er klopft an die<br />
Tür, er taucht in Träumen auf. Jeder hat uner‐<br />
klärliche Gefühle angesichts eigener runder<br />
Geburtstage oder des Todes eines Freunds<br />
oder Verwandten.<br />
Ja, 1882 war er noch Student. Breuer hinge‐<br />
gen hatte schon Erfahrung mit dem Fall Anna<br />
O. Ich hatte folgende Idee: Vielleicht kann ich<br />
Studenten vieles über Psychotherapie beibrin‐<br />
gen, wenn ich sie zu lesenden Augenzeugen<br />
der Erfindung der Psychoanalyse mache.
Bald behandelt ja Nietzsche Breuer mindestens ge‐<br />
nauso wie Breuer Nietzsche. Ist in der Art von<br />
Psychotherapie, die Sie die beiden durch ihre Ge‐<br />
spräche miteinander entwickeln lassen, auch Ihre<br />
Kritik an der Freudschen Psychoanalyse enthalten?<br />
Mein Hauptkritikpunkt an Freud war im‐<br />
mer, dass das Psychosexuelle so sehr im Mit‐<br />
telpunkt seiner Theorien steht. Also habe ich<br />
mir eine Geschichte und eine Personenkonstel‐<br />
lation einfallen lassen, bei denen der Kern der<br />
Entwicklung der Psychotherapie eher in der<br />
Existenzphilosophie liegt.<br />
Hat Ihnen die Auseinandersetzung geholfen, Ihre<br />
eigene Angst vorm Tod zu bewältigen?<br />
Zweifellos. Als ich als Therapeut begonnen<br />
habe, wollte ich unbedingt mehr Erfahrung auf<br />
diesem Gebiet haben. Ich habe also begonnen,<br />
unheilbar kranke Krebspatienten zu behan‐<br />
deln. Das war damals noch sehr ungewöhn‐<br />
lich, weil der Tod ein solches Tabu war. Ich<br />
habe dabei sehr viel gelernt – auch über meine<br />
eigene Angst.<br />
Was bedeutet Ihnen der Nietzsche‐Satz „Stirb zur<br />
rechten Zeit”, den Sie auch zitieren?<br />
Er bedeutet, dass man sein Leben auch tat‐<br />
sächlich führen, dass man es buchstäblich kon‐<br />
sumieren und voll auskosten muss. Nur dann<br />
stirbt man, ohne noch sehr viel ungelebtes Le‐<br />
ben mit sich herum‐zutragen. Niemand möch‐<br />
te am Ende seines Lebens feststellen, dass er<br />
immer nur auf dem Wartegleis gestanden ist.<br />
Interview: Julia Kospach<br />
ZUR PERSON<br />
Irvin D. Yalom, geboren 1931 als Sohn russischer Einwanderer in<br />
Washington D.C., gilt als einer der einflussreichsten Therapeu‐<br />
ten der USA. Als Autor von Romanen und Erzählbänden („Und<br />
Nietzsche weinte”, „Die rote Couch”, „Die Schopenhauer‐Kur"),<br />
die in erster Linie im Milieu der Psychoanalyse angesiedelt sind,<br />
erreichte er international ein Millionenpublikum. Yalom war als<br />
Professor an der Stanford‐Universität tätig und lebt im kaliforni‐<br />
schen Palo Alto. ksp<br />
Aus: Frankfurter Rundschau vom<br />
21./22. November <strong>2009</strong>, S.36‐37.<br />
‒ Volkmar Sigusch/G. Grau: Personenlexikon<br />
zur Sexualforschung<br />
Christine Pries: Das erste seiner Art ‐ V.<br />
Siguschs und G. Graus „Personenlexikon der Se‐<br />
xualforschung”<br />
Arthur Kronfeld zum Beispiel wäre einer<br />
breiteren Öffentlichkeit für immer unbekannt<br />
geblieben, hätten Volkmar Sigusch und Günter<br />
Grau ihn jetzt nicht in ihr „Personenlexikon<br />
der Sexualforschung” aufgenommen. Von den<br />
Nazis ins Moskauer Exil getrieben, nahm sich<br />
Kronfeld, der sieben Jahre lang an Magnus<br />
Hirschfelds Institut für Sexualwissenschaft tä‐<br />
35<br />
MB der AFP <strong>Nr</strong>. <strong>85</strong>/<strong>März</strong> 2010<br />
tig und in der Weimarer Republik recht be‐<br />
kannt gewesen war, 1941 während der Herbst‐<br />
offensive der deutschen Wehrmacht das Le‐<br />
ben. Im Dritten Reich wurde seine Arbeit tot‐<br />
geschwiegen, und nach 1945 wurde sie kaum<br />
rezipiert, bevor zu Beginn der 1980er Jahre ein<br />
Psychotherapeut Nachforschungen über<br />
Kronfeld anzustellen begann. Über den Ver‐<br />
bleib von Kronfelds Nachlass ist bis heute<br />
nichts bekannt, und auch die neuerliche Aus‐<br />
einandersetzung mit seinem Werk steht noch<br />
ganz am Anfang.<br />
Ein besonderes Augenmerk dieses Lexikons<br />
liegt denn auch auf den jüdischen Wissen‐<br />
schaftlern, die aus Deutschland und dadurch<br />
häufig aus der Wahrnehmung überhaupt ver‐<br />
trieben wurden, wodurch eine ganze Traditi‐<br />
on, in deren Zentrum Deutschland gestanden<br />
hatte, zum Abbruch kam. Es wäre jedoch irre‐<br />
führend, das Projekt, in das die Herausgeber<br />
nach eigenem Bekunden 30 Jahre Arbeit inves‐<br />
tiert haben, auf dieses Anliegen zu reduzieren.<br />
Der Anspruch ist enzyklopädisch, und na‐<br />
türlich finden sich neben nahezu vergessenen<br />
und noch wiederzuentdeckenden Forschern<br />
wie eben Kronfeld auch die großen Namen<br />
von Sigmund Freud, Wilhelm Reich oder auch<br />
Alfred C. Kinsey. Das Buch, das nur verstor‐<br />
bene Forscherinnen und Forscher berücksich‐<br />
tigt, birgt aber auch Überraschungen, wenn<br />
zum Beispiel Georges Bataille, Michel Foucault<br />
oder Niklas Luhmann ganz selbstverständlich<br />
— und selbstbewusst — als Sexualforscher<br />
verzeichnet sind.<br />
Beteiligt sind 60 teils internationale Auto‐<br />
ren, die für rund 200 (aus ursprünglich 500 an‐<br />
gedachten ausgewählte) Einträge unter‐<br />
schiedlicher Länge verantwortlich zeichnen.<br />
Die Texte sind nicht medizinisch orientiert und<br />
daher auch für den Laien verständlich. Das<br />
„Personenlexikon der Sexualforschung” ist das<br />
erste seiner Art und krönt, so kann man ohne<br />
Übertreibung sagen, nach Siguschs letztjähri‐<br />
ger „Geschichte der Sexualwissenschaft”<br />
(ebenfalls Campus, vgl. FR vom 18. Juni 2008)<br />
das Lebenswerk des renommierten Frankfurter<br />
Sexualwissenschaftlers.<br />
Volkmar Sigusch/Günter Grau (Hrsg.): Personenlexikon der Se‐<br />
xualforschung. Campus Verlag, Frankfurt/M. <strong>2009</strong>, 816 S. mit<br />
150 Abb., 149 Euro.<br />
Aus: Literatur‐Rundschau der Frankfurter Rund‐<br />
schau vom 8. Dezember <strong>2009</strong>, S.A13.
‒ Psychoanalyse im Fernsehen<br />
Michael G. Meyer: Jeden Abend ab auf die<br />
Couch ‐ 3 Sat zeigt die neue US‐Serie „In Treat‐<br />
ment”<br />
Psychotherapie war für Filmemacher schon<br />
immer ein reiz‐volles Thema: Ungezählte Fil‐<br />
me von Woody Allen befassen sich mit den<br />
meist sehr lustigen Auswirkungen der Thera‐<br />
pie auf gestresste Großstädterpsychen. Doch<br />
die neue US‐Serie „In Treatment – Der Thera‐<br />
peut”, ist im Gegensatz zu den Woody Allen‐<br />
Figuren vor allem sehr ernst. Sie basiert auf<br />
der israelischen Serie „Be Tipul” – alle Charak‐<br />
tere und die Dialoge sind von dort übernom‐<br />
men worden.<br />
Der irisch‐amerikanische Schauspieler Gab‐<br />
riel Byrne verkörpert den Therapeuten Dr.<br />
Paul Weston, der tagaus, tagein zuhört, wie<br />
ihm Patienten aus ihrem Leben erzählen. Mon‐<br />
tags ist es Laura, eine attraktive, junge Frau<br />
(Melissa George, bekannt aus „Aliasʺ), in die<br />
sich Paul im Laufe der Serie verliebt Dienstags<br />
heißt der Patient Alex, ein selbstbewusster US‐<br />
Kampfpilot, der sich aber nach einem Bom‐<br />
benangriff im Irak Vorwürfe macht, weil er<br />
das Leben irakischer Kinder auf dem Gewissen<br />
hat. Mittwochs kommt die junge, depressive<br />
Sportlerin Sophie, am Donnerstag ist es ein<br />
Paar: Amy und Jake stecken in einer Krise.<br />
Und freitags sucht Paul Weston selbst Supervi‐<br />
sion bei seiner ehemaligen Professorin Gina<br />
(Dianne Wiest), die für ihre Rolle mit einem<br />
Emmy ausgezeichnet wurde. Absurderweise<br />
siezen sich die beiden in der deutschen Versi‐<br />
on – obwohl klar wird, dass sie sich seit über<br />
20 Jahren gut kennen.<br />
Die Serie<br />
braucht zwar etwas, um in Fahrt zu kommen.<br />
Aber sobald der Zuschauer die Figuren ken‐<br />
nengelernt hat, will er unbedingt wissen, wie<br />
es weitergeht mit Laura, Alex, Sophie, Jake<br />
und Amy. Die 43 Folgen der ersten Staffel zei‐<br />
gen kaum mehr als die Sitzungen zwischen<br />
Therapeut und Patient ‐ der Zuschauer muss<br />
sich auf das Erzählte einlassen. Da an jedem<br />
Wochentag therapiert wird, heißt das für die<br />
36<br />
MB der AFP <strong>Nr</strong>. <strong>85</strong>/<strong>März</strong> 2010<br />
Zuschauer: Jeden Abend der Woche ab auf die<br />
Couch.<br />
In den USA war „In Treatment” zwar ein<br />
großer Erfolg bei den Kritikern, aber die Quo‐<br />
ten waren nur mittelmäßig. Dennoch gab es<br />
eine Fortsetzung. Im US‐Fernsehen läuft in<br />
diesem Jahr bereits die dritte Staffel.<br />
In Treatment ‐ Der Therapeut,<br />
Aus: Frankfurter Rundschau vom 15. Februar<br />
2010, S.25.<br />
B) PHILOSOPHICA<br />
‒ Jacques Derridas Seminar zur Bestiologie<br />
Der Mensch, die Schlange, der Elefant ‒ und<br />
immer wieder der Wolf<br />
Wie Jacques Derrida einen Zoo politischer Tierfigu‐<br />
ren eröffnete: Zur florierenden philosophischen Li‐<br />
teratur über Souveränität, Macht und Biopolitik<br />
Sind Tiere politische Wesen? Oder, umge‐<br />
kehrt gefragt, bezeichnet die Fähigkeit, in einer<br />
politischen Gemeinschaft zu leben, die Schwel‐<br />
le vom Tier zum Menschen? Mit Aristotelesʹ<br />
berühmter Kennzeichnung des Menschen als<br />
ein politisches Lebewesen trat diese Frage auf<br />
die Bühne der Philosophie – und sie wurde zu‐<br />
letzt durch die Unterscheidung des italieni‐<br />
schen Philosophen Giorgio Agamben zwischen<br />
einem „nackten” und einem „politisch qualifi‐<br />
zierten” Leben in das Zentrum aktueller De‐<br />
batten gerückt.<br />
In seinem letzten Seminar aus den Jahren<br />
2001 bis 2003 widmete sich der französische<br />
Philosoph Jacques Derrida, der 2004 verstor‐<br />
ben ist, unter dem Titel „Das Tier und der<br />
Souverän” in einer Reihe von Einzelinterpreta‐<br />
tionen den unter‐schiedlichsten Szenarien, in<br />
denen sich die Wege von Mensch und Tier<br />
kreuzen – von politischen Herrschern wie von<br />
Königen des Tierreichs. Tatsächlich begegnet<br />
dem Leser dieser bisher nur auf Französisch<br />
erschienenen Seminar‐Aufzeichnungen im<br />
Laufe der Lektüre nichts weniger als ein gan‐<br />
zer Zoo politischer Tierfiguren — von der<br />
Schlange über den Elefanten bis zum Löwen,<br />
und natürlich taucht dabei zuerst und immer<br />
wieder der Wolf auf, in der berühmten Wen‐<br />
dung des römischen Komödiendichters Plau‐<br />
tus, wonach ein Mensch dem anderen als sol‐<br />
cher gegenübertrete.<br />
Dabei wird das Feld der politischen Tier‐<br />
metaphorik im Laufe von Derridas Untersu‐<br />
chung zunehmend unübersichtlich: Ist der<br />
Mensch selbst ein Tier, das zum Zwecke der<br />
Vergemeinschaftung gezähmt und dessen na‐<br />
türliche Instinkte in Schach gehalten werden
müssen? Oder muss die höchste Macht im<br />
Staate, die des Souveräns, zu ihrer Durchset‐<br />
zung nicht auch etwas von der ungebändigten<br />
Kraft der Tiere besitzen, wie Derrida anhand<br />
einer Interpretation von Machiavellis „Fürs‐<br />
ten” fragt: Überwindet die Staatlichkeit die na‐<br />
turwüchsige Logik vom Recht des Stärkeren –<br />
oder benötigt das Recht nicht vielmehr zu sei‐<br />
ner Durchsetzung immer auch eine Form von<br />
Gewalt? Fragen zum Zusammenhang von<br />
Recht, Macht und Gewalt hatten Derrida seit<br />
den späten achtziger Jahren in unterschiedli‐<br />
cher Form beschäftigt, sei es in seinen Interpre‐<br />
tationen von Walter Benjamin und Carl<br />
Schmitt zur „Gesetzeskraft”, sei es in seiner<br />
Kritik an der internationalen Politik, die im In‐<br />
teresse hegemonialer Bestrebungen sogenann‐<br />
te Schurkenstaaten aus der internationalen<br />
Gemeinschaft ausgrenzt und mit Waffenge‐<br />
walt angreift. In der hier aufgerufenen Tierme‐<br />
taphorik finden diese Überlegungen ihre Fort‐<br />
setzung, indem sie auf aufschlussreiche Weise<br />
mit weiteren Strängen der aktuellen Diskussi‐<br />
onen um das Thema der Souveränität ver‐<br />
knüpft werden.<br />
Ausgangspunkt ist auch bei Derrida die<br />
klassische Frage der politischen Ideengeschich‐<br />
te nach dem Ort der höchsten politischen Ge‐<br />
walt, die ein Kennzeichen von Staatlichkeit<br />
schlechthin darstellt. Derrida setzt bei den<br />
Stichwortgebern für die neuzeitliche Souverä‐<br />
nitätstheorie, bei Bodin oder Hobbes an, auch<br />
wenn deren Werke, wie er einschränkend an‐<br />
merkt, in starker Weise von den politischen<br />
Turbulenzen ihrer eigenen Zeit geprägt sind.<br />
Wenn er dennoch am Konzept der Souveräni‐<br />
tät festhalten will, so er‐gibt sich das gewis‐<br />
sermaßen ex negativo aus seiner Diagnose der<br />
gegenwärtigen politischen Situation. Denn<br />
dass die ökonomischen und politischen<br />
Grundlagen des modernen Nationalstaates<br />
brüchig werden, dass wir uns, so schließt sich<br />
Jacques Derrida zumindest auf der deskripti‐<br />
ven Ebene Carl Schmitts Überlegungen an, in<br />
einer Zone der Entpolitisierung und Neutrali‐<br />
sierung bewegen, soll nicht das letzte Wort zur<br />
Möglichkeit von politischem Eingreifen bedeu‐<br />
ten. Dekonstruktion heißt hier also, das Kon‐<br />
zept der Souveränität nicht zu verabschieden,<br />
sondern dessen unterschiedliche Formen und<br />
Logiken aufzuzeigen.<br />
Eine dieser Formen, die durch das Aufgrei‐<br />
fen der Tiermetaphorik teils untergründig,<br />
teils ausdrücklich mit aufgerufen wird, ist Mi‐<br />
37<br />
MB der AFP <strong>Nr</strong>. <strong>85</strong>/<strong>März</strong> 2010<br />
chel Foucaults folgenreiches Konzept der Bio‐<br />
Politik. Damit ist die Tatsache bezeichnet, dass<br />
seit dem 18. Jahrhundert die Körper der Unter‐<br />
tanen und die Bevölkerung als Gesamtheit<br />
zum Gegenstand der administrativen Regulie‐<br />
rung wurden. Foucault nahm Prozesse in den<br />
Blick, die parallel zur oder unterhalb der Ebe‐<br />
ne der staatlichen Gesetzgebung elementare<br />
biologische Vorgänge wie Geburt, Tod, Repro‐<br />
duktion oder die Gesundheit der Bevölkerung<br />
steuerten. Seine Entzifferung dieser gesonder‐<br />
ten Machttechnologien warf immer wieder die<br />
Frage nach deren innerer Zusammengehörig‐<br />
keit auf, um schließlich sogar zum Ausgangs‐<br />
punkt von Agambens Überlegungen in „Homo<br />
sacer” zu werden. Dessen Antwort darauf ist<br />
eben die Theorie des „nackten” Lebens, über<br />
das die souveräne Macht verfügt, das sie aber<br />
gleichzeitig aus sich heraus erzeugt, und worin<br />
Agamben konsequent die verschiedenen Sou‐<br />
veränitätsformen in eine, umfassende ver‐<br />
schmilzt.<br />
Man wird aus Derridas Feder wohl kaum<br />
eine vehementere Kritik lesen können als die<br />
an Agambens forcierter Unterscheidung zwi‐<br />
schen bios und zoe, gedacht als Ergänzung und<br />
Berichtigung Foucaults. „Armer Foucault!ʺ,<br />
entfährt es Derrida an einer Stelle, „Hatte er je<br />
einen grausameren Bewunderer?” Die An‐<br />
nahme einer vor‐ oder unpolitischen Kreatür‐<br />
lichkeit hält er mehr oder minder unumwun‐<br />
den für biologistisch. Stattdessen, so sein Fazit,<br />
nachdem er Agambens Argument im Detail<br />
zerpflückt hat, ist der Mensch nach der aristo‐<br />
telischen Definition als zoon politikon ein un‐<br />
mittelbar auf die Politik angelegtes Wesen. Das<br />
Tier taucht dagegen in der titelgebenden Paa‐<br />
rung mit dem Souverän sozusagen als Grenz‐<br />
wert des Menschlichen nach unten auf, denn<br />
nur im Menschen können sich Dummheit<br />
(französisch: bêtise) und Bestialität vereinen.<br />
Originell ist an Derridas Überlegungen we‐<br />
niger die Tatsache, dass er politische Tierme‐<br />
taphern aufgreift, und viele seiner Thesen sind<br />
im Grunde nicht neu. Originell ist vor allem,<br />
lässt man sich auf das Umwegige seines Vor‐<br />
trags ein, der Parcours, auf dem die bekannten<br />
Theorien abgeschritten und in neue Perspekti‐<br />
ven gerückt werden. Ähnlich ergeht es einem<br />
bei der Lektüre der umfangreichen Habilitati‐<br />
onsschrift des Weimarer Philosophen Friedrich<br />
Balke, deren Einzelstudien zur Antigone, zu<br />
Hobbes, Heidegger oder Kafka lose unter der<br />
Überschrift „Figuren der Souveränität” zu‐
sammen‐gehalten werden. Auch Balke geht es<br />
darum, die klassischen Theorien monarchi‐<br />
scher Gewalt und die Souveränitätspraktiken<br />
moderner Staaten gemeinsam in den Blick zu<br />
bekommen. Eine stärkere inhaltliche Fokussie‐<br />
rung, etwa auf die im Zusammenhang mit<br />
Bodin und Hobbes behandelten Fragen der<br />
Repräsentierbarkeit und Sichtbarkeit der<br />
Macht, wäre im Hinblick auf die Vielzahl der<br />
behandelten Aspekte allerdings wünschens‐<br />
wert gewesen. Andererseits führt die fast leit‐<br />
motivische Verwendung des Konzepts der<br />
Biopolitik weniger zu einer thematischen Bün‐<br />
delung, als vielmehr zu teilweise unplausiblen<br />
Interpretationen, so wenn Balke Heideggers<br />
Todesverständnis mit der Konzeption des<br />
französischen Anatomen Xavier Bichat kurz‐<br />
schließt. Etwas gewaltsam nimmt sich auch<br />
seine Hobbes‐Interpretation aus, wo er zu dem<br />
Ergebnis kommt, dessen politische Theorie sei<br />
„in einem fundamentalen Sinne Biopolitik”,<br />
„da sie den Souverän mit der Aufgabe betraut,<br />
die ,bloße Existenzʹ der Bürger zu schützen<br />
und sie zu diesem Zweck zu allererst als<br />
,nacktes Lebenʹ zu konstituieren”. Vielleicht<br />
wird daran aber auch nur deutlich, dass die in<br />
den letzten Jahren florierende Literatur zum<br />
Themenkreis um Souveränität, Macht und<br />
Biopolitik mittlerweile den Punkt ihrer maxi‐<br />
malen Ausdehnung er‐reicht hat. SONJA<br />
ASAL<br />
FRIEDRICH BALKE: Figuren der Souveränität. Verlag Wilhelm<br />
Fink, München <strong>2009</strong>. 545 Seiten, 58 Euro.<br />
JACQUES DERRIDA: Séminaire La bête et le souverain. Volume<br />
1 (2001‐2002). Editions Galilée: Paris 2008. 469 Seiten, 33 Eu‐<br />
ro.<br />
Aus: Süddeutsche Zeitung vom 14. Januar<br />
2010, S.14.<br />
‒ Michel Foucault: Die Regierung des Selbst<br />
Claude Haas: Der Politik die Wahrheit sagen ‐<br />
Demokratie II: Warum Michel Foucault in seinen letzten Vorle‐<br />
sungen Abweichung und Aufbegehren verteidigt.<br />
Kann von Demokratie die Rede sein, wenn<br />
alle reden dürfen? Bedingt, wie Michel Fou‐<br />
cault in seinen letzten am College de France<br />
gehaltenen Vorlesungen aus dem Winterse‐<br />
mester 1982/83 zu zeigen versucht. Dabei ist es<br />
vordergründig gerade nicht die philosophische<br />
Reflexion oder gar Legitimation bestimmter<br />
Staatsformen, der er auf der Spur ist. Ganz im<br />
Gegenteil verschreibt sich Foucault in diesen<br />
kürzlich auf Deutsch erschienenen Vorlesun‐<br />
gen lediglich den Einsatzmöglichkeiten des<br />
konkreten Wahrsprechens in etablierten politi‐<br />
schen Ordnungen. Es müsse möglich sein, der<br />
38<br />
MB der AFP <strong>Nr</strong>. <strong>85</strong>/<strong>März</strong> 2010<br />
Politik die Wahrheit zu sagen, ohne die Wahr‐<br />
heit der Politik zu sagen.<br />
Als Garant dieser Unterscheidung dient<br />
dem Autor die antike Figur der parrhesia: der<br />
Redefreiheit, der Freimut, des Aufbegehrens<br />
oder eben auch des Wahrsprechens, deren po‐<br />
litisches Potenzial er von Euripides über Pla‐<br />
ton und Plutarch bis hin zu Kant auslotet. Den<br />
Parrhesiasten will er als ein Selbst begriffen<br />
wissen, das sich durch Besonnenheit, Mut und<br />
Risikobereitschaft auszeichnet. Er mische sich<br />
in tagespolitische Belange ein, infiziere seinen<br />
Protest aber niemals mit der eigenen philoso‐<br />
phischen Reflexion. Nicht ohne Penetranz be‐<br />
harrt Foucault auf dieser Trennung: »Die Phi‐<br />
losophie hat nicht zu sagen, was in der Politik<br />
geschehen soll.« Es sei kein Verhältnis der<br />
»Kongruenz«, sondern das einer »widerstre‐<br />
benden Exteriorität«, in dem sich die<br />
parrhesiastische Philosophie der Politik ge‐<br />
genüber befinde.<br />
Die philosophische Fundierung politischer<br />
Strömungen und Systeme hat sich für ihre je‐<br />
weiligen Befürworter oft genug als blamable<br />
Angelegenheit erwiesen. Insofern sollte man<br />
Foucaults Aufruf zur philosophischen Enthalt‐<br />
samkeit in der Politik nicht von vorn‐herein<br />
belächeln. Indem er auf eine Analyse histori‐<br />
scher Formen der Vermengung von Philoso‐<br />
phie und Politik aber so gut wie ganz verzich‐<br />
tet, stellt man sich über weite Strecken die Fra‐<br />
ge, wogegen er eigentlich spricht.<br />
Dennoch wäre es naiv, Foucault über 500<br />
Seiten der ideologischen Demut zu verdächti‐<br />
gen. Immer wieder betreibt er mithilfe der<br />
parrhesia genau das, was der Parrhesiast blei‐<br />
ben lässt: politische Theorie. Zur athenischen<br />
Demokratie etwa hält er fest, dass sie die<br />
parrhesia zwar ermöglicht, dass die parrhesia ihr<br />
aber unmittelbar eine fundamentale Ungleich‐<br />
heit eingetragen habe. Und von dieser Un‐<br />
gleichheit weit eher als von der Gleichheit aller<br />
hänge das Gelingen der Demokratie auch<br />
nachhaltig ab. Schließlich sei der parrhesia der<br />
Mut zum Risiko und zur Exklusivität imma‐<br />
nent. Vor allem neu zugelassene Bürger<br />
Athens drohten in ihrem Sprechen indes allzu<br />
leicht nur die Meinung der Mehrheit zu repro‐<br />
duzieren. Sie seien falsche Parrhesiasten und<br />
stellten damit eine Gefahr ausgerechnet für je‐<br />
ne Staatsform dar, die sie zum Reden gebracht<br />
habe.<br />
Foucault lässt es sich nicht nehmen, »in ei‐<br />
ner Zeit, nämlich der unseren« — und somit
vor einem Vierteljahrhundert — an dieses Pa‐<br />
radox zu erinnern. Keineswegs aber weist er<br />
einen Weg, es zu durchbrechen. Es ist dieser<br />
doppelte Gestus, der seinen Ausführungen<br />
Aktualität verleiht.<br />
Langsam spricht es sich herum, dass es eine<br />
Dummheit der Informationsgesellschaft war,<br />
sich eine Belebung der Demokratie von der<br />
bloßen Zunahme an öffentlichen Redemög‐<br />
lichkeiten zu versprechen. Je mehr geredet<br />
wird, desto mehr wird auch das Gleiche ge‐<br />
sagt. Die Inflationierung so unsäglicher Begrif‐<br />
fe wie »Streitkultur« führt deutlich vor, dass<br />
sich mit ihnen nie die Bereitschaft zur Abwei‐<br />
chung von gängigen Meinungsmustern ver‐<br />
bunden hat. Eindämmen lässt sich der diskur‐<br />
sive Einheitsbrei mit demokratischen Mitteln<br />
wiederum ebenfalls nicht. Er ist Bedingung<br />
und Gefährdung der Demokratie in einem.<br />
Die Zumutung dieser Binsenweisheit gilt es<br />
aber selbst dann noch auszuhalten, wenn sie<br />
auch ihrerseits eines Tages weltweit gebloggt<br />
und getwittert wird. Für diese Erkenntnis hätte<br />
man Foucault nicht unbedingt gebraucht. Aber<br />
es ist doch schön, ihn immer noch an Bord zu<br />
haben.<br />
Michel Foucault: Die Regierung des Selbst und der anderen.<br />
Vorlesungen am College de France 1982/1983; aus dem Fran‐<br />
zösischen von Jürgen Schröder; Suhrkamp Verlag, Frank‐<br />
furt/M. <strong>2009</strong>; 506 S., 45,‐ €<br />
Aus: DIE ZEIT <strong>Nr</strong>. 4 vom 21. Januar 2010, S.46.<br />
‒ Jean-Michel Palmiers Walter-Benjamin-Biografie<br />
Rolf Wiggershaus: Im Labyrinth ‐ Geschichte, aus<br />
Sicht der Verlierer geschrieben: Jean‐Michel Palmiers monumen‐<br />
tale, aber nichtvollendete Walter‐Benjamin‐Studie<br />
Drei Jahre nach der französischen Original‐<br />
ausgabe ist nun die deutsche — wahrhaft kon‐<br />
geniale — Übersetzung einer monumentalen<br />
Monographie über Walter Benjamin erschie‐<br />
nen. Ende der achtziger Jahre veröffentlichte<br />
der französische Kunsthistoriker und Philo‐<br />
soph Jean‐Michel Palmier eine zweibändige<br />
Untersuchung über das Exil Weimarer Intel‐<br />
lektueller. Aus dem Vorhaben einer Ausarbei‐<br />
tung des Schlusskapitels wurde eine Studie<br />
über Benjamin, die wegen Palmiers Tod im<br />
Jahre 1998 Fragment blieb. Doch dass dies<br />
1300‐seitige Fragment je übertroffen werden<br />
könnte, ist schwer vorstellbar.<br />
Das hat mit dem roten Faden dieser Studie<br />
zu tun: der kritischen Rettung Benjamins als so<br />
origineller wie politischer Autor. Deshalb die<br />
beiden so disparat wirkenden Untertitel des<br />
Buches: zum einen „Lumpensammler, Engel<br />
und bucklicht Männlein”, dies Spektrum<br />
39<br />
MB der AFP <strong>Nr</strong>. <strong>85</strong>/<strong>März</strong> 2010<br />
Benjaminscher Gespenster, zum anderen „Äs‐<br />
thetik und Politik bei Walter Benjamin”.<br />
Fünf Teile plante Palmier. Die ersten drei —<br />
Tragödie eines deutsch jüdischen Intellektuel‐<br />
len; Sprache, Philosophie und Magie; Das Pro‐<br />
jekt einer materialistischen Ästhetik — und der<br />
An‐fang des vierten — Materialismus und<br />
Messianismus — liegen laut Herausgeber in<br />
„annähernder” Endfassung vor. Im fünften<br />
Teil sollte es um „Die Pariser Passagen oder<br />
die Archäologie der Moderne” gehen.<br />
Auf einen ersten Teil mit biographisch‐<br />
autobiographischer Orientierung folgen also<br />
vier weitere, die den Wandel des Schwer‐<br />
punkts von Benjamins literarisch‐<br />
philosophischer Weltsicht beleuchten. Auf das<br />
Fehlende wäre man gespannt. Aber doch nur,<br />
weil das nahezu erzählerische Kreisen in im‐<br />
mer neuen Schichten von Benjamins Welt für<br />
dauernde Faszination sorgt.<br />
Der Leser hat am Ende nicht den Eindruck<br />
einer Unvollständigkeit des Buches, sondern<br />
den der Unabschließbarkeit einer Studie, die<br />
einem Leben und vor allem einem damit eng‐<br />
vermählten Werk angemessen ist, die glei‐<br />
chermaßen durch ungewöhnliche Komplexität<br />
wie durch untergründige Verbindungen ge‐<br />
kennzeichnet sind.<br />
Palmiers Meisterschaft in der Kombination<br />
von Einfühlung und Kritik zeigt sich schon im<br />
ersten Teil. So heißt es über die „Berliner<br />
Kindheit um 1900”: „Die Einzigartigkeit des<br />
Buches liegt, abgesehen von seiner bestechen‐<br />
den Schönheit, in der Unkenntnis einer prosai‐<br />
schen Realität, die das Herzstück so vieler<br />
Werke der Epoche ausmacht.”<br />
Anwesend ist das Abwesende bei Benjamin<br />
aber in der „Bipolarität der unentzifferten Zei‐<br />
chen”. Dass sie das Leitmotiv der „Berliner<br />
Kindheit” bilden, entspringe, so Palmier, der<br />
„Enttäuschung des Erwachsenen — des prole‐<br />
tarisierten Schriftstellers, der dem Paradies<br />
dieser bürgerlichen Kindheit entrissen wurde<br />
und der im selben Moment ein Bewusstsein<br />
seiner Klassenlage gewann, in dem er seine<br />
materielle Sicherheit verlor”.<br />
Deshalb hatte gerade das Stück „Loggien”<br />
für Benjamin die Bedeutung einer Art von<br />
Selbstporträt, wie er an seine Vertraute, Gretel<br />
Adorno, schrieb. Die Loggia ist eine Schwelle<br />
zwischen der erstickenden Sicherheit der elter‐<br />
lichen Wohnung und dem Blick in die Hinter‐<br />
höfe mit den Unterkünften der Armen. Benja‐<br />
min, dem proletarisierten Intellektuellen, sind
die Loggien nah „des Trostes wegen, der in ih‐<br />
rer Unbewohnbarkeit für den liegt, der selber<br />
nicht mehr recht zum Wohnen kommt”.<br />
Durch den Vergleich mit Marcel Proust und<br />
Ernst Bloch verleiht Palmier Benjamins Eigen‐<br />
tümlichkeit zusätzlich Konturen. Für Proust<br />
bedeutet Erinnerung die Suche nach verborge‐<br />
nen Augenblicken des Glücks, für Bloch sind<br />
Erinnerungen Sammellinsen für utopische<br />
Stoffe.<br />
Für Benjamin dagegen sind die Augenbli‐<br />
cke der Kindheit solche eines Scheiterns, das<br />
entziffert werden muss, eines Versprechens,<br />
das das Leben nicht gehalten hat. Die Bewah‐<br />
rung der eigenen Kindheit gewinnt für Benja‐<br />
min in genau dem Moment einen historischen<br />
Sinn, in dem das Tragische seines Lebens und<br />
das der Geschichte miteinander verschmelzen.<br />
„Das Kind und der Unterdrückte”, so in‐<br />
terpretiert Palmier die politische Seite von Ben‐<br />
jamins Verhältnis zu seiner Kindheit, „sind<br />
Teil derselben Geschichte: derjenigen, die ,aus<br />
Sicht der Verliererʹ geschrieben wird. In Ben‐<br />
jamins theologisch‐politischer Vision ist das<br />
Kind, das er war, identifiziert mit der Ge‐<br />
schichte selbst, ihrem unerlösten Leid. Die<br />
,Erinnerungenʹ verkörpern die gleichen messi‐<br />
anischen Erwartungen [...], die aber ,die<br />
Flamme der Hoffnung entfachenʹ muß.”<br />
Die einfühlend‐kritische Hal‐<br />
tung Palmiers und sein Interesse am originär<br />
politischen Benjamin bewähren sich, gleich‐<br />
viel, ob es um Benjamins Verhältnis zu Scho‐<br />
lem, Adorno, Bloch, Kracauer, Brecht oder<br />
dem Frankfurter Institut für Sozialforschung<br />
geht oder um Themen wie Mimesis, dialekti‐<br />
sches Bild, Phantasmagorie, Aura, um Erneue‐<br />
rung der Literaturkritik, die Rolle der Intellek‐<br />
tuellen, die Vereinbarkeit von Marxismus und<br />
Theologie oder die Politisierung der Kunst.<br />
Jeder, der etwa Benjamins erkenntniskriti‐<br />
sche Vorrede zum Trauerspielbuch zu verste‐<br />
hen suchte, wird mit Dankbarkeit und Gewinn<br />
lesen, was Palmier über Benjamins Praxis be‐<br />
richtet, für je‐den seiner großen Essays er‐<br />
kenntnistheoretische Grundannahmen zu‐<br />
40<br />
MB der AFP <strong>Nr</strong>. <strong>85</strong>/<strong>März</strong> 2010<br />
sammenzustellen, die durch die Vielfalt ihrer<br />
Quellen verblüffen.<br />
Benjamins Interesse am Universitätsbetrieb<br />
und an den philosophischen Strömungen sei‐<br />
ner Zeit war gering. Einzig in Lukácsʹ „Ge‐<br />
schichte und Klassenbewusst‐sein” sah er die<br />
Aporien der klassischen Erkenntnistheorien<br />
mit ihrem Ausgang von einer Subjekt‐Objekt‐<br />
Spaltung philosophisch aufgehoben. Im Übri‐<br />
gen holte er sich Anregungen bei der Roman‐<br />
tik und dem Judentum, bei vergessenen Auto‐<br />
ren und Außenseitern. „Diese Marginalität<br />
Benjamins”, so Palmier, „dieser ,Schritt zurückʹ<br />
hinter die Begriffsbildungen seiner Zeit, ist die<br />
Bedingung seiner Originalität.”<br />
Dazu gehörte auch das Prägen eigener Be‐<br />
griffe bzw. die Ersetzung von Begriffen durch<br />
Bilder, Konstellationen sinnlicher Objekte, Stil‐<br />
figuren wie die Allegorie. So praktizierte Ben‐<br />
jamin auf seine Weise den „Tigersprung ins<br />
Vergangene”, der die Gegenwart erhellen soll‐<br />
te.<br />
Palmiers Führung durchs Labyrinth von<br />
Benjamins Welt ist bewundernswert, und es<br />
fehlt dabei auch nicht an Hinweisen auf den<br />
politischen und intellektuellen Kontext, in dem<br />
Benjamins Leben, Denken und Dichten sich<br />
abspielte. Doch sich derart intensiv wie Pal‐<br />
mier auf ein Leben und Denken einzulassen,<br />
das so wie das Benjamins in Gestalt von Texten<br />
– weitaus mehr unveröffentlichten und nicht<br />
zur Veröffentlichung gedachten als veröffent‐<br />
lichten — existiert, das hat auch einen be‐<br />
klemmenden Effekt. Es entsteht eine geschlos‐<br />
sene Welt, in der das „sollte”, diese merkwür‐<br />
dig imperativische Vorwegnahme der bekann‐<br />
ten Zukunft, auffallend häufig auftritt. Unbe‐<br />
fangene Einschätzungen werden dann schwie‐<br />
rig.<br />
Ein Beispiel dafür ist, wie Ludwig Klages<br />
bei Palmier vorkommt. In einer Fußnote er‐<br />
wähnt er Benjamins Bewunderung für den Au‐<br />
tor der Bücher „Vom kosmogonischen Eros”<br />
und „Der Geist als Widersacher der Seele”,<br />
doch nichts, was diese Bewunderung ver‐<br />
ständlich machen könnte. Statt über den 1914<br />
erschienenen Aufsatz „Vom Traumbewusst‐<br />
sein” informiert zu werden, um dessen Fort‐<br />
setzung Benjamin Klages bat, erfährt man nur,<br />
dass Klages „ein echter Vorläufer des national‐<br />
sozialistischen Irrationalismus und notorischer<br />
Antisemit” gewesen sei, von dem Benjamin<br />
sich erst unter dem Einfluss Adornos endgül‐<br />
tig losgesagt habe.
Trotz aller Bewunderung hinterlässt<br />
Palmiers Buch ein zwiespältiges Gefühl. Der<br />
Autor führt mit sicherer Hand durch ein Laby‐<br />
rinth – aber nicht mehr hinaus. Bei aller An‐<br />
gemessenheit im Einzelnen hat die Monumen‐<br />
talität des Ganzen angesichts der einen Person,<br />
um die bzw. um deren Werk es geht, etwas<br />
Unmäßiges.<br />
Jean‐Michel Palmier: Walter Benjamin. Lumpensammler, En‐<br />
gel und bucklicht Männlein. Ästhetik und Politik bei Walter<br />
Benjamin. Herausgegeben und mit einem Vorwort versehen<br />
von Florent Perrier. Aus dem Französischen von Horst<br />
Brühmann. Suhrkamp Verlag, Frankfurt/M. <strong>2009</strong>, 1372 Seiten,<br />
64 Euro.<br />
Aus: Frankfurter Rundschau<br />
vom 16.‐17. Januar 2010, S.34‐35.<br />
‒ Jean-Luc Nancy: Blick auf die wahre Demokratie<br />
Christian Schlüter: Die Freiheit des Menschen<br />
ist seine Unbestimmtheit ‐ Jean‐Luc Nancy<br />
sucht die „Wahrheit der Demokratie”<br />
In unruhigen Zeiten wie diesen bekommt<br />
man es immer wieder mit Tabubrechern zu<br />
tun, solchen intellektuellen Dienstleistern also,<br />
denen die allgemeine Ratlosigkeit ein will‐<br />
kommener Anlass ist, der Menschheit ganz<br />
allgemein mit ihren gefährlichen Gedanken<br />
auf die Sprünge zu helfen. In der Regel läuft<br />
dies, was die wirklich bedenkenswerten Inhal‐<br />
te angeht, auf bloße Schaumschlägerei hin‐aus,<br />
wie wir zuletzt bei den Herren Sloterdijk und<br />
Bolz beobachten durften. Doch wollen wir<br />
nicht ungerecht sein: Die Abwesenheit von be‐<br />
denkenswert‐bedenklichen Inhalten ist nicht<br />
allein dem Unvermögen der Autoren geschul‐<br />
det, sondern auch dem beinahe vollständigen<br />
Fehlen von Tabus.<br />
Eigentlich ist alles erlaubt. Etwas zugespitzt<br />
ließe sich sagen, dass heute nur noch auf zwei‐<br />
erlei Weise ein Tabu zu brechen ist: Entweder<br />
man kündigt die öffentliche Hinrichtung sei‐<br />
nes Dackels oder Wellensittichs an, oder man<br />
stellt öffentlich die Demokratie in Frage. Was<br />
letzteres Tabu angeht, haben in letzter Zeit ei‐<br />
nige Philosophen die Provokation gesucht, al‐<br />
len voran Alain Badiou, Slavoj Zizek und Toni<br />
Negri. Und nun präsentiert uns auch noch der<br />
Franzose Jean‐Luc Nancy seine Version:<br />
„Wahrheit der Demokratie” heißt sie, ein<br />
schmales Buch von gerade mal 102 Seiten.<br />
Während seine Kollegen ganz brachial,<br />
wenn auch gut begründet die Demokratie ih‐<br />
rer Bütteldienste für das Kapital wegen ab‐<br />
schaffen wollen, geht Nancy etwas behutsamer<br />
vor. Ihm ist es nicht so sehr um die Abschaf‐<br />
fung zu tun als vielmehr um das Bestreiten ei‐<br />
nes zentralen Geltungsanspruches: Die Demo‐<br />
41<br />
MB der AFP <strong>Nr</strong>. <strong>85</strong>/<strong>März</strong> 2010<br />
kratie „ist nicht eine politische Form unter an‐<br />
deren, im Unterschied dazu, was sie für die<br />
Antike war. Sie ist überhaupt keine politische<br />
Form, oder sie ist zumindest nicht zuerst eine<br />
politische Form”. Damit möchte Nancy aller‐<br />
dings den Ansprüchen nicht nur des Politi‐<br />
schen, sondern auch des Religiösen, Ästheti‐<br />
schen, Ökonomischen oder Szientistischen eine<br />
klare Absage erteilen.<br />
Dergleichen Einzeldisziplinen folgen doch<br />
nur den Kalkülen der Aneignung und Unter‐<br />
werfung, nicht zuletzt der Ausbeutung und<br />
Stillstellung einer dem Menschen eigenen Un‐<br />
ruhe. Demokratie, so Nancy, habe im Unter‐<br />
schied dazu dem Menschen zu dienen, indem<br />
sie ihn „als Risiko und Chance ,seiner selbstʹ<br />
einsetzt, als ,Tänzer über dem Abgrundʹ, um es<br />
auf paradoxe und absichtlich nietzscheanische<br />
Weise zu sagen”. Der Mensch, das nicht fest‐<br />
gestellte Tier: Nancys Projekt ließe sich auch<br />
als das Paradox beschreiben, aus der negativen<br />
Anthropologie eines Helmuth Plessners oder,<br />
was beinahe dasselbe ist, aus dem ontologi‐<br />
schen, vor allem in „Sein und Zeit” vorgeführ‐<br />
ten Sprachspiel eines Martin Heideggers einen<br />
normativen Begriff des Politischen gewinnen<br />
zu wollen.<br />
In ihrer gegenwärtigen politischen<br />
Schwundstufe wäre die Demokratie demnach<br />
zu einer Versicherungsagentur für risiko‐<br />
scheue Investoren geworden – mit der ideolo‐<br />
gisch von der „bürgerlichen Mitte” vorbereite‐<br />
ten Zumutung, für die Schadenssummen die<br />
Allgemeinheit aufkommen zu lassen. Und der<br />
Fehler des Systems bestünde darin, den Men‐<br />
schen in seiner Unruhe und Unbestimmtheit<br />
nicht sein zu lassen.<br />
Jean‐Luc Nancy: Wahrheit der Demokratie. A. d. Frz. v. Richard<br />
Steurer. Passagen Verlag , Wien <strong>2009</strong>, 104 Seiten, 12,90 Euro.<br />
Aus: Literatur‐Rundschau der Frankfurter Rundschau vom 8.<br />
Dezember <strong>2009</strong>, S.A10.<br />
‒ Jean-Luc Nancy und die nationale Identität<br />
Nancy und die Kirchturmpolitik ‐ Der Philosoph<br />
erinnert daran, dass individuelle oder nationale<br />
Identität pluralisch ist<br />
Angesichts der von einem Minister in Gang<br />
gesetzt wurde, der es verstand, nationale Iden‐<br />
tität mit Immigration zu vermengen, kann der<br />
Philosoph Jean‐Luc Nancy nur seine Bestür‐<br />
zung äußern. Tieferliegende und weitgehende<br />
Gründe spielen hier eine Rolle: Gegen eine<br />
Philosophie, die das Subjekt als eine Abge‐<br />
schlossenheit auf sich selbst betrachtet, kann<br />
Nancys gesamtes Werk wahrlich zeigen, dass<br />
jedes Subjekt «auf einzigartige Weise plural»
und «auf plurale Art einzigartig» ist. M.a.W.:<br />
dass alles Existierende in Wirklichkeit eine Ko‐<br />
Existenz ist, und dass es von daher schwierig<br />
ist, hier «einen Horizont von „Identität“ anzu‐<br />
visieren». Solche Gründe haben ihre Fundie‐<br />
rung in der Gegenwart: Der Philosoph gesteht<br />
sehr wohl ein, dass «so belastete Begriffe wie<br />
„Identität“ und „Nation“, die seit einem hal‐<br />
ben Jahrhundert zumindest auch philosophi‐<br />
sche, psychoanalytischer, ethnologische, sozio‐<br />
logische und politische Befragungen infiltrie‐<br />
ren, leichtfertig zu sogenannten „Debatten“<br />
herhalten können.» Das Unverständnis sorgt<br />
für einen Stillstand der begrifflichen Arbeit<br />
oder verführt sogar dazu, «um den heißen Brei<br />
herum zu reden». Hiervon heben sich die<br />
«fragmentarisch und rasch entworfenen» Ge‐<br />
danken wohltuend ab, aus denen dieses kleine<br />
erhellende Büchlein über die «Identität» be‐<br />
steht, wohltuend ab.<br />
Was also heißt Identität? Kurz und knapp:<br />
«Die Identität ist ein Geschehen eines Einzel‐<br />
nen, der sich ein (ein persönliches oder kollek‐<br />
tives) «Eines» anzueignen versucht.» Und das<br />
«geschieht nie nur einmal, sondern unaufhör‐<br />
lich»! Man könnte hier auch von «Enteignung»<br />
(Jacques Derrida) sprechen, weil es niemals ein<br />
kompaktes, zu identifizierendes Subjekt gibt,<br />
dem eine solche «Aneignung» zukäme: «jedes<br />
Mal ist es verschieden, verschieden von ande‐<br />
ren und von sich selbst, d.h. es fehlt ihm jegli‐<br />
che Identität. Das soll aber nicht heißen, es sei<br />
labil, inkonsistent und beliebig in Veränderung<br />
begriffen: die wirkliche Konsistenz eines Sub‐<br />
jekts besteht zu jedem Augenblick darin, dass<br />
es seine tatsächliche Identifizierung über‐<br />
schreitet». Gilt das auch für die «nationale»<br />
Identität? Nancy bejaht das: Identität ist nie ein<br />
«Einbruch» (précipité), ein unauflöslicher<br />
«Körper», der aus einer Art Lager historischer,<br />
religiöser, geopolitischer, ethischer, sozialer<br />
oder mythischer Charakterzüge dessen, was<br />
wir als «Nation» bezeichnen, besteht. Sie ist<br />
bloß ein «Fingerzeig …, auf das, was kommt,<br />
was unaufhörlich auf uns zukommt, uns neue<br />
Wege bahnt, Spuren hinterlässt, aber niemals<br />
ein Ding oder ein einheitlicher Sinn.»<br />
Da sind wir, wie wir sehen, weit entfernt<br />
von den Vorstellungen des französischen<br />
Staatspräsidenten, die er vor seinen Ministern<br />
geäußert hat, als er die großen Leitlinien vor<br />
den Regionalwahlen im <strong>März</strong> 2010 darzulegen<br />
versuchte: «Ich will Nägeln mit Köpfen!» (No‐<br />
vember <strong>2009</strong>). «Man kann das nicht besser<br />
42<br />
MB der AFP <strong>Nr</strong>. <strong>85</strong>/<strong>März</strong> 2010<br />
formulieren», kommentiert Nancy. «Nägel mit<br />
Köpfen, das heißt einen reifen Camembert und<br />
darauf jenen gallischen Hahn, den man aller‐<br />
orts auf die Kirchtürme gepflanzt hat; dass soll<br />
ein echtes und unauslöschliches Identitäts‐<br />
merkmal der französischen Nation sein!? Noch<br />
dazu jener französischen Nation, die seit ei‐<br />
nem guten Jahrhundert ihren Ausdruck findet<br />
auf den gestanzten und verschimmelten Bilder<br />
unserer Weinkisten?»<br />
So wie man dadurch unsere Kunst des<br />
Weinanbaus beleidigt, so beleidigt man auch<br />
«vierzig Jahre harter und ergebnisreicher wis‐<br />
senschaftlicher Forschung», die auf allen Ge‐<br />
bieten unserer Humanwissenschaften und der<br />
Philosophie geleistet wurde ‒ man braucht<br />
bloß den Namen Claude Lévi‐Strauss zu er‐<br />
wähnen. Und dann zwingt man die Gesell‐<br />
schaft zu einer Debatte darüber, womit sie sich<br />
identifizieren soll! Die Gesellschaft, und das<br />
sagt schon ihr Name, ist etwas, was vergesell‐<br />
schaftet, assoziiert: «Sie identifiziert nicht, au‐<br />
ßer bei der Staatsangehörigkeit, der Sozialver‐<br />
sicherung oder bei all den unterschiedlichen<br />
Formen staatlicher Datenerhebungen.» Man<br />
sollte auch bedenken, dass es hier um etwas<br />
ganz anderes geht als um eine nationale Identi‐<br />
fizierung, zu der der Staat ebenso wenig in der<br />
Lage ist wie die Gesellschaft. Es stellt sich nicht<br />
die Frage, ob man über eine französische Iden‐<br />
tität sprechen kann oder muss, sondern man<br />
«lädt dazu ein zu formulieren, worin sie beste‐<br />
he, woraus sie gemacht sei, wozu sie nützlich<br />
sei; und mit noch größerer Unverblümtheit<br />
will man ein für allemal festlegen, «was vom<br />
Einzelnen verlangt wird, wie er sich zu integ‐<br />
rieren, zu assimilieren oder gar sich ihr zu un‐<br />
terwerfen habe.»<br />
Das ist ein gefährliches, aber alles in allem<br />
auch ein vergebliches Unterfangen, und das<br />
nicht nur weil Völker sich niemals vollständig<br />
als eine Einheit identifizieren lassen, sondern<br />
auch deshalb weil sich am Horizont schon<br />
«tektonische Verwerfungen» abzeichnen, die al‐<br />
lerorts die «Identität» in Erschütterung verset‐<br />
zen; die Identität kann man nur im Plural de‐<br />
klinieren, sie entzieht sich jeglicher Fixierung.<br />
Das zeigt sich schon in der Literatur: «Was<br />
macht die Identität eines großen Schriftstellers<br />
aus? Dass man sich nie glaubt erdreisten zu<br />
können, die Identität seiner Figuren vollstän‐<br />
dig erfassen erfasst zu haben. Denken Sie nur<br />
an Henry James, Marcel Proust, Faulkner.<br />
Demgegenüber hat ein schlechter Schriftsteller
von Anfang an, noch bevor er begonnen hat zu<br />
schreiben, eindeutig zu identifizierende Figu‐<br />
ren vor sich!» Robert Maggiori<br />
Jean‐Luc Nancy : Identités. Fragments, Paris<br />
(Galilée), 2010, 80 S., 14 Euro.<br />
Aus: Libération Livres vom 11. Februar 2010, S.I.<br />
‒ Aus dem Französischen von H.‐P. Jäck.<br />
C) SOCIOLOGICA<br />
Matthias Becker: Ungleichheit macht krank<br />
„Gleichheit ist Glück”: Zwei englische Mediziner haben<br />
erforscht, dass für die Gesundheit der Menschen Reich‐<br />
tum weniger wichtig ist als Verteilungsgerechtigkeit<br />
„Manches, was man heute als Armut be‐<br />
klagt, wäre in meiner Kindheit beinahe klein‐<br />
bürgerlicher Wohlstand gewesen.ʺ Viele den‐<br />
ken wie der ehemalige Bundeskanzler Helmut<br />
Schmidt, der immer wieder betont, dass es den<br />
Unterprivilegierten hierzulande so schlecht<br />
nicht gehen könne, schließlich besäßen fast alle<br />
einen Fernseher, Videorecorder oder ein Auto<br />
— Dinge, die noch in den 70er Jahren für viele<br />
Facharbeiter unerreichbar waren. Falsch, sagen<br />
Richard Wilkinson und Kate Pickett, zwei eng‐<br />
lische Epidemiologen, deren Buch „Gleichheit<br />
ist Glück” gerade auf Deutsch erschienen ist.<br />
Zumindest in den entwickelten Ländern sei<br />
das Schlimme an der Armut nicht Mangel,<br />
sondern Kränkung.<br />
Wilkinson und Pickett untersuchen seit Jah‐<br />
ren, welche Faktoren das Wohlergehen der<br />
Menschen bestimmen. Sie sind überzeugt, dass<br />
Gesundheit und Lebenserwartung in einer Ge‐<br />
sellschaft unmittelbar davon abhängen, wie<br />
gleichmäßig der Reichtum verteilt ist. Un‐<br />
gleichheit dagegen „führt zu geringerer Le‐<br />
benserwartung, zu geringerem Geburtsge‐<br />
wicht und höherer Säuglingssterblichkeit. Die<br />
Menschen erreichen eine geringere Körpergrö‐<br />
ße, sie sind anfälliger für Infektionskrankhei‐<br />
ten und Depressionen”. Es kommt demnach<br />
gar nicht so sehr darauf an, ob jemand über ei‐<br />
nen Fernseher verfügt oder nicht. Wichtig ist,<br />
ob die anderen einen haben. In den USA ver‐<br />
fügen 80 Prozent der nach offizieller Definition<br />
Armen über eine Klimaanlage, 75 Prozent über<br />
ein Auto und 33 Prozent über Computer,<br />
Zweitwagen oder Geschirrspülmaschine. Den‐<br />
noch leiden sie häufiger unter Krankheiten als<br />
Menschen mit dem gleichen Konsumniveau in<br />
anderen Gesellschaften. Wilkinson und Pickett<br />
43<br />
MB der AFP <strong>Nr</strong>. <strong>85</strong>/<strong>März</strong> 2010<br />
zeigen, dass derselbe Lebensstandard unter‐<br />
schiedliche Folgen hat — je nachdem, wie hoch<br />
der Lebensstandard der anderen ist.<br />
Der wichtigste Grund dafür ist der „sozia‐<br />
len Psychosomatik” von Wilkinson und Pickett<br />
zufolge, dass Ungleichheit chronischen Stress<br />
erzeugt. Besonders die vermehrte Ausschüt‐<br />
tung des Hormons Cortisol führe in den ent‐<br />
wickelten Ländern zu Herz‐Kreislauf‐<br />
Erkrankungen, Schlaganfällen und Fettleibig‐<br />
keit.<br />
Keine Angst vor Unpopulärem<br />
Deshalb führe ab einem bestimmten Ni‐<br />
veau der Gesundheitsfürsorge mehr Wohl‐<br />
stand nicht zu einer entsprechenden Steige‐<br />
rung der durchschnittlichen Lebens‐zeit, wie<br />
gemeinhin angenommen wird. Das Pro‐Kopf‐<br />
Einkommen in Portugal beispielsweise ist nur<br />
halb so groß wie in den USA. Die Lebenser‐<br />
wartung aber liegt in beiden Ländern bei un‐<br />
gefähr 75 Jahren.<br />
Anders gesagt: Je gleichmäßiger die Vertei‐<br />
lung, desto weniger Reichtum ist nötig, um<br />
das gleiche Maß an Lebenszeit und Lebensqua‐<br />
lität zu erreichen. Dabei geht es wohlgemerkt<br />
nicht um „Chancengleichheit”, um faire Start‐<br />
bedingungen beim Wettlauf um Einkommen<br />
und Status, sondern um Gleichheit im Ergeb‐<br />
nis: ein politischer Standpunkt, der heute völ‐<br />
lig marginalisiert ist.<br />
Aber die beiden Mediziner haben keine<br />
Angst, Unpopuläres auszusprechen. Lapidar<br />
stellen sie fest, Gleichheit könne durch geringe<br />
Lohnspreizung wie durch staatliche Umvertei‐<br />
lung erreicht werden; der Effekt für den<br />
Gesundheitszustand der Bevölkerung sei der‐<br />
selbe.<br />
Der Untertitel der englischen Originalaus‐<br />
gabe — „Warum es egalitäreren Gesellschaften<br />
fast immer besser geht” — zeigt den Geist, der<br />
hier weht: Zwei Naturwissenschaftler, die<br />
ebenso fest an ihre Forschungsergebnisse wie<br />
an den kollektiven Erkenntnisfortschritt glau‐<br />
ben, aufrichtig bis zur Naivität — beispiels‐<br />
weise wenn sie versuchen, die Begüterten da‐<br />
von zu überzeugen, dass weniger individueller<br />
Besitz in ihrem eigenen wohlverstandenen<br />
(Gesundheits‐)Interesse wäre.<br />
Wilkinson und Pickett argumentieren fast<br />
ausschließlich mit Statistiken, die Zahlen<br />
kommen von den UN, Unicef oder der WHO.<br />
Mit diesem Material können sie eindrucksvoll<br />
belegen, wie eng der Zusammenhang zwi‐<br />
schen Gesundheit und Gleichheit ist. Im Detail,
wenn es etwa um die Häufigkeit von Gewalt‐<br />
taten, Drogenkonsum oder psychische Krank‐<br />
heiten geht, ist die Argumentation gelegentlich<br />
etwas holzschnittartig. Aber die Grundthese<br />
von Wilkinson und Pickett ist so unmissver‐<br />
ständlich wie aktuell: Ungleichheit macht<br />
krank.<br />
Kate Pickett/Richard Wilkinson: Gleichheit ist Glück.<br />
Tolkemitt‐Verlag, Berlin 2010, 320 Seiten, 19,90 Euro.<br />
Aus: Frankfurter Rundschau vom<br />
27.‐28. Februar 2010, S,24‐25.<br />
5.<br />
<strong>Brief</strong> von Hajo Hübner<br />
„… zurück aus Bangladesch, geht es mir<br />
nicht gut. Ich laboriere an einer Pneumonie.<br />
Trotzdem.<br />
Hier ein etwas älterer Artikel aus der FAZ.<br />
Als ich mir in Dhaka den <strong>Mitglieder</strong>brief <strong>Nr</strong>.<br />
84 runtergeladen hatte, das war sehr erfreu‐<br />
lich, dahinten, im fernen Bangladesch, fiel mir<br />
der Artikel bei der Lektüre des Artikels über<br />
Hans Kelsen ein.<br />
Wenn Herzkrankheiten und ein höheren<br />
Herzinfarktrisiko bei Rezessionskindern Fol‐<br />
gen von Arbeitslosigkeit sind, dann ist Arbeits‐<br />
losigkeit ein Trauma, und die Folgen gehören<br />
zur Posttraumatischen Belastungsstörung. Im<br />
Kapitalismus oder Neokapitalismus wird das<br />
vielleicht nicht so gesehen, aber da gilt nun<br />
mal wieder Teddys Aphorismus:<br />
«Aufforderung zum Tanz. — Die Psychoanalyse tut sich<br />
etwas zugute darauf, den Menschen ihre Genussfähigkeit wiederzugeben,<br />
wie sie durch die neurotische Erkrankung gestört<br />
sei. Als ob nicht das bloße Wort Genussfähigkeit genügte, diese,<br />
wenn es so etwas gibt, aufs empfindlichste herabzusetzen.<br />
Als ob nicht ein Glück, das sich der Spekulation auf Glück<br />
verdankt, das Gegenteil von Glück wäre, ein weiterer Einbruch<br />
institutionell geplanter Verhaltensweisen ins immer<br />
mehr schrumpfende Bereich der Erfahrung. Welch einen Zustand<br />
muss das herrschende Bewusstsein erreicht haben, dass<br />
die dezidierte Proklamation von Verschwendungssucht und<br />
Champagnerfröhlichkeit, wie sie früher den Attachés in ungarischen<br />
Operetten vorbehalten war, mit tierischem Ernst zur<br />
Maxime richtigen Lebens erhoben wird. Das verordnete Glück<br />
sieht denn auch danach aus; um es teilen zu können, muss der<br />
beglückte Neurotiker auch noch das letzte bisschen an Vernunft<br />
preisgeben, das ihm Verdrängung und Regression übrig<br />
ließen, und dem Psychoanalytiker zuliebe an dem Schundfilm,<br />
dem teuren aber schlechten Essen im French Restaurant, dem<br />
seriösen drink und dem als sex dosierten Geschlecht wahllos<br />
sich begeistern. Das Schillersche »Das Leben ist doch schön«,<br />
das immer schon Papiermaché war, ist zur Idiotie geworden,<br />
seitdem es im Einverständnis mit der omnipräsenten Reklame<br />
ausposaunt wird, zu deren Fanalen auch die Psychoanalyse, ihrer<br />
besseren Möglichkeit zum Trotz, Scheite herbeiträgt. Wie<br />
die Leute durchweg zu wenig Hemmungen haben und nicht zu<br />
viele, ohne doch darum um ein Gran gesünder zu sein, so<br />
müsste eine kathartische Methode, die nicht an der gelungenen<br />
Anpassung und dem ökonomischen Erfolg ihr Maß findet, darauf<br />
ausgehen, die Menschen zum Bewusstsein des Unglücks,<br />
des allgemeinen und des davon unablösbaren eigenen, zu bringen<br />
und ihnen die Scheinbefriedigungen zu nehmen, kraft de-<br />
44<br />
MB der AFP <strong>Nr</strong>. <strong>85</strong>/<strong>März</strong> 2010<br />
rer in ihnen die abscheuliche Ordnung nochmals am Leben<br />
sich erhält, wie wenn sie sie nicht von außen bereits fest genug<br />
in der Gewalt hätte. Erst in dem Überdruss am falschen Genuss,<br />
dem Widerwillen gegens Angebot, der Ahnung von der<br />
Unzulänglichkeit des Glücks, selbst wo es noch eines ist, geschweige<br />
denn dort, wo man es durch die Aufgabe des vermeintlich<br />
krankhaften Widerstands gegen sein positives Surrogat<br />
erkauft, würde der Gedanke von dem aufgehen, was man<br />
erfahren könnte. Die Ermahnung zur happiness, in der der<br />
wissenschaftlich lebemännische Sanatoriumsdirektor mit den<br />
nervösen Propagandachefs der Vergnügungsindustrie übereinstimmt,<br />
trägt die Züge des wütenden Vaters, der die Kinder<br />
anbrüllt, weil sie nicht jubelnd die 'Treppe hinunterstürzen,<br />
wenn er misslaunisch aus dem Geschäft nach Hause kommt.<br />
Es gehört zum Mechanismus der Herrschaft, die Erkenntnis<br />
des Leidens, das sie produziert, zu verbieten, und ein gerader<br />
Weg führt vom Evangelium der Lebensfreude zur Errichtung<br />
von Menschenschlachthäusern so weit hinten in Polen, dass jeder<br />
der eigenen Volksgenossen sich einreden kann, er höre die<br />
Schmerzensschreie nicht. Das ist das Schema der ungestörten<br />
Genussfähigkeit. Triumphierend darf die Psychoanalyse dem,<br />
der es beim Namen nennt, bestätigen, er habe halt einen Ödipuskomplex.»<br />
Aus: Theodor W. Adorno: Minima Moralia ‒ Reflexionen<br />
aus dem beschädigten Leben (1951), Frankfurt am Main (Suhrkamp)<br />
1969, S.73-75. Aphorismus 38.<br />
Es gehört zum Mechanismus von Herr‐<br />
schaft, die Erkenntnis des Leidens, das sie<br />
produziert, zu verbieten…<br />
Der Alltag im Kapitalismus ist vielleicht für<br />
viele «das Trauma», wie des Königs neue<br />
Kleider.<br />
Die AFP sollte die Arbeit von Professor Ge‐<br />
rard van den Berg im Auge behalten. Das wird<br />
spannend.<br />
Von Bangladesch bin ich energiegeladen<br />
zurück. Sie wird wiederkommen, wenn die<br />
Pneumonie vorbei ist. Ich will noch nach Afri‐<br />
ka!<br />
Liebe Grüße […] Hajo“<br />
Köln, den 25. Februar 2010<br />
Hajo Hübners empfohlener Artikel:<br />
Ein Humboldt‐Ökonom aus Holland<br />
Mit 3,5 Millionen Euro lockt die Humboldt‐Stiftung den<br />
VWL‐Professor Gerard van den Berg nach Deutschland<br />
Vor ein paar Tagen hat er an der Universi‐<br />
tät Mannheim zu arbeiten angefangen. Gerard<br />
van den Berg ist offensichtlich zufrieden. „Es<br />
war ein äußerst harter Wettbewerb”, sagt der<br />
47 Jahre alte VWL‐Professor aus Holland.<br />
Doch er hat sich gegen starke Konkurrenz aus<br />
anderen Disziplinen durchgesetzt. Im vergan‐<br />
genen Jahr hat die Alexander von Humboldt‐<br />
Stiftung ausschließlich Naturwissenschaftler,<br />
darunter Physiker, Informatiker und Biologen,<br />
ausgewählt.<br />
Dieses Jahr gehört mit van den Berg erst‐<br />
mals auch ein Ökonom zu den acht Topwis‐<br />
senschaftlern, welche die Stiftung nach
Deutschland lockt. Mit der stolzen Summe von<br />
3,5 Millionen Euro über fünf Jahre ist die<br />
Humboldt‐Professur dotiert. Es ist ein großer<br />
Gewinn für die Universität Mannheim. Deren<br />
VWL‐Dekan Enno Mannen freut sich, nun ge‐<br />
linge „der Sprung in die Gruppe der führen‐<br />
den Zentren für empirische Wirtschaftsfor‐<br />
schung und Ökonometrie”. Aber es sei auch<br />
eine neue Erfahrung. „Die Uni muss sich erst<br />
einmal daran gewöhnen, dass es da jetzt eine<br />
Person mit sehr viel Geld und ohne Lehrver‐<br />
pflichtung gibt”, sagt van den Berg [Mann‐<br />
heim‐Karlsruhe‐Frankfurt am Main]. Seine ers‐<br />
te Professur erhielt er 1996 an der Freien Uni‐<br />
versität Amsterdam. Seitdem hat er sich inter‐<br />
national einen Ruf als stark mathematisch und<br />
empirisch ausgerichteter Ökonom gemacht.<br />
Nun ist er in Mannheim angekommen. Mit<br />
dem vielen Geld plant der Arbeitsmarktfor‐<br />
scher, einige „Post‐Docs” — also promovierte<br />
Mitarbeiter — einzustellen und zudem „ganz<br />
viele Daten einzukaufen”. Die Daten sind Basis<br />
großangelegter ökonometrischer Studien. Van<br />
den Berg hat dabei zwei Forschungsschwer‐<br />
punkte: die Wirkung von aktiver Arbeits‐<br />
marktpolitik und der Zusammenhang zwi‐<br />
schen Arbeitslosigkeit und Gesundheit der Be‐<br />
völkerung. So hat er nachgewiesen, dass Men‐<br />
schen, die in einer Rezession geboren wurden,<br />
ein signifikant höheres Risiko von Herzkrank‐<br />
heiten haben. Gründe dafür sind die schlechte‐<br />
re Ernährung und die schlechtere Hygiene in<br />
wirtschaftlich harten Zeiten. „Zudem verur‐<br />
sacht die Sorge der Eltern um ihren Job einen<br />
starken Stress den die Kinder offenbar schon<br />
vor der Geburt mitbekommen.” Rezessions‐<br />
kinder haben noch siebzig Jahre später ein<br />
deutlich höheres Herzinfarktrisiko oder leiden<br />
häufiger unter Kreislaufschwierigkeiten.<br />
Van den Bergs ökonometrische Studien zur<br />
Wirkung der deutschen Arbeitsmarktpolitik<br />
brachten ernüchternde Ergebnisse: „Die meis‐<br />
ten Maßnahmen des Staates funktionieren lei‐<br />
der nicht gut”, sagt er. Die Milliarden, die der<br />
Staat für Fortbildungskurse ausgibt, haben nur<br />
wenig direkte Effekte. In puncto Qualifikation<br />
bringen sie fast nichts, ergaben van den Bergs<br />
Untersuchungen. Es gibt aber unerwartete Ne‐<br />
benwirkungen: Hatten sie die Aussicht, an ei‐<br />
nem Kurs teilnehmen zu müssen, so beschleu‐<br />
nigte dies die Suche der Arbeitslosen nach ei‐<br />
ner Stelle. „Viele Leute haben offenbar keine<br />
Lust, noch mal einige Wochen in die Schule zu<br />
gehen, da suchen sie lieber intensiver nach ei‐<br />
45<br />
MB der AFP <strong>Nr</strong>. <strong>85</strong>/<strong>März</strong> 2010<br />
nem Job.” Ein fragwürdiger Erfolg, findet der<br />
Ökonom.<br />
PHILIP PLICKERT<br />
Aus: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 23,<br />
November <strong>2009</strong>.<br />
[Vgl. dazu auch oben: Medienschau, Abschnitt<br />
SOCIOLOGICA; d.sekr.]<br />
6.<br />
Jacques Lacan<br />
Welche Funktionen kann die Psychoanalyse<br />
in der Kriminologie erfüllen?<br />
Eine theoretische Einführung<br />
(1950) (I‐II)<br />
Vortrag auf der XIII. Konferenz der französisch‐<br />
sprachigen Psychoanalytiker (29. Mai 1950) in<br />
Zusammenarbeit mit Michel Cénac<br />
I. Auf dem Weg zur Wahrheit in den Humanwis‐<br />
senschaften<br />
Die Naturwissenschaften haben ihrer Theo‐<br />
rie nach niemals die Forderung nach ihrer in‐<br />
neren Kohärenz aufgegeben; dieses Ansinnen<br />
ist auch die Bedingung des Wegs der Erkennt‐<br />
nis selbst. Deshalb vermögen auch die Hu‐<br />
manwissenschaften der Frage nach ihrem Sinn<br />
nicht auszuweichen: sie können auch nicht da‐<br />
von absehen, dass die Antwort darauf sich der<br />
Frage der Wahrheit stellen muss; denn sie sind<br />
Teil des wirklichen Verhaltens ihres For‐<br />
schungsgegenstands.<br />
Dass die menschliche Wirklichkeit den Pro‐<br />
zess dieser Enthüllung in sich trägt, ist der<br />
Grund, weshalb einige Philosophen den Ge‐<br />
schichtsprozess als eine der Materie einge‐<br />
schriebenen Dialektik ansehen; kein «behavio‐<br />
ristisches» Schutzritual des Subjekts gegenüber<br />
seinem Forschungsgegenstand kann dieser<br />
Wahrheit diesen schöpferischen und vergäng‐<br />
lichen Stachel nehmen; jeder Wissenschaftler,<br />
der sich der «reinen» Erkenntnis verpflichtet<br />
sieht, zeichnet sich in allererster Linie durch<br />
seine Verantwortung hinsichtlich dieser<br />
Wahrheit aus.<br />
Niemand weiß das besser als der Psycho‐<br />
analytiker; im Wissen um das, was ihm sein<br />
Subjekt anvertraut, und in der Technik der Be‐<br />
handlung von konditionierten Verhaltenswei‐<br />
sen, übt er sein Handwerk aus auf der Basis<br />
der Erkenntnis, dass die Wahrheit allein Wir‐<br />
kung zeitigt.<br />
Ist aber die Suche nach Wahrheit anderer‐<br />
seits auf dem Gebiet der Jurisprudenz nicht
auch das Objekt der Kriminologie? Und zeigen<br />
sich dort nicht auch zwei Seiten ihres Gesichts?<br />
Ihre polizeiliche Seite als Wahrheit des Verbre‐<br />
chens und ihre anthropologische Seite als<br />
Wahrheit des Verbrechers?<br />
Welche Beziehung besteht bei dieser For‐<br />
schung zwischen der Technik, die unser Ge‐<br />
spräch mit dem Subjekt ausrichtet, und den<br />
Begriffen, die unsere psychologische Erfah‐<br />
rung bestimmt? Das ist das Thema, das uns<br />
heute beschäftigen soll: Wir wollen dabei we‐<br />
niger einen Beitrag zur Delinquenzforschung<br />
leisten ‒ das wird in anderen Vorträgen deut‐<br />
lich werden ‒; es geht uns hier eher darum, de‐<br />
ren legitime Grenzen aufzuzeigen, und das<br />
nicht etwa, um unsere Lehre, losgelöst von ih‐<br />
rer Methode, darzustellen, sondern um sie<br />
nochmals ‒ wie es uns stets aufgetragen ist ‒<br />
hinsichtlich eines neuen Gegenstands zu über‐<br />
denken.<br />
II. Von der soziologischen Wirklichkeit des Verbre‐<br />
chens und dem Gesetz und von der Beziehung der<br />
Psychoanalyse zu ihren dialektischen Grundlagen<br />
Weder das Verbrechen noch der Verbrecher<br />
sind Objekte der Forschung, die außerhalb ih‐<br />
res soziologischen Bezugs zu sehen sind.<br />
Die These, dass das Gesetz die Sünde ge‐<br />
biert, bleibt wahr, auch außerhalb der Perspek‐<br />
tive einer Eschatologie der Gnade, wie sie der<br />
Heilige Paulus vorgegeben hat.<br />
Sie lässt sich wissenschaftlich verifizieren<br />
durch die Behauptung, dass es keine Gesell‐<br />
schaft gibt, die kein positives Recht kennt ‒ sei<br />
es nun überliefert oder kodifiziert, als Brauch‐<br />
tum oder als Rechtsinstitution. Es gibt auch<br />
keine Gesellschaft, in der es nicht vielfältige<br />
Arten von Überschreitungen gibt, die man als<br />
Verbrechen definiert.<br />
Der «unbewusste», «erzwungene», «intuiti‐<br />
ve» Gehorsam des vorgeblich Primitiven ge‐<br />
genüber den Regeln der Gruppe taucht als Be‐<br />
griff in der Ethnologie auf; er wird als Spröss‐<br />
ling einer imaginären Instanz angesehen, die<br />
ihren Schatten auf mancherlei andere Vorstel‐<br />
lungen von den «Ursprüngen», die ebenso my‐<br />
thisch sind wie sie selbst, geworfen hat.<br />
Auch zeigt jede Gesellschaft, dass es eine<br />
Beziehung gibt zwischen dem Verbrechen ge‐<br />
gen das Gesetz und der Strafe (châtiments) ‒<br />
welcher Art sie auch immer sein möge ‒, die<br />
letztlich auf ein Einverständnis des betroffenen<br />
Subjekts angewiesen ist. Dies ist eine notwen‐<br />
46<br />
MB der AFP <strong>Nr</strong>. <strong>85</strong>/<strong>März</strong> 2010<br />
dige Bedingung, damit die Strafe selbst ihre<br />
Bedeutung erhält. Und das zeigt sich in zwei‐<br />
erlei Hinsicht: sei es, dass der Verbrecher<br />
selbst die Strafe an sich einsieht, die vom Ge‐<br />
setz für sein Verbrechen vorgesehen ist ‒ wie<br />
das z.B. auf den Inseln der Trobriander der<br />
Fall ist bei der Todesstrafe für den Inzest zwi‐<br />
schen den Cousins mütterlicherseits, von de‐<br />
nen uns Malinowski in seinem Buch „Le crime<br />
et la coutume dans les sociétés sauvages“ berichtet<br />
(und zwar unter Absehung psychologischer<br />
Triebkräfte ‒ nach denen sich die Gründe für<br />
die Tat aufschlüsseln lassen könnten ‒, aber<br />
auch unter Absehung des durchaus in vielen<br />
Farben durchschimmernden Abscheus, der die<br />
Verdammung zum Suizid in der Gruppe selbst<br />
auslösen könnte) ‒ oder sei es, dass die durch<br />
ein Strafrecht erfasste und daher voraussehba‐<br />
re Sanktion eine Prozedur nach sich zieht, die<br />
durchaus nach recht differenzierten sozialen<br />
Einrichtungen verlangt.<br />
Der Glaube, durch den die Strafe im Indi‐<br />
viduum verankert wird, wie auch die Einrich‐<br />
tungen, durch die sie in der Gruppe in die Tat<br />
umgesetzt wird, erlauben es uns, in eine Ge‐<br />
sellschaft wie der unsrigen den Begriff der<br />
Verantwortlichkeit einzuführen.<br />
Doch hier ist es erforderlich, dass diese glo‐<br />
bale Verantwortlichkeit immer auch als Phä‐<br />
nomen einer Äquivalenz gesehen wird. Wir<br />
können grob davon ausgehen, dass immer<br />
auch die Gesellschaft insgesamt (als prinzipiell<br />
geschlossene Gesellschaft, wie die Ethnologen<br />
sagen) davon betroffen ist, wenn eines ihrer<br />
<strong>Mitglieder</strong> für ein Ungleichgewicht gesorgt<br />
hat, das es auszugleichen gilt; und dass dieses<br />
Individuum letztlich kaum [allein] dafür ver‐<br />
antwortlich zu machen ist, weshalb das Gesetz<br />
oftmals nach einer [kollektiven] Satisfaktion<br />
verlangt: entweder zuungunsten der für den<br />
Gesetzesbrecher verantwortlichen <strong>Mitglieder</strong><br />
(tenants) oder der Kollektivität einer „ingroup“,<br />
die ihn als ihr positives Mitglied akzeptiert.<br />
Es kommt sogar vor, dass sich eine Gesell‐<br />
schaft soweit für strukturell entwickelt hält,<br />
dass sie für die Prozedur der Ausschließung<br />
der Untat die Form eines Sündenbocks wählt<br />
oder auf eine der Gesellschaft fremde Hilfe zu‐<br />
rückgreift, um sich zu regenerieren. Das ver‐<br />
weist dann zusätzlich auf eine kollektive oder<br />
mystische Verantwortlichkeit, deren Spuren in<br />
den Gebräuchen zu finden sind oder in umge‐<br />
kehrten (inversés) Triebkräften ans Licht zu<br />
kommen versuchen.
Aber auch in Fällen, bei denen die Strafe<br />
darauf ausgerichtet ist, den Verursacher des<br />
Verbrechens [direkt] zu treffen, kann man<br />
nicht unbedingt davon sprechen, dass sich so<br />
etwas gewissermaßen nur an jenen richtet, der<br />
als der Verantwortliche gilt: Es ist dabei offen‐<br />
sichtlich, dass man eine Unterscheidung mit‐<br />
denken muss, die die Person betrifft, die für<br />
ihre Untaten eine Antwort schuldig ist, je<br />
nachdem ob ihr Richter in einem Heiligen Offi‐<br />
zium oder in einem Volksgericht besteht.<br />
Die Psychoanalyse führt in ihrer Lehre von<br />
den verschiedenen Instanzen eine deutliche<br />
Unterscheidung beim modernen Menschen<br />
ein; sie kann deshalb den in unserer Epoche<br />
unklaren Begriff der Verantwortung bzw. der<br />
Verantwortlichkeit einer genaueren Definition<br />
zuführen und demgemäß einen Beitrag zu ei‐<br />
ner objektiveren Sicht des Verbrechens leisten.<br />
Durch die ihr eigene Begrenzung aufs Indi‐<br />
viduum maßt sich die psychoanalytische Er‐<br />
fahrung nicht an, einen Gegenstand der Sozio‐<br />
logie in seiner Gänze erfassen zu wollen; eben‐<br />
so wenig kann sie alle Triebkräfte, die heutzu‐<br />
tage in unserer Gesellschaft insgesamt am<br />
Werk sind, erkennen; sie muss sich damit be‐<br />
gnügen, die Spannungen in den Beziehungen<br />
herauszuarbeiten, die in der gesamten Gesell‐<br />
schaft grundlegend am Werke sind, und zwar<br />
deswegen weil nur das Unbehagen in der Kul‐<br />
tur die Verbindung (la jointe) zwischen Kultur<br />
und Natur in ihrer ganzen Klarheit zu enthül‐<br />
len vermag. Diese Gleichsetzungen lassen sich<br />
weiter ausdehnen, wenn man den Transforma‐<br />
tionen Rechnung trägt, aus denen jene Hu‐<br />
manwissenschaften, und speziell ‒ wie wir<br />
noch sehen werden ‒ die Kriminologie Nutzen<br />
ziehen können.<br />
Nicht vergessen sollten wir dabei, dass der<br />
Rückgriff auf das Geständnis des Subjekts, das<br />
in der Kriminologie als einer der Schlüssel zur<br />
Wahrheit gilt, und die Wiedereingliederung in<br />
die soziale Gemeinschaft, die als eines der an‐<br />
gestrebten Ziele angesehen wird, im analyti‐<br />
schen Dialog eine privilegierte Stellung ein‐<br />
nimmt; vor allem weil dieser Dialog bis an sei‐<br />
ne äußerste Grenze der Bedeutungshaftigkeit<br />
getrieben werden kann, berührt er sich mit<br />
dem Universellen der Sprache. Dieser Dialog<br />
lässt sich auch nicht aus der Anthropologie<br />
ausgrenzen, denn er bildet ihre Grundlage und<br />
ihr Ziel. Letztlich ist die Psychoanalyse nichts<br />
weiter als eine technische Extrapolation, die im<br />
Individuum die Wirkungsweise jener Dialektik<br />
47<br />
MB der AFP <strong>Nr</strong>. <strong>85</strong>/<strong>März</strong> 2010<br />
erforscht, die das Werden unserer Gesellschaft<br />
gliedert (scande), und die ‒ nach dem Urteil des<br />
Paulus ‒ zur absoluten Wahrheit findet.<br />
Wer uns hier fragen möge, wohin unser<br />
Vortrag führt, dem werden wir im guten<br />
Glauben ‒ und zwar weil wir uns sehr wohl<br />
dieses Risikos bewusst sind ‒ antworten mit<br />
dem Hinweis auf einen jener bekannten Dialo‐<br />
ge aus den Heroengeschichten der Dialektik,<br />
hier besonders auf Platons Dialog Georgias,<br />
dessen Untertitel auf die Rhetorik verweist,<br />
und der allein dazu gemacht scheint, um die<br />
heutzutage existierende Unwissenheit auszu‐<br />
treiben: hier enthüllt sich wirklich eine Ab‐<br />
handlung über die Herausbildung dessen, was<br />
man Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit nen‐<br />
nen kann.<br />
Sokrates weist hier die Selbstgefälligkeit je‐<br />
nes Meisters zurück, der als freier Mann die<br />
Freiheit der antiken Polis verkörpert, deren<br />
Grenze das Sklaventum bildet. Die Ausfüh‐<br />
rungen kulminieren im Postulat für Freiheit<br />
der Weisheit, die allein aus einer absoluten Ge‐<br />
rechtigkeit (l’absolu de Justice) besteht. Sie be‐<br />
ruht einzig und allein auf der Tugend der<br />
Sprache und der Mäeutik des Dialogpartners.<br />
Sokrates macht dem Dialogpartner die Dialek‐<br />
tik von Leidenschaft und Macht klar, die eben‐<br />
so bodenlos ist wie das Fass der Danaer; er er‐<br />
spart ihm zudem nicht die Erkenntnis des Ge‐<br />
setzes, wonach er seine eigene politischen Exis‐<br />
tenz der Ungerechtigkeit zu verdanken hat, die<br />
in der Polis existiert; er veranlasst ihn dazu,<br />
Demut vor dem ewigen Mythos zu zeigen,<br />
nach dem die Bedeutung der Sühne, der Besse‐<br />
rung des Individuums und seines Beispiels für<br />
die Gruppe [erst] dann zu ihrem Ausdruck<br />
findet, wenn dieses Individuum selbst im Na‐<br />
men desselben Universellen sein eigenes<br />
Schicksal annimmt und sich im Vornherein<br />
dem absurden Gerichtsurteil (verdict) der Polis<br />
beugt, das ihn allererst zum Menschen macht.<br />
Es ist in der Tat keineswegs müßig, wenn<br />
man an jenen historischen Moment erinnert,<br />
aus dem jene Tradition entspringt, die das<br />
Aufkommen der Gesamtheit unserer Wissen‐<br />
schaften bildet und in der sich das Denken des<br />
Erfinders der Psychoanalyse einreiht, nämlich<br />
da wo Sigmund Freud mit pathetischer Be‐<br />
stimmtheit behauptet: «Die Stimme der Ver‐<br />
nunft ist die Grundlage, doch sie schweigt<br />
nicht, bevor man sie gehört hat.» Hier meinen<br />
wir ein stummes Echo von Sokrates‘ Stimme<br />
vernehmen zu können, der sich mit folgenden
Worten an Kallikles wendet: «Die Philosophie<br />
sagt immer das Gleiche.»<br />
Jacques Lacan, Introduction théorique aux<br />
fonctions de la psychanalyse en criminologie, in:<br />
Écrits (Seuil) 1966; S. 125‐149. ‒ Übersetzung<br />
aus dem Französischen von H.‐P. Jäck.<br />
[Fortsetzung folgt]<br />
7.<br />
AFP-Forum: Neurowissenschaften<br />
und Psychoanalyse<br />
‒ Ein Dialog zwischen Catherine Malabou und<br />
Jean‐Pierre Changeux<br />
PLATZ DER NEUROBIOLOGIE!<br />
Jean-Pierre Changeux, Neurobiologe, Mitglied der Akademie<br />
der Wissenschaften (1986), ist mit seinem Buch "L'Homme<br />
neuronal" ("Der neuronale Mensch") bekannt geworden. In einem<br />
Interview, das er mit Catherine Malabou geführt hat, die<br />
Philosophin ist und versucht, die Grundlagen einer plastischen<br />
Ontologie, ausgehend von den Entdeckungen der Biologie, zu<br />
entwerfen, kommt er auf seine Beziehungen zu den Philosophen,<br />
auf die strukturale Anthropologie und auf das Kunstwerk<br />
zu sprechen.<br />
Catherine Malabou: Nach dem Erscheinen der Re‐<br />
zension, die ich über Ihr Buch ʺDu Vrai, du Beau,<br />
du Bienʺ (ʺVom Wahren, Schönen und Gutenʺ) in<br />
der ʺQuinzaine littéraireʺ (Januar <strong>2009</strong>) geschrie‐<br />
ben habe, haben wir beide gewünscht, die Diskussi‐<br />
on fortzusetzen und ich freue mich, dass wir das in<br />
dieser Unterhaltung machen können<br />
In dieser Rezension übe ich heftige Kritik an den<br />
Philosophen, die heute bezüglich der Neurobiologie,<br />
zumindest in Frankreich, eine doppelte Haltung<br />
einnehmen, die scheinbar widersprüchlich, aber im<br />
Grunde identisch ist. Die erste besteht darin, eine<br />
Art des ʺalles ist biologischʺ zu feiern und das phi‐<br />
losophische Denken in einen kognitiven Positivis‐<br />
mus zu transformieren. Die zweite zeichnet sich im<br />
Gegenteil durch eine idealistische Verachtung des<br />
angeblichen Reduktionismus aus, den man der<br />
Neurobiologie nachsagt. Keine dieser beiden Hal‐<br />
tungen ist dazu geeignet, die authentische ideologi‐<br />
sche, theoretische und, woran ich festhalte, philoso‐<br />
phische Revolution zu begreifen, welche die jüngs‐<br />
ten Entdeckungen über das Gehirn seit etwa dreißig<br />
Jahren schon hervorrufen.<br />
Ich glaube, dass es nun wirklich an der Zeit ist,<br />
einmal abzuschätzen, inwiefern diese Entdeckun‐<br />
gen, und besonders Ihre Arbeiten, dazu geeignet<br />
sind, die Landschaft der Philosophie, wie die der<br />
Humanwissenschaften im allgemeinen, zu verän‐<br />
dern. Ich beginne mit der Philosophie, indem ich<br />
Ihnen eine sehr allgemeine Frage stellen möchte:<br />
Wie fühlen Sie sich von den Philosophen in Frank‐<br />
reich, von der einen oder anderen Schule, aufge‐<br />
nommen? Glauben Sie, dass Sie verstanden worden<br />
sind seit dem Erscheinen Ihres Buches ʺDer neuro‐<br />
48<br />
MB der AFP <strong>Nr</strong>. <strong>85</strong>/<strong>März</strong> 2010<br />
nale Menschʺ? Welchen Missverständnissen war<br />
dieses Werk ausgesetzt?<br />
Jean‐Pierre Changeux: Ich muss sagen, dass<br />
ich mich von den französischen Philosophen<br />
nicht sehr aufgenommen fühle. Meine Kontak‐<br />
te sind leider sehr beschränkt gewesen. Ver‐<br />
gessen wir die Philosophen wie Derrida, De‐<br />
leuze oder Marion, sowie die Intellektuellen<br />
eines größeren Publikums wie BHL (Bernard‐<br />
Henry Levy), Glucksmann und Finkielkraut ...,<br />
deren Desinteresse ‐ ja Feindseligkeit ‐ gegen‐<br />
über der Wissenschaft offenkundig ist. Positive<br />
Kontakte wurden zu Michel Onfray herge‐<br />
stellt, aber sie sind folgenlos geblieben. Ich ha‐<br />
be früher sehr fruchtbare Dialoge mit Edgar<br />
Morin geführt, und, im Rahmen des Collège de<br />
France, leider nur sehr kurze Kontakte zu Mi‐<br />
chel Foucault gehabt, der am Vorabend seines<br />
Todes eine Debatte über künstliche und natür‐<br />
liche Intelligenz organisieren wollte. Pierre<br />
Bourdieu interessierte sich konkret für die<br />
Neurowissenschaften des Lernens, aber der<br />
Austausch ist da wiederum durch seinen Tod<br />
unterbrochen worden. Ich habe einen kleinen<br />
Text über den ʺneuronalen Habitusʺ und über<br />
die Neurowissenschaften der sozialen Interak‐<br />
tion geschrieben, um ihn zu ehren, aber er ist<br />
ein toter Text im Feld der Sozialwissenschaften<br />
geblieben.<br />
Ich weiß nicht, an welchen französischen<br />
Philosophen Sie denken, der das ʺalles ist bio‐<br />
logischʺ zelebriert und der das philosophische<br />
Denken in einen kognitiven Positivismus<br />
transformiert ‐ sollen das Patricia und Paul<br />
Churchland sein? Aber sie sind Amerikaner.<br />
Wenn sie in Frankreich leben würden, wäre<br />
das schon ein Ausgangspunkt, auch wenn das,<br />
wie Sie sagen, ungenügend ist! Andererseits<br />
bin ich oft mit der idealistischen Geringschät‐<br />
zung des Reduktionismus konfrontiert wor‐<br />
den. Die Kritiken kamen aus sehr unterschied‐<br />
lichen Richtungen und sind oft heftig gewesen.<br />
Zunächst, und das mag überraschen, aus den<br />
philosophischen Lagern der Marxisten und<br />
Psychoanalytikern: mit der Befürchtung, dass<br />
mit dem biologischen Determinismus der<br />
Mensch sowohl seine soziale Dimension als<br />
auch seine irreduzible Individualität einbüßen<br />
könnte! Ebenso die Befürchtung der religiösen<br />
Dualisten, die überzeugt sind, dass keine<br />
Chemie der Welt von den unsagbaren Qualitä‐<br />
ten des geistigen Lebens wird jemals Rechen‐<br />
schaft geben können ... In beiden Fällen wer‐<br />
den die außerordentliche Komplexität des
menschlichen Gehirns, seine Organisations‐<br />
ebenen und seine Plastizität weder verstanden<br />
noch überhaupt in Erwägung gezogen. Wenn<br />
ʺDer neuronale Menschʺ bei seinem Erscheinen<br />
ein lebhaftes Interesse hervorgerufen hat, hat<br />
er leider nicht die Öffnung zu den Wissen‐<br />
schaften des Menschen und der Gesellschaft<br />
zustande gebracht, die ich erhoffte. Aber mit<br />
Ihnen ändern sich ja die Dinge...<br />
C.M.: In dem Dialog, den Sie mit Paul Ricœur ge‐<br />
führt haben (ʺDie Natur und die Regel, was und<br />
denken lässtʺ), gibt es sicherlich einen echten Aus‐<br />
tausch. Dennoch scheint es mir, dass Ricœur in<br />
nichts nachgibt, was für ihn die Überlegenheit der<br />
phänomenologischen Analyse der Subjektivität be‐<br />
züglich jeder anderen Annäherung, insbesondere<br />
der neurobiologischen, ausmacht. So gehört nach<br />
ihm das Gehirn nicht zum eigentlichen Körper.<br />
Man kann sagen: meine Hand, mein Herz, aber<br />
man kann nicht sagen: mein Gehirn. Dieses bleibt<br />
mir ‐ aufgrund der Tatsache, dass ich davon nicht<br />
die geringste Empfindung haben kann ‐ fremd und<br />
äußerlich. Ich kann mich seiner nicht bemächtigen.<br />
Unmöglich deshalb, es als Grund des Subjekts zu<br />
konstituieren. Was denken Sie darüber? Ist ein<br />
Neurobiologe dazu verurteilt, nur über die objekti‐<br />
ven Aspekte des Geistes, wenn man das so sagen<br />
kann, zu arbeiten, ohne jemals Zugang zu dem In‐<br />
timen der Erfahrung zu haben?<br />
Es ist wahr, dass niemand sein eigenes Gehirn<br />
empfinden kann. Ist also Ihr Objekt dazu bestimmt,<br />
der Selbsterfassung durch sich selbst zu entwischen<br />
und folglich, in einem gewissen Sinne, auch dem<br />
Denken? Ist es letztlich nur ein Wissensobjekt?<br />
J.‐P.C.: Paul Ricœur war sehr erstaunt zu er‐<br />
fahren, dass, im Unterschied zu anderen Kör‐<br />
perorganen, das Gehirn über keine ihm eige‐<br />
nen Sinnesnerven verfügt. Es kann nicht seine<br />
eigenen Aktivitätszustände wahrnehmen! Ich<br />
kann nicht sagen, indem ich z.B. das Bild der<br />
ʺMona Lisaʺ in Erinnerung rufe: schau her,<br />
mein visueller Kortex und mein Stirnkortex<br />
werden genau an dieser oder jener Stelle mobi‐<br />
lisiert! Ich bleibe in meiner Subjektivität einge‐<br />
schlossen, außer wenn ich das wissenschaftli‐<br />
che Wissen in Anspruch nehme, die neuen<br />
Bildtechnologien. Diese bringen mir den Be‐<br />
ginn einer Antwort, indem sie mir die objekti‐<br />
ven Daten hinsichtlich meiner subjektiven Zu‐<br />
stände anbieten ... indem sie mir soz. ʺdie<br />
Selbsterfassung durch sich selbstʺ erlauben!<br />
Eine wichtige Arbeit des empirischen Interface<br />
findet sich auf diese Weise mit der Entwick‐<br />
lung der Bild‐ und Aufzeichnungsmethoden<br />
49<br />
MB der AFP <strong>Nr</strong>. <strong>85</strong>/<strong>März</strong> 2010<br />
EEG oder MEG in realer Zeit eröffnet, auch<br />
wenn die theoretische Arbeit, die sie begleiten<br />
sollte, von meinem Standpunkt aus unzurei‐<br />
chend bleibt. Warum sollte man sich nicht vor‐<br />
stellen, dass die Philosophen gemeinsam mit<br />
Biologen und Mathematikern an dieser Mo‐<br />
dellarbeit teil‐nehmen?<br />
C.M.: Was erwarten Sie heute von einem Dialog<br />
mit der Philosophie, wünschen Sie, dass er stattfin‐<br />
det und welche Form sollte er annehmen?<br />
Wären Sie mit mir einverstanden festzustel‐<br />
len, dass eine ʺKritik der neurobiologischen<br />
Vernunftʺ notwendig geworden ist, die den<br />
philosophischen Einfluss der Neurobiologie<br />
bestimmen würde, indem sie auch die Ver‐<br />
antwortung für gewisse ideologische Abirrun‐<br />
gen einer solchen Beeinflussung übernimmt?<br />
Ist es nicht notwendig geworden, das wahrhaf‐<br />
te Objekt der zeitgenössischen Neurobiologie<br />
zu situieren und abzugrenzen?<br />
J.‐P.C.: Ich hoffe natürlich, dass sich ein Di‐<br />
alog mit der Philosophie entwickeln möge.<br />
Aber ich bin nicht sicher, ob das mit der Aus‐<br />
breitung der angelsächsischen analytischen<br />
und kognitivistischen Tradition in der Folge<br />
von Fodor, Putnam, Quine und den anderen<br />
möglich sei, die nach meiner Meinung eine<br />
sehr negative Wirkung auf die Beziehungen<br />
zwischen Philosophie und Neurowissenschaft<br />
gehabt hat. Im Gegensatz dazu interessiere ich<br />
mich für die Arbeit von Hacking und von<br />
Sperber, obwohl ihre Aufnahme von Begriffen<br />
und Gegebenheiten der Neurowissenschaft<br />
mir noch unzureichend erscheint ... Ich glaube,<br />
man muss sich ein für alle Mal von der Meta‐<br />
pher des Geist‐Programms des Computers und<br />
der formalen Linguistik verabschieden, um an<br />
die neuen neuro‐kognitiven Paradigmen her‐<br />
anzukommen, für die eine neue ʺKritik der<br />
neurobiologischen Vernunftʺ sehr nützlich wä‐<br />
re. Es existiert eine reiche philosophische ‐ und<br />
auch mathematische ‐ Tradition in unserem<br />
Lande, die bei passender Gelegenheit auf diese<br />
Fragen hin neu bestimmt werden könnte, un‐<br />
ter der Bedingung, dass man mit Überzeugung<br />
das aktuelle neurobiologische Wissen und den<br />
sich durchsetzenden ʺinstruierten Materialis‐<br />
musʺ übernimmt. Wir warten sozusagen auf<br />
die neuen Bachelards... und vor allem auf die<br />
großen Theoretiker, wie es in ihrer Zeit Hebb<br />
und Penfield in Kanada, Piron und Hey in<br />
Frankreich, von Neumann, Herbert Simon und<br />
viele andere in den USA waren. Wie Sie es au‐<br />
ßerdem anregen, ʺist es unbedingt notwendig
geworden, das wahre Objekt der gegenwärti‐<br />
gen Neurobiologie zu situieren und einzu‐<br />
grenzenʺ, insbesondere in seinen Beziehungen<br />
zu den besonders lebendigen Feldern der<br />
Ethik und der Ästhetik, aber auch zur Episte‐<br />
mologie, die noch von rückständigen Ideolo‐<br />
gien beherrscht werden.<br />
Auf einer praktischeren Ebene sind sich die<br />
Politiker ‐ die allgemein die Bedeutung der<br />
wissenschaftlichen Forschung und die sich da‐<br />
raus ergebenden Fortschritte nicht genug<br />
ernstnehmen ‐ noch nicht der wichtigen An‐<br />
wendungsmöglichkeiten bewusst geworden,<br />
welche die Fortschritte der Neurowissenschaft<br />
auf den Feldern der Erziehung, der Ursprünge<br />
der Gewalt, des Altwerdens, des Lebens unse‐<br />
rer Gesellschaften im Allgemeinen haben kön‐<br />
nen... Gleichermaßen sind Abweichungen mit<br />
ökonomischem oder militärischem Ziel zu<br />
fürchten, und es ist erstaunlich festzustellen,<br />
dass die Neurowissenschaft nicht auf der<br />
Agenda der Revision der bioethischen Gesetze<br />
steht!<br />
Strukturale Anthropologie und<br />
mentaler Darwinismus<br />
C.M.: In meiner Rezension über die wirkliche phi‐<br />
losophische Bedeutung Ihrer Arbeiten ‐ wenn ich<br />
darauf insistieren darf, wie ich gerade daran erin‐<br />
nert habe ‐ erlaube ich mir auch, auf etwas hinzu‐<br />
weisen, was wie eine Schwäche erscheinen könnte,<br />
wenn wir nicht darauf zurückkommen. Sie sagen,<br />
dass viele große französische Intellektuelle (Fou‐<br />
cault, Derrida...) die neurobiologischen Forschun‐<br />
gen als Vektoren von totalitären, zumindest repres‐<br />
siven Ideologien angesehen haben (die bekannte Re‐<br />
duktion des Menschen auf einen Roboter!). Sie stel‐<br />
len Lévi‐Strauss auf die gleiche Ebene. Das er‐<br />
scheint mir etwas vorschnell. Glauben Sie nicht,<br />
dass ein vertiefter Dialog mit dem, was der Struk‐<br />
turalismus war, notwendig geworden ist?<br />
J.‐P.C.: Die Idee, dass die ʺBiologisierungʺ<br />
des Menschen ein Auswuchs totalitärer Ideo‐<br />
logien ist, stammt meiner Meinung nach nicht<br />
aus der Reduzierung des Menschen auf einen<br />
Roboter, sondern hängt in Europa mit der Er‐<br />
innerung an die Verwüstungen durch die Na‐<br />
zi‐Ideologie und mit der Furcht jeglicher Dis‐<br />
kriminierung zusammen, die sich auf die Bio‐<br />
logie stützen kann. Es ist bemerkenswert, dass<br />
in den USA die Wahrnehmung dieser Frage oft<br />
das Gegenteil darstellt. Nehmen wir den Fall<br />
der Homosexuellen: die Existenz einer biologi‐<br />
schen Differenz wird dort als befreiend erlebt,<br />
hier als diskriminierend!<br />
50<br />
MB der AFP <strong>Nr</strong>. <strong>85</strong>/<strong>März</strong> 2010<br />
Was Lévi‐Strauss betrifft, nein!, ich reihe<br />
ihn nicht in die Kategorie der ʺNeuro‐Phobenʺ<br />
ein. Die persönlichen Kontakte zu ihm haben<br />
mir im Gegenteil sein wirkliches Interesse für<br />
die Neurowissenschaft gezeigt. Aber dennoch<br />
muss man sein Zögern feststellen, sie in seine<br />
wissenschaftliche Reflexion zu integrieren. Das<br />
ist ebenfalls der Fall seiner Erben wie Descola<br />
oder Godelier gewesen. Gleichwohl habe ich<br />
die jüngsten Stellungnahmen von Godelier an‐<br />
lässlich des 30. Geburtstages der Fondation<br />
Fyssen registriert. Dieser geht, gemäß seiner<br />
Begriffe, sogar soweit, den Verzicht sowohl<br />
des Paradigmas des Gesellschaftsvertrages als<br />
auch den Freudianischen Gesichtspunkt (end‐<br />
lich!) zugunsten einer kognitiven und kulturel‐<br />
len Geschichte der Vor‐ und Proto‐Menschen<br />
vorzuschlagen. Er unterstreicht ebenfalls die<br />
Anerkennung der Produktion von nicht be‐<br />
weisbaren Ideen(heiten) ‐ von Abstraktionen,<br />
die durch die tägliche Praxis nicht validierbar<br />
sind ‐ ʺdurch das Gehirnʺ, die aber unabhängig<br />
voneinander in der ganzen Welt auftauchen<br />
konnten und die, indem sie sozial geteilt wur‐<br />
den, zur Schaffung von Institutionen Anlass<br />
gegeben haben. Ich freue mich über diese Ent‐<br />
wicklung, die ich sehr vielversprechend finde.<br />
C.M. ‐ Wie Sie wissen, wünscht sich Lévi‐Strauss<br />
in ʺRace et cultureʺ (ʺRasse und Kulturʺ) klar und<br />
nachdrücklich eine Zusammenarbeit von Biologie<br />
(besonders der Genetik) und den Humanwissen‐<br />
schaften. Was er kritisiert, ist überhaupt nicht die<br />
Darwinʹsche Theorie der Evolution, sondern das,<br />
was er die vulgäre ʺbiologische Evolutionslehreʺ<br />
nennt, die darin besteht, jede Kultur mit einem<br />
Wertkoeffizienten (vom wenigsten zum meisten)<br />
gemäß ihrem vorgeblichen Entwicklungsgrad aus‐<br />
zustatten. Ich stelle mir vor, dass Sie auch das nicht<br />
verteidigen würden.<br />
Mit anderen Worten, es scheint mir, dass Lévi‐<br />
Strauss Ihren Positionen viel näher ist, als Sie es<br />
zuzugestehen scheinen. Er hat niemals auch nur<br />
einen Moment Darwin kritisiert, sondern hat im<br />
Gegenteil immer auf der Schuld des Strukturalis‐<br />
mus gegenüber der Biologie beharrt.<br />
Freilich konnte Lévi‐Strauss nicht die neuesten<br />
Entdeckungen der Gehirn‐Plastizität kennen, und<br />
seine Auffassung der Biologie im Allgemeinen, sein<br />
Blick auf die Evolution im Besonderen, sind gewiss<br />
ein wenig veraltet. Ich weiß andererseits, dass Sie<br />
nicht Anthropologe sind und dass Neurobiologie<br />
und Anthropologie selbstverständlich zwei sehr un‐<br />
terschiedliche Felder sind. Wäre es trotz allem nicht
fruchtbar, die Beziehungen zwischen Darwinismus<br />
und Strukturalismus neu zu denken?<br />
J.‐P.C.: Im 3. Kapitel von ʺRace et histoireʺ<br />
(ʺRasse und Geschichteʺ), S.25‐26, über den Eth‐<br />
nozentrismus ist Lévi‐Strauss über Darwin<br />
und die biologische Evolutionstheorie gewiss<br />
des Lobes voll, aber er greift heftig die Vorstel‐<br />
lung der sozialen oder kulturellen Evolution<br />
an, die ihm zufolge ʺhöchstens nur eine ver‐<br />
führerische, aber gefährlich bequeme Methode<br />
der Darstellung der Fakten mit sich bringtʺ<br />
oder auch noch ʺdie fälschliche wissenschaftli‐<br />
che Aufmachung eines alten philosophischen<br />
Problemsʺ. Warum diese überraschende Kluft,<br />
wenn nicht um die Spencer‘sche Sichtweise<br />
des Sozialdarwinismus zu verurteilen, die, wie<br />
jeder weiß, nur eine irrtümliche Anwendung<br />
der Evolutionstheorie auf das soziale Leben<br />
ist? Wie Patrick Tort gut gezeigt hat, wider‐<br />
setzt sich Darwin in ʺLa Filiation de lʹhommeʺ<br />
(ʺDie Abstammung des Menschenʺ) der These des<br />
Sozialdarwinismus, indem er erklärt, dass ʺdie<br />
natürliche Auslese, indem sie gemeinsam die<br />
Entwicklung der sozialen Instinkte, der affek‐<br />
tiven Gefühle und der Rationalität auswählt,<br />
die Menschwerdung auf den Weg einer Aner‐<br />
kennung des anderen und einer Moral ge‐<br />
bracht hat, die jegliche Form der selektiven<br />
Eliminierung verurteilen...ʺ Es ist selbstver‐<br />
ständlich dringend, die Beziehungen zwischen<br />
Darwinismus und Strukturalismus neu zu<br />
denken, indem man hier das neuronale Inter‐<br />
face einführt. Ich verlasse mich da auf Sie!<br />
C.M.: Es scheint mit folglich sicher zu sein, dass<br />
Levi‐Strauss offensichtlich keineswegs die Existenz<br />
einer Kontinuität zwischen dem Biologischen und<br />
dem Kulturellen leugnet. Er macht sie wiederholt<br />
in seinem Werk geltend. Als Beispiel nehme ich die‐<br />
se bekannte Behauptung aus der ʺStrukturalen<br />
Anthropologieʺ: ʺ(...) Die Verwandtschafts‐ und<br />
Heiratsregeln definieren einen vierten Kommunika‐<br />
tionstyp (nach der Kommunikation der Frauen, der<br />
Kommunikation der Güter und Dienste und der<br />
Kommunikation der Botschaften): den der Gene<br />
zwischen den Phänotypen. Die Kultur besteht folg‐<br />
lich nicht ausschließlich aus Formen der Kommu‐<br />
nikation, die ihr im eigentlichen Sinn zugehören<br />
(wie die Sprache), sondern auch ‐ und vielleicht vor<br />
allem ‐ aus Regeln, die auf alle Arten von ʺKom‐<br />
munikationsspielenʺ anwendbar sind, ob nun diese<br />
auf der Ebene der Natur oder der Kultur sich ab‐<br />
spielenʺ (Anthropologie structurale, pp.326‐327).<br />
Meinen Sie nicht, dass Lévi‐Strauss dieses an‐<br />
dere Gesetz, dieses andere Kommunikationsprinzip,<br />
51<br />
MB der AFP <strong>Nr</strong>. <strong>85</strong>/<strong>März</strong> 2010<br />
das Sie in Ihren Büchern klar herausarbeiten, hätte<br />
erkennen können: es handelt sich um die Theorie<br />
der Epigenese durch selektive Stabilisierung der<br />
Synapsen. Sie ist auch noch bekannt unter dem<br />
Namen des mentalen Darwinismus. Die Kommu‐<br />
nikation beim lebendigen Individuum zwischen ei‐<br />
nerseits einer ʺgenetischen Hülleʺ, die strikt de‐<br />
terminiert ist, und andererseits den epigenetischen,<br />
nicht determinierten Faktoren, deren wichtigster in<br />
der Neurobiologie die zerebrale Plastizität ist? Ein<br />
Dialog, mit anderen Worten, zwischen einem Pro‐<br />
gramm und einer Freiheit der Improvisation, die<br />
durch die unzähligen synaptischen Verbindungen<br />
eröffnet wird, deren unser Gehirn fähig ist? Besteht<br />
da nicht ein ʺKommunikationsspielʺ, dem, zwi‐<br />
schen Natur und Kultur angesiedelt, auch der Wert<br />
eines Gesetzes zugesprochen werden muss?<br />
J.‐P.C.: Ich teile da völlig Ihren Standpunkt.<br />
Das ist genau die Position, die ich im<br />
ʺLʹHomme de véritéʺ (ʺDer Mensch der Wahrheitʺ)<br />
und in meinem letzten Buch ʺDu Vrai, du Beau,<br />
du Bienʺ (ʺVom Wahren, Schönen und Gutenʺ),<br />
das meine vergangenen Vorlesungen am<br />
Collège de France wiederaufnimmt, zu vertei‐<br />
digen versuche. Ich stimme völlig überein mit<br />
dem Begriff des ʺKommunikationsspielsʺ, der<br />
sich dem annähert, was ich die ʺkognitiven<br />
Spieleʺ nenne, die zur Zeit der epigenetischen<br />
Erlernung der Sprache durch das Neugebore‐<br />
ne intervenieren würden. Jedoch mit dem Un‐<br />
terschied, dass ich neuronale Grundlagen vor‐<br />
zuschlagen versuche.<br />
C.M.: Ebenso sehr wie Levi‐Strauss die Strukturen<br />
oft mit dem identifiziert, was er ʺGesetze des Un‐<br />
bewusstenʺ nennt, wobei letzterer Ausdruck hier<br />
überhaupt nicht das Freud‘sche Unbewusste be‐<br />
zeichnet, sondern wohl ein Ensemble von biologisch<br />
verwurzelten Konstruktionsregeln, die mit den ze‐<br />
rebralen Gesetzmäßigkeiten korrespondieren! Wür‐<br />
den Sie eine solche Definition des Unbewussten ak‐<br />
zeptieren?<br />
J.‐P.C.: Ich vermeide den Ausdruck des<br />
ʺUnbewusstenʺ genau aus dem Grunde, um<br />
mich nicht explizit auf das Freud‘sche Unbe‐<br />
wusste zu beziehen. Ich gebrauche dagegen<br />
lieber den Ausdruck Nicht‐Bewusstes, der viel<br />
weniger ideologisch belastet ist und ganz ein‐<br />
fach die Gehirnaktivitäten bezeichnet, die nicht<br />
bewusst sind, und diese sind zahlreich! Ich ak‐<br />
zeptiere selbstverständlich, was Sie ʺbiologisch<br />
verwurzelte Konstruktionsregelnʺ nennen. Ich<br />
entwickle übrigens im ʺMenschen der Wahrheitʺ<br />
und ʺVom Wahren, Schönen und Gutenʺ den Be‐<br />
griff der ʺepigenetischen Regelʺ hinsichtlich
der kulturellen Evolution und insbesondere<br />
des künstlerischen Schaffens (cf. p.226 und<br />
p.320 von ʺDer Mensch der Wahrheitʺ). Ich un‐<br />
terbreite dort, dass unser Gehirn imstande ist,<br />
gewissermaßen wie erworbene Operatoren<br />
Verbindungs‐Dispositive zu benutzen, die fä‐<br />
hig sind, die Produktion der Vor‐<br />
Repräsentationen zu bezwingen ‐ sie gleich‐<br />
sam in einem Rahmen einzufassen ‐ und somit<br />
gegen die kombinatorische Explosion zu<br />
kämpfen, die durch den außergewöhnlichen<br />
Reichtum der zerebralen Verbindungsfähigkeit<br />
(Kopplungsfähigkeit) hervorgerufen wird. Jene<br />
(die Verbindungspositive) sind gewiss biolo‐<br />
gisch verwurzelt, können aber mit angebore‐<br />
nen Dispositiven korrespondieren, die von der<br />
biologischen Evolution beerbt wurden, wie<br />
z.B. die Regeln der Invarianz der Farben oder<br />
des Klangs, aber auch mit jenen erworbenen<br />
Produktionen, die einer Kultur oder sogar ei‐<br />
nem Künstlerstil eigentümlich sind. Die gene‐<br />
tische Kombinatorik erweitert sich durch die<br />
neuronale, epigenetische Kombinatorik. In die‐<br />
sem letzten Fall hat sich der Erwerb der Regel<br />
auf bewusste Weise einstellen müssen, dann,<br />
einmal routinemäßig geworden, konnte ihr<br />
Gebrauch nicht‐bewusst werden. Aus diesem<br />
Grunde zögere ich, Ausdrücke wie ʺGesetz des<br />
Unbewusstenʺ zu verwenden. Im Gegensatz<br />
dazu finde ich es interessant, wenn man ver‐<br />
sucht, in dieser Kombinatorik das Erworbene<br />
des Eigenen der Gattung als auch das Bewuss‐<br />
te des Nicht‐Bewussten zusammenzufügen.<br />
Die ʺStrukturenʺ und die neuronale Plastizität<br />
C.M.: Von da komme ich zu einer meiner Ansicht<br />
nach der wichtigsten Fragen, die nochmal die Be‐<br />
ziehung zwischen ʺmentalem Darwinismusʺ und<br />
ʺStrukturalismusʺ betrifft. Würden Sie akzeptie‐<br />
ren, die durch Selektion, dann durch synaptische<br />
Stabilisierung erreichten Konfigurationen, die An‐<br />
lass zu kulturellen Formen geben (logisches Den‐<br />
ken, Urteile, Theorien, Bräuche, Glauben, Kunst‐<br />
werke) ‐ ʺStrukturenʺ anzusehen?<br />
J.‐P.C.: Wie ich eben gesagt habe, habe ich<br />
den Ausdruck ʺepigenetische Regelʺ benutzt,<br />
um diese kulturellen Formen zu kennzeichnen,<br />
und ich sehe keinen Gegensatz zu dem, dass<br />
Sie sie mit den ʺStrukturenʺ des Strukturalis‐<br />
mus gleichsetzen. Aber ich vermeide das Wort<br />
Struktur in diesem Kontext. In den biologi‐<br />
schen Wissenschaften hat das Wort Struktur<br />
eine ‐ oder vielmehr sehr unterschiedliche ‐<br />
Sinnbedeutungen, was viel Verwirrung nach<br />
sich ziehen kann.<br />
52<br />
MB der AFP <strong>Nr</strong>. <strong>85</strong>/<strong>März</strong> 2010<br />
C.M.: Welche Konsequenzen sind aus der Applika‐<br />
tion der zerebralen Epigenese auf die soziale Evolu‐<br />
tion zu ziehen? Welche Rolle spielt die Plastizität<br />
in dieser Entwicklung?<br />
J.‐P.C.: Ich habe die Bedeutung der Epige‐<br />
nese ‐ und folglich der zerebralen Plastizität ‐<br />
in der sozialen Evolution seit dem Buch ʺDer<br />
neuronale Menschʺ ausgiebig diskutiert, das ist<br />
schon mehr als 25 Jahre her, ohne dass das un‐<br />
sere Kollegen der Human‐ und Sozialwissen‐<br />
schaften besonders interessiert hätte ..<br />
In Frankreich sind die Spaltungen zwischen<br />
den Disziplinen bedauernswert. In dem Uni‐<br />
versum der Wissenschaften vom Menschen<br />
und der Gesellschaft konnte ich feststellen,<br />
dass ‐ noch in unseren Tagen ‐ das Gewicht<br />
der Ideologien sehr groß ist. Sich mit den Bio‐<br />
logen zusammenzutun, ist für einen Soziolo‐<br />
gen eine ideologische Stellungnahme, was<br />
wichtiger zu sein scheint als der Fortschritt des<br />
Wissens! Eine erstaunliche Tatsache im Land<br />
der Aufklärung, dass die kulturelle Welt die<br />
Wissenschaftler bewusst aus ihrer Mitte in ei‐<br />
nem Maße auszuschließen scheint, dass in den<br />
großen Tageszeitungen jene sogar nicht als ʺIn‐<br />
tellektuelleʺ angesehen werden. Es gibt noch<br />
viel zu tun, um die geistigen Einstellungen zu<br />
verändern... Es zeigen sich da die Grenzen der<br />
zerebralen Plastizität unserer Mitbürger!<br />
Das Beispiel des Kunstwerks<br />
C.M.: Ich habe in meiner Rezension bei Ihnen auf<br />
einen gewissen evolutionistischen Optimismus<br />
hingewiesen. Als ob der mentale Darwinismus zu<br />
der Einrichtung einer besseren Welt führen würde!<br />
So sagen Sie in Ihrem letzten Werk: ʺDas Schöne<br />
würde so unter der Form von einzigartigen und<br />
harmonischen Synthesen zwischen Gefühl und Ver‐<br />
stand befördert werden, die das soziale Band ver‐<br />
stärken würden; das Gute bestünde in der Verfol‐<br />
gung eines glücklichen Lebens in der Gesellschaft;<br />
schließlich wäre das Wahre die ständige Suche nach<br />
objektiven, rationalen, allgemeinen und kumulati‐<br />
ven Wahrheiten, mit beständiger kritischen Infra‐<br />
gestellung und dem auf diese Weise hervorgebrach‐<br />
ten Wissensfortschrittʺ (p.514).<br />
Sind Sie nicht zu sehr noch an die Teleologie, an<br />
den schließlichen Sieg des Sinns gebunden? Unter‐<br />
stellt man dem Kunstwerk einen solchen Sieg? Gibt<br />
es nicht, wie Darwin sagte, eine Abwesenheit des<br />
Sinns bei der natürlichen Auswahl?<br />
J.‐P.C.: Selbstverständlich teile ich Darwins<br />
Standpunkt hinsichtlich der biologischen Evo‐<br />
lution und der Sinn‐Absenz bei der natürli‐<br />
chen Auswahl. Gilt das Gleiche für die kultu‐
elle Evolution? Das menschliche Gehirn ist<br />
der Hauptakteur, und dieses ist genau durch<br />
eine ständige Aktivität charakterisiert, einen<br />
Sinn auf die es umgebende Welt zu projizie‐<br />
ren, auch wenn es sich dabei oft, um die Aus‐<br />
drucksweise von Godelier aufzugreifen, um<br />
nicht validierbare Abstraktionen durch die täg‐<br />
liche Praxis handelt. Es gibt eine Überproduk‐<br />
tion des Sinns durch das menschliche Gehirn,<br />
und von dieser Tatsache her die Notwendig‐<br />
keit einer Selektion. Die ʺBlindheitʺ der kultu‐<br />
rellen Evolution hängt meines Erachtens damit<br />
zusammen, dass die durch die <strong>Mitglieder</strong> der<br />
sozialen Gruppe getroffene Auswahl (Selekti‐<br />
on) die konkrete Realität des individuellen<br />
Überlebens mit der Referenz auf ein nicht<br />
überprüfbares Symbolisches vermischt, das<br />
von einer Kultur zur anderen zu variieren<br />
vermag. Von daher die interkulturellen Kon‐<br />
flikte und die vielfältigen Veränderungen des<br />
gemeinschaftlichen Lebens. Von daher auch<br />
die von mir gemachten Vorschläge, diese Kon‐<br />
flikte zu überwinden und auf eine harmoni‐<br />
schere Allgemeinheit abzuzielen. Ich bin nicht<br />
so sehr an den ʺEndsieg des Sinnsʺ gebunden<br />
als an einen bescheidenen Beitrag des ʺgesun‐<br />
den Menschenverstandesʺ zugunsten einer<br />
harmonischen Zukunft der Menschheit ... und<br />
ich denke, dass die Kunstwerke ein allgemein‐<br />
gültigeres und trächtigeres Formenuniversum<br />
darstellen als jede andere kulturelle Repräsen‐<br />
tation.<br />
C.M.: Was trägt der neuro‐ästhetische Gesichts‐<br />
punkt zum Kunstwerk bei?<br />
J.‐P.C.: Ein besseres Verständnis dessen,<br />
was das Kunstwerk ist und was es repräsen‐<br />
tiert. Das erscheint mir ganz selbstverständlich<br />
zu sein!<br />
C.M.: Was bedeutet für Sie das ʺSammelnʺ? Kön‐<br />
nen Sie von Ihrer Sammler‐Erfahrung sprechen<br />
und sie zu Ihrer wissenschaftlichen Praxis in Be‐<br />
ziehung setzen?<br />
J.‐P.C.: Ich habe seit meiner frühesten Ju‐<br />
gend zuerst, wie alle Kinder, <strong>Brief</strong>marken ge‐<br />
sammelt, dann Insekten, Pflanzen und Fossi‐<br />
lien... Ich glaube, dass das eine sehr wirkungs‐<br />
volle Art ist, die uns umgebende Welt im De‐<br />
tail zu kennen, in dem Maße natürlich, dass es<br />
sich dabei nicht einfach um eine zwanghafte<br />
Tätigkeit handelt. So lernt man auf rationale<br />
und systematische Weise ‐ und auf der Basis<br />
von bestimmten Kriterien ‐ zu klassifizieren<br />
und zu organisieren. Das ist ein erster Versuch<br />
von wissenschaftlicher Praxis gewesen, der<br />
53<br />
MB der AFP <strong>Nr</strong>. <strong>85</strong>/<strong>März</strong> 2010<br />
mich überdies als Heranwachsen‐der mit den<br />
Forschern des naturgeschichtlichen Museums<br />
in Kontakt gebracht hat und mich soz. auf die<br />
Ochsentour der biologischen Forschung ge‐<br />
bracht hat.<br />
Schlussfolgerung<br />
C.M.: Glauben Sie an eine neue interdisziplinäre<br />
Zusammenarbeit (von Biologie, Neurowissenschaft,<br />
den Wissenschaften vom Menschen, der Gesell‐<br />
schaft und der Geschichte der Zivilisationen) und<br />
was sollte sie versuchen auszuarbeiten?<br />
J.‐P.C.: Das ist nicht eine Glaubensangele‐<br />
genheit, sondern eine feste Überzeugung. Ich<br />
betrachte es als unbedingt erforderlich, das<br />
Ideal der ʺEnzyklopädieʺ wieder aufzunehmen<br />
und zu erneuern, indem man gegen die Auf‐<br />
spaltungen der Disziplinen, bei gleichzeitiger<br />
Respektierung ihrer Besonderheiten, kämpft.<br />
Ich mag das Wort ʺinter‐disziplinärʺ nicht und<br />
spreche lieber von ʺPluriʺ‐Disziplinarität. Es ist<br />
unbedingt erforderlich, jede Disziplin an den<br />
Wissensfortschritten in den anderen Wissens‐<br />
bereichen teilhaben zu lassen. Man muss eine<br />
Einheit des Wissens konstruieren und ständig<br />
weiterentwickeln lassen. Ich glaube nicht, dass<br />
man an einen dauerhaften Frieden unter den<br />
Menschen denken kann ohne diese fundamen‐<br />
tale Bedingung.<br />
Aus: La Quinzaine littéraire vom 15.‐31. Ok‐<br />
tober <strong>2009</strong>, S.4‐6. – Aus dem Französischen<br />
von Thomas Mahlow, Heilmannstr. 9 c, 81479<br />
München.<br />
Herzlichen Dank für das Auffinden des Artikels und für die<br />
Übersetzungsmühe! d.sekr.<br />
‒ Pädagogik und Hirnforschung<br />
Das Kind als Aktenordner<br />
Können Pädagogen von Hirnforschern lernen?<br />
Mancher Erziehungswissenschaftler sagt. Nein!<br />
Von Walter Schmidt<br />
Der Versuch, einer Waschmaschine das<br />
Würstchen‐Grillen beizubringen, scheitert in<br />
aller Regel. Ihre Speicherchips enthalten dafür<br />
einfach kein taugliches Programm. Ist der Job<br />
des Lehrers ähnlich aussichtslos, wenn er Kin‐<br />
dern und Heranwachsenden et‐was beibringen<br />
will? Ist es dann nicht oft schon viel zu spät?<br />
Sind die Schüler‐Hirne dann nicht bereits so<br />
stark vorgeprägt und Nervenverschaltungen<br />
so fest fixiert, dass die Würfel längst gefallen<br />
sind? Längst festgelegt ist, ob das einzelne<br />
Kind wissbegierig, lernbereit und also ausrei‐<br />
chend motiviert ist, Anregungen als Heraus‐<br />
forderungen wahrzunehmen?
Lässt sich das Ruder bei an‐scheinend fau‐<br />
len oder gar verhaltensauffälligen Kindern<br />
noch her‐umreißen? Können Pädagogen von<br />
einem freien Willen bei ihren Schülern ausge‐<br />
hen und mit Begriffen wie Schuld und Ver‐<br />
antwortung hantieren, wenn doch das Hirn oft<br />
schon über das Verhalten entscheidet, bevor es<br />
dem Individuum bewusst wird?<br />
Otto Speck, bis zu seinem Ruhestand Pro‐<br />
fessor für Sonderpädagogik an der Ludwig‐<br />
Maximilians‐Universität München, hat sich<br />
diesen Fragen in seinem kürzlich erschienenen<br />
Buch über „Hirnforschung und Erziehung”<br />
ausführlich gewidmet und er‐muntert seine<br />
Fachkollegen dazu, sich intensiv mit Hirnfor‐<br />
schung zu beschäftigen. „Die Pädagogik hat al‐<br />
len Grund, sich für das Zentralorgan des Men‐<br />
schen, für sein Gehirn, zu interessieren, laufen<br />
doch hier die Prozesse ab, die allem Lernen<br />
physiologisch zugrunde liegen”, befindet der<br />
Münchner Heilpädagoge.<br />
Tröstlich für engagierte Erzieher dürfte<br />
sein, dass laut Speck ihr Beitrag zum Reifen<br />
eines Menschen durch die Entdeckungen der<br />
Hirnforschung nicht kleiner werde. Zwar<br />
könnten Erzieher nur noch begrenzt gegen das<br />
bei Drei‐ oder gar Sechsjährigen schon weithin<br />
vorgeformte Hirn an erziehen und allenfalls<br />
noch einen Teil der angesammelten Entwick‐<br />
lungsmängel beseitigen. Doch seien sie ande‐<br />
rerseits auch keine Maschinisten, die kleine<br />
Denkapparate bloß noch gut ölen müssten.<br />
Für Motivation und Anspruch von Erzie‐<br />
hern hält Speck es für keineswegs gleichgültig,<br />
ob sie es „mit einem seiner selbst bewussten<br />
Kind oder Jugendlichen” zu tun hätten oder<br />
„mit determinierenden chemo‐physikalischen<br />
Prozessen in seinem Gehirn” – einem nach fes‐<br />
ten Vorgaben ablaufenden „Zusammenspiel<br />
von Nervenzellen und Molekülen”. Ziel von<br />
Pädagogen müsse es bleiben, Kinder zu ver‐<br />
antwortlichen Menschen mit moralischem<br />
Empfinden heranzubilden – unabhängig da‐<br />
von, ob jemand vollumfänglich schuld an sei‐<br />
nem Tun sei.<br />
Zudem sei eine Reihe wichtiger Fragen<br />
noch offen. So ist Speck zufolge bis heute nicht<br />
verstanden, wie und warum aus physikalisch‐<br />
chemischen Prozessen die Inhalte des Be‐<br />
wusstseins entstehen. „Der Streit um das Ver‐<br />
hältnis von neuronalen und mentalen Prozes‐<br />
sen erscheint – jedenfalls gegenwärtig – nicht<br />
lösbar” urteilt der Buchautor. Weder ließen<br />
sich beide Phänomene sauber unterscheiden,<br />
54<br />
MB der AFP <strong>Nr</strong>. <strong>85</strong>/<strong>März</strong> 2010<br />
noch könne man sie gleichsetzen oder gegen‐<br />
einander austauschen.<br />
Eine der wichtigsten Erkenntnisse der Hirn‐<br />
forschung aus jüngerer Zeit dürfte sein, dass<br />
Gehirne in den ersten Lebensjahren zwar ent‐<br />
scheidend geprägt werden, aber bis ins hohe<br />
Alter – wenn auch in Grenzen – formbar blei‐<br />
ben. „Zum Zeitpunkt der Geburt sind nahezu<br />
alle Nervenzellen angelegt, aber noch nicht<br />
überall im Gehirn miteinander verbunden”,<br />
schreibt Speck.<br />
Ein großer Teil der angelegten Nervenzel‐<br />
len gehe jedoch „unwiederbringlich verloren,<br />
wenn diese nicht in Anspruch genommen<br />
werden”. Nur etwa ein Drittel der angelegten<br />
Nervenverbindungen bleibe erhalten. Damit<br />
werde die „große Bedeutung der frühen Ent‐<br />
wicklungsanreize deutlich”.<br />
Diese Sichtweise hat sich allgemein durch‐<br />
gesetzt. „Ein Kind ist kein Aktenordner, in den<br />
man Blatt für Blatt Wissensinhalte ein‐heften<br />
kann, sondern ein Lebewesen, dessen Erleben<br />
und Verhalten neurobiologischen Grundregeln<br />
unterworfen ist”, sagt etwa der Freiburger<br />
Psychiater und Neurowissenschaftler, Profes‐<br />
sor Joachim Bauer.<br />
Zu den „fatalen Irrtümern unserer Zeit”<br />
gehöre die Ansicht, „das Verhalten von Men‐<br />
schen sei im Wesentlichen bereits durch seine<br />
Gene determiniert, weshalb äußere Faktoren<br />
nur wenig ausrichten können”. Doch Men‐<br />
schen seien nun mal „keine durch Gene pro‐<br />
grammierten Selbstläufer, die mit Hilfe eines<br />
Autopiloten durchs Leben fahren”. Umwelt‐<br />
einflüsse, also auch Bezugspersonen, wirken<br />
erheblich daran mit, welche Gene aktiviert<br />
werden. Das Gehirn verwandele „seelische<br />
Eindrücke in biologische Signale, es macht –<br />
salopp ausgedrückt – aus Psychologie also Bio‐<br />
logie.”<br />
Gute Pädagogik tut also sehr wohl not,<br />
doch sie sollte stets die Möglichkeiten des je‐<br />
weiligen Kindes statt seine Schwächen im Au‐<br />
ge haben.<br />
„Jedes Kind ist einzigartig und verfügt über<br />
einzigartige Potenziale zur Ausbildung eines<br />
komplexen, vielfach vernetzten und zeitlebens<br />
lernfähigen Gehirns”, urteilt der Neurobiologe<br />
Professor Gerald Hüther. Was dem Göttinger<br />
Hirnforscher aber eines der größten Anliegen<br />
ist: „Wichtiger als alles Wissen über das Ge‐<br />
hirn eines Dreijährigen ist es, dass man das<br />
Kind mag, und zwar so, wie es ist.” Sonst kön‐<br />
ne man es nämlich nicht „einladen, ermutigen
und inspirieren, sich als kleiner Weltentdecker<br />
auf den Weg zu machen”. Und genau das gelte<br />
„auch für jeden Lehrer, der Pubertierende un‐<br />
terrichtet”.<br />
Mindestens ebenso selbstbewusst wie Otto<br />
Speck zeigt sich der Erziehungswissenschaftler<br />
Volker Ladenthin. „Die Hirnforschung kommt<br />
nicht auf neue pädagogische Ideen, so wenig,<br />
wie ein Internist, der die Magensäfte und Ver‐<br />
dauungsenzyme kennt, neue Speisen erfinden<br />
kann”, sagt der Bonner Universitäts‐Professor.<br />
Was Hirnforscher herausgefunden haben, sei<br />
tüchtigen Erziehern schon lange bekannt.<br />
Ein solcher Fall ist die Erkenntnis, dass rea‐<br />
le, buchstäblich mit Hand und Fuß und allen<br />
Sinnen gemachte Erfahrungen wertvoller sind<br />
als mediale, etwa vorm Fernseher oder Com‐<br />
puter‐Bildschirm gesammelte.<br />
„Bei Kindern, die vornehmlich virtuell, also<br />
über Bilder und sonstige Medien die Wirklich‐<br />
keit kennenlernen, die sich nicht selber, das<br />
heißt auch physisch, mit anderen auseinander‐<br />
setzen, die sich nicht selber in das Ungewisse<br />
ihrer Umwelt hineinwagen, und nicht unmit‐<br />
telbar die Folgen ihres Tuns mit allen echten<br />
Konsequenzen erleben”, werde das Erfahrene<br />
nicht klar oder nur unzureichend im Hirn<br />
strukturiert und verankert, befindet Otto<br />
Speck. Er leitet daraus die Hoffnung ab, „dass<br />
die relativ harten wissenschaftlichen Fakten<br />
dazu beitragen könnten, dass mehr Bewegung<br />
in die pädagogische Szene kommt”, und zwar<br />
trotz der „Schwerbeweglichkeit” der öffentli‐<br />
chen und staatlichen Erziehungs‐ und Bil‐<br />
dungsszene in Deutschland.<br />
BUCHTIPPS<br />
Otto Speck: Hirnforschung und Erziehung. Eine pädagogische<br />
Auseinandersetzung mit neurobiologischen Erkenntnissen.<br />
<strong>2009</strong>, 198 Seiten, Ernst‐Reinhardt‐Verlag, 19,90 Euro.<br />
Joachim Bauer: Lob der Schule. Sieben Perspektiven für Schü‐<br />
ler, Lehrer und Eltern. 2007, 142 Seiten, Hoffmann & Campe,<br />
12,95 Euro.<br />
Karl Gebauer, Gerald Hüther (Hg.): Kinder brauchen Wurzeln.<br />
Neue Perspektiven für eine gelingende Entwicklung. 2001, 214<br />
Seiten, Walter Verlag, 14,90 Euro.<br />
Gerald Hüther: Bedienungsanleitung für ein menschliches Ge‐<br />
hirn. 2006, 139 Seiten, Vandenhoeck & Ruprecht, 15,90 Euro.<br />
Aus: Frankfurter Rundschau<br />
vom 13. Januar 2010, S.22‐23.<br />
8.<br />
Hans‐Peter Jäck<br />
Film‐Arbeitskreis<br />
«Sexuelle Différance im Kino»<br />
Auf den Spuren von Spiel‐ und Spiegelformen<br />
von Männlichkeit und Weiblichkeit<br />
Das Kino nimmt die Rolle als Modemacher und<br />
Abbildner der inzwischen ins Fließen geratenen<br />
55<br />
MB der AFP <strong>Nr</strong>. <strong>85</strong>/<strong>März</strong> 2010<br />
Geschlechtsdifferenz ein. Schlagwörter wie „Neosexualitäten“,<br />
„Metrosexualität“, „Transsexualismus“<br />
machen in Zeitschriften und Wissenschaftspublikationen<br />
die Runde: Was ist demnach dran, an<br />
der in der Psychoanalyse vielzitierten „Neuen Ökonomie<br />
des Psychischen“, die sich offenbar gründlich<br />
von den tradierten Formen der Geschlechterdifferenz<br />
bzw. -polarität unterscheiden soll?<br />
In Serge Gainsbourghs Film „Je t’aime, moi non<br />
plus“ von 1976 behauptet die weibliche Hauptfigur<br />
Johnny (Jane Birkin) gegenüber dem Mann, den sie<br />
für sich zu gewinnen sucht und von dem sie weiß,<br />
dass er homosexuell ist, „Ich bin ein Junge!“, nur<br />
um wenige Szenen später freudig im rosafarbenen<br />
Kleid ihm über die Wiese entgegenzulaufen und<br />
seiner Abwehr mit dem stolzen Ausruf zu begegnen:<br />
„Aber ich bin doch ein Mädchen!“ ‒ Der neue<br />
Roman der 17-jährigen Helene Hegemann, „Axolotl<br />
Roadkill“ (2010) berichtet vom Stand der Dinge in<br />
Sachen Sex der modernen Teenies; „stockbisexuell“<br />
zu sein, wird für diese neue Generation als normal<br />
behauptet. Zugleich aber spielt im Roman der titelgebende<br />
nachtaktive mexikanische Lurch, das<br />
BABY-AXOLOTL, eine zentrale Rolle, die man als<br />
Spiel- und Spiegelform einer „neuer“ Art von Geschlechtsformation<br />
ansehen könnte. Helene Hegemann<br />
ironisiert dies folgendermaßen: „Sieht aus<br />
wie eine Comicfigur, hat keine großen Ansprüche<br />
an irgendetwas und bleibt sein gesamte Leben lang<br />
im Lurchstadium, das heißt, es wird einfach nicht<br />
erwachsen.“ Die neu gewonnene ‒ nicht nur sexuelle<br />
‒ Freiheit verbreitet keinerlei Glücksgefühl,<br />
sondern wird eher trocken und melancholisch zur<br />
Kenntnis genommen: „Ich habe zwar keine Freudensprünge<br />
gemacht, als ich das herausgefunden<br />
habe…“, ‒ wie der Verlust eines Begehrens, das<br />
bisher die herkömmliche(n) Beziehung(en) der Geschlechter<br />
beherrscht und womöglich dadurch in<br />
Dynamik gehalten habe.<br />
Woran lassen sich die „Grenzen“ von Männlichkeit<br />
oder Weiblichkeit erkennen? Sind sie inzwischen<br />
nach beiden Seiten überschreitbar und<br />
überschritten oder verharren wir ‒ wie Franz Kafkas<br />
„Mann vom Lande“ in „Vor dem Gesetz“ ‒ immer<br />
noch auf der Schwelle? ‒ Der Filmarbeitskreis<br />
zu „Film und Psychoanalyse“ will in diesem Semester<br />
dieser Frage anhand von Filmen aus fernen<br />
und nahen Zeiten nachgehen und zeigen, wie das<br />
Bild der Geschlechter sich seit der Erfindung des<br />
Kinos verändert hat; zu fragen wird auch sein nach<br />
„Moden“ und „Logik“ der Darstellungen der Ge-
schlechtsdifferenz. Und somit auch: Was ist und<br />
wohin treibt [uns] die sexuelle différance? Dabei<br />
werden männliche und weibliche Stereotypen ebenso<br />
thematisiert wie differierende Männlichkeits-<br />
und Weiblichkeitsrollen.<br />
Der Arbeitskreis Film am Abendgymnasium Frankfurt<br />
am Main (AGF) trifft sich im Sommersemester wieder<br />
am Donnerstag, 14-täglich, B-Woche, im Bildungszentrum<br />
Ostend (BZO), Raum 1041, 19-15-22.15 Uhr. −<br />
Anmeldung bei H.-P. Jäck, hpjck@t-online.de<br />
Der Arbeitskreis ist auch für Teilnehmerinnen und<br />
Teilnehmer außerhalb des Abendgymnasiums offen.<br />
9.<br />
Hans‐Peter Jäck<br />
Rasche Bemerkungen (4)<br />
Antigone und Kreon<br />
vor einem modernen deutschen Gericht!<br />
Gedanken zu einem unzeitgemäßen Prozess<br />
Vorbemerkung: Dem Einwand von Kreons Verteidigung,<br />
die Taten bzw. die Untaten, die seinem<br />
Mandanten zur Last gelegt werden, seien in Zeiten<br />
des mythischen Griechenland begangen worden<br />
und deshalb nach dem deutschen Strafrecht, das<br />
erst am 15. Mai 1871 erlassen worden ist, nicht zu<br />
bestrafen (allgemeines Rechtsprinzip: Nulla poena<br />
sine lege siehe auch: Grundgesetz der BRD Artikel<br />
103, Ansatz 2), begegnet das Gericht mit den<br />
legendäre gewordenen Begründung, die Ernst von<br />
Pidde 1968 all jenen entgegenhält, die die Untaten<br />
in Richard Wagners Bühnendrama „Der Ring der<br />
Nibelungen“ schon allein aus dem Grunde nicht<br />
für strafwürdig halten, weil das Bühnendrama <br />
ähnlich wie Sophokles’ Antigone in Urzeiten<br />
spiele: „Diese Auffassung ist jedoch zu eng. Zwar<br />
ist nicht zu leugnen, dass sich die (...) zugrunde<br />
liegenden Urdelikte lange vor Erlass des StGB zugetragen<br />
haben. Auf der anderen Seite ist ebenso<br />
wenig zu bestreiten, dass die Straftaten mit jeder<br />
Aufführung (...) erneut begangen werden, so dass<br />
für alle Inszenierungen auf deutschem Boden die<br />
Anwendbarkeit des StGB gemäß §4 ohne Bedenken<br />
unterstellt werden kann.“ (Pidde, S.11) Der<br />
entsprechende Paragraph des StGB lautet: „Das<br />
deutsche Strafrecht gilt, unabhängig vom Recht<br />
des Tatorts, für Taten, die auf einem Schiff oder<br />
Luftfahrzeug begangen werden, das berechtigt ist,<br />
die Bundesflagge oder das Staatszugehörigkeitszeichen<br />
der Bundesrepublik Deutschland zu führen.“<br />
(StGB §4) Desgleichen: „Das deutsche Strafrecht<br />
gilt für Taten, die im Inland begangen werden.“<br />
(StGB § 3)<br />
Das Urteil<br />
Nach allem bisher Gesagten 34 lässt sich<br />
die Schuld beider Figuren – Antigone und<br />
Kreon – näher verdeutlichen: Beide Figuren<br />
34 Vgl. H.P. Jäck, Rasche Bemerkungen (3) in MB 84, Januar<br />
2010.<br />
56<br />
MB der AFP <strong>Nr</strong>. <strong>85</strong>/<strong>März</strong> 2010<br />
tragen eine SCHULD, diese „Schuld“ aber<br />
steht allerdings in den Anklagen vor dem Ge‐<br />
richt nicht zur Debatte: Es geht nicht, wie bei<br />
dieser allgemeinen SCHULD, um die Verabso‐<br />
lutierung des Gesetzes, sondern im Gegenteil<br />
um die Anklage wegen Nichteinhaltung des<br />
Gesetzes!<br />
Und genau dies lässt das Gericht zur<br />
Auffassung kommen, dass beide nicht schul‐<br />
dig sind im Sinne der Anklagen.<br />
Begründung betr. Kreon<br />
A) Eine Verletzung der Fürsorgepflicht<br />
gegenüber abhängigen Minderjährigen nach §<br />
171 StGB liegt nicht vor: Es handelt sich, nach<br />
Aussage des Haimon, nicht um Minderjährige.<br />
Dass die Rechtsfähigkeit eines Jugendlichen<br />
im klassischen Athen noch früher beginnt als<br />
heute, ist erwiesen; dennoch ist anzumerken,<br />
dass diese Jugendlichen, also Haimon und<br />
Antigone, damals wesentlich jünger gewesen<br />
sein müssen als jene 16‐18 Jahre, bei denen<br />
heute die Rechtsfähigkeit beginnt. M.a.W:<br />
wahrscheinlich wären sie im Sinne unseres<br />
heutigen Rechts noch durchaus minderjährig,<br />
aber dennoch schon rechtsfähig gewesen. <br />
B) Eine Beleidigung religiöses Gefühle<br />
nach § 167 StGB liegt nicht vor: Die Einlassun‐<br />
gen des Angeklagten vor Gericht lassen weder<br />
den Verdacht erhärten, es handle sich um Vor‐<br />
sätzlichkeit noch um Fahrlässigkeit bei Belei‐<br />
digung religiöser Gefühle: Es ist vielmehr<br />
deutlich geworden, dass es sich bei dem An‐<br />
geklagten (inzwischen) um einen atheistischen,<br />
areligiösen Menschen handelt, dem keinesfalls<br />
eine antireligiöse Absicht unterstellt werden<br />
kann; vgl. „vielleicht auch kommt sie zur Er‐<br />
kenntnis noch zuletzt, dass man vergebens<br />
[Hervorhebung HPJ] Unterirdische verehrt.“<br />
779f.) Inwieweit hier eine neuerliche Wendung<br />
bezüglich der Haltung am Schluss der Tragö‐<br />
die vorliegt, ist nicht mehr Gegenstand des Ge‐<br />
richts. Vgl.: „Ich weiß es selbst, und es erschüt‐<br />
tert meinen Sinn, hart ist es nachzugeben; doch<br />
im Widerstand dem Unheil zu erliegen hart<br />
und mehr als hart.“ (1095); „Wehe, wie schwer!<br />
Doch ich entsage meinem Sinn und tu’ es [ <br />
nämlich Antigone mit eigener Hand zu befrei‐<br />
en; HPJ]: gegen das Notwendige hilft kein<br />
Kampf.“ (1105) Und der Chor kommentiert<br />
Kreons Lage: „Denn aus dem Geschick, das<br />
nun bestimmt ist, gibt’s Erlösung nicht für<br />
Sterbliche.“ (1337f.)<br />
C) Die Anklage auf Mord oder fahrlässi‐<br />
ge Tötung im Amt nach §§ 211‐123 StGB wird
abgewiesen: dem Gericht ist nicht bewiesen,<br />
dass der Tod der Antigone, des Haimon (und<br />
auch der Eurydike deren Tod hier nicht Ge‐<br />
genstand der Anklage war) unmittelbar dem<br />
Angeklagten zur Last gelegt werden kann: die<br />
genannten Personen verloren ihr Leben durch<br />
Suizid, der im modernen Recht selbst keine<br />
strafwürdige Tat darstellt 35 ; eine moralische<br />
Schuld könnte dem Angeklagten höchstens<br />
dann zugesprochen werden, wenn er die ge‐<br />
nannten Personen außer vielleicht Antigone<br />
durch seine Handlungen zum Selbstmord<br />
getrieben hat; doch eine Schuld im Sinne eines<br />
Verstoßes gegen das StGB liegt nicht vor.<br />
D) Die Anklage wegen Verstoßes gegen<br />
das Bestattungsgesetz gemäß §§ 167‐168 StGB<br />
ist im vollen Sinne zu bejahen: die Totenruhe,<br />
d.h. die ordentliche Bestattung einer Leiche ist<br />
zu gewährleisten. Dabei handelt es sich heute<br />
nicht mehr um eine göttliches, sondern um ein<br />
menschliches Gebot, das unter allen Umstän‐<br />
den einzuhalten ist (Hygiene. Ansteckung, To‐<br />
tenruhe usf.). Dennoch ist das Gericht zu dem<br />
Ergebnis gekommen, dass die persönlichen<br />
Verluste, die der Angeklagte erlitten hat Tod<br />
der Gattin, Tod des Sohnes so groß sind, dass<br />
von einer Bestrafung abgesehen werden kann:<br />
der Angeklagte ist nach seinen eigenen Aussa‐<br />
gen (siehe oben) genug bestraft.<br />
Festzustellen ist insgesamt, dass gegen‐<br />
über den Aussagen in der Tragödie die münd‐<br />
lichen Vernehmungen des Angeklagten eine<br />
gewisse Verschiebung, um nicht zu sagen:<br />
Verhärtung zu erkennen gegeben haben; es ist<br />
zu hoffen, dass hier eine Belehrung durch das<br />
Gericht dem Angeklagten für die Zukunft hilf‐<br />
reich sein kann: Die einsichtslose Verabsolutie‐<br />
rung staatlichen Rechts ruft unweigerlich das<br />
„andere Recht“ auf den Plan; das hat der blin‐<br />
de Teiresias treffend und ironisch formuliert:<br />
35 Wie Cellist Miller in Friedrich Schillers „Kabale und Liebe“<br />
treffend formuliert, ist der Selbstmord nicht strafwürdig, weil<br />
ja „Tod und Missetat zusammenfallen“. Dennoch soll nicht<br />
verschwiegen werden, dass eben dieser Selbstmord früher<br />
strafbar war; so nach dem nach § 90 des österreichischen Gesetzes<br />
über schwere Polizeiübertretungen: „Bei vollbrachtem<br />
Selbstmorde soll der Körper blos von einer Wache begleitet,<br />
außer dem Leichenhof durch gerichtliche Diener verscharrt<br />
werden.“ (Pidde, S.66) Auch das kanonische Recht verweigert<br />
dem Selbstmörder die Ruhe in geweihter Erde (s. c. 9-12 c.23<br />
qu.5, cap. 11.12. X de sepult.). Und selbst das preußische Landrecht<br />
forderte noch: „Ist bereits ein Strafurtheil ergangen, so<br />
soll dasselbe, soweit möglich, anständig und zur Abschreckung<br />
dienlich am todten Körper vollzogen werden.“ (§ 803) (Pidde.<br />
ebda) Das Gericht kann sich allerdings Gedankengänge in<br />
dieser Richtung ersparen, sowohl weil der Bezug zum Christentum<br />
im vorliegenden Drama abwegig ist als auch diese Regelungen<br />
nicht ins Strafgesetzbuch Eingang gefunden haben.<br />
57<br />
MB der AFP <strong>Nr</strong>. <strong>85</strong>/<strong>März</strong> 2010<br />
„Nur Eigensinn verfällt der Schuld des Unver‐<br />
stands. Gib nach dem Warner: stich nach dem<br />
Erschlagnen nicht! Den Toten nochmals töten <br />
welcher Heldenmut!“ (1028‐1030) Es sei Kreon<br />
eine Warnung, dass die Tat, die er dem Ande‐<br />
ren zugedacht hat (d.h. den nochmaligen Tod),<br />
gerade ihn zuletzt selbst trifft (vgl. „Dem To‐<br />
ten gabst du nochmals den Tod.“ 1288).<br />
Ein weiteres Problem, das hier zur Spra‐<br />
che kam, aber nicht juristisch zu bewerten war,<br />
besteht darin, dass ein gewisser Verdacht auf‐<br />
kommen konnte, dass die Annahme des Kö‐<br />
nigsamtes sowie dessen Ausübung wohl nicht<br />
so selbstlos zum „Wohle des Staates“ diente,<br />
wie das bei der Vernehmung bekundet wor‐<br />
den ist: einerseits stellt sich durchaus die Fra‐<br />
ge, warum Kreon das Amt des vertriebenen<br />
Bruders Ödipus übernommen hat, obgleich es<br />
leibliche Erben des vormaligen Königs gibt<br />
(Ismene und Antigone; vgl.: „Sehet, ihr Edlen<br />
aus Thebens Volk, die letzte, die blieb vom<br />
Königsgeschlecht!“ (940f.)); die Begründung,<br />
dass das Königtum nicht in weiblicher Linie<br />
vererbbar sei, lässt sich zwar für die Vergan‐<br />
genheit begründen, nicht aber für die Zukunft:<br />
das Volk und der Senat Thebens hätten durch‐<br />
aus die Möglichkeit gehabt, eine weibliche<br />
Thronfolgeregelung zu schaffen, wenn Kreon<br />
das Amt abgelehnt hätte. Vielleicht war aber<br />
auch Kreon nicht von einer gewissen Macht‐<br />
gier frei, die seiner Enttäuschung entstammt,<br />
dass er nach dem Tod des Königs Laios nicht<br />
sogleich selbst zum König ausgerufen wurde<br />
und Ödipus, der „Fremde“ also, vorgezogen<br />
wurde. Jedenfalls scheint die Unbarmherzig‐<br />
keit seines Handelns gegenüber den Kindern<br />
des Ödipus zu zeigen, dass auch ein Ressenti‐<br />
ment gegenüber dem Rivalen (Ödipus) um<br />
den Thron weiter bestand und an dessen Kin‐<br />
dern abreagiert worden zu sein scheint; wie<br />
sonst wäre sein Generalverdacht gegenüber<br />
Ismene zu erklären: „Du, die im Haus wie eine<br />
Schlange mich beschlich und heimlich aussog!<br />
Und ich habe nicht gemerkt, dass ich zwei<br />
Schäden nährte zum Verderb des Throns! Nun<br />
sprich! Bekenne, dass auch du bei diesem Grab<br />
geholfen! Oder schwörst du, dass du nichts<br />
gewusst?“ (531‐535) Vgl. auch: „Die beiden<br />
Mädchen sind wahnsinnig; eine ward es eben<br />
jetzt, die andre war’s von Anfang an.“ (561f.)<br />
Auch ließ Kreon Antigone ein Ressentiment<br />
gegenüber der Verwandten spüren, das darauf<br />
verweist, dass das Ressentiment gegenüber<br />
Ödipus und dessen Kinder bei Weitem noch
nicht durchgearbeitet worden ist: „Mit kurzem<br />
Zügel, weiß ich, wird der Übermut der Rosse<br />
rasch gebändigt; denn es ziemt sich nicht, sich<br />
groß zu dünken, wenn man Knecht im Hause<br />
ist.“ (477‐479) An dieser Aussage wird klar,<br />
dass Kreon hier zu Antigone wie zu seinem<br />
Spiegel spricht: Er spricht hier aus, was Sig‐<br />
mund Freud über zweieinhalb Jahrtausende<br />
später bestätigt hat: „Das Ich ist nicht Herr im<br />
eigenen Hause.“ Nur, dass Kreon in Selbstver‐<br />
blendung nicht sich selbst gemeint sieht.<br />
Kreon Haltung gegenüber Antigone<br />
führt uns hier noch zu einem weiteren Mo‐<br />
ment, das ebenfalls als Schuld einer Verabsolu‐<br />
tierung zu sehen ist, nämlich seinem Verhält‐<br />
nis zum anderen Geschlecht. Er sieht in Anti‐<br />
gone nicht bloß die wahre Thronerbin seines<br />
Schwagers Ödipus, sondern zudem noch eine<br />
Frau, die durch ihr unbedingtes, und das heißt<br />
für damals: ‚männliches‘ Auftreten seinen pat‐<br />
riarchalischen Herrschaftsanspruch bedroht:<br />
„Die [sc. Antigone] hier verstand nur allzu gut<br />
aufs Freveln sich, als sie bestehende Gesetze<br />
übertrat. Das aber ist ihr zweiter Frevel, dass<br />
sie sich nun lachend noch mit ihrer Tat zu<br />
brüsten wagt. Da wäre wahrlich ich kein<br />
Mann, sie wäre Mann, wenn straflos solcher<br />
Übermut frohlocken darf.“ (480‐4<strong>85</strong>) Und zu‐<br />
letzt zeigt die trotzige Aussage: „Mich lenkt<br />
mein Leben lang kein Weib!“ (525), wie sehr<br />
Kreon sich von Antigones „unweiblicher“ Hal‐<br />
tung in seiner Männlichkeit bedroht fühlt. Was<br />
ihn bedroht, ist anscheinend die Auflösung der<br />
patriarchalisch bestimmten Geschlechterdiffe‐<br />
renz, die ihn zu einem antifeministischen Af‐<br />
fekt treibt; und dieser Affekt zeigt umso deut‐<br />
licher, dass die charakterlichen Geschlechtszu‐<br />
schreibungen insoweit verabsolutiert werden,<br />
damit die männliche Dominanz in der patriar‐<br />
chalisch beherrschten Gesellschaft unangefoch‐<br />
ten bleibt. Der „weibliche Protest“ (Joan<br />
Riviere) bedroht die bis dato klare Hierarchie<br />
der Geschlechter; Antigone ist in Gestalt und<br />
Haltung der Ausdruck für eine mögliche Auf‐<br />
lösung der strikten Geschlechterdifferenz; die<br />
Perspektive, dass einerseits eine Frau die<br />
männliche Herrschaftsfunktion übernehmen<br />
will (und kann) und andererseits die starren<br />
Geschlechtergrenzen aufgeweicht werden<br />
könnten, lässt sich als Parallele lesen zur<br />
sophokleischen These der Diffusion zwischen<br />
göttlichem und menschlichem Recht: mit der<br />
Grenzziehung zwischen Göttern und Men‐<br />
schen kommt auch die Grenzziehung zwi‐<br />
58<br />
MB der AFP <strong>Nr</strong>. <strong>85</strong>/<strong>März</strong> 2010<br />
schen den Geschlechtern ins Gleiten. Der<br />
„Fall“ Kreon steht demnach für ein Beispiel,<br />
bei dem bisher scheinbar feste dualistische<br />
Dispositive fragwürdig geworden sind und<br />
nur in einem verblendeten Aufbäumen noch<br />
fixiert werden können die Frau als Symptom<br />
des Mannes.<br />
Begründung betr. Antigone<br />
A) Die Anklage wegen Widerstands ge‐<br />
gen die Staatsgewalt gemäß §§ 113‐114 StGB<br />
sind abzuweisen. Der Angeklagten kann im<br />
weitesten Sinne zudem ein Notstand gem. § 34<br />
StGB bzw. eine Notwehr gem. § 32 StGB zuge‐<br />
billigt werden.<br />
Dies gilt auch, wenn das Gericht den<br />
Verdacht nicht ausgeräumt sieht, dass die An‐<br />
geklagte in ihrer Berufung auf das göttliche<br />
Recht tieferliegende Motive zu verdecken<br />
sucht; vgl. „den Bruder werd’ ich selbst begra‐<br />
ben. Schön ist mir nach solcher Tat der Tod.<br />
Von ihm geliebt, lieg’ ich bei ihm, dem Lieben,<br />
dann, die fromm gefrevelt hat.“ (71‐74) Das<br />
Gericht konnte nicht die Frage klären, weshalb<br />
die Angeklagte ihren Bruder Polyneikes zum<br />
Geliebten erhebt, ihm also den Platz ihres Ver‐<br />
lobten Haimon einräumt, während anderer‐<br />
seits der zweite Bruder, Eteokles offenbar nicht<br />
ebenso „geliebt“ wird wie Polyneikes; die<br />
„Liebe“ zu dem einen Bruder lässt immerhin<br />
die Frage nach einem gewünschten Inzest (vgl.<br />
„lieg ich bei ihm...“) aufkommen, was auch<br />
durch die in der Anhörung wiederholte Behar‐<br />
rung auf einer „geschwisterlichen“ Liebe nicht<br />
völlig zu klären war. Zu vermuten ist, dass<br />
sich Antigone mit dem unter das Bestattungs‐<br />
verbot gefallenen Bruder Polyneikes identifi‐<br />
ziert und dadurch den alten Bruderzwist über<br />
die Gräber der Brüder hinaus fortsetzt; ihre<br />
„Liebe“ zum Unbestatteten ist gleich dem Hass<br />
gegenüber dem bestatteten Bruder: So setzt se<br />
die alte Familiengeschichte der Labdakiden in<br />
anderer Weise fort und wird selbst schuldig.<br />
Die Identifizierung mit dem toten Bruder<br />
schließt dabei den Willen zum eigenen Tod mit<br />
ein.<br />
Auch der Verdacht des vorentschiede‐<br />
nen Selbstmords ließ sich nicht klären, ob‐<br />
gleich es deutliche Hinweise gibt, die dies un‐<br />
termauern: vgl. Antigone zu Ismene: „Ah,<br />
schrei es aus!. Du wirst mir viel verhasster sein<br />
mit diesem Schweigen: tu es allen kund.“ (86f.)<br />
Es scheint sich hier eine Entschlossenheit we‐<br />
niger zum Gesetzesverstoß als zum eignen Tod
zu zeigen. Auch die Wiederholung der Tat<br />
(erneutes Beerdigen der Leiche) weist in diese<br />
Richtung, was auch durch die Zeugenaussage<br />
des Wächters bestärkt wird: „Und wir gewah‐<br />
ren’s, eilen hin und greifen sie sofort, und sie<br />
erschrak nicht, und wir klagten sie der frühern<br />
Tat sowohl wie dieser neuen an. Doch sie<br />
stand da und leugnete mitnichten ab.“ (432ff.)<br />
Als Geständnis lässt sich die Aussage werten:<br />
„Ja, ich bekenne, dass ich’s tat, und leugne<br />
nicht.“ (443) In beiden Aussagen spiegelt sich<br />
ein Todeswunsch, der zugleich allerdings tief<br />
in die Familiengeschichte der Labdakiden zu‐<br />
rückreicht: Laios entschied sich, aufgrund des<br />
Orakels den eigenen Sohn Ödipus zu töten,<br />
und diese Tat gebiert nun immer neue Unge‐<br />
heuerlichkeiten wie der Chor in „Antigone“<br />
offenbart: „Vieles ist ungeheuer, nichts unge‐<br />
heurer als der Mensch“ (332f.): der Mord des<br />
Ödipus an seinem Vater Laios, der Inzest des<br />
Ödipus mit seiner Mutter Jokaste, der an der<br />
Wiege der Kinder Eteokles, Polyneikes, Ismene<br />
und Antigone steht, schließlich auch die Hyb‐<br />
ris des Ödipus, seine Blendung und der<br />
Selbstmord seiner Frau und Mutter Jokaste.<br />
B) Die Anklage wegen des Verdachts der<br />
gemeinschaftlichen Gründung einer terroristi‐<br />
schen Vereinigung gem. §§ 129‐129a StGB wird<br />
im vollen Umfang abgewiesen: die als Mitver‐<br />
schwörerin verdächtigte Ismene hat klar dar‐<br />
gestellt, dass sie das Ansinnen einer gemein‐<br />
schaftlich zu begehenden Tat weit von sich<br />
gewiesen hat; dass Ismene nach der Tat sich<br />
mit der Schwester solidarisch erklärt, ist<br />
durchaus aus falsch verstandener Schwestern‐<br />
liebe zu erklären: „Wenn sie es tat, so tat ich’s<br />
mit: Ich geb’ es zu und habe teil daran und<br />
trage mit die Schuld.“ (536ff.) Demgegenüber:<br />
„Ich werde beten zu den Unterirdischen, dass<br />
sie verzeih’n: ich beuge mich ja nur dem<br />
Zwang. Denen, die an der Macht sind, füg’ ich<br />
mich: es hat ja keinen Sinn, zu handeln übers<br />
Maß hinaus.“ (65‐69)<br />
C) Die Anklage wegen Beleidigung reli‐<br />
giöser Gefühle nach § 167 StGB wir abgewie‐<br />
sen. Es kann zwar nicht ausgeschlossen wer‐<br />
den, dass die Berufung auf ein göttliches Recht<br />
als bloße Schutzbehauptung (vgl. Punkt A) zu<br />
bewerten ist und dass bei der Tat noch andere<br />
Motive mit hinein spielen; auch der Nachweis<br />
der Staatsanwältin, dass die Angeklagte dem<br />
König Kreon fälschlicherweise unterstellt, er<br />
folge dem göttlichen Recht nicht, weist in diese<br />
59<br />
MB der AFP <strong>Nr</strong>. <strong>85</strong>/<strong>März</strong> 2010<br />
Richtung; dennoch ließ sich letzten Endes die‐<br />
ser Verdacht nicht erhärten.<br />
D) Die Anklage wegen Volksverhetzung<br />
gem. § 130 StGB in Tateinheit mit Landesverrat<br />
gem. § 82 StGB wird abgewiesen: Die Verneh‐<br />
mung der Zeugen (Chor) hat erbracht, dass<br />
das Volk von Theben zwar anfangs gänzlich<br />
zum rechtmäßigen Herrscher stand wenn es<br />
auch eine recht distanzierte Haltung zu dessen<br />
autokratischen Regierungsführung einnahm <br />
vgl. „Dir, des Menoikeus Sohn, beliebt es, so<br />
zu tun, wenn’s einer übel oder wohl meint mit<br />
der Stadt, und jede Satzung anzuwenden steht<br />
bei dir: auf die Verstorbnen wie auf uns, die<br />
Lebenden.“ (211ff.); vgl. auch der Wächter:<br />
„Wie schlimm, wer urteilt und ein falsches Ur‐<br />
teil fällt“ (324) und schließlich Antigone selbst:<br />
„Die alle hier, sie fänden es wohl lobenswert,<br />
wenn ihnen nicht die Furcht die Zunge fessel‐<br />
te. Doch ist die Tyrannei mit vielem ja be‐<br />
glückt: ihr steht auch zu, zu tun, zu reden, was<br />
sie mag!“ (504ff.); doch der Gesinnungswandel<br />
des Volkes/Chores und seine Abkehr von<br />
Herrscher wurde nicht von Antigone herbeige‐<br />
führt, sondern entstammen der Einsicht: „Uralt<br />
im Geschlechte der Labdakos‐Enkel seh’ ich<br />
Leiden immer auf andere Leiden sich stürzen:<br />
nie befreit ein Spross diesen Stamm; doch dar‐<br />
nieder reißt ihn ein Gott, der kein Erlösen<br />
kennt.“ (594ff.) Letztlich ist der Gesinnungs‐<br />
wandel des Volkes ganz allein dem Wahrsager<br />
Teiresias zuzuschreiben: „Seit ich dies weiße<br />
Haar anstatt des dunklen trage auf dem grei‐<br />
sen Haupt, hat er [sc. Teiresias] mit keiner Lü‐<br />
ge je die Stadt getäuscht.“ (1092ff.)<br />
Abschließend sei nochmals hervorgeho‐<br />
ben, dass die Freisprüche zwar nach juristi‐<br />
scher, nicht aber in moralischer Hinsicht, als<br />
Wertung zu rechtfertigen sind. Den Freige‐<br />
sprochenen hofft das Gericht die Notwendig‐<br />
keit einer Katharsis vor Augen geführt zu ha‐<br />
ben, die wohl auch die Zuschauer von »Anti‐<br />
gone« in klassischer Zeit erfasst haben könnte:<br />
Jede Verabsolutierung des Gesetzes bricht mit<br />
der Verpflichtung gegenüber einer Gerechtig‐<br />
keit, die der ursprünglich gewalttätigen<br />
Rechtssetzung eine gewisse Legitimität ver‐<br />
schaffen kann und fordert gerade dadurch den<br />
dialektischen Umschlag in ihr Gegenteil her‐<br />
aus; dabei ruft sie jenes Dritte auf den Plan,<br />
das die versteinerte Statik einer so gearteten<br />
Hypostasierung des Gesetzes wieder in Bewe‐<br />
gung bringt und das gerade zum Nachteil<br />
eines ungezügelten Umgangs mit dem Gesetz.
Entscheidung ohne Recht ist Willkür, Recht‐<br />
sprechung ohne Gerechtigkeit ist Selbstzerstö‐<br />
rung.<br />
H.‐P. Jäck, Frankfurt am Main; aus einem<br />
Antikenprojekt am Abendgymnasium<br />
Frankfurt am Main, 2003<br />
10.<br />
Lachen mit Freud<br />
Aus: tip, Magazin, Berlin 19/08, S.124<br />
60<br />
MB der AFP <strong>Nr</strong>. <strong>85</strong>/<strong>März</strong> 2010