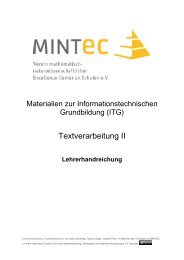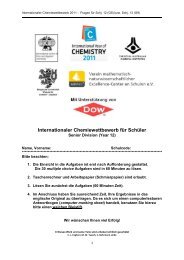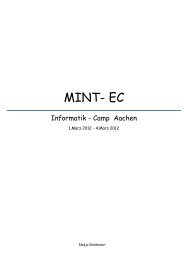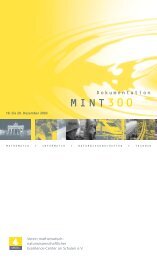2009 - Mint-EC
2009 - Mint-EC
2009 - Mint-EC
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
DEUTSCHE<br />
GESELLSCHAFT FÜR<br />
ZERSTÖRUNGSFREIE<br />
PRÜFUNG E.V.<br />
mInt30009<br />
R<br />
e Skills Week<br />
16. bIs 19. dEzEmbER <strong>2009</strong><br />
mInt30009<br />
DEUTSCHE<br />
GESELLSCHAFT FÜR<br />
ZERSTÖRUNGSFREIE<br />
PRÜFUNG E.V.<br />
e Skills Week<br />
dokumEntatIon
Inhalt<br />
EInlEItung Seite 04<br />
REsÜmEE dER FöRdERER Seite 06<br />
auFtaktvERanstaltung Seite 08<br />
kuRsE FÜR lEhRkRäFtE Seite 10<br />
L01 Informatik-Cluster für MINT-<strong>EC</strong>-Schulen „erlebe it“<br />
L02 Cluster Zerstörungsfreie Materialprüfung (ZfP) für MINT-<strong>EC</strong>-Schulen<br />
kuRsE FÜR schÜlERInnEn und schÜlER Seite 12 – 29<br />
S01 Modellierung mit Petrinetzen<br />
S02 Programmierung von Phidgets in C#<br />
S03 Experimentiertag am DLR_School_Lab<br />
S04 Magnetismus und Supraleitung<br />
S05 Die Welt der Physik – Experimentieren im Schülerlabor „PhysLab“<br />
S06 Biologie trifft Technik<br />
S07 Messung kosmischer Strahlen<br />
S08 Nichts bewegt sich, nichts geht in Betrieb ohne ZfP<br />
S09 Vom Dynamo bis zur Gamma-Strahlung<br />
S10 Ein Tag im Ausbildungszentrum der Telekom Berlin<br />
S11 Gesteine und Minerale<br />
S12 Verhaltens- und Neurobiologie<br />
S13 Nanochemie<br />
S14 Mathematik – von abstrakt bis greifbar<br />
S16 Computer Gaphics – StopMotion-Film<br />
S17 Labortag Magnetfeld der Erde<br />
S18 Farbwahl mit Leuchtdioden<br />
S19 Ein Tag in der Bundesdruckerei<br />
statIstIschEs Seite 30<br />
abEndvERanstaltung Seite 32<br />
kontakt Seite 34<br />
ImpREssum Seite 35
gRusswoRt<br />
Mathematisch-naturwissenschaftliche und technische<br />
Bildung sind wesentliche Bestandteile der<br />
Allgemeinbildung und Grundlage weiterführenden<br />
Lernens in Studium und Beruf. Mit der Initiierung<br />
der vierten Veranstaltung MINT300 hat die Wirtschaft<br />
einen wichtigen Beitrag dazu geleistet,<br />
dass es sich bei den angestrebten Qualitätsverbesserungen<br />
in der Bildung um eine gesamtgesellschaftliche<br />
Aufgabe handelt. Die Kultusministerkonferenz<br />
hat <strong>2009</strong> die Schirmherrschaft für das<br />
Netzwerk der MINT-<strong>EC</strong>-Schulen übernommen. In<br />
diesem Zusammenhang ist es mir ein besonderes<br />
Anliegen, zusammen mit der Wirtschaft auf die<br />
Bedeutung der MINT-Fächer hinzuweisen.<br />
Obwohl in Politik und Öffentlichkeit immer<br />
wieder auf den Mangel an Fachkräftenachwuchs<br />
hingewiesen wird, Hochschulen, Wirtschaft und<br />
Industrie hochqualifizierte Ingenieure, Techniker<br />
und Naturwissenschaftler suchen und eine<br />
Wahl dieser Schul- und Studienfächer propagieren,<br />
scheint das Bewusstsein um die Bedeutung<br />
mathematisch-naturwissenschaftlich-technischer<br />
Bildung noch nicht im wünschenswerten Maß<br />
gewachsen zu sein. Die Bildungspolitik sieht es<br />
deshalb als eines ihrer dringlichen Ziele an, das<br />
Interesse an naturwissenschaftlich-technischer<br />
Bildung sowie entsprechende Begabungen frühzeitig<br />
zu wecken und kontinuierlich zu fördern.<br />
Besonders hervorheben möchte ich an dieser<br />
Stelle die Empfehlung der Kultusministerkonferenz<br />
zur Stärkung der mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen<br />
Bildung (Mai <strong>2009</strong>).<br />
Wir haben Maßnahmen in acht Handlungsfeldern<br />
entwickelt, die 2010 umgesetzt werden sollen.<br />
Die Maßnahmen in all diesen Handlungsfeldern<br />
bilden ein ganzheitliches Lern- und Motivationskonzept,<br />
das schon bei Kindern im Vorschulalter<br />
nachhaltiges Interesse an naturwissenschaftlichen<br />
und technischen Fragestellungen weckt, welches<br />
in der Schule weiter ausgebaut und gefördert<br />
wird. Eine besondere Rolle spielen dabei die Kooperationen<br />
mit Schule, Hochschule, Wirtschaft,<br />
Wirtschaftsverbänden, Kammern und der Bundesagentur<br />
für Arbeit. Denn nur gemeinsam ist<br />
es möglich, das Interesse an Naturwissenschaft<br />
und Technik frühzeitig zu fördern. Dass dies gelingt,<br />
hat die Veranstaltung MINT300 eindrucksvoll<br />
bewiesen.<br />
Henry Tesch<br />
Minister für Bildung, Wissenschaft und Kultur<br />
des Landes Mecklenburg-Vorpommern,<br />
Präsident der Kultusministerkonferenz <strong>2009</strong><br />
Seite 3
Seite 4<br />
EInlEItung<br />
Zum vierten Mal wurde in Berlin die Veranstaltung<br />
MINT300 ausgerichtet. Der Veranstaltungsname<br />
leitet sich aus MINT (Mathematik,<br />
Informatik, Naturwissenschaften, Technik) und<br />
der Anzahl der partizipierenden Schülerinnen<br />
und Schüler ab.<br />
Weit über 300 TeilnehmerInnen sowie 80 Lehrkräfte<br />
von Netzwerkschulen des Vereins MINT-<br />
<strong>EC</strong> beteiligten sich im Jahr <strong>2009</strong>. Und es waren<br />
erneut Schülerinnen und Schüler des Istanbul<br />
Lisesi anwesend, unserer ersten Deutschen<br />
Auslandsschule.<br />
Ermöglicht wurde „MINT300’09“ durch die<br />
Deutsche Gesellschaft für Zerstörungsfreie Prüfung,<br />
„erlebe it“ ein Projekt der BITKOM, die<br />
Siemens Stiftung sowie den Arbeitgeberverband<br />
Gesamtmetall mit seiner Initiative THINK ING.<br />
Offenbar viele gute neuerungen<br />
Erstmals wurde der Ablauf der Veranstaltung<br />
umgestellt und optimiert.<br />
anreise: Anstelle einer Auftaktveranstaltung<br />
am Nachmittag des Anreisetages begann die Veranstaltung<br />
am Mittag. Damit waren insbesondere<br />
Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte ausgeruht,<br />
die aufgrund langer Reisewege bereits<br />
am Vorabend angereist waren.<br />
bildungsmarkt: Nach der Auftaktveranstaltung<br />
konnten die TeilnehmerInnen dann mit ihren Kursanbietern<br />
Kontakt aufnehmen. Auch dies unterschied<br />
die „MINT300’09“ von ihren Vorgängern.<br />
So konnten viele Fragen geklärt werden und die<br />
Teilnehmenden traten bereits am ersten Tag in<br />
Kontakt und Austausch. Weiterhin konnten sich<br />
auf dem Bildungsmarkt die Kursanbietenden den<br />
Teilnehmenden der „MINT300’09“ präsentieren:<br />
„Der Bildungsmarkt der MINT300 ist eine ausgezeichnete<br />
Plattform, um MINT-Aktivitäten<br />
öffentlich sichtbar zu machen. Hierdurch wurde<br />
nicht nur der Verein MINT-<strong>EC</strong> mit den zugehörigen<br />
Schulen wahrnehmbar, sondern auch die<br />
zahlreichen naturwissenschaftlich-technischen<br />
Schülerlabore und außerschulischen Lernorte.<br />
Dies zeigt, wie viel Potenzial in der Veranstaltung<br />
MINT300 steckt.“, so der Kommentar von<br />
Jörg Fandrich vom Berliner PhysLab.<br />
reduktion: Da bereits auf dem Bildungsmarkt<br />
und in den Vorbesprechungen der Kurse auch<br />
Themen, wie die Texterstellung zu dieser Dokumentation<br />
geklärt werden konnten, wurde die<br />
Veranstaltung am Freitagabend nach dem Kurstag<br />
im Rathaus Schöneberg beendet und nicht<br />
wie gewohnt erst Samstagmittag.
Die KMK würDigt Die <strong>Mint</strong>-eC-SChulen<br />
Die Auftaktveranstaltung im Rathaus Schöneberg<br />
bot eine Besonderheit: Herr Minister<br />
Henry Tesch, Minister für Bildung, Wissenschaft<br />
und Kultur des Landes Mecklenburg-Vorpommern<br />
und Präsident der KMK des Jahres <strong>2009</strong>,<br />
gab vor den rund 400 Anwesenden ein Novum<br />
bekannt. Der Präsident der KMK beschirmt das<br />
Netzwerk der MINT-<strong>EC</strong>-Schulen. In seiner Rede<br />
hob Herr Minister Tesch die herausragende<br />
und auf Qualität fokussierte Arbeit des Vereins<br />
MINT-<strong>EC</strong> in besonderer Weise hervor. Für den<br />
Verein MINT-<strong>EC</strong> begrüßte der Vorstandsvorsitzende<br />
Wolfgang Gollub die Anwesenden und<br />
dankte Herrn Henry Tesch für die Anerkennung<br />
des Vereins MINT-<strong>EC</strong> und seiner Netzwerk-<br />
schulen.<br />
Im Anschluss an den Auftakt ging es im Kulturprogramm<br />
kreuz und quer durch Berlin. Viele interessante<br />
Themen standen den TeilnehmerInnen<br />
der „MINT300’09“ zur Auswahl.<br />
Am Folgetag wartete ein intensives Programm<br />
an Universitäten, Forschungseinrichtungen und<br />
in Unternehmen auf die Schülerinnen und Schüler.<br />
Für die begleitenden Lehrkräfte wurde am<br />
Kurstag ein eigenes Programm angeboten. Die<br />
Deutsche Gesellschaft für Zerstörungsfreie Prüfung<br />
und „erlebe it“ boten eigene Workshops<br />
an, welche die Basis für unsere neu eingeführten<br />
MINT-Cluster bilden.<br />
Viele Lehrkräfte die bereits zum zweiten Mal<br />
an der MINT300 teilnahmen, hoben in den<br />
Auswertungsbögen zur „MINT300’09“ den<br />
Nutzen der neuen Struktur der Veranstaltung<br />
hervor. Am Abend kamen alle zu einem feierlichen<br />
Event im Rathaus Schöneberg zusammen.<br />
Dort faszinierte Dr. Mark Benecke das Plenum<br />
mit einem Vortrag aus dem Arbeitsalltag eines<br />
Kriminalbiologen. Sein Vortrag war derart<br />
fesselnd und unterhaltsam, dass Dr. Benecke<br />
eine „Zugabe“ bot. Es folgte die – bei der<br />
MINT300 fast schon traditionelle – Licht-Schau<br />
von „Feeding the Fish“, welche Lichteffekte und<br />
Akrobatik in beeindruckender Weise verbindet.<br />
Bei den Kursleitenden aus Universitäten, Forschungseinrichtungen<br />
und Unternehmen sowie<br />
den MitarbeiterInnen des Rathaus Schöneberg<br />
bedanken wir uns herzlich.<br />
Den Verantwortlichen auf Seiten der Deutschen<br />
Gesellschaft für Zerstörungsfreie Prüfung e. V.,<br />
„erlebe it“ der BITKOM, der Siemens Stiftung und<br />
dem Arbeitgeberverband Gesamtmetall mit seiner<br />
Initiative THINK ING. gilt unser besonderer Dank.<br />
Die MINT300 war und ist ein voller Erfolg und<br />
ein großartiges Veranstaltungsformat, welches<br />
nach wie vor viel Potenzial für eine Weiterentwicklung<br />
besitzt.<br />
Benjamin Burde<br />
Geschäftsführer Verein MINT-<strong>EC</strong><br />
Seite 5
Seite 6<br />
REsÜmEE dER FöRdERER<br />
aRbEIgEbERvERband<br />
gEsamtmEtall<br />
DaS <strong>Mint</strong>-eC-netzwerK erleben!<br />
In Zeiten des Web 2.0 sind Jugendliche mit<br />
den Begriffen „Netzwerk“ und „Kontaktzahl“<br />
wohl vertraut; die Zahl der virtuellen Freunde ist<br />
allgegenwärtig. Mit der Netzwerk-Veranstaltung<br />
MINT300 konnten wir den über 300 teilnehmenden<br />
Schülerinnen und Schülern das Begriffsverständnis<br />
erweitern und aus der virtuellen in die<br />
reale Welt zurückholen. Das Wahrnehmen neuer<br />
Anknüpfungspunkte zu Naturwissenschaften und<br />
Technik, das gemeinsame Erleben interessanter<br />
Veranstaltungen und Versuche sowie der intensive<br />
Austausch mit MitarbeiterInnen von Hochschulen,<br />
Forschungseinrichtungen und Unternehmen<br />
ebenso wie untereinander waren Kernbestandteil<br />
des MINT300-Netzes, das wir nun bereits zum<br />
vierten Mal für die MINT-<strong>EC</strong>-Schulen realisieren<br />
konnten.<br />
Wir halten diese in ihrer Form einmalige Veranstaltung<br />
für einen besonders wichtigen Bestandteil<br />
der Arbeit im Schulnetzwerk des MINT-<strong>EC</strong>, der<br />
das Gemeinschaftsgefühl der Beteiligten stärkt<br />
und dem MINT-<strong>EC</strong> damit nach innen wie nach<br />
außen Profil gibt. Die außerordentlich positiven<br />
Rückmeldungen sowohl von SchülerInnen als auch<br />
von Lehrkräften zeigen, dass dieses Veranstaltungsangebot<br />
die Bedürfnisse trifft und dementsprechend<br />
hervorragend angenommen wird.<br />
Wir freuen uns, dass wir dazu beitragen konnten<br />
und danken sowohl den anderen Förderern<br />
als auch ganz besonders den vielen beteiligten<br />
Institutionen der MINT-Bildung in und um Berlin<br />
und ihren MitarbeiterInnen.<br />
www.think-ing.de<br />
sIEmEns stIFtung<br />
begeiSterung für <strong>Mint</strong> weCKen!<br />
Junge Menschen für die Welt der Naturwissenschaften<br />
und der Technik zu begeistern sowie sie<br />
zur Wahl der entsprechenden Studiengängen zu<br />
motivieren, dies ist das Ziel der Bildungsaktivitäten<br />
der Siemens Stiftung.<br />
Aus diesem Grund freuen wir uns, dass mit unserer<br />
Unterstützung so viele junge Menschen an<br />
der diesjährigen MINT300 teilnehmen konnten.<br />
Um die Voraussetzung für eine chancenreiche<br />
Zukunft zu schaffen, gestalten und unterstützen<br />
wir im Rahmen der Stiftungsarbeit unter anderem<br />
Projekte im Bereich naturwissenschaftlichtechnischer<br />
Bildung. Diese setzen wir auf vielfältige<br />
Weise seit vielen Jahren sehr gerne und<br />
erfolgreich gemeinsam mit Schulen um, mit dem<br />
uns verbindenden Ziel, junge Menschen gut auf<br />
die Berufswelt vorzubereiten. Dies ist uns ein<br />
wichtiges Anliegen und wir freuen uns über das<br />
große Interesse, das uns bei den Projekten entgegengebracht<br />
wird.<br />
Die TeilnehmerInnen der MINT300 waren eingeladen,<br />
sich über die Projekte der Siemens Stiftung<br />
auf dem Bildungsmarkt zu informieren. Sowohl<br />
während der gesamten Veranstaltung als<br />
auch bei Gesprächen am Stand hat sich gezeigt,<br />
wie interessiert und offen die Schülerinnen und<br />
Schüler sowie die Lehrkräfte dem Thema MINT<br />
und der Netzwerk-Arbeit des Vereins MINT-<strong>EC</strong><br />
gegenüberstehen.<br />
Die engagierte Teilnahme an einer Veranstaltung<br />
wie MINT300 zeigt, dass der Verein MINT-<strong>EC</strong> mit<br />
solchen Angeboten auf dem richtigen Weg ist.<br />
www.siemens-stiftung.org
" ERlEbE It“ –<br />
dIE nachwuchsInItIatIvE<br />
dER dt. It-wIRtschaFt<br />
infOrMatiK-CluSter etabliert!<br />
Der Bundesverband der Informationswirtschaft,<br />
Telekommunikation und neue Medien (BITKOM e. V.)<br />
ist über das Projekt „erlebe it“ neuer Förderer<br />
des Vereins MINT-<strong>EC</strong>. Unterstützt wurde in diesem<br />
Jahr auch erstmalig die MINT300 in Berlin<br />
mit einem Angebot von insgesamt drei Kursen,<br />
davon einen für Lehrkräfte. Abgerundet wurde<br />
die inhaltliche Zusammenarbeit durch eine Präsenz<br />
am Bildungsmarkt.<br />
Mit besonderer Freude haben wir das große<br />
Interesse der TeilnehmerInnen an der MINT300<br />
für die Angebote aus den Themenfeldern Informatik,<br />
Telekommunikation und neue Medien<br />
aufgenommen. Zeigt es doch, dass hier ein<br />
Bedarf an Unterstützungsangeboten bei den<br />
Schulen besteht.<br />
Im Rahmen des Kursangebotes „erlebe it“ –<br />
Informatik-Cluster für MINT-<strong>EC</strong>-Schulen konnte<br />
ein Netzwerk etabliert werden, das zukünftig<br />
nicht nur mit besonderen Angeboten rund um<br />
die Informatik den Kompetenzauf- und -ausbau<br />
unterstützt. Aus der Zusammenarbeit sollen Angebote<br />
entstehen, die zum Beispiel durch das<br />
bundesweite Netzwerk der IT-Scouts auch anderen<br />
Schulen zur Verfügung gestellt werden. Auf<br />
diese Weise kann die MINT-Ausrichtung eine noch<br />
größere Verbreitung finden. Wir sind beeindruckt<br />
von dem großen Engagement der Schülerinnen<br />
und Schüler und der Lehrkräfte an den MINT-<br />
<strong>EC</strong>-Schulen und freuen uns sehr auf die weitere<br />
Zusammenarbeit.<br />
www.erlebe-it.de<br />
Wir bedanken uns für die freundliche<br />
Unterstützung im Rahmen des EU-Projektes<br />
„e-Skills-Week“.<br />
dEutschE gEsEllschaFt<br />
FÜR zERstöRungsFREIE<br />
pRÜFung e.v. (DGZfP)<br />
gelungene veranStaltung!<br />
Zum dritten Mal öffnete die DGZfP ihre Schulungsräume<br />
und Labore für MINT300. Unser Anliegen<br />
ist es, junge Menschen für die zerstörungsfreie<br />
Materialprüfung zu begeistern, die immer noch<br />
wenig bekannt, aber ein faszinierendes Arbeits-<br />
und Forschungsgebiet ist. Die DGZfP beteiligte<br />
sich dieses Jahr mit zwei Veranstaltungen, wovon<br />
eine speziell an Lehrkräfte gerichtet war.<br />
SChülerKurSuS S08 –<br />
„niChtS bewegt SiCh, niChtS<br />
geht in betrieb Ohne zfP“<br />
Unter diesem Motto gewannen 30 Schülerinnen<br />
und Schüler und zwei Lehrkräfte einen ersten<br />
Einblick in unterschiedliche Verfahren der zerstörungsfreien<br />
Materialprüfung (ZfP).<br />
lehrerKurSuS l02 –<br />
„CluSter Material-Prüfung“<br />
Einer Idee des Vereins MINT-<strong>EC</strong> folgend, die<br />
während der EduNetwork 09 diskutiert wurde,<br />
bot die DGZfP interessierten Lehrkräften die<br />
Gründung eines Clusters Materialprüfung an.<br />
Die Teilnehmerzahl von 20 Lehrkräften spiegelte<br />
das große Interesse wider. Ideen der Vernetzung<br />
von Schule und Industrie wurden gesammelt. Ein<br />
ZfP-Experimentierkoffer ist nun in der Entwicklung.<br />
Nach Unterstützung durch EU-Fördermittel<br />
wird gesucht.<br />
Es waren gelungene Veranstaltungen, die ganz<br />
wesentlich durch die Kontaktaufnahme und Gesprächsmöglichkeiten<br />
am DGZfP-Stand während<br />
des Bildungsmarktes unterstützt wurden. 2011 ist<br />
die DGZfP ganz sicher wieder mit dabei!<br />
www.dgzfp.de<br />
Seite 7
donnERstag - 17. dEzEmbER <strong>2009</strong><br />
Seite 8<br />
auFtaktvERanstaltung<br />
Henry Tesch Christian Bänsch<br />
Im wIlly-bRandt-saal dEs Rathaus schönEbERg<br />
AbLAufpLAn<br />
bILDunGSMARKT<br />
pressekonferenz<br />
> KMK beschirmt <strong>Mint</strong>-eC-Schulen<br />
Redner<br />
> Christian bänsch, Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung<br />
> henry tesch, Minister für Bildung, Wissenschaft und Kultur, Präsident der KMK<br />
> wolfgang gollub, Vorstandsvorsitzender Verein MINT-<strong>EC</strong><br />
TREffEn MIT DEn KuRSAnbIETERn<br />
Grußwort<br />
> angela Clerc, Siemens Stiftung<br />
Vorträge<br />
> Nachwuchsbarometer Technikwissenschaften – vera lohel, acatech<br />
> MINT-<strong>EC</strong> alumni berichten von ihrer Studienfachwahl –<br />
emmy-Charlotte förster, Carsten Schmidt, Jens höppner<br />
KuLTuRpROGRAMM
Vera Lohel<br />
v.l.n.r. : Jens Höppner, Emmy-Charlotte Förster,<br />
Carsten Schmidt, Benjamin Burde<br />
v.l.n.r.: Benjamin Burde, Henry Tesch, Wolfgang Gollub<br />
Angela Clerk<br />
Wolfgang Gollub<br />
Birthe Kleemann<br />
Xxxxx Xxxxxxx<br />
Xxxxxxx Xxxxxxxx<br />
Michael Wolfgang Zeisberger<br />
Seite 9
kuRs l01<br />
kuRsE FÜR lEhRkRäFtE<br />
Seite 10<br />
InFoRmatIk-clustER FÜR mInt-Ec-schulEn<br />
ERlEbE It<br />
Am 2. Tag der „MINT300’09“ trafen sich interessierte<br />
Lehrkräfte von unterschiedlichen Schulen<br />
in den Räumen des Bundesverbandes der Informationswirtschaft,<br />
Telekommunikation und neue<br />
Medien e. V. (BITKOM e. V.), um die Möglichkeiten<br />
zur Implementierung eines Informatik-Netzwerks<br />
innerhalb der MINT-<strong>EC</strong>-Schulen zu diskutieren.<br />
Nach einer kurzen Vorstellungsrunde aller TeilnehmerInnen<br />
und der Vorstellung der Zielsetzung<br />
für den Workshop stellten sich die Initiative<br />
„erlebe it“, der IT-Bildungsnetz e. V. sowie das<br />
Schülerlabor für Informatik und Lehrer-Online<br />
mit ihren speziellen ITK-Angeboten den TeilnehmerInnen<br />
vor. In einem nächsten Schritt gaben<br />
die Vertreter der Schulen einen Überblick, in<br />
welchen Rahmen das Fach Informatik an Ihrer<br />
Schule eingebettet ist und welche Anforderungen<br />
und Erwartungen an ein Unterstützungsangebot<br />
zur Förderung eines IT-Angebotes oder -Schwerpunktes<br />
gesehen werden. Während der Ausführungen<br />
wurden sehr schnell die unterschiedlichen<br />
Rahmenbedingungen in den Schulen und den<br />
jeweiligen Bundesländer deutlich. Es zeigte sich<br />
aber auch, dass die von den Initiativen in den verschiedenen<br />
ITK-Bereichen vorhandenen Angebote<br />
eine gute und umfassende Basis für den Aufbau<br />
eines Informatik-Clusters darstellen.<br />
Im zweiten Teil des Workshops ging es um die<br />
konkrete Ausgestaltung des Unterstützungsangebotes.<br />
Auf Basis von drei Handlungsfeldern wurden<br />
die vorhandenen Angebote strukturiert. Außerdem<br />
wurden erste Themenfelder identifiziert, die<br />
idealer Weise noch entwickelt werden sollten.<br />
Statement Kursanbieter<br />
„Wir freuen uns, gemeinsam mit anderen IT-Initiativen den<br />
MINT-<strong>EC</strong>-Schulen ein wirklich umfassendes Angebot im IT-Bereich<br />
anbieten zu können. Die positive Resonanz der anwesenden Lehr-<br />
kräfte bestätigte uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“<br />
Lehrkräfte: Annette Weber-Förster, Wolfgang Schäfer, Nils van den Boom, Hans Kuhbandner,Harald Schweinfurth, Alex Domay,<br />
Dietmar Meyer, Michael Mader, Beate Kusch, Caroline Warda, Georg Fischer, Stephan Kirschnick<br />
Im letzten Schritt des Workshops wurden bereits<br />
erste Arbeitsschritte zur Umsetzung des<br />
Informatik-Angebotes festgelegt. Diese sehen<br />
sowohl bildungspolitische Aktivitäten als auch<br />
operative Unterstützungsangebote zur Technik-<br />
und Berufsorientierung an den teilnehmenden<br />
Schulen vor.<br />
Während des Workshops herrschte eine sehr<br />
gute, konstruktive Atmosphäre. Alle Anwesenden<br />
brachten engagiert ihre Ansichten, Rahmenbedingungen<br />
und Wünsche ein. In einer offenen Diskussion<br />
wurde ein, für alle Anwesenden tragfähiges<br />
und umsetzungsorientiertes Konzept entwickelt,<br />
welches ein solides Fundament für die zukünftige<br />
Zusammenarbeit im Informatik-Cluster der<br />
MINT-<strong>EC</strong>-Schulen darstellt.
clustER zERstöRungsFREIE matERIal-<br />
pRÜFung (zFp) FÜR mInt-Ec schulEn<br />
dgzfp E.v.<br />
Die Zerstörungsfreie Prüfung ist wesentlich mit<br />
dafür verantwortlich, dass Unfälle und Katastrophen<br />
nicht passieren. Heute ist keine Gas- oder<br />
Ölversorgung, kein Start eines Flugzeuges, keine<br />
Herstellung eines Autos oder eines Zuges, kein<br />
Brückenbau und kein Betrieb eines Kraftwerkes<br />
mehr denkbar, ohne die ständige Kontrolle mittels<br />
zerstörungsfreier Prüfung. Jedes sicherheitsrelevante<br />
Teil wird geprüft. Wie solch eine zerstörungsfreie<br />
Materialprüfung aussieht, konnten<br />
Lehrerinnen und Lehrer verschiedener MINT-<strong>EC</strong>-<br />
Schulen im Kurs „Cluster Zerstörungsfreie Materialprüfung<br />
für MINT-<strong>EC</strong>-Schulen“ erfahren.<br />
Nach einem freundlichen Empfang im Berliner<br />
Ausbildungszentrum der Deutschen Gesellschaft<br />
für Zerstörungsfreie Materialprüfung (DGZfP)<br />
und einer kurzen Vorstellungsrunde aller Lehrkräfte<br />
führte Frau Hannelore Wessel-Segebade<br />
in einem interessanten Einführungsvortrag alle<br />
Beteiligten in das Gebiet der Materialprüfung<br />
ein. Neben diesen spannenden theoretischen<br />
Einblicken konnten die KursteilnehmerInnen im<br />
Anschluss einige Verfahren in der Praxis testen.<br />
Hier standen eine endoskopischen Sichtprüfung<br />
von Schweißnähten und eine Ultraschallprüfung<br />
auf dem Programm. Zudem konnten die Apparaturen<br />
zur Durchstrahlungsprüfung mit Röntgenstrahlen<br />
und zur Riss- und Porenprüfung nach dem<br />
Eindringverfahren intensiv begutachtet werden.<br />
Mit diesen Eindrücken schmeckte das anschließende<br />
Mittagsmenü nochmals so gut!<br />
Auf Grundlage dieser sehr interessanten theoretischen<br />
und praktischen Erfahrungen des Workshop-Vormittags<br />
zeigte sich, dass die Methoden<br />
der Materialprüfung eine Reihe von spannenden<br />
Tätigkeitsfeldern im Bereich der Mathematik,<br />
Physik, Chemie und Technik bieten, deren Einbringung<br />
in den Unterricht sehr lohnenswert ist.<br />
Im zweiten Teil des Workshops wurde daher in<br />
kleinen Gruppen nach möglichen Anknüpfungspunkten<br />
und einer lehrplankonformen Einbringung<br />
in den naturwissenschaftlichen Unterricht<br />
gesucht.<br />
Schnittstellen zur Physik zeigten sich beispielsweise<br />
im Bereich der spektroskopischen Methoden<br />
der Materialprüfung in Anlehnung an<br />
die Behandlung der Wechselwirkung von Licht<br />
mit Materie oder der Fehlerprüfung mit Wirbelstrom<br />
im Themenbereich der Elektrizitätslehre. In<br />
Chemie könnte z. B. ein im Unterricht durch die<br />
SchülerInnen hergestellter fluoreszierender Farbstoff<br />
mit einer Riss- und Porenprüfung nach dem<br />
Eindring-Verfahren abgeschlossen werden.<br />
Am Ende des Workshops stand fest, dass die<br />
zerstörungsfreie Materialprüfung eine Fülle faszinierender<br />
Projekte für den naturwissenschaftlichen<br />
Unterricht bietet. Eine Reihe von Experimenten<br />
konnte auch schon grob skizziert werden.<br />
Diese zu bündeln und einen Pool interessanter<br />
Experimente für den Unterricht zu entwickeln ist<br />
das Ziel, das sich die Beteiligten für die nächste<br />
Sitzung im Mai 2010 in Erfurt gesetzt haben.<br />
Lehrkräfte: Gudrun Adlung, Elke Gutsch, Hella Lampe, Rudolf Bertram, Dr. Jakob Trefz, Günter Entenmann, Thomas Seibold, Friedrich Holst,<br />
Norbert Jurich, Carsten Penz, Katharina Sukkau, Roland Winter, Thorsten Korthaus, Dr. Gisela Hennekemper, Christoph Lisowski<br />
kuRs l02<br />
Seite 11
kuRs s01<br />
kuRsE FÜR schÜlERInnEn und schÜlER<br />
Seite 12<br />
modEllIERung mIt pEtRInEtzEn<br />
hasso-plattnER-InstItut, potsdam<br />
In unserem Kurs besuchten wir das Hasso-Plattner-Institut<br />
(HPI) in Potsdam. Das HPI gehört<br />
als An-Institut zur Universität Potsdam. So sind<br />
die Studienbedingungen sehr gut, da man durch<br />
private Fördergelder zu einem anerkannten Bachelor-<br />
oder Masterabschluss kommt.<br />
Unser Thema beim Kurs am Hasso-Plattner-<br />
Institut war die Modellierung mit Petrinetzen.<br />
Petrinetze sind das meist beachtete und am besten<br />
untersuchte Modell für nebenläufige, parallele<br />
Prozesse. Beim Modellieren mit Petrinetzen<br />
geht es darum, komplexe Programmabläufe und<br />
Systemstrukturen vereinfacht darzustellen, was<br />
beim späteren Programmieren von Systemen hilft<br />
und es möglich macht, dass jemand, der sich<br />
nicht mit dem System/Prozess auskennt, einen<br />
Überblick über die Abläufe gewinnt. Zu Beginn<br />
des Kurses stellten sich einige Studierende vor<br />
und gaben uns danach mit einer Powerpoint-<br />
Präsentation eine sehr ausführliche Einführung<br />
in das Thema Petrinetze. So konnten schon nach<br />
kurzer Zeit alle TeilnehmerInnen das Gelernte anwenden,<br />
um verschiedene Probleme, wie die Realisierung<br />
des „Satz des Phythagoras“, zu lösen.<br />
Nach der Einführung folgte eine Kleingruppenarbeit,<br />
in der Lösungsvorschläge für verschiedene<br />
Problemstellungen, wie das Schalten einer Baustellenampel,<br />
erarbeitet wurden. Am Ende der<br />
Gruppenarbeit folgte das Vorstellen und Diskutieren<br />
der verschiedenen Lösungen. Hierbei wurde<br />
auch vermehrt auf Fragen und Anmerkungen der<br />
TeilnehmerInnen eingegangen.<br />
Nach dem Vortrag zu Petrinetzen lösten wir in<br />
kleinen Gruppen alltägliche Probleme. So sollten<br />
wir zum Beispiel einen Friseurbesuch darstellen.<br />
Der Friseur sollte erst die Haare waschen, dann<br />
schneiden und danach föhnen – wie man es bei<br />
einem normalen Friseurbesuch gewohnt ist. Das<br />
Problem bei dieser Aufgabe war, dass der Friseur<br />
den Kunden nach dem Schneiden immer fragen<br />
musste, ob die Frisur nun in Ordnung sei. Falls<br />
das nicht der Fall sein sollte, musste er noch mal<br />
schneiden. Deshalb musste der Friseur sich zusätzlich<br />
auch noch unterhalten.<br />
In einer anderen Aufgabe ging es um eine Baustellenampel.<br />
Wie man es aus der Praxis kennt,<br />
ist die eine Fahrbahnseite gesperrt und Autos<br />
aus den unterschiedlichen Richtungen dürfen<br />
nicht zur gleichen Zeit fahren. Wir mussten nun<br />
die Ampeln so schalten, dass sie nie zur gleichen<br />
Zeit „grün“ anzeigten. Natürlich gab es noch<br />
viele weitere spannende Problemstellungen, die<br />
wir während der Veranstaltung lösten.<br />
Wie man an diesen Beispielen sehen kann, war<br />
es ein sehr interessanter Tag. Zur Stärkung gab<br />
es zwischendurch noch ein sehr leckeres Essen<br />
in der Mensa der Universität vom HPI spendiert.<br />
So konnten wir sogar etwas ins Studentenleben<br />
hineinschnuppern.<br />
SchülerInnen: Tamara Michel, Thomas Hensel, Marvin Franke, Christian Müller, Tobias Hirsch, Carsten Petruschke, Maximilian Schoch,<br />
Robin Kasparek, Tina Gutting, Yannick Schmidt, Jan Neuburger, Susanne Müller, Nils Konrad, Caroline Schwippert, Marc Tonsen,<br />
Daniel Otto-Schleicher, Carla Kuhn, Christopher Durand, Yassine Amraue, Philipp Feodorovici, Stefan Sturm, Dennis Hock<br />
Lehrkräfte: Christoph Pohlmann
pRogRammIERung von phIdgEts In c#<br />
hasso-plattnER-InstItut, potsdam<br />
Nach einer längeren Fahrt mit der Straßenbahn<br />
bis Potsdam trafen wir im Hasso-Plattner-Institut<br />
ein. Uns wurde zuerst eine kleine Einführung über<br />
Programmierung in C# gezeigt, anschließend<br />
wurden uns die Hardware-Boards „Phidgets“<br />
vorgestellt, von denen eine sehr große Auswahl<br />
zur Verfügung stand, mit denen man eigene<br />
kleine Projekte realisieren konnte. Nach einigen<br />
Programmierversuchen, die auch nach einigen<br />
Startschwierigkeiten ganz gut funktioniert haben,<br />
gab es eine Mittagspause in der Kantine<br />
des Instituts. Als wir uns nach dem Essen alle<br />
wieder in einem Hörsaal getroffen haben, wurde<br />
uns sehr viel Interessantes über das Hasso-Plattner-Institut<br />
erzählt. Später konnten wir uns an<br />
unser eigenes Projekt setzen. Wir sollten einen<br />
intelligenten Toaster entwickeln, doch die Zeit<br />
verging schneller als gedacht und unser Toaster<br />
ist nicht ganz fertig geworden.<br />
kuRs s02<br />
Schülerstatement<br />
„Mir hat das MINT-Camp in Berlin sehr gut gefallen, da es ein sehr abwechslungsreiches<br />
Programm gab, welches die MINT-Fächer und auch viel<br />
Performance beinhaltete. Außerdem war die Veranstaltung gut durchdacht,<br />
sodass wir die ganze Zeit unterwegs waren und es keine Langeweile gab.“<br />
SchülerInnen: Alexander Alt, Stephan Engelmann, Mathias Gebhardt, Sang Paik, Friedrich Horschig, Felix Treede, Christian Dziwok, Fabio Weishaupt,<br />
Birte Jetter, Vincent Glöer, Markus Faßbender, Nils Goldammer, Martin Rettelbach, Karl Stelzner, Markus Werntges, Peter Schmitzer, Carsten Bruns,<br />
Sebastian Wambach, Daniel Steinmetz, Alexander Wex | Lehrkräfte: Guido Müller, Dr. Thomas Feser, Dr. Frank Hill<br />
Seite 13
kuRs s03 ExpERImEntIERtag am dlR_school_lab<br />
Seite 14<br />
dEutschEs zEntRum FÜR luFt- und RaumFahRt (dlR)<br />
Nach einem informativen Einführungsreferat mit<br />
Video über das DLR wurden wir eingeteilt in<br />
Kleingruppen, zu jeweils fünf SchülerInnen. Jede<br />
Gruppe konnte zwei Experimente – begleitet von<br />
einem erfahrenen Tutor – durchführen. Das waren<br />
im Einzelnen:<br />
verKehrSSiMulatiOn<br />
Ausgehend von einer realen Verkehrssituation<br />
haben wir am Beispiel der T-Kreuzung vor dem<br />
Institutsgebäude verschiedene Ampelschaltungen<br />
ausprobiert und herausgefunden, welche den besten<br />
Verkehrsfluss und die meiste Gerechtigkeit<br />
bietet. Besonders interessant war auch die Darstellung<br />
einer Straße vor dem Institut mit einer<br />
Vielzahl eingebauter Sensoren, mit denen man die<br />
unterschiedlichen physikalischen Eigenschaften<br />
der einzelnen Fahrzeuge berechnen konnte.<br />
infrarOtliCht<br />
Das Infrarotlicht wurde uns durch einen Versuch<br />
nahegebracht, den der Physiker Herschel Anfang<br />
des 19. Jahrhunderts durchgeführt hatte. Wie<br />
Herschel haben wir das weiße Licht mit einem<br />
Prisma aufgespaltet und neben dem roten Bereich<br />
den stärksten Temperaturanstieg festgestellt.<br />
Mit einer Infrarotkamera haben wir verschiedene<br />
Eigenschaften des Infrarotlichts erforscht, z. B.<br />
erkannten wir, dass Materialien, die für sichtbares<br />
Licht undurchdringlich sind, sehr wohl im<br />
Infrarotbereich durchsichtig erscheinen und umgekehrt.<br />
Wir untersuchten auch die Wärmeabstrahlung<br />
verschieden gefärbter und gestalteter<br />
Oberflächen.<br />
SOlar- unD brennStOffzelle<br />
Zunächst ermittelten wir in einem Experiment<br />
die Abhängigkeit der Stromstärke vom Winkel<br />
der Einstrahlung des Sonnenlichts. Mit dem erzeugten<br />
Strom wurde Wasser in Wasserstoff und<br />
Sauerstoff aufgespaltet und damit eine Brennstoffzelle<br />
betrieben. Uns hat das Arbeiten (bzw.<br />
das Erarbeiten) in der Gruppe sehr viel Spaß bereitet<br />
und wir sind uns alle einig, dass wir uns<br />
auch beruflich gerne mit diesen Themen auseinander<br />
setzen würden.<br />
3D-Sehen<br />
Beim 3D-Sehen haben wir zuerst darüber gesprochen,<br />
wie das dreidimensionale Sehen zustande<br />
kommt. Danach haben wir uns den 3D-Bildern<br />
zugewandt. Uns wurde erklärt, wie diese erzeugt<br />
werden. Mehr über das dreidimensionale Sehen<br />
zu erfahren war äußerst spannend. Die Tutorin<br />
hat den Kurs sehr interessant gestaltet.<br />
gPS<br />
Nach einer allgemeinen Einführung und Erklärung<br />
von GPS und Navigation führten wir praktische<br />
Übungen durch. In der bitteren Kälte von<br />
–11 °C durften wir selbst mit GPS-Empfängern<br />
experimentieren und haben damit beispielsweise<br />
automatisch ein Wegeprotokoll erstellen lassen.<br />
Nach all dem hatten wir einen guten Einblick in<br />
die Funktion von GPS.<br />
SchülerInnen: Timo Scholz, Jan Schneider, Michael Mendl, Paul Fischer, Salih Köse, Marc Hasenmueller, Simone König, Annika Grundmann,<br />
Christian Baeger, Erik Heinemann, Ugur Batir, Thomas Hille, Alexander Penack, Natalie Prinz, Julian Hering, Daniel Beuth, Vincent Koch,<br />
Elisabeth Gerny, Sebastian Klukas, Markus Ebbert, Robert Etzkorn, Kai Strycker, Benjamin Struth, Kevin Wöll<br />
Lehrkräfte: Jürgen Schneider, Patrick Epple, Daniel Krauhakel
magnEtIsmus und supRalEItung<br />
hElmholtz-zEntRum bERlIn<br />
Am Freitag standen verschiedene Arbeitsgruppen<br />
zur Auswahl. Das Projekt S04 über Magnetismus<br />
und Supraleitung, zu dem ich mich<br />
angemeldet hatte, fand im „Helmholtz-Zentrum<br />
Berlin“ statt.<br />
Dort werden die Eigenschaften von neuen Legierungen<br />
sowie von neuen Kristallstrukturen<br />
erforscht. Zu diesem Zweck steht in dem Forschungszentrum<br />
ein Atomreaktor zur Produktion<br />
von Neutronen, mit deren Hilfe die Struktur von<br />
Kristallen ermittelt werden soll. Außerdem wurden<br />
die Eigenschaften von Supraleitern untersucht.<br />
Unser Projekt begann mit einem kurzen Vortrag<br />
über die Ziele des Forschungsinstituts. Danach<br />
gingen wir direkt in einen Versuchsraum. Dort<br />
wurden wir in drei Gruppen eingeteilt und führten<br />
erst einmal Experimente zum Magnetismus allgemein<br />
durch. Nachdem wir die allgemeinen<br />
Experimente abgeschlossen hatten, wurden wir<br />
mit Flüssigstickstoff, Magneten und YBa 2Cu 3O 7<br />
ausgestattet. YBa 2Cu 3O 7 ist bereits ab 93K supraleitend.<br />
Da Stickstoff erst bei 77K flüssig wird,<br />
konnten wir YBa 2Cu 3O 7 herunterkühlen und somit<br />
zu einem Supraleiter machen.<br />
Danach haben wir noch Versuche mit Magneten<br />
und dem Supraleiter gemacht und so<br />
herausgefunden, dass es sich bei Supraleitern um<br />
Diamagneten handelt. Auf die Experimentreihe<br />
folgten noch ein Vortrag über die Entdeckung,<br />
Verwendung und Erforschung von Supraleitern<br />
sowie eine Führung durch das Institut.<br />
Schließlich konnten wir noch an einem Quiz<br />
teilnehmen, um unser, an diesem Tag erlerntes<br />
Wissen zu testen.<br />
SchülerInnen: Daniel Schürhoff, Alexander Zurhelle, Alexander Zeltinger, Matthias Gößwein, Max Beck, Leonard Commandeur, Simon Bürkle,<br />
Felix Hoffmann, Maximilian Löffel, Nils Fromm, Maike Konz, Florian Falk, Niels Christ, Frederik Dohmann, Carina Dürr, Rayan Guerdelli, Christian Knipl,<br />
Viktoria Schubert, Daniel Surek, Lucas Macher | Lehrkräfte: Carsten Schäfer, Svenja Hohmeier<br />
kuRs s04<br />
Seite 15
kuRs s05<br />
Seite 16<br />
dIE wElt dER physIk -–<br />
ExpERImEntIEREn Im schÜlERlaboR<br />
“<br />
physlab“<br />
physlab, FREIE unIvERsItät bERlIn<br />
Unser Kurs im PhysLab gliederte sich in zwei<br />
große Teile. Nachdem wir vom Leiter des Phys-<br />
Labs, Jörg Fandrich begrüßt wurden, konnte<br />
jeder Kursteilnehmende zwei von vier physikalischen<br />
Experimenten auswählen. Angeboten<br />
wurden der Franck-Hertz-Versuch, der Photoeffekt,<br />
das Interferometer und der Stirlingmotor.<br />
Ich entschied mich für den Photo effekt<br />
und das Interferometer und konnte sowohl das<br />
Plancksche Wirkungsquantum als auch den<br />
Brechungsindex von Luft experimentell bestimmen.<br />
Die Experimente wurden von drei Tutoren<br />
des PhysLabs hervorragend betreut, so dass sowohl<br />
Fragen zu den theoretischen Grundlagen<br />
als auch zur praktischen Durchführung der Experimente<br />
schnell geklärt waren.<br />
Lehrerstatement<br />
„Im Namen aller KursteilnehmerInnen danke ich Herrn Fandrich und<br />
seinem Team für den gelungenen und abwechslungsreichen Tag im<br />
PhysLab der Freien Universität Berlin.“<br />
Christian hagel, luisen-gymnasium, hamburg bergedorf<br />
Veranstalterstatement<br />
„Es war wieder eine Freude, die MINT300-SchülerInnen beim Experimentieren<br />
zu beobachten. Ich hoffe sehr, dass viele von ihnen dauerhaft<br />
an einem MINT-Fach Interesse finden und dieses als Basis für ihren<br />
Berufsweg wählen.“<br />
Jörg fandrich, Schülerlabor „Physlab“<br />
Der zweite Teil fand in den PhysLab-Einführungsexperimenten<br />
statt. Mehr als 120 Mitmach-<br />
Experimente sind hier aufgebaut und stehen<br />
Schulklassen unter dem Motto „Mehr entdecken<br />
lassen, weniger erklären“ ganzjährig<br />
zur Verfügung. Herr Fandrich zeigte uns zunächst<br />
einige ausgewählte, besonders verblüffende<br />
Einführungsexperimente.<br />
Anschließend konnte jeder nach eigenem<br />
Geschmack physikalische Phänomene erkunden<br />
und mit den anderen KursteilnehmerInnen darüber<br />
diskutieren. Viele Stationen waren auch<br />
mit kurzen Experimentieranleitungen oder weiterführenden<br />
Fragestellungen versehen. Die Mischung<br />
zwischen den aufwendigeren High-Tech-<br />
Experimenten am Vormittag und den zahlreichen<br />
kleinen Experimenten am Nachmittag war überaus<br />
gelungen und spiegelte die Vielfältigkeit der<br />
Physik wider. Zum Abschluss beantwortete Herr<br />
Fandrich die Fragen der TeilnehmerInnen zu Vorlesungen,<br />
Übungen, Seminaren und Praktika im<br />
Physikstudium.<br />
SchülerInnen: Hilmar Schubert, Helene Will, Moritz Benner, Liesa Röder, Ursula Katharina Waschke, Madeline Müller,<br />
Ingrid Siluk-Reitenbach, Massimo Casale, Tobias Jetter, Maja Merz, Andreas Hochbaum, Denis König<br />
Lehrkräfte: Christian Hagel
IologIE tRIFFt tEchnIk<br />
tEchnIschE hochschulE wIldau<br />
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften<br />
und Technik erwarten uns in Berlin. Vor uns lagen<br />
drei interessante Tage gefüllt mit Kulturprogrammen,<br />
Schülerpraktika und dem Kennenlernen von<br />
neuen Leuten aus ganz Deutschland.<br />
„Weiß jemand wo Wildau ist?“ Zum Glück informierte<br />
man uns schon vorher, wie wir zu der<br />
Technischen Fachhochschule kommen, also gelangten<br />
wir rechtzeitig zu unserem Fachvortrag<br />
über Biosystemtechnik und Bioinformatik, den wir<br />
uns zusammen mit Frau Sybille Köppen und 20<br />
weiteren MINT-TeilnehmerInnen anhörten.<br />
Trotz des recht komplexen Themas, zu welchem<br />
uns manchmal Hintergrundinformationen<br />
fehlten, erklärte uns Dr. Carsten Lübke die Erfindung<br />
und Funktionsweise eines Biosensors doch<br />
recht verständlich.<br />
Nach dem Mittagessen begann der praktische<br />
Teil: Wir wiesen Glucose quantitativ und qualitativ<br />
nach. Zuerst einmal zeigte uns ein selbst<br />
hergestellter Teststreifen, in welcher Probelösung<br />
Glucose enthalten ist und in welcher nicht.<br />
Mit einer Eppendorf-Pipette und verschieden konzentrierten<br />
Glucose-Lösungen wiesen wir mithilfe<br />
eines Farbstoffs die Glucose quantitativ nach.<br />
Zum Schluss stellten wir mit einer Sauerstoffelektrode<br />
und einer Eierschalenmembran einen<br />
elektrochemischen Biosensor her. Den gesamten<br />
Versuch zu erklären, wäre zu kompliziert. Auch<br />
die Lehrkräfte konnten sich nicht davor drücken,<br />
die Experimente selbst durchzuführen. Wir fanden<br />
es toll, dass man uns den Aufenthalt in Wildau<br />
ermöglicht hat! Es hat Spaß gemacht und wir<br />
haben etwas dazugelernt.<br />
Veranstalterstatement<br />
„Uns hat der Tag wirklich sehr viel Spaß gemacht. Selten hatten wir so eine<br />
positive Dynamik in einem Kurs, wie mit den MINT300-SchülerInnen.“<br />
Dr. Carsten lübke, technische hochschule wildau<br />
SchülerInnen: Teresa Buschmann, Maren Bauer, Jakob Rau, Birte Ohm, Tobias Graf, Susanne Kirchen, Christian Koch, Jan Hahlbrock, Philipp Demling,<br />
Lukas Anicker, Meike Dahmen, Peter Eigenbrod, Sarah Weissenberger, Luisa Ander, Patricia Swientek, Katrin Müller, Lukas Zibula, Pascal Müller<br />
Lehrkräfte: Dirk Bahrouz, Sybille Köppen, Bernhard Schrautemeier<br />
kuRs s06<br />
Seite 17
kuRs s07<br />
kuRs<br />
Seite 18<br />
mEssung kosmIschER stRahlung<br />
dEsy-schÜlERlaboR physIk.bEgREIFEn<br />
Am 18. Dezember <strong>2009</strong> befasste sich der Kurs<br />
7 der Veranstaltung MINT300 mit dem Thema<br />
„Messung von kosmischer Strahlung“, bei dem<br />
sich Schule und Wissenschaft treffen sollte. Veranstalter<br />
war das DESY in Zeuthen.<br />
Zunächst hörten wir einen Vortrag über kosmische<br />
Strahlung und deren Messverfahren, um<br />
die Stärke zu ermitteln. Der besondere Schwerpunkt<br />
lag auf der Detektion von Myonen. Myonen<br />
sind kosmische Teilchen, die Elektronen ähneln,<br />
da sie negativ geladen sind, jedoch eine weit<br />
größere Masse haben. Sie sind der Hauptbestandteil<br />
der sekundären kosmischen Strahlung<br />
und entstehen in zehn Kilometer Höhe durch<br />
Reaktionen von Protonen mit Atomkernen der<br />
Atmosphäre.<br />
Die Experimente wurden in vier Gruppen durchgeführt,<br />
von denen jeweils zwei das gleiche Experiment<br />
bearbeiteten. Die Aufgabenstellung lautete,<br />
mittels Zählraten aus den beiden Experimenten<br />
herauszufinden, in welchem Winkel die meisten<br />
Myonen auf die Erdoberfläche treffen.<br />
Material<br />
2 Kamiokannen / Szintillatoren<br />
Netzteil mit Regler<br />
Triggerbox<br />
Laptop mit Messdatenaufnahmesystem<br />
Kabel<br />
In dem einen Experiment sollten die, von Myonen<br />
ausgelösten Impulse in Kamiokannen gezählt werden.<br />
Eine Kamiokanne besteht aus einer wassergefüllten<br />
Thermoskanne, die lichtundurchlässig<br />
abgedichtet ist. Sobald ein Myon in eine Kamiokanne<br />
einschlägt, wird Cherenkov-Strahlung erzeugt,<br />
die ein Photomultiplier registriert und<br />
elektrische Impulse erzeugt. Gezählt wird jedoch<br />
nur ein Impuls, sofern dieser in einem sehr kurzen<br />
Zeitfenster in beiden Kannen registriert wird.<br />
Durch Anordnung der Kannen zueinander kann<br />
auf die Abhängigkeit der gezählten Impulse vom<br />
Einfallswinkel der Myonen geschlossen werden. In<br />
dem zweiten Experiment waren die Kamiokannen<br />
durch Szintillatoren ersetzt, deren Funktionsweise<br />
jedoch die gleiche ist.<br />
In der statistischen Auswertung der Messergebnisse<br />
wurden die gezählten Einschläge pro<br />
Zeit in Hz bestimmt.<br />
Es ergaben sich folgende Raten:<br />
Kamiokannen Szintillator<br />
Horizontal 0,009/s 0,07/s<br />
45° 0,09/s 0,7/s<br />
Vertikal 0,038/s 1,0/s<br />
Die kosmische Myonen-Strahlung ist in vertikaler<br />
Richtung somit weit höher, als z. B. in horizontaler<br />
Richtung. Berücksichtigt man die Krümmung<br />
der Atmosphäre und der Erdoberfläche, so ist<br />
der Weg eines Myons, welches horizontal in ein<br />
Messgerät dringt größer als der, der vertikal einfallenden<br />
Teilchen. Die Wahrscheinlichkeit, dass<br />
ein vertikal eingefallenes Myon bereits zerfallen<br />
ist, ist somit niedriger, welches sich in der gemessenen<br />
Rate darstellt.<br />
Interessante Einblicke wurden auch in die Messhalle<br />
in Zeuthen gewährt, wo Detektoren und<br />
Messapparaturen ausgestellt waren.<br />
SchülerInnen: Robin Kampes, Maria Ritter, Senta Zickwolff, Jeannine Sander, Felix Tiefenthaler, Jan David Maruska, Felix Börner-Bernhardt,<br />
Lisa Stuber, Christian Dahle, Annika Wagstyl | Lehrkräfte: Michael Heumann, Susanne Heidt
nIchts bEwEgt sIch,<br />
nIchts gEht In bEtRIEb ohnE zFp<br />
dgzfp E.v.<br />
Morgens um 9:30 Uhr fanden wir SchülerInnen<br />
und Lehrkräfte, die den Kurs S08 und L02 gewählt<br />
haben, uns in der Max-Planck-Straße 6 ein, weil<br />
dort unser Kurs stattfand. In diesem Kurs erfuhren<br />
wir Genaueres über die Zerstörungsfreie Materialprüfung.<br />
Was ist Zerstörungsfreie Materialprüfung,<br />
fragen sich jetzt wahrscheinlich Viele.<br />
Hier werden Materialien, die später in Flugzeugen,<br />
Autos, Zügen und für Gastanks verwendet<br />
werden, auf Fehler in ihrer Oberfläche und im<br />
Materialinneren untersucht. Dort angekommen<br />
begrüßte uns Frau Wessel-Segebade sehr herzlich<br />
und stellte die Deutsche Gesellschaft für Zerstörungsfreie<br />
Prüfung e. V. kurz vor.<br />
Nach der Begrüßung bekamen wir die verschiedenen<br />
Verfahren der Materialprüfung erklärt. Es<br />
gibt fünf verschiedene Verfahren, um die Materialien<br />
zu prüfen, doch dazu später noch mal<br />
Genaueres. Nach der Einführung in die Verfahren<br />
teilten wir uns in die vier vorgegebenen Gruppen<br />
ein. In diesen Gruppen lernten wir kurz die einzelnen<br />
Verfahren kennen. Die fünf verschiedenen<br />
Verfahren sind folgende: Die Sichtprüfung, dabei<br />
wird die Oberfläche der Materialien auf Kerben<br />
oder Risse untersucht. Dies kann man mit Handspiegeln<br />
oder Endoskopen machen.<br />
Die Ultraschallprüfung, dabei wird das Material<br />
auf Fehler im Inneren, wie Lufteinschlüsse,<br />
untersucht. Dazu legt man einen Ultraschallkopf<br />
auf das Material und betrachtet die Kurve, die auf<br />
dem Messgerät angezeigt wird. Sieht man eine<br />
Unregelmäßigkeit auf dem Display, liegt dort der<br />
Fehler im Material.<br />
Bei der Eindringprüfung wird die Schweißnaht<br />
genauer betrachtet. Hierfür braucht man drei<br />
verschiedene Behandlungsmittel. Als erstes wird<br />
das Eindringmittel auf die Schweißnaht gesprüht,<br />
welches eine rote Färbung hat und man wartet<br />
bis es in die Fehler eingedrungen ist. Danach wird<br />
mit einem Reiniger die Oberfläche vom überflüssigen<br />
Eindringmittel befreit. Anschließend wird<br />
der Entwickler aufgesprüht. Dieser sorgt dafür,<br />
dass das Eindringmittel, welches in die Fehler<br />
gezogen ist, wieder an die Oberfläche gelangt<br />
und dort eine rote Markierung hinterlässt, die<br />
den Fehler anzeigt. Bei der Magnetpulverprüfung<br />
wird ein künstlich erzeugtes Magnetfeld an das<br />
Material gelegt, so dass die Magnetfeldlinien das<br />
zu prüfende Material durchlaufen. Danach gibt<br />
man ein fluoreszierendes Mittel auf das Material.<br />
Dies geschieht alles unter UV-Licht. Diese<br />
Methode zeigt oberflächennahe Fehler an. Die<br />
Magnetfeldlinien treten durch den Fehler nach<br />
außen und reagieren mit dem fluoreszierenden<br />
Mittel. Als letztes die Durchstrahlprüfung: Bei<br />
der Durchstrahlprüfung wird das Material mit<br />
Gammastrahlung bestrahlt und hinter dem Material<br />
befindet sich ein Film, der an den Stellen,<br />
wo sich Fehler befinden, schwarz bleibt.<br />
Zwischendurch gab es auch noch ein leckeres<br />
Mittagessen. Nachdem wir die Verfahren<br />
uns angeschaut haben und zum Teil auch selber<br />
durchführen durften, haben wir noch eine Abschlussbesprechung<br />
gemacht. Die Veranstaltung<br />
war gegen 16:30 Uhr zu Ende.<br />
Schülerstatement<br />
„Es hat viel Spaß gemacht und war sehr interessant. Ich war erstaunt wie<br />
vielfältig die Zerstörungsfreie Prüfung ist, da ich zuvor noch nie etwas<br />
davon gehört hatte.“<br />
Celina fraatz und Kristina breithaupt<br />
SchülerInnen: Jorgen Depken, Samuel Meffert, Harald Schüller, Imka Sarina van Lessen, Soi Ha Dip, Mareike Trappen, Martin Kray, Albert Möller,<br />
Max Schoschies, Christian Moritz, Fabian Hunold, Vincent Feindt, Rasmus Haupt, Susanne Weiler, Artur Ruppel, Sandra Müller, Jan Zgadzaj,<br />
Ulrich Solbach, Martin Nell, Janek Klaus, Tom Elfering, Henrike Lachmann, Svava Reuter, Markus Müller, Sven Knebel, Jonas Krehl, Mariel Bernhard,<br />
Celina Fraatz, Kristina Breithaupt | Lehrkräfte: Oliver Theiss, Thorsten Schultheis, Katja Cullmann<br />
kuRs s08<br />
Seite 19
kuRs s09 vom dynamo bIs zuR gamma-stRahlung<br />
Seite 20<br />
hFt lEIpzIg, ERlEbE It<br />
Der BITKOM e. V. ist ein Interessenverband<br />
der deutschen IT-Branche und hatte uns in seine<br />
Räumlichkeiten eingeladen. Die Veranstaltung<br />
hatte den vielversprechenden Titel „Vom<br />
Dynamo bis zur Gamma-Strahlung – Selected<br />
Topics in High Frequency Technology“. Andrzej<br />
Wiatrek, ein wissenschaftlicher Mitarbeiter der<br />
Hochschule für Telekommunikation Leipzig (HfTL),<br />
klärte mit uns die Grundlagen und erläuterte Begriffe<br />
wie Frequenz, Phase, Intensität und Polarisation<br />
einer Welle. Er unterbrach seinen Vortrag<br />
immer wieder, um uns das gerade Gelernte an<br />
einfachen Experimenten zu zeigen. Zu diesem<br />
Zweck hatten er und sein Kollege Dr. Kambiz<br />
Jamshidi verschiedene Laborinstrumente mitgebracht.<br />
Wir als KursteilnehmerInnen durften nun<br />
verschiedene Experimente durchführen. So wurde<br />
zum Beispiel über elektromagnetische Wellen die<br />
Musik einer Schülerin, die ihren MP3-Player an<br />
den Generator und das Oszilloskop anschloss,<br />
übertragen. Anschließend bekamen wir zwei Metallplatten<br />
in die Hand gedrückt und durften eine<br />
konstruktive oder destruktive Interferenz erzeugen,<br />
indem wir die Platten in verschieden großen<br />
Abständen über und unter die Strecke zwischen<br />
Sender und Empfänger hielten. Sprich: Die Musik<br />
wurde lauter oder war gar nicht mehr zu hören.<br />
Auch der allseits bekannte Doppler-Effekt (der<br />
Schülerstatement<br />
„Unser Kurs war eine gute Wahl. Ich habe viel über Optik, Hoch-<br />
frequenztechnik und Glasfasern gelernt und es herrschte immer eine<br />
lockere und entspannte Atmosphäre. Die Wissenschaftler der HfTL<br />
haben einen sehr netten Eindruck hinterlassen und auch für das leibliche<br />
Wohl war immer gesorgt (der riesige Kaffeeautomat im Nebenraum<br />
bleibt in Erinnerung genau wie die MINTler, die unbedingt<br />
einen Blick hineinwerfen wollten).<br />
Bleibt zu sagen: Einmal MINT, immer MINT, denn ein Besuch beim<br />
MINT300 in Berlin lohnt sich immer!“<br />
tom Simon athenstädt, werner-heisenberg-gymnasium, leverkusen<br />
SchülerInnen: Alexander Rasch, Sarah Stengel, Thomas Peters, Niklas Hilgert, Tobias Martin, David Gerth, Inez Homeister, Philipp Wegner,<br />
Dipendra Bhusal, Marius Schultz, Julian Eberhardt, Daniel Maiwald, Maria Möller, Tom Simon Athenstädt, Hannah Möbus, Nikolai Püllen,<br />
Phillip Großmann, Katrin Drisch, Carolin Ackermann, Fabian Laute | Lehrkräfte: Christoph Bauer<br />
Grund für die unterschiedliche Tonhöhe eines<br />
mit Martinshorn vorbeifahrenden Einsatzfahrzeugs)<br />
wurde für uns im Experiment verdeutlicht.<br />
Andrzej Wiatrek zeigte sich immer offen für Fragen<br />
und erklärte uns jedes Phänomen geduldig<br />
und mit einigem Humor.<br />
Nach dem Essen begann der zweite Teil unseres<br />
Kurses, den Dr. Kambiz Jamshidi gestaltete. Der<br />
iranische Wissenschaftler sprach mit uns Englisch<br />
und vertiefte als Erstes unsere Kenntnisse über<br />
Strahlen- und Wellenoptik. Es ging um Reflexion,<br />
Brechung, Fermatsches Prinzip, Snelliussches Brechungsgesetz<br />
und Totalreflexion („total internal<br />
reflection“). Dann bewegten wir uns langsam<br />
aber sicher in Richtung Glasfasertechnologie.<br />
Dr. Jamshidi verwies auf einige eindrucksvolle<br />
Rekorde bei der Datenübertragung mit Glasfasern:<br />
Daten können über 580 Kilometer verlustfrei<br />
mit Datenraten von inzwischen bis zu 32 Terabit<br />
pro Sekunde durch eine Glasfaser gejagt werden<br />
(Rekord aufgestellt im Mai <strong>2009</strong>). Mit Hilfe von<br />
starken Lasern und Glasquadern wurde uns die<br />
Totalreflexion und damit das Prinzip der Datenübertragung<br />
via Glasfaser verdeutlicht. Die Modulation<br />
des Lichts, durch die die Datenübertragung<br />
erst möglich wird, kann durch Veränderung der<br />
Frequenz, der Intensität, der Phase oder der Polarisation<br />
geschehen. Nachdem Dr. Jamshidi die<br />
Strahlen- und Wellenoptik abgehandelt hatte,<br />
ging er noch kurz auf die Quantenoptik ein und<br />
bat abschließend um ein kurzes Feedback, das<br />
verdientermaßen sehr positiv ausfiel.<br />
Damit war der Kurs offiziell zu Ende. Einige interessierte<br />
MINTler durften dann noch zusammen<br />
mit Andrzej Wiatrek die Glasfaserkabel begutachten.<br />
Katrin und ich durften unter Anleitung<br />
zwei Faserenden „zusammen spleißen“. Dafür<br />
legt man beide Enden in eine hochpräzise Maschine,<br />
die die Kabel erst sehr genau justiert und<br />
dann mit einem Lichtbogen verschmilzt.
EIn tag Im ausbIldungszEntRum<br />
dER tElEkom bERlIn<br />
dEutschE tElEkom ag<br />
Die Teilnehmenden des Kurses Nummer 10 verbrachten<br />
einen Tag im Ausbildungszentrum der<br />
Telekom in Berlin Lichterfelde-Ost. Das Thema<br />
hieß „Technik zum Anfassen und Erleben“.<br />
Wir, 10 Schülerinnen und Schüler und zwei<br />
Lehrkräfte, fuhren morgens um 8.17 Uhr mit der<br />
Regionalbahn nach Lichterfelde-Ost. Dort wurden<br />
wir dann vom Projektleiter am Bahnhof abgeholt<br />
und zum Gebäude der Telekom geführt und bekamen<br />
die verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten<br />
im Betrieb der Telekom vorgestellt.<br />
Nach einer kurzen Sicherheitseinführung konnten<br />
wir unser praktisches Können unter Beweis<br />
stellen. Unser Ziel war es, eine Telefonleitung<br />
funktionsfähig zu machen. Wir begannen mit<br />
dem Anschließen der Leitung am Hauptverteiler<br />
(HVT). Um die Verbindung herzustellen, mussten<br />
wir verschiedenfarbige Adern in der richtigen<br />
Reihenfolge, unter Beachtung der Markierungen<br />
anbringen (rot, grün, grau, gelb, weiß; ohne Markierung<br />
(1a), einfache Markierung (1b), zweifache<br />
Markierung mit großem Abstand (2a) und zweifache<br />
Markierung mit kleinem Abstand (2b)).<br />
Als nächstes ging es ans Reparieren der Untergrundleitungen,<br />
die extra für uns gekappt worden<br />
waren. Dies konnten wir in Zweiergruppen in zwei<br />
verschiedenen Möglichkeiten ausprobieren: Die<br />
erste Variante war das Sortieren der Adern auf<br />
Spleißkämme. Dadurch wurden die getrennten<br />
Adern wieder zusammengeführt. Bei der zweiten<br />
Variante wurden die komplementären Adern durch<br />
Einmalverbinder (Upsen) zusammengefügt.<br />
Zum Schluss konnten wir die Verbindung zur TAE<br />
(Telefon-Anschluss-Einheit) herstellen. Dazu wurden<br />
die verschiedenen Adern in der oben genannten<br />
Reihenfolge angebracht. Als letzten Schritt<br />
verbanden wir die Adern durch vier rote Adern mit<br />
einer Stromdose (Wohnung). Der anschließende<br />
Anruf vom HVT zur TAE ergab, dass wir erfolgreich<br />
eine Telefonleitung hergestellt hatten.<br />
Nach einer Pause ging es mit einem kleinen<br />
Vortrag über Bluetooth weiter. Hierzu gab es auch<br />
ein Handout. Im Anschluss erfuhren wir, wie man<br />
eine Internetverbindung herstellt und wie man<br />
T-Home-Entertainment nutzt. Als letztes hatten<br />
die Veranstalter ein lustiges Quiz vorbereitet, um<br />
unser neu erworbenes Wissen zu testen.<br />
Insgesamt war der Tag ein kreativer, lustiger<br />
und informativer Tag, bei dem wir SchülerInnen<br />
auch selbst Hand anlegen konnten.<br />
SchülerInnen: Viktoria Aust, Ansgar Böttcher, Mike Brenner, Jan Burhenne, Deborah Eckern, Peter Finger, Bruno Heller, Sebastian Hobert,<br />
Ralf Mahnke, Liselotte Preu, Matthias Richardy, Carolin Scheele, Jacob Tiedemann, Nils Zottmann | Lehrkräfte: Ulrich Hornung, Dr. Michael Savoric,<br />
Thorsten Vogelsang<br />
kuRs s10<br />
Seite 21
kuRs s11 gEstEInE und mInERalE<br />
Seite 22<br />
musEum FÜR natuRkundE<br />
Wir, das ist der Kurs S11 Mineralien und Gesteine,<br />
haben unser Projekt im Museum für Naturkunde<br />
in Berlin durchgeführt. Geleitet wurde dieser Kurs<br />
von dem Mineralogen und Planetologen Herrn<br />
Dr. Ralf-Thomas Schmitt.<br />
Zunächst haben wir einen Vortrag als Einführung<br />
in unser Thema gehört, mit genauen<br />
Definitionen einzelner Fachbegriffe: Was zum<br />
Beispiel ist ein Mineral und was nicht? Auch<br />
Erläuterungen, wie zum Beispiel die Benennung<br />
und Klassifizierung von Mineralien wurden uns<br />
gegeben. Nach dem Vortrag konnten wir dann<br />
Fragen stellen. Danach hat sich unsere Gruppe<br />
getrennt. Ein Teil hat sich die größte Mineraliensammlung<br />
Deutschlands mit Fundstücken von<br />
Humboldts Südamerikareise im 18 Jhd. angesehen<br />
Schülerstatement<br />
„Es war eine tolle Möglichkeit, einen Tag mit einem Spezialisten mit<br />
diesem Thema zu verbringen, der einem alle Fragen beantworten<br />
konnte und seine Leidenschaft zu Gesteinen und Mineralen auf uns<br />
übertrug. Durch die Einführung am Anfang wurde das Interesse<br />
geweckt und die, für uns unklaren Sachzusammenhänge sind im Laufe<br />
des Tages durch eigenes Forschen verständlich geworden. Das hat<br />
uns sehr gefallen, da wir am Ende des Tages selbst zu kleinen<br />
„Spezialisten“ herangewachsen waren.“<br />
Mathilda Knoblauch und nikola Künder<br />
Lehrerstatement<br />
„Der Kurs war sehr gut auf die Zielgruppe ausgerichtet (z. B. vertiefendes<br />
Stationenlernen). Er bot am Rasterelektronenmikroskop Einblicke<br />
in modernste Untersuchungstechniken. Beeindruckend war der Blick<br />
hinter die Kulissen der Mineraliensammlung mit 250.000 Stücken, die<br />
u. a. von Humboldt gesammelt worden waren. Die Bedeutung des<br />
Fachgebietes wurde am Beispiel einer Graphikkarte veranschaulicht.<br />
Einziger Kritikpunkt: Zu wenig Zeit. Gesamtbeurteilung: Der Kurs war<br />
interessant und man hat viel gelernt.“<br />
Dorothee telligmann und Dr. Jörg Kreutz<br />
und dem anderen Teil wurde im Labor von einer<br />
Mitarbeiterin erklärt, wie man mit Hilfe eines<br />
Rasterelektronenmikroskops mit eingebautem<br />
Spektrometer einzelne Mineralien eines Gesteins<br />
bestimmen kann. Später wurden die Teilgruppen<br />
dann getauscht.<br />
Anschließend ging es zur Stationsarbeit. Dort<br />
gab es vier Stationen, an denen wir verschiedene<br />
Aufgaben erledigten mussten. Mit Hilfe von Mikroskopen<br />
bestimmten wir Mineralien. Zum Teil<br />
bestanden die Gesteine aus mehreren verschiedenen<br />
Mineralien, wobei wir Mineralien auf Grund<br />
ihrer Kristallform bestimmten, und wir haben<br />
diese zum Teil nachgebastelt. Auch geologische<br />
Vorgänge, wie Aufschmelzung (Anatexis) oder<br />
Metamorphose wurden von uns betrachtet, bei<br />
denen unter ganz bestimmten Bedingungen, wie<br />
Druck und Temperatur, aus einem Mineral oder<br />
Gestein ein Neues entsteht. Als Beispiel hierfür<br />
sei die Umwandlung von Kalkstein zu Marmor<br />
genannt. An der vierten und letzten Station haben<br />
wir Mineralien in einem Gesteinsdünnschliff<br />
unter dem Mikroskop mit verschiedenen Polarisationsfiltern<br />
betrachtet und das entstandene Bild<br />
nach Art der Mineralogen in mikroskopischen<br />
Zeichnungen festgehalten.<br />
Danach ging es noch einmal in die Sammlung,<br />
wo Herr Dr. Schmitt einige Mineralien, wie zum<br />
Beispiel Gold, Silizium oder Blei bereitgelegt hatte,<br />
deren Elemente heutzutage in jedem Handy,<br />
Computer oder MP3-Player zu finden sind. Auch<br />
die genaue Verwendung dieser Mineralien wurde<br />
uns anschaulich erläutert.<br />
Danach war das eigentliche Projekt beendet,<br />
jedoch hatten wir Freikarten für das Naturkundemuseum<br />
bekommen, die wir natürlich nicht<br />
verschwendet haben.<br />
SchülerInnen: Annika Reinhold, Christine Grabatin, Ann-Kathrin Lemke, Linda Hollenbeck, Franziska Geiger, Martha Majewski, Christopher Henze,<br />
Lorenz Schröder, Mathilda Knoblauch, Nikola Künder, Cidem Acar, Stefan Ullrich | Lehrkräfte: Dr. Jörg Kreutz, Dorothee Telligmann
vERhaltEns- und nEuRobIologIE<br />
natlab dER FREIEn unIvERsItät bERlIn<br />
Zunächst erfolgte eine kurze Einführung von der<br />
Leiterin Dr. Petra Skiebe-Corrette zur Konzeption<br />
von Schülerlabors.<br />
v1: Die extrazelluläre ableitung vOn<br />
MeChanOSenSOriSChen neurOnen DeS<br />
SChabenbeinS<br />
Das Bein einer Küchenschabe wurde auf einem<br />
Styroporkissen mit Stecknadeln fixiert. An die<br />
Nadeln wurden Elektroden angeschlossen, diese<br />
waren über einen Verstärker mit einem Rechner<br />
und einem Lautsprecher verbunden. Mit Hilfe<br />
eines Computerprogramms war es möglich, die<br />
Potenzialänderungen nicht nur akustisch wahrzunehmen,<br />
sondern ihre Frequenz und Amplitude<br />
auch graphisch darzustellen. Das experimentelle<br />
Arbeiten hat uns allen viel Spaß gemacht. Wir<br />
durften selbstständig arbeiten, theoretische Erklärungen,<br />
die zum Verständnis nötig waren,<br />
wurden jedoch nicht vernachlässigt.<br />
v2: Die rüSSelreflex-KOnDitiOnierung<br />
bei hOnigbienen<br />
„Ist es überhaupt möglich eine Biene zu „dressieren“<br />
und wenn ja, wie?“. Wir steckten unsere<br />
ersten Testbienen in vorbereitete Röhrchen. Dafür<br />
wurde die jeweilige Biene isoliert und gekühlt.<br />
Wenn sie dann bewegungsunfähig war, wurden<br />
sie in kleinen Röhrchen fixiert, so dass nur der<br />
Kopf frei war. Zur Verfügung hatten wir Zuckerwasser,<br />
welches einen künstlichen Nektar darstellt.<br />
Jede Gruppe hatte eine große Spritze, mit<br />
der ein Luftstrom erzeugt wurde. Das Ziel war es<br />
den Rüsselreflex (Ausrollen des Rüssels) zu erzeugen,<br />
ohne dass Zuckerwasser vorhanden war.<br />
Durch Vorwärts- und Rückwärtskonditionierung<br />
testeten wir, welche erfolgreicher war. In der Lernphase<br />
wurden je zwei Bienen mit Luftstrom und<br />
in der Folge mit Zuckerwasser konfrontiert. Das<br />
waren unsere CS-US-Bienen, sie wurden vorwärts<br />
konditioniert. Zwei andere Bienen wurden erst<br />
mit dem Zuckerwasser und dann mit Luftstrom<br />
behandelt, das waren unsere US-CS-Bienen, also<br />
rückwärts konditioniert. Die letzten zwei Bienen<br />
waren Testbienen, um sicherzustellen, dass unsere<br />
Bienen auf das Zuckerwasser reagieren. Sie<br />
wurden nur mit Zuckerwasser konfrontiert.<br />
Die statistische Auswertung der Ergebnisse ergab<br />
ein signifikantes Ergebnis. Der Rüsselreflex<br />
der Biene kann nur über die Vorwärtskonditionierung<br />
erfolgreich erreicht werden.<br />
Besonders gut hat uns gefallen, dass uns mal<br />
ein praktischer Einblick in das Leben eines Wissenschaftlers<br />
geboten wurde. Die Arbeit mit den<br />
Bienen war sehr interessant, doch zeigte sie uns<br />
auch den Alltag von Naturwissenschaftlern.<br />
v3: Die extrazelluläre ableitung an einer<br />
ganglienzelle Der retina<br />
Das dritte Experiment beschäftigte sich mit<br />
den Ganglienzellen der Netzhaut. Allerdings war<br />
unser „Auge“ nur ein Computerchip, der Ganglienzellen<br />
entsprach. Mithilfe dieses Chips simulierten<br />
wir das sensorische Verhalten einer Katze,<br />
die unterschiedlich große Formen wahrnehmen<br />
sollte. Die zu Beginn des Versuches aufgestellten<br />
Hypothesen bestätigten sich teilweise im Laufe<br />
des Experimentes. Der Versuch zeigte uns einen<br />
Einblick in die Forschungsarbeit zum optischen<br />
System, um bestimmte Formen der Blindheit beheben<br />
zu können. Nachdem die Energiereserven<br />
beim Mittagessen wieder aufgefüllt waren, stellten<br />
die Gruppen der Versuche 1–3 ihre Ergebnisse<br />
der Gesamtgruppe vor. Dies erfolgte mit<br />
Hilfe einer kurzen PowerPoint Präsentation und<br />
bot den anderen TeilnehmerInnen des Kurses die<br />
Gelegenheit Rückfragen zu stellen.<br />
Insgesamt ein toller Tag mit praktischen Einblicken,<br />
wie sie in der Schule meist nicht möglich<br />
sind. Dankeschön an das Team vom NatLab!<br />
SchülerInnen: Joline Dörr, Theresa Vasko, Elisabth Weyandt, Carolin Haupts, Daniel Baran, André Schnatz, Pia Bischoff, Alexander Klein, Deborah Eckern,<br />
Annika Hansen, Jörg Ackermann, Paul Suske, Marcel Bisanz, Karolin Leitenberger, Anna Baumann, Friederike Bartels, Lea Schmidtke, Jenny Jacob, Mathias Wendt<br />
Lehrkräfte: Judith Plaum, Elisabeth Hilt-Seibring, Karin Keilich, Frank Pfeiffer<br />
kuRs s12<br />
Seite 23
kuRs s13<br />
Seite 24<br />
nanochEmIE<br />
natlab dER FREIEn unIvERsItät bERlIn<br />
Der Kurs war in zwei Bereiche geteilt. Eine Gruppe<br />
beschäftigte sich mit dem Rastertunnelmikroskop.<br />
Bei unserem Versuch zur Oberflächenstrukturanalyse<br />
von Nanoteilchen mit dem Rastertunnelmikroskop<br />
(RTM) lernten wir zunächst die Theorie<br />
und Funktionsweise des Gerätes kennen.<br />
Wir untersuchten als Erstes die Detektornadel.<br />
Zwischen ihr und der zu untersuchenden Probe<br />
liegt eine Spannung an. Die Nadel wird in einem<br />
konstanten Abstand über die Probe bewegt, aufgrund<br />
des quantenmechansichen Tunneleffekts<br />
kann nun zwischen Nadel und Probenoberfläche<br />
ein Strom fließen. Über die verschiedenen Stromstärken,<br />
die dabei fließen, errechnet ein Computer<br />
ein Bild der Oberfläche. Wir lernten, wie man<br />
die einige Millimeter lange Messnadel vor ihrem<br />
Einsatz präparieren muss und wie diese in das<br />
Mikroskop eingesetzt wird.<br />
Danach setzten wir unsere erste Probe, eine<br />
Goldfolie ein und starteten das Mikroskop. Die<br />
Grafik zeigte eine sehr ungleichmäßige und unebene<br />
Fläche.<br />
Die zweite Probe war eine Graphitschicht. Dieser<br />
Versuch klappte auch nach mehreren Anläufen<br />
nicht, da zu viele Störfaktoren die Messung beeinträchtigten<br />
(Temperaturschwankungen, Schall,<br />
Erschütterungen durch elektrische Geräte oder<br />
Menschen), die Aufnahme war verschwommen.<br />
Bei dem dritten Versuch trugen wir Titan dioxid-<br />
Nanopartikel auf einen Goldfilm auf und untersuchten<br />
die Struktur der Nanopartikel. Auch dieser<br />
Versuch klappte aufgrund der vielen Störfaktoren<br />
nur sehr schlecht und es kam ein sehr schlechtes<br />
Bild dabei heraus.<br />
Da unsere Aufnahmen nicht die gewollten Ergebnisse<br />
brachten, zeigte unser Gruppenleiter<br />
besser gelungene Bilder. Bei diesen sah man<br />
eine Art Wolkenstruktur bei Gold und eine sehr<br />
gleichmäßige Berg-Tal-Struktur bei Graphit.<br />
Die zweite Gruppe behandelte Gold- und<br />
Silbernanopartikel.<br />
Aus den Metallsalzen Silbernitrat und Tetrachlorgoldsäure<br />
stellten wir Goldsilberpartikel<br />
erfolgreich und Goldpartikel teilweise erfolgreich<br />
her. Im UV/VIS Spektrum ließen sich Abweichungen<br />
vom Idealwert feststellen. Ideal wären<br />
498nm gewesen, unsere Teilchen wiesen einen<br />
Wert von 510nm auf. Wir haben gelernt, dass<br />
Gold nicht alles ist was glänzt.<br />
SchülerInnen: Jana Fechner, Christopher Knopf, Tugce Dinc, Melis Aydin, Nora Schneider, Raphaela Acht, Nazli Deniz Bulutlar, Tim Baumeister,<br />
Benedikt Herget, Lara Jennen, Friederike Söchting, Philip Wilken | Lehrkräfte: Patrick Schnell, Karin Jabs, Dr. Regine Schütt
mathEmatIk - von abstRakt bIs gREIFbaR<br />
dFg FoRschungszEntRum mathEon<br />
Beim Kurs S14 wurde den Teilnehmenden die<br />
praktische Seite der Mathematik näher gebracht.<br />
Mithilfe der Graphentheorie werden z. B. U-Bahnpläne<br />
gestaltet. Die SchülerInnen hatten auch<br />
die Möglichkeit, das 3D-Labor zu besichtigen<br />
und erhielten dadurch einen guten Einblick in<br />
die Arbeit des Matheon.<br />
SchülerInnen: Kerstin Saul, Marvin Strätz, Markus Kapsch, Lisa Göbel, Rupert Fraunhofer, Fabian Zelesinski, Laura König, Markus Borsch,<br />
Christian Pohler, Theis-Luca Hülsebus, Lukas Löthmeier, Moritz Danzer, Julia Kage, Patrick Deppe, Réka Tóth, Christopher Heyder, Alexander Patz,<br />
Tilman Aleman, Carl-Friedrich Werring, Felix Schröder | Lehrkräfte: Annekatrin Jäkel, Kurt Wiens, Gabriele Denkhaus<br />
kuRs s14<br />
Seite 25
kuRs s16<br />
Seite 26<br />
computER gRaphIcs - stopmotIon-FIlm<br />
tEchnIschE unIvERsItät bERlIn (tu)<br />
Am besten lässt sich unser Kurs unter der Überschrift<br />
„Sechs Stunden für zehn Sekunden“ zusammenfassen,<br />
denn das Ziel des Kurses im<br />
Fachbereich Elektrotechnik/Informatik an der<br />
TU Berlin war das Erstellen eines 10 Sekunden<br />
langen StopMotion-Films. Erwartet hatten wir<br />
viel Theorie und intensives Arbeiten am Computer,<br />
doch es sollte anders kommen. Nachdem<br />
die Wenigsten von uns den Begriff StopMotion<br />
kannten, erklärte unsere Kursleiterin zunächst,<br />
dass es sich dabei um eine Trickfilm-Technik<br />
handelt, bei der Unbewegliches beweglich gemacht<br />
wird. Typische Beispiele hierfür sind die<br />
animierten Knetmasse-Figuren in der Sendung<br />
mit der Maus und das berühmte Sandmännchen,<br />
aber auch in Werbe- und Kinofilmen wird diese<br />
Technik oft eingesetzt.<br />
Bevor wir mit unserer Aufgabe beginnen konnten,<br />
wurden wir in drei Gruppen aufgeteilt, in<br />
denen wir uns jeweils eine Story für den Film<br />
überlegen durften. Diese Ideenfindung musste<br />
schnell gehen, damit uns genug Zeit blieb, die<br />
erforderlichen 250 Fotos zu schießen, da eine<br />
Sekunde Film aus 25 Einzelbildern besteht. Um<br />
unsere Ideen in die Tat umsetzen zu können, bekamen<br />
wir als Arbeitsmaterial Knetmasse gestellt,<br />
aber auch die für uns als „Nervennahrung“ gedachten<br />
Gummibärchen und Salzstangen waren<br />
willkommene Requisiten.<br />
Lehrerstatement<br />
„Dieser speziell für Mädchen konzipierte Kurs war ein gelungenes<br />
Beispiel dafür, wie anhand einer praxisnahen Aufgabenstellung das<br />
Vorurteil „Frauen und Technik passen nicht zusammen“ widerlegt<br />
werden kann. Die engagierte Zusammenarbeit der Schülerinnen zeigte<br />
deutlich, dass Technik nicht trocken sein muss, sondern in Verbindung<br />
mit Kreativität und Geschicklichkeit sogar viel Spaß machen kann.“<br />
Kurt Peteler, lise-Meitner-gymnasium unterhaching<br />
Nach dem Mittagessen in der Mensa legten wir<br />
sofort mit den „Dreharbeiten“ los. Dabei war zu<br />
beachten, dass die einmal eingestellte Digitalkamera<br />
nicht mehr bewegt werden durfte, so dass<br />
die Lichtverhältnisse konstant blieben. Schon<br />
die kleinste Positionsänderung der Kamera oder<br />
wechselnde Lichtverhältnisse hätten zur Folge<br />
gehabt, dass wir das Projekt hätten wieder von<br />
vorne beginnen müssen. Unsere Fingerfertigkeit<br />
und unsere Geduld wurden auf eine harte Probe<br />
gestellt, da sich Position und Form der Knetfiguren<br />
von Bild zu Bild nur um wenige Millimeter<br />
verändern durften. Aber am Ende hatte dann<br />
doch jede Gruppe alle Fotos „im Kasten“, die<br />
anschließend mithilfe einer speziellen Software<br />
zu einem Film zusammengefügt wurden. Leider<br />
war die Zeit zu knapp, um uns auch mit dieser<br />
Software vertraut zu machen, deshalb übernahm<br />
unsere Kursleiterin die Konvertierung. Die Freude<br />
war riesig, als wir die Produkte dieses kreativen<br />
und spaßreichen Tages in Form unserer fertigen<br />
Filme endlich sehen konnten.<br />
Besonders gefreut hat uns, dass Herr Burde<br />
die Premiere unserer drei Filme „Pacman und<br />
das Brandenburger Tor“, „Killerkugeln“ und<br />
„Frohes Fest“ noch am gleichen Tag auf der<br />
Abendveranstaltung im Rathaus Schöneberg in<br />
Anwesenheit aller MINT300-TeilnehmerInnen<br />
möglich machte.<br />
SchülerInnen: Isabel Ashoff, Martina Wycisk, Joana Stifft, Carola Spieß, Sophia Stahl, Johanna Siebelmann, Elena Padeffke, Carina Hergesell,<br />
Friederike Kahlow, Isabel Becker, Lisa Valentin, Jennifer Storbeck, Lisa Sontowski | Lehrkräfte: Katrin Kupfer,Kurt Peteler
laboRtag magnEtFEld dER ERdE<br />
dEutschE gEoFoRschungszEntRum, potsdam (gFz)<br />
In einem einleitenden Vortrag erklärte uns Dr. Wigor<br />
Webers die große historische Bedeutung des<br />
Geländes und führte uns auch sehr verständlich<br />
in die Hauptforschungsfelder und Methoden der<br />
Geophysik ein, wobei natürlich ein großer Fokus<br />
auf dem Erdmagnetismus lag: Uns wurde erklärt,<br />
wie etwa Magnetometer funktionieren, wo diese<br />
die besten Messdaten liefern und wie man aus<br />
diesen Messdaten Schlüsse auf Rohstoffablagerungen<br />
ziehen kann. Dr. Webers Begeisterung<br />
für sein Fachgebiet übertrug sich dann schnell<br />
auf den Großteil der Gruppe, sodass wir voller<br />
Erwartungen in den Laborteil des Tages gingen:<br />
Es gab drei verschiedene Versuche, die wir in<br />
Gruppen nacheinander durchführten.<br />
Der erste Versuch drehte sich um das Magnetometer,<br />
das sich außerhalb des Gebäudes befand.<br />
Wir untersuchten den Einfluss, den eine mit Strom<br />
durchflossene Spule, abhängig von ihrer Entfernung<br />
zum Magnetometer, auf die Messdaten hat.<br />
Obwohl wir klare Ausschläge in der Messkurve<br />
erwarteten, konnten wir in den Ergebnissen eigentlich<br />
nichts erkennen. Nachdem wir die Werte<br />
für nur genau die Zeitpunkte, an denen der Strom<br />
an war, zusammengetragen hatten, konnten wir<br />
dann doch bestätigen, dass die Spule einen größeren<br />
Einfluss auf die Messdaten hat, wenn sie<br />
sich näher am Messgerät befindet.<br />
Im zweiten Versuch bestimmten wir, mit nicht<br />
viel mehr als einer speziellen Spule und einem<br />
Kompass, die Horizontalintensität des Erdmagnetfeldes.<br />
Die mit Strom durchflossene Spule bildete<br />
ihr eigenes Magnetfeld, dessen Richtung genau<br />
einen rechten Winkel zum Erdmagnetfeld bildete.<br />
Da wir die Feldstärke des künstlichen Magnetfeldes<br />
berechneten, konnten wir über die Änderung<br />
des Ausschlages der Kompassnadel dann die<br />
Stärke des Erdmagnetfeldes berechnen.<br />
Für den dritten Versuch mussten wir uns auf das<br />
verschneite Gelände wagen. Mit zwei verschiedenen<br />
Messmethoden konnten wir das Magnetfeld<br />
auf einem Acker messen, auf dem „Bodenschätze“<br />
vergraben worden waren. Über unsere<br />
Messungen konnten wir dann Rückschlüsse ziehen,<br />
wo wir zu graben hatten.<br />
Zusätzlich konnten wir uns auch den großen<br />
Refraktor des Astrophysikalischen Observatoriums<br />
Potsdam angucken, der 1899 als erster<br />
seiner Art gebaut wurde. Heutzutage ist er als<br />
Teleskop nicht mehr im Einsatz, aber angesichts<br />
der eisigen Außentemperaturen konnten wir gut<br />
nachvollziehen, welchen Einsatz Generationen<br />
von Wissenschaftlern gezeigt haben :-).<br />
Durch die wunderschönen alten Gebäude wurde<br />
schon eine Atmosphäre von Wichtigkeit geschaffen,<br />
aber besonders durch die sehr enthusiastischen<br />
Veranstalter, besonders Herr Dr. Webers,<br />
der jede Frage gerne beantwortete und uns<br />
nie das Gefühl gab, wir würden stören oder wären<br />
am falschen Platz, wurde es für uns ein überaus<br />
interessanter und unvergesslicher Tag.<br />
kuRs s17<br />
Schülerstatement<br />
„Der Tag im GFZ hat mir richtig viel Spaß gemacht. Eigentlich habe ich mit<br />
Physik gar nichts zu tun, aber es war echt interessant und ich hab vieles<br />
gelernt. Ich war begeistert :). Ich würde dort gern noch einmal hin fahren<br />
und vielleicht in einen anderen Bereich, z. B. Erdbebenforschung oder<br />
Meteorologie, hineinschauen wollen.“<br />
franziska britze<br />
SchülerInnen: Frederik Johnen, Benjamin Ruppik, Franziska-Daniela Britze, Alexander Janocha, Richard Peters, Karl Hartmann, Judith Plenter,<br />
Tom Elfering, Inka Bürger, Sarah Kellermann, Tatjana Wolters, David Carnal, Robin Pohland, Sönke Wengler-Rust, Jan Sihler, Maurus Wollensack,<br />
Abra Aminpoor, Clara Schenk, Adrian Bandera, Tobias Seibert | Lehrkräfte: Ulrich Hornung, Elke Entenmann, Margret Buse<br />
Seite 27
kuRs s18 FaRbwahl mIt lEuchtdIodEn<br />
Seite 28<br />
tu bERlIn<br />
Zuerst würde ich gerne hervorheben, dass mir<br />
die Veranstaltung MINT300 sehr gut gefallen<br />
hat und dass der Aufenthalt in Berlin sehr angenehm<br />
war. Es war eine Möglichkeit, dem täglichen<br />
Schulleben für ein paar Tage zu entfliehen,<br />
Berlin kennenzulernen, und neue Erfahrungen<br />
sowie neues Wissen mitzunehmen.<br />
Am Freitag hatte ich zusammen mit Christian<br />
Kalinowski den Kurs 18, welcher das Thema der<br />
Leuchtdioden behandelte, gewählt. Dieser war<br />
sehr ansprechend, da man auch ohne viele Vorkenntnisse<br />
das Thema gut verstehen konnte. Der<br />
Kurs wurde von zwei Studierende aus dem Studiengang<br />
der Elektrotechnik gehalten und war<br />
erstaunlich transparent, logisch und verständlich.<br />
Uns wurde zuerst der theoretische Teil beigebracht,<br />
so z. B. was ein Transistor ist und welche<br />
Aufgabe er erfüllt. Nach einer kleinen Mittagspause<br />
hat man uns die Möglichkeit geboten, auf<br />
unserer eigenen Schaltplatine eine Leuchtdiode<br />
zu löten, die in den Farben rot, grün, und blau<br />
leuchten kann. Diese Farben sind in unterschiedlicher<br />
Intensität nach Belieben mischbar und so<br />
erhält man ein weites Spektrum an Farben.<br />
Der Kurs hat mir sehr gut gefallen und meiner Meinung<br />
nach, hätte man sich noch einen weiteren<br />
Tag mit dem Thema beschäftigen können.<br />
Rückblickend gesehen, war die Veranstaltung<br />
MINT300 ein sehr gelungenes Projekt, um neues<br />
Wissen zu erlangen, neue Menschen, die auch<br />
naturwissenschaftlich interessiert sind, kennenzulernen<br />
und einen Eindruck von dem Stadtleben<br />
Berlins zu erhalten. Ich würde gerne wieder bei<br />
der nächsten Veranstaltung dabei sein und kann<br />
es Jedem nur empfehlen.<br />
SchülerInnen: Jonas Pohl, Philip Arnold, Sarina Becker, Miriam Neumann, Annika Hasselhorn, Julian Seiler, Felix Kumor, Alexander Batoulis,<br />
Johannes Hain, Leonard Gura, Phillip Zimmermann, Christian Kalinowski | Lehrkräfte: Thomas Kerschner, Dr. Ulrich Strobel, Michael Gottschlich
EIn tag In dER bundEsdRuckEREI<br />
bundEsdRuckEREI gmbh<br />
Nach einer leicht verspäteten Anreise erreichte<br />
die Gruppe die Bundesdruckerei und wurde an der<br />
Pförtnerloge in Empfang genommen. Sicherheitsgemäß<br />
wurden alle Personalien aufgenommen<br />
und die Handys verschlossen. Fotoverbot.<br />
In einem Showroom wartete bereits eine größere<br />
Anzahl an Personen, was bei allen SchülerInnen<br />
sichtlich Eindruck machte. Die Informationen<br />
über die Berufschancen bei der Bundesdruckerei<br />
– Ausbildung, während des Studiums als WerkstudentIn,<br />
Einstellung nach abgeschlossenem<br />
Studium (z. B. Informatik) – gaben einen guten<br />
Einblick in die Vielzahl der Möglichkeiten, die<br />
dieses Unternehmen bietet.<br />
Anschließend begann die „Show“ und einige<br />
fiktive Reisepässe wurden erstellt. Sehr anschaulich<br />
das Ganze. Eine Simulation über die Check-<br />
In-Formalitäten an Flughäfen zeigte, wie wichtig<br />
IT auch in solchen Bereichen sein kann. Digitale<br />
Reisepässe bieten hier viele Möglichkeiten, was<br />
allen TeilnehmerInnen klar wurde.<br />
Auf langen Wegen herum und „top secret“–<br />
Bereiche ging es zum Mittagessen. Anschließend<br />
wurde den SchülerInnen die Produktion von Reisepässen<br />
sehr detailliert gezeigt.<br />
Alles in allem zeigte der „Tag in der Bundesdruckerei“<br />
gute Einblicke in die verschiedenen<br />
Tätigkeiten der dort Beschäftigten. Was auf den<br />
ersten Eindruck wenig abwechslungsreich klingt,<br />
offenbart doch zahlreiche Herausforderungen,<br />
insbesondere im IT-Bereich.<br />
Die zuständigen Personen der Bundesdruckerei<br />
führten sehr nett und informativ durch den Tag<br />
und waren jederzeit für alle KursteilnehmerInnen<br />
ansprechbar. Das Infoprogramm war angemessen,<br />
eine höhere Schülerbeteiligung wäre schön<br />
gewesen, wobei dies bei den Sicherheitsstandards<br />
des Unternehmens sicher nicht leicht zu<br />
bewerkstelligen ist.<br />
SchülerInnen: Miriam Wendel, Angelina Jakoby, Laura Kühn, Mareike Gödert, Martina Beltran, Jennina Man, Marion Wallek, Timo Egenolf,<br />
Huyen Kieu, Daria Doncevic, Linh Dong, Felix Lücke | Lehrkraft: Norbert Kouker<br />
kuRs s19<br />
Seite 29
Seite 30<br />
statIstIschEs<br />
schÜlERInnEn und schÜlER bEwERtEn mInt300<br />
MINT300 ist ein erfolgreiches Format, welches<br />
insbesondere drei Zielen dient:<br />
Intensive Arbeit in einem MINT-Kurs<br />
Beförderung des Austauschs der<br />
Schülerinnen und Schüler<br />
Berufs- und Studienorientierung<br />
All dies in einem kompakten Programm, welches<br />
zwei Tage dauert. Wie in der Einleitung erwähnt,<br />
findet die MINT300 alle zwei Jahre statt und wurde<br />
nun zum vierten Mal ausgerichtet. Dabei sind<br />
uns bei der Evaluation einige Punkte aufgefallen,<br />
die möglicherweise nicht nur unsere Arbeit im<br />
Bereich der Schülerveranstaltungen tangieren<br />
werden. Wir nehmen einen Trend wahr, der nachstehend<br />
auch kurz interpretiert werden soll.<br />
Die Zustimmung zur Gesamtveranstaltung befindet<br />
sich nach wie vor auf exzellentem Niveau.<br />
Auf die Frage, wie den Schülerinnen und Schülern<br />
die Gesamtveranstaltung gefallen hat, antworten<br />
60 % mit „gut“ und 34 % mit „hervorragend“.<br />
Damit liegen wir bei einer Zustimmung von über<br />
90 %. Auch die Zustimmung zu den Kursangeboten<br />
ist beeindruckend hoch. Obgleich wir uns hier<br />
auf dem Niveau der Auswertung des Jahres 2007<br />
befinden, ist beispielsweise die Zustimmung zur<br />
Auftaktveranstaltung gesunken. Dies beinhaltet<br />
jedoch nicht den Bildungsmarkt.<br />
Interessant sind insbesondere die zu den Vorjahren<br />
bestehenden Abweichungen. Den Aussagen<br />
„Ich kann mir nach der MINT300 eher<br />
vorstellen, im MINT-Bereich zu arbeiten bzw. zu<br />
studieren“ haben ebenso weniger Schülerinnen<br />
und Schüler zugestimmt, wie der Aussage „Die<br />
Veranstaltung hat mich bestärkt, MINT-Fächer in<br />
der Schule stärker zu berücksichtigen“.<br />
Auch wenn die Zustimmung insbesondere zu<br />
letzterer Frage noch bei ausgezeichneten 70 %<br />
liegt, so sehen wir hier einen Trend, den wir auch<br />
in unseren MINT-Camps bemerken und den wir<br />
thesenhaft formulieren wollen:<br />
Schülerinnen und Schüler nehmen deutlich<br />
früher eine Differenzierung vor und legen<br />
sich auf ein Gebiet – in unserem Falle<br />
MINT – fest<br />
Dadurch wird die Gesamtschülerschaft<br />
früher heterogen<br />
Es wird zunehmend schwieriger Schülerinnen<br />
und Schüler zu erreichen, die sich möglicherweise<br />
noch für MINT begeistern lassen, die<br />
aber noch unentschieden sind.<br />
Insbesondere letzterer Punkt beschäftigt auch<br />
den Verein MINT-<strong>EC</strong>. Und so versuchen wir Wege<br />
zu finden, auch Schülerinnen und Schüler zu erreichen,<br />
die sich noch im Entscheidungsprozess<br />
befinden. Wir meinen, da wir mehr und mehr klar<br />
fokussierte Schülerinnen und Schüler auf unseren<br />
Veranstaltungen wahrnehmen, dass dies möglicherweise<br />
Unentschlossene fernhält, die nicht zu<br />
„100 %“ MINT-affin sind. Möglicherweise gibt es<br />
hier Bedenken, nicht mit den MINT-Interessierten<br />
„mithalten“ zu können. Für diese Zielgruppe wären<br />
unter Umständen andere Formate anzudenken,<br />
wie z. B. Gespräche mit MINT-Professionals aus<br />
der Arbeitswelt, der Forschung oder auch mit<br />
StudentInnen.<br />
Wir möchten diese Annahmen insofern unterstreichen,<br />
als dass die Schülerinnen und Schüler,<br />
die den oben genannten Aussagen nicht zustimmen<br />
konnten, in der überwiegenden Anzahl der<br />
Fälle vermerkten, sie hätten sich ja bereits klar<br />
für MINT entschieden.<br />
Generell sehen wir auch eine zunehmend gerichtete<br />
Haltung der Schülerinnen und Schüler.<br />
Diese resultiert – neben dem Zuwachs an Angeboten<br />
– auch aus den höheren Anforderungen, welche<br />
die Schulzeitverkürzung mit sich bringt. Damit<br />
werden Angebote viel stärker „zielgerichtet“<br />
ausgewählt und Raum für „Neues“ entfällt.
ERgEbnIssE dER EvaluatIon<br />
70 %<br />
60 %<br />
50 %<br />
40 %<br />
30 %<br />
20 %<br />
10 %<br />
0 %<br />
70 %<br />
60 %<br />
50 %<br />
40 %<br />
30 %<br />
20 %<br />
10 %<br />
0 %<br />
70 %<br />
60 %<br />
50 %<br />
40 %<br />
30 %<br />
20 %<br />
10 %<br />
0 %<br />
Die Auftaktveranstaltung am Donnerstag war<br />
a b c d E<br />
Insgesamt fand ich MINT300<br />
a b c d E<br />
Die Programmangebote am Freitag waren<br />
a b c d E<br />
70 %<br />
60 %<br />
50 %<br />
40 %<br />
30 %<br />
20 %<br />
10 %<br />
0 %<br />
70 %<br />
60 %<br />
50 %<br />
40 %<br />
30 %<br />
20 %<br />
10 %<br />
0 %<br />
bewertungen<br />
a: hervorragend<br />
b: gut<br />
C: weniger gut<br />
D: schlecht<br />
e: nichts gewählt<br />
MINT300 2007<br />
MINT300 <strong>2009</strong><br />
bewertungen<br />
f: stimme ich voll zu<br />
g: stimme ich zu<br />
h: stimme ich nicht zu<br />
i: stimme ich gar nicht zu<br />
J: nichts gewählt<br />
Die Veranstaltung hat mich bestärkt, MINT-Fächer<br />
in der Schule stärker zu berücksichtigen<br />
F g h I J<br />
Ich kann mir nach MINT300 eher vorstellen,<br />
im MINT-Breich zu arbeiten bzw. zu studieren.<br />
F g h I J<br />
Seite 31
FREItag - 18. dEzEmbER <strong>2009</strong><br />
Seite 32<br />
abEndvERanstaltung<br />
Im wIlly-bRandt-saal dEs Rathaus schönEbERg<br />
AbLAufpLAn<br />
Anmoderation<br />
> benjamin burde, Geschäftsführer Verein MINT-<strong>EC</strong><br />
Vortrag – „Kriminalbiologie“<br />
> Dr. Mark benecke, Kriminalbiologe<br />
berichte<br />
> Die zuvor gelosten Kurse stellten ihr Programm im Vortrag vor<br />
Abschlussworte<br />
> hannelore wessel-Segebade,<br />
Deutsche Gesellschaft für zerstörungsfreie Prüfung e. V. (DGZfP e. V.)<br />
Abendbuffet und „Come Together“<br />
als Abschluss<br />
performance – feeding the fish<br />
Hannelore Wessel-Segebade
Andrea Czesla, Benjamin Burde, Christina Nenz Feeding the Fish<br />
Seite 33
Seite 34<br />
kontakt<br />
verein <strong>Mint</strong>-eC<br />
Poststraße 4/5<br />
10178 Berlin<br />
Ansprechpartner:<br />
Geschäftsführer<br />
Benjamin Burde<br />
burde@mint-ec.de<br />
Tel.: 030. 40 00 67 31<br />
Fax.: 030. 40 00 67 35
iMPreSSuM<br />
herauSgeber<br />
Verein MINT-<strong>EC</strong> ®<br />
Poststraße 4/5<br />
10178 Berlin<br />
www.mint-ec.de<br />
reDaKtiOn<br />
Christina Nenz<br />
geStaltung<br />
rohloff design, Berlin<br />
www.rohloff-design.de<br />
bilDnaChweiS<br />
Alle Abbildungen:<br />
© Verein MINT-<strong>EC</strong> ®<br />
Berlin, Juni 2010
16. bIs 19. dEzEmbER <strong>2009</strong><br />
www.mInt300.dE<br />
kuRs 01<br />
supRalEItung und magnEtIsmus<br />
hahn-mEItnER-InstItut bERlIn