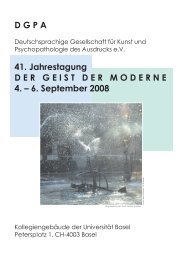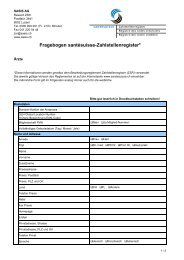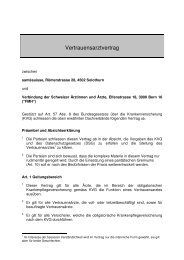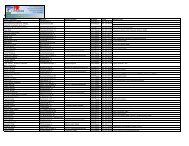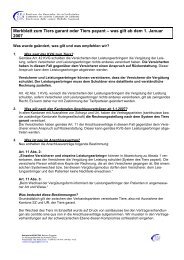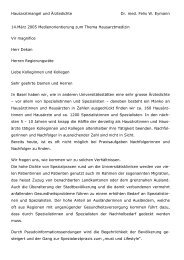Wieso wird das Gespräch am Ende des Lebens zwischen Arzt und ...
Wieso wird das Gespräch am Ende des Lebens zwischen Arzt und ...
Wieso wird das Gespräch am Ende des Lebens zwischen Arzt und ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Patienten über die eigentlichen medizinisch-technischen Details hinaus zu<br />
suchen, währenddem unsere Patienten gleichzeitig eine Autonomie <strong>und</strong> oftmals<br />
eine Unabhängigkeit von uns entwickeln, die auf uns einerseits erschreckend<br />
wirken kann, die aber auch Gr<strong>und</strong>lage sein kann für offene, vertiefte <strong>und</strong> die<br />
echten <strong>Lebens</strong>fragen tangierende <strong>Gespräch</strong>e.<br />
Auch wenn die Akademie der Medizinischen Wissenschaften in ihren 2004<br />
verabschiedeten Richtlinien zur Betreuung von Menschen <strong>am</strong> <strong>Lebens</strong>ende<br />
anerkennt, <strong>das</strong>s <strong>am</strong> <strong>Lebens</strong>ende für den Betroffenen eine unerträgliche Situation<br />
entstehen kann, in der der Wunsch nach Suizidbeihilfe entstehen <strong>und</strong> dauerhaft<br />
bestehen bleiben kann, ist der Wunsch nach assistiertem Suizid für viele von uns<br />
noch ein Tabu, mit dem wir nur äusserst schwer umgehen können.<br />
Nietzsche als Vordenker schrieb in seiner Lehre „vom Sterben zur rechten Zeit“:<br />
„Wenn <strong>das</strong> Werk <strong>des</strong> <strong>Lebens</strong> getan ist, gilt es, dem natürlichen <strong>und</strong><br />
unvernünftigen Tod zuvorzukommen <strong>und</strong> den freiwilligen Tod zu sterben.“<br />
Nun – einerseits bejahen <strong>und</strong> fördern wir die Autonomie unserer Patienten;<br />
dieses wichtigste ethische Prinzip gilt es hochzuhalten; andererseits haben wir<br />
grosse Mühe, mit den Wünschen unserer autonomen Patienten nach<br />
Suizidbeihilfe umzugehen. Immer in solchen Situationen <strong>wird</strong> der Ruf nach<br />
Palliativmedizin laut. Nun – wie Markus Zimmermann vom Institut für<br />
Sozialethik der Universität Luzern in einem vor wenigen Wochen erschienenen<br />
Editorial zu Recht schreibt, schliessen sich eine gut ausgebaute Palliative Care<br />
<strong>und</strong> Suizidbeihilfe nicht aus - Länder wie Holland <strong>und</strong> Belgien bestätigen dies - ,<br />
sondern befördern sich sogar gegenseitig. Schliesslich reagieren beide<br />
Bewegungen mit ganz unterschiedlichen Strategien auf dieselben Probleme,<br />
nämlich Abhängigkeit, Autonomieverlust <strong>und</strong> Leiden <strong>am</strong> <strong>Lebens</strong>ende. Es<br />
werden nur zwei unterschiedliche Wege angeboten, mit der letzten <strong>Lebens</strong>phase<br />
umzugehen – der der palliativmedizinischen Betreuung <strong>und</strong> Begleitung <strong>und</strong><br />
derjenige der <strong>Lebens</strong>verkürzung beispielsweise durch assistierten Suizid.<br />
Tatsache ist, <strong>das</strong>s Abhängigkeit, Autonomieverlust, Pflegebedürftigkeit,<br />
Depressivität, Schmerzen <strong>und</strong> Leiden in unserem Denken heute noch negativer<br />
bewertet werden, als dies früher der Fall war. Sollten wir nicht unseren Kindern<br />
eines Tages sagen dürfen „Ich brauche Hilfe; ich kann nicht mehr alleine zur<br />
Toilette gehen“. Wir möchten diese <strong>Lebens</strong>phase soweit wie möglich<br />
hinausschieben oder gar gänzlich verhindern. Besuche in Pflegeheimen <strong>und</strong> die<br />
Betreuung demenzkranker Menschen lassen gerade uns als Ärzte immer wieder<br />
erkennen, <strong>das</strong>s sich weder für uns noch für die Gesellschaft die Konfrontation<br />
mit Abhängigkeit <strong>und</strong> Autonomieverlust vollständig eliminieren lässt. Auch<br />
wenn wir heute nicht wissen, wie wir selbst derzeit in einer solchen Situation<br />
entscheiden werden – so wir überhaupt dann noch entscheidungs- <strong>und</strong><br />
urteilsfähig sind – ist es wahrscheinlich auch unsere Aufgabe, mit unseren<br />
Patienten <strong>und</strong> deren Angehörigen eine Kultur <strong>des</strong> Wartens auf den Tod zu<br />
entwickeln. Würdiges Sterben bedeutet ja wohl nicht – wie es die<br />
Sterbehilforganisation Dignitas anbietet, die den Begriff der Würde zu ihrem<br />
N<strong>am</strong>en gemacht hat, dem Sterbensprozess möglichst bald ein <strong>Ende</strong> zu setzen,