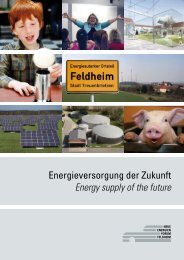Amtsblatt - Treuenbrietzen
Amtsblatt - Treuenbrietzen
Amtsblatt - Treuenbrietzen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Nr. 08/07 - 16 - <strong>Treuenbrietzen</strong>er Nachrichten<br />
Die Johanniter kommen<br />
Wasser von oben und von unten gab es am 7.Mai 2004 beim Saisonstart<br />
im <strong>Treuenbrietzen</strong>er Freibad. Für den Betrieb des Bades ist jetzt die<br />
Johanniter- Unfallhilfe Potsdam zuständig. Zur neuen Mannschaft gehören<br />
neben Heiko MILDNER die Schwimmmeister Gaston PAATZ und Uli<br />
SCHENK. Als Kassiererinnen sind Anneliese ZIMMERMANN und Elke<br />
ANDREAS tätig. (FE,08.05.2004,S.15)<br />
Ein Jahr später gibt es Veränderungen beim Personal. Zwei neue<br />
Schwimmmeister treten die Nachfolge von Heiko MILDNER an. Für die<br />
Pflege des Bades werden Hilfskräfte im Rahmen geringfügiger Beschäftigung<br />
abgestellt. (FE,03.05.2005,S.13).<br />
Uli BASCH erinnert sich<br />
Ulrich BASCH schrieb bereits 1967 über Pläne, in <strong>Treuenbrietzen</strong> ein<br />
Lehrschwimmbecken oder ein Hallenbad zu errichten.<br />
(MVS,04.04.1967,S.5). Noch heute erinnert er sich: In den 60-er Jahren<br />
gab es Pläne, hier ein beheiztes und überdachtes Leistungszentrum für<br />
den Schwimmsport aufzubauen. Die <strong>Treuenbrietzen</strong>er Schwimmer nahmen<br />
damals im Kreis Jüterbog eine unangefochtene Spitzenposition ein.<br />
Das Becken der 1936 errichteten Badeanstalt konnte vom Keller her beheizt<br />
werden. Die Heizung konnte zu DDR- Zeiten nicht genutzt werden,<br />
da keine Steinkohle zur Verfügung stand und Braunkohle als Heizmaterial<br />
nicht geeignet war. Im Schwimmbad standen noch zwei riesige Eichen,<br />
die gefällt werden mussten, weil ihr Wurzelwerk das Becken bedrohte.<br />
Quellen:<br />
1. Brandenburgisches Landeshauptarchiv, Protokollbuch der Bade- Deputation<br />
<strong>Treuenbrietzen</strong> (Rep. 8, Nr. 55)<br />
2. Protokolle von Beratungen der Stadtverordnetenversammlung<br />
3. Protokolle von Sitzungen des Magistrats<br />
4. Zeitungsberichte<br />
Die Ziegelei in Dietersdorf<br />
(Adolf Leity)<br />
Die Entwicklung der Ziegelei in Dietersdorf hängt eng mit der Ansiedlung<br />
von Büdnern auf der wüsten Dorfstätte zusammen. Ausgelöst wurde die<br />
Dorfentstehung durch die neue Berlin-Cassler-Chaussee (1818 gebaut).<br />
Die ersten Einwohner verwendeten zum Bau ihrer Häuser sonnengetrocknete<br />
Lehmziegel. Den Baustoff fanden sie ca. 50 m hinter dem<br />
Luthersbrunnen in den Pflugschen Lehmkieten. Anfangs musste jeder<br />
seine Lehmziegel selbst produzieren.<br />
Der Besitzer der Lehmkieten, der Pflügkuffer Hüfner Pflug, sah hier die<br />
Möglichkeit, durch eine Ziegelei etwas Geld hinzuzuverdienen. 1857 trat<br />
der Ziegelmeister Johann Gottlieb Oertel in den Dienst des Hüfners Pflug<br />
und baute eine Ziegelei auf. Mitarbeiter fand er unter den Dietersdorfer<br />
Neuansiedlern. 1860 arbeitete Johann Friedrich August Tietz als Ziegelmeister.<br />
1861 wird neben Tietz noch Johann Gotttlob Drehsler als Ziegelmeister<br />
genannt. Drehsler stammt aus Jüterbog und hatte 1861 Adele<br />
Maria Gelbricht, Tochter des Pfarrers aus Marzahna, geheiratet. Ihm schien<br />
die Ziegelei nicht den gewünschten Erfolg gebracht zu haben, denn er<br />
wechselte den Beruf und wurde Gastwirt in Dietersdorf.<br />
Erst mit dem Ziegelmeister Wilhelm Heinrich Haseloff aus Niemegk kam<br />
die Pflugsche Ziegelei in Schwung. Er verstand sein Handwerk, das er<br />
sich in der Niemegker Ziegelei erworben hatte. Er übernahm 1863 die<br />
Ziegelei und baute einen so genannten Erdofen zum Brennen der Ziegel.<br />
Bald kamen Kunden aus den umliegenden Dörfern. Die Ziegelei warf guten<br />
Gewinn ab. So konnte er die Ziegelei kaufen und wurde Besitzer der<br />
Ziegelei. Sein Haus unmittelbar hinter dem Luthersbrunnen ist vermutlich<br />
das erste Haus, das vollständig aus gebrannten Ziegeln errichtet wurde.<br />
Er hatte vier Kinder:<br />
1. Friederike * 10.02.1863 2. Anna Wilhelmine * 23.09.1864<br />
3. Heinrich * 17.11.1867 4. Wilhelm Herrmann * 29.12.1868<br />
† 23.12.1867<br />
Einige Dietersdorfer fanden bei ihm Arbeit und Brot. Die Ziegelarbeiter<br />
strichen den Lehm in Holzformen. Die Lehmsteine wurden auf einer Sandfläche<br />
luftgetrocknet, bevor sie in den Brennofen kamen. Die Dietersdorfer<br />
selbst hatten aber nicht so viel Geld, um sich ihre Häuser nur aus gebrannten<br />
Ziegeln zu bauen. Sie verwendeten teilweise noch Lehmsteine,<br />
die sie selbst herstellen mussten.<br />
Fuhrleute kamen von weit her, um das begehrte Baumaterial zu holen.<br />
Zum Übernachten hatten Haseloffs eine Schlafkammer für die Fuhrleute<br />
eingerichtet.<br />
Der Ziegelmeister Wilhelm Heinrich Haseloff starb am 25.04.1888 an einem<br />
tragischen Unfall im Alter von 54 Jahren. Der Sohn Wilhelm Herrmann<br />
war der Erbe. Er hielt aber nicht viel von der Arbeit. Sein liebster<br />
Aufenthaltsort war die Gaststätte. Die Ziegelei hatte praktisch keinen kompetenten<br />
Leiter. Das Geld verbrauchte er für seine Sucht. Auf Grund dieser<br />
Lebensweise starb er am 06.12.1898 an Delirium tremens. Die Ziegelei<br />
war pleite und wurde nicht mehr genutzt.<br />
Die Ziegelei Ernst Höhne<br />
1873 heiratete der Ziegelmeister Christian Ernst Höhne die Tochter des<br />
Pflügkuffer Hüfners Pflug, Johanne Friederike. Als Mitgift erhielt das junge<br />
Paar ein Grundstück in Dietersdorf am Schwabecker Weg. Da dort<br />
eine Lehmlagerstätte war, baute er sich dort eine Ziegelei mit einem Erdofen<br />
auf. Hier fanden Dietersdorfer Arbeit.<br />
Über das Leben des Ziegeleibesitzers Ernst Höhne ist wenig bekannt.<br />
Der Erfolg schien ihm versagt geblieben zu sein. Er wird ein hartes Leben<br />
geführt haben, um seine große Familie ernähren zu können. Überdies<br />
war er verschuldet und musste einen Kredit zurückzahlen. All diese Sorgen<br />
werden wohl zu seinem frühen Tod geführt haben. Er starb 1896,<br />
seine Frau 1898. Den acht hinterbliebenen Kindern wird keine andere<br />
Wahl geblieben sein, als die Ziegelei zu verkaufen.<br />
Als neuer Besitzer erwarb Hermann Wuschovius, Ziegelmeister aus Niemegk,<br />
das Grundstück. Er baute 1899 einen Ringofen, der 1900 in Betrieb ging.<br />
Auch bei ihm fanden die Dietersdorfer Arbeit. Aber der hohe Kredit für den<br />
Bau des Ringofens lastete auf seinem Betrieb, und er geriet in Schwierigkeiten.<br />
Durch die Schuldenlast sah er für sich keinen Ausweg mehr. So hat er<br />
sich das Leben genommen (vermutlich erschossen).<br />
Danach übernahm sein Stiefvater Friedrich, ein reicher Kaufmann und<br />
Landwirt aus Niemegk, die Ziegelei und beglich die Schulden. Ein genaues<br />
Datum konnte nicht ermittelt werden. 1913 war Friedrich schon Besitzer.<br />
Verwaltet wurde die Ziegelei aber von Hermanns Schwester Ottony verh.<br />
Schneck. Sie lebte in Wiesenburg, ihr Mann war dort Postangestellter.<br />
Nach dem I. Weltkrieg, nach dem Tode von Herrn Friedrich um 1930,<br />
wurde die Ziegelei an einen Herrn Rettmeier verpachtet. Frau Schneck<br />
verwaltete aber weiterhin die Ziegelei. In den 30iger Jahren ließ die Tonqualität<br />
nach. Die Qualität der Ziegel ließ zu wünschen übrig. Daher entschloss<br />
man sich 1939, die Produktion einzustellen. Die Räumlichkeiten<br />
wurden nur noch zu Lagerzwecken genutzt. Die Ziegelei wurde dem Verfall<br />
preisgegeben, da niemand mehr Verwendung für das Gelände fand.<br />
1959 wurde die Sprengung der Anlage angeordnet, da dieses Terrain als<br />
Abenteuerspielplatz von den Kindern entdeckt worden ist.