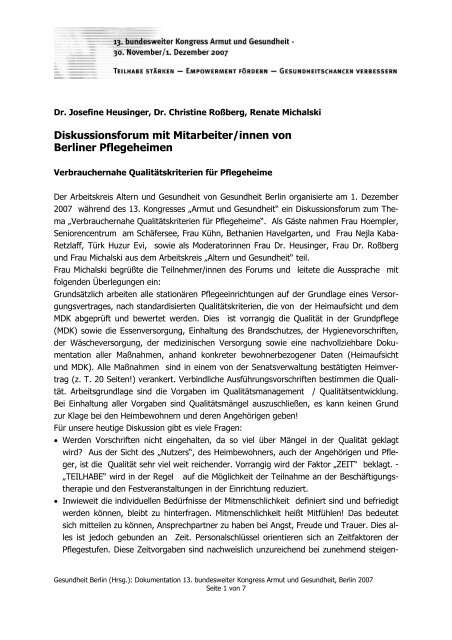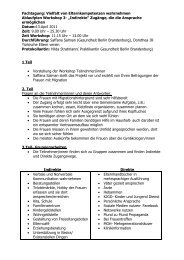Dr. Josefine Heusinger, Dr. Christine Roßberg, Renate Michalski ...
Dr. Josefine Heusinger, Dr. Christine Roßberg, Renate Michalski ...
Dr. Josefine Heusinger, Dr. Christine Roßberg, Renate Michalski ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Dr</strong>. <strong>Josefine</strong> <strong>Heusinger</strong>, <strong>Dr</strong>. <strong>Christine</strong> <strong>Roßberg</strong>, <strong>Renate</strong> <strong>Michalski</strong><br />
Diskussionsforum mit Mitarbeiter/innen von<br />
Berliner Pflegeheimen<br />
Verbrauchernahe Qualitätskriterien für Pflegeheime<br />
Der Arbeitskreis Altern und Gesundheit von Gesundheit Berlin organisierte am 1. Dezember<br />
2007 während des 13. Kongresses „Armut und Gesundheit“ ein Diskussionsforum zum The-<br />
ma „Verbrauchernahe Qualitätskriterien für Pflegeheime“. Als Gäste nahmen Frau Hoempler,<br />
Seniorencentrum am Schäfersee, Frau Kühn, Bethanien Havelgarten, und Frau Nejla Kaba-<br />
Retzlaff, Türk Huzur Evi, sowie als Moderatorinnen Frau <strong>Dr</strong>. <strong>Heusinger</strong>, Frau <strong>Dr</strong>. <strong>Roßberg</strong><br />
und Frau <strong>Michalski</strong> aus dem Arbeitskreis „Altern und Gesundheit“ teil.<br />
Frau <strong>Michalski</strong> begrüßte die Teilnehmer/innen des Forums und leitete die Aussprache mit<br />
folgenden Überlegungen ein:<br />
Grundsätzlich arbeiten alle stationären Pflegeeinrichtungen auf der Grundlage eines Versor-<br />
gungsvertrages, nach standardisierten Qualitätskriterien, die von der Heimaufsicht und dem<br />
MDK abgeprüft und bewertet werden. Dies ist vorrangig die Qualität in der Grundpflege<br />
(MDK) sowie die Essenversorgung, Einhaltung des Brandschutzes, der Hygienevorschriften,<br />
der Wäscheversorgung, der medizinischen Versorgung sowie eine nachvollziehbare Doku-<br />
mentation aller Maßnahmen, anhand konkreter bewohnerbezogener Daten (Heimaufsicht<br />
und MDK). Alle Maßnahmen sind in einem von der Senatsverwaltung bestätigten Heimver-<br />
trag (z. T. 20 Seiten!) verankert. Verbindliche Ausführungsvorschriften bestimmen die Quali-<br />
tät. Arbeitsgrundlage sind die Vorgaben im Qualitätsmanagement / Qualitätsentwicklung.<br />
Bei Einhaltung aller Vorgaben sind Qualitätsmängel auszuschließen, es kann keinen Grund<br />
zur Klage bei den Heimbewohnern und deren Angehörigen geben!<br />
Für unsere heutige Diskussion gibt es viele Fragen:<br />
• Werden Vorschriften nicht eingehalten, da so viel über Mängel in der Qualität geklagt<br />
wird? Aus der Sicht des „Nutzers“, des Heimbewohners, auch der Angehörigen und Pfle-<br />
ger, ist die Qualität sehr viel weit reichender. Vorrangig wird der Faktor „ZEIT“ beklagt. -<br />
„TEILHABE“ wird in der Regel auf die Möglichkeit der Teilnahme an der Beschäftigungs-<br />
therapie und den Festveranstaltungen in der Einrichtung reduziert.<br />
• Inwieweit die individuellen Bedürfnisse der Mitmenschlichkeit definiert sind und befriedigt<br />
werden können, bleibt zu hinterfragen. Mitmenschlichkeit heißt Mitfühlen! Das bedeutet<br />
sich mitteilen zu können, Ansprechpartner zu haben bei Angst, Freude und Trauer. Dies al-<br />
les ist jedoch gebunden an Zeit. Personalschlüssel orientieren sich an Zeitfaktoren der<br />
Pflegestufen. Diese Zeitvorgaben sind nachweislich unzureichend bei zunehmend steigen-<br />
Gesundheit Berlin (Hrsg.): Dokumentation 13. bundesweiter Kongress Armut und Gesundheit, Berlin 2007<br />
Seite 1 von 7
<strong>Dr</strong>. <strong>Josefine</strong> <strong>Heusinger</strong>, <strong>Dr</strong>. <strong>Christine</strong> <strong>Roßberg</strong>, <strong>Renate</strong> <strong>Michalski</strong>: Diskussionsforum mit Mitarbeiter/innen von<br />
Berliner Pflegeheimen<br />
dem Pflege- und Betreuungsbedarf. Mitmenschlichkeit bestimmt die höchste Qualität. Sie<br />
erfordert Zeit und kompetentes Handeln. Beides kostet Geld, das nicht vorhanden ist.<br />
• Sind freiwillige Hilfe und Ehrenamtlichkeit die Lösung, um auf die Bedürfnisse der Bewoh-<br />
ner angemessen zu reagieren?<br />
• Können alltägliche Bedürfnisse - wie z. B. Arztbesuche, ein Friedhofsbesuch oder Teil-<br />
nahme an Veranstaltungen außerhalb der Einrichtung - befriedigt werden, ohne dass<br />
hierfür extern Dienstleistungen, verbunden mit hohem Kostenaufwand, in Anspruch ge-<br />
nommen werden müssen?<br />
• Wie wird auf die besonderen Bedürfnisse der Bewohner mit Demenzerkrankungen einge-<br />
gangen?<br />
• Verlässliche Bezugspersonen sind lebenslang wichtig! Kann dies im Rahmen der ausgewie-<br />
senen Bezugspflege geleistet werden?<br />
• Gibt es individuelle Betreuungsmöglichkeiten, in die auch Angehörige einbezogen sind?<br />
• Welche Möglichkeiten hat der Heimbeirat im Rahmen seiner Mitwirkungsrechte auf die<br />
konzeptionelle Gestaltung einzuwirken?<br />
• Wie groß ist das Interesse / die Möglichkeit der Hausbewohner, die Aufgaben eines<br />
Heimbeirates wahrzunehmen?<br />
Frau <strong>Dr</strong>. <strong>Heusinger</strong> berichtet anschließend in ihrem Beitrag aus dem Forschungsprojekt ei-<br />
ner „Fallstudie zur Qualität von Pflege und Versorgung in stationären Pflegeeinrichtungen“:<br />
Ich möchte einleitend einige Bemerkungen zur Qualitätsdiskussion in Heimen machen. Im<br />
Auftrag des Bundesfamilienministeriums habe ich gerade eine Reihe von Fallstudien in ver-<br />
gleichsweise guten Pflegeheimen angefertigt. In diesem Zusammenhang habe ich mich noch<br />
einmal sehr genau mit Qualitätskriterien befasst. Auf die wichtigsten Eckpfeiler der aktuellen<br />
Diskussion, nämlich die Veröffentlichung der MDK-Berichte, . möchte ich jetzt gar nicht ge-<br />
nauer eingehen, sondern vielmehr gleich auf die Lücken in der heutigen Qualitätsdiskussion.<br />
Stichworte:<br />
• Körperliche Unversehrtheit der BewohnerInnen ist eine Minimalanforderung, die auch ge-<br />
prüft wird<br />
• Bauliche Voraussetzungen sind wichtig, werden benannt und geprüft<br />
• Dokumentationspflichten sollen Qualität überprüfbar machen. Das sehe ich kritisch, denn<br />
Papier und EDV sind geduldig: ein Formular in der Akte, in das die Biografie eingetragen<br />
wird, kann allein keine gute Biografiearbeit bewirken.<br />
• Es fehlen Kriterien für die so genannte. Ergebnisqualität, die m. E. gleichbedeutend ist mit<br />
der Lebensqualität der Menschen, die in den Heimen wohnen<br />
• Von dem Expertenworkshop zu Beginn der genannten Untersuchung habe ich hier schon<br />
einmal berichtet. Es sind einige Aspekte für Lebensqualität erforderlich, die ich über die<br />
körperliche Unversehrtheit hinaus als „verbrauchernahe Kriterien“ hier einführen möchte.<br />
Man könnte sie auch als Kriterien für eine menschenwürdige Versorgung bezeichnen:<br />
• Die Lebensgeschichte und die Lebensleistung eines Menschen prägen ihn und machen<br />
seine individuelle Persönlichkeit aus. Deshalb kommt es auf das Interesse an den einzel-<br />
Gesundheit Berlin (Hrsg.): Dokumentation 13. bundesweiter Kongress Armut und Gesundheit, Berlin 2007<br />
Seite 2 von 7
<strong>Dr</strong>. <strong>Josefine</strong> <strong>Heusinger</strong>, <strong>Dr</strong>. <strong>Christine</strong> <strong>Roßberg</strong>, <strong>Renate</strong> <strong>Michalski</strong>: Diskussionsforum mit Mitarbeiter/innen von<br />
Berliner Pflegeheimen<br />
nen BewohnerInnen, an ihrer Geschichte und ihren Geschichten an. Biografiearbeit ist<br />
nicht nur ein Bogen in der Akte, der ausgefüllt wird, sondern Ausdruck von Interesse an<br />
und Respekt vor jedem Einzelnen.<br />
• Soziale Beziehungen pflegen, d. h., für das Pflegepersonal, für die BewohnerInnen wichti-<br />
ge Menschen zu kennen und die Kontakte zu unterstützen, vor allem zu Angehörigen so-<br />
wie zu alten Freunden und Bekannten.<br />
• Es ist aber auch durchaus möglich, neue Beziehungen zu knüpfen. Ein sehr schönes Bei-<br />
spiel findet sich in diesem Fotoband, der eine Reihe von Freundschaften dokumentiert, die<br />
in einem Pflegeheim neu entstanden sind. Vielleicht ist es ein allgemein menschliches Be-<br />
dürfnis, vielleicht in unserer Leistungsgesellschaft besonders ausgeprägt, das weiß ich<br />
nicht. Aber um sich wohl zu fühlen, ist es für fast alle Menschen entscheidend, für andere<br />
nützlich, bedeutsam, wichtig zu sein. Wie oft sagen alte Menschen ganz traurig „Ich bin<br />
doch zu nichts mehr nütze“. Ihnen Wege zu zeigen, die ihnen erlauben, etwas für andere<br />
Schönes, Gutes, Sinnvolles zu tun, ist deshalb für ihre Zufriedenheit entscheidend.<br />
• Das ist bekannt aus Wohngemeinschaften, in denen BewohnerInnen beim Kochen helfen.<br />
Das ist ein guter Ansatz. Aber nicht alle wollen kochen. Bei meinen Untersuchungen habe<br />
ich z. B. beobachtet, dass Beschäftigungsangebote für eine nützliche Tätigkeit die Bewoh-<br />
nerInnen oft sehr befriedigen. Und für einzelne ist es toll, wenn sie eine Aufgabe haben,<br />
und sei es das tägliche Abreißen der Kalenderblätter auf dem Flur und im Gemeinschafts-<br />
raum, das Tischdecken oder Serviettenfalten oder Medizinbecher abtrocknen, Zeitung ho-<br />
len oder, oder, oder. Auch selbst das Bett zu machen, kann mit Stolz erfüllen – andere<br />
sind aber auch empört, weil sie bei den Heimpreisen einen Hotelservice erwarten. Erst die-<br />
se Woche habe ich gelesen von einem Heim, das BewohnerInnen 25 - 50 € für praktische<br />
Hilfen zahlt. Das ist nicht nur eine gute Aufbesserung des Taschengeldes und Anerken-<br />
nung, das schafft auch Verbindlichkeit.<br />
• Ganz kurz möchte ich noch auf die Frage der Einzelzimmer eingehen. Ein eigenes Zimmer<br />
ist sicher das, was sich mit minimalen Ausnahmen alle Menschen wünschen. Die Privat-<br />
sphäre zu wahren ist ohnehin schwer, wenn man sich nicht mehr selbst versorgen kann.<br />
Wenigstens einen Ort zum Ungestörtsein sollte man dann haben dürfen. Die Argumente,<br />
die hier immer wieder vorgebracht werden, sind nicht überzeugend: Bettlägerigkeit sollte<br />
es außer bei Sterbenden sowieso nicht geben, jeder pflegebedürftige Mensch kann in ge-<br />
eignete Pflegerollstühle mobilisiert werden oder notfalls mit dem Bett an der Gemeinschaft<br />
teilhaben. Einsamkeit lässt sich nicht bekämpfen, indem zwei Menschen in ein Zimmer ge-<br />
steckt werden. Selbst Ehepaare bevorzugen im Heim oft zwei Zimmer nebeneinander. Die<br />
aktuellen Vorschläge der Marseille-Kliniken, eine wie sie es nennen „2-Sterne-Pflege“ an-<br />
zubieten, also Mehrbettzimmer und Gemeinschaftsbäder, lehne ich deshalb ab.<br />
• Eine gute Versorgung der BewohnerInnen kann nur von zufriedenen MitarbeiterInnen ge-<br />
sichert werden. Die BewohnerInnen sind zwar der verletzlichste Teil, aber auch die Mitar-<br />
beiterInnen verdienen mehr Aufmerksamkeit. Viele leiden darunter, die ihnen anvertrauten<br />
Menschen nicht glücklicher machen zu können. Dabei ist das Problem nicht, dass sie nicht<br />
wüssten wie das geht. Sie haben tatsächlich wenig Zeit dafür und meist viel zu wenig Un-<br />
terstützung von oben. In der Folge reagieren sie z. B. so, wie mir eine Fachkraft erklärte:<br />
Gesundheit Berlin (Hrsg.): Dokumentation 13. bundesweiter Kongress Armut und Gesundheit, Berlin 2007<br />
Seite 3 von 7
<strong>Dr</strong>. <strong>Josefine</strong> <strong>Heusinger</strong>, <strong>Dr</strong>. <strong>Christine</strong> <strong>Roßberg</strong>, <strong>Renate</strong> <strong>Michalski</strong>: Diskussionsforum mit Mitarbeiter/innen von<br />
Berliner Pflegeheimen<br />
„Ich will gar nicht wissen, was die Bewohner früher gemacht haben und wer sie waren.<br />
Ich bin heute zu allen freundlich und höflich, das reicht.“ Diese Reaktion ist nicht bösartig,<br />
sondern eine sehr verbreitete und funktionale Überlebensstrategie. Wenn die Pflegekräfte<br />
sich auf die Individualität der BewohnerInnen einlassen, ihre Sorgen und Wünsche kennen<br />
und teilen, können sie sie nicht mehr so behandeln, wie sie das tun. Sobald eine individu-<br />
elle, persönliche Beziehung entsteht – wie sie sich die meisten BewohnerInnen für ihren<br />
alltäglichen Umgang sehnsüchtig wünschen – wird der Dienst nach Vorschrift zur seeli-<br />
schen Grausamkeit. Es ist deshalb oft eine Frage der Psychohygiene und des Selbstschut-<br />
zes für die Pflegekräfte, die BewohnerInnen als mehr oder weniger einheitliche Gruppe,<br />
die es zu versorgen gilt, zu betrachten, und sich möglichst wenig einzulassen.<br />
• Wer den Heimalltag kennt, weiß, dass es da immer auch Ausnahmen gibt. Fast alle Pflege-<br />
kräfte haben einzelne BewohnerInnen, zu denen sie innige Beziehungen pflegen. Gerade<br />
an denen sieht man, wie schön das sein kann und wie gut das beiden Beteiligten tut.<br />
• So was müsste strukturell gefördert werden, das System dafür ist auch bekannt. Es ist die<br />
Bezugspflege, die aber mit den bestehenden Personalschlüsseln nicht machbar ist. Ich<br />
weiß, dass heutzutage auf jeder BewohnerInnen- Akte eine Bezugspflegekraft benannt ist.<br />
Das will der MDK so und ist ja auch nicht weiter schwer zu machen. Aber in der Realität<br />
wird das kaum gelebt. In der Regel wissen weder Angehörige noch BewohnerInnen, wer<br />
ihre Bezugspflegekraft ist, und die Bezugspflegekraft macht zwar vielleicht die Pflegepla-<br />
nung und kennt den Hausarzt, aber die Biografie, das soziale Netzwerk ihrer BewohnerIn-<br />
nen kennt sie auch nicht besser als andere. Geschweige denn, dass sie mal mit ihren Be-<br />
wohnerInnen einen Ausflug zum alten Zuhause gemacht, einen Besuch bei Bekannten or-<br />
ganisiert hat oder regelmäßig etwas Besonderes mit ihm oder ihr unternimmt.<br />
• Die aktuellen Pflegeheimvergleiche in Berlin sind ein Fortschritt im Hinblick auf Verbrau-<br />
cherschutz, auch wenn sie vieles nicht zeigen bzw. man sehr viel interpretieren muss.<br />
Sehr gut finde ich dort die Erwähnung der Personalzahlen. Die zeigen nämlich schon sehr<br />
viel: Bestenfalls kommt eine Pflegekraft auf etwas mehr als 2 BewohnerInnen, es können<br />
aber auch mal nur 21 Vollzeitstellen für 121 BewohnerInnen sein. Ein Monat hat durch-<br />
schnittlich 30 Tage, mal 24 Stunden ergeben 720 Stunden. Ohne Urlaub und Krankheit zu<br />
berücksichtigen, arbeiten 21 Vollzeitkräfte in einem Monat zusammen 3360 Stunden. Für<br />
die Rund-um-die-Uhr-Versorgung von 121 BewohnerInnen stehen in dieser Einrichtung<br />
112 Arbeitsstunden am Tag zur Verfügung, das ist nicht einmal eine Stunde für pro Be-<br />
wohnerIn. Und es handelt sich hier um ein Pflegeheim, in dem die BewohnerInnen min-<br />
destens die Pflegestufe 1 haben. Die wiederum bekommen nur diejenigen, die mindestens<br />
90 Minuten am Tag Hilfe brauchen.<br />
• So ist eine menschenwürdige Versorgung nicht möglich, wir brauchen zusätzliche Ressour-<br />
cen für die stationäre Pflege. Sowohl mehr Pflegepersonal als auch nachbarschaftliche, eh-<br />
renamtliche Hilfe. Ein wichtiges verbrauchernahes Qualitätskriterium zur Bewertung von<br />
Einrichtungen ist deshalb auch, wie offen und intensiv darum gerungen wird, Angehörige<br />
und Ehrenamtliche einzubinden, ernst zunehmen, zu beteiligen, und zwar nicht nur als Lü-<br />
ckenbüßer, sondern als PartnerInnen.<br />
Gesundheit Berlin (Hrsg.): Dokumentation 13. bundesweiter Kongress Armut und Gesundheit, Berlin 2007<br />
Seite 4 von 7
<strong>Dr</strong>. <strong>Josefine</strong> <strong>Heusinger</strong>, <strong>Dr</strong>. <strong>Christine</strong> <strong>Roßberg</strong>, <strong>Renate</strong> <strong>Michalski</strong>: Diskussionsforum mit Mitarbeiter/innen von<br />
Berliner Pflegeheimen<br />
Fazit:<br />
Die Qualitätskriterien, die heute überwiegend benutzt werden, beschränken sich wesentlich<br />
auf körperliche Unversehrtheit und bauliche Vorschriften sowie Dokumentationspflichten.<br />
Insofern möchte ich meinen einführenden Beitrag mit zwei Botschaften beenden:<br />
• Erstens müssen wir uns dafür einsetzen, dass mehr Ressourcen für die stationäre Pflege<br />
mobilisiert werden. Dazu gehört Geld, aber auch mehr nachbarschaftliche Integration in<br />
den Stadtteil, Zusammenarbeit mit Freiwilligen usw. Angehörige und Ehrenamtliche stellen<br />
außerdem auch Öffentlichkeit her, ein wichtiger Aspekt von Qualitätskontrolle! Wichtig hier<br />
der Hinweis: Seit der Föderalismusreform sind die Länder zuständig für die Heime. In Ber-<br />
lin und Brandenburg werden demnächst Heimgesetze gemacht. Lassen Sie uns da auf-<br />
merksam sein und uns einmischen!<br />
• Zweitens müssen die Interessen der BewohnerInnen lauter formuliert werden. Ich finde<br />
zwar die Bezeichnung „Kunde“ für Pflegeheim- BewohnerInnen falsch, aber gerade in Ber-<br />
lin, wo es ein Überangebot an Heimplätzen gibt, haben sie und ihre Angehörigen doch ei-<br />
ne gewisse Verbrauchermacht. Ich habe deshalb hier einige Fragen für die Wahl eines<br />
Heimplatzes aufgelistet, die ergänzend zu den bekannten Checklisten vielleicht stärker auf<br />
die Lebensqualität der BewohnerInnen zielen. Sie sind unvollständig, aber vielleicht könnte<br />
es eine Aufgabe sein, diese Liste zu ergänzen und weiter zu konkretisieren.<br />
Qualitätsfragen an Pflegeheime<br />
Mit diesen (unvollständigen) Fragen zur Qualität und tatsächlichen Bewohnerorientierung<br />
einer Pflegeeinrichtung möchte ich anregen, eine über die körperliche Unversehrtheit hi-<br />
nausgehende Lebensqualität der Bewohnerinnen und Bewohner sicherzustellen:<br />
• Wer interessiert sich für die Lebensgeschichte und das soziale Netzwerk, also wichtige<br />
Ressourcen der einzelnen Bewohnerinnen und Bewohner?<br />
• (Wie) Werden die Bewohnerinnen und Bewohner dabei unterstützt, sich gegenseitig ken-<br />
nen zu lernen?<br />
• Ist die Zahl der Bewohnerinnen und Bewohner im Wohnbereich überschaubar, so dass<br />
nachbarschaftliche Kontakte entstehen können? Werden diese durch die Innenarchitektur,<br />
insbesondere Wohnküchen mit einer familiären (Koch- und) Esskultur, gefördert?<br />
• Wie viele Pflegekräfte sind zu welchen Tageszeiten für wie viele Pflegebedürftige da? Wird<br />
bei der Dienstplangestaltung auf Spitzenbelastungszeiten morgens und bei den Mahlzeiten<br />
geachtet? Gelingt es ganz überwiegend (60% und mehr) personelle Kontinuität für die<br />
Bewohnerinnen und Bewohner zu wahren oder wird doch meist in Funktionspflege ge-<br />
pflegt, also z. B. Essen von der Pflegekraft angereicht, die gerade Zeit hat?<br />
• Gibt es Bezugspflegekräfte, die nicht nur die Pflegeplanung machen, sondern auch bei der<br />
praktischen Pflege kontinuierlich zuständig sind? Sind sie besonders gut über „ihre“ Pfle-<br />
gebedürftigen informiert, für sie, ihre Angehörigen und Ärztinnen oder Ärzte Ansprechper-<br />
sonen? Machen sie hin und wieder etwas Besonderes mit „ihren“ Pflegebedürftigen?<br />
Gesundheit Berlin (Hrsg.): Dokumentation 13. bundesweiter Kongress Armut und Gesundheit, Berlin 2007<br />
Seite 5 von 7
<strong>Dr</strong>. <strong>Josefine</strong> <strong>Heusinger</strong>, <strong>Dr</strong>. <strong>Christine</strong> <strong>Roßberg</strong>, <strong>Renate</strong> <strong>Michalski</strong>: Diskussionsforum mit Mitarbeiter/innen von<br />
Berliner Pflegeheimen<br />
• Wann endet der Spätdienst bzw. zu welcher Uhrzeit können die Bewohnerinnen und Be-<br />
wohner im Normalfall noch erwarten, Unterstützung bei der Abendtoilette und beim Zu-<br />
bettgehen zu erhalten? Wann genau gehen die Letzten, die dabei Unterstützung benöti-<br />
gen, in dem konkreten Wohnbereich tatsächlich ins Bett?<br />
• Gibt es täglich vor- und nachmittags sowie gelegentlich abends und an den Wochenenden<br />
Beschäftigungsangebote? Wie werden die Bewohnerinnen und Bewohner an der Entwick-<br />
lung von Angeboten und am Tagesablauf beteiligt?<br />
• Können daran auch Schwerstpflegebedürftige/Bettlägerige teilnehmen? Oder gibt es täg-<br />
lich andere Angebote für diese Menschen?<br />
• Werden alle Bewohnerinnen und Bewohner täglich aus dem Bett mobilisiert?<br />
• (Wie) Werden die Bewohnerinnen und Bewohner dabei unterstützt, Verantwortung bzw.<br />
sinnvolle Aufgaben auch für andere zu übernehmen?<br />
• (Wie) Werden die Bewohnerinnen und Bewohner dabei unterstützt, hin und wieder die<br />
Einrichtung einzeln und zusammen mit anderen zu verlassen?<br />
• Arbeiten freiwillig Engagierte in der Einrichtung? Beruht ihr Engagement auf einem Kon-<br />
zept, sie gezielt einzubinden? Wofür?<br />
• Wie werden die Angehörigen in den Alltag einbezogen? Gibt es dafür ein Konzept und<br />
konkrete Angebote?<br />
Am Beginn der Diskussion informierten die Vertreterinnen aus den Einrichtungen über ihre<br />
Profilierung und Schwerpunkte in der Pflege:<br />
• Das Vitanas Seniorencentrum arbeitet nach dem psychobiographischen Pflegemodell von<br />
Professor Erwin Böhm. Die Einrichtung erhielt die international anerkannte Auszeichnung<br />
für Leistungen in der Betreuung von Menschen mit Demenz ENPP (Europäisches Netzwerk<br />
für psychobiographische Pflegeforschung).<br />
• Die Senioreneinrichtung TÜRK HUZUR EVI berücksichtigt in Pflege und Betreuung die be-<br />
sonderen Bedürfnisse türkischer Mitbürger/innen.<br />
• Die Seniorenresidenz Bethanien Havelgarten ist eine neue Einrichtung mit außergewöhn-<br />
lich komfortabler Ausstattung. Bemerkenswert ist der großzügig gestaltete geschützte Gar-<br />
ten- und Wohnbereich für Menschen mit Demenz. Zu den besonderen Einrichtungen gehö-<br />
ren moderne Wellnessbäder, ein Veranstaltungssaal. ein Andachtsraum, das Restaurant<br />
mit Blick auf die Havel und ein hauseigenes Ausflugsboot.<br />
In einem regen Erfahrungsaustausch wurde vor allem über folgende Anliegen aus dem All-<br />
tag in der Pflegearbeit gesprochen:<br />
• Individuell auf die Bedürfnisse der Bewohner/innen einzugehen ist von den personellen<br />
und finanziellen Möglichkeiten der Einrichtung abhängig.<br />
• Die „Charta der Rechte hilfs- und pflegebedürftiger Menschen“ ist zwar Grundlage des<br />
Handelns, die konkrete Umsetzung für ein selbstbestimmtes Leben der Heimbewoh-<br />
ner/innen ist von vielen Voraussetzungen abhängig, die noch nicht immer realisierbar<br />
sind.<br />
Gesundheit Berlin (Hrsg.): Dokumentation 13. bundesweiter Kongress Armut und Gesundheit, Berlin 2007<br />
Seite 6 von 7
<strong>Dr</strong>. <strong>Josefine</strong> <strong>Heusinger</strong>, <strong>Dr</strong>. <strong>Christine</strong> <strong>Roßberg</strong>, <strong>Renate</strong> <strong>Michalski</strong>: Diskussionsforum mit Mitarbeiter/innen von<br />
Berliner Pflegeheimen<br />
• Eine Bezugspflege, die auf die Wünsche und Bedürfnisse der Bewohner/innen ausgerichtet<br />
ist, erfordert einen erweiterten Pflegeschlüssel.<br />
• Ehrenamtliche Helfer sind in den Heimen stets willkommen. Sie benötigen eine komplette<br />
Begleitung und Betreuung (Fortbildung). Anerkennung und Dank werden ihnen zuteil.<br />
• Angehörigenarbeit fördert die Kommunikation. Angehörige lernen sich untereinander ken-<br />
nen, tauschen ihre Erfahrungen aus und helfen sich gegenseitig.<br />
• Ein gutes Qualitätsmanagement und qualifizierte Mitarbeiter sind Garanten für bestmögli-<br />
che Betreuung. Dabei ist die Kompetenz entscheidend, nicht die Anzahl.<br />
• Die ärztliche Versorgung besonders bei notwendiger Behandlung durch Fachärzte muss<br />
verbessert werden. Weitgehend zufrieden ist die Betreuung in den Einrichtungen mit dem<br />
Berliner Modell, in denen Ärzte fest angestellt sind.<br />
• Die Betreuung dementiell erkrankter Bewohner/innen gewinnt zunehmend an Bedeutung.<br />
Die Einrichtungen sind entsprechend konzeptionell darauf eingestellt. Die Pflegekräfte<br />
werden besonders fachlich qualifiziert.<br />
Am Schluss der Diskussion wurde mit dem Dank für die informative Aussprache die Einla-<br />
dung an interessierte Teilnehmer/innen zu einem Besuch der Einrichtungen ausgesprochen,<br />
<strong>Dr</strong>. <strong>Josefine</strong> <strong>Heusinger</strong>, <strong>Dr</strong>. <strong>Christine</strong> <strong>Roßberg</strong>, <strong>Renate</strong> <strong>Michalski</strong><br />
Zurück zur Inhaltsübersicht Kongress Armut und Gesundheit<br />
Gesundheit Berlin (Hrsg.): Dokumentation 13. bundesweiter Kongress Armut und Gesundheit, Berlin 2007<br />
Seite 7 von 7