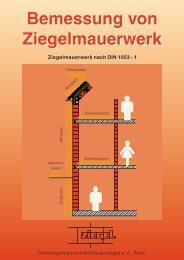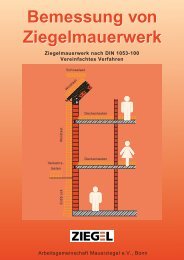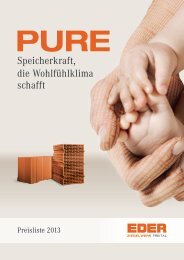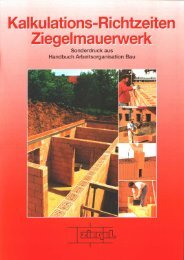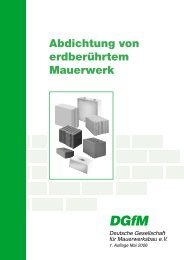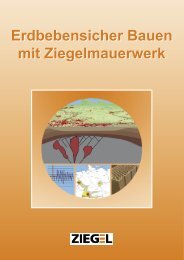EnEV 2009 Energie-Einsparverordnung Adobe PDF-Format
EnEV 2009 Energie-Einsparverordnung Adobe PDF-Format
EnEV 2009 Energie-Einsparverordnung Adobe PDF-Format
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Unbeheizte Glasvorbauten ermöglichen<br />
bei intelligenter Nutzung eine zusätzliche<br />
Heizwärmeeinsparung. Diese ergibt sich<br />
durch die Temperaturerhöhung in dieser<br />
Zone und die damit verbundene Absenkung<br />
der Transmissionswärmeverluste<br />
der angrenzenden Bauteile des beheizten<br />
Wohnbereichs. Neben diesem Effekt<br />
lassen sich auch Lüftungswärmeverluste<br />
reduzieren, wenn beispielsweise die<br />
Zuluft angrenzender Wohnräume über<br />
den Glasvorbau geführt wird. Da die<br />
Einsparpotentiale von Glasvorbauten<br />
stark von ihrer Nutzung und Geometrie<br />
abhängen, sind allgemeingültige Zahlenangaben<br />
hierzu nicht möglich. Im Monatsbilanzverfahren<br />
der DIN V 4108-6<br />
können die <strong>Energie</strong>bilanzen von Glasanbauten<br />
berechnet werden.<br />
Es darf nicht übersehen werden, dass<br />
Glasvorbauten im Sommer zu starken<br />
Überhitzungen neigen, die deren Nutzbarkeit<br />
deutlich einschränken können.<br />
Daher sind große Lüftungsöffnungen<br />
und zumindest in den Schrägverglasungen<br />
wirksame Verschattungseinrichtungen<br />
erforderlich. Die Investitionskosten<br />
von Glasanbauten weisen der Regel<br />
keine Wirtschaftlichkeit im Hinblick auf<br />
eine mögliche <strong>Energie</strong>einsparung auf.<br />
Bild 2.2: Schematische Darstellung<br />
der Verlust- und Gewinnquellen einer<br />
Gebäudeenergiebilanz.<br />
Hinweis:<br />
Werden die beheizten, an den Glasvorbau<br />
angrenzenden Bereiche<br />
nicht durch eine wirksame räumliche<br />
Trennung abgeschottet, zählt der<br />
Glasvorbau mit seiner Hüllfläche<br />
zum beheizten Gebäudevolumen<br />
und muss entsprechend im <strong>EnEV</strong>-<br />
Nachweis berücksichtigt werden.<br />
Eine weiterführende Ausnutzung der Solargewinne<br />
wird mit sogenannten Hybridsystemen<br />
möglich. Mit dieser Technik<br />
lassen sich bisher thermisch ungenutzte<br />
Gebäudeteile, wie z.B. Decken, Innen-<br />
und Außenwände als zusätzliche Speicher<br />
nutzen. Solarkollektoren, Verglasungssysteme<br />
oder transparente Dämmkonstruktionen<br />
(TWD) vor opaken Gebäudehüllflächen<br />
können so eine erhöhte<br />
Solarenergienutzung für das Gebäude<br />
ermöglichen, wenn diese über aktive Beund<br />
Entladung meist mittels luftdurchströmter<br />
Bauteile gekoppelt werden. Die<br />
Gebäudemassen tragen jedoch nur zur<br />
kurzzeitigen Speicherung für eine Periode<br />
von 3 bis 5 Tagen bei. Größenordnungsmäßig<br />
lassen sich 20 bis 30<br />
Prozent der auf die Kollektoroberflächen<br />
einfallenden Strahlung zur Heizwärmeeinsparung<br />
nutzen. Das entspricht bei<br />
senkrechten, südorientierten Kollektoren<br />
einer <strong>Energie</strong>einsparung zwischen 70<br />
und 110 kWh/(m 2 ·a)bezogen auf die<br />
Kollektorfläche [L7, L8].<br />
2. <strong>Energie</strong>bilanz eines Wohngebäudes<br />
2.1.3 Heizwärmebedarf<br />
Der Heizwärmebedarf Q h, also die<br />
Wärme, die ein Heizkörper dem Raum<br />
zur Verfügung stellen muss, ergibt sich<br />
aus den zuvor ermittelten Verlusten und<br />
Gewinnen wie folgt:<br />
Q h = Q l - η · (Q i + Q s) [kWh] (6)<br />
mit<br />
Q l = Wärmeverluste aus Transmission<br />
und Lüftung (3)<br />
η = Ausnutzungsgrad der Gewinne<br />
(siehe 3.3.7)<br />
Q i = Interne Gewinne (4)<br />
Q s = Solare Gewinne (5)<br />
2.2 Heizenergiebedarf<br />
Der notwendige Brutto-Heizenergiebedarf<br />
Q – setzt sich aus dem Heizwärmebedarf<br />
Q h und bei gekoppelter Erzeugung<br />
auch aus dem Trinkwarmwasserbedarf<br />
Q TW, den Verlusten der Heizanlage<br />
Q Anl abzüglich eventueller Anteile<br />
regenerativer <strong>Energie</strong> Q r zusammen.<br />
Hierbei ist zu berücksichtigen, dass in<br />
den Verlusten der Heizanlage auch der<br />
Strom der Hilfsenergie für Pumpen,<br />
Brenner, etc. enthalten ist. Der so<br />
ermittelte Heizenergiebedarf beinhaltet<br />
daher unter Umständen zwei oder mehr<br />
<strong>Energie</strong>träger und ist für Vergleiche mit<br />
gemessenen Verbräuchen entsprechend<br />
aufzuteilen. Nach DIN V 4108-6<br />
ergibt er sich zu:<br />
Q = Q h + Q TW + Q Anl - Q r [kWh] (7)<br />
7