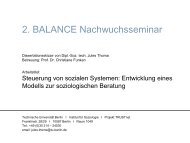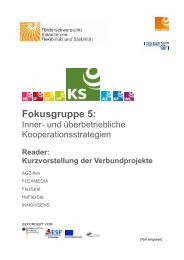Einschätzungen zum Forschungsstand Arbeit und Leben
Einschätzungen zum Forschungsstand Arbeit und Leben
Einschätzungen zum Forschungsstand Arbeit und Leben
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
165ff.). Wir halten den Begriff dann für sinnvoll, wenn er aus seiner üblichen<br />
individualistischen Verengung gelost wird, d. h. wenn Work-Life-Balance nicht einfach als<br />
individuelle Kompetenz <strong>zum</strong> Ausgleich von Anforderungen aus unterschiedlichen<br />
<strong>Leben</strong>sbereichen angesehen wird, sondern wenn die Rahmenbedingungen in den Blick<br />
genommen werden, unter denen solche individuellen Balancierungsleistungen erbracht<br />
werden (können).<br />
(1) Zunächst waren diejenigen Studien zu nennen, die den Fokus auf den europäischen<br />
Vergleich legen. Sie sind fast ausschließlich quantitativ angelegt <strong>und</strong> bieten Vergleichsdaten<br />
u. a. zu WLB-Indizes in Zusammenhang mit <strong>Arbeit</strong>szeiten, aber auch mit sozialpolitischen<br />
Regulationsinstrumenten, mit Typen von familiären Arrangements sowie mit Verlaufsmustern<br />
von Berufsbiographien usw. (z.B. die Studien „Quality of Life in Changing Europe” [Lippe et<br />
al. 2009], „Household, Work and Flexibility“ [Literatur unter www.hwf.at], die europäische<br />
Betriebsbefragung zu <strong>Arbeit</strong>szeit <strong>und</strong> Work-Life-Balance, z.B. Eurofo<strong>und</strong> [European<br />
Fo<strong>und</strong>ation for the Improvement of Living and Working Conditions] 2007, 2009). Inwieweit<br />
die bislang vorliegenden quantitativen Daten <strong>zum</strong> internationalen Vergleich ausreichend sind,<br />
können wir an dieser Stelle nicht abschätzen.<br />
(2) Die räumliche Dimension von Work-Life-Balance steht bei denjenigen Projekten im<br />
Vordergr<strong>und</strong>, die sich mit den Folgen von Telearbeit auseinandersetzen. Hier ist eine<br />
charakteristische Ungleichheit von Forschung <strong>und</strong> realen Veränderungen zu beobachten.<br />
Zunächst hatte das Phänomen Telearbeit – bereits seit Beginn der 1990er Jahre – eine große<br />
wissenschaftliche Resonanz gef<strong>und</strong>en, die durchaus in Kontrast zu ihrem anfangs eher<br />
geringen Verbreitungsgrad stand. Mittlerweile hat sich das Verhältnis allerdings verändert.<br />
Aktuelle Studien zu Telearbeit fokussieren WLB-Fragen an zentraler Stelle, daneben u.a.<br />
auch ergonomische <strong>und</strong> arbeitswissenschaftliche Fragestellungen (z. B. Winkler 2001,<br />
Büssing 1998, Hornberger/Weisheit 1999). Die räumliche Dimension der WLB findet ebenso<br />
in den Studien zu Mobilität von <strong>Arbeit</strong>nehmern Beachtung (aktuell z. B. Kesselring/Vogl<br />
2010).<br />
Zu Fragen von Mobilität <strong>und</strong> Telearbeit besteht gewissermaßen „Querschnittsbedarf“ im<br />
Rahmen breiterer Studien zur WLB. An die Stelle eines Fokus auf Telearbeiter als einer<br />
speziellen Beschäftigtengruppe sollte die Untersuchung des Einsatzes <strong>und</strong> der Nutzung von<br />
neuen Kommunikationsmitteln <strong>und</strong> ihre Auswirkungen auf Belastungen <strong>und</strong> „<strong>Leben</strong>“ für<br />
sämtliche Beschäftigtengruppen treten. Denn <strong>Arbeit</strong> an wechselnden Orten bzw. mobile<br />
<strong>Arbeit</strong> sowie (zeitweise sowie offizielle wie informelle) Heimarbeit wird für immer mehr<br />
Beschäftigte in unterschiedlichen Tätigkeitssegmenten Realität. Hier besteht gerade für<br />
„Normalbeschäftigte“ in Zukunft – nicht zuletzt in Abhängigkeit von weiteren technischen<br />
Entwicklungen – weiterer Forschungsbedarf.<br />
(3) Ein Schwerpunkt der (qualitativen) Studien zur Work-Life-Balance liegt gegenwärtig<br />
noch immer im Beschäftigtensegment der Führungskräfte (aus den letzten Jahren u.a. Projekt<br />
„Führen in Teilzeit. Eine empirische Untersuchung der Chancen <strong>und</strong> Risiken der Einführung<br />
von Teilzeitarbeitsregelungen auch in Führungspositionen“ [Buhrmann], Notz 2001) – nicht<br />
zuletzt deshalb, weil für diese Gruppe besonders weitgehende Probleme im Feld der Work-<br />
Life-Balance erwartet werden, u.a. aufgr<strong>und</strong> von überlangen <strong>Arbeit</strong>szeiten sowie hohen<br />
Leistungsanforderungen. Die bevorzugten Methoden sind qualitativ. So wichtig es ist, gerade<br />
den Führungskräften hohe Aufmerksamkeit zuzugestehen, so wichtig ist es ebenfalls, die<br />
Frage der Work-Life-Balance für sämtliche Beschäftigtensegmente zu untersuchen. Zudem<br />
besteht gegenwärtig hinsichtlich der Führungskräfte noch Forschungsbedarf nicht allein<br />
hinsichtlich ihrer eigenen Vereinbarkeitsproblematik, sondern auch in Bezug auf die<br />
Möglichkeiten <strong>und</strong> Grenzen balanceorientierten Führens (d. h.: Wie ermöglicht <strong>und</strong>