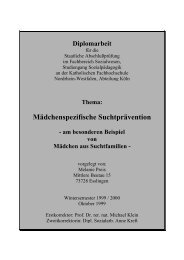Klein, M. (2000).
Klein, M. (2000).
Klein, M. (2000).
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Klein</strong>, M. (<strong>2000</strong>). Alkohol und Familie: Forschung und Forschungslücken [Alcohol and the family:<br />
Research update and research needs]. In: Kruse, G., Körkel, J. & Schmalz, U. Alkoholabhängigkeit<br />
erkennen und behandeln. Bonn: Psychiatrie-Verlag, S. 139 – 158.<br />
Michael <strong>Klein</strong><br />
Alkohol und Familie: Forschung und Forschungslücken<br />
Angehörige von Suchtkranken leben in einer besonders schwierigen Lebsnssituation:<br />
Sie leiden unter den Folgen der Sucht und werden oft noch für das Leiden ihres<br />
suchtkranken Partners (mit)verantwortlich gemacht. Daher ist es nicht verwunderlich,<br />
dass Angehörige, die meist nicht unter der Intoxikationswirkung von Drogen stehen,<br />
stärker und bewusster in der Familie leiden als die betroffenen Suchtkranken selbst.<br />
Entsprechende Studien zeigen eine verstärkte psychosoziale Belastung bei<br />
Angehörigen von Suchtkranken (z.B. Moos et al., 1982). Obwohl eine erste<br />
wissenschaftliche Studie zur Situation der Angehörigen von Suchtkranken schon vor<br />
dem 1. Weltkrieg veröffentlicht worden war (Heron, 1912), wurde die<br />
Fachöffentlichkeit insgesamt erst spät auf die Situation der Angehörigen von<br />
Suchtkranken aufmerksam und die Wissenslage ist heute noch, wie die folgenden<br />
Ausführungen zeigen werden, recht defizitär.<br />
In den Selbsthilfegruppen, speziell den sogenannten Angehörigengruppen,<br />
dominieren bis heute populärwissenschaftliche Modelle bezüglich der Rolle von<br />
Angehörigen von Suchtkranken. Zu einem nicht unwesentlichen Teil werden diese<br />
Vorstellungen auch in psychosozialen Helferkreisen zur Erklärung des<br />
Angehörigenverhaltens benutzt. Die Modelle besagen zumeist, dass Angehörige von<br />
Suchtkranken abhängige und selbstunsichere Persönlichkeiten sind, die sich trotz<br />
besseren Wissens nicht von ihren trinkenden Partnern zu lösen vermögen, sondern<br />
diese vielmehr noch durch unbewusstes, aber auch ungeeignetes Verhalten in der<br />
Abhängigkeit bestärken. Dies entspricht der monolithischen Vorstellung vom<br />
Angehörigen als "Co" (= Co-Abhängigen), eines Menschen mit einem klar<br />
vorhersagbaren Persönlichkeitsbild mit stark problematischen Zügen und<br />
pathologischem Interaktionsverhalten. Dabei liegen längst empirische Belege für die<br />
Heterogenität nicht nur der Gruppe der Alkoholabhängigen, sondern auch der<br />
Familien mit einem Alkoholabhängigen vor (z.B. von Villiez, 1986). Andere<br />
Untersuchungen haben gezeigt, dass die Partner von Suchtkranken durchaus in<br />
einem normalen Wertebereich, was ihre Persönlichkeit und Psychopathologie betrifft,<br />
liegen können (Paolino et al., 1976). Geradezu sträflich hat die Suchtforschung den
Bereich der Angehörigen bisher vernachlässigt, was entscheidend zur Persistenz der<br />
zahlreichen unüberprüften "Szene-Ideologien" beigetragen haben dürfte.<br />
Dementsprechend überwiegen dann populärwissenschaftliche Beiträge, die<br />
entweder ausschließlich auf Eigenerfahrung basieren oder seit Jahrzehnten<br />
vorhandene klinische Einsichten unüberprüft wiederholen. Entsprechende Buchtitel<br />
lauten dann für den Bereich der Partner von Suchtkranken z.B. "Ertrunkene Liebe",<br />
"Der Kuss der Selene", "Wiegenlied mit Spätfolgen", "Die Liebesgeschichte des<br />
Jahrhunderts" oder "Verstrickt in die Probleme anderer", "Herr Alkohol & Frau Co.",<br />
"Die Sucht gebraucht zu werden", "Wenn Frauen zu sehr lieben" usw. Beim Thema<br />
"Kinder von Suchtkranken" herrschen ähnlich hochemotionalisierte Buch- und<br />
Zeitschriftenartikel vor. Einige Beispiele lauten: "Die vergessenen Kinder", "Die<br />
armen Kinder", "Süchtig geboren", "Um die Kindheit betrogen", "Alles total geheim!"<br />
usw.<br />
In wichtigen Fachbüchern wird das Angehörigenthema jedoch gar nicht oder oft nur<br />
am Rande abgehandelt. In "Alkoholkonsum und Gemeinwohl" (Edwards et al., 1997),<br />
einem führenden Werk zur epidemiologischen Suchtforschung, tauchen die<br />
Angehörigen lediglich als die Opfer alkoholbedingter Gewalthandlungen auf. Im<br />
"Lehrbuch der Suchterkrankungen" (Gastpar et al., 1999) taucht der Angehörige des<br />
Suchtkranken noch nicht einmal im Stichwortverzeichnis auf.<br />
Das offensichtliche Vorherrschen stark affektiv besetzter populärwissenschaftlicher<br />
Beiträge verweist deutlich auf die Vernachlässigung, bisweilen Verleugnung, des<br />
Themas "Angehörige von Suchtkranken" durch Wissenschaft und Forschung. Der<br />
vorliegende Beitrag soll daher die bisher vorhandenen Forschungsresultate<br />
darstellen und eine Analyse der derzeitigen Problemkonzeptionalisierung liefern.<br />
Wer ist ein Angehöriger eines Suchtkranken?<br />
Unter Angehörigen von Suchtkranken werden in der Regel die nahestehenden<br />
Verwandten gefasst. Präziser und daher für die Praxis relevanter ist die Vorstellung,<br />
dass es sich um jene Menschen handelt, die in einer dauerhaften Gemeinschaft mit<br />
einer Person leben, die entweder Suchtmittel missbraucht oder von diesen abhängig<br />
ist. Als solche kommen in erster Linie (Ehe-)Partner und Kinder in Frage. Auf diese<br />
beiden Personengruppen wird im folgenden mit dem Akzent "Partner und Kinder von<br />
süchtigen Alkoholkonsumenten" ausführlich eingegangen. Andere relevante<br />
Personengruppen, wie z.B. die Eltern oder Partner von Drogenabhängigen, werden<br />
im Rahmen dieses Beitrags nicht behandelt. Ihre Erwähnung an dieser Stelle soll<br />
jedoch die Breite des Feldes der betroffenen Personen verdeutlichen. Einer der<br />
vielen Aspekte der Heterogenität des Angehörigenproblems ist in der hier kaum zu<br />
berücksichtigenden Gruppe der Partner von Drogenabhängigen zu sehen. Diese<br />
Personengruppe, zumeist Frauen, hat neben den allgemein gültigen Auswirkungen<br />
von Suchterkrankungen ihres Partners, wie sie im folgenden für die Partner von
Alkoholabhängigen beschrieben werden, noch unter den Besonderheiten der<br />
illegalisierten Drogenszene (z.B. Beschaffungsdruck, Verführung zum Eigenkonsum<br />
["anfixen"], Kriminalität und Beschaffungsprostitution) zu leiden.<br />
Zahlen zum Thema Angehörige von Suchtkranken<br />
Es gibt mehr Menschen, die im Umfeld von Suchtkranken leben als Suchtkranke<br />
selbst. Dieses oft übersehene Faktum unterstreicht die Notwendigkeit einer<br />
realistischen Wahrnehmung und Erforschung der Situation dieser Menschen<br />
genauso wie die Bedeutung von frühzeitigen adäquaten Hilfen. Die Suchthilfe hat<br />
sich bislang zu wenig auf die Situation und Bedürfnisse der Personen im Umfeld von<br />
Suchtkranken eingestellt (<strong>Klein</strong>, 1997). Dies ist umso erstaunlicher, als dass seit<br />
mehr als 10 Jahren systemische Erklärungs- und Behandlungskonzepte in weiten<br />
Bereichen der Suchthilfe dominieren. Diese betonen bekanntermaßen die Wichtigkeit<br />
des Interaktionsumfelds von Menschen bei der Entstehung dysfunktionaler<br />
Symptome.<br />
Im einzelnen ist davon auszugehen, dass mehr als 1.3 Millionen Menschen mit<br />
einem Alkoholabhängigen in einer Partnerschaft zusammenleben. Von diesen<br />
Partnern dürften zwei Drittel Frauen sein. Weitere 1.8 bis 2.0 Millionen Kinder und<br />
Jugendliche im Alter bis zu 18 Jahren sind betroffen. Bei etwa 0.15 Millionen<br />
Abhängigen von illegalen Drogen sind weiterhin bis zu 0.3 Millionen Eltern als<br />
Angehörige betroffen.<br />
Angehörige von Suchtkranken weisen nach Meinung vieler Kliniker ein höheres<br />
Ausmaß an psychischen Störungen auf, was sowohl prä- als auch postmorbid in<br />
Bezug auf die Suchtstörung ihres Angehörigen bedingt sein könnte. Dieser Eindruck<br />
ist jedoch möglicherweise durch die Tatsache verzerrt sein, dass es sich dabei<br />
ausschließlich um die Partner von behandelten Suchtkranken handelt, also um eine<br />
selektive Gruppe. In der Tat zeigen Studien zur Frage von Persönlichkeitsstörungen<br />
bei Ehefrauen von Alkoholikern, dass nur etwa die Hälfte auffällige<br />
Persönlichkeitszüge aufweist. Kogan et al. (1963) hatten 50 Frauen aus<br />
Selbsthilfegruppen und 50 Frauen aus einer Normalpopulation verglichen. Die<br />
Ehefrauen der Alkoholabhängigen zeigten zwar häufiger Störungen, bei jedem<br />
gemessenen Merkmal war aber höchstens die Hälfte der Frauen auffällig. Bestimmte<br />
dominierende Persönlichkeitsmuster konnten nicht gefunden werden.
Im folgenden werden die beiden wesentlichen Angehörigengruppen, Partner und<br />
Kinder von Alkoholikern, bezüglich ihrer Merkmale, Symptome und Risiken<br />
ausführlicher dargestellt.<br />
I. Partner von Suchtkranken<br />
Partner von Suchtkranken wurden seit dem Beginn der Selbsthilfebewegung für<br />
Angehörige ("Al-Anon"), d.h. seit etwa 1950, allmählich als eigenständige<br />
Problemgruppe wahrgenommen. Allzu oft jedoch dienten die Partnerinnen von<br />
Alkoholikern als Mittel zum Zweck, mit dem die Therapie des Suchtkranken<br />
effektiver, konfrontativer und realistischer gestaltet werden konnte, ohne dass für den<br />
Angehörigen selbst ein Bedürfnis nach Hilfe gesehen wurde oder dass sie direkt Hilfe<br />
erhalten hätten. Immer wieder wird für Angehörige von Alkoholikern die Abhängigkeit<br />
vom Partner als stärkstes persönliches Problem formuliert. Fengler (<strong>2000</strong>, 93) liefert<br />
einige Fallbeispiele für die starke Abhängigkeit von Angehörigen von Suchtkranken:<br />
"So ermahnte eine Frau immer wieder erfolglos ihren Mann, weniger zu trinken, und<br />
bezog immer wieder Prügel von ihm. Ein Mann lernte am Tag der Scheidung von<br />
einer heroinabhängigen Frau eine andere heroinabhängige Frau kennen und<br />
beschloss spontan, sie als Partnerin bei sich aufzunehmen". Diese Fallbeispiele<br />
führen zum Konzept der Co-Abhängigkeit, einer spezifischen Form der Abhängigkeit,<br />
wie sie für Partner von Suchtkranken als Charakteristikum formuliert wurde.<br />
Co-Abhängigkeit<br />
Mit den Fortschritten in der Kommunikationsforschung seit 1965 wurde die Rolle der<br />
Partner von Suchtkranken kritisch thematisiert. In diesen frühen Arbeiten zur<br />
Interaktion in suchtbelasteten Familien kristallisierte sich auch das bisweilen negativ<br />
missbrauchte Zerrbild des "Komplizen" heraus, einer Person, die – meist unbewusst<br />
– durch ungeeignete Verhaltensweisen vor dem Hintergrund eigener Defizite das<br />
Leiden des Suchtkranken (!) weiter verlängert. Bislang hat sich jedoch nicht<br />
empirisch zeigen lassen, dass dieses Verhaltensmuster auf die Gruppe der Partner<br />
von Suchtkrankeninsgesamt zutrifft.<br />
Co-Abhängigkeit bezeichnet nach Fengler (1994) Haltungen und Verhaltensweisen<br />
von Personen, die durch Tun und Unterlassen dazu beitragen, dass der süchtige<br />
oder suchtgefährdete Mensch süchtig oder suchtgefährdet bleiben kann. Andere<br />
Autoren sehen Co-Abhängigkeit als eine Persönlichkeitsstörung, die durch die
pathologische Abhängigkeit von einer anderen Person gekennzeichnet ist<br />
(McGovern & DuPont, 1992). In vielen Fällen kann diese Abhängigkeit von der<br />
anderen Person, also vom suchtkranken Partner, zu selbstschädigenden und –<br />
erniedrigenden Verhaltensweisen führen. Allerdings sind diese Annahmen bislang<br />
nicht ausreichend empirisch belegt worden und stützen sich ausschließlich auf<br />
klinische Beobachtungen. Die Autoren führen an anderer Stelle (DuPont &<br />
McGovern, 1991), ebenfalls vor dem Hintergrund klinischer Einzelfallstudien, aus,<br />
dass Co-Abhängigkeit eine behandelbare Persönlichkeitsstörung darstellt, die durch<br />
ein Muster zwanghafter Verhaltensweisen nach Anerkennung durch andere zum<br />
Zwecke der Erlangung von Sicherheit, Selbstwert und Identität gekennzeichnet ist.<br />
Cermak (1991) sieht Co-Abhängigkeit als ein Muster von<br />
Persönlichkeitseigenschaften an, die sich auf der Basis mangelndem Selbstbezugs<br />
("anti-narzisstisch") komplementär, d.h. optimal, zu Suchtstörungen mit ihrem hohen<br />
Ausmaß an selbstbezogenen, bisweilen egoman wirkenden, Symptomen ergänzen.<br />
Whitfield (1984) sieht Co-Abhängigkeit als eine Erkrankung bzw. ein unangepasstes,<br />
problematisches, dysfunktionales Verhalten einer Person, die durch<br />
Zusammenleben, Zusammenarbeit oder in anderer Weisen in enger Verbindung mit<br />
einem Alkoholkranken steht. Kern dieser Definition ist also die spezifische<br />
Interaktion, die im Umfeld eines Alkoholabhängigen entsteht. Diese kann für den<br />
Angehörigen zu einem Stressfaktor werden, durch den sich eigenständige<br />
Erkrankungen (z.B. im psychosomatischen Bereich) entwickeln.<br />
Die Ambivalenz der Co-Abhängigkeit wird in folgender Definition deutlicher<br />
unterstrichen: "Er/sie ist ein Kompagnon, ein unwissentlich Verbündeter des<br />
Abhängigen und ein doppelter Teilhaber an der Krankheit: Er kriegt "seinen Teil ab"<br />
und er trägt ungewollt seinen Teil dazu bei, dass die Abhängigkeit sich festigt"<br />
(Schneider, 1996, 77).<br />
Als einzelne Problemverhaltensweisen eines Co-Abhängigen werden benannt:<br />
• Übermäßig Verantwortung für den Abhängigen übernehmen.<br />
• Das Verhalten des Abhängigen selbst in Anbetracht offener Widersprüche und<br />
Inkonsistenzen entschuldigen und rechtfertigen.<br />
• Dem Abhängigen Belastungen abnehmen oder ersparen wollen.<br />
• Das Verhalten des Abhängigen kontrollieren, indem man ständig Verstecke, in<br />
denen der Abhängige seine Suchtmittel verbergen könnte, sucht.<br />
• Den Abhängigen zwanghaft von Alkohol, Kauforten und Trinkanlässen<br />
fernhalten.<br />
• Den Abhängigen beim Lügen ertappen wollen, ihm ständig misstrauen und ihn<br />
bekehren wollen.<br />
• Selber unaufrichtig dem Abhängigen, anderen Personen oder sich selbst<br />
gegenüber sein, was Tatsachen und Gefühle bezüglich der Abhängigkeit und<br />
der eigenen Rolle betrifft.<br />
Die aufgelisteten Definitionen co-abhängigen Verhaltens machen einerseits die<br />
Tendenzen zum abhängigen Verhalten vor dem Hintergrund einer oft<br />
beeinträchtigten Persönlichkeit deutlich und unterstreichen die Möglichkeit der
Ambivalenz dieser Rolle. Sie sind jedoch zu wenig differenziert und berücksichtigen<br />
zu wenig die Möglichkeiten der Flexibilität und Adaptabilität im menschlichen<br />
Verhalten.<br />
Versuche, eine eigene klinische Störung "Co-Abhängigkeit" zu operationalisieren, hat<br />
es wiederholt gegeben (z.B. Cermak, 1991). Diese sind jedoch bislang an<br />
Reliabilitäts- und Validitätsproblemen gescheitert. So zeigte sich, dass der von<br />
Potter-Efron & Potter-Effron (1989) entwickelte Co-Abhängigkeitsfragebogen CAQ<br />
(Codependency Assessment Questionnaire) fast nur Merkmale des Neurotizismus<br />
und von Stresserleben misst (Gotham & Sher, 1996) und daher keine eigenständige<br />
Kategorie "Co-Abhängigkeit" begründen kann.<br />
Auch die große Heterogenität der Gruppe der Angehörigen wurde bislang zu wenig<br />
erfolgreich in Form empirisch abgesicherter Subtypen erfasst. Solange keine<br />
verlässlichen Subgruppen von Angehörigenverhaltensweisen festgestellt werden und<br />
das Konzept nicht verlässlich diagnostizierbar ist, wird das Co-Abhängigkeitskonzept<br />
nicht als wissenschaftlich sinnvolle Kategorie anzusehen sein.<br />
Selbstreflexion für Partner von Alkoholabhängigen<br />
Angehörigen von Suchtkranken kann im Sinne einer Selbstüberprüfung ihrer<br />
Lebenssitaution und ihres Veränderungswunsches folgender Fragenkatalog<br />
vorgelegt werden (modifiziert nach Arenz-Greiving, 1998):<br />
1. Wodurch war Ihre Rolle im Elternhaus bestimmt? Waren Sie derjenige, der<br />
Verantwortung für andere übernahm, viel leistete, vermittelte, sich ständig<br />
Anerkennung verdiente?<br />
2. Was gefiel Ihnen an Ihrem Partner, als Sie sich kennenlernten bzw.<br />
heirateten? Gehörte dazu, dass er von Ihnen erwartete, umsorgt und gestützt<br />
zu werden, dass er sich gehen lassen konnte und Sie für ihn Verantwortung<br />
übernahmen?<br />
3. Was hat Ihrer Meinung nach Ihrem Partner beim Kennlernen bzw. bei der<br />
Heirat besonders an Ihnen gefallen? Was hat er sich von Ihnen erhofft?<br />
Spielten Eigenschaften Ihrerseits wie Fürsorge, Opferwille, Tüchtigkeit und<br />
Bescheidenheit eine starke Rolle?<br />
4. In welchem Umfang hat Ihr Partner dafür gesorgt, dass sich Ihr Leben<br />
entfalten konnte? Hat er Ihnen Unterstützung bei der Verwirklichung Ihrer<br />
Lebensträume gegeben? Hat er Ihre Neigungen gefördert, Ihre Bildung, Ihre<br />
berufliche Karriere?
5. Was haben Sie von Ihrem Partner für sich selbst erwartet? Hatten Sie<br />
Ansprüche an ihn, oder waren Sie eher zufrieden, dass sie ihn als Partner<br />
gewonnen hatten und dass Sie für ihn dasein konnten?<br />
6. Aus welchen Quellen bezogen Sie Selbstwert? Sind es vorwiegend die<br />
Verantwortung und die Fürsorge für andere? Wie stünde es um Ihren<br />
Selbstwert, wenn dies wegfiele?<br />
7. Was tun Sie für sich persönlich, für die Entfaltung und Pflege Ihrer<br />
individuellen Interessen und Neigungen?<br />
8. Stimmt das Bild, das Sie nach außen abgeben, mit Ihrem persönlichen<br />
Selbstbild überein oder spielen Sie anderen gewöhnlich etwas vor?<br />
9. Haben Sie sich Mühe gegeben, das Alkoholproblem Ihres Partners nicht<br />
öffentlich werden zu lassen? Wie haben Sie dies getan?<br />
10. Welche Bereiche Ihres Lebens sind durch die Alkoholabhängigkeit Ihres<br />
Partners verkümmert? In welchen Bereichen haben Sie zurückstecken<br />
müssen und sich nicht selbst entfalten können?<br />
11. Hat es durch das Trinken Ihres Partners auch Vorteile für Sie gegeben? Sind<br />
Sie selbstständiger, kompetenter, unabhängiger geworden? Werden Sie von<br />
anderen anerkannt, weil Sie so tüchtig sind und bei Ihrem Partner bleiben?<br />
12. Womit befassen Sie sich gedanklich am meisten? Geht es um Ihren Partner,<br />
sein Trinken und die drohenden Konsequenzen oder sind Sie frei für andere<br />
Gedanken?<br />
13. Wer oder was bestimmt vorwiegend Ihr Ehe- und Familienleben?<br />
14. Leiden Sie unter dem übermäßigen Drang, Ihren Partner zu kontrollieren?<br />
Begegnen Sie ihm mit Misstrauen und Hassgefühlen?<br />
In diesem Fragenkatalog sind typische Lebenserfahrungen und –risiken von Partnern<br />
von Alkoholikern thematisiert. Wenn der Angehörige viele dieser Fragen mit<br />
Antworten auf co-abhängige Tendenzen beantwortet, so ist dies als ein Anreiz für<br />
Veränderungen (durch Selbst- oder Fremdhilfe) zu sehen. Die vertiefte<br />
Selbstreflexion soll den Angehörigen dabei helfen, seine Situation besser zu<br />
erkennen und zu bewerten.<br />
Partnerinteraktion<br />
Im Umfeld von Alkoholkranken realisieren sich wie auch bei anderen dysfunktionalen<br />
Systemen besonders rigide Interaktionsmuster, die wegen ihrer<br />
Veränderungsresistenz auch als "Interaktionsfiguren" bezeichnet werden. Da die<br />
Angehörigen von Suchtkranken wegen ihrer besonderen Nähe zum Suchtkranken<br />
besonders stark den emotionalen Belastungen des Zusammenlebens mit einem<br />
Suchtkranken ausgesetzt sind, lassen sich an ihnen die relevanten<br />
Interaktionsfiguren gut ablesen.
Ein erstes, recht einfaches Interaktionsmodell unterscheidet zwischen symmetrischer<br />
und komplementärer Interaktion. Bei der symmetrischen Interaktion reagieren<br />
beide Partner mit den gleichen Verhaltensweisen (z.B. beide schimpfen; beide lassen<br />
sich gehen; beide gebrauchen Gewalt). Dieses Interaktionsmuster tritt bei<br />
Angehörigen von Suchtkranken nach klinischer Erfahrung eher selten auf. Dem<br />
gegenüber stehen komplementäre Interaktionen, bei denen die Partner mit<br />
gegensätzlichen Verhaltensweisen reagieren (z.B. einer schimpft, der andere<br />
beschwichtigt; einer lässt sich gehen, der andere verhält sich kontrolliert; einer<br />
gebraucht Gewalt, der andere erduldet diese Gewalt). Dieses sehr grob<br />
konzeptionalisierte Interaktionsmuster tritt bei Angehörigen von Suchtkranken nach<br />
klinischer Erfahrung häufiger und unflexibler als in anderen Partnerschaften auf.<br />
Empirische Untersuchungen zu diesen klinischen Eindrücken liegen kaum vor. Das<br />
Interaktionsmodell "symmetrisch-komplementär" hat jedoch Eingang in viele andere<br />
Modelle, so auch das im folgenden dargestellte, gefunden.<br />
Bereits Jackson (1954) hat eine Abfolge von Phasen mit verschiedenen<br />
Interaktionsmustern von Angehörigen von Suchtkranken beschrieben. Dieses, je<br />
nach Differenzierung drei- bzw. siebenphasige Modell, ist als erstes<br />
entwicklungsorientiertes Modell des suchtbelasteten Partnerschaft für die klinische<br />
Praxis wichtig geworden, da es eine grobe Einordnung des Partnerschaftsverhaltens<br />
ermöglicht. Dabei dominieren jeweils komplementäre Interaktionsmuster. Nach einer<br />
ersten Phase der Verleugnung des Alkoholproblems (1) mit Vermeiden des Themas<br />
oder Abstreiten eines Problems folgt die Phase der Eliminierung des Trinkproblems<br />
(2). In dieser Phase dominieren Kontrolle und Reglementierung des Partners. Sie<br />
endet mit häufiger werdenden Zuständen von Ohnmachtsgefühlen und Selbstmitleid<br />
aufgrund der Erfahrung, dass das Alkoholproblem des Partners nicht nachlässt,<br />
sondern zunimmt. In der anschließenden dritten Phase der Desorganisation (3),<br />
nachdem oft jahrelange Kontrolle zu keinem dauerhaften Erfolg geführt hat, nimmt<br />
die Partnerin das Trinken des Ehemannes hin. Er wird jetzt in seiner Rolle als Partner<br />
und Vater weniger unterstützt. wird der suchtkranke Partner ausgegrenzt. Die<br />
Partnerin fühlt sich resigniert und oft wertlos. Diese letzte Phase, die auch mit<br />
Anklage und Bestrafung einhergeht, führt bisweilen zur Trennung vom Partner, zur<br />
Einweisung/Überweisung in eine Behandlungsinstitution oder zum vorzeitigen Tod<br />
des Abhängigen.<br />
Der Versuch einer empirischen Bestätigung des Phasenmodells nach Jackson wurde<br />
u.a. von Lemert (1960) unternommen. Dabei gelang es mit Hilfe ausführlicher<br />
Interviews mit Partnern von Alkoholabhängigen in 70% aller Fälle die Abfolge der drei<br />
genannten Phasen zu bestätigen. Das ursprünglich von Jackson vorgeschlagene<br />
differenziertere Sieben-Phasenmodell konnte so nicht bestätigt werde, weshalb es<br />
hier auch nicht in seiner Ausführlichkeit dargestellt wird. Außerdem zeigte sich, dass<br />
die Frauen, deren Männer weiterhin süchtig tranken, wesentlich höhere Werte für<br />
Stresserleben aufwiesen als Frauen aus der Normalbevölkerung oder Frauen, deren<br />
Männer nach einer Suchterkrankung abstinent lebten (Kogan & Jackson, 1965).
Am differenziertesten werden die Interaktionsfiguren in folgendem Modell deutlich<br />
(vgl. Schwoon, 1993; <strong>Klein</strong>, 1997), das die wichtigsten Beziehungsmöglichkeiten im<br />
Umgang mit Suchtproblemen darstellt. Ihm liegt wiederum die Vorstellung einer<br />
Komplementarität des Partnerverhaltens in Bezug auf das Suchtverhalten des<br />
Abhängigen zugrunde. Demnach können folgende Reaktionen auftreten:<br />
Das Ausmerzen (z.B. Alkohol ausschütten)<br />
Das Bekämpfen (z.B. schimpfen, tadeln)<br />
Das Bekriegen (z.B. entwürdigen, entehren)<br />
Das Zwingen (z.B. einweisen, einsperren)<br />
Das Eindämmen (z.B. Alkohol zuteilen)<br />
Das Kontrollieren (z.B. beobachten, verfolgen)<br />
Das Heilen (z.B. pflegen, hegen)<br />
Das Bekehren (z.B. in religiöse Gemeinschaft mitnehmen)<br />
Das Helfen (z.B. unterstützen, verstehen wollen)<br />
Das Begleiten (z.B. zulassen, abwarten)<br />
Das Gewähren lassen (z.B. sich nicht kümmern)<br />
Diese Interaktionsfiguren sind als jeweilige Anpassungsleistungen an die<br />
Eigengesetzlichkeiten der Abhängigkeit eines suchtkranken Partners zu verstehen<br />
und können in kurzer Abfolge variieren.<br />
Belastungen für Angehörige<br />
Partner und Kinder von Suchtkranken leben unter stärkeren Belastungen als<br />
Menschen in funktionalen Familien (Moos et al., 1982; Sher, 1991). Diese<br />
Belastungen können im familiären Kontext als Ergebnisse von "Duldungs"- und
"Katastrophenstress" verstanden werden (Schneewind, 1991). Duldungsstress<br />
bezeichnet jene Reaktionen, die entstehen, wenn Menschen über längere Zeit<br />
hinweg Bedingungen ausgesetzt sind, die sie trotz Aversivität glauben nicht<br />
verändern zu können. Katastrophenstress entsteht in Systemen, in denen häufig<br />
unerwartete und scheinbar unberechenbare Ereignisse passieren, die von den<br />
Mitgliedern nicht kontrolliert werden können.<br />
Im einzelnen können für den Partner folgende Belastungssituationen auftreten:<br />
• Unzuverlässigkeit und Unberechenbarkeit des suchtkranken Partners<br />
• Vernachlässigung durch den suchtkranken Partner<br />
• Aggression und Gewalttätigkeit<br />
• Sexuelle Übergriffe, sexueller Missbrauch, Vergewaltigungen<br />
• Vermehrte Partnerschafts- und Familienkonflikte<br />
• Finanzielle Konflikte, erhöhtes Armutsrisiko<br />
• Drohender oder tatsächlicher Arbeitsplatzverlust<br />
• Arbeitslosigkeit, ggf. Langzeitarbeitslosigkeit<br />
• Schulden<br />
• Soziale Marginalisierung, Gefahr sozialer Isolation<br />
• Notsituationen durch Alkoholintoxikationen des Partners<br />
In Einzelfällen können diese Belastungsfaktoren durch spezifische Konstellationen im<br />
Sinne von Mediator- bzw. Moderatorvariablen erhöht oder abgeschwächt werden<br />
(Sher, 1991). So kann das Vorhandensein eines tragfähigen sozialen Netzwerks<br />
(z.B. die eigenen Eltern oder Geschwister, enge Freunde) für die Angehörigen eher<br />
protektiv wirken. Auf der anderen Seite kann das Vorhandensein psychischer<br />
Störungen beim Angehörigen (z.B. Depressionen, Angsterkrankungen, somatoforme<br />
Störungen) die Auswirkungen der oben genannten Stressfaktoren verstärken.<br />
Grundhaltungen Angehöriger<br />
Besonders wichtig für Prävention und Behandlung von Problemen Angehöriger sind<br />
die inneren Grundhaltungen, die dafür verantwortlich sind, dass Angehörige oft viele<br />
Jahre starken Leidens ertragen. Zu diesen Grundhaltungen zählt die Annahme, dass<br />
mit ausreichend Liebe, Geduld und Ausdauer das Suchtproblem des Partners zu<br />
lösen sei, dass man sich selbst nicht in den Mittelpunkt stellen darf, dass die<br />
Bedürfnisse der anderen wichtiger sind als die eigenen und dass man durch<br />
Kontrolle das Verhalten anderer dauerhaft verändern kann. Weitere Grundhaltungen<br />
können vor dem Hintergrund eines depressiv-resignativen Weltbildes entdeckt<br />
werden: Dass man sowieso nichts verändern könne, dass Abgrenzung und Abwehr<br />
alles nur schlimmer mache, dass man ohnehin im Konfliktfalle unterlegen sei. Viele
dieser Grundhaltungen sind das Resultat negativer Lebenserfahrungen – oft auch<br />
schon aus Kindheit und Jugend – und spiegeln die geringe<br />
Selbstwirksamkeitserwartung der Betroffenen wider.<br />
Obwohl nicht zu allen postulierten Grundhaltungen Forschungsresultate vorliegen,<br />
gibt es einige interessante Belege. In einer Untersuchung an 116 Partnerinnen,<br />
deren alkoholabhängige Männer bereits eine Therapie seit ein bis vier Jahren<br />
abgeschlossen hatten, zeigte sich, dass sich die Hälfte der Frauen, obwohl die<br />
Mehrzahl der Männer abstinent lebte, für deren Abstinenz verantwortlich fühlte<br />
(Fahrner, 1990). Ebenso viele leben mit einer Angst vor dem Rückfall ihres Mannes.<br />
In der schon erwähnten Untersuchung von Moos et al., (1982) ergab sich, dass<br />
Angehörige deutlich weniger Alkohol tranken als Vergleichspersonen aus der<br />
Normalbevölkerung. Sie scheinen also ein besonders kontrolliertes restriktives<br />
Verhaltensmuster zu praktizieren. Darüber hinaus hatten sie weniger soziale<br />
Kontakte und berichteten – allerdings nur im Falle einer Rückfälligkeit ihres Mannes -<br />
mehr negative Lebensereignisse. Ehefrauen von Alkoholikern erwiesen sich nur als<br />
besonders dominant, wenn sich der Alkoholismus des Partners bereits vor der<br />
Eheschließung entwickelt hatte (Lemert, 1962).<br />
Ambivalente Haltungen Angehöriger<br />
Was Professionelle wie Betroffene immer wieder überrascht, ist die oft<br />
zwiegespaltene Haltung der Angehörigen von Suchtkranken. Dies mag sich darin<br />
ausdrücken, dass sie auf der einen Seite das Suchtverhalten ihres Partners aufs<br />
Schärfste kritisieren, während sie es ihm auf der anderen Seite ermöglichen, sein<br />
Suchtverhalten fortzusetzen. Dieses Ermöglichungsverhalten ("enabling") kann in<br />
Schutz- und Entschuldigungsreaktionen gegenüber der Außenwelt bis hin zur<br />
Übernahme der gesamten Verantwortung für die Familie bestehen. Was von<br />
Angehörigen oft selbst beklagt wird, ist ihre Unfähigkeit zu konsequentem Verhalten.<br />
Dabei neigen sie oft zur Selbstüberforderung, was sich insbesondere bei der<br />
Entwicklung und Verfolgung realistischer Ziele zeigt. So resultiert das Scheitern von<br />
Angehörigen allzu oft aus unrealistischen Zielen, z.B. beim Erlernen konsequenten<br />
Verhaltens ("Ich trenne mich noch heute von Dir!"). Zum Grundkonflikt des<br />
Abhängigen gehört, dass er auf der einen Seite in ein System fast undurchdringlicher<br />
Verstrickungen eingebunden ist, auf der anderen Seite aber lange Zeit glaubt, vom<br />
Gleichgewicht mehr zu profitieren als von jeder Veränderung. Wie Steinglass (1983)<br />
zeigte, sind Veränderungen im Leben dysfunktionaler Familien – insbesondere<br />
Suchtfamilien – am ehesten in der Folge kritischer Lebensereignisse (wie z.B. Geburt<br />
eines Kindes, Arbeitsplatzverlust, Unfall oder schwere Krankheit) zu erwarten.<br />
In der klinisch psychologischen Forschung wurde die ambivalente Rolle des<br />
Angehörigen mit dem Modell des tertiären Kranheitsgewinns konzeptionalisiert.<br />
Darunter wird der Vorteil verstanden, der sich für einen Angehörigen - neben allen
Nachteilen – ergibt, wenn der Partner für längere Zeit suchtkrank ist (z.B. Zugewinn<br />
an Sozialkompetenz, Achtung und Bewunderung im Bekanntenkreis). Es wird dabei<br />
angenommen, dass über diesen Weg die "Gewinnanteile" als positive Verstärker das<br />
systemische Gleichgewicht der suchtbelasteten Familie mit aufrechterhalten.<br />
Selektive Partnerwahl bei Kindern aus suchtbelasteten Familien<br />
Dass Töchter suchtkranker Väter in erhöhtem Maße einen suchtkranken Mann zum<br />
Partner wählen, wird von Seiten erfahrener Kliniker immer wieder berichtet. Dieser<br />
geschlechtsspezifische Effekt einer selektiven Partnerwahl ("assortive mating") von<br />
Töchtern alkoholabhängiger Väter konnte in einer Untersuchung mit mehr als 1400<br />
Personen deutlich bestätigt werden, wobei allerdings das Geschlecht des<br />
alkoholabhängigen Elternteils, d.h. ob es sich um Vater oder Mutter handelte, keine<br />
Rolle spielte. Dabei stellte sich heraus, dass die Töchter aus suchtbelasteten<br />
Familien mehr als zweieinhalb Mal so häufig einen suchtkranken Partner heirateten<br />
als Vergleichsprobandinnen ohne familiäre Suchtbelastung. "Data relating to 708<br />
men and 708 women, the parents of the questionnaire respondents, revealed that<br />
even after controlling for the increased rate of alcohol-dependent spouses among<br />
alcoholics, assortive mating appears to be associated with positive family histories of<br />
alcoholism. Within this sample, nonalcoholic daughters of alcoholics were more than<br />
twice as likely to marry an alcoholic as nonalcoholic daughters of nonalcoholics,<br />
irrespective of the alcoholic parent´s gender" (Schuckit et al., 1994, 237).<br />
Während für die Töchter aus suchtbelasteten Familien der Effekt einer selektiven<br />
Partnerwahl nachgewiesen worden ist, ist ein derartiger Effekt für Söhne nicht<br />
bekannt. Aus einer Untersuchung an alkoholabhängigen Männern und Frauen geht<br />
hervor, dass die alkoholabhängigen Frauen der Stichprobe in 31.1% aller Fälle mit<br />
einem alkoholabhängigen Mann verheiratet waren, während sich die<br />
alkoholabhängigen Männer der Stichprobe nur in 8.3% aller Fälle eine<br />
alkoholabhängige Frau zur Partnerin wählten (Hall et al., 1983).<br />
Psychische Störungen bei Partnern von Suchtkranken<br />
Dass Angehörige von Suchtkranken eher als Normalpersonen unter psychischem<br />
Stress und psychischen Störungen leiden können, wurde bereits erwähnt. Nach der<br />
Untersuchung von Kogan et al. (1963) war es etwa die Hälfte der Partner, die<br />
psychisch auffällig waren, ohne dass in der damaligen Untersuchung die
entsprechenden Störungskategorien erhoben worden waren. Diese Störungen<br />
können sowohl vor der Beziehung mit einem Suchtkranken bestanden haben oder<br />
sich in Folge der Beziehung entwickelt oder verstärkt haben. Rimmer & Winokur<br />
(1972) analysierten die psychische Gesundheit von 57 Ehefrauen alkoholabhängiger<br />
Männer, die in ambulanter Behandlung waren. 42% hatten wiesen eine<br />
Familiengeschichte bezüglich Suchtstörungen bei Verwandten ersten oder zweiten<br />
Grades auf. Die Vergleichszahl für affektive Störungen lag bei 16%. Weitere 16%<br />
ergaben sich für andere psychiatrische Störungen. Selbst betroffen von Depression<br />
waren 32% der Partnerinnen alkoholabhängiger Männer. Die Vergleichsquote bei<br />
parallelisiert ausgewählten Normalprobanden lag bei 2%.<br />
Von den psychischen Störungen, die bei Angehörigen Suchtkranker, nach klinischer<br />
Erfahrung am häufigsten auftreten können, sind zu nennen: Angststörungen,<br />
affektive Störungen, somatoforme Störungen und substanzbezogene Störungen<br />
(Achse-I-Störungen). Unter Achse-I-Störungen werden solche Störungen verstanden,<br />
die in der Regel nicht überdauernd, oft reaktiv, meist mit Krankheitseinsicht und<br />
Leidensdruck versehen und im Verhältnis zu den Persönlichkeitsstörungen leichter<br />
zu behandeln sind. Sie werden- daher der Name – in den psychiatrischen<br />
Klassifikationssystemen ICD-10 und DSM-IV auf der ersten von fünf Achsen codiert.<br />
Demgegenüber sind die Achse-II-Störungen solche, die relativ früh im Leben, meist<br />
schon in der Adoleszenz, beginnen, deren Symptome in Widerspruch zu den<br />
vorherrschenden kulturellen Normen und Werten stehen, eher überdauernd und<br />
schwer zu behandeln sind. Die wichtigsten Achse-II-Störungen in diesem<br />
Zusammenhang sind die Persönlichkeitsstörungen. Bei diesen kommt meist noch<br />
das Merkmal der Ich-Syntonie (Ich-Stimmigkeit) hinzu. Dabei erleben sich die<br />
betroffenen Personen als nicht problembelastet oder gar gestört, sondern lokalisieren<br />
die Ursache interaktionaler oder gar individueller Probleme bei anderen ("Du bist<br />
schuld!").<br />
Bei Angehörigen von Suchtkranken treten vor allem zwei Persönlichkeitsstörungen<br />
häufiger als bei Normalprobanden auf (siehe z.B. Salzmann & Körkel, ???):<br />
1. Die abhängige (asthenische) Persönlichkeitsstörung (ICD 10: F60.7)<br />
2. Die ängstlich (vermeidende) Persönlichkeitsstörung (ICD 10: F60.6).<br />
Deren Symptome werden im folgenden aufgelistet.<br />
Als Hauptmerkmale der abhängigen (dependenten) Persönlichkeitstörung nach ICD-<br />
10 werden benannt (Dilling et al., 1991):<br />
a. Überlassung der Verantwortung für wichtige Bereiche des eigenen Lebens an<br />
andere.<br />
b. Unterordnung eigener Bedürfnisse unter die anderer Personen, zu denen eine<br />
Abhängigkeit besteht.
c. Mangelnde Bereitschaft zur Äußerung angemessener Ansprüche gegenüber<br />
Personen, zu denen eine Abhängigkeit besteht.<br />
d. Selbstwahrnehmung als hilflos, inkompetent und schwach.<br />
e. Häufige Ängste vor Verlassenwerden und ständiges Bedürfnis, sich des<br />
Gegenteils zu versichern; beim Alleinsein sehr unbehagliche Gefühle.<br />
f. Erleben von innerer Zerstörtheit und Hilflosigkeit bei der Beendigung einer<br />
engen Beziehung.<br />
g. Bei Missgeschick neigen diese Personen dazu, die Verantwortung anderen<br />
zuzuschieben.<br />
Die Merkmale dieser Persönlichkeitsstörung, die sehr deutlich an viele klinische<br />
Schilderungen von Angehörigenverhalten erinnern, müssen nicht alle gleichzeitig<br />
vorliegen, um die entsprechende Diagnose zu rechtfertigen. Es müssen vielmehr<br />
wenigstens vier der genannten Merkmale vorliegen.<br />
Neben der abhängigen Persönlichkeitsstörung, die von allen<br />
Persönlichkeitsstörungen bei Angehörigen von Suchtkranken am häufigsten<br />
vorliegen dürfte, ist die ängstlich (vermeidende) Persönlichkeitsstörung ebenfalls<br />
wichtig. Ihre Hauptsymptome nach ICD-10 lauten (Dilling et al., 1991):<br />
a. Andauernde und umfassende Gefühle von Anspannung und Besorgtheit.<br />
b. Gewohnheitsmäßige Befangenheit und Gefühle von Unsicherheit und<br />
Minderwertigkeit.<br />
c. Andauernde Sehnsucht nach Zuneigung und Akzeptiertwerden.<br />
d. Überempfindlichkeit gegenüber Zurückweisung und Kritik.<br />
e. Weigerung zur Aufnahme von Beziehungen, solange der betreffenden Person<br />
nicht unkritisches Akzeptiertwerden garantiert ist; sehr eingeschränkte<br />
persönliche Beziehungen.<br />
f. Gewohnheitsmäßige Neigung zur Überbetonung potenzieller Gefahren oder<br />
Risiken alltäglicher Situationen, bis zur Vermeidung bestimmter Aktivitäten,<br />
ohne das Ausmaß phobischer Vermeidung.<br />
g. Eingeschränkter Lebensstil wegen des Bedürfnisses nach Gewissheit und<br />
Sicherheit.<br />
Auch bei dieser Persönlichkeitsstörung langt das Vorliegen von vier Symptomen aus.<br />
Im Falle der Angehörigen von Suchtkranken ist zusätzlich anzunehmen, dass sie<br />
Mischformen der vermeidenden und ängstlichen Persönlichkeitsstörung in sich<br />
vereinigen.
Außerdem können sie Anteile der zwanghaften und selbstunsicheren<br />
Persönlichkeitsstörung in sich vereinen.<br />
Da, wie schon erwähnt, bei weitem nicht alle Partner von Alkoholabhängigen unter<br />
einer psychischen Störung leiden müssen, liegt es für die Forschung an, hier genaue<br />
Prävalenzen zu erheben, damit zwischen verschiedenen Störungsbildern bei<br />
Angehörigen einerseits und Reaktions- und Bewältigungsmustern andererseits klar<br />
unterschieden werden kann.<br />
Hilfen für Angehörige<br />
Das Hilfesystem für Angehörige ist bei weitem nicht so differenziert wie das für<br />
Suchtkranke. Dennoch gibt es zahlreiche Möglichkeiten der Hilfe, die möglichst früh<br />
einsetzen sollten. Diese bestehen in den bekannten Selbsthilfegruppen, die teilweise<br />
speziell für Angehörige (z.B. Al-Anon) durchgeführt werden. In manchen Fällen, in<br />
denen eine komplexe, behandlungsbedürftige psychische Störung vorliegt, sollte<br />
professionelle Hilfe in Form von Psychotherapie aufgesucht werden. Besonders<br />
wichtig erscheinen Formen der sozialen Unterstützung und Gruppenangebote, da<br />
diese den Angehörigen Hilfen auch jenseits der zeitlich limitierten Angebote<br />
(Therapiestunde, Selbsthilfetreffen) bereitstellen können.<br />
II. Kinder von Suchtkranken<br />
Die zweite große Angehörigengruppe, auf die im Rahmen dieses Beitrags fokussiert<br />
wird, sind die Kinder von Alkoholabhängigen. Auch diese Gruppe wurde traditionell<br />
wenig berücksichtigt. Inzwischen liegen zu diesem Themenbereich jedoch – vor<br />
allem aus dem angloamerikanischen Bereich – zahlreiche Forschungsergebnisse<br />
und Interventionsansätze (siehe zusammenfassend z.B. <strong>Klein</strong> & Zobel, 1997) vor.<br />
Die wissenschaftliche Aufarbeitung des Themas "Kinder von Suchtkranken" ist<br />
dementsprechend weiter fortgeschritten als die des vorausgehenden<br />
Themenbereichs "Partner von Suchtkranken".
Zahlen zum Thema Kinder von Alkoholabhängigen<br />
In einer Vielzahl von Studien wurde nachgewiesen (z.B. McKenna & Pickens, 1981;<br />
Hesselbrock et al., 1982), dass Alkoholabhängige überzufällig oft aus Familien<br />
stammen, in denen bereits Vater bzw. Mutter oder beide Elternteile abhängig waren.<br />
Schon im Altertum wurde von Philosophen wie Aristoteles und Plutarch beobachtet,<br />
dass Kinder von Trinkern oft selbst ein auffälliges Trinkverhalten entwickelten. Der<br />
von Plutarch stammende Satz "Trinker zeugen Trinker" (zit.n. Goodwin, 1979, 57)<br />
weist auf diesen Sachverhalt anschaulich hin, suggeriert aber zugleich, dass die<br />
Abhängigkeit quasi durch Geburt, und damit unausweichlich, an die Kinder<br />
weitergegeben wird.<br />
Eine oft zitierte Reviewstudie (Cotton, 1979) zeigte, dass von knapp 4000<br />
alkoholabhängigen Personen 30.8% einen abhängigen Elternteil aufwiesen.<br />
Demgegenüber gaben in der nichtklinischen Kontrollstichprobe von 922 Personen<br />
lediglich 4.7% einen abhängigen Elternteil an. Für eine gemischte psychiatrische<br />
Vergleichsstichprobe von 1082 Patienten konnte in 12.0% aller Fälle<br />
Alkoholabhängigkeit in der Elterngeneration ermittelt werden.<br />
Eine Langzeitstudie über einen Zeitraum von 33 Jahren (Drake & Vaillant, 1988)<br />
brachte für erwachsene Kinder aus Suchtfamilien in 28% der Fälle eine Diagnose für<br />
Alkoholabhängigkeit. Männer mit einem abhängigen Vater hatten mehr als doppelt so<br />
häufig eine Alkoholabhängigkeit als Männer ohne abhängigen Vater.<br />
Als besonders belastet erweisen sich diejenigen jungen Erwachsenen aus einer<br />
suchtbelasteten Familie, bei denen beide Elternteile suchtkrank waren oder bei<br />
denen ein suchtkranker Elternteil seine Abhängigkeit nicht erfolgreich bewältigen<br />
konnte. Diese Ergebnisse unterstützen die Annahme, dass es das quantitative und<br />
qualitative Ausmaß der Exposition gegenüber der elterlichen Abhängigkeit ist, das<br />
sich pathogen auf die Entwicklung der Mitglieder der nächster Generation auswirkt.<br />
Junge Erwachsene, deren Eltern ihre Abhängigkeit schon lange überwunden haben<br />
oder bei denen nur ein Elternteil suchtkrank war, haben eine vergleichsweise<br />
bessere Entwicklungsprognose, die sich – wie Moos et al. (1990) zeigen konnten –<br />
vielfach gar nicht von der junger Erwachsener aus normalen Familien unterscheidet.<br />
Die Autoren kommen deshalb auch zu der Schlussbewertung: "The stress-related<br />
influence of parental alcoholism seems to diminish or disappear when the parent<br />
succeeds in controlling his or her alcohol abuse" (Moos et al., 1990, 183).
Die aufgeführten Studien belegen in Übereinstimmung mit einer Vielzahl anderer<br />
Untersuchungen (siehe zusammenfassend: Sher, 1991; Lachner & Wittchen, 1997),<br />
dass Kinder von Alkoholikern, und zwar insbesondere Söhne, als Risikogruppe für<br />
die Entwicklung von Alkoholmissbrauch und -abhängigkeit angesehen werden<br />
müssen. Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass diese Kinder im<br />
Vergleich zu Kindern nicht suchtkranker Eltern ein bis zu sechsfach höheres<br />
Risiko haben, selber abhängig zu werden oder Alkohol zu missbrauchen.<br />
Belegt ist auch, dass für Kinder in suchtbelasteten Familien das Risiko der<br />
Erkrankung an anderen psychischen Störungen (insbesondere Angststörungen,<br />
Depressionen, Persönlichkeitsstörungen) deutlich - wenn auch nicht so stark wie für<br />
Abhängigkeitserkrankungen - erhöht ist (Velleman, 1992).<br />
Jedoch ist ausdrücklich nicht davon auszugehen, dass alle Kinder von Alkoholikern<br />
eine eigene Abhängigkeit oder andere psychische Störungen entwickeln müssen.<br />
Vielmehr spielen zahlreiche pathogene und protektive Faktoren bei der Transmission<br />
von Störungen, also der Weitergabe einer Krankheit von der Elterngeneration auf die<br />
Kinder, eine wichtige abschwächende oder verstärkende Rolle. So hat sich gezeigt,<br />
dass die Abhängigkeit beider Elternteile das Erkrankungsrisiko der Kinder erhöht<br />
(Quinten & <strong>Klein</strong>, 1999), wie andererseits die Aufrechterhaltung von<br />
Transaktionsmustern und –ritualen aus der Zeit vor der Abhängigkeit das<br />
Erkankungsrisiko für die Kinder abschwächt (Bennett & Wolin, 1994).<br />
Klar ist jedoch, dass die Gruppe der Kinder aus suchtbelasteten Familien als<br />
Ganzes eine höhere Vulnerabilität gegenüber Verhaltens- und Erlebensstörungen<br />
aufweist als Kontrollgruppen mit normalem familiärem Hintergrund. Es zeichnet sich<br />
dabei ab, dass Merkmale der Familienumwelt, Persönlichkeitseigenschaften,<br />
Kognitionen und biologische Dispositionen des Kindes interagieren und<br />
letztendlich das Auftauchen sowie die Ausprägung von psychischen<br />
Störungen bestimmen.<br />
Neuere Studien zeigen (siehe zusammenfassend Pollock, 1992), dass vor allem<br />
Söhne von Alkoholabhängigen als junge Erwachsene auf Alkohol oft anders<br />
reagieren als Vergleichspersonen, und zwar sowohl subjektiv (d.h. in ihrem<br />
eigenen Empfinden) als auch objektiv (d.h. mit physiologischen Parametern).<br />
Im einzelnen ergab sich, dass sie einerseits die berauschenden Effekte des Alkohols<br />
erst bei einer höheren Konzentration wahrnahmen - also mehr trinken mussten, um<br />
den gleichen berauschenden Effekt zu spüren wie Vergleichspersonen. Die später<br />
einsetzenden unangenehmen Effekte, - gemeinhin als Kater, Hangover usw. bekannt<br />
- nahmen sie ebenfalls in geringerem Maße wahr. Andererseits wurde für Söhne von<br />
Abhängigen eine erhöhte Stressdämpfung nach Alkoholkonsum nachgewiesen<br />
(Levenson et al., 1987). Dies hat zur Folge, dass Alkoholtrinken positiv erlebt wird, da<br />
es das subjektive Stresserleben verringert. Diese Ergebnisse (allgemeine vegetative<br />
Hyperreagibilität und herabgesetzte Sensitivität auf Ethanol) machen deutlich, dass<br />
eine dispositionell erhöhte Toleranz in bezug auf Alkohol sowie verstärkte
Stressdämpfungseffekte entscheidende Risikofaktoren im Rahmen des genetisch<br />
determinierten Vulnerabilitätsanteils für die Entwicklung von Abhängigkeit darstellen.<br />
Ein zweiter wesentlicher Risikofaktor, neben den biologischen Anlagen, ist in der<br />
Familienumwelt der Kinder suchtkranker Eltern zu sehen. Die in diesem<br />
Zusammenhang am häufigsten anzutreffende Familienkonstellation, bestehend aus<br />
einem alkoholabhängigen Vater und einer nicht suchtkranken Mutter, bringt<br />
entscheidende Veränderungen in der Dynamik der betroffenen Familien mit sich. Die<br />
Eltern können oft ihren Pflichten als Erzieher der Kinder nicht mehr in genügendem<br />
Maße nachkommen, da der Abhängige in vielen Fällen auf das Suchtmittel fixiert ist<br />
und daher die Kinder kaum mehr wahrnimmt. Die Mutter braucht ihre Kräfte meist für<br />
das grundlegende Funktionieren der Familie und die Wahrung einer vermeintlich<br />
intakten Fassade nach außen hin. All diese suchtbedingten intrafamilialen<br />
Veränderungen zeigen Wirkungen hinsichtlich einer negativeren<br />
Familienatmosphäre, einer deutlich schwächeren oder stärkeren, d.h. extremeren,<br />
Familienkohäsion sowie in Bezug auf die Frustration kindlicher<br />
Bedürfnisbefriedigungen (z.B. nach Sicherheit, Verlässlichkeit, Geborgenheit) und die<br />
Qualität der Eltern-Kind-Bindungen.<br />
Hauptsymptome<br />
Kinder in suchtbelasteten Familien gelten, wie bereits erwähnt, als eine Risikogruppe<br />
bezüglich der Entwicklung eigener Suchterkrankungen ab dem Jugendalter, aber<br />
auch bezüglich vielfältiger psychischer und körperlicher Störungen in Kindheit,<br />
Jugend- und Erwachsenenalter. Am häufigsten werden "die Symptomgruppen<br />
Hyperaktivität, Störungen des Sozialverhaltens, Intelligenzminderungen, somatische<br />
Probleme und Misshandlungen sowie Angst und depressive Symptome" (Elpers &<br />
Lenz, 1994, 107) erwähnt.<br />
Im Jahre 1969 legte Margaret Cork mit der Veröffentlichung ihres Buches "The<br />
forgotten children" eine erste systematische klinische Befragung von Kindern aus<br />
suchtbelasteten Familien vor. Sie hatte in ihrer Studie 115 Kinder aus<br />
Alkoholismusfamilien im Alter von 8 - 16 Jahren ausführlich interviewt. Die von den<br />
betroffenen Kindern am häufigsten genannten Anliegen und Erfahrungen waren:<br />
1. Nicht zu Freunden gehen, um nicht in die Zwangslage zu geraten, diese zu<br />
sich nach Hause einladen zu müssen, wo die Eltern sich beschämend<br />
verhalten könnten.
2. In der Schule mit den Gedanken zu Hause sein, was dort gerade Schlimmes<br />
passiert oder bald passieren wird.<br />
3. Andere Kinder beneiden oder eifersüchtig auf diese sein, wenn sie Spaß und<br />
Leichtigkeit mit ihren Eltern erleben.<br />
4. Sich als Kind unter Gleichaltrigen isoliert, abgewertet und einsam fühlen.<br />
5. Sich von den Eltern vernachlässigt, bisweilen als ungewolltes Kind fühlen.<br />
6. Für die Eltern sorgen, sich um sie ängstigen, insbesondere wenn die Mutter<br />
süchtig trinkt.<br />
7. Sich um Trennungsabsichten oder vollzogene Trennungen der Eltern<br />
unablässig Sorgen machen.<br />
8. Als Jugendlicher die Eltern nicht im Stich lassen wollen (z. B. nicht von zu<br />
Hause ausziehen können).<br />
9. Die Eltern für ihr Fehlverhalten entschuldigen. Lieber andere Menschen oder<br />
sich selbst beschuldigen.<br />
(10)Vielfache Trennungen und Versöhnungen der Eltern erleben und sich nicht auf<br />
einen stabilen,<br />
dauerhaften Zustand verlassen können.<br />
11. Wenn der trinkende Elternteil schließlich mit dem Alkoholmissbrauch aufhört,<br />
weiterhin selbst Probleme haben oder solche suchen.<br />
Zu den von Kindern insgesamt am häufigsten genannten Erfahrungen gehört die der<br />
Unberechenbarkeit des elterlichen Verhaltens. Dies bezieht sich verstärkt auf den<br />
Alkohol trinkenden, aber auch auf den jeweils anderen, (meist als coabhängig<br />
bezeichneten) Elternteil. Versprechungen, Vorsätze, Ankündigungen usw. werden oft<br />
nicht eingehalten, aber auch inkonsistentes Belohnungs- und Bestrafungsverhalten<br />
herrscht vor. Generell werden sehr viele Ambivalenzerfahrungen und<br />
Loyalitätskonflikte berichtet (z.B. manchmal übermäßig verwöhnt und manchmal<br />
übermäßig bestraft zu werden; den alkoholabhängigen Elternteil extrem zu verachten<br />
und zu hassen, ihn aber auch sehr zu mögen und zu umsorgen; den<br />
alkoholabhängigen Elternteil auch im Erwachsenenalter noch kontrollieren zu<br />
müssen). In manchen Fällen wurde deutlich, dass Kinder das süchtige Trinken ihrer<br />
Eltern auf sich selbst attribuierten, z.B. wegen spezifischer eigener<br />
Fehlverhaltensweisen oder - im Extremfall - wegen ihrer bloßen Existenz.<br />
West & Prinz (1987) benennen in ihrer Überblicksarbeit, in der sie 46 empirische<br />
Studien aus den Jahren 1975 bis 1985 auswerteten, Auswirkungen in den folgenden<br />
Bereichen:<br />
(1) Hyperaktivität und Verhaltensauffälligkeiten<br />
(2) Substanzmissbrauch, Delinquenz und Schuleschwänzen
(3) Kognitive Funktionsstörungen<br />
(4) Soziale Interaktionsprobleme<br />
(5) Körperliche Probleme<br />
(6) Angst und Depressionen<br />
(7) Körperliche Misshandlung, Missbrauch und Vernachlässigung<br />
(8) Dysfunktionale Familieninteraktionen.<br />
Für Kinder in Suchtfamilien gelten besondere Regeln, z.B. dass Gefühlskontrolle,<br />
Rigidität, Schweigen, Verleugnung und Isolation geeignete<br />
Problembewältigungsverhaltensweisen (Wegscheider, 1988) sind. Es herrschen<br />
auch oft extreme Belastungssituationen vor. Diese sind dadurch gekennzeichnet,<br />
dass<br />
sie mehr Streit, konflikthafte Auseinandersetzungen und<br />
Disharmonie zwischen den Eltern erleben als andere Kinder;<br />
sie extremeren Stimmungsschwankungen und<br />
Unberechenbarkeiten im Elternverhalten ausgesetzt sind;<br />
sie häufiger in Loyalitätskonflikte zwischen den Elternteilen<br />
gebracht werden;<br />
Verlässlichkeiten und Klarheiten im familiären Ablauf weniger<br />
gegeben sind sowie Versprechungen eher gebrochen werden;<br />
sie häufiger Opfer von Misshandlungen (physisch, psychisch,<br />
sexuell) und Vernachlässigung werden.<br />
Es wäre wünschenswert, zu den bereits erforschten Aspekten stärker die subjektiven<br />
Theorien der betroffenen Kinder zum Problemverhalten der Eltern hinzuzufügen.<br />
Dies könnte im übrigen Interventions- und Präventionsprogrammen verstärkten<br />
Nutzen einbringen, da diese dann direkt an den Problemkonstruktionen der<br />
Betroffenen ansetzen.<br />
Drohende Konsequenzen
Aus einer umfangreichen Überblicksarbeit zu den familiär übertragenen<br />
Vulnerabilitätsfaktoren geht das erhöhte Erkrankungsrisiko für Kinder in<br />
suchtbelasteten Familien deutlich hervor (Lachner & Wittchen, 1997). Unter<br />
Vulnerabilität wird dabei das erhöhte Risiko für die Belastung mit einer psychischen<br />
Störung, nicht das reale Vorhandensein einer derartigen Störung verstanden. Im<br />
einzelnen unterscheiden die Autoren entsprechend dem biopsychosozialen Modell<br />
zwischen psychischen Störungen, emotionalen Merkmalen und<br />
Persönlichkeitseigenschaften, kognitiven, sozialpsychologischen und biologischen<br />
Variablen in ihren Auswirkungen auf die Kinder und Jugendlichen aus<br />
Alkoholikerfamilien. Aus der Vielzahl der berichteten Studien zeigen folgende<br />
Vulnerabilitätsmerkmale die deutlichsten Unterschiede zwischen Kindern in<br />
suchtbelasteten Familien und Kontrollkindern, wodurch klar wird, welche<br />
Konsequenzen für die Kinder von Suchtkranken am ehesten drohen:<br />
1. Lebensgeschichtlich früher Beginn mit Alkohol- und Drogenmissbrauch.<br />
(2) Häufigere Diagnosen in den Bereichen Angst, Depression und<br />
Essstörungen.<br />
(3) Stärkere Hyperaktivität, Impulsivität und Aggressivität.<br />
(4) Defizite im schulischen Leistungsbereich.<br />
(5) Defizite im visuellen Wahrnehmungsbereich.<br />
6. Stärkere intrafamiliäre Konflikte.<br />
Zu den drohenden Konsequenzen sind insbesondere solche Persönlichkeits- und<br />
Verhaltensänderungen zu zählen, die aus der sozialpsychologischen Forschung<br />
bekannt wurden, wenn Personen keine ausreichende Kontrolle über die eigenen<br />
Handlungsfolgen und die Umwelt ausüben können. Dazu zählen insbesondere<br />
negative Selbstwirksamkeitserwartung und erlernte Hilflosigkeit. Beide Phänomene<br />
treten auf, wenn ein Individuum zu wenige Erfahrungen erfolgreicher Interaktionen<br />
mit seinem Umfeld macht und es seine Handlungsziele überwiegend nicht<br />
durchsetzen kann.<br />
Es ist jedoch anzumerken, dass viele Symptome für Kinder aus Suchtfamilien nicht<br />
spezifisch sind, sondern dass einerseits bei Kindern aus anderen dysfunktionalen<br />
Familien ähnliche Konsequenzen möglich sind, und dass andererseits die direkt<br />
alkoholbezogenen Vulnerabilitätsfaktoren (z.B. genetisches Risiko) stark mit anderen<br />
Variablen (z.B. familiale Gewalt) kovariieren.
Risikovariablen<br />
Im folgenden wird zwischen direkten und indirekten Auswirkungen elterlichen<br />
Alkoholmissbrauchs auf die Entwicklung von Kindern unterschieden. Diese Einflüsse<br />
sind besonders bedeutsam, da sie die Vulnerabilität für bestimmte<br />
Verhaltensstörungen beeinflussen können. Die indirekten Auswirkungen sind<br />
solche, die in Interaktion mit Umwelt- und Familienvariablen ihre Pathogenität<br />
entfalten. Bei den indirekten Auswirkungen sind es nicht der Alkohol, die Droge oder<br />
die psychotrope Substanz selbst, welche die Schädigung beim Kind hervorruft,<br />
sondern die Begleitumstände und Konsequenzen des Missbrauchs bzw. der<br />
Abhängigkeit. Hierzu zählen z.B. die Instabilität und Unberechenbarkeit des<br />
Elternverhaltens, die häufiger auftretenden Formen von Kindesmisshandlung, -<br />
missbrauch und –vernachlässigung, die häufigeren Trennungen und Scheidungen,<br />
chronische Konflikte und Streitigkeiten in den Familien, ein erhöhtes Ausmaß an<br />
physischer und psychischer Gewalt usf. Im allgemeinen ist der innerfamiliäre Stress<br />
(besonders Duldungs- und Katastrophenstress) deutlich erhöht. Bei den Kindern<br />
entwickeln sich Symptome mangelnden Selbstwertgefühls, geringerer<br />
Selbstwirksamkeitserwartung und häufig auch Selbsthass und Schuldgefühle (Sher,<br />
1991; Nastasi & DeZolt, 1994).<br />
Zu den möglichen direkten Auswirkungen elterlichen Alkoholmissbrauchs auf<br />
Kinder zählt an erster Stelle das fetale Alkoholsyndrom (FAS) und die fetalen<br />
Alkoholeffekte, im deutschen Sprachraum auch oft Alkoholembryopathie (AE)<br />
genannt. Hinzu kommen Alkoholvergiftungen, die nach Ergebnissen von Lamminpää<br />
& Vilska (1990) häufiger bei Kindern aus suchtbelasteten Familien als bei<br />
unbelasteten Kindern auftreten.<br />
Alkoholembryopathie<br />
Bei diesem Syndrom sind vor allem kognitive und neuropsychiatrische Schädigungen<br />
festzustellen. Die Hauptsymptome des FAS sind Dysfunktionen des zentralen<br />
Nervensystems, abnormale Gesichtselemente, Verhaltensdefizite und<br />
Wachstumsrückstände (Retardierung). Auch werden häufig enge Zusammenhänge<br />
mit Hyperaktivität, geistiger Retardierung und EEG-Anomalien berichtet.
In Deutschland kommen heutzutage jährlich etwa 2200 Kinder mit fetalem<br />
Alkoholsyndrom zur Welt (Löser, 1995). Mit einer Prävalenz von 1:300<br />
Neugeborenen ist die Alkoholembryopathie (AE) hierzulande häufiger als z.B.<br />
Morbus Down mit 1:650 (Löser, 1995). Aufgrund der sehr permissiven<br />
Alkoholkonsumkultur in unserer Gesellschaft wird das Gefährdungsrisiko für<br />
Ungeborene hierzulande im internationalen Vergleich als hoch angesehen.<br />
Da die Problematik der Alkoholembryopathie an anderer Stelle dieses Buches<br />
(Querverweis geben!) ausführlich dargestellt wird, mögen diese kurzen Hinweise<br />
ausreichen.<br />
Hilfen für Kinder von Alkoholabhängigen<br />
Aus dem gesamten Forschungsstand (West & Prinz, 1987) ist abzuleiten, dass<br />
entscheidend für die Pathogenisierung des Kindes in der suchtbelasteten Familie die<br />
Dauer, Art und Häufigkeit der Exposition gegenüber den Folgen des süchtigen<br />
Verhaltens eines oder beider Elternteile ist. Für die Frage, in welchen Fällen es<br />
also zur Transmission einer Störung kommt, sind vor allem Qualität und Quantität der<br />
Exposition gegenüber den negativen Folgen der Alkoholabhängigkeit der Eltern<br />
entscheidend. Daher sind dies auch die für Prävention und Intervention<br />
bedeutsamsten Aspekte.<br />
Unter präventiven Aspekten erscheint es ratsam, Kindern von Alkoholikern möglichst<br />
früh Hilfen bereitzustellen, um eine optimale Entwicklung wahrscheinlicher zu<br />
machen bzw. erste auftretende Störungen schnell zu behandeln. Daher bewegen<br />
sich Frühinterventionen für Kinder aus suchtbelasteten Familien meist an der<br />
Grenzlinie zwischen Primär- und Sekundärprävention. Diese Frühinterventionen<br />
umfassen meist die ganze Familie. Dabei müssen auf der einen Seite das<br />
vorhandene Risiko und die resultierende Vulnerabilität, auf der anderen Seite die<br />
bereits vorhandenen Ressourcen genau erfaßt werden, um beide Bereiche in<br />
Präventionsplanung und effektive Frühintervention einfließen zu lassen.<br />
Aber auch die direkte Arbeit mit Kindern von Suchtkranken hat sich als wichtig und<br />
wirksam erwiesen (Robinson & Rhoden, 1998). Dies trifft zum einen auf diejenigen<br />
Fälle zu, in denen die Eltern (noch) nicht oder nur ein Elternteil (i.d.R. der
Angehörige) bereit sind, Hilfe anzunehmen, zum anderen – als unterstützende<br />
Maßnahme -, wenn die Eltern bereits eine Hilfeleistung erhalten. Im einzelnen ist bei<br />
den Hilfeleistungen für Kinder von Suchtkranken zwischen Einzel- und Gruppenarbeit<br />
mit den Kindern, begleitender Elternarbeit und freizeitpädagogischen Angeboten zu<br />
unterscheiden. Diese geschieht in der Regel im ambulanten Kontext (siehe z.B.<br />
Dilger, 1994; Ehrenfried et al., 1998), kann aber auch in komplexeren Fällen halb-<br />
oder vollstationär, vor allem im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie, erfolgen.<br />
Die wichtigsten Prinzipien für Hilfen für Kinder von Alkoholabhängigen sind in der<br />
Frühzeitigkeit, der Dauerhaftigkeit und Vernetztheit der Maßnahmen in Bezug auf<br />
andere familienbezogene Hilfen zu sehen.<br />
Schluss<br />
Der vorliegende Beitrag hat zum Ziel, anhand der noch sehr spärlichen<br />
Forschungsergebnisse zu Angehörigen von Suchtkranken mit den Schwerpunkten<br />
Partner und Kinder die Sensibilität für diese Personengruppen, die mehr Personen<br />
umfassen als die Suchtkranken selbst, zu steigern. Entsprechende Konsequenzen<br />
für das Hilfesystem scheinen naheliegend und zwingend: Darunter sind<br />
Frühintervention, Umfeldinterventionen, spezialisierte, zumindest jedoch<br />
problemsensibilisierte, Hilfeangebote, Verstärkung der Sekundärprävention für<br />
Angehörige, Schwerpunktprävention für Risikogruppen und schließlich ressourcen-<br />
und lebensfeldorientierte Hilfen zu verstehen. Es bleibt zu hoffen, dass die sich<br />
abzeichnenden Innovationen innerhalb der Suchthilfe zu Gunsten dieser<br />
Personengruppen zu einer Intensivierung der Hilfemaßnahmen und der<br />
Professionalisierung führen werden. Schließlich ist noch anzumerken, dass Hilfen für<br />
Partner und Kinder von Alkoholabhängigen sich in gegenseitiger Abstimmung<br />
ergänzen und befruchten können. Die Zielgröße heißt dann Hilfen für die von Sucht<br />
belastete Familie.<br />
Literatur
Arenz-Greiving, I. (1998). Selbsthilfegruppen für Suchtkranke und Angehörige. Ein<br />
Handbuch für Leiterinnen und Leiter. Freiburg: Lambertus.<br />
Bachmeier, R., Funke, W., Herder, F., Kluger, H., Medenwaldt, J., Missel, P.,<br />
Weissinger, V. & Wüst, G. (1999). Basisdokumentation 1998. Ausgewählte Daten zur<br />
Entwöhnungsbehandlung im Fachverband Sucht e.V. Bonn: Fachverband Sucht e.V.<br />
(= Reihe: Qualitätsförderung in der Entwöhnungsbehandlung; Band 7).<br />
Bennett, L.A. & Wolin, S.J. (1994). Familienkultur und Alkoholismus-Weitergabe. In:<br />
Appel, C. (Hrsg.) Kinder alkoholabhängiger Eltern. Ergebnisse der Suchtforschung.<br />
(S. 15 - 44). Freiburg: Lambertus.<br />
Cermak, T. (1991) Co-addiction as a disease. Psychiatry Annals 21, 266 –272.<br />
Cork, M.R. (1969). The forgotten children: A study of children with alcoholic parents.<br />
Toronto: Addiction Research Foundation.<br />
Cotton, N.S. (1979). The familial incidence of alcoholism. Journal of Studies on<br />
Alcohol 40, 89 - 116.<br />
Dilger, H. (1994). "Maks": Ein Modellprojekt für Kinder und ihre suchtkranken Eltern.<br />
In: Arenz-Greiving, I. & Dilger, H. (Hrsg.): Elternsüchte - Kindernöte. Berichte aus der<br />
Praxis. (S. 68 - 78). Freiburg: Lambertus.<br />
Dilling, H., Mombour, W. & Schmidt, M.H. (Hrsg.) (1991). Internationale Klassifikation<br />
psychischer Störungen. ICD-10 Kapitel V (F). Klinisch-diagnostische Leitlinien. Bern:<br />
Huber.<br />
Drake, R.E. & Vaillant, G.E. (1988). Predicting alcoholism and personality disorder in<br />
a 33-year longitudinal study of children of alcoholics. British Journal of Addiction 83,<br />
799 - 807.
DuPont, R.L: & McGovern, J.P: (1991). Co-dependence: A new diagnosis. Part I.<br />
Directions in Psychiatry 11, 1 - 8.<br />
Edwards, G. et al. (1997). Alkoholkonsum und Gemeinwohl. Strategien zur<br />
Reduzierung des schädlichen Gebrauchs in der Bevölkerung. Stuttgart: Enke.<br />
Ehrenfried, T., Heinzelmann, C., Kähni, J. & Mayer, R. (1998). Arbeit mit Kindern und<br />
Jugendlichen aus Familien Suchtkranker. Balingen: Selbstverlag (2. Korrigierte<br />
Auflage).<br />
Elpers, M. & Lenz, K. (1994). Psychiatrische Störungen bei Kindern alkoholkranker<br />
Eltern. Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie 22, 107 - 113.<br />
Fengler, J. (1994). Süchtige und Tüchtige. München: Pfeiffer.<br />
Fengler, J. (<strong>2000</strong>). Co-Abhängigkeit. In: In: Stimmer, F. (Hrsg.). Suchtlexikon. (S. 90 -<br />
96). München: Oldenbourg.<br />
Gastpar, M. , Mann, K. & Rommelspacher, H. (Hrsg.) (1999). Lehrbuch der<br />
Suchterkrankungen. Stuttgart: Thieme.<br />
Goodwin, D.W. (1979). Alcoholism and heredity. Archives of General Psychiatry 36,<br />
57 - 61.<br />
Gotham, H.J. & Sher, K.J. (1996). Do codependent traits involve more than basic<br />
dimensions of personality and psychoptahology? Journal of Studies on Alcohol 57,<br />
34 – 39.<br />
Hall, R.L., Hesselbrock, V.M. & Stabenau, J.R. (1983). Familial distribution of alcohol<br />
use: II. Assortive mating of alcoholic probands. Behavior Genetics 13, 373 – 382.
Heron, D. (1912). A second study of extreme alcoholism in adults. London: Eugenics<br />
Laboratory Memoirs No. 17.<br />
Hesselbrock, V.M., Stabenau, J.R., Hesselbrock, M.N., Meyer, R.E. & Babor, T.F.<br />
(1982). The nature of alcoholism in patients with different familiy histories for<br />
alcoholism. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry 6, 607<br />
- 614.<br />
Jackson, J.K. (1954). The adjustment of the family to the crises of alcoholism.<br />
Quarterly Journal of Studies on Alcohol 15, 562 - 586.<br />
<strong>Klein</strong>, M. (1997). Ziele und Strukturen des Suchthilfesystems. Gestern - heute –<br />
morgen. In: Sticht, U. (Hrsg.). Gute Arbeit in schlechten Zeiten - Suchtkrankenhilfe im<br />
Umbruch. (S. 130 – 159). Freiburg: Lambertus. (= 22. Freiburger<br />
Sozialtherapiewoche 1997).<br />
<strong>Klein</strong>, M. & Zobel, M. (1997). Kinder aus alkoholbelasteten Familien. Kindheit und<br />
Entwicklung. Zeitschrift für Klinische Kinderpsychologie, 6, 133 - 140.<br />
Kogan, K.L., Fordyce, W.E. & Jackson, J.K. (1963). Personality disturbances of wives<br />
of alcoholics. Quarterly Journal of Studies on Alcohol 24, 227 – 238.<br />
Kogan, K.L. & Jackson, J.K. (1965). Stress, personality and emotional disturbance in<br />
wives of alcoholics. Quarterly Journal of Studies on Alcohol 26, 486 – 495.<br />
Lachner, G. & Wittchen, H.U. (1997). Familiär übertragende Vulnerabilitätsmerkmale<br />
für Alkoholmissbrauch und -abhängigkeit. In: Watzl, H. & Rockstroh, B. (Hrsg.).<br />
Abhängigkeit und Missbrauch von Alkohol und Drogen. (S. 43 - 89). Göttingen:<br />
Hogrefe.<br />
Lamminpää, A. & Vilska, J. (1990). Children´s alcohol intoxications leading to<br />
hospitalizations and the children´s psychosocial problems. Acta Psychiatrica<br />
Scandinavica 81, 468 - 471.
Lemert, E.M. (1960). The occurence and the sequence of events in the adjustment of<br />
families to alcoholism. Quarterly Journal of Studies on Alcohol 21, 679 – 697.<br />
Lemert, E.M. (1962). Dependency in alcoholic marriages. Quarterly Journal of<br />
Studies on Alcohol 23, 590 - 609.<br />
Levenson, R.W., Oyama, O.N. & Meek, P.S. (1987). Greater reinforcement from<br />
alcohol for those at risk: Parental risk, personality risk, and sex. Journal of Abnormal<br />
Psychology 96, 242 - 253.<br />
Löser, H. (1995). Alkoholembryopathie und Alkoholeffekte. In: Deutsche Hauptstelle<br />
gegen die Suchtgefahren (Hrsg.) Jahrbuch Sucht ´96. (S. 41 – 52). Geesthacht:<br />
Neuland.<br />
McGovern, J.P. & DuPont, R.L. (1992). Co-dependence: The other half of addiction.<br />
Houston Medicine 8, 5 – 11.<br />
McKenna, T. & Pickens, R. (1981). Alcoholic children of alcoholics. Journal of Studies<br />
on Alcohol 42, 1021 - 1029.<br />
Moos, R.H., Finney, J.W. & Cronkite, R. (1990). Alcoholism treatment: Context,<br />
process and outcome. New York: Oxford University Press.<br />
Moos, R.H., Finney, J.W. & Gamble, W. (1982). The process of recovery from<br />
alcoholism. II. Comparing spouses of alcoholic patients and matched community<br />
controls. Journal of Studies on Alcohol 43, 888 – 909.<br />
Nastasi, B.K. & DeZolt, D.M. (1994). School interventions for children of alcoholics.<br />
New York: Guilford Press.<br />
Paolino, T.J., McCrady, B., Diamond, S. & Longabaugh, R. (1976). Psychological<br />
disturbances in spouses of alcoholics. An empirical assessment. Journal of Studies<br />
on Alcohol 37, 1600 – 1608.
Pollock, V.E. (1992). Meta-analysis of subjective sensitivity to alcohol in sons of<br />
alcoholics. American Journal of Psychiatry 149, 1534 - 1538.<br />
Potter-Efron, R.T. & Potter-Efron, P.S. (1989). Assessment of codependency with<br />
individuals from alcoholic and chemically dependent families. Special issue: Codependency:<br />
Issues in treatment and recovery. Alcoholism Treatment Quarterly 6, 37<br />
- 57.<br />
Quinten, C. & <strong>Klein</strong>, M. (1999). Langzeitentwicklung von Kindern aus suchtbelasteten<br />
Familien – Ergebnisse der Thommener Kinderkatamnese. In: Fachverband Sucht<br />
(Hrsg.): Suchtbehandlung. Entscheidungen und Notwendigkeiten. (S. 235 - 243).<br />
Geesthacht: Neuland. (= Schriftenreihe des Fachverbandes Sucht e.V.; 22).<br />
Rimmer, J. & Winokur, G. (1972). The spouses of alcoholics: An example of assortive<br />
mating. Diseases of the Nervous System 33, 509 – 511.<br />
Robinson, B.E. & Rhoden, J.L. (1998). Working with children of alcoholics. The<br />
practitioner´s handbook. 2nd Edition. Thousand Oaks: Sage.<br />
Schneewind, K.A. (1991). Familienpsychologie. Stuttgart: Kohlhammer.<br />
Schneider, R. (1996). Die Suchtfibel. Informationen zur Abhängigkeit von Alkohol und<br />
Medikamenten. Baltmannsweiler: Röttger-Schneider (= 10., vollst. überarb. Aufl.).<br />
Schuckit, M.A., Tipp, J.E. & Kelner, E. (1994). Are daughters of alcoholics more likely<br />
to marry alcoholics? American Journal of Drug and Alcohol Abuse 20, 237 - 245.<br />
Schwoon, D.R. 1993. Bekehren - Heilen - Ausmerzen - Begleiten: Wiederkehrende<br />
Interaktionsfiguren im Umgang mit Alkoholikern. In: Andresen, B., Stark, F.M. &<br />
Gross, J. (Hrsg.). Psychiatrie und Zivilisation. (S. 213 – 228). Köln: Edition<br />
Humanistische Psychologie.
Sher, K.J. (1991). Children of alcoholics. A critical appraisal of theory and research.<br />
Chicago: University of Chicago Press.<br />
Steinglass, P. (1983). Ein lebensgeschichtliches Modell der Alkoholismusfamilie.<br />
Familiendynamik 8, 69 – 91.<br />
Streissguth, A.P., Barr, H.M., Sampson, P.D. & Bookstein, F.L. (1994). Prenatal<br />
alcohol and offspring development: The first fourteen years. Drug and Alcohol<br />
Dependence 36, 89 - 99.<br />
Velleman, R. (1992). Intergenerational effects - a review of environmentally oriented<br />
studies concerning the relationship between parental aclohol problems and family<br />
disharmony in the genesis of alcohol and other problems. II. The intergenerational<br />
effects of family disharmony. The International Journal of the Addicitions 27, 367 -<br />
389.<br />
von Villiez, T. (1986). Sucht und Familie. Berlin: Springer.<br />
Wegscheider, S. (1988). Es gibt doch eine Chance. Hoffnung und Heilung für die<br />
Alkoholiker-Familie. Wildberg: Bögner-Kaufmann. (= Deutsche Übersetzung der<br />
englischsprachigen Erstausgabe von 1981).<br />
West, M.O. & Prinz, R.J. (1987). Parental alcoholism and childhood<br />
psychopathology. Psychological Bulletin 102, 204 - 218.<br />
Whitfield, C.L: (1984). Co-alcoholism: Recognizing a treatable illness. Family and<br />
Community Health 7, 16 –27.
Korrespondenzadresse:<br />
Prof. Dr. Michael <strong>Klein</strong><br />
Katholische Fachhochschule Nordrhein-Westfalen<br />
Forschungsschwerpunkt Sucht<br />
Abteilung Köln<br />
Wörthstraße 10<br />
D - 50668 Köln<br />
In den 70er Jahren wurde das Konzept dann weiter generalisiert. Man ging nicht mehr davon<br />
aus, daß die Ehefrau die Co-Abhängigkeit innerhalb der Partnerschaft entwickelte, sondern<br />
daß sie die Co-Abhängigkeit bereits in der Kindheit durch das Aufwachsen mit einem<br />
abhängigen Elternteil entwickelt hat. Demnach wählen Frauen mit entsprechenden familiären<br />
Erfahrungen in der Regel ebnfalls einen abhängigen Partner, da sie auch hier wieder<br />
Verantwortung übernehmen und daraus ihre Identität ableiten können. Anfang der 90er Jahre<br />
wurde das Konzept dann auf alle Familien übertragen, die als 'dysfunktional' angesehen<br />
werden können. Demnach entwickeln Kinder aus dysfunktionalen Familien in ihrem späteren<br />
Leben ebenfalls dysfunktionale, hilfebezogene Beziehungsmuster mit suchtbelasteten<br />
Menschen (Prest & Protinsky, 1993).<br />
Die empirische Bestätigung dieser Sichtweise steht allerdings noch aus. Fischer et al. (1992)<br />
fanden keinen signifikanten Zusammenhang zwischen dysfunktionalen Merkmalen in der<br />
Herkunftsfamilie und späterem co-abhängigem Verhalten. Irwin (1995) fand bei 190<br />
Erwachsenen mit einem Durchschnittsalter von 31.5 Jahren sowohl im Codependence
Inventory (O'Brien & Gaborit, 1992) als auch auf der Spann-Fischer Codependency Scale<br />
(Fischer et al., 1991) keinen Zusammenhang zwischen dem Aufwachsen mit einem<br />
abhängigen Eltenteil und späterem co-abhängigen Verhalten. Es zeigte sich auch kein<br />
Zusammenhang zwischen traumatischen Kindheitserfahrungen und späterer Co-Abhängigkeit.<br />
Hinkin & Kahn (1995) fanden, daß Frauen mit elterlicher Abhängigkeit (Durchschnittsalter<br />
45 Jahre) und abhängigem Ehemann nicht mehr Symptome von Co-Abhängigkeit zeigten als<br />
solche Frauen ohne elterliche Abhängigkeit, deren Ehemann ebenfalls abhängig war.