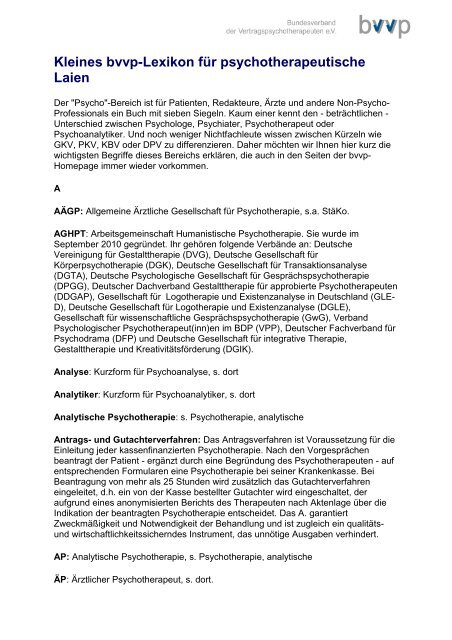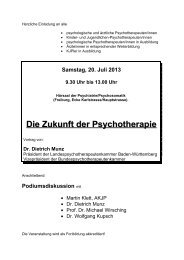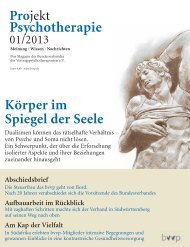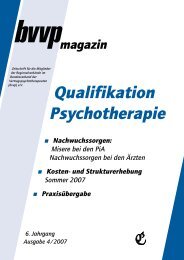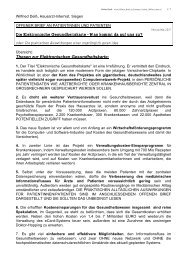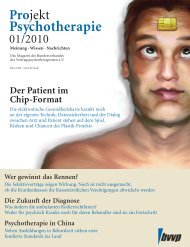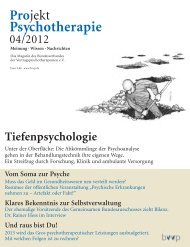Kleines bvvp-Lexikon für psychotherapeutische Laien
Kleines bvvp-Lexikon für psychotherapeutische Laien
Kleines bvvp-Lexikon für psychotherapeutische Laien
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Kleines</strong> <strong>bvvp</strong>-<strong>Lexikon</strong> <strong>für</strong> <strong>psychotherapeutische</strong><br />
<strong>Laien</strong><br />
Der "Psycho"-Bereich ist <strong>für</strong> Patienten, Redakteure, Ärzte und andere Non-Psycho-<br />
Professionals ein Buch mit sieben Siegeln. Kaum einer kennt den - beträchtlichen -<br />
Unterschied zwischen Psychologe, Psychiater, Psychotherapeut oder<br />
Psychoanalytiker. Und noch weniger Nichtfachleute wissen zwischen Kürzeln wie<br />
GKV, PKV, KBV oder DPV zu differenzieren. Daher möchten wir Ihnen hier kurz die<br />
wichtigsten Begriffe dieses Bereichs erklären, die auch in den Seiten der <strong>bvvp</strong>-<br />
Homepage immer wieder vorkommen.<br />
A<br />
AÄGP: Allgemeine Ärztliche Gesellschaft <strong>für</strong> Psychotherapie, s.a. StäKo.<br />
AGHPT: Arbeitsgemeinschaft Humanistische Psychotherapie. Sie wurde im<br />
September 2010 gegründet. Ihr gehören folgende Verbände an: Deutsche<br />
Vereinigung <strong>für</strong> Gestalttherapie (DVG), Deutsche Gesellschaft <strong>für</strong><br />
Körperpsychotherapie (DGK), Deutsche Gesellschaft <strong>für</strong> Transaktionsanalyse<br />
(DGTA), Deutsche Psychologische Gesellschaft <strong>für</strong> Gesprächspsychotherapie<br />
(DPGG), Deutscher Dachverband Gestalttherapie <strong>für</strong> approbierte Psychotherapeuten<br />
(DDGAP), Gesellschaft <strong>für</strong> Logotherapie und Existenzanalyse in Deutschland (GLE-<br />
D), Deutsche Gesellschaft <strong>für</strong> Logotherapie und Existenzanalyse (DGLE),<br />
Gesellschaft <strong>für</strong> wissenschaftliche Gesprächspsychotherapie (GwG), Verband<br />
Psychologischer Psychotherapeut(inn)en im BDP (VPP), Deutscher Fachverband <strong>für</strong><br />
Psychodrama (DFP) und Deutsche Gesellschaft <strong>für</strong> integrative Therapie,<br />
Gestalttherapie und Kreativitätsförderung (DGIK).<br />
Analyse: Kurzform <strong>für</strong> Psychoanalyse, s. dort<br />
Analytiker: Kurzform <strong>für</strong> Psychoanalytiker, s. dort<br />
Analytische Psychotherapie: s. Psychotherapie, analytische<br />
Antrags- und Gutachterverfahren: Das Antragsverfahren ist Voraussetzung <strong>für</strong> die<br />
Einleitung jeder kassenfinanzierten Psychotherapie. Nach den Vorgesprächen<br />
beantragt der Patient - ergänzt durch eine Begründung des Psychotherapeuten - auf<br />
entsprechenden Formularen eine Psychotherapie bei seiner Krankenkasse. Bei<br />
Beantragung von mehr als 25 Stunden wird zusätzlich das Gutachterverfahren<br />
eingeleitet, d.h. ein von der Kasse bestellter Gutachter wird eingeschaltet, der<br />
aufgrund eines anonymisierten Berichts des Therapeuten nach Aktenlage über die<br />
Indikation der beantragten Psychotherapie entscheidet. Das A. garantiert<br />
Zweckmäßigkeit und Notwendigkeit der Behandlung und ist zugleich ein qualitäts-<br />
und wirtschaftlichkeitssicherndes Instrument, das unnötige Ausgaben verhindert.<br />
AP: Analytische Psychotherapie, s. Psychotherapie, analytische<br />
ÄP: Ärztlicher Psychotherapeut, s. dort.
Seite 2<br />
Ärztlicher Psychotherapeut(in): Arzt/Ärztin, der/die eine wissenschaftlich und<br />
gleichzeitig GKV-anerkannte Richtlinienpsychotherapie-Ausbildung nachgewiesen<br />
hat. ÄP wird auch synonym gebraucht <strong>für</strong> psychotherapeutisch tätige Ärzte/innen.<br />
Bei ÄP handelt es sich entweder um eine/n Facharzt/ärztin <strong>für</strong> Psychotherapeutische<br />
Medizin, um eine(n) Facharzt/ärztin <strong>für</strong> Psychiatrie und Psychotherapie, um eine(n)<br />
Facharzt/ärztin <strong>für</strong> Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie oder um<br />
eine(n) Facharzt/ärztin mit Zusatztitel "Psychotherapie" oder "Psychoanalyse".<br />
B<br />
BÄP: Berufsverband der Ärztlichen Psychoanalytikerinnen und Psychoanalytiker in<br />
der DGPT, s.a. StäKo.<br />
BDP: Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen. Im BDP sind<br />
Diplom-Psychologen und solche mit Bachelor und Masterabschluss aller<br />
Tätigkeitsfelder berufspolitisch organisiert. Die <strong>psychotherapeutische</strong> Sektion des B.<br />
ist der VPP. S. dort.<br />
BKJPP: Berufsverband <strong>für</strong> Kinder- und Jugendlichenpsychiatrie und-psychotherapie,<br />
s.a. StäKo.<br />
BMG: Bundesministerium <strong>für</strong> Gesundheit.<br />
BPM: Berufsverband der Fachärzte/innen <strong>für</strong> Psychotherapeutische Medizin<br />
Deutschlands, s.a. StäKo.<br />
Budget: Festgelegtes maximales Honorarvolumen <strong>für</strong> die Gesamtvergütung<br />
sämtlicher Ärzte/innen und Psychotherapeut(inn)en, <strong>für</strong> eine Fachgruppe (z.B.<br />
Psychotherapeuten) oder eine(n) einzelne(n) Facharzt/ärztin oder<br />
Psychotherapeuten/innen.<br />
Budgetierung: Festlegung einer Arztgruppe (z.B. Psychotherapeuten) im HVM oder<br />
eines einzelnen Arztes oder Psychotherapeuten auf ein maximales Honorarvolumen.<br />
Bundespsychotherapeutenkammer: Arbeitsgemeinschaft der<br />
Landespsychotherapeutenkammern analog der Bundesärztekammer<br />
BVDN: Berufsverband Deutscher Nervenärzte, s.a. StäKo.<br />
<strong>bvvp</strong>: Bundesverband der Vertragspsychotherapeuten. Der B. ist derzeit<br />
mitgliederstärkster Psychotherapeutenverband niedergelassener<br />
Psychotherapeut(inn)en aller sozialrechtlich zugelassen Grundberufe in Deutschland.<br />
Niedergelassene Richtlinienpsychotherapeuten (Vertragspsychotherapeuten) aller<br />
(ÄP, PP und KJP) und Ausbildungsrichtungen (AP, TP, VT) können Mitglied in<br />
seinen 17 Landesverbänden werden. Der Verband vertritt integrativ und<br />
gleichberechtigt die berufspolitischen Interessen dieser Gruppen. S.a. AGR.<br />
C
Chronifizierte psychische Störung: Lang anhaltender, dauerhafter<br />
Krankheitzustand einer psychischen Störung, der die Aussicht auf Heilung sehr<br />
verringert. Durchschnittlich vergehen 7-9 Jahre, bis Patienten mit psychisch<br />
bedingten Störungen einen Psychotherapeuten aufsuchen, wobei in vielen Fällen<br />
bereits Chronifizierung festgestellt werden muss.<br />
D<br />
DÄVT: Deutsche Ärztliche Gesellschaft <strong>für</strong> Verhaltenstherapie, s.a. Stäko.<br />
Seite 3<br />
Delegationsverfahren: Verfahren, das bis 1999 Diplom-Psychologen und KJP die<br />
Teilnahme an der GKV-Versorgung mit dem Status eines sog. Heilhilfsberufs<br />
erlaubte. Die daran teilnehmenden Psychologen und KJP behandelten formal nicht<br />
eigenverantwortlich und selbstständig, sondern unter der Verantwortung eines<br />
ärztlichen Psychotherapeuten. Das PTG beseitigt ab 1.1.1999 diesen Missstand und<br />
schafft die dem Arzt gleichberechtigten Heilberufe des PP und KJP (s. dort).<br />
Deutsche Gesellschaft <strong>für</strong> Ärztliche Hypnose und Autogenes Training, s.a.<br />
StäKo.<br />
DFT: Deutsche Fachgesellschaft <strong>für</strong> Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie,<br />
DGAP: Deutsche Gesellschaft <strong>für</strong> Analytische Psychologie. Fachverband, der auf C.<br />
G. Jungs Theorien und ihren Weiterentwicklungen fußt. S.a. Gesprächskreis II.<br />
DGAPT: Deutsche Gesellschaft <strong>für</strong> Analytische Psychotherapie und<br />
Tiefenpsychologie. Analytischer Fachverband in den neuen Bundesländern. S.a.<br />
Gesprächskreis II<br />
DGIP: Deutsche Gesellschaft <strong>für</strong> Individualpsychologie. Fachverband, der auf A.<br />
Adlers Theorien und ihren Weiterentwicklungen fußt. S.a. Gesprächskreis II.<br />
DGPM: Deutsche Gesellschaft <strong>für</strong> Psychotherapeutische Medizin, s.a. StäKo.<br />
DGPPN: Deutsche Gesellschaft <strong>für</strong> Psychiatrie, Psychotherapie und<br />
Nervenheilkunde, s.a. StäKo.<br />
DGPR: Deutsche Gesellschaft <strong>für</strong> Klinische Psychotherapie und Psychosomatische<br />
Rehabilitation, s.a. StäKo.<br />
DGPs: Deutsche Gesellschaft <strong>für</strong> Psychologie, s.a. Gesprächskreis II.<br />
DGPT: Deutsche Gesellschaft <strong>für</strong> Psychoanalyse, Psychotherapie, Psychosomatik<br />
und Tiefenpsychologie. Dachverband der vier analytischen Gesellschaften DGAP,<br />
DGIP, DPG und DPV. S.a. Gesprächskreis II.<br />
DGVT: Deutsche Gesellschaft <strong>für</strong> Verhaltenstherapie. s.a. Gesprächskreis II.<br />
DKPM: Deutsches Kollegium <strong>für</strong> Psychosomatische Medizin, s.a. StäKo.
DMP: Desease Management Program, DMP sind von den Krankenkassen<br />
aufgelegte Programme zum Management von meist schweren Erkrankungen, die<br />
bisher zu wenig Beachtung fanden. Beispiel: Diabetes.<br />
DPG: Deutsche Psychoanalytische Gesellschaft. Fachverband, der auf S. Freuds<br />
Theorien und ihren Weiterentwicklungen fußt. S.a. Gesprächskreis II<br />
DPtV: Deutsche PsychotherapeutenVereinigung. Zusammenschluss der früheren<br />
Vereinigung der Kassenpsychotherapeuten und des Deutschen<br />
Psychotherapeutenverbandes. Mitgliederstärkster Verband v.a. <strong>für</strong> PP und KJP<br />
DPV: Deutsche Psychoanalytische Vereinigung. Fachverband, der auf S. Freuds<br />
Theorien und ihren Weiterentwicklungen fußt. Zweiggesellschaft der International<br />
Psychoanalytic Association (IPA). S.a. Gesprächskreis II.<br />
DVT: Deutscher Fachverband <strong>für</strong> Verhaltenstherapie, s.a. AGR, StäKo<br />
E<br />
EBM: Einheitlicher Bewertungsmaßstab. Bemessungsgröße ärztlicher und<br />
<strong>psychotherapeutische</strong>r Leistungen in Punktzahlen und Zeitwerten. Der EBM wird<br />
zwischen KBV und Spitzenverbänden der Krankenkassen im Bewertungsausschuß<br />
beschlossen. Dieser ist paritätisch mit Ärzten und Kassenvertretern besetzt.<br />
Seite 4<br />
Erstattungspsychotherapeut/in: Diplom-Psychologe/in, der/die bisher keine<br />
Kassenzulassung hat, dessen Therapierechnungen der/die Patient/in selbst bezahlt<br />
hat, der/die dann versuchen muss, den Betrag von seiner Kasse erstattet zu<br />
bekommen. Die GKV-Kassen haben bis 1999 die Rechnungen insbesondere dann<br />
erstattet, wenn kein(e) Vertragstherapeut/in zur Verfügung stand. Die<br />
Erstattungspsychotherapie sollte durch das PTG weitgehend beseitigt werden, was<br />
nicht geschehen ist. Heute sind Erstattungspsychotherapeut(inn)en ausgebildete<br />
Psychotherapeut(inn)en ohne Kassensitz.<br />
F<br />
Facharzt/ärztin <strong>für</strong> Psychiatrie: Psychiater/in, s. dort. Vgl. Facharzt/ärtin <strong>für</strong><br />
Psychiatrie und Psychotherapie. Der/die F. ohne <strong>psychotherapeutische</strong><br />
Zusatzausbildung behandelt vorwiegend mit Kurzgesprächen und medikamentös mit<br />
Psychopharmaka.<br />
Facharzt/ärztin <strong>für</strong> Psychiatrie und Neurologie: Syn: Nervenarzt/ärztin. Aufgrund<br />
seiner i.d.R. somatisch ausgerichteten Ausbildung hat der F. in vielen Fällen keine<br />
<strong>psychotherapeutische</strong> Vorbildung. Ohne <strong>psychotherapeutische</strong> Zusatzausbildung<br />
behandelt er daher überwiegend mit Kurzgesprächen und medikamentös mit<br />
Psychopharmaka.<br />
Facharzt/ärztin <strong>für</strong> Psychiatrie und Psychotherapie: Neue Berufsbezeichnung <strong>für</strong><br />
Facharzt/ärztin <strong>für</strong> Psychiatrie (Psychiater/in). Der/die neue F. ist aufgrund<br />
seiner/ihrer in der Weiterbildungsordnung geforderten <strong>psychotherapeutische</strong>n
Vorbildung zur Teilnahme an der Richtlinien-Psychotherapie berechtigt (s. dort);<br />
dasselbe gilt <strong>für</strong> die Nervenärzte(innen, die auch psychotherapeutisch i.d.R.<br />
ausgebildet sind.<br />
Seite 5<br />
Facharzt/ärztin <strong>für</strong> Psychotherapeutische Medizin: Alte Bezeichnung des/der seit<br />
1992 bestehenden <strong>psychotherapeutische</strong>n Facharztes/ärztinn. Der/die<br />
Facharzt/ärtin <strong>für</strong> Psychotherapeutische Medizin und der/die Facharzt/ärztin <strong>für</strong><br />
Psychiatrie und Psychotherapie werden zukünftig die Grundlage ambulanter ärztlich<strong>psychotherapeutische</strong>r<br />
Tätigkeit sein, da bei der Niederlassung ein Facharzttitel<br />
verlangt wird und eine vollzeitige <strong>psychotherapeutische</strong> Tätigkeit als Arzt/Ärztin nicht<br />
mehr über den Zusatztitel Psychotherapie möglich sein wird. (s. auch :<br />
fachgebundene Psychotherapie.<br />
Fachgebundene Psychotherapie: Zusatztitel <strong>für</strong> Fach- und Hausärzt(inn)e/n, der<br />
zu einer <strong>psychotherapeutische</strong>n Tätigkeit bei psychischen Störungen mit Bezug auf<br />
das jeweilige Fachgebiet berechtigt.<br />
Fachpsychotherapie: Psychotherapieleistung, die vom Facharzt <strong>für</strong><br />
Psychotherapeutische Medizin, vom Facharzt <strong>für</strong> Psychiatrie und Psychotherapie,<br />
vom ärztlichen Psychotherapeuten mit Zusatztitel, vom Psychologischen<br />
Psychotherapeuten oder vom Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten erbracht<br />
wird.<br />
Funktionelle Störung: s. Störung, funktionelle<br />
G<br />
G-BA, s. Gemeinsamer Bundesausschuss<br />
Gemeinsamer Bundesausschuss: Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) mit<br />
seinen jeweiligen Unterausschüssen ist das wichtigste Gremium der<br />
Selbstverwaltung zur Bewertung von Arznei- und Hilfsmitteln sowie der zulässigen<br />
Therapieverfahren. Auch über die Psychotherapierichtlinien wird dort unter<br />
Beteiligung von <strong>psychotherapeutische</strong>n Leistungserbringern und Krankenkassen<br />
entschieden.<br />
Gesprächskreis II: Der Gesprächskreis II ist nach Inkrafttreten des<br />
Psychotherapeutengesetzes zu einer Plattform und einem Abstimmungsgremium der<br />
Verbände der Psychologischen Psychotherapeut(inn)en, der Kinder- und<br />
Jugendlichenpsychotherapeut(inn)en und der sog. gemischten Verbände (die auch<br />
wie der <strong>bvvp</strong> ärztliche Psychotherapeut(inn)en als Mitglieder haben) geworden.<br />
Verbände, die ausschließlich ärztliche Psychotherapeuten als Mitglieder haben, sind<br />
dort nicht vertreten Z.Zt. gehören über 30 Verbände zu diesem Gremium.<br />
GK II s. Gesprächskreis II<br />
GKV: Gesetzliche Krankenversicherung. Krankenversicherungssystem <strong>für</strong><br />
Pflichtversicherte, bestehend aus Primär- und Ersatzkassen. Vgl. PKV.
GNP: Gesellschaft <strong>für</strong> Neuropsychologie,<br />
GPPMP: Gesellschaft <strong>für</strong> Psychotherapie, Psychosomatik und Medizinische<br />
Psychologie, s.a. StäKo.<br />
Gruppentherapie: Unter G. versteht man <strong>psychotherapeutische</strong><br />
Behandlungsverfahren mit mehreren Teilnehmern unter Leitung eines Therapeuten<br />
(vgl. Selbsthilfegruppe, Selbsterfahrungsgruppe). Als GKV-zugelassene Verfahren<br />
gelten verschiedene analytisch begründete und verhaltenstherapeutische Kurzzeit-<br />
und Langzeit-Verfahren (vgl. analytische Psychotherapie, tiefenpsychologisch<br />
fundierte Psychotherapie und Verhaltenstherapie).<br />
Gutachterverfahren: s. Antrags- und Gutachterverfahren<br />
GwG: Gesellschaft <strong>für</strong> Gesprächspsychotherapie, s.a. AGPT.<br />
H<br />
Seite 6<br />
Hamsterradeffekt: Effekt, der eintritt, wenn bei einer Honorardeckelung des<br />
Honorarvolumens von einzelnen Praxisinhabern versucht wird, sich einen größeren<br />
Anteil über Mengenausweitung zu sichern (s. dort). Wenn dies die Vertragsärzte<br />
mehrheitlich versuchen, verdienen sie trotz Mengenausweitungen nicht oder kaum<br />
mehr als vorher. Diejenigen, die sich daran nicht beteiligen oder beteiligen können,<br />
verdienen aber weniger. Dies betraf früher v.a. die Psychotherapeuten, die mit ihren<br />
zu 95% zeitlich festgelegten, genehmigungspflichtigen Leistungen kaum ausweiten<br />
können.<br />
Honorardeckelung: Festlegung eines Honorarvolumens <strong>für</strong> einen bestimmten<br />
Zeitraum, das nicht überschritten wird und aus dem sämtliche vertragsärztliche<br />
Leistungen bezahlt werden müssen, was aber wegen des Hamsterradeffekts zu<br />
Punktwertverfall führt.<br />
Honorargerechtigkeit: Aufgabe der KVen ist, durch einen angemessenen HVM <strong>für</strong><br />
H. zu sorgen, so dass das Einkommen in jeder Fachgruppe sich dem ärztlichen<br />
Durchschnitt nähert. Dies wird jedoch u.a. wegen der regional unterschiedlichen<br />
Kräfteverhältnisse in den KV-Vertreterversammlungen oft nicht erreicht. Die<br />
Leidtragenden sind daher Psychotherapeut(inn)en, deren Leistungen durch<br />
Mengenausweitung anderer Gruppen und nachfolgenden Punktwertverfall<br />
unangemessen niedrig bewertet werden, und Psychiater/innen, die sich mehr mit<br />
Gesprächen ihren Patienten widmen. Aber auch die Punktzahlbewertungen <strong>für</strong> eine<br />
Psychotherapiesitzung sowie <strong>für</strong> die Gesprächsziffern in Facharztkapiteln der<br />
Psychiater und der Psychotherapeuten im EBM sind im Vergleich zu anderen<br />
ärztlichen Leistungen immer noch viel zu niedrig angesetzt (s.<br />
Durchschnittseinkommen).<br />
Honorarvolumen: Die Summe, die bundesweit oder regional von den KVen jährlich<br />
<strong>für</strong> ambulante ärztliche Leistungen ausgegeben werden. Seit einigen Jahren ist das<br />
H. gedeckelt, d.h. auf die Vorjahressumme plus einen geringen Zuwachs festgelegt.
HVM: Honorarverteilungsmaßstab. Der H. ist der Maßstab, nach dem - zumeist in<br />
Punktwerten ausgedrückt - die Leistungen der verschiedenen ärztlichen<br />
Fachgruppen bewertet werden.<br />
I<br />
Seite 7<br />
ICD-10: Internationale Klassifikation von Krankheiten (International Classification of<br />
Diseases) in der 10. Fassung. In Deutschland gebräuchliches Diagnosesystem mit<br />
der Auflistung diagnostischer Leitlinien, dessen Anwendung zur Abrechnung von<br />
Leistungen von KVen und Kostenträgern verlangt wird. Für psychische Störungen ist<br />
das Kapitel V (F) relevant.<br />
Integrationsmodell: Im PTG festgelegte gleichberechtigte Integration der PP und<br />
KJP in die kassenärztlichen Strukturen (KVen und KBV).<br />
K<br />
Kassenärztliche Vereinigung: Abkürzung: KV. Regionale Vereinigung der<br />
Vertragsärzte auf Landesebene. Alle KVen sind Körperschaften öffentlichen Rechts<br />
mit Hoheitsaufgaben wie Honorarverteilung, Sicherstellung der Versorgung,<br />
Zulassung neuer Ärzte und Psychotherapeuten, Vereinbarung regionaler<br />
Honorarregelungen im HVM im Benehmen mit den Krankenkassen. Sie handeln<br />
entsprechend ihrem gesetzlichen Auftrag rechtlich unabhängig. Darüber hinaus sind<br />
sie in der KBV zusammengefasst. In die K. wurden die PP und KJP ab 1999<br />
gleichberechtigt integriert (Integrationsmodell). In den Organen der K. und KBV<br />
dürfen die PP und KJP allerdings zusammen nur maximal 10% der Vertreter stellen.<br />
Kassenärztliche Bundesvereinigung: Abkürzung KBV. Dachorganisation aller<br />
regionalen KVen. Die K. ist Verhandlungspartner der Spitzenverbände der<br />
Krankenkassen und der Politik auf Bundesebene.<br />
KBV: Kassenärztliche Bundesvereinigung, s. dort<br />
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut: (Sozial-)Pädagoge oder Diplom-<br />
Psychologe, der <strong>für</strong> seine Approbation als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut<br />
eine wissenschaftlich anerkannte, auf Kinder- und Jugendliche spezialisierte<br />
Psychotherapieausbildung nachgewiesen hat. Approbation ist ab 1999 Pflicht und<br />
gesetzliche Grundlage <strong>für</strong> die Berufsausübung nach dem PTG. Geschützte<br />
Berufsbezeichnung.<br />
KJP: Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut, s. dort.<br />
Kurzzeittherapie (KZT): Unter K. versteht man GKV-anerkannte<br />
Behandlungsverfahren, die beabsichtigen, ein umschriebenes oder fokussierbares<br />
psychisches Problem oder Symptom in maximal 25 Stunden aufzulösen oder auch<br />
die Indikation <strong>für</strong> eine Langzeittherapie zu überprüfen. Die K. kann entweder als<br />
tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie oder als Verhaltenstherapie<br />
durchgeführt werden (s. dort).
KV: Kassenärztliche Vereinigung, s. dort<br />
KZT: s. Kurzzeittherapie<br />
Seite 8<br />
Leitlinien: L. sind Orientierungshilfen <strong>für</strong> Behandler/innen bei der Behandlung<br />
bestimmter Erkrankungen, die von den relevanten Fachgesellschaften aufgrund der<br />
Berücksichtung der aktuellen Forschungslage entwickelt wurden und weiter<br />
entwickelt werden.<br />
LL: Leitlinien, s. dort<br />
M<br />
Mengenausweitung: Versuch des einzelnen Vertragsbehandlers, sich bei einer<br />
Honorardeckelung des Honorarvolumens durch Ausweiten der Menge der tatsächlich<br />
oder angeblich durchgeführten und dann abgerechneten Leistungen einen größeren<br />
Anteil "am Kuchen" zu sichern. Wegen des sog. Hamsterradeffekts bleibt der erzielte<br />
Honoraranteil im Durchschnitt durch den verursachten Punktwertverfall allerdings<br />
weitgehend gleich (s. dort). Diejenigen, die sich daran nicht beteiligen oder beteiligen<br />
können, verdienen allerdings weniger. Dies betrifft v.a. die Psychotherapeuten, die<br />
mit ihren zu 95% zeitlich festgelegten, genehmigungspflichtigen Leitungen kaum M.<br />
betreiben können, selbst wenn sie wollten.<br />
N<br />
Nervenarzt: Syn: Facharzt <strong>für</strong> Psychiatrie und Neurologie, s. dort.<br />
Neurose: s. Störung, neurotische<br />
P<br />
PKV: Private Krankenversicherung. Eine solche Versicherung steht Versicherten ab<br />
einer bestimmten Einkommenshöhe offen. Vgl. GKV.<br />
PP: Psychologischer Psychotherapeut, s. dort.<br />
Psychiater: s. Facharzt <strong>für</strong> Psychiatrie.<br />
Psychoanalyse: Psychoanalytische (auf Freud zurückgehende) Behandlung, deren<br />
Setting meist die Liegeposition des Patienten auf der Couch vorsieht. Sie wird mit<br />
hoher Wochenstundenfrequenz (3-4 Stunden) durch eine/n ausgebildete/n<br />
Psychoanalytiker/inn durchgeführt. Gegenstand der P. ist v.a. die Aufdeckung,<br />
Bearbeitung und Bewältigung bisher unbewusster Konflikte, die im Zusammenhang<br />
mit der Symptomatik des Patienten stehen, wobei der Therapeut-Patient-Interaktion<br />
eine besondere Rolle zugeschrieben wird. Die P. im engeren Sinne ("klassische<br />
Psychoanalyse") ist zwar Grundlage weiterer GKV-anerkannter psychoanalytischer<br />
Behandlungsformen, sie ist aber selber als dauerhaft 4-stündige Behandlung z.Zt.<br />
keine Kassenleistung (vgl. Psychotherapie, analytische und Psychotherapie,<br />
tiefenpsychologisch fundierte).
Psychoanalytiker: Speziell ausgebildeter Psychotherapeut. Der P. wendet<br />
Psychoanalyse und abgeleitete Verfahren an (tiefenpsychologisch fundierte und<br />
analytische Psychotherapie).<br />
Seite 9<br />
Psychologischer Psychotherapeut: Diplom-Psychologe, der <strong>für</strong> seine Approbation<br />
als Psychotherapeut eine wissenschaftlich anerkannte Psychotherapieausbildung<br />
nachgewiesen hat. Diese Ausbildung ist im PsychThG und in der vom BMG<br />
herausgegebenen Ausbildungs- und Prüfungsverordnung geregelt. Approbation ist<br />
ab 1999 Pflicht und gesetzliche Grundlage <strong>für</strong> die Berufsausübung nach dem PTG,<br />
berechtigt aber noch nicht zur Behandlung im Rahmen der GKV. Geschützte<br />
Berufsbezeichnung.<br />
Psychopharmakon: Psychopharmarka sind Medikamente zur psychischen<br />
Beeinflussung, die vorwiegend vom Hausarzt oder Psychiater verordnet werden. P.<br />
sind manchmal auch bei der Behandlung von Neurosen vorübergehend nötig, als<br />
Dauerbehandlung aber i.d.R. nur bei schweren psychischen Störungen (Psychosen)<br />
sinnvoll. Bei den meisten neurotischen, narzisstischen und psychosomatischen<br />
Störungen gehören P. nicht zum Behandlungskonzept.<br />
Psychose: Schwere psychische Störung, bei der neben Psychopharmaka-<br />
Behandlung oft auch Psychotherapie sinnvoll ist. Eine ausschließlich<br />
<strong>psychotherapeutische</strong> Behandlung ist selten indiziert.<br />
Psychosomatische Störung: Syn.: Psychosomatose, psychosomatische<br />
Erkrankung. Erkrankung mit organischer Beeinträchtigung bzw. somatischem<br />
Substrat, bei der bei Auslösung und Aufrechterhaltung psychische Faktoren eine<br />
bedeutsame Rolle spielen. Bei der Erkrankung ist neben organmedizinischer<br />
Behandlung meist auch Psychotherapie indiziert. Psychopharmaka sind in der Regel<br />
als Hauptbehandlungsform ungeeignet. Typische Formen sind (Ulkus, Gastritis,<br />
Asthma, Essstörungen .<br />
Psychosomatose: Syn: Psychosomatische Störung oder Erkrankung, s. Störung,<br />
psychosomatische<br />
Psychotherapeut: Kurzbezeichnung <strong>für</strong> PP, KJP und ÄP, wird allerdings<br />
gelegentlich nur <strong>für</strong> PP und KJP gebraucht. Geschützte Berufsbezeichnung ab 1999<br />
<strong>für</strong> die drei genannten Gruppen.<br />
Psychotherapeut, ärztlicher: s. Ärztlicher Psychotherapeut<br />
Psychotherapeutengesetz: Ab 1.1.99 gültiges, jahrzehntelang erkämpftes und<br />
erwartetes Gesetz, das die neuen Heilberufe des PP und KJP schafft, deren<br />
Berufsausübung (berufsrechtlicher Teil) und Kassenzulassung (sozialrechtlicher Teil)<br />
regelt und diese beiden Gruppen den Ärzten gleichstellt.<br />
Psychotherapeutenkammer: Die P. sind regional <strong>für</strong> das jeweilige Bundesland<br />
analog der Ärztekammern <strong>für</strong> das Berufsrecht der Psychologischen und Kinder- und<br />
Jugendlichen-Psychotherapeuten zuständig. Für Bundesbelange ist die<br />
Bundespsychotherapeutenkammer zuständig
Seite 10<br />
Psychotherapie, tiefenpsychologisch fundierte: Wissenschaftlich und GKVanerkanntes<br />
Verfahren (Richtlinienverfahren), das aus der Psychoanalyse abgeleitet<br />
worden ist und auf der psychoanalytischen Theorie gründet. Gegenstand der P. ist<br />
wie in den anderen psychoanalytisch begründeten Verfahren v.a. die Aufdeckung,<br />
Bearbeitung und Bewältigung bisher unbewusster Konflikte, die im Zusammenhang<br />
mit der Symptomatik des Patienten stehen, wobei auch hier die Therapeut-Patient-<br />
Interaktion besonders beachtet wird. Die P. wird mit einer Frequenz von 1-2<br />
Wochenstunden im Sitzen durchgeführt und gilt nach der neuen Ausbildungs- und<br />
Prüfungsverordnung <strong>für</strong> PP als eigenständiges Verfahren, <strong>für</strong> das eine eigene<br />
Fachkunde verlangt wird (vgl. Psychoanalyse und Psychotherapie, analytische).<br />
Psychotherapie, analytische: Auf Freud zurückgehendes, von der Psychoanalyse<br />
abgeleitetes, wissenschaftlich und GKV-anerkanntes Behandlungsverfahren<br />
(Richtlinienverfahren). Die P. wird entweder in Liegeposition des Patienten (auf der<br />
Couch) oder auch im Sitzen angewandt. Die P. wird durch einen ausgebildeten<br />
Psychoanalytiker durchgeführt, im Gegensatz zur klassischen Psychoanalyse<br />
allerdings nur mit einer Wochenstundenfrequenz von 2-3 Stunden. Gegenstand der<br />
P. ist wie bei der Psychoanalyse v.a. die Aufdeckung, Bearbeitung und Bewältigung<br />
bisher unbewußter Konflikte, die im Zusammenhang mit der Symptomatik des<br />
Patienten stehen, wobei der Therapeut-Patient-Interaktion eine besondere Rolle<br />
zugeschrieben wird (vgl. Psychoanalyse). Die P. kann bis zu maximal 300 Stunden<br />
auf Kassenkosten durchgeführt werden.<br />
Psychotherapie-Richtlinien: Richtlinien über die in der GKV zugelassenen<br />
Psychotherapieverfahren und ihre Umsetzung. Die Richtlinien werden aufgrund der<br />
Beschlüsse des Gemeinsamen Bundesausschusses "Psychotherapie-Richtlinien"<br />
zwischen KBV und gesetzlichen Kassen vereinbart. Derzeit sind nach den P. drei<br />
Verfahren (psychoanalytische Psychotherapie, tiefenpsychologisch fundierte<br />
Psychotherapie und Verhaltenstherapie) anerkannt als Richtlinienverfahren.<br />
PsychThG: Offizielle juristische Abkürzung <strong>für</strong> Psychotherapeutengesetz, s. dort.<br />
PTG: Eingebürgerte Abkürzung <strong>für</strong> Psychotherapeutengesetz, s. dort.<br />
Punktwert: Der Punktwert ist die Eurocent ausgedrückte aktuelle Bewertung der<br />
zunächst nur mit Punktzahlen bewerteten ärztlichen Leistungen.<br />
Punktzahl: Die Zahl, mit der eine ärztliche oder <strong>psychotherapeutische</strong> Leistung im<br />
EBM bewertet wird.).<br />
Q<br />
QM: Qualitätsmanagement. In der GKV tätige Leistungserbringer sind zu QM in ihrer<br />
Praxis gesetzlich verpflichtet. Der <strong>bvvp</strong> bietet hierzu sein preisgünstiges und einfach<br />
zu handhabendes QM-Konzept „q<strong>bvvp</strong>“ an.<br />
QS: Qualitätssicherung.<br />
QZ: Qualitätszirkel. Kollegial geleitete, regelmäßig tagende Arbeitsgruppe von
Seite 11<br />
Ärzten/ärztinnen, PP und/oder KJP zum Zwecke der Fortbildung und des Austauschs.<br />
R<br />
RCT: Randomized Controlled Trial, dt: randomisierte kontrollierte Studie. Die R. ist<br />
heute Standardverfahren („Goldstandard“) bei wissenschaftlicher Überprüfung und<br />
wissenschaftlichem Nachweis. Es gibt ernstzunehmende Bedenken,<br />
Wirksamkeitsnachweise von Psychotherapie nur auf R. zu stützen, statt auch<br />
zusätzlich naturalistische (Feld-)Studien angemessen zu würdigen.<br />
Regelleistungsvolumen: Das R. beschreibt ein Honorarverteilungsverfahren, das<br />
bei Honorardeckelung <strong>für</strong> einen garantierten Punktwert <strong>für</strong> die Leistungsmenge<br />
innerhalb der RLV-Grenzen sorgen und Mengenausweitungen einschränken soll. Es<br />
wird dabei eine bestimmte reguläre Leistungsmenge (Regelleistung) einer<br />
Arztgruppe definiert, die mit einem angemessenen Punktwert vergütet werden soll.<br />
Darüberhinausgehende Leistungen werden dann nur noch mit gestaffeltem<br />
Abschlag/Restpunktwerten (meist deutlich unter 1 Cent) vergütet, um solche<br />
Ausweitungen unattraktiv zu machen (s. Abstaffelung, Mengenausweitung). Für<br />
Psychotherapeuten gab es früher ein R., heute gibt es stattdessen eine zeitbezogene<br />
Kapazitätsgrenze. S. dort.<br />
Richtlinienpsychotherapeut(in: Ärztliche(r) Psychotherapeut(in, Psychologischer<br />
Psychotherapeut/in oder Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut/in, der/die nicht<br />
nur eine wissenschaftlich, sondern auch eine GKV-anerkannte<br />
Psychotherapieausbildung entsprechend den Psychotherapie-Richtlinien<br />
nachgewiesen hat. Für PP und KJP ab 1999 Approbation erforderlich.<br />
Richtlinienpsychotherapie: Die R. ist eine nach den Psychotherapie-Richtlinien<br />
durchgeführte Psychotherapie in einem der dort festgelegten Behandlungsverfahren<br />
(Richtlinienverfahren). Dazu gehören z.Zt. tiefenpsychologisch fundierte<br />
Psychotherapie, analytische Psychotherapie und Verhaltenstherapie in ihren<br />
jeweiligen Varianten.<br />
Richtlinienverfahren: s. Richtlinienpsychotherapie<br />
S<br />
Selbsthilfegruppe: Patientengruppe ohne Leitung eines Psychotherapeuten, die<br />
sich regelmäßig zu Sitzungen trifft. S. sind normalerweise eingebunden in<br />
übergeordnete Gruppenstrukturen oder Organisationen, die den Delegierten der S.<br />
erlauben, miteinander und mit Fachleuten in Kontakt zu treten.<br />
Selbsterfahrungsgruppe: Gruppe unter Leitung eines Psychotherapeuten, an der<br />
psychisch gesunde Teilnehmer teilnehmen, um sich selber besser kennenzulernen.<br />
Daher wird die Teilnahme von den Kassen auch nicht bezahlt.<br />
Selektivvertrag: Vertrag von Leitungserbringern und Krankenkassen neben der<br />
üblichen Vertragsbehandlung. Es gibt ergänzende Selektivverträge (add on) oder<br />
ersetzende Selektivverträge.
Seite 12<br />
StäKo: Ständige Konferenz. Gemeint ist im <strong>psychotherapeutische</strong>n Bereich i.d.R. die<br />
Ständige Konferenz ärztlicher Psychotherapeutischer Verbände (BÄP, BKJPP,<br />
BVDN, DÄVT, Deutsche Gesellschaft <strong>für</strong> Ärztliche Hypnose und Autogenes Training,<br />
DGPR, DGPPN, DGPM, DKPM, GPPMP, Sektion Ärzte im DVT, VPK, Vereinigung<br />
leitender Ärzte psychosomatischer Krankenhäuser und Abteilungen). Die S. ist eine<br />
Arbeitsgemeinschaft, die die rein ärztlich-<strong>psychotherapeutische</strong>n Interessen wahren<br />
soll.<br />
Störung, narzisstische: Störung des Selbsterlebens oder Selbstwerts. Eine der<br />
Hauptindikationen <strong>für</strong> Psychotherapie. Psychopharmaka sind in der Regel<br />
ungeeignet. Typische Formen sind Grandiosität, narzisstische Abkapselung,<br />
Beziehungsunfähigkeit, Minderwertigkeitsgefühle.<br />
Störung, neurotische: Syn: Neurose, Psychoneurose. Auf unbewussten infantilen<br />
Konflikten bzw. frühen Lernprozessen beruhende Fehlanpassung mit<br />
Symptomcharakter. Psychische Beeinträchtigung von Krankheitswert, bei der in der<br />
Regel Psychotherapie indiziert ist. Eine rein pharmakologische (medikamentöse)<br />
Behandlung ist selten angemessen, da sie nicht kausal (ursächlich) wirken kann. Die<br />
N. ist die Hauptindikation <strong>für</strong> Psychotherapie. Typische Formen sind Angstneurosen,<br />
Phobien, neurotische Depressionen, Zwangsneurosen.<br />
Störung, psychosomatische: s. psychosomatische Störung<br />
Störung, funktionelle: Krankheit, die sich in körperlichen Funktionsstörungen zeigt,<br />
zumeist und v.a. zu Anfang ohne somatisches Substrat, bei der psychische Faktoren<br />
bei Auslösung und Aufrechterhaltung kausal beteiligt sind. Daher ist meist statt einer<br />
organmedizinischen eine <strong>psychotherapeutische</strong> Behandlung angemessen und<br />
notwendig. Typische Formen sind sexuelle Störungen, Herzneurosen, Magen- und<br />
Darmstörungen, Appetitlosigkeit.<br />
T<br />
Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie: s. Psychotherapie,<br />
tiefenpsychologisch fundierte.<br />
TP: Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie, s. Psychotherapie,<br />
tiefenpsychologisch fundierte<br />
U<br />
Übergangsregelungen: Die Übergangsregelungen des PTG sahen vor, dass bereits<br />
im Delegationsverfahren arbeitende PP und KJP ihre Ausbildung nicht nach der<br />
Ausbildungs- und Prüfungsverordnung des PTG nachweisen müssen, sondern<br />
aufgrund von theoretischen Kenntnissen in wissenschaftlich anerkannten Verfahren<br />
und durch Praxistätigkeit nachgewiesen haben. Dies galt sowohl <strong>für</strong><br />
Psycholog(inn)en und KJP, die bereits im Delegationsverfahren tätig waren, als auch<br />
<strong>für</strong> die sog. Erstattungspsycholog(inn)en. Für die Approbation als PP<br />
(berufsrechtlicher Teil des PTG) und die Kassenzulassung (sozialrechtlicher Teil des<br />
PTG) gelten jeweils unterschiedliche Ü. Ziel dieser Ü. ist die Besitzstandswahrung<br />
der bereits niedergelassen arbeitenden PP.
V<br />
VAKJP: Vereinigung Analytischer Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeuten.<br />
Fach- und Berufsverband dieser Behandlergruppe.<br />
Vereinigung leitender Ärzte psychosomatischer Krankenhäuser und<br />
Abteilungen, s.a. StäKo.<br />
Seite 13<br />
Vertragspsychotherapeut/in: Ärztlicher Psychotherapeut/in, Psychologischer<br />
Psychotherapeut/inn oder Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut/in, der/die nicht<br />
nur eine wissenschaftlich, sondern auch eine GKV-anerkannte<br />
Psychotherapieausbildung entsprechend den Psychotherapie-Richtlinien<br />
nachgewiesen hat, niedergelassen und KV-zugelassen ist. Für PP und KJP ab 1999<br />
Approbation erforderlich. .<br />
Verhaltenstherapie: Wissenschaftlich und GKV-anerkannte Therapieform<br />
(Richtlinienverfahren), die sich an der empirisch-experimentellen Psychologie<br />
orientiert. Nach Auffassung der V. ist menschliches Verhalten erlernt und kann<br />
wieder verlernt werden. Problematisches Verhalten unterliegt denselben<br />
Lernbedingungen wie sog. normales Verhalten. In der V. werden psychische<br />
Störungen durch eine Verhaltens-/Problemanalyse beschrieben und erklärt und<br />
durch gezielte Interventionen modifiziert. Die V. stellt die Fähigkeit des Menschen zur<br />
Selbstregulation in den Mittelpunkt ihrer Bemühungen. Sie verfügt über eine Reihe<br />
wirksamer therapeutischer Techniken, die differenziert an den Patienten angepasst<br />
werden. Der Therapeut-Patient-Beziehung wird in der modernen V. eine wichtige<br />
Funktion beigemessen.<br />
Verhaltenstherapeut: Auf Verhaltenstherapie spezialisierter Psychotherapeut. Er ist<br />
meist Diplom-Psychologe, da Verhaltenstherapie ein v.a. von psychologischen<br />
Wissenschaftlern entwickeltes Verfahren ist.<br />
VIVT: Verband <strong>für</strong> Integrative Verhaltenstherapie. Verhaltenstherapeutischer<br />
Fachverband in den neuen Bundesländern. S. Gesprächkreis II<br />
VPP: Verband Psychologischer Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten im<br />
BDP. Sektion im BDP (s. dort, s.a. Gesprächkreis II)<br />
VPK: Vereinigung Psychotherapeutisch Tätiger Kassenärzte, s.a. StäKo.<br />
VT: Verhaltenstherapie, s. dort.<br />
Z<br />
Zeitbezogene Kapazitätsgrenze: Zur Leistungsbegrenzung gilt heute – statt des<br />
früheren RLV – bei Psychotherapie eine zeitbezogene Kapazitätsgrenze aller von<br />
einem Psychotherapeut(inn)en im Quartal zusammen erbrachten<br />
Psychotherapieleistungen. Die zeitbezogene Kapazitätsgrenze wird in Punkten<br />
definiert und muss die BSG-Rechtsprechung berücksichtigen. S. dort.
Zusatztitel: Ärztliche Zusatzbezeichnung, hier "fachgebundene Psychotherapie"<br />
oder "Psychoanalyse", die nach entsprechender <strong>psychotherapeutische</strong>r<br />
Zusatzausbildung, die in Weiterbildungsordnung und -richtlinien geregelt wird,<br />
geführt werden darf.<br />
(Dr. F.R. Deister, <strong>bvvp</strong>, ©<strong>bvvp</strong>)<br />
<strong>bvvp</strong> e.V. Bundesverband der Vertragspsychotherapeuten<br />
Schwimmbadstr. 22, 79100 Freiburg<br />
Tel. 0761-7910245 Fax: 0761 7910243<br />
Mail: <strong>bvvp</strong>@<strong>bvvp</strong>.de<br />
www.<strong>bvvp</strong>.de<br />
2013_03<br />
Seite 14