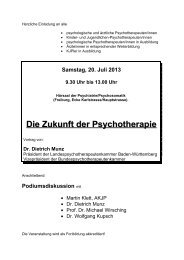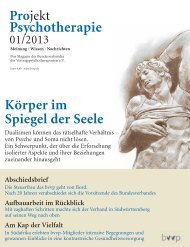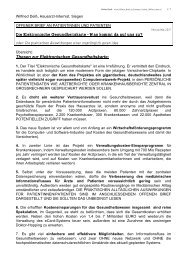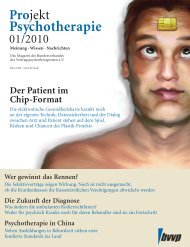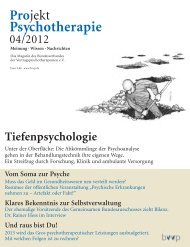Qualifikation Psychotherapie - BVVP
Qualifikation Psychotherapie - BVVP
Qualifikation Psychotherapie - BVVP
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
magazin<br />
Zeitschrift für die Mitglieder<br />
der Regionalverbände im<br />
Bundesverband der<br />
Vertragspsychotherapeuten<br />
(bvvp) e.V.<br />
<strong>Qualifikation</strong><br />
<strong>Psychotherapie</strong><br />
<br />
<br />
Nachwuchssorgen:<br />
Misere bei den PiA<br />
Nachwuchssorgen bei den Ärzten<br />
Kosten- und Strukturerhebung<br />
Sommer 2007<br />
<br />
Praxisübergabe<br />
6. Jahrgang<br />
Ausgabe 4/2007
Marktplatz<br />
Impressum<br />
Herausgeber: Der Vorstand des Bundesverbandes der Vertragspsychotherapeuten<br />
e.V.(bvvp)<br />
bvvp-Geschäftsstelle: Schwimmbadstraße 22, 79100 Freiburg, Tel.:<br />
0761-7910245, Fax: 0761-7910243, E-Mail: bvvp@bvvp.de, Homepage:<br />
www.bvvp.de<br />
Verantwortlich für den Gesamtinhalt im Sinne der gesetzlichen<br />
Bestimmungen: Martin Klett, AKJP, Erasmusstr. 16, 79098 Freiburg,<br />
Tel.: 0761-278090, E-Mail: MartinKlett@t-online.de<br />
Redaktion Bundesvorstand/Regionalverbände: Martin Klett, Erasmusstr.16,<br />
79098 Freiburg, Tel.: 0761-278090, Fax: 07664-600451, E-Mail:<br />
MartinKlett@t-online.de<br />
Redaktion Schwerpunkt, Rezensionen und Sonstiges: Ortwin Löwa,<br />
Hermann-Behn-Weg 20, 20146 Hamburg, Tel. u. Fax: 040-448429, E-<br />
mail: oloewa@gmx.de Dr. med. Rüdiger Hagelberg, Alte Rabenstr. 14,<br />
20148 Hamburg, ruediger_hagelberg@yahoo.de<br />
Referat Dienstleistungen im bvvp: Manfred Falke, Triftstr. 33, 21255<br />
Tostedt: Tel.: 04182-21703, Fax: 04182-22927, E-Mail: vvpnds@bvvp.de<br />
Verlag: Copernicus Gesellschaft mbH, Max-Planck-Str. 3,<br />
37191 Katlenburg-Lindau – Pro jekt leitung: Michael Koschorreck<br />
Satz: Selignow Verlagsservice Berlin,<br />
www.selignow.de<br />
Druck, Bindung, Versand:<br />
druckhaus köthen GmbH, 06366 Köthen<br />
Anzeigen: Copernicus Systems + Technology GmbH, Kreuzbergstr. 30,<br />
10965 Berlin (bis Oktober 2007)<br />
Anzeigenhotline für Beilagen und<br />
gestaltete Anzeigen: 030-6090296-0,<br />
Fax: 030-6090296-22 (Herr Selignow)<br />
Das nächste Heft erscheint am 24.01.08<br />
(Redaktionsschluss: 05.12.07)<br />
ISSN-Nummer: 1683–5328<br />
Praxis<br />
Praxisgründung<br />
Ärztliche Psychotherapeutin (TP) (FÄ Allg.med., Zusatzb.<br />
PT) sucht Praxisübernahme/KV-Sitz oder Jobsharing im Raum<br />
Kempten,Lindau, Ravensburg,Ulm. echiffre:<br />
www.cosis.net/bvvp/ch.php?e=bvvp-Magazin-04/07-158<br />
Praxis-Verkauf<br />
Praxisabgabe Breisgauhochschwarzwald ärztliche "alte" Praxis<br />
mit Tiefenpsychologie und Psychoanalyse zum 1.1.08 an ärztliche<br />
Nachfolge abzugeben. Kontakt: 07633 15611 oder E-Mail:<br />
brueggemann.lutz@gmail.com<br />
Weiterbildung<br />
Weiterbildung in Gestalttherapie Neue Ausbildungsgruppen in<br />
München, Zürich, Würzburg/Frankfurt, Wien. Das neue Programm<br />
der GestaltAkademie ist da. IGW, Theaterstr.4, 97070 Würzburg<br />
fon 0931/354450, www.igw-gestalttherapie.de<br />
Fortbildung<br />
<strong>Psychotherapie</strong> 2008<br />
Psychotherapeutische Zusatzausbildungen<br />
Hypnose, Autogenes Training, Verhaltenstherapie,<br />
Tiefenpsychologie, Psychodynamische <strong>Psychotherapie</strong><br />
aktuelle Themen- und Methodenseminare<br />
Trauma, Angst, Raucherentwöhnung, Depression, Tests<br />
Rechtsfragen, Kuzzeittherapie, Psychosomatik usw.<br />
Aufmerksamkeitsstörungen und Hyperaktivität<br />
Diagnostik,Therapie, Elternarbeit, Soz. Kompetenz<br />
Supervisions-Ausbildung (DGSv)<br />
Therapie von Kindern und Jugendlichen<br />
Hör-/Sprachentwicklung, ADHS, LRS-Störung,<br />
Kinderhypnose, Verhaltensstörungen, Emot. Störungen<br />
Weiterbildung <strong>Psychotherapie</strong> (Blockform)<br />
Facharztausbildung, Zusatzbezeichnung<br />
Psychosomatische Grundkompetenz<br />
Universität Tübingen<br />
Die Zeitschrift ist für Mitglieder der Regionalverbände des bvvp im<br />
Mitgliedsbeitrag enthalten. Einzelverkaufspreis 6 .<br />
Bei Einsendungen an die Redaktion wird, wenn nichts anderes vermerkt,<br />
das Einverständnis zur vollen oder auszugsweisen Veröffentlichung vorausgesetzt.<br />
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt<br />
die Meinung des Herausgebers und der Redaktion wieder. Auszugsweiser<br />
Textabdruck ist mit Quellenangabe gestattet.<br />
Auf unserer homepage www. bvvp-magazin.de können Sie Hefte<br />
bestellen, Beiträge älterer Hefte herunterladen. Schauen Sie mal<br />
rein!<br />
Bitte besuchen Sie auch die bvvp-Homepage www.bvvp.de. Während<br />
wir «fürs Grundsätzliche» zuständig sind, finden Sie dort die aktuelle<br />
Berichterstattung.<br />
2<br />
Wilhelmstraße 5 , D-72074 Tübingen<br />
07071 / 29-76439, -76872, -75010 FAX: 29-5101<br />
wit@uni-tuebingen.de, http://www.wit.uni-tuebingen.de<br />
Wir machen Ihr Buch!<br />
www.selignow.de<br />
bvvp-magazin 4/2007
Inhalt Ausgabe 4/2004 4/2007<br />
bvvp-magazin 4/2007<br />
Vorwort<br />
Bundesvorstand<br />
Regionalverbände<br />
Dienstleistungen<br />
Schwerpunkt<br />
Gelesen<br />
Service<br />
Impressum<br />
Vorwort.............................................................................................................................. 4<br />
Die Kostenerhebung – warum unterstützte der bvvp dieses Projekt? ......... 5<br />
Der heiße Draht zum Mitglied – die Hotline des bvvp zur<br />
Kostenerhebung ........................................................................................................... 7<br />
Da zieht’s einem die Schuh aus! ............................................................................ 9<br />
Berichtspflicht als Dauerbrenner ............................................................................ 9<br />
Gesetzentwurf zur Telekommunikations-Überwachung ................................... 9<br />
Denkwürdiges aus der PKV-Studie – Gesundheitskosten gleichmäßiger<br />
verteilt als gedacht ..................................................................................................... 10<br />
DGPT und bvvp und die deutsche Sprache – unbewußte Botschaften ans<br />
Publikum ........................................................................................................................ 10<br />
„Gesundheitsziele sind eine wichtige Voraussetzung für eine<br />
Verbesserung des Gesundheitszustandes der Bevölkerung“ .......................... 11<br />
Offener Brief des PIA-Netzes .................................................................................... 11<br />
Neues vom „IGeLn“ in und um Hamburg ............................................................ 12<br />
Modelprojekt zur veränderten Abrechnung und Vergütung für die<br />
Fachärzte für Psychosomatik und <strong>Psychotherapie</strong> ............................................. 12<br />
Psychosoziale Versorgung in Deutschland .......................................................... 13<br />
Anträge der KV auf Entziehung der Zulassung .................................................. 14<br />
Pkws zu Sonderkonditionen / Riester-Rente –<br />
Neuerungen in 2008 / Management Handbuch ............................................. 15<br />
<strong>Qualifikation</strong> <strong>Psychotherapie</strong><br />
Rechtliche und wissenschaftliche Grundlagen heutiger <strong>Psychotherapie</strong>-<br />
Aus- und Weiterbildung ............................................................................................. 17<br />
<strong>Qualifikation</strong> <strong>Psychotherapie</strong> ................................................................................... 18<br />
Die Ausbildung der Psychologen/innen (Pädagogen/innen) zu<br />
Psychotherapeuten/innen (PP und KJP) – Ein kritischer Überblick ............ 18<br />
Interview 1 Eine Studie fördert den Protest und die Gründung des ersten<br />
PiA – Netzes .......................................................................................................... 20<br />
Interview 2 Der PiA Protest verbreitert sich und erreicht die Politik ......... 22<br />
Die Weiterbildung der Ärzte/innen zu Psychotherapeuten/innen Ein<br />
kritischer Überblick ..................................................................................................... 24<br />
BÄK und KBV zur Fragen der ärztlichen Weiterbildung und des<br />
Nachwuchses ................................................................................................................ 26<br />
Interview 3 Interview mit der Vorsitzenden des bvvp .................................... 27<br />
Psychotherapeutische Aus- und Weiterbildung heute – eine kritische<br />
Bestandsaufnahme aus Sicht der Institute .......................................................... 29<br />
Immer strebe zum Ganzen ........................................................................................ 30<br />
Für uns gelesen............................................................................................................... 33<br />
Veranstaltungen ............................................................................................................ 32<br />
Adressen der Regionalverbände ............................................................................... 34<br />
Impressum ....................................................................................................................... 2
Vorwort<br />
Liebe Kolleginnen und<br />
Kollegen,<br />
diese Ausgabe unseres bvvp-Magazins ist eine ganz besondere Ausgabe.<br />
Knapp sechs Jahre ist unser Magazin jetzt alt und hat es in dieser<br />
Zeit zu insgesamt 23 Ausgaben gebracht. Das ist eine gute Zeit<br />
für unser Magazin und für uns alle gewesen. Aufregend war es, dass<br />
und wie es überhaupt zu dem Entschluss kam, eine eigene Verbandszeitschrift<br />
zu begründen, und furchtbar viel Arbeit. Ich möchte deshalb<br />
an dieser Stelle die beiden wichtigsten Initiatorinnen der bvvp-<br />
Magazins nochmals hervorheben, die sich in ihrem Drang und ihrer<br />
Lust zum Schreiben und streitbarem Gestalten mit der spitzen Feder<br />
so wesensverwandt sind wie ihre Vornamen. Ursula Neumann und Ursula<br />
Stahlbusch, zwei bärenstarke Schreibe-Frauen, haben nicht nur<br />
organisatorisch die Ärmel hochgekrempelt, sondern auch dafür gesorgt,<br />
dass sich viele Mitglieder mit ihren Interessen an gesellschaftspolitischen<br />
Themen aus an die <strong>Psychotherapie</strong> angrenzenden Gebieten<br />
im Magazin wieder gefunden haben.<br />
Unsere Partner für Druck, Lay-out und Versand waren Herr<br />
Koschorrek vom Copernicus-Verlag und Herr Selignow. Die Zusammenarbeit,<br />
für die ich mich hiermit im Namen des Vorstands und unserer<br />
Mitglieder herzlich bedanken will, war immer angenehm, verständnisvoll<br />
und entgegenkommend. Insbesondere Herr Selignow<br />
war bei jeder Ausgabe geduldig mit den Detailfragen befasst.<br />
Ursula Stahlbusch und Ursula Neumann<br />
Foto: Ursula Neumann<br />
Und trotzdem – dies wird das letzte Heft in dieser Zusammenarbeit<br />
sein. Nach reiflicher Überlegung<br />
haben wir einen Relaunch<br />
unseres Magazins beschlossen.<br />
Ab 2008 wird unser<br />
Magazin bei einem anderen<br />
Verlag erscheinen, in gleicher,<br />
bzw. wie wir hoffen noch<br />
besserer inhaltlicher Qualität<br />
und in neuer äußerer Aufmachung.<br />
Der Neustart zum nächsten<br />
Jahr wird nicht nur für<br />
Sie als unsere geneigten Leser<br />
spannend werden, sondern<br />
auch für uns, die Mitglieder<br />
des Bundesvorstands,<br />
Andreas-M. Selignow<br />
die regelmäßig für das Magazin<br />
schreiben und unsere beiden jetzigen Schwerpunktredakteure,<br />
Herr Löwa und Herr Hagelberg, die Nachfolger der beiden Ursulas.<br />
Wir alle sind gespannt, wie gut uns die Bewegung, Veränderung und<br />
Erneuerung gelingen wird, freuen uns aber auch sehr darauf und hoffen,<br />
dass Sie im nächsten Jahr, wenn sie das erste Heft der neuen Generation<br />
in Händen halten, mit uns begeistert sein werden.<br />
Mit besten Grüßen<br />
Ihre Birgit Clever<br />
Vorsitzende bvvp<br />
Ortwin Löwa, Ursula Stahlbusch, Ursula Neumann, Rüdiger Hagelberg<br />
<br />
bvvp-magazin 4/2007
Aus der Gesundheitspolitik<br />
und dem Bundesvorstand<br />
Die Kostenerhebung<br />
– warum unterstützte<br />
der bvvp dieses<br />
Projekt?<br />
Die KBV beschloss, eine Erhebung zu den Kosten<br />
und den Organisationsstrukturen für Praxen<br />
aus dem Bereich Neurologie, Psychiatrie,<br />
Psychosomatik und <strong>Psychotherapie</strong> durchzuführen.<br />
Warum der ganze Aufwand?<br />
Diese Erhebung ist die Folge von immer wieder<br />
vorgebrachten Forderungen der Berufsverbände<br />
und insbesondere des Beratenden Fachausschusses<br />
<strong>Psychotherapie</strong> bei der KBV. Sie<br />
ist auch im Zusammenhang damit zu sehen,<br />
dass im Wettbewerbsstärkungsgesetz durch<br />
den Gesetzgeber festgelegt wurde, dass ab<br />
dem Jahr 2008 ein neuer EBM gelten soll und<br />
dass ab 2009 die Angemessenheit der Vergütung<br />
zeitgebundener psychotherapeutischer<br />
Leistungen ganz und gar über den EBM – also<br />
über die Punktzahl – hergestellt werden muss.<br />
Der Punktwert hingegen soll bundesweit und<br />
für alle Arztgruppen gleich sein.<br />
Die Forderung, die insbesondere auch immer<br />
der bvvp in den verschiedensten Zusammenhängen<br />
vorgebracht hatte, ergab sich<br />
aus der Tatsache, dass die Praxiskosten im<br />
sog. Praxisbetriebsmodell „<strong>Psychotherapie</strong>“<br />
für den EBM mit 25.000 €Euro ausgesprochen<br />
niedrig waren und im Gegensatz zur<br />
BSG-Rechtsprechung und den Beschlüssen<br />
des Bewertungsausschusses keine halbe Personalstelle<br />
vorsehen. Eine Reinigungskraft<br />
könnte mit den vorgesehenen ca. 3500 Euro€<br />
im Jahr gerade bezahlt werden. Auch die<br />
Mietkosten spiegelten die traurige Historie<br />
der Sparpraxen wider.<br />
bvvp-magazin 4/2007<br />
Sachzwang oder versteckte<br />
Absicht?<br />
Zunächst war versucht worden, die Krankenkassen<br />
auch für das Projekt zu interessieren und<br />
sie als Mit-Finanziers zu gewinnen. Die Kassen<br />
wollten aber lieber nicht. Bis das klar war, war<br />
viel Zeit verronnen. Mitte Oktober tagt der Erweiterte<br />
Bewertungsausschuss. Bis dahin müssen<br />
für alle EBM-Leistungen Punktzahlen kalkuliert<br />
sein. Ende Juni wurde dann die Firma Prime<br />
Networks allein von der KBV beauftragt. Diese<br />
fing Anfang Juli mit der Arbeit an und stellte<br />
am 18.7.07 der KBV, den Berufsverbänden und<br />
auch den Kassen, die sich dazu gern einladen<br />
ließen, das Konzept vor. Bereits im Anschluss<br />
an diese Sitzung wurden erste Änderungen mit<br />
der Firma diskutiert und dann in den nächsten<br />
5 Tagen incl. Wochenende mit Prime Networks<br />
abgestimmt. Die Firma war äußerst kooperativ<br />
und nahm Anregungen gern auf. Wie Prime<br />
Networks am Ende dieser hektischen Tage<br />
feststellte, sei der Fragebogen nun viel besser<br />
geworden. Dennoch merkt man ihm an, dass<br />
er mit heißer Nadel gestrickt wurde.<br />
Erhebung der Realität<br />
In der Phase der Konstruktion des Bogens ist<br />
es gelungen, die Basis dafür zu legen, dass die<br />
Arbeitsrealität von Psychotherapeuten besser<br />
abgebildet wird als in früheren Erhebungen.<br />
Es wird nicht nur nach dem real vorhandenen<br />
und bezahlten Personal gefragt, sondern auch<br />
nach mithelfenden Familienangehörigen. Am<br />
allerwichtigsten war jedoch die Frage nach den<br />
Tätigkeiten, die üblicherweise von einer Helferin<br />
oder einer Sekretärin ausgeführt werden:<br />
die delegierbaren Tätigkeiten.<br />
Der Kampf um die Spalte<br />
Etwas sarkastisch kann man feststellen, dass<br />
sich jahrelanges Argumentieren in den Gremien<br />
der KBV nun im Vorhandensein einer zusätzlichen<br />
Spalte in einer Tabelle einer Erhebung<br />
niederschlägt. Mit den Ergebnissen aus<br />
dieser Spalte hoffen wir Psychotherapeuten in<br />
der KBV darstellen zu können, dass das BSG<br />
recht hat: nur mit einer halben Personalstel-<br />
<br />
le ist es überhaupt möglich, eine psychotherapeutische<br />
Praxis so zu organisieren, dass<br />
die sog. optimale Praxis mit ca. 36 Sitzungen<br />
pro Woche erreicht werden kann. Die „Helferinnen-Arbeiten“<br />
müssen auch dann gemacht<br />
werden, wenn es keine Helferin gibt. Sie würden<br />
ab 2009 bei unveränderter Punktzahl von<br />
den Praxisinhabern umsonst erbracht, da sie<br />
nirgends einkalkuliert sind.<br />
Erhebung, Auswertung und<br />
Interpretation<br />
Der ganze August und die erste Septemberwoche<br />
standen für die Erhebung zur Verfügung.<br />
Innerhalb einer Woche soll ausgewertet<br />
werden. Die ersten Zwischenberichte über<br />
die Teilnahme stimmten eher bedenklich. Die<br />
Psychotherapeuten waren wirklich in Urlaub!<br />
Eine Verlängerung um 4 Tage ergab dann<br />
aber doch eine Beteiligung von insgesamt<br />
ca. 2000 Psychiatern, Neurologen und Psychotherapeuten.<br />
Das Ziel der derzeitigen berufspolitischen<br />
Arbeit besteht in dem Versuch, auch mit Hilfe<br />
der Erhebung zu belegen, was wir schon<br />
lange vortragen und wofür wir die Unterstützung<br />
des BSG haben: Psychotherapeuten<br />
können nur mit Personal Punktzahlen von<br />
über 500 000 Punkten (beim gegenwärtigen<br />
EBM) erreichen. Psychotherapeuten, die im<br />
Durchschnitt der Psychotherapeuten liegen,<br />
also zwischen 300 000 und 350 000 Punkten<br />
pro Quartal, erbringen den größten Teil<br />
der Helferinnen-Tätigkeit selbst.<br />
Welche Hürden sind zu nehmen?<br />
Sobald die Daten vorliegen, muss zunächst<br />
die KBV überzeugt werden. Das ist Aufgabe<br />
des Beratenden Fachausschusses. Dann muss<br />
die Ärzteseite im Arbeitsausschuss des Bewertungsausschusses<br />
gewonnen werden. Hierbei<br />
muss die KBV die beiden Vertreter der Psychotherapeuten,<br />
Dieter Best und den Autor dieses<br />
Artikels, unterstützen.<br />
Danach erst müssen die Kassen im Arbeitsausschuss<br />
des Bewertungsausschusses überzeugt<br />
werden. Da in diesen Sitzungen auch immer<br />
ein Vertreter oder eine Vertreterin des BMG
Aus der Gesundheitspolitik und dem Bundesvorstand<br />
GEMEINSAME SELBSTVERWALTUNG<br />
KRANKENKASSEN<br />
AK 4<br />
KBV<br />
ARBEITS AUSSCHUSS<br />
KRANKENKASSEN<br />
ÄRZTE<br />
Psychotherapeuten<br />
TEIL-IDENTISCH<br />
BEWERTUNGS AUSSCHUSS<br />
Krankenkassen<br />
Ärzte<br />
ERWEITERTER BA<br />
ZUSÄTZLICH 4 NEUTRALE<br />
+ 1 VORSITZENDER<br />
Dieter Best, stellv. Vors. Deutsche<br />
Psychotheapeutenvereinigung<br />
Jürgen Doebert, kooptiertes<br />
Vorstandsmitglied bvvp<br />
anwesend ist, hoffen wir auch noch auf dessen<br />
Unterstützung. Wenn sich Kassen und Ärzte einigen,<br />
ist es gut, wenn nicht, sind wir darauf<br />
angewiesen, dass wir unser Anliegen auch dem<br />
unparteiischen Vorsitzenden des erweiterten<br />
Bewertungsausschusses nahe bringen.<br />
Ein Randproblem<br />
Was für uns Psychotherapeuten unglaublich<br />
wichtig ist, ist gesamt gesehen eine Petitesse.<br />
Die richtig schwierigen Probleme liegen in der<br />
Einigung mit den Kassen über die Gesamtforderungen<br />
für die Ärzte. Eine Liste von Forderungen<br />
hat die KBV aufgestellt:<br />
• bei den Kosten soll die Mehrwertsteuererhöhung<br />
bei den Posten einkalkuliert<br />
werden, die der Mehrwertsteuer unterliegen.<br />
• Beim Arztlohn soll die in den Krankenhäusern<br />
erstrittene Erhöhung der Oberarztgehälter<br />
sich auch auf den Anteil jeder<br />
Leistung auswirken, die den Arztlohn<br />
darstellt. Die KBV geht hier mit einer Forderung<br />
von knapp 30.000 € Erhöhung in<br />
die Verhandlungen.<br />
• Für alle Ärzte soll die Produktivität um<br />
10% gesenkt werden. Die Produktivität<br />
ist eine Stellschraube bei der EBM-Kalkulation,<br />
mit der der Anteil abrechenbarer<br />
Zeit pro Woche an den angenommenen<br />
51 Stunden Gesamtarbeitszeit dargestellt<br />
wird. Die Begründung der KBV hierfür<br />
liegt im Anwachsen der Dokumentationen<br />
und Verwaltungsarbeiten durch den<br />
Arzt, z.B. QM.<br />
• Außerdem soll in alle Praxiskostenbetriebsmodelle<br />
eine zusätzliche Personalstelle<br />
hineinkalkuliert werden. Allerdings<br />
sind bei dieser Forderung die Psychotherapeuten<br />
ausgenommen. Auch hier liegt<br />
die Begründung in erhöhtem Verwaltungsaufwand,<br />
der vorgeschriebenen QM<br />
usw.<br />
Der KBV pfeift bei diesen Forderungen der<br />
Wind ins Gesicht: Die Kassen bestehen darauf,<br />
dass für das Jahr 2008 keine zusätzlichen<br />
Kosten entstehen sollen. Dafür haben sie die<br />
Unterstützung des BMG. Auch dies bekräftigt,<br />
dass das Gesetz keine Neukalkulation der<br />
Kosten oder der Punktzahlen erlaube. Lediglich<br />
die Pauschalierung vieler Leistungen sei<br />
vorgeschrieben und somit auch deren Neukalkulation<br />
aus der Kombination der zusammengefassten<br />
Leistungen. Diese Äußerungen<br />
des BMG verwundern insofern, als die Hau-<br />
<br />
särzte ja den Eindruck gewonnen hatten, insbesondere<br />
mit Unterstützung des BMG eine<br />
kräftige Honorarerhöhung einfordern zu können.<br />
Der Traum einer Verdopplung des bisherigen<br />
Scheinwertes durch die neue Hausarztpauschale<br />
scheint durch die Äußerungen des<br />
Ministeriums ausgeträumt.<br />
Das Auseinanderklaffen der Termine führt<br />
zu vielen Problemen. In 2008 soll ein neuer<br />
EBM mit den Pauschalierungen kommen.<br />
In 2009 aber erst der Fonds samt morbiditäts-gestützter<br />
Mengenbegrenzung, wovon<br />
sich die Ärzteschaft aber zusätzliches<br />
Geld erhofft.<br />
Schwierige Gemengelage<br />
Natürlich würden alle Psychotherapeuten von<br />
den oben angesprochenen ersten drei Veränderungen<br />
profitieren – auch wenn sie alle<br />
nicht in der gewünschten Höhe am Ende<br />
herauskämen. Das wird uns aber nicht helfen,<br />
denn wir brauchen eine Erhöhung unserer<br />
Punktzahl, die relativ noch höher ist als<br />
die aller anderen Arztgruppen. Denn zur Zeit<br />
erreichen wir die „angemessene Vergütung“<br />
nur durch einen höheren Punktwert. In Zukunft<br />
müssen wir das über die Punktzahl er-<br />
bvvp-magazin 4/2007
Aus der Gesundheitspolitik und dem Bundesvorstand<br />
reichen- jedenfalls größtenteils. Die KBV hält<br />
einen Zuschlag für sinnvoll, wenn anders nicht<br />
flexibel genug die Anpassung an die Gewinne<br />
des Facharztmix erreicht werden kann.<br />
In einer Hinsicht haben wir gute Karten:<br />
Für die psychotherapeutischen Leistungen ergibt<br />
sich aus der Formulierung des Gesetzes<br />
geradezu die Notwendigkeit einer Neukalkulation.<br />
Genau dies führte – und damit sind wir<br />
wieder am Anfang – zur Kostenerhebung!<br />
Jürgen Doebert<br />
kooptiertes Vorstandsmitglied bvvp<br />
bvvp-Geschäftsstelle Postversand<br />
+++Neueste Nachricht+++<br />
Neueste Nachricht +++++<br />
Am 25.9.2007 präsentierte die Firma<br />
PrimeNetworks die Ergebnisse der Kosten-<br />
und Struktur-Erhebung in neurologischen,<br />
psychiatrischen und psychotherapeutischen<br />
Praxen im Arbeitsausschuss<br />
des Bewertungsausschusses<br />
Da es sich im Moment noch um Daten<br />
handelt, die der Geheimhaltung durch das<br />
Gremium unterliegen, kann zunächst nur<br />
folgendes gesagt werden:<br />
1.<br />
2.<br />
3.<br />
4.<br />
Es kamen genügend Datensätze zustande,<br />
um die Erhebung auszuwerten,<br />
obwohl die Erhebung in den Sommerferien<br />
durchgeführt wurde.<br />
Bei allen Fachgruppen ergaben sich<br />
höhere Praxiskosten, als bisher im<br />
EBM kalkuliert. Insbesondere Personalkosten,<br />
Miete und Versicherungen<br />
verursachen die höhere Gesamtsumme<br />
Plausibilisierungs-Überprüfungen ergaben,<br />
dass die Angaben realistisch<br />
und glaubhaft sind.<br />
Bei den PP, KJP und ärztlichen Psychotherapeuten<br />
lässt sich deutlich ablesen,<br />
dass angestelltes Personal mehr<br />
als in früheren Erhebungen vorhanden<br />
ist, aber insgesamt so wenig, daß vom<br />
Praxisinhaber in nennenswertem Umfang<br />
Tätigkeiten ausgeführt werden,<br />
die eigentlich von Personal ausgeführt<br />
werden könnten, wenn es vorhanden<br />
wäre.<br />
Aufgrund der nun erhobenen Daten wird<br />
die KBV eine Neukalkulation der Abrechnungsziffern<br />
der betroffenen Arztgruppen<br />
durchführen. Dann kommt es darauf an,<br />
inwieweit den Kassen die sprechende Medizin<br />
am Herzen liegt.<br />
Jürgen Doebert<br />
kooptiertes Vorstandsmitglied bvvp<br />
bvvp-magazin 4/2007<br />
.<br />
Der heiße Draht zum<br />
Mitglied – die Hotline<br />
des bvvp zur<br />
Kostenerhebung<br />
Einen Riesenkraftakt hat der bvvp-Vorstand<br />
zusammen mit der Bundesgeschäftsstelle vollbracht:<br />
im Zusammenhang mit der Kostenerhebung<br />
der KBV (s. Artikel. S. 5) musste unter<br />
größtem Zeitdruck eine „Segelanweisung“<br />
zum Ausfüllen als Hilfe für unsere Mitglieder<br />
erstellt werden. Diese bvvp-Info musste dann<br />
4500 mal gedruckt und in Briefumschläge gesteckt<br />
werden, damit jedes Mitglied die Segelanweisung<br />
pünktlich, d.h. möglichst zeitgleich<br />
mit der Aussendung des durch die KBV beauftragten<br />
Prime-Trust-Centers erhielt.<br />
„Eine Hotline wäre gut....“ so der Gedanke<br />
in der Vorstands-Telefonkonferenz. ….Aber<br />
Fotos unserer Hotline-Aktiven:<br />
rechts oben: Helga Ströhle<br />
mitte: Elisabeth Schneider-Reinsch<br />
unten rechts Benedikt Waldherr<br />
unten mitte: Martin Kremser
Aus der Gesundheitspolitik und dem Bundesvorstand<br />
Veronika Fekete<br />
die Telefonnummer sollte schon in der Segelanweisung<br />
stehen... Und morgen müssen wir<br />
mit dem Drucken anfangen... Wer soll denn<br />
die Hotline machen? ... Die Landesvorstände?<br />
..Die sind großenteils im Urlaub ... Also<br />
der Vorstand ... Wie kann man das organisieren????<br />
Die Lösung bestand in einer glücklicherweise<br />
noch aufgefundenen bisher nicht genutzten<br />
Telefonnummer des bvvp, einem<br />
schnell gekauften zusätzlichen ISDN-Telefon,<br />
mit dem man Rufumleitungen machen<br />
kann. Dann in einer Excel-Tabelle mit vielen<br />
offenen Zeiten, in die sich die Vorstandsmitglieder<br />
eintragen konnten.<br />
Der Anspruch war hoch: jeden Tag außer<br />
Sonntag von morgens bis in den Abend<br />
hinein, in der Regel von 10.00 -22.00 Uhr<br />
wollten wir dienstbereit sein!! Ist das angesichts<br />
von Urlaub der Vorstandsmitglieder<br />
überhaupt zu schaffen?<br />
Die Rettung kam durch ehemalige Vorstandsmitglieder:<br />
Elisabeth Schneider-<br />
Reinsch, Helga Ströhle und Benedikt Waldherr.<br />
Sie übernahmen viele Dienste. Nur bei<br />
wenigen Engpässen musste der uns vertraute<br />
Anrufbeantworter auf einen Rückruf verweisen.<br />
Der eindeutige Hot-Line-König ist unser<br />
Vorstandsmitglied Martin Kremser, der<br />
unglaublich viele Zeiten abdeckte und sehr<br />
viele Gespräche führte.<br />
Die Mitglieder lohnten uns die Mühe: die<br />
Hotline wurde außerordentlich intensiv genutzt.<br />
Und alle „Hot-Liner“ bekamen deutlichen<br />
Zuspruch von den Anrufern, was für<br />
eine wirklich gute Sache diese Hilfe beim<br />
Ausfüllen sei. Manche/r war überrascht, wie<br />
viel er oder sie in der Woche arbeitet. Andere<br />
staunten, was aus dem Honorarbescheid der<br />
KV alles zu entnehmen ist. Für wieder andere<br />
ergaben sich Hinweise, dass sie bei ihrer<br />
Steuererklärung noch manches nicht bedacht<br />
hatten. Und natürlich: alle hatten Verständnisfragen<br />
zu dem Erhebungsbogen, denn:<br />
sobald man sich näher damit beschäftigte,<br />
merkte man, wie unklar manche Fragen waren,<br />
wie wenig man die eigene Praxis darin<br />
abbilden konnte usw..<br />
Ein schöner Nebeneffekt: Fast alle Vorstandsmitglieder<br />
wissen jetzt, wie man am<br />
eigenen Telefon eine Anrufweiterschaltung<br />
hinbekommt! Was die Anrufer nicht merkten<br />
war nämlich, dass sie eine kleine Reise<br />
durch Deutschland immer zuerst nach Freiburg,<br />
dann aber über Wiesbaden nach Stuttgart<br />
und Hannover machten.<br />
Die Auswertung der Anrufe geschah mit<br />
einer immer fortgesetzten excel-Tabelle: Anliegen<br />
und Antwort. So konnten sich die<br />
„Hot-Liner“ gegenseitig Hinweise geben und<br />
wurden immer kompetenter. Und es konnte<br />
eine Liste mit häufig gestellten Fragen nach<br />
ca. einer Woche auf die Homepage gestellt<br />
werden. So lernten alle, was eine FAQ-Liste<br />
ist: frequently asked questions.<br />
Die bvvp-Info zum Erhebungsbogen und<br />
die FAQ-Liste wurden – ganz sicher wegen<br />
der schnellen Verfügbarkeit und wegen ihrer<br />
<br />
Beya Stickel<br />
Qualität – von mehreren anderen Verbänden<br />
übernommen: DGPT und VAKJP sowie DGVT<br />
übernahmen die Bögen ganz, die Kinder- und<br />
Jugend-Psychiater großenteils.<br />
Im Sinne der Sache wurde auf der Homepage<br />
und in e-mail Listen angeboten, die bvvp-Info<br />
persönlich zuzusenden, wenn man<br />
sich bei der Geschäftsstelle meldet. Die Geschäftsstelle<br />
wurde erfreulich oft angemailt.<br />
Jeder Anfragende erhielt mit den Infos auch<br />
gleich die Einladung, dem Verband beizutreten.<br />
Es hat sich in der Tat schon einigen erschlossen,<br />
wie gut und fundiert der bvvp arbeitet,<br />
und entsprechende Anfragen gingen<br />
ein.<br />
Fazit: knapp 200 PP, KJP und ÄP wurden<br />
über die Hot-Line betreut und oft auch erst<br />
endgültig zur Teilnahme an der Erhebung motiviert.<br />
Eine weitere große Zahl wandte sich<br />
an den jeweiligen Landesverband. Gemessen<br />
am Rücklauf, der Ferienzeit und der sofort erkennbaren<br />
Mühsal der Ausfüll-Arbeit ist dies<br />
ein gigantisches Ergebnis!<br />
Gemessen an der Wichtigkeit der Kostenerhebung<br />
für die gesamte Berufsgruppe ist eine<br />
Beteiligung von.1910 (davon 722 PP, 269 KJP,<br />
die übrigen verteilen sich auf die ärztlich-psychotherapeutischen<br />
Berufsgrupen) auf den ersten<br />
Blick klein. Dennoch sind KBV und Prime<br />
Trust mit der „Ausbeute“ sehr zufrieden. Angesichts<br />
von Ferien und mit den Erfahrungen<br />
aus sonstigen Erhebungen ist die Teilnahme<br />
sogar gigantisch. Allen, die sich durch den<br />
Fragebogen gequält haben, ist sehr zu danken!<br />
Sie haben sich sozusagen um die Berufsgruppe<br />
verdient gemacht und die Basis dafür<br />
gelegt, dass wir gegenüber KBV und Kassen<br />
nicht mit leeren Händen da stehen.<br />
Jürgen Doebert<br />
kooptiertes Vorstandsmitglied bvvp<br />
Vorstandskollege Kremser am Ende eines langen Hotline-Tages mit einem Anrufer nach Ausfüllen des Erhebungsbogens<br />
bvvp-magazin 4/2007
Aus der Gesundheitspolitik und dem Bundesvorstand<br />
Kommentar<br />
Lieber Jürgen, lieber Hermann, liebe Alle<br />
vom <strong>BVVP</strong><br />
Ich möchte Euch ganz herzlich Dank sagen<br />
für das große Engagement des bvvp<br />
bei der Beratung zur Befragung über die<br />
Praxiskosten. Der bvvp hat meiner Ansicht<br />
nach, die differenziertesten und präzisesten<br />
Analysen vorgegeben.<br />
Ich hoffe, dass sich Eure hervorragende<br />
Arbeit auch darin niederschlägt, dass<br />
Mitglieder, die sich von ihrem bisherigen<br />
Verband nicht mehr ausreichend vertreten<br />
fühlen, in den <strong>BVVP</strong> eintreten.<br />
Der Beitrag ist gut angelegt, denn<br />
das Geld wird vor allem vor Ort für<br />
die Regionalverbände ausgegeben,<br />
die sich besonders fundiert für die<br />
Mitgliederbetreuung einsetzen. Man hat<br />
also wirklich was davon.<br />
Herzlichen Gruß<br />
Marianne Funk<br />
Da zieht’s einem die<br />
Schuh aus!<br />
Vor vielen, vielen Jahren gelang es Hermann<br />
Mezger, unserem Musterkläger bis hin zum<br />
BSG und Vorsitzendem des VVPSW, dass<br />
auch im regionalen „Reutlinger Generalanzeiger“<br />
über die Honorarmisere der Psychotherapeuten<br />
berichtet wurde. Die katastrophale<br />
Lage der Psychotherapeuten wurde<br />
im Mai 1999 in einem Artikel mit der Überschrift<br />
„Hier putzt der Chef persönlich!“ dargestellt.<br />
Der Begriff der Sparpraxis (der durch<br />
die „Henker-Studie“ des <strong>BVVP</strong> 1996 erstmals<br />
salonfähig gemacht worden war) wurde hier<br />
drastisch-plastisch illustriert.<br />
Ist das noch zu steigern? – Man glaubt<br />
es kaum, aber es geht! Ein Anrufer der<br />
bvvp-Hot-Line zur Kostenerhebung putzt<br />
auch heute noch selbst. Er meinte auf Nachfragen,<br />
dass das nicht aufwändig sei, da er<br />
seine Patienten immer bitte, die Schuhe auszuziehen!<br />
Das ist auch für die Patienten die sinnlich<br />
erfahrbare Sparpraxis!<br />
Jürgen Doebert<br />
kooptiertes Vorstandsmitglied bvvp<br />
Berichtspflicht als<br />
Dauerbrenner<br />
Als Neuestes gibt es zu berichten: bis<br />
31.12.2007 ändert sich an der Rechtslage<br />
und somit auch daran, wie die jeweiligen KVen<br />
es handhaben – nichts!<br />
Dennoch gibt es Bewegung. Zunächst<br />
konnte erreicht werden, dass auch die KBV<br />
die gegenwärtige Regelung als „etwas über<br />
das Ziel hinausgeschossen“ begriff. Somit<br />
hatten wir Unterstützung bei dem Ansinnen,<br />
die jetzigen Regelungen wieder etwas<br />
zu entschärfen. Die gegenwärtige Einigung<br />
mit den Krankenkassen, die aber noch nicht<br />
verabschiedet ist, läuft darauf hinaus, dass<br />
die Berichtspflicht nicht mehr im EBM, sondern<br />
in den <strong>Psychotherapie</strong>-Vereinbarungen<br />
geregelt wird. Darin soll dann stehen, dass<br />
nur zu Beginn und am Ende einer Behandlung<br />
ein Bericht zu schreiben ist, ggf. einmal<br />
im Jahr, wenn sich die Behandlung länger hinzieht.<br />
Das heißt: nicht mehr im Behandlungsfall,<br />
also jedes Quartal, sondern im Krankheitsfall.<br />
Ein Krankheitsfall zieht sich über<br />
4 Quartale hin.<br />
Dennoch: das Sozialgesetzbuch V wird natürlich<br />
nicht geändert. Daher bleibt grund-<br />
bvvp-magazin 4/2007<br />
sätzlich das Schreiben eines Berichts obligatorisch.<br />
Allerdings muss hierfür der Patient<br />
sein Einverständnis erklären. Schriftlich!<br />
Erteilt der Patient das Einverständnis nicht<br />
(mündlich reicht und dann Aktennotiz) besteht<br />
die Berichtspflicht nicht. Wir werden<br />
berichten.<br />
Jürgen Doebert<br />
kooptiertes Vorstandsmitglied bvvp<br />
Gesetzentwurf zur<br />
Telekommunikations-<br />
Überwachung<br />
Die Bundesregierung plant eine Neuregelung<br />
der Telekommunikationsüberwachung.<br />
Laut eigenem Anspruch will sie dabei neben<br />
inzwischen vorhandenen europarechtlichen<br />
Vorschriften auch die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes<br />
berücksichtigen, wonach<br />
auch bei der Telekommunikation der Kernbereich<br />
privater Lebensführung geschützt werden<br />
muss.<br />
<br />
Nach der Lektüre des Gesetzesentwurfes<br />
(BT-Drs. 16/5846, auf der Seite der Bundespsychotherapeutenkammer<br />
unter unten angegebenem<br />
Link nachzulesen) kann aber festgestellt<br />
werden, dass Anspruch und Wirklichkeit<br />
der Gesetzesgestaltung einmal mehr erheblich<br />
auseinander klaffen.<br />
Gespräche zwischen Psychotherapeuten<br />
und Patienten können demnach abgehört<br />
werden, sie sind nur relativ geschützt. „Das<br />
geplante Gesetz ist ein massiver Eingriff in<br />
den Kernbereich der privaten Lebensführung“,<br />
erklärte Prof. Dr. Rainer Richter, Präsident<br />
der Bundespsychotherapeutenkammer<br />
(BPtK) in einer Presseerklärung. „Das heimliche<br />
Mithören von psychotherapeutischen<br />
Gesprächen gefährdet den Erfolg unserer<br />
Behandlung.“ Der Gesetzgeber scheint aber<br />
bei seinem Entwurf zur Telekommunikationsüberwachung<br />
diesen Eingriff in den Kernbereich<br />
der privaten Lebensführung, der ja<br />
laut Bundesverfassungsgericht zu schützen<br />
ist, nicht zu sehen. Diese im Gesetzesentwurf<br />
zum Ausdruck kommende Haltung des<br />
Gesetzgebers ist mindestens von erheblicher<br />
Unkenntnis psychotherapeutischer Behandlungserfordernisse<br />
geprägt, sicher aber bezüglich<br />
den Anforderungen des Bundesverfassungsgerichtes<br />
juristisch ungenügend. Die
Aus der Gesundheitspolitik und dem Bundesvorstand<br />
Martin Klett<br />
sich verstärkende Tendenz der letzten Jahre,<br />
dass unzureichende Gesetzte im Nachhinein<br />
von den Gerichten korrigiert werden müssen,<br />
scheint sich auch hier munter weiter zu entwickeln,<br />
sollten die Psychotherapeuten nicht<br />
wie -im Entwurf bereits vorgesehen- Seelsorger,<br />
Verteidiger und Abgeordnete von der<br />
verdeckten Ermittlung grundsätzlich ausgeschlossen<br />
werden.<br />
Die BPtK hält ein absolutes Verbot von<br />
telekommunikativer Überwachung psychotherapeutischer<br />
Praxen für unbedingt erforderlich,<br />
weil ansonsten der Erfolg einer psychotherapeutischen<br />
Behandlung gefährdet<br />
ist. Sie hat den Abgeordneten im Rechtsausschuss<br />
des Deutschen Bundestages eine<br />
ausführliche Stellungnahme zum Gesetzesentwurf<br />
zugesandt, in der sehr fundiert auf<br />
die Erfordernisse psychotherapeutischer Arbeitsbedingungen<br />
und deren inakzeptablen<br />
und juristisch fragwürdigen Einschränkungen<br />
durch die im Gesetzesentwurf vorgesehenen<br />
Regelungen eingegangen wird.<br />
Wie die BPTK für die Psychotherapeuten<br />
betont auch die BÄK für die Ärzte, dass die<br />
Privatsphäre von Patienten unbedingt geschützt<br />
bleiben muss, weil das uneingeschränkte<br />
Vertrauen im Arzt-Patienten-Verhältnis<br />
die Voraussetzung jeder erfolgreichen<br />
Therapie sei. „Die geplante Neuregelung der<br />
Telekommunikationsüberwachung berührt<br />
elementare Rechte der Patienten“, sagte der<br />
Präsident der Bundesärztekammer, Prof. Jörg-<br />
Dietrich Hoppe, der „Berliner Zeitung“.<br />
Am 19. und 21. September findet eine<br />
Anhörung zum Gesetzesentwurf im Rechtsausschuss<br />
des Deutschen Bundestages statt.<br />
Wir dürfen gespannt sein, ob die begründeten<br />
Bedenken der Profession, wie sie durch<br />
die BPtK und BÄK vorgetragen werden, die<br />
Abgeordneten zur Nachdenklichkeit bewegen<br />
können oder ob der derzeit kursierende<br />
Sicherheits- und Kontrollwahn verantwortlicher<br />
politischer Repräsentanten auch hier<br />
trotz der –auch juristischen – Bedenken die<br />
Oberhand gewinnen wird.<br />
Den Gesetzesentwurf sowie die Stellungnahme<br />
der Bundespsychotherapeutenkammer<br />
können Sie nachlesen unter:<br />
http://www.bptk.de/show/729037.html<br />
Martin Klett,<br />
2. stellv. Vorsitzender bvvp<br />
Denkwürdiges aus der<br />
PKV-Studie –<br />
Gesundheitskosten<br />
gleichmäßiger verteilt<br />
als gedacht<br />
10<br />
Bisher galt die Annahme, dass 20 Prozent der<br />
Versicherten 80 Prozent der Kosten im deutschen<br />
Gesundheitswesen verursachen. Gesundheitspolitiker<br />
und Programme von Krankenkassen<br />
orientierten sich an dieser Relation.<br />
Eine Studie des Wissenschaftlichen Instituts<br />
der Privaten Krankenversicherung kam<br />
nun zu ganz andern, überraschenden Ergebnissen.<br />
Die Gesundheitsausgaben verteilen<br />
sich gleichmäßiger als bisher angenommen<br />
– vor allem bei älteren Versicherten. Bestrebungen,<br />
die darauf abzielen, die Kosten für<br />
teure Patienten zu drosseln, erweisen sich<br />
demzufolge als fragwürdig, besonders wenn<br />
sie zulasten einer breiten Gesundheitsversorgung<br />
gehen.<br />
Dies Studie der PKV fußt auf der Analyse<br />
der Ausgaben für 625.000 beihilfeberechtigte<br />
PKV-Versicherte über 50 Jahre im Zeitraum<br />
von 1995 bis 2004. Im Gegensatz zur<br />
Gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV)<br />
konnte auch der Verlauf der Aufwendungen<br />
für bestimmte Versichertengruppen in die<br />
Auswertung einbezogen werden.<br />
Entgegen der Erwartungen waren die<br />
Ausgaben gerade im ambulanten Bereich im<br />
Untersuchungszeitraum relativ gleichmäßig<br />
über alle Versicherten verteilt. Hohe Ausgaben<br />
kamen nur vereinzelt vor. Patienten, die<br />
im ersten Jahr hohe Ausgaben verursachten,<br />
schlugen in den Folgejahren im Schnitt mit<br />
deutlich geringeren Kosten zu Buche. Aus<br />
den Ergebnissen ergibt sich, dass es nicht<br />
immer dieselben Personen sind, die hohe Gesundheitskosten<br />
verursachen. Die Gesundheitskosten<br />
hängen zwar vom Lebensalter<br />
ab, sind aber innerhalb der jeweiligen Altersgruppe<br />
weit weniger auf Einzelfälle konzentriert<br />
als bisher angenommen. Die Konzentration<br />
nimmt mit zunehmendem Alter<br />
sogar ab. Da aber bei alten Versicherten insgesamt<br />
die höchsten Kosten auftreten, stellt<br />
sich die Verteilungsfrage aus gesundheitsökonomischer<br />
Sicht dort am dringlichsten, da<br />
ein hohes Lebensalter immer mehr mit einer<br />
permanenten Inanspruchnahme von medizinischen<br />
Leistungen einher geht.<br />
Allerdings erweist sich auch, dass im<br />
Durchschnitt die Ausgaben in jedem Lebensalter<br />
in den vergangenen 10 Jahren gewachsen<br />
sind, weil immer mehr Versicherte<br />
aller Altersklassen immer mehr Leistungen<br />
in Anspruch nehmen. Die Gesundheitsversorgung<br />
wird gesamthaft teurer.<br />
Die wesentliche Schlussfolgerung, die aus<br />
der Studie gezogen werden muss, lautet also,<br />
dass die Lösung der Finanzierungsprobleme<br />
im Gesundheitswesen nicht aus einer<br />
Optimierung besonders teurer Fälle erwartet<br />
werden kann. Diese Annahme hat bisher<br />
bei Weichenstellungen unter Kostengesichtspunkten<br />
eine große Rolle gespielt. Nun<br />
ist Umdenken notwendig. Zukünftig muss es<br />
also verstärkt eine optimierten Breitenversorgung<br />
für alle gehen.<br />
Birgit Clever<br />
1. Vorsitzende bvvp<br />
DGPT und bvvp und<br />
die deutsche Sprache<br />
– unbewußte<br />
Botschaften ans<br />
Publikum<br />
Im Mitgliederrundschreiben der DGPT 3/<br />
2007 wird über die Kostenerhebung berichtet.<br />
Gegen Ende des Artikels heißt es: „Der bvvp<br />
hat es übernommen, eine ‚Segelanweisung‘ zu<br />
erarbeiten, in der die im Erhebungsbogen abgefragten<br />
Positionen Schritt für Schritt erläutert<br />
werden. Wir schicken sie Ihnen, mit freundlicher<br />
Genehmigung des bvvp, gern zu!“ In der<br />
Tat, der bvvp hat ein fundiertes Papier formuliert.<br />
Wir haben es primär für unsere Mitglieder<br />
getan. Aber es hat uns natürlich sehr gefreut,<br />
dass andere Verbände diese Arbeit auch dadurch<br />
würdigten, dass sie den Text nutzten.<br />
Im Hinblick auf die DGPT sehen wir es als<br />
Schritt zur Entspannung und zur Zusammenarbeit<br />
auf der Sachebene. Insofern ist das Fol-<br />
bvvp-magazin 4/2007
Aus der Gesundheitspolitik und dem Bundesvorstand<br />
gende auch als ein Beitrag dazu zu verstehen,<br />
gewisse Probleme in der Zusammenarbeit verständlich<br />
zu machen:<br />
Das Wort „übernommen“ in diesem Zusammenhang<br />
erfordert eigentlich die Angabe,<br />
von wem er die Aufgabe übernommen<br />
hat. Man stellt sich eine freundliche Kooperation<br />
der DGPT und des bvvp vor, in der<br />
abgesprochen wird, wer welche Teile einer<br />
Arbeit übernimmt. Genau diese Kooperation<br />
findet allerdings nicht statt- leider! Aber<br />
es wird solch ein Eindruck vermittelt. Das<br />
es nicht sooo freundlich zugeht, ergibt sich<br />
auch daraus, dass hier kein Wort des Dankes<br />
gefunden wird. Hätte man sich damit übernommen?<br />
Und wenn man mal angefangen<br />
hat mit dem Wort „übernommen“ zu spielen,<br />
dann landet man bei der Erkenntnis, dass eine<br />
mögliche, die Realität widerspiegelnde und<br />
einfache Formulierung der DGPT hätte sein<br />
können: „Wir haben die vom bvvp ausgearbeitete<br />
‚Segelanweisung‘ mit freundlicher Genehmigung<br />
des bvvp übernommen.“<br />
Dies führt nun zu dem Gedanken, dass<br />
Geben seliger als Nehmen sei. In Deutschland<br />
schlagen sich die Machtverhältnisse in<br />
einer schönen Verdrehnung nieder: Arbeitgeber<br />
nehmen nämlich eigentlich die Arbeitsleistung<br />
der Arbeiter. So gesehen hat nach<br />
der Formulierungskunst der DGPT der bvvp<br />
die Aufgabe „genommen“ und nicht etwa<br />
die DGPT die Arbeit des bvvp. Aber haben<br />
wir das nicht schon immer geahnt, dass die<br />
DGPT seliger als der bvvp ist? Cobra- übernehmen<br />
Sie!<br />
Jürgen Doebert<br />
kooptiertes Vorstandsmitglied bvvp<br />
„Gesundheitsziele<br />
sind eine wichtige<br />
Voraussetzung für eine<br />
Verbesserung des<br />
Gesundheitszustandes<br />
der Bevölkerung“<br />
„Die Vernetzung und Kooperation der Akteure<br />
im Gesundheitswesen und die Ausrichtung<br />
an gemeinsamen Zielen und Handlungsfeldern<br />
ist eine wesentliche Voraussetzung<br />
für die Qualität der Versorgung und die Verbesserung<br />
der Gesundheit der Bevölkerung“<br />
bvvp-magazin 4/2007<br />
sagte die Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz<br />
und baden-württembergische<br />
Ministerin für Arbeit und Soziales Dr. Monika<br />
Stolz am 10.09.2007 in Berlin, wo sie zusammen<br />
mit der Bundesgesundheitsministerin<br />
Ulla Schmidt die Tagung „Gemeinsam Zukunft<br />
gestalten – Gesundheitsziele konkret“<br />
eröffnet hat.<br />
Der neue Kooperationsverbund des<br />
Forums Gesundheitsziele.de stellte sich in<br />
diesem Rahmen erstmals der breiten Öffentlichkeit<br />
vor. Zahlreiche Akteure des Gesundheitswesens<br />
haben sich partnerschaftlich zusammengefunden,<br />
um das im Jahr 2000 eingerichtete<br />
Modellprojekt zur Entwicklung von<br />
Themenschwerpunkten und nationalen Gesundheitszielen<br />
selbstfinanziert fortzuführen.<br />
Der bvvp ist in diesem Verbund Mitglied<br />
und seit Jahren aktiv an der Entwicklung<br />
beteiligt.<br />
Unter Beteiligung von Bund und Ländern<br />
wurden bereits sechs nationale Gesundheitsziele<br />
definiert. Sie reichen von konkreten<br />
Krankheitsbildern wie Brustkrebs und Zuckerkrankheit<br />
(Diabetes mellitus) über Präventionsziele<br />
wie „Tabakkonsum reduzieren“ und<br />
„Gesund aufwachsen“ bis hin zur Stärkung<br />
der Patientenmitwirkung. Im Bereich der seelischen<br />
Erkrankungen wurde zuletzt die Depression<br />
bearbeitet unter Leitung unserer<br />
Vorsitzenden, Frau Dr. Birgit Clever. Für alle<br />
Gesundheitsziele werden auch Evaluationskonzepte<br />
erarbeitet, die Umsetzung erfordert<br />
die Initiative der im Kooperationsverbund zusammengeschlossenen<br />
Akteure.<br />
„Die Länder werden auch in Zukunft aktiv<br />
an der Weiterentwicklung und Umsetzung<br />
der nationalen Gesundheitsziele mitwirken.<br />
Die Möglichkeit zur Festlegung landesspezifischer<br />
Gesundheitsziele ist dabei aber unentbehrlich.“,<br />
machte Stolz deutlich.<br />
In diesem Zusammenhang verwies die Ministerin<br />
auch auf die Notwendigkeit der Verknüpfung<br />
bei der Festlegung von Zielen mit<br />
der Gesundheitsberichterstattung.<br />
„Gleichzeitig muss auch die Vielfalt der<br />
bestehenden Aktivitäten abgebildet und gefördert<br />
werden. Gesundheitspolitik ist und<br />
bleibt eine Querschnittsaufgabe“, so Stolz,<br />
„die von den beteiligten Akteuren der Selbstverwaltung<br />
und vor Ort in den Stadt – und<br />
Landkreisen in eigener Verantwortung wahrgenommen<br />
wird.“<br />
Birgit Clever<br />
1. Vorsitzende bvvp<br />
11<br />
Offener Brief des PIA-<br />
Netzes<br />
Mit einem offenen Brief an die Klinikleitungen<br />
psychiatrischer und psychosomatischer Kliniken<br />
fordern einige engagierte Psychologische<br />
Psychotherapeuten in Ausbildung (PPiA-Netz)<br />
die tariflich abgesicherte und angemessene<br />
Vergütung des Psychiatriejahres,<br />
das jeder PP und KJP im Rahmen seiner psychotherapeutischen<br />
Ausbildung absolvieren<br />
muss. Angemessen erscheint den KollegInnen<br />
in Ausbildung eine Bezahlung nach TVöD 13<br />
(bzw. BAT IIa), analog der Vergütung der fachärztlichen<br />
Weiterbildung.<br />
Der bvvp unterstützt die im offenen Brief<br />
des PPiA-Netzes erhobenen Forderungen. Die<br />
derzeitige Situation mit ungeregelter und dadurch<br />
überwiegend nicht vorhandener Vergütung<br />
des Psychiatriejahres ist für viele an<br />
den Ausbildungen zum Psychologischen Psychotherapeuten<br />
oder Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten<br />
interessierten KollegInnen<br />
erheblicher Hinderungsgrund, eine<br />
solche Ausbildung beginnen zu können.<br />
Die angemessene Vergütung des Psychiatriejahres<br />
sollte zeitnah im PThG geregelt werden,<br />
ansonsten droht in naher Zukunft ein erheblicher<br />
Nachwuchsmangel.<br />
Weitere Infos finden sich auf der Homepage<br />
des Landesverbands Nordrhein zum Pi-<br />
ANo-Netz bzw. <strong>Psychotherapie</strong>nachwuchs-<br />
NetzNordrhein:<br />
www.<strong>Psychotherapie</strong>NachwuchsNordrhein.de<br />
Martin Klett<br />
2. stellv. Vorsitzender bvvp
Aus den Regionalverbänden<br />
Hamburg<br />
Neues vom „IGeLn“ in und<br />
um Hamburg<br />
Meine Schwiegermutter hustete seit Wochen,<br />
ohne dass der Hausarzt den Grund finden<br />
konnte. Er überwies sie an einen Lungenfacharzt<br />
am Nordrand Hamburgs. Ich begleitete<br />
sie dorthin. In Verdacht hatte ich die<br />
Nebenwirkung eines bestimmten Medikamentes;<br />
aber warum nicht die basalen Lungenparameter<br />
bei einer fast 80 Jährigen mal<br />
zum Ausschluss von Schlimmerem untersuchen<br />
lassen?<br />
Wir hatten ca. eine Stunde gewartet, als<br />
sie aufgerufen wurde. Nun würde also die<br />
Lunge geröntgt und die Lungenfunktion geprüft<br />
werden. Die ärztliche Untersuchung<br />
würde schließlich zu einer Diagnose führen.<br />
Ein Irrtum. Weil ich mir die Beine vertreten<br />
wollte, kam ich zufällig an einem kleinen Behandlungszimmer<br />
mit offener Tür vorbei, in<br />
dem meine Schwiegermutter zu meiner Überraschung<br />
einer Helferin gegenüber saß. Und<br />
ich hörte den Satz: „Das kostet 30 €Euro“.<br />
Offenbar hatte meine Schwiegermutter<br />
vor jeglicher Untersuchung an einem „Verkaufsgespräch“<br />
teil genommen, war sehr verunsichert<br />
und wollte von mir wissen, was sie<br />
von den angebotenen Untersuchungen aus<br />
der „Selbstzahler-Medizin“ über sich ergehen<br />
lassen müsse. Meine allgemeinmedizinischen<br />
Kenntnisse reichten noch locker aus, um alles,<br />
was „im Angebot“ war, so lange als überflüssig<br />
zu deklarieren, als noch nicht einmal der<br />
erste Schritt einer Kassen-bezahlten medizinischen<br />
Untersuchung gegangen war.<br />
Das geschah dann wenig später, weitere<br />
sinnvolle diagnostische Schritte folgten, und<br />
die Diagnose war in der Tat rasch gestellt: Sie<br />
litt an den gut bekannten Nebenwirkungen<br />
ihres Hochdruckmedikamentes.<br />
Eine Patientin von mir, ehemalige Krankenschwester,<br />
berichtete mir empört über den<br />
Besuch bei einem für sie noch unbekannten<br />
Gynäkologen, den sie aufgesucht hatte, nachdem<br />
ihr alter Frauenarzt in Pension gegangen<br />
war. An der „Rezeption“ erhielt sie einen<br />
Fragebogen, auf dem gefragt wurde, ob sie<br />
sich speziellen Untersuchungen, die sinnvoll<br />
und beruhigend wären aber von der Kasse<br />
n o c h nicht bezahlt würden, unterziehen<br />
wollte. Die sollte sie ankreuzen und das Blatt<br />
Papier dann unterschreiben. Sollte sie keine<br />
zusätzlichen Untersuchungen wünschen, wäre<br />
auch das anzukreuzen und dann genauso<br />
zu unterschreiben. Als „Frau vom Fach“ wies<br />
sie beide Ansinnen empört zurück und verließ,<br />
als sie auf kein Verständnis stieß, die<br />
Praxis auf Nimmerwiedersehen.<br />
Berlin<br />
Rüdiger Hagelberg<br />
„Modelprojekt zur veränderten<br />
Abrechnung und<br />
Vergütung für die Fachärzte<br />
für Psychosomatik und<br />
<strong>Psychotherapie</strong><br />
In Berlin läuft seit 1.8.2007 das Modelprojekt,<br />
wie es auf Initiative der DGPM (Vorsitzender<br />
Herr Palmowski) in Zusammenarbeit<br />
mit der KV Berlin entwickelt worden ist. Einschreibefrist<br />
war der 31.7.07. Ende Juni hatte<br />
die KV Berlin durch den Hauptabteilungsleiter<br />
für Abrechnung und Honorar dazu eine<br />
Informationsveranstaltung durchgeführt.<br />
Hier eine kurze Zusammenfassung:<br />
Das funktioniert so, daß auf der Basis<br />
der vier Abrechnungsquartale von 2006 die<br />
Punkte des aktuellen IB (umfaßt in Berlin<br />
Kapitel 22, 35.1 u. 35.3) mit den Punkten<br />
die im Rahmen des Kapitel 35.2 (genehmigungspflichtige<br />
Leistungen für die wir bisher<br />
den gestützten Punktwert erhalten) zu einem<br />
einzigen Budget addiert werden. Diese Gesamtpunktzahl<br />
ist dann für ein Jahr fest und<br />
in keiner Weise ausweitbar (zur Zeit können<br />
Leistungen aus 35.2 vermehrt zum gestützten<br />
Punktwert abgerechnet werden). So entsteht<br />
ein Gesamtbudget, innerhalb dessen<br />
man beliebig Leistungen aus dem Kapitel 22<br />
oder 35 abrechnen kann, solange das Budget<br />
reicht, dann ist Schluß. Gewünscht wird<br />
nun von den Initiatoren, daß die Leistungen<br />
aus Kapitel 35 abrechnungstechnisch zunehmend<br />
über Nummern aus dem Kapitel 22 abgerechnet<br />
werden. Also z.B. Therapiestunden<br />
über die unbegrenzt abzurechnende 10 min –<br />
Gesprächsziffer erbacht werden (obwohl dann<br />
ein 50 min Gespräch deutlich schlechter honoriert<br />
würde). Für das Modellprojekt wird<br />
nach einem speziellen Verfahren ein Punktwert<br />
ermittelt, der angeblich etwas unter dem<br />
gestützte Punktwert liegen wird.<br />
Die Vorteile, die sich die DGPM davon für<br />
die Fachärzte verspricht, sind weder kurznoch<br />
langfristig nachzuvollziehen. Dass dann<br />
keine Anträge mehr geschrieben werden brauchen<br />
und beliebig lange Therapien durchführen<br />
werden können (keine Stundenkontingente)<br />
wird als Gewinn verkauft. So könnte<br />
dann auch ein Facharzt beliebig lange Therapien<br />
machen. Der Erwerb einer analytischen<br />
<strong>Qualifikation</strong> wäre z.B. nicht mehr erforderlich.<br />
(Im Prinzip kann er es schon heute, nur<br />
die niedrigere Honorierung der unbegrenzt<br />
abrechenbaren 10-Min.-Ziffer schränkt das<br />
ein). Die DGPM habe Angst, daß die Langzeittherapie<br />
aus dem Leistungskatalog herausgenommen<br />
werden könnte und will sich<br />
durch die Hintertür Langzeittherapie „light“<br />
sichern, statt mit allen gemeinsam für den Erhalt<br />
der PT inklusive Langzeittherapie als Regelleistung<br />
zu kämpfen. Diagnostische Leistungen,<br />
mit denen man jetzt oft schnell über<br />
die IB-Grenze kommt, würden dann voll honoriert.<br />
(Da das Gesamtbudget aber begrenzt<br />
ist, gehen die diagnostischen Leistungen eindeutig<br />
zu Lasten der therapeutischen Leistungen,<br />
was ja nun noch weniger in unserem Interesse<br />
u. schon gar nicht dem der Patienten<br />
sein kann.) Langfristig will man damit erreichen,<br />
dass die Fachärzte für PS und PT sich<br />
von der Fachgruppe der PP ganz abgrenzen,<br />
was möglichst schon im neuen EBM umgesetzt<br />
werden soll.<br />
Aus politischen und ökonomischen Gründen<br />
haben wir als Verband den Kollegen von<br />
12 bvvp-magazin 4/2007
Aus den Regionalverbänden<br />
einer Teilnahme an dem Modellprojekt abgeraten,<br />
um es nicht durch unsere Teilnahme<br />
zu unterstützen. Wir halten es weder für<br />
richtig aus der Richtlinientherapie auszusteigen,<br />
wie es die DGPM für den Facharzt beabsichtigt,<br />
noch Fachärzte und PP wieder einmal<br />
gegeneinander auszuspielen und voneinander<br />
zu trennen. Dass es Unterschiede zwischen<br />
den PP und Fachärzten gibt ist dabei<br />
unbestritten. Aber da wo wir gleiches tun (in<br />
den Therapiestunden), soll es auch weiterhin<br />
gleich genannt und gleich bewertet werden.<br />
Die DGPM erhofft sich offenbar, dass sie für<br />
sich als kleine Gruppe später eine bessere Honorierung<br />
heraushandeln kann, als langfristig<br />
gemeinsam mit den PP. Das ist eine sehr<br />
fragwürdige Strategie.<br />
Frank Horzetzky<br />
Rheinland-Pfalz<br />
Psychosoziale Versorgung in<br />
Deutschland<br />
Was kann bzw. was soll die<br />
ambulante psycho-somatische<br />
Versorgung leisten?<br />
(Dieser Artikel ist entstanden anlässlich eines<br />
Symposions des medizinischen Dienstes der<br />
Krankenkassen in Rheinland-Pfalz bezüglich<br />
der Versorgung von psychisch Kranken im<br />
ambulanten Kassensystem. Lediglich einige<br />
Änderungen wurden speziell für das Erscheinen<br />
im bvvp-Magazin vorgenommen)<br />
Bei der psychosomatischen Behandlung handelt<br />
es sich um eine Behandlung von seelischen<br />
und körperlichen Erkrankungen. Dabei<br />
betrachtet die Psychosomatische Medizin den<br />
bvvp-magazin 4/2007<br />
Frank Horzetzky<br />
Patienten in seinen Kontakten zu seiner Umgebung,<br />
insbesondere in seiner Beziehung zu<br />
den Mitmenschen und ist daher eine interpersonelle<br />
Medizin, eine „Beziehungsmedizin“.<br />
Dass eine solche Vorgehensweise sinnvoll<br />
und effektiv ist, war schon seit langem den<br />
Hausärzten bekannt und daher war es auch<br />
folgerichtig, dass Michael Balint diese Vorgehensweise<br />
in den Mittelpunkt seiner Betrachtungen<br />
stellte und vor mehr als einem halben<br />
Jahrhundert die Balintgruppenarbeit entwickelte,<br />
die mittlerweile einen festen Platz in<br />
den Weiterbildungsbestimmungen der meisten<br />
Facharztrichtungen gefunden hat.<br />
So kam es dann auch dazu, dass das Fach<br />
Psychosomatische Medizin und <strong>Psychotherapie</strong><br />
1970 seine Aufnahme in der Approbationsordnung<br />
für Ärzte fand.<br />
Untersuchungen zeigen, dass über 20%<br />
der Patienten beim Hausarzt unter Depressionen<br />
und Angststörungen leiden, weitere<br />
20% an psychogenen funktionellen Störungen,<br />
nach heutiger Nomenklatur Somatisierungsstörungen<br />
genannt, dass aber 50 bis<br />
80% dieser Erkrankungen nicht oder unzureichend<br />
diagnostiziert werden (Tress 1997)<br />
und damit unser Gesundheitssystem durch<br />
zu häufige wiederkehrende rein somatische<br />
Abklärung und Behandlung belasten. Dies<br />
belastet einerseits den ambulanten Bereich,<br />
aber auch den stationären Bereich des Gesundheitssystems<br />
und führt zu einer in unserer<br />
Zeit nicht vertretbaren Fehl-Ausgabe<br />
finanzieller Ressourcen.<br />
Gleichzeitig hat sich durch die Veränderungen<br />
der gesamtgesellschaftlichen und<br />
- wirtschaftlichen Verhältnisse und ihre Auswirkungen<br />
auf den Gesundheitssektor eine<br />
Rationalisierungs- und versteckte Rationierungstendenz<br />
ergeben, die eine gute Medizin<br />
nach den Regeln der ärztlichen Kunst auch<br />
bei Nutzung von Einsparpotenzialen kaum<br />
mehr möglich macht.<br />
Daher ist eine ganzheitliche psychosomatische<br />
und damit kosteneffektive Medizin<br />
eine und vielleicht die einzige Möglichkeit,<br />
Menschen und nicht nur Krankheiten in<br />
diesem System noch qualitativ ausreichend<br />
zu behandeln.<br />
Dass eine gute Medizin unter den momentanen<br />
Bedingungen nicht mehr erbracht werden<br />
kann, soll hier nur am Rande noch einmal<br />
Erwähnung finden.<br />
Wer sind nun die Leistungserbringer der<br />
Psychosomatischen Versorgung im ambulanten<br />
Bereich?<br />
Da ist zu allererst der Hausarzt zu erwähnen,<br />
der ja meistens der erste Ansprechpartner<br />
für den Patienten darstellt und der die<br />
13<br />
Siegfried Stephan<br />
richtigen Weichen stellen kann für eine angemessene<br />
und langfristig kostengünstige Medizin.<br />
Zu seiner Aufgabe gehört es, hier Störungen<br />
und Erkrankungen im Kontext der Biografie,<br />
der sozialen Gegebenheiten zu sehen<br />
und dann selbst im Rahmen einer psychosomatischen<br />
Grundversorgung die Behandlung<br />
durchzuführen, wenn er die fachliche<br />
Kompetenz dazu erworben hat oder aber einen<br />
Facharzt mit der entsprechenden Kompetenz<br />
hinzuzuziehen. Dieser kann dann im<br />
Rahmen einer entsprechenden „Grundversorgung“<br />
oder einer spezifischeren Pharmakotherapie<br />
und/oder <strong>Psychotherapie</strong> eine weitere<br />
Behandlung in Abstimmung mit dem<br />
Hausarzt durchführen.<br />
Zu den Fachärzten gehören einerseits die<br />
„Fachärzte für Psychiatrie und <strong>Psychotherapie</strong>“<br />
und Nervenärzte, bei Kindern und<br />
Jugendlichen die „Fachärzte für Kinderund<br />
Jugendpsychiatrie und <strong>Psychotherapie</strong>“,<br />
dann die für die psychosomatischen<br />
Erkrankungen speziell ausgebildeten „Fachärzte<br />
für Psychosomatische Medizin und<br />
<strong>Psychotherapie</strong>“ und außerdem die Psychologischen<br />
Psychotherapeuten und Kinder-<br />
und Jugendlichenpsychotherapeuten<br />
nach dem Psychotherapeutengesetz, die den<br />
Fachärzten zugeordnet werden. Diese nehmen<br />
seit einigen Jahren durch das Psychotherapeutengesetz<br />
ermöglich gleichwertig<br />
an der kassenärztlichen Versorgung teil und<br />
haben die Behandlungsmöglichkeiten erweitert<br />
und verbessert.<br />
Zum anderen gehören auch zu den Behandlern<br />
die Fachärzte mit der Zusatzbezeichnung<br />
„<strong>Psychotherapie</strong>“ und „Psychoanalyse“,<br />
die eine zu ihrem Gebiet zusätzlich<br />
erworbenen Kompetenz in dem psychotherapeutischen<br />
Bereich erworben haben und die<br />
ein zusätzliches wichtiges Glied in der Behandler<br />
darstellen.<br />
Aufgabe dieser aller genannten Facharzt-
Aus den Regionalverbänden<br />
gruppen ist es nun, entsprechend abzuklären,<br />
wer nun der geeignete und für die spezielle<br />
Erkrankung adäquateste Behandler ist. Hier<br />
ist dann die entsprechende Kooperation der<br />
verschiedenen „Psychosomatiker“ gefordert,<br />
wie sie gerade in gemeinsamen „Qualitätszirkeln“<br />
und Intervisionsgruppen gefördert<br />
und praktiziert wird.<br />
So macht es natürlich Sinn, wenn die psychosomatischen<br />
Erkrankungen des Gehirn,<br />
die wir als Psychosen kennen, vom Psychiater<br />
und Nervenarzt schwerpunktmäßig behandelt<br />
werden, auch wenn die oft begleitend<br />
notwendige psychotherapeutische Behandlung<br />
durch einen ärztlichen oder psychologischen<br />
Psychotherapeuten erfolgen kann.<br />
Eine psychosomatische chronische Darmerkrankung<br />
ist dann meist besonders gut bei<br />
einem „Facharzt für psychosomatische Medizin<br />
und <strong>Psychotherapie</strong>“ oder einem spezialisierten<br />
psychologischen Psychotherapeuten<br />
aufgehoben, die medikamentöse Begleitbehandlung<br />
könnte zum Beispiel je nach Ausgestaltung<br />
der Erkrankung auch von einem<br />
Psychiater oder einem Hausarzt/Internisten<br />
mit psychosomatischer Grundkompetenz<br />
erfolgen.<br />
Diese Beispiele zeigen schon, wie wichtig<br />
an dieser Stelle die ergänzenden Kompetenzen<br />
der verschiedenen Facharztgruppen<br />
gefordert sind und eine unter den momentanen<br />
finanziellen Bedingungen überhaupt<br />
noch vertretbare Medizin geleistet<br />
werden kann.<br />
Eine solche Medizin im ambulanten Bereich<br />
ermöglicht es dann, vielen Chronifizierungstendenzen<br />
entgegenzuwirken und damit<br />
eine stationäre Behandlung oft zu verhindern<br />
oder aber abzukürzen. Dass diese Vorgehensweise<br />
auch kurzfristig nicht immer finanziell<br />
billiger ist und bei kurzsichtiger Betrachtungsweise<br />
manchmal sogar teurer erscheinen<br />
läßt, läßt manche gesundheitspolitische<br />
Weitsicht verhindern.<br />
Da sich zur Zeit, und dies wird auf absehbare<br />
Zeit wohl noch so bleiben, die finanziellen<br />
Möglichkeiten in unserem Staat nicht wesentlich<br />
verbessern werden, und dieser staatliche<br />
und gesellschaftliche Engpaß auf unser<br />
Gesundheitssystem auswirkt und manchen<br />
sogar denken läßt, das finanzielle Problem<br />
im Gesundheitssystem sei ausschließlich<br />
dort entstanden, bleibt nur eine Strategie,<br />
die finanziellen Rest-Ressourcen im Gesundheitssystem<br />
zu nutzen:<br />
1. Eine kostengünstige Medizin muß eine<br />
psycho-somatische Medizin sein. Eine<br />
andere können wir uns nicht mehr leisten,<br />
da sie langfristig zu teuer ist.<br />
2. Eine kostengünstige psycho-somatische<br />
Medizin ist nur möglich durch Kooperation<br />
und Absprache zwischen dem Primärarzt<br />
(Hausarzt) und den speziellen Fachärzten<br />
(Psychiater/Nervenarzt, Psychosomatiker,<br />
ärztlicher und psychologischer<br />
Psychotherapeut)<br />
3. Eine kostengünstige psychosomatische<br />
Behandlung ist eine schwerpunktmäßig<br />
im ambulanten Bereich stattfindende<br />
Behandlung. Die dort möglichen Behandlungen<br />
müssen durch Bereitstellung<br />
von den finanziellen Mitteln (teilweise<br />
durch Transfer der Gelder aus dem stationären<br />
Bereich) ermöglicht werden, um die<br />
teurere und in vielen Fällen nicht bessere<br />
stationäre Kliniksbehandlung zu verhindern<br />
oder abzukürzen.<br />
4. Bei notwendiger über die ambulanten<br />
Möglichkeiten hinausgehender Behandlung<br />
ist eine Verzahnung stationärer und<br />
ambulanter Bereiche notwendig und effektiver<br />
(Integrierte Versorgung)<br />
5. Wer die ambulante psycho-somatische<br />
Medizin stützt, trägt dazu bei, dass unsere<br />
Patienten langfristig in unserem Gesundheitssystem<br />
überhaupt noch behandelt<br />
werden können.<br />
Dr. med Siegfried Stephan<br />
Facharzt für Psychiatrie und <strong>Psychotherapie</strong><br />
Facharzt für Psychosomatische Medizin<br />
und <strong>Psychotherapie</strong><br />
Psychoanalyse – spezielle Schmerztherapie<br />
Ärztlicher Vorsitzender des<br />
<strong>Psychotherapie</strong>-Fachausschusses der<br />
Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz<br />
1. Vorsitzender der NETZ für seelische Gesundheit<br />
Mainz e.V.<br />
Delegierter <strong>BVVP</strong> aus Rheinland-Pfalz<br />
Literatur:<br />
– TRESS, W. (Hrsg.): Psychosomatische Grundversorgung.<br />
Stuttgart 1997 (Schattauer)<br />
– DAK-Gesundheitsreport 2002<br />
Westfalen-Lippe<br />
Anträge der KV auf<br />
Entziehung der Zulassung<br />
Die KVWL hat beim Zulassungsausschuß in<br />
knapp 50 Fällen Anfang des Jahres Anträge<br />
auf Entziehung der Zulassung gestellt, weil<br />
die Kollegen zu wenig gearbeitet hatten und<br />
dieses als schwerwiegende Pflichtverletzung<br />
angesehen wurde seitens der KV. Als Maßstab<br />
wurden die erbrachten GKV-Leistungen<br />
genommen (sehr fragwürdiger Maßstab!<br />
Präsenz kann man nicht mit Leistungserbringung<br />
gleichsetzen!). Betroffen waren die Kollegen,<br />
die weniger als 10 Wochenstd. Kalkulationszeit<br />
in 43 Arbeitswochen pro Jahr erbracht<br />
hatten.<br />
Der Zulassungsausschuss <strong>Psychotherapie</strong><br />
bei der KVWL hat inzwischen mehrfach hierzu<br />
getagt, die betroffenen Kollegen eingeladen<br />
und die eingegangenen Begründungen<br />
geprüft. Noch nicht alle betroffenen Kollegen<br />
sind vorstellig geworden. Wie zu hören<br />
ist – einige unserer Mitglieder sind auch betroffen-<br />
wurde in fast allen Fällen seitens des<br />
Zulassungsausschusses der Antrag der KV<br />
zurückgewiesen wegen Unverhältnismäßigkeit.<br />
Einige der Kollegen, die z.B. aus familiären<br />
Gründen vorübergehend wenig arbeiten,<br />
haben befristete Anträge auf hälftiges<br />
Ruhen der Zulassung gestellt wie es seit Anfang<br />
des Jahres aufgrund des neuen Vertragsarztsrechtsänderungsgesetz<br />
möglich ist. Wir<br />
wissen von einem betroffenen Mitglied, dass<br />
die KV gegen den Beschluss des Zulassungsausschusses<br />
in Widerspruch gegangen ist, die<br />
Begründung liegt allerdings noch nicht vor.<br />
Die nächste Instanz ist der Berufungsausschuss.<br />
Solange kein rechtsgültiger Bescheid<br />
vorliegt, ist der Sitz unberührt und die Praxis<br />
kann wieder ausgebaut werden bzw. der Sitz<br />
ausgeschrieben und verkauft werden.<br />
Wir als Berufsverband erleben dieses Vorgehen<br />
der KV als unverhältnismäßige disziplinierende<br />
Maßnahme und werden uns für<br />
die betroffenen Kollegen einsetzen. Die Begründung<br />
der KV, dieses aus Sicherstellungsgründen<br />
veranlasst zu haben, wirkt auf uns<br />
wie ein Scheinargument. Dieses Thema wird<br />
erneut im Fachausschuss <strong>Psychotherapie</strong> zu<br />
diskutieren sein.<br />
Lisa Störmann-Gaede<br />
Fachärztin für Psychosomatische Medizin und <strong>Psychotherapie</strong><br />
und praktische Ärztin. Schatzmeisterin<br />
im AGVP Westfalen-Lippe<br />
14 bvvp-magazin 4/2007
Dienstleistungen<br />
Pkws zu Sonderkonditionen<br />
Nach langer Suche ist es uns gelungen, einen seriösen bundesweit<br />
agierenden Händler für Neuwagen zu finden. Der Preisvorteil für Sie<br />
gegenüber dem Listenpreis liegt bei durchschnittlich 20 %, kann im<br />
Einzelfall auch bei ca. 30 % liegen. Vermitteln können wir Ihnen damit<br />
Neuwagen von fast allen großen Herstellern (VW, Audi, Seat, Skoda,<br />
Opel, Ford, Renault, Nissan, Citroen, Smart, Volvo, Porsche, Chevrolet,<br />
Alfa Romeo), es handelt sich dabei sowohl um deutsche Neufahrzeuge,<br />
als auch um EU-Neuwagen. In jedem Falle erhalten Sie die<br />
volle Werksgarantie als auch eine deutsche Zulassungsbescheinigung<br />
und selbstverständlich ein deutsches Bordbuch. Sie können das Fahrzeug<br />
bei dem ausliefernden Händler oder im Zentrallager ab-holen,<br />
auf Wunsch kann der Wagen jedoch auch zu Ihnen nach Hause geliefert<br />
werden. Der Kaufpreis wird erst bei Übergabe des Fahrzeugs fällig,<br />
auf keinen Fall müssen Sie etwas anzahlen.<br />
Falls Sie ein unverbindliches Angebot wünschen, senden Sie uns<br />
bitte (am einfachsten per Mail oder Fax) den Namen des Herstellers,<br />
Modell/Typ und Ihre Ausstattungswünsche, wir nennen Ihnen dann<br />
den Preis, zu dem wir Ihnen das Fahr-zeug vermitteln können.<br />
bvvp-Dienstleistungen,<br />
c/o Manfred Falke,<br />
Triftstr. 33, 21255 Tostedt,<br />
Tel. 04182/21703, Fax 04182/22927,<br />
E-Mail: falke@bvvp.de<br />
4 % des Bruttoeinkommens des Riester-Renten-Berechtigten (bislang<br />
3%). Der maximal mögliche und steuerlich absetzbare Beitrag<br />
steigt auf jährlich 2.100 (vorher 1.575 ). Die Zulagenhöhe<br />
für einen Erwachsenen steigt auf jährlich 154 (vorher 114 ) und<br />
für ein Kind auf 185 (vorher 138 ). Zudem wird zur Zeit darüber<br />
nachgedacht, ob die Zulagenhöhe für alle ab 2008 geborenen Kinder<br />
auf 300 erhöht wird.<br />
Unser Rat: Wenn es möglich ist und wenn es sich auf Grund einer<br />
hohen staatlichen Förderung durch Zulagen und ggf. zusätzliche<br />
Steuervorteile anbietet, dann sollten Sie die Riester-Förderung mitnehmen.<br />
Man muss sich jedoch auch darüber im klaren sein, dass<br />
das Volumen der Riester-Förderung und damit auch der Effekt für<br />
die Altersvorsorge relativ klein bleibt. Quantitativ größere Effekte<br />
lassen sich mit der Rürup-Rente erzielen, da hier das steuerlich geförderte<br />
Volumen bis zu 20.000 (Ledige) bzw. 40.000 (Verheiratete)<br />
betragen kann.<br />
Wir analysieren gern für Sie, welcher Förderweg für Sie am ehesten<br />
in Frage kommt und wie hoch die staatliche Förderung für Sie<br />
auf Grund Ihrer individuellen Voraussetzungen ausfällt.<br />
Und selbstverständlich stehen Ihnen in beiden Bereichen leistungsstarke<br />
bvvp-Gruppenvertrags-Angebote zur Verfügung. Sprechen Sie<br />
uns gern an.<br />
Hartmut Scheele<br />
c/o AVB TEAM (Finanzdienstleister des bvvp) ,<br />
Tel. 040/4313910; Fax 040/43139119;<br />
e-mail: hartmut.scheele@avb-hamburg.de<br />
Riester-Rente –<br />
Neuerungen in 2008<br />
Selbständige und Freiberufler haben keinen eigenen Anspruch auf eine<br />
Riester-Rente. Wenn Sie jedoch einen Ehepartner haben, der sich<br />
in einem Angestellten- oder Beamtenverhältnis befindet und nicht<br />
Mitglied in einem berufsständischen Versorgungswerk ist, dann haben<br />
Sie Anspruch auf einen eigenen Riester-Rentenvertrag, auf den<br />
zwar keine eigenen Beiträge, jedoch die Ihnen zustehende staatliche<br />
Zulage eingezahlt wird.<br />
2008 ändert sich einiges bei der Riester-Rente: Dies betrifft die<br />
geforderte jährliche Beitragshöhe, den steuerlich geförderte Maximalbeitrag<br />
und die Höhe der Zulagen. Der geforderte Gesamtbeitrag<br />
zur Riester-Rente (incl. aller staatlicher Zulagen) beträgt dann<br />
bvvp-magazin 4/2007<br />
15<br />
Management Handbuch für die<br />
psychotherapeutische Praxis ab<br />
sofort mit 30 % Rabatt auf<br />
Grundwerk/Grundversion und<br />
25 % Rabatt auf die<br />
Aktualisierungen/Updates<br />
Ausführliche Informationen und ein Bestellformular finden Sie im Internet<br />
(www.bvvp.de Service/Dienstleistungen). Bereits bestehende<br />
Abonnements können natürlich auch vom Verbandspreis profitieren.<br />
Bitte verwenden Sie auch hier das Bestellformular.
Schwerpunkt<br />
Schwerpunkt<br />
<strong>Qualifikation</strong> <strong>Psychotherapie</strong><br />
<br />
Ortwin Löwa<br />
Rüdiger Hagelberg<br />
Liebe bvvp-Mitglieder, liebe<br />
Leser/innen des Schwerpunktes,<br />
vor acht Jahren trat das Psychotherapeutengesetz in Kraft. Der Kampf<br />
darum zwischen psychologischen Verbänden, Ärzteorganisationen,<br />
Krankenkassen, Kassenärztlichen Vereinigungen und nicht zuletzt den<br />
politischen Instanzen dauerte gut ein Vierteljahrhundert, nachdem<br />
die Psychiatrieenquete des Deutschen Bundestages 1973 schwerwiegende<br />
Mängel in der Versorgung psychisch Kranker – sowohl ambulant,<br />
als auch stationär – feststellte – und ging bis zum Bundesverwaltungsgericht<br />
und auch dem Bundesverfassungsgericht. Horrorbegriffe<br />
wie Delegations – oder Erstattungsverfahren sind insbesondere<br />
den heute niedergelassenen Psychologischen Psychotherapeuten<br />
in schmerzlicher Erinnerung. Dabei hatten gerade sie schon früh in<br />
der Nachkriegszeit sich in diversen Organisationen etabliert und nach<br />
dem Missbrauch der <strong>Psychotherapie</strong> als Instrument der Repression und<br />
Aussonderung in der Nazizeit nunmehr ein weites hilfreiches Feld eröffnet.<br />
Der Neurosenbegriff wurde anerkannt, seelische Kriegsschäden<br />
ebenfalls. Neben der klassischen analytischen <strong>Psychotherapie</strong> erlebten<br />
weitere Therapieformen einen regelrechten Boom und weiteten<br />
sich schließlich auch in einen „grauen“ Markt aus. Mit dem Gesetz<br />
sollte nun die Vielfalt zu einer Einheit zusammen gefasst werden.<br />
Benedict Waldherr – Kassenärztliche Vereinigung Bayern – im Bayerischen<br />
Ärzteblatt ( März 2003 ) – mit einem Fazit:<br />
„PP und KJP waren als neue Heilberufe entstanden, die Berufsausübung,<br />
der berufsrechtliche Teil und die Kassenzulassung als sozialrechtlicher<br />
Teil geregelt. Mit Hilfe von weitreichenden Übergangsregelungen<br />
sollten nicht nur die ehemaligen Delegationspsychologen,<br />
sondern auch möglichst viele der früheren Erstattungspsychologen<br />
Approbation und Kassenzulassung erhalten. Gleichzeitig wurde die<br />
16<br />
Bedarfsplanung der <strong>Psychotherapie</strong> flächendeckend eingeführt und<br />
die Ausbildung neu geregelt.“<br />
PP, KJP – wie immer, wenn ein Problem der bürokratisch – verwaltenden<br />
Hand anvertraut wird, einwickelte sich auch im <strong>Psychotherapie</strong>bereich<br />
ein Geflecht, ja ein Dschungel von Abkürzungen ( siehe<br />
Kasten ) , z.B. das Kürzel, das wie ein sanfter Frauenname daher<br />
kommt: PiA! Das heißt: „Psychotherapeut/innen in Ausbildung“ und<br />
enthält jede Menge Sprengstoff. Er liegt am Schnittpunkt von Geschichte<br />
und Zukunft der <strong>Psychotherapie</strong> und bündelt sich in der Frage,<br />
wie wir das psychotherapeutische Erbe an den Nachwuchs weitergeben.<br />
Zunächst einmal in Form eines monströsen Regelwerks, das<br />
alle Schrecken enthält, die die deutsche Bildungsbürokratie zur Verfügung<br />
hat und mit einem veritablen Geburtsfehler behaftet ist: Die<br />
unterschiedliche Klassifizierung von künftigen ärztlichen Psychotherapeuten<br />
und ihren psychologischen Kollegen. Während Ärzte eine<br />
Weiterbildung absolvieren, wurden die Psychologen zu Auszubildenden<br />
degradiert, ein gesetzestechnischer Kunstgriff, um die Bundeskompetenz<br />
zu sichern. Daraus ergab sich nun in der Folge ein Wirrwarr,<br />
dessen Verwerfungen sich in einer Vielzahl von individuellen<br />
Leidensgeschichten vor allem der PiA zeigten und einen Druck erzeugten,<br />
der schliesslich aktuell zu der Gründung von PiA – Netzwerken<br />
führte, durch die mittlerweile ein umfassender Reformprozess<br />
angestoßen wurde. Mit Kerstin Sude und Kristina Siever, die in<br />
Hamburg und Nordrhein – Westfalen diese Selbsthilfegruppen gründeten,<br />
haben wir ausführlich gesprochen.<br />
Rüdiger Hagelberg erläutert und bewertet anhand von Zahlen,<br />
Daten und Fakten die Aus- und Weiterbildungssituation von PP, KJP<br />
und Ärzten und sprach mit der Bundesärztekammer. Aus der Sicht<br />
der Wissenschaft und der sie vermittelnden ausbildenden Institute<br />
beschreibt der Analytiker und Dozent Michael Klöpper die Anforderungen,<br />
die an die Ausbildungsinhalte zu stellen sind. Eine übergeordnete<br />
Perspektive, sozusagen einen archimedischen Punkt, sieht der<br />
praktizierende „Facharzt für <strong>Psychotherapie</strong>“ Thomas Bartsch in der<br />
Frage, wie das Puzzle der psychischen Störungen und der ihnen zugeordneten<br />
Therapierichtungen wieder durch eine ganzheitliche Be-<br />
bvvp-magazin 4/2007
vvp-magazin 4/2007<br />
<strong>Qualifikation</strong> <strong>Psychotherapie</strong><br />
trachtung zusammengefasst werden kann. Wer sich nun nach einem<br />
Wegweiser durch das Dickicht sehnt, für den stellen wir den Survivalguide<br />
PiA vor.<br />
In der Tat: Überleben, darauf kommt es in dem Gesamtkomplex<br />
<strong>Psychotherapie</strong> an. Die Aussichten – eine Herausforderung, die Benedict<br />
Waldherr so beschrieb:<br />
„Vier Jahre nach der Einführung des Psychotherapeutengesetzes<br />
gibt es noch einiges zu tun: Das 1999 vereinbarte Budget aus dem<br />
Psychotherapeutengesetz und die darauf gründende anschließende<br />
Finanzierung stranguliert zunehmend die Versorgung. Die Umsetzung<br />
der BSG-Rechtsprechung zur Honorierung in der <strong>Psychotherapie</strong><br />
aus dem Jahr 1999 bleibt aus oder wird nur ansatzweise wie beispielsweise<br />
durch die AOK Bayern erfüllt. Die Expost-facto-Bedarfsplanung<br />
von 1999 hatte zu sehr verzerrten Versorgungsstrukturen<br />
geführt. Im Grunde wurden die Verwerfungen, so wie sie sich unter<br />
dem unkontrollierten Erstattungsverfahren und dem Delegationsverfahren<br />
entwickelt hatten, mit dem Psychotherapeutengesetz und<br />
der Bedarfsplanung festgeschrieben. Eine eigene Bedarfsplanung für<br />
Abkürzungen zum Thema<br />
PPiA<br />
Psychologische PsychotherapeutInnen in<br />
Ausbildung<br />
KJPiA Kinder- u.<br />
JugendlichenpsychotherapeutInnen in<br />
Ausbildung<br />
PiA PsychotherapeutInnen in Ausbildung (=<br />
PPiA + KJPiA)<br />
PP<br />
Psychologische PsychotherapeutInnen<br />
KJP Kinder- u.<br />
JugendlichenpsychotherapeutInnen<br />
KJP<br />
Kinder- u. Jugendpsychiater und -therapeuten<br />
PsychThG Gesetz über die Berufe des PP u. des KJP –<br />
Psychotherapeutengesetz<br />
PsychTh-APrV Ausbildungs- u. Prüfungsverordnung für PP<br />
KJPsychTh-APrV Ausbildungs- u. Prüfungsverordnung für<br />
KJP<br />
PsychThV Verordnung über die Ausbildungsförderung<br />
(BAföG) für den Besuch von<br />
Ausbildungsstätten für <strong>Psychotherapie</strong> u.<br />
Kinder- u. Jugendlichenpsychotherapie<br />
Pt<br />
<strong>Psychotherapie</strong><br />
PtK<br />
Psychotherapeutenkammer<br />
LPtKn Landespsychotherapeutenkammern<br />
BPtK Bundespsychotherapeutenkammer<br />
LPA<br />
Landesprüfungsamt; LPÄ<br />
Landesprüfungsämter<br />
AP<br />
Analytische <strong>Psychotherapie</strong><br />
GT<br />
Gesprächspsychotherapie<br />
TP<br />
Tiefenpsychologisch fundierte<br />
<strong>Psychotherapie</strong><br />
VT<br />
Verhaltenstherapie<br />
AA<br />
Arbeitsagentur, zuständig für ALG I<br />
ALG<br />
Arbeitslosengeld<br />
KVen Kassenärztliche Vereinigungen<br />
BMG Bundesgesundheitsministerium<br />
KfW<br />
Kreditanstalt für Wiederaufbau, u.a.<br />
zuständig für staatliche Bildungskredite<br />
17<br />
die Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie fehlt völlig. Dies bedeutet,<br />
dass auch drei Jahre nach der Umsetzung des Gesetzes in vielen<br />
Regionen – auch in Bayern – KJP fehlen. Durch die neuen Ausbildungsrichtlinien<br />
und die Einführung eines Psychiatriejahres geht<br />
der Nachwuchs kontinuierlich zurück. Dies bedeutet, dass die Versorgungsnotlage,<br />
gerade in ländlichen Gebieten, auf absehbare Zeit<br />
zunehmen wird. Auch aufgrund der Altersstruktur der Psychotherapeuten<br />
werden in Zukunft noch größere Versorgungslücken entstehen,<br />
da viele Kollegen aus Altersgründen aus der Versorgung ausscheiden<br />
werden. Eine Änderung der Bedarfsplanung ist deshalb<br />
dringend erforderlich.“<br />
Nimmt man den Komplex Nachwuchsschulung verschärfend hinzu,<br />
ist noch einiges zu tun!<br />
Ortwin Löwa<br />
Dr. med. Michael Klöpper, Psychoanalytiker, Dozent, Supervisor<br />
und Lehrtherapeut, war (Gründungs-) Vorsitzender (1990 – 2000)<br />
der Hamburger „Arbeitsgemeinschaft für Integrative <strong>Psychotherapie</strong>,<br />
Psychoanalyse und Psychosomatik“ (APH) und der Hamburger<br />
„Akademie für <strong>Psychotherapie</strong> und Psychoanalyse“ sowie Vorsitzender<br />
des PPP-Ausschusses der ÄK Hamburg bis 2006. Zahlreiche<br />
Veröffentlichungen zur Tiefenpsychologischen <strong>Psychotherapie</strong>,<br />
Bindungstheorie und Säuglingsforschung. Kürzlich Buchveröffentlichung<br />
„Reifung und Konflikt“ (Rezension im bvvp-Magazin<br />
2.07) Er war überdies Mitinitiator und Gründungsmitglied des damaligen<br />
„vvph“ (heute „bvvp-Hamburg“).<br />
Rechtliche und wissenschaftliche<br />
Grundlagen heutiger<br />
<strong>Psychotherapie</strong>-Aus- und<br />
Weiterbildung<br />
Seitdem das Psychotherapeutengesetz (PsychThG) neben die Regelungen<br />
der Ärztlichen Weiterbildungsordnung (WBO) getreten ist, können<br />
grundsätzlich nur noch zwei Berufsgruppen die psychotherapeutische<br />
Tätigkeit ausüben, Ärzte und Psychologen. Lediglich im Bereich<br />
der Kinder- und Jugend-<strong>Psychotherapie</strong> haben auch Sozialpädagogen<br />
und Pädagogen das Recht zur Ausübung dieser Berufstätigkeit. Damit<br />
hat der Gesetzgeber zwar einen engen Rahmen für den Zugang<br />
zur psychotherapeutischen Berufstätigkeit geschaffen, ihr aber gleichzeitig<br />
auch eine hohe Rechtssicherheit gegeben. Diesem berufsrechtlichen<br />
Rahmen steht die sozialrechtliche Regelung der Versorgung<br />
der Bevölkerung mit <strong>Psychotherapie</strong> zur Seite, die im Rahmen der Bedarfsermittlung<br />
Zulassungs-Obergrenzen für Psychotherapeuten in der<br />
kassenärztlichen Praxis festgelegt hat. Ferner ist in den <strong>Psychotherapie</strong>-Richtlinien<br />
rechtsverbindlich ausgeführt, welche psychotherapeutischen<br />
Verfahren eine Anerkennung im Rahmen der Gesetzlichen<br />
Krankenversicherung besitzen.<br />
Gegenwärtig zählen die Analytische und die Tiefenpsychologische<br />
<strong>Psychotherapie</strong> sowie die Verhaltenstherapie zu den sozialrechtlich<br />
zugelassenen <strong>Psychotherapie</strong>verfahren. (Für Gesprächspsychotherapie<br />
und EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing,<br />
sprich: Trauma-Therapie) bestehen noch Einschränkungen.) Diese
Schwerpunkt<br />
Michael Klöpper<br />
Diese Sichtweise muss indes mit dem Blick auf die Ausbildungssituation<br />
differenziert werden. Auszubildende sind i.d.R. mit der Aufgabe<br />
überfordert, eine Integration verschiedener wissenschaftlicher<br />
Positionen zu leisten. Vielmehr ist es Aufgabe der Ausbildenden, die<br />
Studenten in einem Prozess schrittweise an die Grundlagen des psychotherapeutischen<br />
Verfahrens heranzuführen, um dann in einem<br />
weiteren Schritt die Integration der Ergebnisse und Denkansätze<br />
neuer Forschungsergebnisse und Theorien zu ermöglichen. Ein Studium<br />
der aktuellen Fachliteratur zeigt, dass sich ein derartiger Integrations-Prozess<br />
gegenwärtig in allen Theorien der anerkannten <strong>Psychotherapie</strong>verfahren<br />
vollzieht.<br />
Michael Klöpper<br />
Verfahren können im Rahmen der Verfahrensrichtlinien von niedergelassenen<br />
Therapeuten durchgeführt und gegenüber den Krankenkassen<br />
abgerechnet werden. Die psychotherapeutische Aus- und Weiterbildung<br />
beschränkt sich ganz überwiegend auf sie. (Im stationären<br />
Bereich findet traditionell eine sehr viel größere Zahl von Verfahren<br />
Anwendung.) Zwischen diesen Verfahren wird sich der angehende<br />
(niedergelassene) Psychotherapeut also entscheiden müssen.<br />
Die Beschränkung der Auswahlmöglichkeit auf die genannten<br />
drei „Kernbereiche“ psychotherapeutischer Tätigkeit wird von vielen<br />
bedauert und kritisiert. Sie weisen insbesondere darauf hin, dass<br />
dabei sowohl die Bedeutung und Errungenschaften der humanistischen<br />
<strong>Psychotherapie</strong>verfahren verloren gehen als auch, dass dabei<br />
die Ergebnisse zeitgenössischer Forschung in anderen Humanwissenschaften<br />
(z.B. Neurobiologie, beobachtungsbasierte Entwicklungspsychologie)<br />
zu wenig beachtet und integriert würden.<br />
Diese Bedenken treffen in der Realität nicht ganz zu. Vor dem Hintergrund<br />
der neuen Forschungsergebnisse unterliegen die konkret gelehrten<br />
Inhalte der <strong>Psychotherapie</strong> heute sowohl in den Aus- und Weiterbildungsinstituten<br />
als auch im Bereich der Fortbildung einem gravierenden<br />
Wandel. Beide, die Institute ebenso wie die Träger der Fortbildung,<br />
arbeiten intensiv daran, die traditionell bewährten Verfahren<br />
der <strong>Psychotherapie</strong> entsprechend den Fortschritten und Ergebnissen<br />
der Humanwissenschaften beider Couleur, natur- und geisteswissenschaftlich,<br />
weiter zu entwickeln. So gibt es beispielsweise im Bereich<br />
der Analytischen Verfahren eine breite Entwicklung und Vielzahl von<br />
Veröffentlichungen, die darauf abzielen, die Ergebnisse der neurobiologischen<br />
und insbesondere der Trauma-Forschung in das analytische<br />
Konzept zu integrieren. Im Bereich der Verhaltenstherapie wird heute<br />
dem emotionalen Erleben und der Beziehung eine ganz andere Bedeutung<br />
beigemessen, als noch vor einem Jahrzehnt. Und die großen<br />
Fortbildungsveranstaltungen, wie sie in der Bundesrepublik angeboten<br />
werden, stellen sich der Herausforderung der Annäherung zwischen<br />
Natur- und Geisteswissenschaft im Bereich der <strong>Psychotherapie</strong><br />
und machen ein vielfältiges Angebot zur Integration derer Ergebnisse<br />
in die anerkannten psychotherapeutischen Verfahren.<br />
<strong>Psychotherapie</strong> wird in dieser Sichtweise als eine Tätigkeit verstanden,<br />
deren wissenschaftliche Position in einer gedachten Mitte<br />
zwischen den Positionen der Naturwissenschaften auf der einen<br />
und der Geisteswissenschaften auf der anderen Seite anzusehen ist.<br />
In dieser Situation haben die <strong>Psychotherapie</strong> als Wissenschaft und<br />
der Psychotherapeut in seiner Berufstätigkeit die Aufgabe zu bewältigen,<br />
die Forschungsergebnisse beider Seiten, der Naturwissenschaft<br />
ebenso wie der Geisteswissenschaft, zu einem kohärenten Denk- und<br />
Arbeitsmodell zu integrieren.<br />
18<br />
<strong>Qualifikation</strong> <strong>Psychotherapie</strong><br />
Ein Bereich gerät bei der täglichen psychotherapeutischen Praxis-<br />
(und Krankenhaus-) Arbeit mit ihren dortigen Herausforderungen<br />
immer leicht aus dem Blickfeld, der unseres ärztlichen und psychologischen<br />
„Nachwuchses“. Wie steht es eigentlich damit? Wo und<br />
wie werden unsere „Nachfolger/innen“ aus- oder weiter gebildet?<br />
Sind es genug? Unter welchen Bedingungen finden Aus- oder Weiterbildung<br />
statt?<br />
Mindestens zwei Probleme, die die „Aktiven“ beschäftigen, spielen<br />
bereits bei der Aus- oder Weiterbildung eine große Rolle: Die<br />
schwierige finanzielle Situation für viele und die Unterschiedlichkeit<br />
aber nur scheinbare Unvereinbarkeit von ärztlichem und psychologischem<br />
Denken und jeweiliger psychotherapeutischer <strong>Qualifikation</strong>s-Systematik.<br />
Insofern werden unsere „Nachfolger/innen“ bereits gut auf das<br />
eingestimmt, was später auf sie zu kommt. Nicht übertrieben ist<br />
der Eindruck, dass die Beschäftigung mit der Aus- oder Weiterbildung<br />
zum/r Psychotherapeuten/in zuweilen dem Griff ins Wespennest<br />
gleicht.<br />
Die Ausbildung der Psychologen/<br />
innen (Pädagogen/innen) zu<br />
Psychotherapeuten/innen (PP<br />
und KJP) – Ein kritischer<br />
Überblick<br />
I. Ausbildungsumfang<br />
Gemäß Verordnung des BMG auf der Grundlage von § 8 des Psychotherapeutengesetzes<br />
(PsychThG) sind 4200 Stunden bzw. drei, berufsbegleitend<br />
fünf Jahre Ausbildung für Psychologen/innen sowie Pädagogen/innen<br />
zu Psychotherapeuten/innen (PP) sowie zu KJPlern/<br />
innen in fünf Bausteinen vorgeschrieben: Praktische Tätigkeit, Theoretische<br />
Ausbildung, Praktische Ausbildung, Selbsterfahrung und<br />
bvvp-magazin 4/2007
<strong>Qualifikation</strong> <strong>Psychotherapie</strong><br />
das Wahlpflichtangebot. Die KJP-<strong>Qualifikation</strong> kann auch wie andere<br />
<strong>Qualifikation</strong>en, z.B. Analytische <strong>Psychotherapie</strong>, in einer Zusatzausbildung<br />
zur PP-Ausbildung erworben werden, umgekehrt geht dies<br />
nicht.<br />
1. Praktische Tätigkeit: 1800 Stunden bzw. eineinhalb Jahre (nicht<br />
immer deckungsgleich – ein noch ungeklärtes Detail von vielen); in<br />
Abschnitten von jeweils 3 Monaten 1200 Stunden in einer psychiatrisch-klinischen<br />
Einrichtung („Psychiatriejahr“) und 600 Stunden in<br />
einer anerkannten Einrichtung der psychotherapeutisch-psychosomatischen<br />
Versorgung („Psychosomatikhalbjahr“); „Beteiligung“ an der<br />
Behandlung von 30 Patienten/innen u.a..<br />
2. Theoretische Ausbildung: 600 Stunden Vermittlung von allgemeinen<br />
und speziellen Grundkenntnissen in dem angestrebten Therapieverfahren.<br />
3. Praktische Ausbildung – „Fälle“ (Ausbildungseinrichtung): 600<br />
Behandlungsstunden im angestrebten Therapieverfahren mit 6 Patientenbehandlungen,<br />
dabei 150 Supervisionsstunden (50 Stunden<br />
Einzel-SV). Erstellung von 6 Falldarstellungen (dabei ggf. zwei Prüffälle)<br />
u.a..<br />
4. Selbsterfahrung: 120 Stunden im angestrebten Therapieverfahren.<br />
5. Wahlpflichtangebot – sog. „Freie Spitze“: ca. 1000 Stunden für Literaturstudium,<br />
Dokumentationen, Prüfungsvorbereitungen usw.<br />
II. Misere bei den PiA<br />
Missstände in der Ausbildung der Psychologen/innen u.a. werden<br />
vielstimmig beklagt.<br />
(Dazu ist z.B. ein Forschungsgutachten des BMG in Vorbereitung,<br />
für das die BPtK eine Bestandsaufnahme der bisherigen Ausbildungsbedingungen<br />
mit entsprechenden Fragestellungen erarbeitet hat.)<br />
Unter anderem müssen die Lerninhalte des voraus gehenden Psychologiestudiums<br />
mit den Inhalten der <strong>Psychotherapie</strong>ausbildung in<br />
einer Feinabstimmung zwischen dem universitären Bereich und den<br />
Ausbildungsinstituten noch besser koordiniert werden. Einstweilen<br />
gäbe es noch „Redundanzen“. Zudem seien die Lerninhalte der Theoretischen<br />
Ausbildung nicht immer mit den Anforderungen der Praktischen<br />
Ausbildung zeitlich koordiniert und bereiteten auch nicht genügend<br />
auf die Abschlussprüfungen vor.<br />
Derzeit müssen Psychologen/innen für die PP-Ausbildung nur<br />
den Prüfungsnachweis in „Klinischer Psychologie“ vorlegen. Mögliche<br />
andere Kenntnisse und <strong>Qualifikation</strong>en aus Vorstudium oder<br />
aus früheren Selbsterfahrungskursen fielen, so wird kritisiert, einstweilen<br />
kaum ins Gewicht.<br />
Grundsätzlich wird von psychologischer Seite darauf bestanden,<br />
dass eine vergleichbare Gliederung wie in der Medizin mit Medizinstudium<br />
und späterer Spezialisierung in der Facharzt-Weiterbildung<br />
in ähnlicher Weise für die Psychologen/innen gelten müsse. Psychologen/innen<br />
(gemeint immer auch (Sozial-)Pädagogen/innen für<br />
den Bereich KJP) durchlaufen indes zur Zeit eine „Ausbildung“, so<br />
als fange man gewissermaßen fast „bei Null“ an. Vor allem die Praktische<br />
Tätigkeit sei nur unspezifisch und mit fraglicher wissenschaftlicher<br />
Kompetenz definiert. Hauptkritikpunkt aber ist, dass „fertige“<br />
Psychologen/innen als „Praktikanten“ mit uneinheitlichem arbeitsrechtlichem<br />
Status häufig nicht bezahlt aber in verantwortlicher Stellung<br />
als „klinische(r) Psychologe/in“ eingesetzt würden. (Ca. 60 %<br />
der Psychologen/innen in Praktischer Tätigkeit erhalten nach augenblicklichem<br />
Stand keinerlei Vergütung.)<br />
Auch der Umfang von 1800 Stunden Praktische Tätigkeit im Verhältnis<br />
zu den 4200 Stunden Gesamtausbildung wird als zu groß erachtet,<br />
zumal die 1200 Stunden des Psychiatriejahres „besonders<br />
auch“ den Erwerb von Kenntnissen über Störungen zum Ziel hätten,<br />
in denen <strong>Psychotherapie</strong> nicht indiziert sei. Die Praktische Tätigkeit<br />
gilt für die Betroffenen als das „Nadelöhr“ ihrer Ausbildung. (Dazu<br />
auch: Süddeutsche Zeitung vom 25./26.11.06 und „Psychologie<br />
heute“ Juli 2007 S. 76 ff)<br />
Das ausgezeichnete Handbuch für die Psychologen/innen in Ausbildung<br />
(PiA) mit dem pointierten Titel „Survivalguide PiA“ informiert<br />
über <strong>Psychotherapie</strong>ausbildung mit ihren Vor-und Nachteilen<br />
in nahezu lückenloser Weise. Auch hier wird die unbezahlte häufig<br />
aber qualifizierte Arbeit der Psychologen/innen während ihrer Praktischen<br />
Tätigkeit als Missstand hervor gehoben. Überdies seien Psychologen/innen<br />
während ihrer Ausbildung zumeist älter und oft in<br />
einer familiären Lebenssituation, die finanzielle Gratifikation erforderlich<br />
mache. Der „Survivalguide PiA“ gibt das Alter zwischen 26<br />
und 40 Jahren an, 78,6 % der PiA seien Frauen. (a.a.O. S 95) Ausbildungsunterbrechungen<br />
seien häufiger notwendig, Bafög werde indes<br />
nur selten gezahlt (U.a. lt. Schreiben des Bundesministeriums für Bildung<br />
und Forschung vom 22.08.06; siehe auch Kasten)<br />
Im Gegensatz zum ebenfalls nicht vergüteten Praktischen Jahr (PJ)<br />
der Ärzte/innen sind aber die Unterschiede zu bedenken: Das PJ der<br />
werdenden Ärzte findet im Erststudium statt (Bafög!), ist kürzer, und<br />
die PJler/innen sind zumeist jünger und familiär weniger gebunden.<br />
Vor allem aber wird auch von ärztlicher Seite die Nicht-Vergütung im<br />
PJ als Missstand angesehen (DÄB 34-35/2007 A 2337).<br />
bvvp-magazin 4/2007<br />
19<br />
Einige weitere Zahlen<br />
Kosten der Ausbildung real zwischen 60000 Euro und 100000<br />
Euro, dabei reine Ausbildungskosten zwischen 10000 Euro und<br />
25000 Euro (je nach Therapieverfahren bzw. Ausbildungsziel variierend).<br />
PiA finanzieren ihre Ausbildung und ihren Lebensunterhalt<br />
zu ca. 55 % aus Nebentätigkeit und zu ca. 45 % aus Ersparnissen.<br />
Bafög-Zahlungen werden dagegen kaum gewährt, eine Zahl von<br />
0,7 % wird genannt. („Survivalguide PiA“ S. 52 ff)<br />
Zahlen der KBV für 2005 und (ähnlich) der BPtK geben an,<br />
dass ca. 15200 Psychologische Psychotherapeuten/innen (12600<br />
PP/2600 KJP) und ca. 4000 „Ärztliche Psychotherapeuten/innen“<br />
niedergelassen tätig sind, davon jeweils immer ungefähr<br />
zwei Drittel bis drei Viertel Psychotherapeutinnen. Insgesamt hatte<br />
die BPtK 2006 ca. 29000 Mitglieder, davon etwa die Hälfte<br />
niedergelassen.<br />
Die zur Zeit in Ausbildung befindlichen Psychologen/innen<br />
werden von der BPtK mit ca. 8000 angegeben, eine andere Schätzung<br />
nennt die Zahl von 6000, davon 4000 VTler/innen. Berufstätige<br />
Psychologische Psychotherapeuten/innen (in der BPtK) sind<br />
im Mittel 51 Jahre alt. Der u.a. daraus errechnete jährliche Niederlassungs-Nachwuchsbedarf<br />
wird mit ca. 1000 Kollegen/innen<br />
pro Jahr angegeben. Er ist zur Zeit nur knapp realisiert. Langfristig<br />
aber sei der Nachwuchs mit dem sich entwickelnden Aufkommen<br />
zu decken. (Zahlen und Einschätzungen gem. BPtK-Newsletter<br />
1/2006).<br />
Eine gewisse Entspannung der wirtschaftlichen Situation könne<br />
sich ergeben, wenn Behandlungen (unter Supervision) innerhalb<br />
der Praktischen Ausbildung honoriert werden. Es sei daher überaus<br />
wichtig festzulegen, nach welchen Vorleistungen sie beginnen<br />
können. Einstweilen gibt es dazu keine allgemein gültige Rechtsgrundlage.<br />
Die Ausbildungsinstitute handhaben dieses zentrale
Schwerpunkt<br />
Anliegen der PiA wie auch die Honorierung selbst einstweilen unterschiedlich.<br />
Alles in allem, so fasst es die Sprecherin des „Netzwerks PiA“ Nordrhein<br />
zusammen, gäbe es zur Zeit in der <strong>Psychotherapie</strong>ausbildung<br />
der Psychologen/innen eine „soziale Selektion“ (nur gut betuchte<br />
Psychologen/innen), eine „Geschlechtsselektion“ (nur Frauen) und eine<br />
„Methodenselektion“ zu Gunsten von VT ( aus unterschiedlichen,<br />
hier nicht weiter ausgeführten Gründen).<br />
Die Festlegung von Mindestzahlen (anders als in den WBO en der<br />
Ärzte/innen) bei nahezu allen Zeitangaben für die Ausbildungsanforderungen<br />
der PiA ermöglicht es den Ausbildungsinstituten, die Anforderungen<br />
institutsintern zu modifizieren ggf. sogar zu erhöhen. Auch<br />
die „Freie Spitze“ kann durch die Institute teilnehmerfreundlich gestaltet<br />
werden oder nicht.<br />
Alles in allem haben die ersten Jahre der Ausbildung der Psychologen/innen<br />
zu Psychotherapeuten/innen unter der Ägide des<br />
PsychThG eine Fülle von Erfahrungen erbracht, die die Notwendigkeit<br />
von Veränderungen bzw. Weiterentwicklungen beweisen. Dazu<br />
haben formelle wie informelle Gremien von der BPtK bis zum „Netzwerk<br />
PiA“ überzeugende Argumente gesammelt und bringen sie mit<br />
einiger geschlossener Stoßkraft vor. Nirgends aber sind sie so abgewogen,<br />
sorgfältig und vollständig zusammen gefasst wie in dem<br />
Handbuch „Survivalguide PiA“.<br />
Hier wird besonders augenfällig: Baldige Erfolge sind von großer<br />
Dringlichkeit, hoffentlich aber auch absehbar.<br />
Interview 1<br />
Rüdiger Hagelberg<br />
Eine Studie fördert den Protest<br />
und die Gründung des ersten<br />
PiA – Netzes<br />
20<br />
Karin Sude<br />
Eine Meldung im Deutschen Ärzteblatt (PP 6, Ausgabe September<br />
2007, Seite 397:)<br />
Eine Gruppe engagierter Psychologischer Psychotherapeuten in Ausbildung<br />
(PiA-Netz) fordert in einem offenen Brief an die Leitungen<br />
psychiatrischer und psychosomatischer Kliniken in Deutschland eine<br />
tariflich angemessene Vergütung des sogenannten Psychiatriejahres.<br />
57 Prozent der angehenden Psychologischen Psychotherapeuten und<br />
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (KJP) arbeiten während<br />
der 1 800 Stunden umfassenden praktischen Tätigkeit ohne Gehalt,<br />
ermittelte eine Studie von Busche, Mösko und Kliche (2006). Gemäß<br />
ihrer <strong>Qualifikation</strong> als Diplom-Psychologen (Diplom-Pädagogen als<br />
KJP) würden die PPiA jedoch in der Regel als vollwertige Stationspsychologen<br />
und -psychotherapeuten eingesetzt, und sie führten eigenverantwortlich<br />
psychotherapeutische Einzelgespräche und Therapiegruppen<br />
durch.<br />
Für diese Tätigkeit fordert das PiA-Netz eine Vergütung entsprechend<br />
der fachärztlichen Weiterbildung nach BAT IIa beziehungsweise<br />
TVöD 13. Das Netz wendet sich gegen die Bezeichnungen „Praktikanten“<br />
und „Auszubildende“ während des Psychiatriejahrs. Ihrer<br />
Meinung nach handelt es sich nach dem abgeschlossenen Studium<br />
zum Diplom-Psychologen (Diplom-Pädagogen) um eine Weiterbildung<br />
zum „Fachpsychologen“ – vergleichbar mit der Weiterbildung<br />
zum Facharzt.<br />
Ändert sich die Vergütung nicht, befürchten auch die Bundespsychotherapeutenkammer<br />
und der Berufsverband Deutscher Psychologen<br />
und Psychologinnen e.V. (BDP) langfristig Nachwuchsprobleme.<br />
Neben dem Lebensunterhalt, der während der zumeist Vollzeittätigkeit<br />
in der Klinik weiterfinanziert werden muss, zahlen die Psychologischen<br />
Psychotherapeuten in Ausbildung nämlich auch die Kosten für<br />
die Ausbildungsinstitute (200 bis 600 Euro monatlich) weiter. Den<br />
„Luxus Ausbildung“ können sich immer weniger leisten.<br />
Betroffene der o.g. Studie, die am Institut und Poliklinik für Medizinische<br />
Psychologie der Universitätsklinik Hamburg Eppendorf erstellt<br />
wurde, war die Hamburger PiA Kerstin Sude. Sie bündelte als eine der<br />
Ersten den Unmut und organisierte ein Netzwerk.<br />
Was hat Sie veranlasst, in Hamburg das Pia – Netz zu gründen?<br />
Hier hole ich mal etwas aus…<br />
Seit 2003, dem Beginn meiner Ausbildung zur Psychologischen<br />
Psychotherapeutin (TP), ist mein Unmut über die Ausbildungssituation,<br />
insbesondere bzgl. der abzuleistenden Praktischen Tätigkeit,<br />
gewachsen. Trotz Berufsausbildung, Psychologie-Diplom,<br />
Berufserfahrung, fortgeschrittenem Alter arbeitete ich ohne Entgelt<br />
Hunderte von Stunden in der Psychiatrie und bestritt daneben<br />
meinen Lebensunterhalt sowie die hohen Ausbildungskosten.<br />
Da tun sich Grenzen auf. Es gibt KollegInnen, die jahrelang als<br />
Psychologin tätig sind und nun ihre Approbation anstreben, die<br />
sich z.T. aus einer festen Stelle heraus um einen unentgeltlichen<br />
Arbeitsplatz für diese Zeit kümmern müssen, eine absurde Situation.<br />
Aus familiären Gründen wollte ich in Hamburg bleiben, nur<br />
in anliegenden Bundesländern hätte es ggf. ein Honorar für die<br />
Praktische Tätigkeit gegeben. Zudem haben Lehrende des Ausbildungsinstitutes<br />
darauf hingewiesen, das es in Hamburg bedauerlicherweise<br />
keinerlei PiA-Vernetzung bzgl. dieser Missstände<br />
gibt. Nun habe ich beruflich und privat Erfahrung mit dem<br />
Aufbau von Netzwerken und dachte, dies könne doch nicht so<br />
schwierig sein.<br />
Begonnen mit der konkreten Vernetzung habe ich mit einigen<br />
KollegInnen im Februar 2005. Zunächst einmal haben wir in einer<br />
Mail dafür geworben, dass möglichst viele Hamburger PiA,<br />
einen Brief an die gesundheitspolitischen SprecherInnen (SPD,<br />
CDU, GAL, FDP) Hamburgs verfassen, in denen diese aufgefordert<br />
werden, für eine Mitgliedschaft von PiA in der Psychotherapeutenkammer<br />
Hamburg zu stimmen, da zu diesem Zeitpunkt Än-<br />
bvvp-magazin 4/2007
<strong>Qualifikation</strong> <strong>Psychotherapie</strong><br />
derungen im Kammergesetz für die Heilberufe verabschiedet werden<br />
sollten. Einige von uns zeigten zudem Präsenz bei der dazugehörigen<br />
ExpertInnen-Anhörung im Hamburger Rathaus. Ende des<br />
Jahres 2005 wurde dann Dank des großen Drucks ein neues Kammergesetz<br />
für die Heilberufe in Hamburg verabschiedet, endlich<br />
mit der Möglichkeit einer freiwilligen PiA-Mitgliedschaft ab 2006.<br />
Über die Ziele und Vorstellungen konnten wir vom PiA-Netz-Hamburg<br />
zum ersten Mal am 11.1.06 in der Kammer verhandeln.<br />
Wir gründeten kurz nach Kammereintritt die PiA-Liste-Hamburg<br />
und traten erfolgreich bei der letzten Delegiertenwahl der<br />
PtK Hamburg an, mit dem Resultat: Mike Mösko und ich wurden<br />
gewählte Kammerdelegierte und damit auch „PiA-Delegierte“.<br />
bvvp-magazin 4/2007<br />
21<br />
Was zeichnet die Arbeit des PiA-Netzwerkes aus und welche Ziele<br />
verfolgt das PiA-Netzwerk?<br />
Seit Mitte 2006 treffen sich einige Hamburger PiA ungefähr monatlich,<br />
um Aktionen und das weitere berufspolitische Vorgehen<br />
zu planen und koordinieren. Wir schätzen die Anzahl in hamburgischen<br />
Ausbildungsinstituten auf ca. 400, davon sind mittlerweile<br />
über 200 in unserem hamburgischen Info-(E-Mail-)Verteiler. Anfangs<br />
baten wir PiA-KollegInnen mitzumachen, mittlerweile fragen<br />
PiA o. Psychologie-Studierende selbst an. Es war ein etwas<br />
mühsames, aber auch erfolgreiches Unterfangen, über E-Mails,<br />
schriftl. Anfragen bei Instituten, einem Treffen in der Psychotherapeutenkammer<br />
u.a. diesen Mail-Verteiler immer weiter zu vergrößern.<br />
Inzwischen ist es so, dass sich eine relevante Info nun „von<br />
selbst“ verteilt, indem KandidatensprecherInnen in ihren Instituten<br />
oder auch in Kliniken wichtige Aushänge vornehmen.<br />
Rechtzeitig vor der Wahl zur Delegiertenversammlung der PtK<br />
warben wir mit Flyer und E-Mail für unsere Liste und sprachen<br />
damit PiA aller Hamburgischen Institute, gleich welcher Fachrichtung<br />
an. Diese sind mittlerweile auch komplett im Hamburger<br />
Netzwerk vertreten. Die KJP-KollegInnen, die anfangs auch zu<br />
den Netzwerktreffen kamen, hatten es leider zeitlich nicht mehr<br />
geschafft, so kurzfristig einen eigenen Wahlkörper aufzustellen.<br />
Das ist bedauerlich. Wir sitzen in einem Boot, konnten zur Wahl<br />
aber formal nicht gemeinsam antreten. Wir kooperieren mit dem<br />
PPiA-Bundesnetz. Dank dieser Kontakte existieren z.B. in PiA-<br />
Kreisen „Positiv-Listen“ und Austausch, in welchen Kliniken die<br />
Praktische Tätigkeit entlohnt wird und wie dort ansonsten das<br />
PiA-Klima ist.<br />
Zahlreiche unserer Ziele für die Kammer-Mitgliedschaft in<br />
Hamburg sind erreicht: Das aktive und passive Wahlrecht, gesetzte<br />
personelle PiA-VertreterInnen in der Kammerversammlung,<br />
Implementierung eines Ausschusses „Ausbildung“, kostenfreie<br />
Mitgliedschaft für PiA ohne Vergütung (innerhalb der Praktischen<br />
Tätigkeit), Aufnahme im Versorgungswerk, Zugang zu den<br />
Infoquellen der Kammer, eigene Website, Mailingliste und Zugang<br />
zum Mitgliederbereich innerhalb des Kammerauftritts. Andere<br />
weiterführende Ziele, wie z. B. die Vernetzung mit den PiA-<br />
Ausschüssen bzw. -VertreterInnen der anderen Landespsychotherapeutenkammern<br />
zur Implementierung eines Ausschusses Ausbildung<br />
in der Bundespsychotherapeutenkammer lassen sich nur<br />
nach und nach erreichen.<br />
Ziele innerhalb der Hamburger Ausbildungslandschaft, bezogen<br />
auf die Praktische Tätigkeit, sind u. a. die angemessene finanzielle<br />
Vergütung, eigene Räumlichkeiten und ausreichende Einarbeitung.<br />
Ferner wünschen wir uns schulgebundene fachliche Unterstützung,<br />
Einzelsupervision, Optimierung der Klinik-/Institut-<br />
Verträge bzw. Erhöhung der Transparenz der Ausbildungsbedingungen<br />
an den Hamburger Ausbildungsinstituten. Zudem verfolgen<br />
wir Ziele, die sich auf die Ausbildungsinstitute beziehen, wie<br />
u.a. die Transparenz der Ausbildungsbedingungen zu erhöhen, z.B.<br />
wie ambulante <strong>Psychotherapie</strong>stunden vergütet werden. Neben<br />
MentorInnenprogramm und Existenzgründungsberatung von Seiten<br />
der PtK sind auch Veranstaltungen und Infoabende für (angehende)<br />
PiA, wie z.B. Psychologie- und Pädagogikstudierende, geplant.<br />
Eine Idee ist zudem die Vernetzung mit KollegInnen der ärztlichen<br />
Psychotherapeutenausbildung. Doch auch der Aufbau von<br />
Altersvorsorge bzw. Ideen bei Unterfinanzierung günstige Kreditmöglichkeiten<br />
oder Stiftungsfonds-Unterstützung bereit zu stellen,<br />
spielen eine Rolle. Die Erarbeitung eines Katalogs mit notwendigen<br />
Qualitätskriterien steht noch aus. Alles step by step, es<br />
sind komplexe Themen, da letztlich Reformpozesse wie Bologna<br />
und die Umstellung des Studiums auf das Bachelor-, Master-System<br />
auch mit einfließen. Unsere persönlichen Ressourcen sind<br />
letztlich zwar vielfältig, doch auch begrenzt.<br />
Am 10.09.07 traf sich das erste Mal die PiA-Arbeitsgruppe<br />
zur „Fusionierung“, wie auf dem 10. DPT beschlossen und vom<br />
Vorstand der BPtK berufen. Frank Mutert (Bayern) und ich sind<br />
dort Mitglied als von der BPtK berufene PiA. Die Arbeitsgruppe<br />
soll einen Vorschlag auf dem 11. DPT im November in Mainz einbringen.<br />
Gibt es Fälle, an denen die Problematik besonders sichtbar<br />
wird?<br />
Ja, da gibt es mehrere Beispiele.<br />
Fall 1: Kathrin H. (Name erfunden), 36 J., findet nach d. Psychologie-Studium<br />
ihre Traumstelle in einer Reha Klinik in Mecklenburg-Vorpommern.<br />
Sie arbeitet Vollzeit, der Vertrag wird nach<br />
der Probezeit entfristet. In Berlin ist diese Klinik im Sinne des<br />
Psychotherapeutengesetzes als psychiatrisch-klinische Einrichtung<br />
für den Praxisteil der <strong>Psychotherapie</strong>ausbildung anerkannt,<br />
so dass sie, wie geplant, mit ihrer Therapieausbildung beginnt.<br />
Es ist möglich geworden, die Ausbildungsbedingungen erfüllen<br />
und gleichzeitig Ausbildungs- und Lebenshaltungskosten tragen<br />
zu können. Kathrin ist verheiratet, ihr Mann arbeitet in Hamburg.<br />
So setzt sie die Ausbildung an einem Hamburger Ausbildungsinstitut<br />
fort. Hier erfährt sie, dass die Hamburger Behörde das Psychotherapeutengesetz<br />
anders auslegt als die Berliner und damit<br />
ihre Klinik für die Therapieausbildung nicht als psychiatrische Klinik<br />
anerkennt. Sie bringt daraufhin eine Klage auf den Weg, die<br />
ohne Erfolg bleibt. Um die Ausbildung weitermachen und mit ihrem<br />
Mann in Hamburg leben zu können, kündigt sie ihre volle, unbefristete<br />
Stelle, um letztlich mit drei Jahren Berufserfahrung als<br />
unbezahlte Kraft die gleiche Tätigkeit in einer anderen Klinik in<br />
Hamburg auszuüben.<br />
Fall 2: Rike S. (Name erfunden), 41 Jahre alt, ledig, Diplom-Psychologin<br />
in Hamburg, stellt nach Abschluss ihres Studiums fest,<br />
dass sie bei dem ohnehin knappen Stellenangebot ohne Approbation<br />
kaum eine Chance haben wird. Sie ist Erzieherin und hat<br />
bereits eine Therapieausbildung absolviert, die nicht von der KV<br />
anerkannt wird. Um im klinischen und psychotherapeutischen Bereich<br />
arbeiten zu können, startet sie eine <strong>Psychotherapie</strong>ausbildung<br />
in einem von den Krankenkassen anerkannten Verfahren.<br />
Während der Praktischen Tätigkeit von 1,5 Jahren arbeitet sie<br />
halbtags im sozialpsychiatrischen Bereich für das Nettogehalt einer<br />
Sozialpädagogin von 950,- Euro und die andere Hälfte der<br />
Arbeitswoche im Rahmen der Ausbildung ohne Vergütung in der<br />
Versorgung einer psychiatrischen Klinik. Ihre Ausbildungskosten
Schwerpunkt<br />
betragen pro Monat zwischen 500,- bis 600,- Euro. Dies bedeutet<br />
Leben am (Belastungs-)Limit.<br />
Es gibt auch einige wenige Beispiele, in denen PiA für ihre Arbeit<br />
in der Klinik bezahlt werden. Sie verdienen zwischen 500 und<br />
600 Euro netto im Monat, sind dafür die einzige Psychologin auf<br />
Station mit viel Verantwortung. Zieht man die durchschnittlich<br />
340 Euro Ausbildungskosten im Monat davon ab, so bleibt noch<br />
nicht einmal genug für die Miete.<br />
Sie sind inzwischen in der Hamburger Psychotherapeutenkammer<br />
repräsentiert. Ist dies eine Ausnahme oder ein Zeichen, dass<br />
die Forderungen der PiA auch auf verbandlicher Ebene mehr Aufmerksamkeit<br />
erhalten?<br />
Ausnahme u. Zeichen zugleich! Einiges haben wir erreicht, nämlich<br />
wie erwähnt für Hamburg die kostenlose PtK-Mitgliedschaft<br />
für PiA, das aktive und passive Wahlrecht. Ich bin stellvertretende<br />
DPT-Delegierte der Hamburger Kammer und damit erste PiA von<br />
ca. 6.000, die auf Bundesebene dabei sowie mittlerweile berufen<br />
ist in eine Bundespsychotherapeutenkammer-AG zur Integration<br />
von PiA auf Bundesebene.<br />
In der Delegiertenversammlung Hamburg sind inzwischen zwei<br />
weitere PiA in Ausschüssen vertreten (vgl. Bericht im kommenden<br />
Psychotherapeutenjournal). Es sind auf jeden Fall sehr positive<br />
Zeichen, dennoch bleibt ständige Präsenz und Erinnerung auf allen<br />
Ebenen notwendig. Das PiA-Netz-Hamburg ist damit ein „Pilotprojekt“,<br />
ein Start für die PiA anderer Bundesländer. Und diese<br />
folgen gerade temporeich.<br />
Die Fragen stellte Ortwin Löwa<br />
Interview 2<br />
Der PiA Protest verbreitert sich<br />
und erreicht die Politik<br />
Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) hat ein Forschungsgutachten<br />
ausgeschrieben, um die Ausbildung zum Psychologischen<br />
Psychotherapeuten (PP)und zum Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten<br />
(KJP) evaluieren zu lassen. Darauf aufbauend sollen Vorschläge<br />
für die zukünftige Ausbildung von Psychotherapeuten erarbeitet<br />
werden. Das Projekt soll eine Laufzeit vom 1. Januar 2008 bis<br />
zum 31. März 2009 haben.<br />
Im Vorfeld der Ausschreibung hatte das BMG die BPtK zu Gesprächen<br />
über das Forschungsgutachten eingeladen. Gemeinsam mit den Landeskammern<br />
und den Trägerorganisationen der Ausbildungsinstitute<br />
hatte die BPtK für das BMG einen Katalog mit Fragen zusammengestellt,<br />
die im Gutachten bearbeitet werden könnten.<br />
Diese Meldung vom 2.9.07 kann sich u.a. Kristina Siever aus Nordrhein-Westfalen<br />
als Erfolg zuschreiben. Sie hat an vorderer Front den<br />
PiA – Protest politisiert, ebenfalls mit einem Netzwerk.<br />
22<br />
Kristina Siever<br />
Auch sie fragten wir zunächst nach ihrer Gründen.<br />
Ein Gemisch unterschiedlicher Affekte, insbesondere Ohnmacht<br />
und Wut. Ich habe im Juli 2006 begonnen, mich berufspolitisch<br />
für die Verbesserung der Bedingungen für PPiA zu engagieren, mit<br />
einer Petition an den Deutschen Bundestag, in der ich um die Änderung<br />
des PsychThG und anderer relevanter Rechtsnormen bitte.<br />
Meine Petition ist die zweite Petition von PiA. Die erste Petition,<br />
in der um eine gesetzliche Regelung zur Vergütung der sogenannten<br />
praktischen Tätigkeiten von PPiA in psychiatrischen und psychosomatischen<br />
Kliniken gebeten wurde, war im Mai 2006 vom<br />
Petitionsausschuß des Bundestages mit aus Sicht der PiA unhaltbaren<br />
Begründungen abgelehnt worden. Bei meinen Internetrecherchen<br />
stieß ich eines Tages auf das bundesweite PPiA-Netz,<br />
ein unabhängiges, therapieschulenübergreifendes Netzwerk von<br />
PPiA, das es bereits seit 3 Jahren gibt und das sich vor allem über<br />
seine Mailingliste organisiert. Ich bekam schnell den Eindruck, daß<br />
das Netz eine Art virtuelle Selbsthilfegruppe war, deren Mitglieder<br />
versuchten, sich alltagspraktische Tipps zu geben, damit das Leid<br />
der Pt-Ausbildung persönlich etwas erträglicher wird. Oft ging es<br />
z.B. um Fragen nach guten Ausbildungsinstituten mit fairen, transparenten<br />
Ausbildungsgebühren und Lehrkliniken, die die praktischen<br />
Tätigkeiten zumindest mit einer geringen Vergütung wertschätzen.<br />
(Berufs-)politische Initiativen gab es wenig.<br />
Über dieses überregionale Netzwerk erfuhr ich, dass es seit<br />
2 Jahren auch eine regionale Vernetzung von PiA gibt, das PiA-<br />
Netz-Hamburg, und dass dieses Netzwerk inzwischen sehr erfolgreich<br />
ist. Dessen Erfolge haben mich davon überzeugt, dass wir<br />
in allen Bundesländern regionale PiA-Netzwerke brauchen, deren<br />
Mitglieder sich treffen und so berufspolitische Aktivitäten effektiver<br />
organisieren können. Da die Situation in NRW aus verschiedenen<br />
Gründen besonders schwierig für den Pt-Nachwuchs ist<br />
und mit der Erlangung der Approbation zu PP bzw. KJP noch lange<br />
nicht „alles gut ist“, habe ich zusammen mit Katrin Reich, einer<br />
frisch approbierten PP ohne KV-Zulassung, die versucht, sich<br />
mit der Pt von SelbstzahlerInnen und Privatversicherten über Wasser<br />
zu halten, im März das <strong>Psychotherapie</strong>NachwuchsNetzNordrhein<br />
gegründet, das aus zwei miteinander kooperierenden Teil-<br />
Netzwerken besteht: dem PiANo-Netz für PPiA, KJPiA, klinisch<br />
ausgerichtete PsychologiestudentInnen und StudentInnen pädagogischer<br />
Studiengänge mit Interesse an der KJP-Ausbidung, sowie<br />
dem KiJuPPNo-Netz für frisch approbierte PP und KJP. Das Pi-<br />
ANo-Netz hat aktuell 77 Mitglieder und das KiJuPPNo-Netz 20.<br />
Auf welche grundsätzlichen Probleme der Pt-Ausbildung sind Sie,<br />
ausgehend von Ihrem persönlichen Fall, gestoßen?<br />
Ich habe am eigenen Leib erfahren, dass Personen wie ich offensichtlich<br />
nicht für eine Pt-Ausbildung vorgesehen sind: Als alleinerziehende<br />
Mutter zweier schulpflichtiger Kinder ohne eigene Unterhaltsberechtigung<br />
und ohne gut betuchte unterstützungswillige<br />
Eltern oder ein reiches Erbe der Großtante türmte sich nach<br />
bvvp-magazin 4/2007
<strong>Qualifikation</strong> <strong>Psychotherapie</strong><br />
Abschluss meines Psychologiestudiums die Pt-Ausbildung wie<br />
ein finanzieller, zeitlicher und emotionaler Mount Everest vor mir<br />
auf. Ich hatte dann zunächst Glück und wurde für 18 Monate als<br />
Elternzeitvertretung in einer Klinik eingestellt, die einen Kooperationsvertrag<br />
für beide Arten von praktischer Tätigkeit (1.200<br />
Std. Psychiatrie und 600 Std. Psychosomatik) mit einem TP-Institut<br />
hatte. So konnte ich nach BAT IV a bezahlt die größte Hürde<br />
in der Pt-Ausbildung, die vorgeschriebenen 18 Monate praktische<br />
Tätigkeiten, nehmen.<br />
Nach einer weiteren Elternzeitvertretung in einer anderen Klinik<br />
fand ich mich dann Anfang vergangenen Jahres in der Arbeitslosigkeit<br />
wieder, was mich angesichts einer dramatischen Einkommenseinbuße<br />
durch das ALG I und monatlichen Ausbildungskosten<br />
in Höhe von ca. 900,- EUR in Verzweiflung stürzte. Ich stand<br />
vor der Frage, wie ich nun überhaupt noch meine 5-jährige „berufsbegleitende“<br />
Teilzeit-Ausbildung fortsetzen könnte – wurde<br />
doch mein Antrag auf BAföG mit der Begründung abgelehnt, dass<br />
eine Teilzeit-Pt-Ausbildung gemäß PsychThG und PsychTh-AprV<br />
trotz eigens erlassener BAföG-Verordnung für PiA – der PsychThV<br />
– grundsätzlich nicht förderungswürdig sei und dass es dabei auch<br />
unerheblich wäre, dass ich Kinder erziehe; erfuhr ich weiter, dass<br />
ich auch keinen Bildungskredit der KfW beantragen könne, da sich<br />
dieser auch nach den BAföG-Kriterien richte; wurde mir schließlich<br />
von der AA mitgeteilt, dass meine Pt-Ausbildung nicht finanziell<br />
gefördert werden könne, da die staatlich anerkannten Pt-Ausbildungsinstitute<br />
nicht den AA-Kriterien für Weiter-bildungsträger<br />
entsprächen und überdies generell keine Weiterbildungen gefördert<br />
werden könnten, die länger als 3 Jahre dauerten und nur in<br />
Teilzeit absolviert würden.<br />
Diese Erfahrungen brachten mich zu der bitteren Erkenntnis,<br />
dass dieses Psychotherapeutengesetz in Wirklichkeit ein Psychotherapeutenverhinderungsgesetz<br />
ist: Nicht die fachliche Kompetenz<br />
und persönliche Eignung von AbsolventInnen des Hochschulstudiums<br />
in Psychologie entscheiden darüber, wer von ihnen sich<br />
zu PP oder KJP ausbilden lassen kann, sondern in erster Linie die<br />
finanzielle und familiäre Situation.<br />
Inwiefern spielt bei der Problematik die Entstehungsgeschichte<br />
des Psychotherapeutengesetzes eine Rolle?<br />
Es gab einen mehrere Jahrzehnte währenden erbitterten Kampf<br />
um das PsychThG. Die Politik wollte Ende der 1990er Jahre endlich<br />
ein Gesetz verabschieden, und die Verbände, des langen Kämpfens<br />
müde, wollten das auch, unter der Maxime: „Besser endlich<br />
ein schlechtes Gesetz, als weiter gar keines!“ Mit dem Schachzug,<br />
im PsychThG eine „Ausbildung“ zu PP und KJP gesetzlich<br />
festzuschreiben, konnte das Gesetz schneller im Bundestag verabschiedet<br />
werden, während im Fall der Konzeption als Weiterbildung<br />
– was sie de facto ist – die Zustimmung der Länder erforderlich<br />
gewesen wäre.<br />
bvvp-magazin 4/2007<br />
23<br />
Gibt es darüber hinaus noch spezielle Konflikte in der Praxis?<br />
Es gibt eine Fülle von Konflikten und Schwierigkeiten im Alltag<br />
der Pt-Ausbildung. Die bereits angesprochene Problematik der<br />
18 Monate praktische Tätigkeiten in den Kliniken, oftmals völlig<br />
unbezahlt oder beschämend gering und in einem quasi arbeitsrechtsfreien<br />
Raum, ist ein Skandal – insbesondere vor dem Hintergrund,<br />
dass es gängige Praxis ist, dass die PiA in den Kliniken<br />
weitreichende Verantwortung übernehmen und eigenständig behandeln<br />
– oft ohne Einarbeitung und sogar zuweilen ohne jede<br />
Supervision. Es gibt Kliniken, in denen die PiA allein ganze Stationen<br />
aufbauen und betreuen, und der Oberarzt kommt einmal in<br />
der Woche für eine halbe Stunde „Teambesprechung“ mit den so<br />
gebeugten PraktikantInnen vorbei. Sowohl die Institute, die die<br />
Gesamtverantwortung für alle Ausbildungsbestandteile haben,<br />
als auch die über diese Aufsicht führenden LPÄ und das BMG wissen<br />
das seit Jahren – aber es ändert sich nichts.<br />
Als weiterer Punkt ist zu nennen, dass die Ausbildung an privaten<br />
Instituten, die durch die LPÄ die staatliche Anerkennung erhalten<br />
und von diesen im Auftrag der Landesgesundheitsministerien<br />
überwacht werden, nicht unproblematisch ist. Es gibt bspw. unter<br />
den Instituten, die die Rechtsform einer GmbH haben, Leitungen,<br />
deren Haltung den AusbildungsteilnehmerInnen gegenüber eine<br />
kaufmännisch dominierte Orientierung erkennen lässt. Stichworte<br />
hierzu sind hohe Ausbildungsgebühren, große Supervisionsgruppen<br />
(ich habe von Gruppen mit bis zu 12 TeilnehmerInnen gehört<br />
– in der PsychTh-APrV ist von 4 Personen die Rede!) und Auszahlung<br />
sehr geringer Anteilen von den Honoraren, die die KVen für<br />
die ambulanten Therapien, die von den PiA in der Institutsambulanz<br />
oder in kooperierenden Lehrpraxen durchgeführt werden, an<br />
die Institute zahlen.<br />
Ein anderes Problem ergibt sich an Instituten, deren Leitung<br />
gleichzeitig mehrere Funktionen ausübt, z.B. sowohl die Gesamtleitung,<br />
die Geschäftsführung und die Leitung der Institutsambulanz<br />
als auch die Erteilung von Theorieseminaren sowie die<br />
Durchführung von Lehrtherapien, Gruppenselbsterfahrung, Einzel-<br />
und Gruppensupervision – und dann vielleicht auch noch als<br />
PrüferInnen in der Zwischenprüfung und der mündlichen Staatsexamensprüfung<br />
fungiert.<br />
Auch die ungeregelte Mitbestimmung der PiA in den Instituten<br />
kann zu Konflikten führen. Während es an den analytischen<br />
Instituten, seit langem die Tradition gewählter „KandidatInnensprecherInnen“<br />
gibt, ist dies bei reinen TP-Instituten sowie den<br />
VT- und den universitären Instituten unterschiedlich. Die SprecherInnen<br />
der AusbildungsteilnehmerInnen sollten ihre Funktion<br />
auch ungehindert wahrnehmen können. Dazu ist z.B. erforderlich,<br />
dass sich niemand in solch ein Amt wählen lassen kann, der<br />
bei den InstitutsleiterInnen in Einzelselbsterfahrung ist; dass die<br />
SprecherInnen der verschiedenen Ausbildungsgruppen gegenseitig<br />
Kontakt aufnehmen können; dass die Wahlen in Abwesenheit<br />
der InstitutsleiterInnen und -dozentInnen stattfinden.<br />
Ein weiteres Konfliktfeld eröffnet sich an Instituten, an denen<br />
AusbildungsteilnehmerInnen gleichzeitig vom Institut eingestellt<br />
sind und z.B. für die Ausbildungsorganisation einschließlich der<br />
erforderlichen Kontakte mit dem LPA zuständig sind.<br />
Zusammenfassend kann man sagen, dass die Entwicklung von<br />
Gütekriterien für Institute sowie kooperierende Lehrkliniken und<br />
-praxen notwendig ist. Damit ist nicht gemeint, dass die Ausbildungsträgerverbände<br />
sich bei ihren halbjährlichen Treffen auf<br />
Standards einigen und eine Selbstverpflichtung über deren Einhaltung<br />
eingehen. Es geht darum, dass auch die PiA aufgrund ihrer<br />
Erwartungen und Erfahrungen formulieren, was in ihren Augen<br />
ein gutes Institut, eine gute Klinik und eine gute Lehrpraxis ist –<br />
und dass die Institute und Ausbildungsträgerverbände mit ihnen<br />
darüber in einen Dialog treten und transparente Maßnahmen der<br />
Qualitätskontrolle und -verbesserung entwickeln.<br />
Welche Auswirkungen sehen Sie für die Zukunft in bezug auf die<br />
verschiedenen Therapieverfahren, in denen der Erwerb der Fachkunde<br />
möglich ist?<br />
Es wird eine gravierende Verarmung des psychotherapeutischen
Schwerpunkt<br />
Angebotes geben. Zur Zeit ist es möglich, die Pt-Ausbildung mit<br />
Fachkunde in den drei sozialrechtlich zugelassenen Richtlinienverfahren<br />
AP, TP und VT zu absolvieren. Außerdem ist die Ausbildung<br />
in GT z.B. an der Uni Hamburg möglich, allerdings aufgrund<br />
der noch fehlenden sozialrechtlichen Zulassung der GT ohne<br />
Fachkunde in GT (stattdessen TP). Festzustellen ist seit Jahren<br />
die zunehmende Dominanz der VT auf Kosten der psychodynamischen<br />
Verfahren, insbesondere der AP: inzwischen absolvieren<br />
rund 75% aller PiA eine VT-Ausbildung. Von „Methodenvielfalt“<br />
kann da keine Rede mehr sein.<br />
Meiner Einschätzung nach spielt bei dieser Methodenselektion<br />
neben der seit den 1980er Jahren zu konstatierenden Dominanz<br />
der VT in den Instituten für Klinische Psychologie der Universitäten,<br />
oftmals verbunden mit regelrechter professoraler Entwertung<br />
der psychodynamischen Verfahren, die Finanzierungsproblematik<br />
eine große Rolle: Da es lediglich für die 3-jährige Vollzeit-<br />
Ausbildung die Möglichkeit gibt, BAföG oder einen Bildungskredit<br />
der KfW zu erhalten und die 3-jährige Vollzeitausbildung fast<br />
nur in VT angeboten wird, die überdies aufgrund der fehlenden<br />
Einzelselbsterfahrung deutlich billiger und weniger aufwendig ist,<br />
findet eine Abstimmung mit den Füßen zugunsten der VT statt.<br />
Die Ausbildung in TP kann dagegen an fast allen Instituten nur<br />
in 5 Jahren Teilzeitausbildung absolviert werden und in AP ausschließlich<br />
in der 5-jährigen Teilzeitform.<br />
Welche Konsequenzen ergeben sich für den Personenkreis, der<br />
künftig als PsychotherapeutInnen tätig sein wird?<br />
Durch die herrschenden Pt-Ausbildungsbedingungen kommt es,<br />
wie oben schon gesagt, auch zu einer sozialen Selektion: Der<br />
private Geldbeutel wird zum Entscheidungskriterium dafür, ob<br />
PsychologInnen sich zu PP weiterqualifizieren können; das Recht<br />
auf freie Berufswahl ist hier außer Kraft gesetzt. Hinzu kommt<br />
noch eine Geschlechterselektion: inzwischen sind 80% der derzeitigen<br />
PPiA weiblich und sogar 90 % der KJPiA. Die PP- und<br />
KJP-Praxis der Zukunft hat tendenziell eine weibliche Inhaberin,<br />
VT-ausgebildet, finanziell sorgenfrei durch ihr bisheriges Leben<br />
gekommen – und kinderlos: mit der Erziehung von Kindern, insbesondere<br />
der Alleinerziehung, ist die umfangreiche Pt-Ausbildung<br />
kaum zu vereinbaren.<br />
Sehen Sie Auswirkungen für die psychotherapeutische Versorgung<br />
überhaupt?<br />
Die skandalösen Bedingungen lassen viele PsychologInnen vor<br />
dem Beginn einer Pt-Ausbildung zurückschrecken. Es ist schon<br />
seit mehreren Jahren klar, dass dadurch die psychotherapeutische<br />
Versorgung der Bevölkerung bald nicht mehr sichergestellt ist.<br />
Verschärfend kommt hinzu, dass es in ein paar Jahren eine Ruhestandswelle<br />
unter den PsychotherapeutInnen geben wird. Schon<br />
heute warten PatientInnen oft bis zu 12 Monate auf einen ambulanten<br />
Therapieplatz – diese reale Unterversorgung wird sich<br />
dramatisch zuspitzen. Die Versorgung von Kindern und Jugendlichen<br />
mit <strong>Psychotherapie</strong> ist bereits heute katastrophal, die gängigen<br />
Wartezeiten sind völlig unzumutbar. Für KJPiA ist es besonders<br />
schwer, überhaupt Stellen in den kinder- und jugendpsychiatrischen<br />
Kliniken zu ergattern, um die vorgeschriebene<br />
praktische Tätigkeit absolvieren zu können. Angesichts der Tatsache,<br />
dass rund 25% aller Kinder und Jugendlichen psychische<br />
Störungen aufweisen, müssten seitens der Politik schnellstens<br />
drastische Maßnahmen zur Förderung der KJP-Ausbildung beschlossen<br />
werden.<br />
24<br />
Gibt es ein Ungleichgewicht zwischen der Weiterbildung von MedizinerInnen<br />
zu psychotherapeutisch tätigen FachärztInnen und<br />
der Ausbildung von Diplom-PsychologInnen zu Psychologischen<br />
PsychotherapeutInnen?<br />
Ja, ganz klar. PPiA sind gegenüber AssistenzärztInnen, die sich in<br />
einer Weiterbildung zu FachärztInnen für Psychosomatische Medizin<br />
und <strong>Psychotherapie</strong> befinden, massiv benachteiligt. AbsolventInnen<br />
eines Medizinstudiums, die sich psychotherapeutisch<br />
spezialisieren, tun dies im Rahmen einer weitgehend kostenlosen<br />
Weiterbildung zu FachärztInnen als aus Sicht der PiA sehr gut bezahlte,<br />
für die Dauer der 5-jährigen Weiterbildung festangestellte<br />
AssistenzärztInnen. Sie erhalten oftmals die theoretischen Ausbildungsinhalte<br />
sowie die kasuistisch-technischen Seminare kostenlos<br />
im Rahmen des Weiterbildungscurriculums der Klinik, an der<br />
sie angestellt sind. Selbst von den AssistenzärztInnen zu bezahlen<br />
sind dann lediglich die Selbsterfahrung sowie die Supervision für<br />
die im Rahmen der Weiterbildung durchzuführenden ambulanten<br />
<strong>Psychotherapie</strong>n; dies ist dank des festen Gehalts kein Problem.<br />
Was müsste sich Ihrer Meinung nach gesetzlich, aber auch in der<br />
praktischen Ausgestaltung ändern?<br />
Das PsychThG und die PsychTh-APrV müssen dringend so reformiert<br />
werden, dass PsychologInnen sich – analog zur Weiterbildung<br />
von ÄrztInnen zu FachärztInnen – allein aufgrund ihrer Kompetenzen<br />
für eine Weiterbildung zu einer Art FachpsychologInnen<br />
entscheiden können, die ohne Not finanzier- und absolvierbar sowie<br />
mit der Erziehung von Kindern vereinbar ist.<br />
Was wünschen Sie sich von den Berufsverbänden?<br />
Ich wünsche mir von den relevanten Berufs- und Ausbildungsträgerverbänden<br />
(Fachgesellschaften), dass sie sich endlich alle mit<br />
einer generativ-sorgenden Haltung konsequent den existentiellen<br />
Nöten ihres PP- und KJP-Nachwuchses zuwenden; dass sie sich eindeutig<br />
mit ihm solidarisieren und ihn emotional und konkret handelnd<br />
unterstützen, sowohl durch Soforthilfe in Form von Patenschaften/MentorInnenmodellen,<br />
Stipendien und zinslosen Darlehen,<br />
als auch dadurch, dass sie sich mit dem Ziel der mittelfristigen<br />
Reformierung der relevanten Rechtsnormen schnellstmöglich<br />
auf gemeinsame Forderungen einigen, die sie gegenüber der Politik<br />
geschlossen vertreten.<br />
Die Fragen stellte Ortwin Löwa<br />
Die Weiterbildung der Ärzte/innen<br />
zu Psychotherapeuten/innen.<br />
Ein kritischer Überblick<br />
Die Weiterbildung der Ärzte/innen zu Psychotherapeuten/innen ist<br />
an die primäre Weiterbildung in einem der Facharztgebiete Psychosomatische<br />
Medizin und <strong>Psychotherapie</strong>, Psychiatrie und <strong>Psychotherapie</strong><br />
oder Kinder-und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie (sog.<br />
P-Fächer) gebunden oder dient dem Erwerb eines Zusatztitel für sog.<br />
„Fachgebundene <strong>Psychotherapie</strong>“ in einem anderen Facharztgebiet.<br />
<strong>Psychotherapie</strong> als primäre Facharztqualifikation, als „reine Ärztliche<br />
bvvp-magazin 4/2007
<strong>Qualifikation</strong> <strong>Psychotherapie</strong><br />
<strong>Psychotherapie</strong>“, gibt es nicht mehr. Nicht nur dieser Umstand macht<br />
die Darstellung und Bewertung der Ärztlichen Weiterbildung zu Psychotherapeuten/innen<br />
– auch im Vergleich zur entsprechenden Ausbildung<br />
der Psychologen/innen – deutlich komplizierter.<br />
I. Weiterbildungsumfang<br />
1. Weiterbildung für das Gebiet Psychosomatische Medizin<br />
und <strong>Psychotherapie</strong><br />
Weiterbildung in Theorie und Behandlung (Weiterbildungsinstitute):<br />
Ca. 150 Stunden Theorie und Behandlung in allgemeiner Psychosomatik<br />
mit Krisenintervention, AT, Balint-Arbeit u.a., dabei 30 (psychosomatische)<br />
Behandlungen; 240 Stunden Theorie, 100 Stunden<br />
Diagnostik und 1500 Behandlungsstunden im speziellen <strong>Psychotherapie</strong>verfahren<br />
unter Supervision; dabei auch Anwenden von unterschiedlichen<br />
Therapieformen (Einzel/Gruppen-Therapie u.a.)<br />
Parallel: Weiterbildung im Krankenhaus: 60 Monate an einer<br />
Weiterbildungsstätte, davon 12 Monate Assistenzarzt-Tätigkeit in<br />
Psychiatrie und <strong>Psychotherapie</strong> und 12 Monate in Innerer Medizin<br />
und Allgemeinmedizin. (24 Monate Tätigkeit im ambulanten Bereich<br />
möglich.)<br />
Selbsterfahrung: 150 Stunden Einzel- und 70 Doppelstunden<br />
Gruppenselbsterfahrung (Tiefenpsychologie) und 70 Doppelstunden<br />
Einzel- oder Gruppenselbsterfahrung (VT).<br />
(Zu diesem „Gebiet“ gehört die Zusatz-Weiterbildung zum Bereich<br />
„Psychoanalyse“ mit erheblichen Erweiterungen im Anforderungskatalog.)<br />
2. Weiterbildung für das Gebiet Psychiatrie und <strong>Psychotherapie</strong><br />
Weiterbildung in Theorie und Behandlung (Weiterbildungsinstitute):<br />
Ca. 500 Stunden Theorie und Behandlung in allgemeiner Psychiatrie,<br />
spezieller Neurologie und spezielle <strong>Psychotherapie</strong>, dabei Erstuntersuchungen,<br />
Krisenintervention, psychiatrische Behandlungen,<br />
AT u.v.m. 240 Behandlungsstunden im speziellen <strong>Psychotherapie</strong>verfahren<br />
unter Supervision u.v.m.<br />
Parallel: Weiterbildung im Krankenhaus: 60 Monate an einer<br />
Weiterbildungsstätte, davon 24 Monate Assistenzarzt-Tätigkeit in<br />
der psychiatrischen und psychotherapeutischen, 12 Monate in der<br />
neurologischen Patientenversorgung; 6 bis 12 Monate in der Inneren<br />
Medizin oder KJP usw. möglich. (24 Monate Tätigkeit im ambulanten<br />
Bereich möglich.)<br />
Selbsterfahrung: 150 Stunden Einzel-oder Gruppenselbsterfahrung<br />
und 35 Doppelstunden Balint-Gruppenarbeit<br />
3. Weiterbildung für das Gebiet Kinder-und Jugendpsychiatrie<br />
und -psychotherapie<br />
Weiterbildung in Theorie und Behandlung (Weiterbildungsinstitute):<br />
Ca. 500 Stunden Theorie und Behandlung in spezieller Neurologie,<br />
allgemeiner Psychiatrie und spezieller <strong>Psychotherapie</strong>; dabei Erstuntersuchungen,<br />
Krisenintervention, Familientherapie, Balint-Arbeit,<br />
AT u.v.m. 240 Behandlungsstunden im speziellen <strong>Psychotherapie</strong>verfahren<br />
unter Supervision u.v.m.<br />
Parallel: Weiterbildung im Krankenhaus: 60 Monate an einer<br />
Weiterbildungsstätte, davon 12 Monate Assistenzarzt-Tätigkeit in<br />
der Kinder-und Jugendmedizin, Psychiatrie und/oder Psychosomatische<br />
Medizin und <strong>Psychotherapie</strong>; 6 Monate Tätigkeit in Neurologie<br />
oder Neuropädiatrie anrechenbar. (24 Monate Tätigkeit im ambulanten<br />
Bereich möglich.)<br />
Selbsterfahrung: 150 Stunden Einzel- oder Gruppenselbsterfahrung.<br />
bvvp-magazin 4/2007<br />
25<br />
II. Nachwuchssorgen bei den Ärzten<br />
Im medizinisch-ärztlichen Sektor zerfällt <strong>Psychotherapie</strong> in verschiedene<br />
Facharztgebiete und –bereiche und beinhaltet dort nur noch die<br />
„Zweitkompetenz“. Dies gilt erst recht für ärztliche Fachgebiete mit Zusatztitel<br />
„<strong>Psychotherapie</strong>“. Gegen das seinerzeit ausführlich begründete<br />
Votum des bvvp behielt man den „Facharzt für Psychotherapeutische<br />
Medizin“ (ggf. „und Psychosomatik“) als Mittelpunkt ärztlicher<br />
psychotherapeutischer Heilkunst nicht bei, sondern kehrte den Facharzt-Titel<br />
um. Man verwies damit die <strong>Psychotherapie</strong> auch dort auf<br />
den „zweiten Platz“.<br />
Die so entstandene Zersplitterung und Verkürzung „Ärztlicher<br />
<strong>Psychotherapie</strong>“ (eine politisch korrekte Bezeichnung verbietet sich<br />
aus Platzgründen) erscheint um so widersinniger, als die seit Jahren<br />
fatale Honorarsituation in weiten Bereichen der P-Fächer und der<br />
„Zusatztitler“ (90 % – Regelung!) die Fachärzte/innen weg von den<br />
Leistungen ihres primären Facharzt-Titels in die „Zweitkompetenz“<br />
<strong>Psychotherapie</strong> zwingt, weil nur der dortige feste Punktwert für genehmigungspflichtige<br />
Leistungen eine einigermaßen „rentable“ Praxisführung<br />
ermöglicht. Schon aus diesem Grund war die Abschaffung<br />
der alten Facharztqualifikation „Psychotherapeutische Medizin“ nicht<br />
zu rechtfertigen. Aber auch das an ihre Stelle getretene Fachgebiet<br />
„Psychosomatische Medizin und...“, dessen Bedeutung für eine bessere<br />
ganzheitliche Medizin immer wieder in vielen mündlichen und<br />
schriftlichen Bekenntnissen beschworen wird, bleibt in Wahrheit zu<br />
einem Schattendasein verurteilt. Die Weiterbildungsordnungen spiegeln<br />
die wirklichen medizinischen Erfordernisse bei der Behandlung<br />
von (psychisch) erkrankten Patienten/innen nicht wider. Dies bleibt<br />
auch mit dem Blick auf die einzelnen Weiterbildungsgänge – hier<br />
exemplarisch ausgewählt die Praktische Weiterbildung in Diagnostik<br />
und Therapie – und ebenso im Vergleich mit der Ausbildung der<br />
Psychologen/innen evident.<br />
Im Weiterbildungsgebiet „Psychosomatische Medizin und <strong>Psychotherapie</strong>“<br />
besteht ein völliges Ungleichgewicht zwischen ca.<br />
150 Stunden und 30 Fallbehandlungen (Stundenzahl unklar) in der<br />
Erstkompetenz „Psychosomatische Medizin“ und einem Übermaß<br />
von 1600 <strong>Psychotherapie</strong>stunden (Diagnostik und Behandlung) in<br />
der Zweitkompetenz „<strong>Psychotherapie</strong>“. Dies ist nahezu das Doppelte<br />
dessen, was die Praktische Ausbildung der Psychologen/innen<br />
vorsieht.<br />
Geklagt wird denn auch von ärztlicher Seite, dass die Weiterbildung<br />
zu lange dauerte. Die Aussage eines ärztlichen Kollegen, Psychologen<br />
behandelten Patienten bereits vollapprobiert psychotherapeutisch,<br />
da fange die Ärztliche Weiterbildung erst an („Ärztliche<br />
<strong>Psychotherapie</strong>“, 1/2007, S. 46), scheint indes (polemisch) übertrieben.<br />
Nach aller Erfahrung dauert die Qualifizierung der Ärzte aber in<br />
der Tat ein bis zwei Jahre länger, allerdings mit dem unabweisbaren<br />
Vorteil, dass sie zumeist auf Assistenz-Arzt-Niveau bezahlt wird. Nicht<br />
die sehr lange Dauer der Weiterbildung ist primär zu beklagen, sondern<br />
ihre in mehrerer Hinsicht ungleichgewichtige Struktur und ihre<br />
Umsetzung in der Praxis.<br />
Die oben ausführlicher dargestellte vor allem strukturelle Kritik<br />
an der Weiterbildung „Psychosomatische Medizin und <strong>Psychotherapie</strong>“<br />
lässt sich für das Facharzt-Gebiet „Psychiatrie und <strong>Psychotherapie</strong>“<br />
fortsetzen. Hier sind die Anforderungen für die Weiterbildung in<br />
der „Zweitkompetenz“ <strong>Psychotherapie</strong> aber eher zu niedrig. Es sind<br />
kaum 300 <strong>Psychotherapie</strong>stunden (Diagnostik und Behandlung) d.h.<br />
ein Fünftel dessen, was in obigen Facharzt-Gebiet und die Hälfte dessen,<br />
was in der Psychologischen Praktischen Ausbildung gefordert
Schwerpunkt<br />
Einige weitere Zahlen:<br />
Die Zahl der niedergelassenen „Ärztlichen Psychotherapeuten/<br />
innen“ (ÄP) ist mit ca. 4000 weit unterschritten. An den festgelegten<br />
40 % des Gesamt-SOLL – Mindestzahl 5763 – fehlt nahezu<br />
ein Drittel, so dass es unbeschadet der hohen Gesamtzahlen aller<br />
Psychotherapeuten rechnerisch noch Niederlassungsmöglichkeiten<br />
für 1643 ÄP (in 61 % aller Kreise) gibt, für Psychologische<br />
Psychotherapeuten/innen aber nur noch 25 (in den neuen<br />
Bundesländern).<br />
Eine Gegenüberstellung der Zahlen der „ärztlichen Lücke“ mit den<br />
Zahlen der entsprechenden Facharzt-Qualifizierungen ergibt für:<br />
2004:<br />
• 476 Fachärzte für Psychiatrie und <strong>Psychotherapie</strong>,<br />
• 91 Fachärzte für Psychotherapeutische Medizin<br />
2005:<br />
• 495 Fachärzte für Psychiatrie und <strong>Psychotherapie</strong><br />
• 120 Fachärzte für Psychotherapeutische Medizin<br />
2006:<br />
• 514 Fachärzte für Psychiatrie und <strong>Psychotherapie</strong><br />
• 198 Fachärzte für Psychosomatische Medizin und <strong>Psychotherapie</strong><br />
(inzwischen).<br />
Nur zwei Schlussfolgerungen daraus: Es brauchte drei „Jahrgänge“,<br />
um obige „Lücke“ rechnerisch zu schließen. Wegen ausscheidender<br />
Kollegen/innen reicht das real natürlich nicht. Auffällig auch das<br />
„psychiatrische Übergewicht“, was die oben dargestellten vorrangigen<br />
Probleme des „Psychosomatischen Fachgebietes“ bestätigen<br />
könnte: Zu wenige streben diese Facharztqualifikation an, der<br />
Nachwuchs reicht nicht aus. (Zahlen gem. Rücksprache mit KBV und „DÄ“<br />
Heft 34-35 A 2312 f)<br />
26<br />
wird, vorgesehen. Lediglich im Fachgebiet Kinder- und Jugendpsychiatrie<br />
und -psychotherapie scheinen die Anforderungen auch unter<br />
Berücksichtigung einer langen Krankenhaus-Zeit in sich einigermaßen<br />
ausgewogen und mit der „Psychologischen KJP“ vergleichbar zu<br />
sein. Wobei – nota bene– KJP nicht gleich KJP ist: Das P steht bei<br />
den Ärzten/innen für Psychiatrie und <strong>Psychotherapie</strong>, bei den Psychologen/innen<br />
schlicht für <strong>Psychotherapie</strong>. Im ärztlichen Fachgebiet<br />
KJP, so die BÄK, gebe es die größten Nachwuchssorgen.<br />
Schließlich sind die Weiterbildungsanforderungen für den Erwerb<br />
des Zusatztitels für „Fachgebundene <strong>Psychotherapie</strong>“ mit nur 50 Behandlungsstunden<br />
bis jetzt verschwindend gering. Hier ist eine geringe<br />
Erweiterung beschlossen. (Siehe nachfolgender Bericht über<br />
Gespräche mit BÄK und KBV.)<br />
In einer „Feinbetrachtung“ der Weiterbildung der Ärzte/innen<br />
fänden sich weitere Kritikpunkte, die hier nicht alle aufgezählt werden<br />
können. Manche stimmen mit der Kritik der PiA an ihrer Ausbildung<br />
überein. Der „Ärztetag 2006“ beschrieb in Einzelstimmen die<br />
Problematik der „Ärztlichen <strong>Psychotherapie</strong>“ mit den bekannten Defiziten<br />
in der Honorierung, aber auch dem mangelnden Einsatz der<br />
Ärztekammern für dieses medizinische Fach, verlor sich dann aber in<br />
Psychologen-Schelte. (DÄB 22/2006 A 1500 ff) „Alleinvertretungsanspruch“<br />
oder „Übermacht“ der Psychologen zu beklagen, verwechselt<br />
indes Ursache und Wirkung; denn primäre Ursache des Zurückdrängens<br />
„Ärztlicher <strong>Psychotherapie</strong>“ – augenfällig u.a. in den oben<br />
beschriebenen Facharzt-Weiterbildungen – ist ihre seit Jahren innerärztlich<br />
verfestigte Existenz unter wirtschaftlichen und personellen<br />
Minimalbedingungen. Eine der schwerwiegenden Folgen davon ist,<br />
dass der Nachwuchs an „Ärztlichen Psychotherapeuten“ ausbleibt.<br />
BÄK und KBV zu Fragen der<br />
ärztlichen Weiterbildung<br />
und des Nachwuchses<br />
Rüdiger Hagelberg<br />
Das Gespräch mit der BÄK konzentrierte sich auf Inhalt und Umfang<br />
der Weiterbildungs-Anforderungen in den jeweiligen P-Fächern.<br />
Ein Ungleichgewicht zwischen den Anforderungen der Praktischen<br />
Ausbildung – hier „Facharzt für Psychosomatische Medizin<br />
und <strong>Psychotherapie</strong>“ (PM und PT), dort „Facharzt für Psychiatrie und<br />
<strong>Psychotherapie</strong>“ (PS und PT) – wird seitens der BÄK bzw. den Weiterbildungsgremien<br />
n i c h t gesehen. Die lange stationäre Assistenzarzt-Tätigkeit<br />
in der Psychiatrie könne gewissermaßen anteilig auch<br />
als „<strong>Psychotherapie</strong>“ im weiteren Sinne gewertet werden.<br />
Insofern sei dann auch der Umfang der psychotherapeutischen<br />
Weiterbildung des „Facharztes für PM und PT“ nicht ungleichgewichtig<br />
oder übertrieben groß. Von der Komplexität psychischer bzw. psychosomatischer<br />
Krankheitsbilder ausgehend sollte auch ein komplexes<br />
(Weiter-)Bildungsangebot gemacht werden. Es sei nicht darum<br />
gegangen, sich mit den Ausbildungsgängen der Psychologischen<br />
Psychotherapeuten zu vergleichen.<br />
Auch seitens der BÄK wird die Umbenennung des Facharzttitels<br />
„Psychotherapeutische Medizin“ in „Psychosomatische Medizin und<br />
<strong>Psychotherapie</strong>“ bedauert. Dies sei aber „von den Verbänden“ so gefordert<br />
worden. (Nicht vom bvvp, im Gegenteil!)<br />
Bei der Weiterbildungsordnung für die sog. Fachgebundenen <strong>Psychotherapie</strong><br />
(VT und Tiefenpsychologie) wurde eine Erweiterung beschlossen,<br />
die von den Landesärztekammern zum Teil schon umgesetzt<br />
ist. Veränderungen scheinen aber nicht erheblich. Hier kurz zusammengefasst:<br />
Erweiterung der Theorie im speziellen Therapieverfahren<br />
von 100 auf 120 Stunden; an Stelle von bisher 50 Stunden<br />
Kurzzeitbehandlung 10 supervidierte Erstuntersuchungen und 120<br />
Stunden Behandlung im speziellen Therapieverfahren unter Supervision<br />
mit drei abgeschlossenen Fällen. Die Selbsterfahrung wird auf<br />
100 Stunden Einzel- oder Gruppenselbsterfahrung erhöht.<br />
Sollte die 90 % -Regelung in der Zukunft modifiziert werden oder<br />
gar wegfallen (Veränderungen dazu sind ja in Sicht), wird die Fachgebundene<br />
<strong>Psychotherapie</strong> möglicherweise in der Praxis wieder mehr<br />
Bedeutung erlangen. Die entsprechenden Weiterbildungsanforderungen<br />
werden damit erstrecht (trotz oben erwähnter geringfügiger<br />
Erweiterung) in einem erheblichen Ungleichgewicht zu einer dann<br />
möglichen Anwendungspraxis und zu den „Nachbarqualifikationen“<br />
der P-Fächer liegen.<br />
Zahlen über die augenblickliche Situation der „Ärztlichen <strong>Psychotherapie</strong>“<br />
und insbesondere über deren Nachwuchs bekommt man mit<br />
einigem Glück von der KBV.<br />
Auf meine Frage, mit welcher Rechnung man bei einem SOLL/IST-<br />
Vergleich auf die IST-Zahlen komme, wurde geantwortet, da gäbe es<br />
„zehn Möglichkeiten“. Dies sollte die Kompliziertheit jeglicher Berech-<br />
bvvp-magazin 4/2007
<strong>Qualifikation</strong> <strong>Psychotherapie</strong><br />
nungen betonen, womit sich die Rechnerei der Kompliziertheit des<br />
ganzen Weiterbildungsbereiches offenbar bestens anpasst.<br />
Bei vorsichtiger Berechnung des Nachwuchses, die wegen Fehlens<br />
genauer Zahlen der Ausscheidenden nur in Annäherung möglich<br />
ist, wird eine erhebliche Lücke von geschätzten mindestens 30<br />
% deutlich (Siehe obiger Kasten). Die in diesem Heft geschilderten<br />
Probleme der „Ärztlichen <strong>Psychotherapie</strong>“ manifestieren sich damit<br />
auch in einem deutlichen Nachwuchsmangel.<br />
(Tel.Gespräche mit Frau Dr. Güntert, Dezernat 2, BÄK am 3.9.07 und mit Herrn<br />
Kleinicker, Abt. Bedarfsplanung, Bundesarztregister und Datenaustausch der KBV<br />
am 17.09.07)<br />
Rüdiger Hagelberg<br />
Birgit Clever<br />
Interview 3<br />
Interview mit der Vorsitzenden<br />
des bvvp<br />
bvvp-magazin 4/2007<br />
27<br />
Rüdiger Hagelberg hat in seinen zwei Artikeln die Aus- bzw. Weiterbildungsbedingungen<br />
für Ärztliche und Psychologische Psychotherapeuten<br />
und KJP geschildert. Hat ein Berufsverband wie<br />
der bvvp hier überhaupt Einflussmöglichkeiten?<br />
Die Artikel von Rüdiger Hagelberg machen deutlich, dass der Weg<br />
zum Beruf „ PsychotherapeutIn“ für Ärzte und Psychologen/Pädagogen<br />
nach einer ganz unterschiedlichen Systematik verläuft.<br />
Die beiden Wege führen auch zu unterschiedlichen Schwierigkeiten<br />
und zu unterschiedlichen beteiligten Institutionen, wenn<br />
es darum geht, Einfluss zu nehmen. Die Stärke des bvvp liegt genau<br />
darin, dass wir uns in beiden Bereichen gut auskennen und<br />
die unterschiedlichen Stärken und Schwächen in der Organisation<br />
der Ausbildung bei den Psychologen und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten<br />
beziehungsweise der Weiterbildung der<br />
Ärzte sehr gut einschätzen können.<br />
Die Ausbildung der Psychologischen Psychotherapeuten und<br />
KJP wird vom Bundesministerium für Gesundheit und der Konferenz<br />
der Ländergesundheitsministerien festgeschrieben. BMG<br />
und Gesundheitsministerkonferenz stützen sich wiederum auf die<br />
Kammern der PP und KJP als Partner für Beratung und Umsetzung.<br />
Überall dort, wo der bvvp in den Landeskammern vertreten<br />
ist, unterstützen wir z.B. die Bemühungen, die unselige Regelung<br />
mit dem Psychiatriejahr zu verändern. Darüber hinaus pflegt der<br />
bvvp die direkten Kontakte zu Politikern und nutzt alle Gelegenheiten<br />
zum direkten Gespräch mit den Parlamentariern.<br />
Für die Weiterbildung der Ärzte wird von der Bundesärztekammer<br />
eine Musterweiterbildungsordnung erarbeitet, die vom<br />
Deutschen Ärztetag beschlossen und von den Landesärztekammern<br />
umgesetzt wird. Die Sozialministerien der Länder müssen<br />
die Weiterbildungsordnungen, die Satzungsrecht der Landesärztekammern<br />
sind, genehmigen. Möglichkeiten auf die Weiterbildungsordnung<br />
der ärztlichen Psychotherapeuten Einfluss<br />
zu nehmen, bestehen also in der Bundesärztekammer, bzw. auf<br />
dem Deutschen Ärztetag sowie in den Landesärztekammern auf<br />
die dann rechtsgültige Umsetzung, die von Land zu Land unterschiedlich<br />
sein kann. Günstig ist, dass der bvvp inzwischen auch<br />
auf dem Ärztetag vertreten ist und die Zusammenarbeit der bvvp-Delegierten<br />
in den Landesärztekammern immer besser koordiniert<br />
werden kann.<br />
Trotzdem muss man sich vor Augen führen, dass bestimmte<br />
grundlegende Probleme des ärztlichen Nachwuchses bestehen,<br />
die auch durch Verbesserungen in der ärztlichen Weiterbildung<br />
nicht aufgehoben werden können. Das allergrößte Problem besteht<br />
darin, dass sich immer weniger Ärzte insgesamt so intensiv<br />
für die Seelenheilkunde interessieren, dass sie ihre gesamte Facharztweiterbildung<br />
diesem Thema widmen wollen. Die immer wieder<br />
mal aufkeimenden Auseinandersetzungen zwischen Ärzten<br />
und Psychologen darüber, welche Teilaspekte von Regelungen<br />
der jeweils anderen Gruppe vorteilhafter sind, gehen insofern<br />
am Kernproblem der Nachwuchsfrage vorbei. Sehr schwierig ist<br />
auch die Interessenvertretung der ärztlichen Psychotherapeuten<br />
innerhalb der gesamten Ärzteschaft. In dieser Hinsicht haben es<br />
die psychologischen Psychotherapeuten und Kinder und Jugendlichenpsychotherapeuten<br />
deutlich leichter, als sie sich über ihre<br />
eigenen Kammern leichter Gehör verschaffen können.<br />
Welche Position hat der bvvp in Bezug auf die ärztliche <strong>Psychotherapie</strong>?<br />
Sind Sie mit der Namensgebung des Facharztes für Psychosomatische<br />
Medizin und <strong>Psychotherapie</strong> einverstanden ?<br />
Der bvvp hatte schon immer die Vorstellung, dass eigentlich eine<br />
ganz enge Kooperation ärztlicher und psychologischer Psychotherapeuten<br />
sowie der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten<br />
das Beste für die Verankerung der <strong>Psychotherapie</strong> im Gesundheitswesen<br />
wäre. Insofern stand er lange Zeit zwischen den ärztlichen<br />
Psychotherapeuten und den PP und KJP, die versuchten, ihre Identität<br />
über eigene Kapitel im EBM 2000 plus zu verankern, was zu<br />
einer ziemlich unfruchtbaren Auseinandersetzung führte, anstatt<br />
nach Möglichkeiten zu suchen, das Fachgebiet als Ganzes im Auge<br />
zu behalten und Gemeinsamkeiten zum Nutzen aller durchzusetzen.<br />
Insofern sehen wir auch immer noch mit einer gewissen<br />
Skepsis, dass die Verbände der psychosomatisch-psychotherapeutisch<br />
tätigen Ärzte die gesamte Psychosomatik für sich reklamieren<br />
und die systematisierte <strong>Psychotherapie</strong> (im Sinne der <strong>Psychotherapie</strong>-Richtlinien)<br />
eher hintan stellen, was sie auch durch den<br />
neuen Namen ihres Facharztes ausdrücken. Natürlich ist es notwendig,<br />
die Tätigkeit der ärztlichen Psychotherapeuten in Abgrenzung<br />
zu den Fachärzten für Psychiatrie und <strong>Psychotherapie</strong> klar<br />
zu definieren und dies in der vorwiegend somatisch ausgerichteten<br />
Ärzteschaft durch einen zutreffenden Namen zu dokumentieren.<br />
Trotzdem wird damit eine aus unserer Sicht hinderliche Aus-
Schwerpunkt<br />
einandersetzung zwischen Ärzten und Psychologen initiiert, die<br />
natürlich ihre Kompetenz, auch psychosomatische Erkrankungen<br />
mit psychotherapeutischen Mitteln behandeln zu können, hochhalten.<br />
Aber auch die PP und KJP machen den Ärzten gegenüber<br />
unfruchtbare Fronten auf. Dass sie durch die Bezeichnung ihrer<br />
Kammern als „Psychotherapeutenkammern“ den berechtigten<br />
Ärger der Ärzte auf sich ziehen, weil diese darin eine unzulässige<br />
Vereinnahmung der <strong>Psychotherapie</strong> durch die PP/KJP sehen, ist<br />
sozusagen das Pendant.<br />
Wo steht der bvvp in Bezug auf die Fachgebundene <strong>Psychotherapie</strong>?<br />
Die fachgebundene <strong>Psychotherapie</strong> ist ja das Nachfolgemodell<br />
des Zusatztitels <strong>Psychotherapie</strong>. Die Verbindung von Körper und<br />
Seele findet an dieser Stelle in der Weiterbildungsordnung der<br />
Ärzte ihre Konkretisierung und ist dem bvvp ausgesprochen wichtig.<br />
Nur durch eine taugliche Konzeptionalisierung dieser Schnittstelle<br />
wird es möglich sein, die psychische Dimension dauerhaft<br />
in der Medizin verankert zu halten. Nur wenn überwiegend somatisch<br />
ausgerichtete Haus- und Fachärzte die Möglichkeit haben,<br />
sich in der Behandlung seelisch begründeter Erkrankungen<br />
so weiterzubilden, dass sie diese Kenntnisse dann auch befriedigend<br />
anwenden können, wird das von Thure von Üexküll begründete<br />
bio-psycho-soziale Denken erhalten werden können.<br />
Voraussetzung für eine befriedigende Ausübung einer Tätigkeit<br />
ist jedoch ein ausreichend fundierter Kompetenzerwerb. Zumal<br />
psychosomatische Krankheiten und psychische Ursachen in allen<br />
Fachgebieten der Medizin nach all den Statistiken immer<br />
weiter zunehmen, erscheint dies nicht nur wünschenswert, sondern<br />
fast schon zwingend. Die aber jetzt in der Musterweiterbildungsordnung<br />
der Ärzte festgelegten Anforderungen hinsichtlich<br />
der Anzahl der Behandlungsstunden unter Supervision, dem<br />
Herzstück jeden psychosomatisch-psychotherapeutischen Kompetenzerwerbs,<br />
sind so niedrig, dass man wirklich allergrößte Bedenken<br />
anmelden muss, ob derart weitergebildete Kollegen tatsächlich<br />
in der Lage sind über den Zugang zu Richtlinienpsychotherapie<br />
seelisch schwerkranke Patienten aus dem gesamten Störungsspektrum<br />
der Psychosomatik und <strong>Psychotherapie</strong> adäquat<br />
zu behandeln. Besonders augenfällig wird dieses Problem, wenn<br />
man bedenkt, dass die Anforderungen an Fachärzte für Psychosomatische<br />
Medizin und <strong>Psychotherapie</strong> oder aber auch an die<br />
Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten<br />
ungleich höher sind. Diese Anforderungen<br />
wurden ja nicht aus Spaß aufgestellt, sondern in der Verantwortung<br />
für die Patienten. Man muss jetzt an die Landesärztekammern<br />
appellieren, beziehungsweise in ihren Gremien Einfluss<br />
nehmen, dass Anforderungen der Muster -Weiterbildungsordnung<br />
zum Schutze der Patienten und ihrer Behandler bei<br />
der Fachgebundenen <strong>Psychotherapie</strong> durch landeseigene Regelungen<br />
angehoben werden.<br />
Die Ausbildungsinstitute für PP und KJP sind anerkannt und<br />
laufen. Die Kammern für PP und KJP sind nun alle gegründet. Jetzt<br />
scheint Raum für die Diskussion von Einzelheiten zu sein.<br />
ausgeübt werden können. Hier müsste durch eine gesetzliche Öffnungsklausel<br />
mehr Raum geschaffen werden.<br />
Das zentrale Übel im Zusammenhang mit der Ausbildung von<br />
PP und KJP ist aber die systematisch unbefriedigende Einordnung<br />
des Status der Ausbildungskandidaten. Die sogenannten<br />
PiA müssen in ihrem Psychiatrischen Jahr voll arbeiten, bekommen<br />
keinen oder einen unangemessenen Lohn und sehen gleichzeitig<br />
die Kosten für die weitere Ausbildung an den staatlich anerkannten<br />
Instituten auf sich zukommen. Es ist absolut erstaunlich,<br />
dass trotzdem eine große Zahl von jungen Leuten diese Mühe<br />
auf sich nimmt - und dies zusätzlich mit einer völlig unklaren<br />
beruflichen weiteren Zukunft, wenn man an die derzeit noch gültigen<br />
Restriktionen der Bedarfsplanung denkt. Die unselige Regelung<br />
zum Jobsharing macht es darüber hinaus sowohl denen, die<br />
eine Praxis abgeben wollen, wie auch den jungen Kollegen nahezu<br />
unmöglich, hier zu einer vernünftigen Kooperation zu kommen.<br />
Mindestens für diese Übergabephase sollten Lockerungen der bisherigen<br />
Jobsharing -Regelung gefunden werden.<br />
Wie kann der bvvp die Anliegen der PiA unterstützen?<br />
Zunächst ist es ganz sicher ein wichtiger Schritt, den wir in diesem<br />
Heft tun, überhaupt in der Kollegenschaft die Situation der<br />
jungen KollegInnen bekannt zu machen. Dies könnte dazu führen,<br />
dass sich die Praxis abgebenden Kollegen hinsichtlich der<br />
Höhe der Preise beim Praxisverkauf auch auf die Situation der<br />
jungen KollegInnen einstellen. Wir wissen, dass dies schwierig<br />
ist, da viele der KollegInnen, die jetzt ihre Praxen aufgeben, eine<br />
schlechte Altersvorsorge haben - eine Folge der jahrelangen<br />
miesen Bezahlung unserer Leistungen. Wie schon vorhin ausgeführt,<br />
ist der entscheidende Partner für Veränderungen für die<br />
PiA der Gesetzgeber. Auf ihn kann man kaum direkt selbst einwirken<br />
sondern nur im Verbund mit all den anderen Verbänden,<br />
die im GK II zusammengeschlossen sind, wie auch über die Landeskammern<br />
der PP und KJP und der Bundespsychotherapeutenkammer.<br />
Angesichts der bisherigen sehr durchgängigen Weigerung<br />
des Bundesgesetzgebers, das Psychotherapeuten-Gesetz<br />
überhaupt wieder anzufassen, müssen hier noch sehr viele dicke<br />
Bretter gebohrt werden. Aber damit hat der bvvp schon lange Erfahrung<br />
und kann das gut.<br />
Denkt der bvvp über eine Form der Mitgliedschaft der PiA im eigenen<br />
Verband nach?<br />
Auf jeden Fall unterstützt der bvvp über diejenigen, die in den Landeskammern<br />
aktiv sind, eine Mitgliedschaft der PiA in den Kammern<br />
und sucht nach satzungsrechtlichen Möglichkeiten, den PiA<br />
auch eine Mitarbeit im bvvp, beziehungsweise seinen Landesverbänden<br />
zu ermöglichen. Da der bvvp allerdings bisher seine Aktivitäten<br />
ganz klar für die niedergelassenen und die in den Richtlinienverfahren<br />
arbeitenden Psychotherapeuten gesehen hat, gibt<br />
es hier gewisse Hürden, ähnlich wie bei dem Projekt, sich für angestellte<br />
Psychotherapeuten zu öffnen - was aber angesichts der<br />
neuen Kooperationsformen im Gesundheitswesen ebenso eine unbedingte<br />
Notwendigkeit ist.<br />
Wo muss Ihrer Meinung nach zuerst etwas geändert werden?<br />
Wenn ein neues Verfahren im Bereich der <strong>Psychotherapie</strong> anerkannt<br />
werden soll, wird gefordert, dass dieses Verfahren sich bereits<br />
in der Versorgung bewährt haben soll. Die Regelungen des<br />
Psychotherapeutengesetzes schließen aber aus, dass Verfahren,<br />
die nicht wissenschaftlich anerkannt sind, überhaupt gelehrt und<br />
28<br />
An welchen berufspolitischen Themen arbeitet der bvvp zur Zeit<br />
außerdem?<br />
Damit sprechen Sie ein weites Feld an, es sind nämlich furchtbar<br />
viele Themen, die uns beschäftigen. Wir haben uns vorgenommen,<br />
darüber einmal ausführlich im nächsten Magazin zu berichten. Daher<br />
zähle ich hier nur einmal die Themen auf:<br />
bvvp-magazin 4/2007
<strong>Qualifikation</strong> <strong>Psychotherapie</strong><br />
die Betreuung von Musterklageverfahren auf den verschiedenen<br />
Instanzen in verschiedenen KVen; die Umsetzung der neuen<br />
Gesetze (VändG und WSG), insbesondere die Kostenerhebung<br />
und deren Umsetzung in den EBM; die Mitarbeit bei Versorgungsleitlinien<br />
für psychische Krankheiten; die Anerkennung<br />
von psychotherapeutischen Verfahren im Gemeinsamen Bundesausschuss;<br />
die Info-Veranstaltungen über QM und zu den Zulassungsmöglichkeiten<br />
nach VändG.<br />
Haben Sie bei diesem Engagement überhaupt noch Zeit, an die<br />
PiA zu denken?<br />
Wenn man bedenkt, dass dort der Nachwuchs für unseren Beruf<br />
und auch für die Berufspolitik heranwächst, dann wird der bvvp<br />
hier in den nächsten Jahren zusammen mit den Vertretern und<br />
Vertreterinnen der PiA einen neuen Schwerpunkt seiner Arbeit<br />
legen müssen. Es kann und darf nicht sein, dass die jungen Kolleginnen<br />
und Kollegen schon völlig entmutigt und erschöpft in<br />
den Beruf als PP und KJP treten. Aber natürlich ist es auch so,<br />
dass all die aufgeführten Themen, mit denen wir zurzeit beschäftigt<br />
sind, den beruflichen Alltag derer, die jetzt PiA sind, massiv<br />
beeinflussen werden. Insofern sind wir natürlich auch schon jetzt<br />
für die PiA an vielen anderen Stellen unterwegs.<br />
bvvp-magazin 4/2007<br />
Die Fragen stellte Ortwin Löwa<br />
Psychotherapeutische Aus- und<br />
Weiterbildung heute.<br />
Eine kritische Bestandsaufnahme<br />
aus Sicht der Institute<br />
29<br />
Beabsichtigen ein Arzt oder Psychologe heute, eine psychotherapeutische<br />
Ausbildung (gemeint ist im folgenden Text immer: Ausbildung<br />
der Psychologen/innen bzw. Pädagogen/innen und Weiterbildung<br />
der Ärzte/innen) zu beginnen, muss er sich berufsrechtlich,<br />
sozialrechtlich und fachlich-inhaltlich über die Bedingungen seines<br />
künftigen Berufsbildes informieren. Dieser Aufsatz soll dem Interessenten<br />
eine Orientierung dazu bieten und dem bereits berufstätigen<br />
Psychotherapeuten zeigen, wie komplex, ja schwierig die Ausbildung<br />
heute ist.<br />
Inhaltlich ist sie ebenso wie die Fortbildung im Großen und<br />
Ganzen betrachtet und salopp gesagt „up to Date“. Das klingt beruhigend.<br />
Aber ist die Situation der Ausbildung für die Auszubildenden<br />
wie für die Ausbildenden wirklich „beruhigend“? Ich glaube<br />
das nicht.<br />
Ärzte wie Psychologen sind durch die Vorgaben der WBO und des<br />
PsychThG mit Anforderungen konfrontiert, die für sie allein schon<br />
durch die verwirrende Vielfalt von Aus-und Weiterbildungsgängen eine<br />
immense Herausforderung darstellen. Ärzte erwerben ihre psychotherapeutische<br />
Kompetenz in Gestalt verschiedener Facharzt- und Zusatzbezeichnungen<br />
und müssen sie mit dem psychotherapeutischen<br />
Verfahren ihrer Wahl verbinden, ohne immer genau zu wissen, was dies<br />
für sie bedeutet. Psychologen stehen vor verwirrenden Begrifflichkeiten<br />
wie Fachkunde, verklammerte Ausbildung, zweite Fachkunde<br />
und den damit verbundenen Institutionen der berufsrechtlichen Anerkennung,<br />
deren Zusammenhänge und Folgen sie für die spätere Berufstätigkeit<br />
kaum aus eigenem Verständnis erfassen können. In den<br />
Wirren der Möglichkeiten, Risiken und Chancen, welche die Ausbildung<br />
zum Psychotherapeuten in sich tragen, haben die Berufsanfänger<br />
meist nur wenig Unterstützung von den Instituten, Kammern, KV<br />
en und Behörden. Hier ist die Einrichtung einer institutionalisierten Beratung<br />
sinnvoll und nötig. Sie stößt aber an Grenzen, weil der Gesetzgeber<br />
es versäumt hat, Ausbildungsinstitute mit den notwendigen finanziellen<br />
Mitteln auszustatten, die sie für ihre ihnen per Gesetz übertragenen<br />
Aufgaben benötigen. Die hier klaffende Lücke wird gegenwärtig<br />
durch Freiwilligkeit und Ehrenamtlichkeit geschlossen, ein unhaltbarer<br />
Zustand im Bereich beruflicher Ausbildung, unbefriedigend<br />
für beide Seiten, die Ausbildenden wie die Auszubildenden.<br />
Die Unzufriedenheit mit der Finanzierung der Ausbildung teilen<br />
beide Seiten. Die Auszubildenden müssen es in der Regel jahrelang<br />
ertragen, ihre berufsbegleitende Studien- und Lehrzeit mit einem äußerst<br />
schmalen, wenn nicht unzulänglichen Budget zu verbringen. Ihre<br />
Verdienstmöglichkeiten sind dadurch deutlich eingeschränkt, dass<br />
die Ausbildung über mehrere Jahre einen Zeitumfang von bis zu 20<br />
Stunden pro Woche erfordert, der für Erwerbstätigkeit nicht zur Verfügung<br />
steht. Darüber hinaus muss die Gruppe der Psychologen einstweilen<br />
akzeptieren, dass anderthalb Jahre ihrer Ausbildung, die Phase der<br />
„Praktischen Tätigkeit“, unbezahlt sind. Allein diese finanziellen Beeinträchtigungen<br />
stellen eine deutliche Einschränkung für die Entwicklung<br />
der Auszubildenden, insbesondere auch ihrer Familien dar. Viele<br />
sind nicht bereit, dies in der Zeit einer Postgraduierten-Ausbildung hinzunehmen.<br />
Allein dies beeinträchtigt die Entwicklung der Berufsgruppe<br />
der Psychotherapeuten erheblich und führt zu einer spezifischen<br />
Beschränkung derer, die bereit sind, diesen Beruf zu ergreifen.<br />
Die Ausbildenden bekommen für ihre Tätigkeit in der Regel kein<br />
angemessenes Entgelt. Lehrtherapie und Supervision werden vielfach<br />
mit einem Honorar abgegolten, das nicht einmal dem Satz entspricht,<br />
der von den gesetzlichen Krankenkassen für eine Therapiestunde<br />
gezahlt wird. Darüber hinaus ist die Tätigkeit als Ausbilder<br />
mit häufiger Präsenz im Institut zur Ableistung von Kursen und Seminaren<br />
verbunden. Viele Institute sind indes nicht in der Lage, diese<br />
Tätigkeiten überhaupt oder angemessen zu vergüten. So leisten<br />
die Ausbildenden zumindest einen Teil ihrer Tätigkeit ehrenamtlich.<br />
Davon sind in besonderer Weise die Funktionsträger der Institute betroffen,<br />
deren Arbeitsaufwand gelegentlich bis zu 20 Stunden pro<br />
Woche betragen kann.<br />
Die finanzielle Situation in den Instituten der verhaltenstherapeutischen<br />
Ausbildung soll sich, so ist zu hören, weniger angespannt dar<br />
stellen, als in denen der analytischen Verfahren. Die Funktionsfähigkeit<br />
der analytischen Institute – meist auch Träger der tiefenpsychologischen<br />
Ausbildung – ist indes weitgehend nur durch das ehrenamtliche<br />
Engagement der Ausbilder sicherzustellen. Idealismus, Freude<br />
am Fach und oft genug auch narzisstische Gratifikation sind allerdings<br />
zur Sicherstellung von Existenz, Funktionsfähigkeit und Fortentwicklung<br />
der Institute und der <strong>Psychotherapie</strong> allein gefährliche<br />
Motive, und Ehrenamtlichkeit ist wenig geeignet, wirklich gutes Personal<br />
an ein Institut zu binden.<br />
Psychotherapeuten werden nicht nur in Instituten ausgebildet,<br />
sondern auch in psychiatrischen, psychotherapeutischen und psychosomatischen<br />
Fachkliniken. Sie werden dort – wie in der ambulanten<br />
Praxis – dringend benötigt. Ihr zwischen Praxis und Klinik deutlich<br />
unterscheidbares Tätigkeitsfeld beinhaltet unterschiedliche inhaltliche<br />
Anforderungsprofile: in der Klinik müssen mehr und häufiger<br />
akute und schwere psychische Störungszustände behandelt werden,<br />
während in der Praxis Patienten über längere Zeit und in Zuständen
Schwerpunkt<br />
Aus- und Weiterbildungsinstitute<br />
Es gibt 175 Aus- und Weiterbildungsinstitute <strong>Psychotherapie</strong><br />
in Deutschland, davon 150 in den alten, 25 in den neuen<br />
Bundesländern.<br />
Nach Therapieverfahren (Westen/Osten): Tiefenpsychologie<br />
(TP): 84 (74/10), VT: 67 (53/14), gemischt 7 (7/0), KJP 11<br />
(10/1), davon 6 TP, 4 VT und 1 gemischt, 5 unklar.<br />
52 Institute bieten zu ihrem „Hauptgebiet“ KJP an, davon etwa<br />
jeweils die Hälfte TP oder VT.<br />
Nicht alle Institute bilden Ärzte und Psychologen gemeinsam<br />
weiter bzw. aus. Genaue Zahlen dazu fehlen.<br />
(Zahlen gem. Zusammenstellung aller „anerkannten Ausbildungsinstitute für<br />
<strong>Psychotherapie</strong>“ durch BPtK, Stand 01.06.07)<br />
behandelt werden, bei denen Chronifizierung der Erkrankung kennzeichnend<br />
ist. Psychotherapeuten in der Ausbildung können die Kompetenz<br />
für beide Behandlungssituationen nur erwerben, wenn sie<br />
auch in beiden Bereichen tätig sind. Für die meisten Auszubildenden<br />
gilt allerdings, dass sie die stationäre und ambulante <strong>Psychotherapie</strong><br />
mit ihren jeweiligen Problemen und Schwierigkeiten ausreichend<br />
gut kennen lernen.<br />
Hingegen öffnet sich zwischen beiden Aus- bzw. Weiterbildungseinrichtungen,<br />
hier den Kliniken, dort den Instituten, ein Konfliktfeld.<br />
Während die Kliniken darauf abzielen, die Ausbildung ihrer mitarbeitenden<br />
Ärzte und Psychologen im eigenen Rahmen und insbesondere<br />
auch während der Dienstzeit anzubieten, so bieten die Institute<br />
eine berufsbegleitende Weiterbildung an, die in den Abendstunden<br />
und während der Freizeit erfolgt. Diese Konstellation muss vor<br />
allem dann Konflikte aufwerfen, wenn die Kooperation zwischen Kliniken<br />
und Instituten nicht inhaltlich und organisatorisch gut abgestimmt<br />
ist. Um unfruchtbare Machtkämpfe zu vermeiden, kann Ärztekammern<br />
und Anerkennungsbehörden im Einzelfall die Aufgabe<br />
zufallen, über die Ausformulierung ihres Regelwerkes Einfluss auf diese<br />
Konflikte zu nehmen. Dabei bewährt sich, wenn Fachgremien mit<br />
Vertretern aller beteiligter Interessengruppen gebildet werden, um<br />
konsensfähige Konzepte zu erarbeiten. Sie sind dann in die Ausführungsbestimmungen<br />
einzuarbeiten.<br />
Zwischen einzelnen Anbietern der psychotherapeutischen Ausbildung<br />
selbst kann es einen weiteren Konfliktbereich geben, der, weil<br />
schwierig zu diskutieren, nur angedeutet werden soll. Die Stichworte<br />
Ressourcen-Orientierung und Entwicklungs-Orientierung mögen<br />
andeuten, welches die beiden Positionen sind, die hier miteinander<br />
konfligieren. Angeregt von der Pendelbewegung, welche die gesellschaftspolitische<br />
Werteentwicklung ständig bewegt, kommt es gegenwärtig<br />
zu einer erkennbaren Dominanz des Leistungsprinzips. Eine<br />
Art „Neo-Kapitalismus“ scheint die Denkstrukturen in Wirtschaft<br />
und Politik zunehmend zu durchziehen, nach dem unter Leistung hohe<br />
Produktivität unter Einsatz von möglichst wenig Zeit und Geld<br />
verstanden wird. Dieses Leistungsprinzip findet inzwischen auch im<br />
Gesundheitswesen und in der psychotherapeutischen Versorgung<br />
Anwendung. Unter Leistung der <strong>Psychotherapie</strong> wird danach verstanden,<br />
dass eine Symptomreduktion und die Mobilisierung von Ressourcen<br />
unter Einsatz von möglichst wenig Therapiesitzungen zu<br />
günstigen Preisen erreicht wird. Diesem „Effizienzprimat“ steht das<br />
Prinzip der „Orientierung an der Entwicklung“ des Menschen gegenüber,<br />
welches fragt: Wie müssen die Entwicklungsbedingungen beschaffen<br />
sein, damit die Symptomatik durch psychische Reifung einen<br />
Wandel erfährt? Entwicklungsorientierte <strong>Psychotherapie</strong> ist nicht<br />
unbedingt dadurch wirtschaftlich, dass sie schnell und billig erfolgt,<br />
30<br />
sondern dass sie unter Einsatz von mehr Zeit auf stabile und langfristige<br />
Veränderungen abzielt.<br />
Die fachlich-inhaltliche Entwicklung der <strong>Psychotherapie</strong> als Wissenschaft<br />
vollzieht sich auch in diesem Konfliktfeld. Sie kann in Gefahr<br />
geraten, der Pendelbewegung der gesellschaftspolitischen Veränderungen<br />
zu folgen. An der Schnittstelle von gesellschaftspolitischem<br />
Wandel und wissenschaftlicher Entwicklung unseres Faches<br />
berührt sich die therapeutische Verantwortung des Psychotherapeuten<br />
unvermeidlich mit seiner Einbindung in den gesellschaftspolitischen<br />
Kontext. Diese Berührung erfordert von ihm Wachsamkeit<br />
und kritische Bestimmung der eigenen psychosozialen Position<br />
sowie Aufmerksamkeit gegenüber der Möglichkeit, dem Wandel der<br />
Umwelt unbemerkt zu folgen.<br />
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die psychotherapeutische<br />
Ausbildung inhaltlich den Stand der Entwicklung der <strong>Psychotherapie</strong><br />
als Wissenschaft ausreichend gut abbildet. Vor allem spiegelt<br />
sie wider, dass sich unser Fach in Entwicklung befindet, eben so<br />
wie Entwicklung ein konstituierendes Charakteristikum der conditio<br />
humana ist. Daneben aber ist zu beklagen, dass die Bedingungen,<br />
unter denen <strong>Psychotherapie</strong> heute gelernt und gelehrt wird, nicht befriedigen.<br />
Vor allem die beschriebenen Konflikte bedürfen der Beachtung,<br />
ja der Lösungen. Es gilt, Gefahren von der Entwicklung der <strong>Psychotherapie</strong><br />
abzuwenden, die – so mein Eindruck – zu keinem Zeitpunkt<br />
ihrer Geschichte so hilfreich und wirksam war wie heute.<br />
Immer strebe zum Ganzen<br />
Michael Klöpper<br />
Der Walsroder ärztliche Psychotherapeut Thomas Bartsch ist Lesern<br />
des Schwerpunkts bereits durch sein Buch „Der Stein des Sisyphos“<br />
bekannt. Er lässt sich in seiner Arbeit auch durch literarische<br />
Bilder inspirieren und verdichtet sie zu eigenen lyrischen<br />
Produkten. Das Ergebnis dieses integrativen Prozesses ist die folgende<br />
Betrachtung, in der er die <strong>Psychotherapie</strong> wieder auf ihren<br />
ganzheitlich – humanistischen Kern zurückführt.<br />
„Gibt es ein Geheimnis unter der Oberfläche menschlichen Tuns?<br />
Oder sind die Menschen ganz und gar so, wie ihre Handlungen,<br />
die offen zutage liegen, es anzeigen?“<br />
Pascal Mercier, „Nachtzug nach Lissabon“,<br />
Carl Hanser Verlag, München / Wien, Mai 2006, S. 36<br />
Ich möchte dieses Zitat meinen eigenen Betrachtungen zur Lage der<br />
<strong>Psychotherapie</strong> vorausschicken. Sind Romanciers mit Tiefsinn und<br />
ohne Bindung an eine methodenimmanente Doktrin möglicherweise<br />
eher in der Lage, wesentliche Phänomene und Fragen unserer Zeit<br />
zu erfassen, als Menschen, die ihre ideologische Heimat in Gefilden<br />
„fundierter“ tiefenpsychologischer oder verhaltenstherapeutischer,<br />
ärztlich-psychosomatischer oder psychologisch-psychotherapeutischer<br />
Ausbildung und Ausrichtung wähnen?<br />
Stiftet es Sinn, die Energie berufspolitischen Ehrgeizes primär<br />
in die Definition methoden- und berufsgruppenspezifischer Unterschiede,<br />
vermeintlicher entsprechender Abgrenzungsnotwendigkeiten<br />
bzw. Lagerbildungen und in die Demonstration subjektiv erfahrenen<br />
Unrechts strömen zu lassen? Ist es – bei allem unbestreitbar<br />
notwendigen Einsatz gegen Missstände und für Gleichbehand-<br />
bvvp-magazin 4/2007
vvp-magazin 4/2007<br />
<strong>Qualifikation</strong> <strong>Psychotherapie</strong><br />
lung – nicht die oberste Priorität, über alle Unterschiede der Sozialisation,<br />
Ausbildung und Berufsfelder die leuchtende Überschrift<br />
„Gemeinsamkeit“ zu setzen und vor allem mit gebündelter Kraft die<br />
(Rück-)Besinnung auf ein überprüftes Wertefundament und ein von<br />
Würde und Individualität geprägtes Menschenbild zu postulieren,<br />
das gleichsam wegzubrechen droht?<br />
Zweifellos gilt es gegen Unrecht aufzubegehren! Dabei dürfen<br />
meines Erachtens jedoch weder die Prioritäten verrutschen noch<br />
die Konzentration auf die unabdingbare Geschlossenheit psychologischer<br />
und ärztlicher Psychotherapeutinnen/-therapeuten verloren<br />
gehen.<br />
Ich arbeite als ärztlicher Psychotherapeut seit über 10 Jahren in<br />
eigener Praxis. Meine praktische Ausbildung absolvierte ich in sowohl<br />
verhaltenstherapeutisch als auch tiefenpsychologisch ausgerichteten<br />
Fachkliniken. Außerdem habe ich mich während meiner<br />
Praxis-Assistenz, die seinerzeit noch als Voraussetzung für die eigene<br />
Niederlassung galt, intensiv mit der Transaktionsanalyse vertraut<br />
gemacht. Die Ausbildung in den besagten Kliniken war recht intensiv,<br />
anspruchsvoll und streckenweise auch hart. Ich möchte in diesem<br />
Kontext nur erwähnen: Nachtdienste, Zuständigkeit für psychotherapeutische<br />
und psychosomatisch-ärztliche Belange (wenn auch mit<br />
dem Schwerpunkt „psychosomatisch“). Dabei hatte ich als Bezugstherapeut<br />
bzw. Stationsarzt nicht weniger Patienten psychotherapeutisch<br />
zu behandeln als psychologische Psychotherapeutinnen/-therapeuten.<br />
Mein Arbeitspensum und meine Verantwortung gingen phasenweise<br />
an meine physischen und psychischen Grenzen! Die theoretische<br />
Ausbildung war ein integrierter Bestandteil meiner klinischen<br />
Aufgaben (selbstredend sollte dies gleichermaßen für Psychologinnen/Psychologen<br />
gelten!), die Selbsterfahrung und Teilnahme<br />
an Balint-Gruppen musste ich selber finanzieren.<br />
Nach meiner Niederlassung sah ich mich mit der geradezu moralisierend<br />
und dogmatisch vorgetragenen Forderung einiger ärztlicher<br />
Kolleginnen und Kollegen konfrontiert, die mit Hinweis auf<br />
die für Ärzte gültige Berufsordnung von mir erwarteten und verlangten,<br />
dass ich am allgemeinärztlichen Notdienst teilnehme, nachdem<br />
ich jahrelang ausschließlich psychotherapeutisch bzw. psychosomatisch<br />
gearbeitet hatte und folglich über keinerlei notfallmedizinische<br />
und praktisch-allgemeinmedizinische Erfahrungen verfügte<br />
(die sich auch nicht in „Trockenkursen“ nachholen lassen). Nach einigen<br />
Auseinandersetzungen, in denen ich vorwiegend meine ethische<br />
Grundhaltung und den Schwerpunkt meiner Gewissensentscheidung<br />
betonte, gelang mir aufgrund bestimmter Formalkriterien schließlich<br />
die Befreiung vom Notdienst; ein gewisser Groll von ärztlicher<br />
Seite war mir in der Folgezeit sicher: „Sie verstoßen gegen unseren<br />
Korpsgeist…“<br />
Als ich aus Gründen der Sympathie und des Gefühls geistiger Nähe<br />
eine Kontaktbrücke zu psychologischen Kolleginnen und Kollegen<br />
schlug, indem ich Austausch, Koordination und gemeinsames berufspolitisches<br />
Engagement anbot, erfuhr ich – nach vordergründigen Solidaritätsbekundungen<br />
– eine mehr oder minder subtile Ausgrenzung:<br />
Zum üblichen regionalen Arbeitstreffen, an dem vor meiner Niederlassung<br />
und dem Therapeutengesetz nur psychologische Psychotherapeutinnen<br />
/ -therapeuten teilgenommen hatten, wurde ich bald<br />
„aus Gründen der Tradition“ nicht mehr eingeladen – und dies, nachdem<br />
ich zuvor die Gründung eines gemeinsamen Arbeitskreises angeregt<br />
und in der Zeit vor dem Therapeutengesetz bereitwillig Indikationsbescheinigungen<br />
ausgestellt hatte. Mir erging es nicht allein<br />
so; die anderen ärztlichen Therapeuten meiner Region machten<br />
die gleiche Erfahrung! Ich verstand nun die Welt nicht mehr, kauerte<br />
als sogenannter „Facharzt für Psychotherapeutische Medizin“ im<br />
31<br />
Niemandsland zwischen Ärzten und Psychologen und gehörte offenkundig<br />
weder zu der einen noch zur anderen Gruppe!<br />
Ich schreibe diese persönlichen Erfahrungen nicht nieder, weil ich<br />
etwa eine „narzisstische Kränkung“ abarbeiten möchte und dafür Beifall<br />
oder Mitleid heische, sondern um meine psychologischen Kolleginnen<br />
und Kollegen anzuregen, einmal die Perspektive zu wechseln<br />
und die berufspolitischen Ungerechtigkeiten und die damit einhergehenden<br />
Formen der Ungleichbehandlung auf psychologischer<br />
und ärztlicher Seite wahrzunehmen und nicht – aus welchen Gründen<br />
auch immer – weiterhin Öl in das Feuer absurder Grabenkämpfe<br />
zu gießen.<br />
Gerade aufgrund meiner subjektiven Erlebnisse plädiere ich für ein<br />
Miteinander psychologischer und ärztlicher Psychotherapeutinnen<br />
und -therapeuten, für ein Ende irrationaler und die gemeinsame Position<br />
schwächender Spaltungstendenzen wie auch für eine Integration<br />
verschiedener therapeutischer Ansätze – allerdings unter dem<br />
Primat eines Menschenbildes, das dem Wort „Individuum“ (lat.: das<br />
Unteilbare!!!) Rechnung trägt.<br />
Mit „unteilbar“ meine ich nicht allein die Würde des einzelnen<br />
Menschen in Abgrenzung von einer Gruppe, also dessen Unauflösbarkeit<br />
in einem Kollektiv, sondern auch und vor allem seine „Nicht-<br />
Zerlegbarkeit“ in einzelne Bestandteile und Funktionseinheiten.<br />
Zurück zum obigen Zitat und Buch: Haben Sie den Roman „Nachtzug<br />
nach Lissabon“ gelesen? Ich kann diesen Bewusstseinskrimi nur<br />
wärmstens empfehlen, in dem es an anderer Stelle heißt: „Es ist noch<br />
nicht lange her, da dämmerte mir endlich, dass es einen mächtigen<br />
Text in mir gibt, der über allem geherrscht hat, was ich bis heute fühlte<br />
und tat, einen verborgenen glühenden Text, dessen tückische Macht<br />
darin liegt, dass ich trotz all meiner Bildung nie auf den Gedanken<br />
kam, er könnte vielleicht nicht die Gültigkeit besitzen, die ich ihm, ohne<br />
im geringsten davon zu wissen, zugestanden hatte“ (S. 319).<br />
Welche psychotherapeutische Methode ist geeignet, einem Patienten,<br />
der unter der Regie dieses Textes leidet, effektiv zu helfen?<br />
Geht es um die Aufarbeitung der Lerngeschichte, pathologischer<br />
Konditionierungsprozesse und der aufrechterhaltenden pathogenen<br />
Faktoren?<br />
Heißt hier der entscheidende therapeutische Ansatz: kognitive<br />
Umstrukturierung, Lockerung der Symptomfixierung, Erarbeitung<br />
von Copingstrategien? Oder gilt es das frühe, bislang unbewusst<br />
abgewehrte Traum zutage zu fördern, den Zusammenhang mit dem<br />
Aktualgeschehen herzustellen und in einem fruchtbaren therapeutischen<br />
Milieu den Patienten nachreifen zu lassen und den alten<br />
Text durch positive emotionale Neuerfahrungen weitestgehend zu<br />
neutralisieren?<br />
Ich möchte folgende Thesen aufstellen:<br />
1. Der Mensch ist unbedingt als Ganzheit zu betrachten: ausgestattet<br />
mit einem Bewusstsein und Unterbewusstsein.<br />
2. Sein Leidensdruck und seine Symptome sind ausschließlich als<br />
ein Phänomen zu verstehen, das nur aus dieser höchst individuellen,<br />
d.h. einmaligen und nicht austauschbaren Ganzheit entstanden<br />
ist.<br />
3. Die Symptome und Auffälligkeiten können also nicht jeweils<br />
nur für sich und losgelöst vom Ganzen betrachtet und behandelt<br />
werden: Der Mensch ist kein Roboter mit austauschbaren Teilen;<br />
das therapeutische Instrumentarium ist kein Ersatzteillager.<br />
4. Der Mensch darf also nicht reduziert werden auf „therapierelevante“<br />
Symptome bzw. auf ein Syndrom.<br />
5. Jede Diagnostik und jeder Therapieansatz, die nur oder vorrangig<br />
auf das Symptom und dessen Behandlung fokussieren, ohne<br />
den jeweiligen Hintergrund respektive das verursachende Kon-
Schwerpunkt<br />
6.<br />
7.<br />
8.<br />
9.<br />
10.<br />
11.<br />
12.<br />
flikt-Milieu zu reflektieren, missachten die Individualität und damit<br />
die Würde des Menschen.<br />
Der einzelne Mensch existiert nicht nur für sich; er lebt nicht allein<br />
auf einer Insel, sondern unterliegt permanent soziokulturellen<br />
Einflussfaktoren.<br />
Wenn ein Mensch auf diese Einflüsse mit Symptombildung reagiert,<br />
so muss dies nicht bedeuten, dass die Symptome als solche<br />
pathologischer Natur seien; sie können auch die adäquate<br />
Reaktion gesunder Anteile auf pathogene Außenfaktoren bedeuten.<br />
Die <strong>Psychotherapie</strong> muss also auch diese Außenfaktoren analysieren<br />
und auf ihren pathogenen Gehalt überprüfen.<br />
Wir leben in einer Zeit, in der die Intensität wie auch die Quantität<br />
destruktiver Stressoren zunehmen.<br />
Diese Stressoren bedürfen einer tiefreichenden Analyse im Kontext<br />
jedes therapeutischen Settings und eines entsprechend anstehenden<br />
Paradigmenwechsels.<br />
Diese Analyse ergibt: Wir leben in einer Strömung, in der das Individuum<br />
zunehmend seine geistig-emotionale Heimat, seine<br />
ethische Orientierung und seine Verwurzelung im Glauben einbüßt.<br />
Das Individuum droht sich konsekutiv aufzulösen, zu zersplittern,<br />
seine innere Mitte, sein Kohärenzgefühl zu verlieren.<br />
Es geht deshalb immer weniger um neurotische Konflikte, sondern<br />
um frühe Störungen und Strukturpathologie in tiefgreifend<br />
gestörten Umfeldern.<br />
13. Jede Therapie, gleich ob verhaltenstherapeutischer oder tiefenpsychologischer<br />
Ausrichtung, welche sich auf die Behandlung<br />
abnorm erscheinender Splitter konzentriert und nicht die Fragmentierung<br />
als solche bedenkt, ist nicht an der Ursache orientiert<br />
und läuft zudem Gefahr, durch einen falschen Ansatz die<br />
Zersplitterung zu forcieren oder die Symptome auf einen anderen<br />
Splitter zu verschieben.<br />
14. Jede Diagnostik, die nur die Abnormität von Splittern charakterisiert,<br />
erliegt dem gleichen Irrtum.<br />
15. Jedes Qualitätsmanagement, das die „Qualität“ der Diagnostik<br />
und Behandlung als krankheitswertig eingeschätzter Splitter erfassen<br />
und kontrollieren soll, ohne soziokulturell bedingte Ursachen<br />
und die jeweilige Dynamik des Fragmentierungsprozesses<br />
zu erfassen, ist irreführend, absurd und bedeutet Zeitund<br />
Geldverschwendung.<br />
16. Eine „<strong>Psychotherapie</strong>-Szene“, die unter Ausblendung der genannten<br />
Fragmentierung in ermüdenden Diskussionen um<br />
überdetaillierte Diagnostik, nosologische Spezifikationen und<br />
Behandlungsansätze kreist, problematisiert und feiert sich am<br />
Wesentlichen vorbei, rennt in die Irre und wird selber zum Splitter<br />
im Zerplitterungsprozess, statt im Rahmen ihrer Möglichkeiten<br />
entgegenzusteuern.<br />
Und schließlich: Auch die Neurobiologie kann nicht das „Geheimnis<br />
unter der Oberfläche menschlichen Tuns“ entzaubern (Gott sei<br />
Dank!).<br />
Thomas Bartsch<br />
Veranstaltungen<br />
Weiterbildung, Kongresse, Reisen<br />
von<br />
bis<br />
Veranstaltung<br />
Kontakt<br />
2007-10-21<br />
2008-04-14<br />
2007-11-01<br />
2008-12-31<br />
2007-11-03<br />
2007-11-04<br />
2007-11-12<br />
2008-10-19<br />
2007-11-16<br />
2007-11-17<br />
2007-11-19<br />
2007-11-20<br />
2007-11-24<br />
2007-11-24<br />
2007-11-28<br />
2008-03-31<br />
2007-11-30<br />
2007-12-02<br />
2008-02-22<br />
2008-02-24<br />
2008-03-06<br />
2008-03-09<br />
2008-03-14<br />
2008-03-15<br />
Verhaltenstherapie als Gruppenverfahren: Zusatzausbildung, Veranstaltungsreihe beim AIM im VFKV<br />
in München<br />
Lehrgang Klinische- und Gesundheitspsychologie: Ausbildung der AVM zum Klinischen- und Gesundheitspsychologen<br />
Dauer: 3. SE Beginn: Oktober/November 2007<br />
EMDR-Vertiefungsseminar: Aktive Zukunftsorientierung und EMDR in der Behandlung von Komplextraumatisierten<br />
mit Steffen Bambach in Berlin. 16 FE, 296 Euro.<br />
Zusatzausbildung: zum/r Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeuten/in in VT (4 Seminarwochen)<br />
beim AIM im VFKV in München<br />
Fortbildung zum zertifizierten Fairness-Coach: Ausführliche Info unter <br />
Fritz Simon und Matthias Varga von Kibéd: Wieslocher Dialog: Tetralemma, Konstruktivismus und Strukturaufstellungen.<br />
Akkreditiertes Seminar<br />
Traumtag: Vorträge, Seminare, Workshop zum Thema Traum, u.a. Traumtheorien von C.G. Jung und die<br />
Neurowissenschaft. I. Riedel, V. Kast, C. B. Möller<br />
C.G.Jung: Fortbildung für Psych.u.Ärzte: 4 UE, monatl., Mittwoch 18:15 bis 21:15 Uhr C.G.Jung-Institut,<br />
RosenheimerStr.1,81667 Mü Beitrag jew. 20 Euro<br />
EMDR-Ausbildung in Königslutter: Zertifizierte EMDR-Ausbildung bei dem einzigen autorisierten Institut<br />
von F. Shapiro in Deutschland. Info: www.emdr.de<br />
Lorna Smith Benjamin/München: Behandlung schwerer Persönlichkeitsstörungen (SASB/IRT)<br />
Identitäten: Kloster Seeon Frühjahrstagung der DGAP<br />
Workshop in Hilden: Die Praxis der neuropsychologischen Begutachtung mit Dipl.-Psych. Herbert König<br />
32<br />
www.vfkv.de<br />
Tel.: 089/8346900<br />
Roswitha Gangl<br />
Tel: 0662/88 41 66<br />
Institut für Traumatherapie<br />
www.traumatherapie.de<br />
www.vfkv.de<br />
Tel.: 089/8346900<br />
Dr. Norbert Copray<br />
kontakt@fairness-stiftung.de<br />
www.wieslocher-institut.com<br />
C.G. Jung-Institut Zürich<br />
Tel. +41 44 914 10 47<br />
C.G.Jung-Institut München<br />
Tel. 089 2714050<br />
EMDR-Institut Deutschland<br />
02204-25866<br />
petra.grabowski@lvr.de<br />
dgap@cgjung.de;06201-492440<br />
Lankheit-Feilhuber<br />
Akademie bei König und Müller<br />
www.koenigundmueller.de<br />
bvvp-magazin 4/2007
Für uns gelesen<br />
Psychogramm des Bösen –<br />
„Kalteis“ von Andrea Maria<br />
Schenkel<br />
Andrea Maria Schenkel – Kalteis – Edition Nautilus<br />
-158 Seiten ISBN: 978-3894015497 12,90 Euro<br />
Es gibt Verbrechen, die entziehen sich einer<br />
schnellen psychologischen Analyse. Die Bayerische<br />
Autorin Andrea Maria Schenkel hat in<br />
ihrem sensationell erfolgreichen Debutroman<br />
„Tannöd“ versucht, einen scheinbar unfassbaren<br />
Mord in der scheinbar heilen Welt eines<br />
Dorfes durch eine kühle, distanzierte Sprache zugänglich<br />
zu machen. Jetzt hat sie ihren Stil verfeinert<br />
und schildert in einer Mischung aus Fiktion<br />
und Gerichtsdokumenten die unheilvolle Begegnung<br />
eines Serienmörders im München der<br />
Nazizeit mit einem Mädchen vom Lande, das die<br />
Abenteuer der Großstadt sucht. Wie Truman Capote<br />
in „Kaltblütig“ erreicht die Autorin durch<br />
den dokumentarischen Reporterblick Einsichten<br />
in die Psyche des Täters, die ihm selbst verborgen<br />
bleiben.<br />
Ortwin Löwa<br />
Plädoyer für eine evidenzbasierte<br />
Medizin – „Kranke Geschäfte“<br />
von Markus Grill<br />
Markus Grill – Kranke Geschäfte – Rowohlt TB –<br />
224 Seiten ISBN-13: 978-3498025090 16.90 Euro<br />
Was in der Medizin nachweisbar wirksam – evident<br />
– ist, hängt in unserem Gesundheitssystem<br />
leider nicht nur von der Wissenschaft ab,<br />
sondern häufig auch von mächtigen Interessengruppen,<br />
für die Einfluss und Profit über eine<br />
gründliche Evaluation gehen. Am Beispiel des<br />
Zusammenwirkens von Pharmakonzernen, Forschungsinstituten<br />
und Ärzten zeigt der Stern<br />
– Autor Markus Grill, welche verhängnisvollen<br />
Auswirkungen der Vorrang von Vermarktungsstrategien<br />
über wirksame Kontrollen bei Medikamenten<br />
hat. Im Zentrum stehen Auseinandersetzungen<br />
um kritische Analysen wie etwa im<br />
„Arzneiverordnungsreport“ oder dem „arznei –<br />
telegramm“ oder der Streit um das neu gegründete<br />
„Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit<br />
im Gesundheitswesen“. Vieles ist nicht neu,<br />
bvvp-magazin 4/2007<br />
aber in seiner zugespitzt – provozierenden Zusammenfassung<br />
heilsam aufrüttelnd.<br />
Ortwin Löwa<br />
Poetische Bilder zum Klingen gebracht<br />
– „Zwischenzeit“: Jazz und<br />
Lyrik von Thomas Bartsch und<br />
Andreas Müller – Oesterling<br />
Lyrik zu verfassen gehört zur hohen Schule der<br />
sprachlichen Kunst. Für Thomas Bartsch ist dies<br />
eine schöpferische Begleitung seines therapeutischen<br />
Alltags. Insofern gehören Sehnsüchte,<br />
Versagungen, Klagen und unaufgelöste Widersprüche<br />
zu den Themen seiner Gedichte. Poetische<br />
verdichtete Sprache lebt jedoch nicht<br />
nur vom bloßen Text, sondern auch vom Klang<br />
des Vortrags. Wird dieser Klang musikalisch untermalt,<br />
ergibt sich eine weitere Dimension der<br />
Empfindungen. Dieses Hörbild gestalten Thomas<br />
Bartsch und seine Frau Ulrike in der CD<br />
„Zwischenzeit“, begleitet vom Konzertpianisten<br />
Andreas Müller – Oesterling. Seine Jazzimprovisationen<br />
belauschen die Kraft der Worte und geben<br />
den Gedanken und Empfindungen Raum,<br />
sich treiben zu lassen. Zwischenzeit, das bedeutet<br />
Abschied und Erwartung, so wie die Amsel<br />
nach ihrem letzten Lied vom Gesang der Nachtigall<br />
träumt<br />
Ortwin Löwa<br />
Zwischenzeit – 12.00 Euro – Privatverlag Edition Astrup<br />
– Bestellungen über edition.astrup@t-online.de<br />
Survivalguide PiA – Die<br />
<strong>Psychotherapie</strong>-Ausbildung<br />
meistern<br />
Birgit Lindel, Ina Sellin, Springer Medizin Verlag<br />
Heidelberg, 2007, ISBN – 13 978-3-540-46851-6,<br />
19,90 €Euro<br />
33<br />
Neu in diesem Jahr erschienen ist der „Survivalguide<br />
PiA“ von Birgit Lindel und Ina Sellin, der<br />
sich an Studierende der Psychologie, Pädagogik<br />
und Sonderpädagogik, Ausbildungsteilnehmer,<br />
Dozenten, Lehrtherapeuten, Supervisoren<br />
und Selbsterfahrungsleiter sowie an alle Interessierten<br />
wendet. Nicht angesprochen werden die<br />
KollegInnen, die sich zum ärztlichen Psychotherapeuten<br />
ausbilden lassen, da sich dieses Buch<br />
auf die PP/KJP konzentriert.<br />
Die 12 Kapitel – von der Einleitung, dem<br />
Überblick über die Ausbildungsarten, der Suche<br />
nach dem „passenden Ausbildungsinstitut“,<br />
den Erläuterungen zu den einzelnen Ausbildungsbausteinen<br />
bis hin zur Prüfung und der<br />
„Zeit danach“ sind gespickt mit Informationen<br />
auf rund 350 Seiten. 21 Abbildungen und 13<br />
Tabellen erleichtern die Übersichtlichkeit. Die<br />
Inhalte werden mit Hilfe von Cartoons aufzulockern<br />
versucht. Dennoch gelingt dies nicht<br />
durchgängig. Trotz des fast humoristischen Titels<br />
breitet die Lektüre vor dem Leser eine recht<br />
trockene Materie aus.<br />
Ein gelungene Idee sind die Kurzinterviews<br />
am Ende fast aller Kapitel, in denen derzeitige<br />
und ehemalige PiAs von ihren eigenen Erfahrungen<br />
berichten.<br />
Zu diskutieren wäre darüber, ob manche<br />
Texte so ausführlich wiedergegeben werden<br />
müssen. So werden viele Gesetze und Verordnungen<br />
seitenweise zitiert, auch Lehrpläne einzelner<br />
Institute aus dem Internet wiedergegeben.<br />
Wünschenswert wären stattdessen viele<br />
andere Informationen. Obgleich immer wieder<br />
Hinweise auf die Ausbildungsbedingungen im<br />
Bereich der KJP gegeben werden, kommt zum<br />
Beispiel dieser Bereich viel zu kurz. Dazu gehören<br />
fehlende Hinweise auf Besonderheiten<br />
in der Diagnostik oder das Stundenkontingent,<br />
das sich bei der Antragstellung um Bezugspersonenstunden<br />
noch erhöht, um hier einige Beispiele<br />
zu nennen.<br />
Während man bezüglich der Inhalte dieses<br />
Buches noch durchaus unterschiedlicher Meinung<br />
sein kann, fehlen – gemessen am Titel,<br />
der die Erwartung auf „Überlebens-Tipps“ weckt<br />
– „Insider-Tipps“ für die bestmögliche Bewältigung<br />
dieser Ausbildung. Gemeint wären hier<br />
konkrete Angaben, wie man sich in der PiA-Zeit<br />
organisieren könnte, um am Ende gut gewappnet<br />
für die Prüfungen und die „Zeit danach“ zu<br />
sein. Viele kleine Details könnten dargelegt werden,<br />
die das „Überleben“ in der Ausbildung tatsächlich<br />
erleichtern, insbesondere im Hinblick<br />
auf das Selbstmanagement der Ausbildungsteilnehmer.<br />
Dazu gehören auch Rolle und Aufgaben<br />
von Mentoren, wozu nur wenige Angaben<br />
gemacht werden. An anderen Stellen hingegen
Für uns gelesen<br />
gehen die Autoren so ins Detail, dass es wundert:<br />
Als „Tipp“ im Kapitel Prüfung wird dem<br />
Leser jedoch der Hinweis gegeben: „Planen Sie<br />
genügend Zeit für die Anreise zu den Prüfungsräumlichkeiten<br />
ein, insbesondere dann, wenn Sie<br />
weiter entfernt wohnen oder nicht genau wissen,<br />
wo sich die Räume befinden.“<br />
Auch bei den wenig detaillierten Angaben zur<br />
Zusatzausbildung zur Gruppentherapie finden<br />
sich keine eindeutigen Hinweise darauf, dass es<br />
von Beginn an wichtig wäre, sich darüber Gedanken<br />
zu machen, ob man an Gruppenarbeit Spaß<br />
Adressen<br />
bvvp Baden-Württemberg<br />
(Arbeitsgemeinschaft der 4 bvvp-Landesverbände<br />
Nordbaden, Südbaden, Nordwürttemberg,<br />
Südwürttemberg)<br />
Sekretariat: Frau Stickel<br />
Vorsitzende: Frau Dr. med. Regine Simon,<br />
FÄ für Psychotherapeutische Medizin,<br />
Psychoanalyse<br />
Schwimmbadstr. 22, 79100 Freiburg,<br />
Tel: (0761) 70438749<br />
Fax: (0761) 7072407<br />
E-Mail: bvvp-bw@bvvp.de<br />
mit den regionalen Verbänden:<br />
Nordbaden (VVPN) Geschäftsstelle:<br />
Dr. med Knoke, Michael, Nervenarzt,<br />
<strong>Psychotherapie</strong>, Psychoanalyse<br />
Sekretariat: Frau Pfeiffer<br />
Otto-Beck-Str. 12, 68165 Mannheim<br />
Tel. (Prax.): 0621- 26183<br />
Fax: 0621- 1222590<br />
E-mail: vvpn-bureau@t-online.de<br />
Nordwürttemberg (VVPNW)<br />
Dr. med. Helga Ströhle<br />
c/o Geschäftsstelle Frau Bosch<br />
Blücherstr. 10, 89547 Gerstetten<br />
Tel.: 07323-5695 oder 96160<br />
Fax: 07323-3691<br />
e-mail: vvpnw@bvvp.de<br />
Süd-Württemberg (VVPSW)<br />
Sekretariat: Elisabeth Bosch<br />
Blücherstraße 10, 89547 Gerstetten,<br />
Telefon: 07323-96160, Fax: 07323-3691<br />
E-mail: vvpsw@bvvp.de<br />
Südbaden (VVPS e.V.) Geschäftsstelle:<br />
Schwimmbadstraße 22, 79100 Freiburg<br />
(Sekretariat Frau Stickel)<br />
Tel. 0761- 7072153<br />
Fax: 0761-7072163<br />
E-mail: vvps@bvvp.de<br />
Bayern (<strong>BVVP</strong> Bayern)<br />
Geschäftsstelle:<br />
Nußbaumstraße 4, 80336 München<br />
hätte. Denn wer das erst am Ende der Ausbildung<br />
feststellt, muss mit erheblichem Mehraufwand<br />
rechnen – ein ärgerliches Unterfangen.<br />
Verwundern mag so manchen Lesern auch<br />
die eine oder andere Formulierung oder Verallgemeinerung<br />
von Verhaltensweisen. So schreiben<br />
die beiden Autorinnen von „mangelnder Qualität<br />
der Dozenten“, von „so genannten Drehtürpatienten“<br />
(gemeint sind Patienten mit einer chronischen<br />
Erkrankung) oder von Patienten, die „Erkrankungen<br />
präsentieren“. Ärgerlich auch immer<br />
wieder die fast ausschließliche Bezugnahme in<br />
Sekreteriat: Frau Sehrer<br />
Tel: (089) 417 686 01<br />
Fax: (089) 417 686 02<br />
E-mail: info@bvvp-bayern.de<br />
Berlin (VVP Berlin)<br />
Grunert, Michael, Dipl.-Psych.<br />
Heinrich-Roller-Straße 20, 10405 Berlin<br />
Tel.: 030- 440 515 61 Fax: 030- 440 47 111 E-<br />
Mail: vvp-berlin@gmx.de<br />
Brandenburg (BVP Brandenburg)<br />
Dr. med. Stephan Alder<br />
Stephensonstr. 16, 14482 Potsdam<br />
Tel.: 0331-7409500 Fax: 0331-7409615<br />
Email: Dr.Alder@t-online.de<br />
Hamburg (bvvp Hamburg)<br />
Geschäftsstelle:<br />
Dipl.-Psych. Beate Glüsing<br />
Klapperhof 2, 21033 Hamburg<br />
Tel.: 040-726 92 778 Fax: 040-726 92 688<br />
Geschäftsstelle:<br />
E-mail: bvvp-Hamburg@bvvp.de<br />
Hessen (VHVP)<br />
Dr. med. Meinhard Korte, FA für<br />
Psychotherapeutische Medizin,<br />
Psychoanalytiker<br />
Gluckstraße 10, 63452 Hanau<br />
Tel. 06181/ 98 21 86<br />
Fax: 06181 / 98 21 87,<br />
E-mail: vhvp@bvvp.de<br />
Mecklenburg-Vorpommern<br />
(Landesverband M-V im bvvp)<br />
Dr. Christiane Kirchner<br />
Knieperdamm 7, 18435 Stralsund<br />
Tel.: 03831-304 940 Fax: 03831-304 051<br />
E-mail: info@kirchner.uhlenhaus.de<br />
Niedersachsen (bvvp Nds)<br />
Dr. med. Jörg K. Merholz<br />
Bombergallee 1, 31812 Bad Pyrmont<br />
Tel.: 05281-151 172 Fax: 05281-151 171<br />
E-Mail: merholz@bvvp-nds.de<br />
34<br />
den Formulierungen auf Psychologen. Vielleicht<br />
wäre den Autoren dazu zu raten, bei der sicher<br />
wünschenswerten 2. Auflage ihre Zielgruppe auf<br />
diejenigen zu beschränken, für die sie eigentlich<br />
schreiben und für die sie wirklich gute Informationen<br />
zur Verfügung stellen.<br />
Am Ende es Buches sind viele nützliche Anschriften<br />
aufgelistet. Dazu auch die von Berufsverbänden<br />
mit kurzen Hinweisen zu deren<br />
Schwerpunkten. Der bvvp müsste in einer<br />
nächsten Auflage allerdings hier noch ergänzt<br />
werden.<br />
Ariadne Sartorius<br />
Nordrhein (RVN)<br />
Büroservice Elke Schumacher<br />
Charles-Wimar-Str. 57, 53125 Bonn<br />
Tel: 0228-9180244/ Fax: 0228 9180245<br />
E-mail: rvn.buero@arcor.de<br />
Rheinland-Pfalz<br />
(bvvp Rheinland-Pfalz)<br />
Jörg Ebert<br />
Am Sportfeld 6, 55124 Mainz<br />
Tel: 06131-943191<br />
Fax: 0721-1515 75 924<br />
e-mail: praxis@dr-joerg-ebert.de<br />
Saarland (VVPSaar)<br />
Rita Marzell<br />
Neugrabenweg 18, 66123 Saarbrücken<br />
Tel: 0681-3904580/ Fax: 0681 93815307<br />
E-mail: ritamarzellsaar@t-online.de<br />
Sachsen (bvvp)<br />
Sabine Schmitt-Drees<br />
Zum Weißiger Kirchsteig 12<br />
01454 Ullersdorf<br />
Tel: 03528-410016/ Fax: 03528 410016<br />
E-mail: S.Schmitt-Drees@12move.de<br />
Schleswig-Holstein (BVP SH)<br />
Ulla Schüffelgen-Daus<br />
Hohelandstr. 58, 23564 Lübeck<br />
Tel: 0451-581424/ Fax: 0451 7060778<br />
E-mail: U.Schueffelgen-Daus@gmx.com<br />
Westfalen-Lippe (AGVP)<br />
Martin Kremser, Dr.med., Facharzt für<br />
Psychotherapeutische Medizin<br />
Bruchstr.34 32756 Detmold<br />
Tel: 05231-32220 / Fax: 05231 31033<br />
E-mail: martin.kremser@freenet.de<br />
AGVP Büro Frau Annegret Floer<br />
Sellen 59, 48565 Burgsteinfurt<br />
Tel.: 02551-82522 Fax: 02551-4954<br />
E-mail: JA.Floer@t-online.de<br />
bvvp-magazin 4/2007
Neuerscheinungen<br />
und<br />
Bücher zum Schwerpunkt<br />
Antipsychiatrie<br />
Verlag<br />
Statt Psychiatrie 2. Stastny, P.;<br />
Lehmann, P. ISBN:<br />
9783925931383. 24.90 <br />
Alternatives Beyond Psychiatry.<br />
Stastny, P.; Lehmann, P. ISBN:<br />
9780954542818. 24.90 <br />
Argument<br />
Sozialpsychiatrie. Persönliche<br />
Assistenz, Empowerment. Beschäftigungsverhältnisse<br />
in<br />
der Sozialen Arbeit. Evaluationsforschung,<br />
Erinnerungsarbeit.<br />
Osterkamp, U. (Forum Kritische<br />
Psychologie Bd 51). ISBN:<br />
9783886197897. 13.00 <br />
Asanger<br />
Einsatzkräfte im Stress. Auswirkungen<br />
von traumatischen Belastungen<br />
im Dienst. Krampl, M.<br />
ISBN: 9783893344864. 25.00 <br />
Ellen West. Gedichte, Prosatexte,<br />
Tagebücher, Krankengeschichte.<br />
Akavia, N.; Hirschmüller, A. ISBN:<br />
9783893344840. 25.00 <br />
Frühes Trauma und Strukturdefizit.<br />
Ein psychoanalytischimginativ<br />
orientierter Ansatz zur<br />
Bearbeitung früher und komplexer<br />
Traumatisierungen. Hochauf, R.<br />
ISBN: 9783893344857. 29.00 <br />
Kausale <strong>Psychotherapie</strong>. Manual<br />
zur ätiologieorientierten Behandlung<br />
psychotraumatischer<br />
und neurotischer Störungen.<br />
Fischer, G. ISBN:<br />
9783893344352. 60.00 <br />
Traumatische Ereignisse in<br />
einer globalisierten Welt. Interkulturelle<br />
Bewältigungsstrategien,<br />
psychologische Erstbetreuung und<br />
Therapie. Boege, K.; Manz, R. ISBN:<br />
9783893344833. 22.00 <br />
Auditorium Netzwerk<br />
Geist und Gehirn I. Spitzer, M.<br />
ISBN: 9783830285069. 19.95 <br />
bvvp-magazin 4/2007<br />
Geist und Gehirn II. Spitzer, M.<br />
ISBN: 9783830285076. 19.95 <br />
Geist und Gehirn III. Spitzer, M.<br />
ISBN: 9783830285083. 19.95 <br />
Geist und Gehirn IV. Spitzer, M.<br />
ISBN: 9783830285090. 19.95 <br />
BALANCE<br />
Das Schluss-mit-dem-Eiertanz-<br />
Arbeitsbuch. Für Angehörige von<br />
Menschen mit Borderline.<br />
Kreger, R.; Shirley, J. (Balance<br />
Ratgeber). ISBN: 9783867390118.<br />
15.90 <br />
Das Unglück der kleinen Giftmischerin.<br />
Und zehn weitere Geschichten<br />
aus der Forensik.<br />
Wulff, E. ISBN: 9783867390156.<br />
13.90 <br />
Umgang mit Psychopharmaka.<br />
Ein Patienten-Ratgeber. Greve, N.;<br />
Osterfeld, M.; Diekmann, B. (Balance<br />
Ratgeber). ISBN:<br />
9783867390026. 14.90 <br />
borgmann<br />
Lösungsorientierte Therapie ....<br />
...was hilft, wenn nichts hilft. Anregungen,<br />
Erfahrungen, Ideen.<br />
Hargens, J. ISBN:<br />
9783861452997. 9.60 <br />
Wenn Lösungen Gestalt annehmen.<br />
Externalisieren in der<br />
kreativen Kindertherapie. Vogt, M.<br />
ISBN: 9783861453000. 19.80 <br />
Carl-Auer-Systeme<br />
Berauschte Sehnsucht. Zur ambulanten<br />
systemischen Therapie<br />
süchtigen Trinkens. Klein, R. ISBN:<br />
9783896704924. 24.90 <br />
Die Stimme des Kindes in der<br />
Familientherapie. Gammer, C.<br />
ISBN: 9783896705389. 29.95 <br />
Einführung in die Praxis der<br />
systemischen Therapie und Beratung.<br />
Klein, R.; Kannicht, A.<br />
ISBN: 9783896705716. 12.95 <br />
Einführung in die systemische<br />
Paartherapie. Welter-<br />
Enderlin, R. ISBN:<br />
9783896704726. 12.95 <br />
Einführung in Lösungsfokussierung<br />
und Systemische<br />
Strukturaufstellungen.<br />
Sparrer, I. ISBN: 9783896705419.<br />
12.95 <br />
Gruppendynamik und die Professionalisierung<br />
psychosozialer<br />
Berufe. König, O. ISBN:<br />
9783896705792. 24.95 <br />
Paartherapie - Bewegende<br />
Interventionen. El-Hachimi, M.;<br />
Stephan, L. ISBN:<br />
9783896705846. 19.95 <br />
Pirouetten im Supermarkt.<br />
Strategische Interventionen für<br />
Therapie und Selbsthilfe.<br />
Nardone, G. ISBN:<br />
9783896706003. 19.95 <br />
Wie kann ich Ihnen helfen,<br />
mich wieder loszuwerden?.<br />
Therapie und Beratung in Zwangskontexten.<br />
Conen, M.; Cecchin, G.<br />
ISBN: 9783896705129. 29.95 <br />
Wie Salz in der Suppe. Aktionsmethoden<br />
für den beraterischen<br />
Alltag. Lauterbach, M. ISBN:<br />
9783896706089. 24.95 <br />
Deutscher<br />
Psychologen Verlag<br />
Tödliche Gedanken. Prävention<br />
und Therapie der Suizidalität.<br />
Junglas, J. (Beiträge zur allgemeinen<br />
<strong>Psychotherapie</strong> 5). ISBN:<br />
9783931589820. 22.80 <br />
Edition<br />
Psychosymbolik<br />
«Bruch-Teile». Scriptum, Zwischen<br />
Genuss und Leben.<br />
Vorträge gehalten am Institut für<br />
Psychosymbolik - IPV e.V., München<br />
2003-2006. Danis, J. (Psychosymbolik).<br />
ISBN:<br />
9783925350801. 30.00 <br />
35<br />
EHP Verlag Andreas<br />
Kohlhage<br />
Pflück dir den Traum vom<br />
Baum der Erkenntnis. Träume<br />
im Spiegel von Naturgesetzen - Ein<br />
Lehrbuch für die Arbeit mit Träumen.<br />
Grön, O. (Schriften der Bayerischen<br />
Akademie für Gesundheit).<br />
ISBN: 9783897970458. 40.00 <br />
Charakter-Transformation. Erkennen<br />
- verändern - heilen.<br />
Johnson, S. ISBN:<br />
9783897970427. 28.00 <br />
Hogrefe<br />
EMDR und Biofeedback in der<br />
Behandlung von posttraumatischen<br />
Belastungsstörungen.<br />
Ein neuropsychotherapeutisches<br />
Behandlungsprogramm. Jacobs, S.;<br />
Jong, A. (Therapeutische Praxis).<br />
ISBN: 9783801720391. 24.95 <br />
Evidenzbasierte Leitlinie zur<br />
<strong>Psychotherapie</strong> Affektiver Störungen.<br />
Jong-Meyer, R.;<br />
Hautzinger, M.; Kühner, C.;<br />
Schramm, E. (Evidenzbasierte Leitlinien<br />
<strong>Psychotherapie</strong> 1). ISBN:<br />
9783801720704. 19.95 <br />
KIDS 2 - Geistige Behinderung<br />
und schwere Entwicklungsstörung.<br />
Sarimski, K.; Steinhausen, H.<br />
(KIDS Kinder-Diagnostik-System<br />
2). ISBN: 9783801719456.<br />
69.95 <br />
Sonderpädagogik des Lernens.<br />
Walter, J.; Wember, F. (Handbuch<br />
Sonderpädagogik Bd 2). ISBN:<br />
9783801717094. 99.95 <br />
Zwangsstörungen. Ein systemisch-integratives<br />
Behandlungskonzept.<br />
Tominschek, I.;<br />
Schiepek, G. (Praxis der Paar- und<br />
Familientherapie 4). ISBN:<br />
9783801718886. 24.95 <br />
Klett-Cotta<br />
Gestalttherapie. Zur Praxis der<br />
Wiederbelebung des Selbst.<br />
Perls, F.; Hefferline, R.;<br />
Goodman, P. ISBN:<br />
9783608944358. 24.50 <br />
Pflegekinder und ihre Entwicklungschancen<br />
nach frühen<br />
traumatischen Erfahrungen.<br />
Nienstedt, M.; Westermann, A.<br />
ISBN: 9783608960075. 32.00 <br />
Psychoanalytische und tiefenpsychologisch<br />
fundierte Therapie<br />
mit Jugendlichen. Seiffge-<br />
Krenke, I. ISBN: 9783608944402.<br />
34.00 <br />
Transfer - Von der Psychotheraphie<br />
in den Alltag. Konzepte<br />
der Humanwissenschaften.<br />
König, K. ISBN: 9783608944723.<br />
22.00 <br />
Von der Angst, Psychoanalytiker<br />
zu sein. Das Durcharbeiten<br />
der phobischen Position.<br />
Zwiebel, R. ISBN:<br />
9783608944761. 29.50 <br />
Peter Lang<br />
Geschichte der ostdeutschen<br />
Musiktherapie. Entwicklung -<br />
Selbstverständnis - gesellschaftspolitischer<br />
und wissenschaftstheoretischer<br />
Kontext. Jürgens, P. (Europäische<br />
Hochschulschriften -<br />
Reihe VI 747). ISBN:<br />
9783631562963. 56.50 <br />
Tiergestützte Kinderpsychotherapie.<br />
Theorie und Praxis der<br />
tiergestützten <strong>Psychotherapie</strong> bei<br />
Kindern und Jugendlichen.<br />
Prothmann, A. ISBN:<br />
9783631552933. 39.80 <br />
Psychiatrie-Verlag<br />
CRA-Manual zur Behandlung<br />
von Alkoholabhängigkeit. Erfolgreicher<br />
behandeln durch positive<br />
Verstärkung im sozialen Bereich.<br />
Meyers, R.; Smith, J. (Fachbuch).<br />
ISBN: 9783884144329.<br />
29.90 <br />
Medikamentenbehandlung bei<br />
psychischen Störungen.<br />
Finzen, A. (Basiswissen). ISBN:<br />
9783884144299. 14.90 <br />
Psychosen verstehen. Modelle<br />
der Subjektorientierung und ihre<br />
Bedeutung für die Praxis.<br />
Lütjen, R. (Fachbuch). ISBN:<br />
9783884144336. 19.90
Neuerscheinungen und Bücher zum Schwerpunkt<br />
Recovery. Das Ende der Unheilbarkeit.<br />
Amering, M.; Schmolke, M.<br />
(Fachbuch). ISBN: 9783884144213.<br />
24.90 <br />
Seelische Erkrankung, Religion<br />
und Sinndeutung. Mönter, N.<br />
(Fachbuch). ISBN: 9783884144190.<br />
19.90 <br />
Sexualmörder - Sexualtäter -<br />
Sexualopfer. Marneros, A. (Edition<br />
Das Narrenschiff). ISBN:<br />
9783884144237. 29.90 <br />
Supervision und Beratung in der<br />
Psychiatrie. Heltzel, R. (Basiswissen).<br />
ISBN: 9783884144312.<br />
14.90 <br />
Umgang mit depressiven Patienten.<br />
Mahnkopf, A. (Basiswissen).<br />
ISBN: 9783884144183. 14.90 <br />
Psychosozial-Verlag<br />
Das Unverstehbare verstehen.<br />
Acht forensisch-psychologische Täterbegutachtungen<br />
im Strafprozess.<br />
Maisch, H. Rode, I.; Jacobs, G. (edition<br />
psychosozial). ISBN:<br />
9783898067447. 19.90 <br />
Die Krise der Männlichkeit. In der<br />
unerwachsenen Gesellschaft.<br />
Richter, H. (edition psychosozial).<br />
ISBN: 9783898065702. 19.90 <br />
Im Schatten des Ruhms. Erinnerungen<br />
an meinen Vater Erik H. Erikson.<br />
Erikson Bloland, S. (Bibliothek<br />
der Psychoanalyse). ISBN:<br />
9783898065016. 22.90 <br />
Immigration und Identität. Psychosoziale<br />
Aspekte und kulturübergreifende<br />
Therapie. Akhtar, S. Utari-<br />
Witt, H. (Bibliothek der Psychoanalyse).<br />
ISBN: 9783898065900.<br />
22.90 <br />
Leben in Patchwork-Familien.<br />
Halbschwestern, Stiefväter und wer<br />
sonst noch dazugehört.<br />
Bliersbach, G. (edition psychosozial).<br />
ISBN: 9783898067430. 19.90 <br />
Löwin im Dschungel. Blinde und<br />
sehbehinderte Menschen zwischen<br />
Stigma und Selbstwerdung. Glofke-<br />
Schulz, E. (edition psychosozial).<br />
ISBN: 9783898067355. 34.90 <br />
Schattauer<br />
Affekttaten und Impulstaten.<br />
Forensische Beurteilung von Affektdelikten.<br />
Marneros, A. ISBN:<br />
9783794525171. 69.00 <br />
Intimizid - Die Tötung des Intimpartners.<br />
Ursachen, Tatsituationen<br />
und forensische Beurteilung.<br />
Marneros, A. ISBN:<br />
9783794524143. 69.00 <br />
Kognitive Verhaltenstherapie<br />
der Adipositas. Cooper, Z.;<br />
Fairburn, C.; Hawker, D. ISBN:<br />
9783794525430. 49.00 <br />
Neurologische Begutachtung.<br />
Einführung und praktischer Leitfaden.<br />
Hausotter, W. ISBN:<br />
9783794524051. 39.95 <br />
Sexualstraftaten. Forensische Begutachtung,<br />
Diagnostik und Therapie.<br />
Schläfke, D.; Hässler, F.;<br />
Fegert, J. ISBN: 9783794523320.<br />
49.95 <br />
Springer<br />
Neuropsychologie der Schizophrenie.<br />
Symptome, Kognition und<br />
Gehirn. Kircher, T.; Gauggel, S. ISBN:<br />
9783540711469. 79.95 <br />
Psychische Erkrankungen in der<br />
Hausarztpraxis. Schneider, F.;<br />
Niebling, W. ISBN: 9783540711445.<br />
59.95 <br />
Psychopharmakologischer Leitfaden<br />
für Klinische Psychologen<br />
und Psychotherapeuten. Inklusive<br />
Psychopharmakotherapie im Kindesund<br />
Jugendalter. Benkert, O.;<br />
Hautzinger, M.; Graf-<br />
Morgenstern, M. ISBN:<br />
9783540479574. 34.95 <br />
Schmerzpsychotherapie. Grundlagen<br />
- Diagnostik - Krankheitsbilder -<br />
Behandlung. Kröner-Herwig, B.;<br />
Frettlöh, J.; Klinger, R.; Nilges, P.<br />
ISBN: 9783540722816. 59.95 <br />
Stressbewältigung für Kinder<br />
und Jugendliche. Lohaus, A.;<br />
Domsch, H.; Fridrici, M. ISBN:<br />
9783540739425. 22.95 <br />
Praxishandbuch ADHS. Diagnostik<br />
und Therapie für alle Altersstufen.<br />
Kahl, K.; Puls, J.; Schmid, G. ISBN:<br />
9783131430212. 29.95 <br />
<strong>Psychotherapie</strong> der Borderline-<br />
Störungen. Krankheitsmodelle und<br />
Therapiepraxis - störungsspezifisch<br />
und schulenübergreifend.<br />
Dammann, G.; Janssen, P. (Lindauer<br />
<strong>Psychotherapie</strong>-Module). ISBN:<br />
9783131268624. 29.95 <br />
<strong>Psychotherapie</strong> der Depression.<br />
Krankheitsmodelle und Therapiepraxis<br />
- störungsspezifisch und schulenübergreifend.<br />
Schauenburg, H.;<br />
Hofmann, B. (Lindauer <strong>Psychotherapie</strong>-Module).<br />
ISBN: 9783131260628.<br />
29.95 <br />
Urban & Fischer<br />
ABC der Verhaltensänderung.<br />
Der Leitfaden für erfolgreiche Prävention<br />
und Gesundheitsförderung.<br />
Kerr, J.; Weitkunat, R.; Moretti, M.<br />
ISBN: 9783437481604. 39.95 <br />
Akute psychische Erkrankungen.<br />
Management und Therapie.<br />
Hewer, W.; Rössler, W. ISBN:<br />
9783437228803. 79.95 <br />
Kognitive Verhaltenstherapie bei<br />
Krebspatienten. Ein praktisches<br />
Therapiemanual. Moorey, S.;<br />
Greer, S. ISBN: 9783437244308.<br />
39.95 <br />
Lexikon Psychiatrie, <strong>Psychotherapie</strong>,<br />
Medizinische Psychologie.<br />
Peters, U. ISBN: 9783437150616.<br />
39.95 <br />
Psychoedukation Borderline-<br />
Störung. Manual zur Leitung von<br />
Patienten- und Angehörigengruppen.<br />
Rentrop, M.; Reicherzer, M.; Bäuml, J.<br />
ISBN: 9783437227462. 39.95 <br />
Vandenhoeck &<br />
Ruprecht<br />
Der Arztphilosoph Viktor von<br />
Weizsäcker. Leben und Werk im<br />
Überblick. Benzenhöfer, U. ISBN:<br />
9783525491270. 26.90 <br />
Fachliteratur<br />
von Springer!<br />
.<br />
NEU<br />
DAS Fachbuch zum Thema<br />
„school shootings“<br />
Arbeitsmaterialien für Lehrer und<br />
Schulpsychologen<br />
Checklisten für den Ernstfall<br />
2007. 246 S. 46 Abb. Geb.<br />
€ (D) 29,95; € (A) 30,79; sFr 46,00<br />
ISBN 978-3-540-71630-3<br />
.<br />
NEUAUFLAGE<br />
Checklisten für die Beurteilung von<br />
Gutachten – auch für Fachfremde<br />
Entspricht den Richtlinien<br />
der deutschen Psychologen-<br />
Vereinigungen<br />
5., vollst. überarb. Aufl. 2007. Etwa 280 S. Geb.<br />
ca. € (D) 44,95; ca. € (A) 46,21; ca. sFr 69,00<br />
ISBN 978-3-540-46837-0<br />
Nach dem bewaffneten Kampf.<br />
Ehemalige Mitglieder der RAF und<br />
Bewegung 2. Juni sprechen mit Therapeuten<br />
über ihre Vergangenheit.<br />
Holderberg, A. (Psyche und Gesellschaft).<br />
ISBN: 9783898065887.<br />
19.90 <br />
Schopenhauers Stachelschweine.<br />
<strong>Psychotherapie</strong>geschichten über die<br />
Nähe und ihre Tücken. Luepnitz, D.<br />
(edition psychosozial). ISBN:<br />
9783898065771. 22.90 <br />
Thieme<br />
Forensische Psychiatrie. Klinik,<br />
Begutachtung und Behandlung zwischen<br />
Psychiatrie und Recht.<br />
Nedopil, N. ISBN: 9783131034533.<br />
119.95 <br />
Praxis der <strong>Psychotherapie</strong>. Ein<br />
integratives Lehrbuch. Senf, W.;<br />
Broda, M. ISBN: 9783131060945.<br />
119.95 <br />
Waxmann<br />
Neue Vaterschaft. Vater-Kind-<br />
Beziehung auf Distanz.<br />
Watzlawik, M.; Ständer, N.;<br />
Mühlhausen, S. ISBN:<br />
9783830918486. 24.90 <br />
Vom Urvertrauen zum Selbstvertrauen.<br />
Das Bindungskonzept in der<br />
emotionalen und psychosozialen<br />
Entwicklung des Kindes. Posth, R.<br />
ISBN: 9783830917977. 29.90 <br />
070227x<br />
Jetzt in Ihrer Buchhandlung.<br />
€ (D) sind gebundene Ladenpreise in Deutschland und enthalten 7% MwSt;<br />
€ (A) sind gebundene Ladenpreise in Österreich und enthalten 10% MwSt.<br />
sFr sind unverbindliche Preisempfehlungen. Preisänderungen und Irrtümer<br />
vorbehalten.<br />
springer.de<br />
<br />
070227x_057x256ma_4c.indd 1<br />
09.08.2007 10:02:16 Uhr