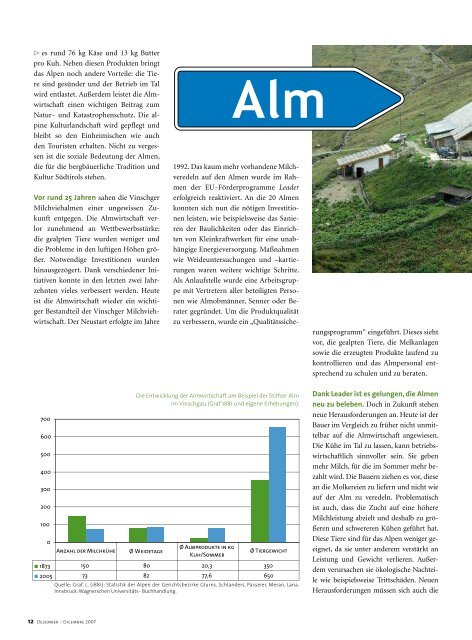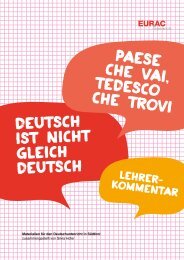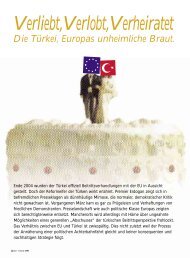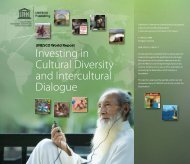Download - EURAC
Download - EURAC
Download - EURAC
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
es rund 76 kg Käse und 13 kg Butter<br />
pro Kuh. Neben diesen Produkten bringt<br />
das Alpen noch andere Vorteile: die Tiere<br />
sind gesünder und der Betrieb im Tal<br />
wird entlastet. Außerdem leistet die Almwirtschaft<br />
einen wichtigen Beitrag zum<br />
Natur - und Katastrophenschutz. Die alpine<br />
Kulturlandschaft wird gepflegt und<br />
bleibt so den Einheimischen wie auch<br />
den Touristen erhalten. Nicht zu vergessen<br />
ist die soziale Bedeutung der Almen,<br />
die für die bergbäuerliche Tradition und<br />
Kultur Südtirols stehen.<br />
Vor rund 25 Jahren sahen die Vinschger<br />
Milchviehalmen einer ungewissen Zukunft<br />
entgegen. Die Almwirtschaft verlor<br />
zunehmend an Wettbewerbsstärke:<br />
die gealpten Tiere wurden weniger und<br />
die Probleme in den luftigen Höhen größer.<br />
Notwendige Investitionen wurden<br />
hinausgezögert. Dank verschiedener Initiativen<br />
konnte in den letzten zwei Jahrzehnten<br />
vieles verbessert werden. Heute<br />
ist die Almwirtschaft wieder ein wichtiger<br />
Bestandteil der Vinschger Milchviehwirtschaft.<br />
Der Neustart erfolgte im Jahre<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
1992. Das kaum mehr vorhandene Milchveredeln<br />
auf den Almen wurde im Rahmen<br />
der EU - Förderprogramme Leader<br />
erfolgreich reaktiviert. An die 20 Almen<br />
konnten sich nun die nötigen Investitionen<br />
leisten, wie beispielsweise das Sanieren<br />
der Baulichkeiten oder das Einrichten<br />
von Kleinkraftwerken für eine unabhängige<br />
Energieversorgung. Maßnahmen<br />
wie Weideuntersuchungen und –kartierungen<br />
waren weitere wichtige Schritte.<br />
Als Anlaufstelle wurde eine Arbeitsgruppe<br />
mit Vertretern aller beteiligten Personen<br />
wie Alm obmänner, Senner oder Berater<br />
gegründet. Um die Produktqualität<br />
zu verbessern, wurde ein „Qualitätssiche-<br />
Die Entwicklung der Almwirtschaft am Beispiel der Stilfser Alm<br />
im Vinschgau (Graf 1881 und eigene Erhebungen).<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Quelle: Graf, L. (1881): Statistik der Alpen der Gerichtsbezirke Glurns, Schlanders, Passeier, Meran, Lana.<br />
Innsbruck: Wagnerschen Universitäts - Buchhandlung.<br />
rungsprogramm“ eingeführt. Dieses sieht<br />
vor, die gealpten Tiere, die Melkanlagen<br />
sowie die erzeugten Produkte laufend zu<br />
kontrollieren und das Almpersonal entsprechend<br />
zu schulen und zu beraten.<br />
Dank Leader ist es gelungen, die Almen<br />
neu zu beleben Doch in Zukunft stehen<br />
neue Herausforderungen an. Heute ist der<br />
Bauer im Vergleich zu früher nicht unmittelbar<br />
auf die Almwirtschaft angewiesen.<br />
Die Kühe im Tal zu lassen, kann betriebswirtschaftlich<br />
sinnvoller sein. Sie geben<br />
mehr Milch, für die im Sommer mehr bezahlt<br />
wird. Die Bauern ziehen es vor, diese<br />
an die Molkereien zu liefern und nicht wie<br />
auf der Alm zu veredeln. Problematisch<br />
ist auch, dass die Zucht auf eine höhere<br />
Milchleistung abzielt und deshalb zu größeren<br />
und schwereren Kühen geführt hat.<br />
Diese Tiere sind für das Alpen weniger geeignet,<br />
da sie unter anderem verstärkt an<br />
Leistung und Gewicht verlieren. Außerdem<br />
verursachen sie ökologische Nachteile<br />
wie beispielsweise Trittschäden. Neuen<br />
Herausforderungen müssen sich auch die<br />
Almwirtschaft bedeutet gesündere Tiere, Entlastung<br />
für den Betrieb im Tal, Erhalt einer Jahrhunderte alten<br />
Kulturlandschaft.<br />
Eigentümer der „Interessentschafts almen“<br />
stellen. Diese gemeinschaftliche Besitzform<br />
kennzeichnet eine Almfläche, die<br />
mehreren Personen gehört. Inzwischen<br />
sind viele davon allerdings keine Landwirte<br />
mehr. Es lasten also nicht nur sämtliche<br />
Kosten und anfallende Arbeiten auf den<br />
Schultern der verbliebenen Eigentümer,<br />
es nimmt auch die Zahl der gealpten Tiere<br />
zwangsläufig ab.<br />
Fakt ist, dass heute wesentlich weniger<br />
Kühe gesömmert werden als früher<br />
(vgl. Grafik). Trotzdem scheint es nicht<br />
sinnvoll, diese Zahl insgesamt zu erhöhen,<br />
da inzwischen auch die Milchvieh almen<br />
abgenommen haben. Zudem konnten<br />
früher aufgrund der kleineren und leichteren<br />
Tiere auch steilere und höher gelegene<br />
Weiden und somit größere Flächen<br />
genutzt werden. Für die Zukunft ist es<br />
wichtig, dass die Almen auf ihre derzeitigen<br />
Milchkühe zählen können. Dabei<br />
nimmt die Qualität der Almprodukte eine<br />
Schlüsselrolle ein. Für gute Produkte bedarf<br />
es gesunder und almtauglicher Tie-<br />
re. Folglich muss in Zukunft eine standortangepasste<br />
Tierzucht angestrebt werden.<br />
Das Stichwort lautet: „Weniger Leistung,<br />
dafür ein Mehr an Qualität“. Ferner<br />
sollen die Kühe auf der Alm richtig versorgt<br />
und die Milch fachgerecht veredelt<br />
werden. Somit muss auch in den nächsten<br />
Jahren eine konstante Aus - und Weiterbildung<br />
sowie Beratung des Almpersonals<br />
gewährleistet werden. Neue Absatzmöglichkeiten<br />
am Markt ergeben sich aus<br />
der Positionierung der Produkte als „Premiumprodukte“.<br />
Als Ziel gilt, die Almwirtschaft<br />
auch weiterhin für den Bauern<br />
attraktiv zu gestalten. Hierfür sind<br />
die öffentlichen Förderungen grundlegend.<br />
Doch auch Kooperationen mit anderen<br />
Branchen wie Tourismus oder<br />
Schule sind voran zu treiben. In erster Linie<br />
braucht es aber Bauern wie Alois, die<br />
zur Almwirtschaft stehen, sich stets neuen<br />
Herausforderungen stellen und für Innovationen<br />
offen sind.<br />
„Werden Sie Ihre Tiere auch in Zukunft<br />
alpen lassen?“, möchte ich von Bauer<br />
<strong>EURAC</strong> - Wissenschaftlerin Helga Tröbinger (im Bild rechts)<br />
hat im Zuge des Projekts FutureAlp rund 110 Interviews<br />
mit Bauern und Fachleuten geführt.<br />
Alois noch wissen. Er ist zuversichtlich.<br />
Zu sehr schätzt er diese lang gehegte Tradition:<br />
„Wissen Sie, es Alpen gheart zum<br />
Bauern sein oanfoch drzua!“<br />
Helga Tröbinger / <strong>EURAC</strong><br />
Institut für Regionalentwicklung<br />
und Standortmanagement<br />
helga.troebinger@eurac.edu<br />
Projekt FutureAlp<br />
Das Institut für Regionalentwicklung und<br />
Standortmanagement arbeitet seit Juni<br />
2005 am Projekt FutureAlp. Dieses Forschungsprojekt<br />
beschäftigt sich mit der<br />
Südtiroler Almwirtschaft, insbesondere mit<br />
den Milchviehalmen. Ziel der Studie ist es,<br />
zu deren Erhalt beizutragen. Dazu wurde die<br />
Südtiroler Milchviehalmwirtschaft beschrieben,<br />
ihr Handlungsbedarf aufgezeigt und<br />
Maßnahmen für ihre Zukunft festgelegt. Im<br />
Rahmen des Projekts hat die <strong>EURAC</strong> - Wissenschaftlerin<br />
Helga Tröbinger neun Milchviehalmen<br />
im Vinschgau und Ultental untersucht<br />
und rund 110 Gespräche mit Bauern<br />
und Experten geführt.<br />
12 Dezember – Dicembre 2007 Dezember – Dicembre 2007 13<br />
FOTO: Tröbinger