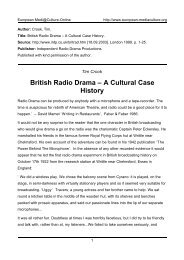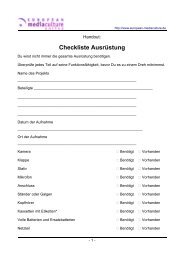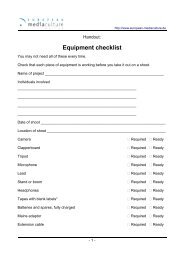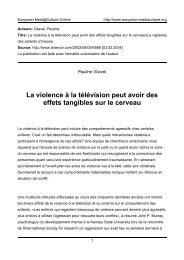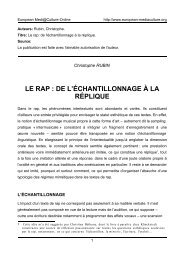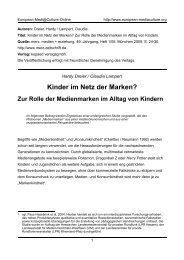Theo Hug - European MediaCulture
Theo Hug - European MediaCulture
Theo Hug - European MediaCulture
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>European</strong> Medi@Culture-Online http://www.european-mediaculture.org<br />
Massenmedien im Kontext des Nachrichtenwesens wie auch der Unterhaltung, Bildung<br />
und Erziehung. Eine Ausnahme stellt in diesem Zusammenhang das Konzept der<br />
kritischen Seherziehung, einer Anleitung zum bewußten Training des visuellen<br />
Wahrnehmungsvermögens, von Adolf Reichwein (1938) dar.<br />
In der Nachkriegszeit wurden die jugendschützerischen Motive im Rahmen der<br />
Filmerziehung wieder aufgriffen und durch entwicklungspsychologische erweitert (cf.<br />
Keilhacker 1953). Im Mittelpunkt standen dabei Filmgespräche zur Förderung des<br />
Filmverständnisses und Filmerlebnisses der Heranwachsenden. Diese Bewahrpädagogik,<br />
„deren Ziel es war, das ‘Gute und Echte’ den Kindern zu vermitteln, und das ‘Schlechte<br />
und Gefährliche’ fernzuhalten“ (cf. Baacke 1995, 176), war zunächst auch im Kontext der<br />
Fernseherziehung bedeutsam. Die Vorstellung von pädagogischen Schonräumen, die<br />
damit verbunden waren, wurde mit der Idee des „kritischen Rezipienten“ (cf. Heinrich<br />
1961; Kerstiens 1971, 44 f) und in der weiteren Folge durch die ideologiekritische<br />
Medienpädagogik (cf. Baacke 1974) infragegestellt, die in den medienpädagogischen<br />
Diskussionen bis heute eine Rolle spielt.<br />
Gegenwärtig lassen sich grosso modo vier Ansätze mit entsprechenden<br />
Ausdifferenzierungen ausmachen:<br />
• Die normative Medienpädagogik, die an die Bewahrpädagogik der 50er und 60er Jahre<br />
anschließt, ist heute eher in Form von Gelegenheitsargumentationen und nicht als<br />
ausformuliertes wissenschaftliches Konzept anzutreffen. Diese Argumentationen, die in<br />
alltagsweltlichen, berufspraktischen und bildungspolitischen Zusammenhängen eine<br />
nicht zu unterschätzende Rolle spielen, basieren auf gesellschaftlichen Normen und<br />
Werten, die in der Regel ihrerseits nicht mehr konsequent hinterfragt werden.<br />
Charakteristisch ist auch der Rekurs auf bestehende Bestimmungen des<br />
Jugendschutzes, auf Probleme der Reizüberflutung, der Aggression, der Verarmung<br />
des Gefühlslebens und des Verlusts von kreativen Potentialen, „Wirklichkeitsbezügen“<br />
und des selbständigen Denkens infolge intensiven Medienkonsums, sowie auf den<br />
Verfall geistiger und kultureller Werte durch seichte Massenunterhaltung und<br />
medienvermittelte Scheinwelten. Hand in Hand mit diesen Argumentationen werden<br />
häufig Forderungen nach „entwicklungsangemessenen“ Medienangeboten erhoben.<br />
Dabei werden die zugrundeliegenden psychologischen Konzepte einer stufenförmigen<br />
Entwicklung „des“ Menschen oftmals nicht mehr weiter problematisiert. Ebenso werden<br />
die (un–)erwünschten Medienwirkungen eher vermutet oder behauptet und nicht einer<br />
differenzierten Prüfung unterzogen. Analog bleiben auch die Fragen nach dem Cui bono<br />
der unterschiedlichen Varianten der Fremd– oder Selbstbewahrung notorisch<br />
unterbelichtet, wenngleich offenkundig geworden ist, daß es zumeist Kinder,<br />
12