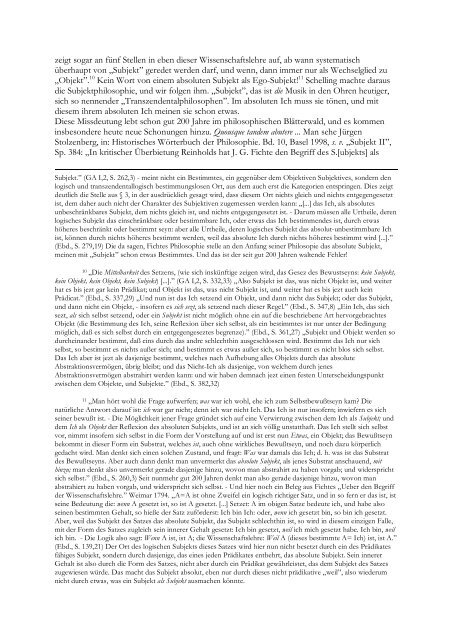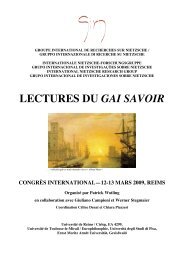Vom Elend der Transzendentalphilosophie am Beispiel Schellings ...
Vom Elend der Transzendentalphilosophie am Beispiel Schellings ...
Vom Elend der Transzendentalphilosophie am Beispiel Schellings ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
zeigt sogar an fünf Stellen in eben dieser Wissenschaftslehre auf, ab wann systematisch<br />
überhaupt von „Subjekt” geredet werden darf, und wenn, dann immer nur als Wechselglied zu<br />
„Objekt”. 10 Kein Wort von einem absoluten Subjekt als Ego-Subjekt! 11 Schelling machte daraus<br />
die Subjektphilosophie, und wir folgen ihm. „Subjekt”, das ist die Musik in den Ohren heutiger,<br />
sich so nennen<strong>der</strong> „Transzendentalphilosophen”. Im absoluten Ich muss sie tönen, und mit<br />
diesem ihrem absoluten Ich meinen sie schon etwas.<br />
Diese Missdeutung lebt schon gut 200 Jahre im philosophischen Blätterwald, und es kommen<br />
insbeson<strong>der</strong>e heute neue Schonungen hinzu. Quousque tandem abutere ... Man sehe Jürgen<br />
Stolzenberg, in: Historisches Wörterbuch <strong>der</strong> Philosophie. Bd. 10, Basel 1998, s. v. „Subjekt II”,<br />
Sp. 384: „In kritischer Überbietung Reinholds hat J. G. Fichte den Begriff des S.[ubjekts] als<br />
Subjekt.” (GA I,2, S. 262,3) - meint nicht ein Bestimmtes, ein gegenüber dem Objektiven Subjektives, son<strong>der</strong>n den<br />
logisch und transzendentallogisch bestimmungslosen Ort, aus dem auch erst die Kategorien entspringen. Dies zeigt<br />
deutlich die Stelle aus § 3, in <strong>der</strong> ausdrücklich gesagt wird, dass diesem Ort nichts gleich und nichts entgegengesetzt<br />
ist, dem daher auch nicht <strong>der</strong> Charakter des Subjektiven zugemessen werden kann: „[...] das Ich, als absolutes<br />
unbeschränkbares Subjekt, dem nichts gleich ist, und nichts entgegengesetzt ist. - Darum müssen alle Urtheile, <strong>der</strong>en<br />
logisches Subjekt das einschränkbare o<strong>der</strong> bestimmbare Ich, o<strong>der</strong> etwas das Ich bestimmendes ist, durch etwas<br />
höheres beschränkt o<strong>der</strong> bestimmt seyn: aber alle Urtheile, <strong>der</strong>en logisches Subjekt das absolut-unbestimmbare Ich<br />
ist, können durch nichts höheres bestimmt werden, weil das absolute Ich durch nichts höheres bestimmt wird [...].”<br />
(Ebd., S. 279,19) Die da sagen, Fichtes Philosophie stelle an den Anfang seiner Philosopie das absolute Subjekt,<br />
meinen mit „Subjekt” schon etwas Bestimmtes. Und das ist <strong>der</strong> seit gut 200 Jahren waltende Fehler!<br />
10 „Die Mittelbarkeit des Setzens, (wie sich inskünftige zeigen wird, das Gesez des Bewustseyns: kein Subjekt,<br />
kein Objekt, kein Objekt, kein Subjekt) [...].” (GA I,2, S. 332,33) „Also Subjekt ist das, was nicht Objekt ist, und weiter<br />
hat es bis jezt gar kein Prädikat; und Objekt ist das, was nicht Subjekt ist, und weiter hat es bis jezt auch kein<br />
Prädicat.” (Ebd., S. 337,29) „Und nun ist das Ich setzend ein Objekt, und dann nicht das Subjekt; o<strong>der</strong> das Subjekt,<br />
und dann nicht ein Objekt, - insofern es sich sezt, als setzend nach dieser Regel.” (Ebd., S. 347,8) „Ein Ich, das sich<br />
sezt, als sich selbst setzend, o<strong>der</strong> ein Subjekt ist nicht möglich ohne ein auf die beschriebene Art hervorgebrachtes<br />
Objekt (die Bestimmung des Ich, seine Reflexion über sich selbst, als ein bestimmtes ist nur unter <strong>der</strong> Bedingung<br />
möglich, daß es sich selbst durch ein entgegengeseztes begrenze).” (Ebd., S. 361,27) „Subjekt und Objekt werden so<br />
durcheinan<strong>der</strong> bestimmt, daß eins durch das andre schlechthin ausgeschlossen wird. Bestimmt das Ich nur sich<br />
selbst, so bestimmt es nichts außer sich; und bestimmt es etwas außer sich, so bestimmt es nicht blos sich selbst.<br />
Das Ich aber ist jezt als dasjenige bestimmt, welches nach Aufhebung alles Objekts durch das absolute<br />
Abstraktionsvermögen, übrig bleibt; und das Nicht-Ich als dasjenige, von welchem durch jenes<br />
Abstraktionsvermögen abstrahirt werden kann: und wir haben demnach jezt einen festen Unterscheidungspunkt<br />
zwischen dem Objekte, und Subjekte.” (Ebd., S. 382,32)<br />
11 „Man hört wohl die Frage aufwerfen; was war ich wohl, ehe ich zum Selbstbewußtseyn k<strong>am</strong>? Die<br />
natürliche Antwort darauf ist: ich war gar nicht; denn ich war nicht Ich. Das Ich ist nur insofern; inwiefern es sich<br />
seiner bewußt ist. - Die Möglichkeit jener Frage gründet sich auf eine Verwirrung zwischen dem Ich als Subjekt; und<br />
dem Ich als Objekt <strong>der</strong> Reflexion des absoluten Subjekts, und ist an sich völlig unstatthaft. Das Ich stellt sich selbst<br />
vor, nimmt insofern sich selbst in die Form <strong>der</strong> Vorstellung auf und ist erst nun Etwas, ein Objekt; das Bewußtseyn<br />
bekommt in dieser Form ein Substrat, welches ist, auch ohne wirkliches Bewußtseyn, und noch dazu körperlich<br />
gedacht wird. Man denkt sich einen solchen Zustand, und fragt: Was war d<strong>am</strong>als das Ich; d. h. was ist das Substrat<br />
des Bewußtseyns. Aber auch dann denkt man unvermerkt das absolute Subjekt, als jenes Substrat anschauend, mit<br />
hinzu; man denkt also unvermerkt gerade dasjenige hinzu, wovon man abstrahirt zu haben vorgab; und wi<strong>der</strong>spricht<br />
sich selbst.” (Ebd., S. 260,3) Seit nunmehr gut 200 Jahren denkt man also gerade dasjenige hinzu, wovon man<br />
abstrahiert zu haben vorgab, und wi<strong>der</strong>spricht sich selbst. - Und hier noch ein Beleg aus Fichtes „Ueber den Begriff<br />
<strong>der</strong> Wissenschaftslehre.” Weimar 1794. „A=A ist ohne Zweifel ein logisch richtiger Satz, und in so fern er das ist, ist<br />
seine Bedeutung die: wenn A gesetzt ist, so ist A gesetzt. [...] Setzet: A im obigen Satze bedeute ich, und habe also<br />
seinen bestimmten Gehalt, so hieße <strong>der</strong> Satz zuför<strong>der</strong>st: Ich bin Ich: o<strong>der</strong>, wenn ich gesetzt bin, so bin ich gesetzt.<br />
Aber, weil das Subjekt des Satzes das absolute Subjekt, das Subjekt schlechthin ist, so wird in diesem einzigen Falle,<br />
mit <strong>der</strong> Form des Satzes zugleich sein innerer Gehalt gesetzt: Ich bin gesetzt, weil ich mich gesetzt habe. Ich bin, weil<br />
ich bin. - Die Logik also sagt: Wenn A ist, ist A; die Wissenschaftslehre: Weil A (dieses bestimmte A= Ich) ist, ist A.”<br />
(Ebd., S. 139,21) Der Ort des logischen Subjekts dieses Satzes wird hier nun nicht besetzt durch ein des Prädikates<br />
fähiges Subjekt, son<strong>der</strong>n durch dasjenige, das eines jeden Prädikates entbehrt, das absolute Subjekt. Sein innerer<br />
Gehalt ist also durch die Form des Satzes, nicht aber durch ein Prädikat gewährleistet, das dem Subjekt des Satzes<br />
zugewiesen würde. Das macht das Subjekt absolut, eben nur durch dieses nicht prädikative „weil”, also wie<strong>der</strong>um<br />
nicht durch etwas, was ein Subjekt als Subjekt ausmachen könnte.