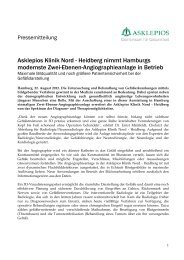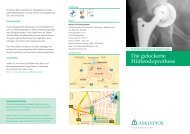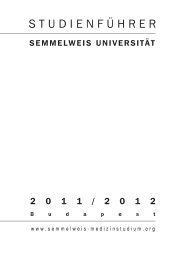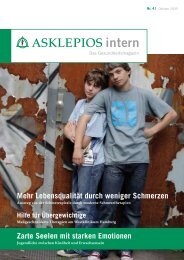BRIDGING Überbrückung der oralen Antikoagulation ... - Asklepios
BRIDGING Überbrückung der oralen Antikoagulation ... - Asklepios
BRIDGING Überbrückung der oralen Antikoagulation ... - Asklepios
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Nr. 11 Oktober 2007<br />
<strong>BRIDGING</strong><br />
<strong>Überbrückung</strong> <strong>der</strong> <strong>oralen</strong> <strong>Antikoagulation</strong><br />
BURNOUT<br />
das Laster <strong>der</strong> Mo<strong>der</strong>ne<br />
KONTRASTMITTEL-SONOGRAPHIE DER LEBER<br />
sensibel und spezifisch
Impressum<br />
Redaktion<br />
Jens Oliver Bonnet<br />
(verantw.)<br />
PD Dr. Oliver Detsch<br />
Dr. Birger Dulz<br />
PD Dr. Siegbert Faiss<br />
Dr. Christian Frerker<br />
Dr. Annette Hager<br />
PD Dr. Werner Hofmann<br />
Dr. Susanne Huggett<br />
Prof. Dr. Uwe Kehler<br />
Dr. Daniel Kleinschmidt<br />
Prof. Dr. Lutz Lachenmayer<br />
Dr. Jürgen Ma<strong>der</strong>t<br />
Dr. Ursula Scholz<br />
PD Dr. Karl Wagner<br />
Cornelia Wolf<br />
Herausgeber<br />
<strong>Asklepios</strong> Kliniken<br />
Hamburg GmbH<br />
Pressestelle<br />
Rudi Schmidt V. i. S. d. P.<br />
Friedrichsberger Straße 56<br />
22081 Hamburg<br />
Tel.: (040)1818-842008<br />
Fax: (040)1818-842046<br />
E-Mail:<br />
medtropole@asklepios.com<br />
Aufl age: 15.000<br />
Erscheinungsweise:<br />
4 x jährlich<br />
ISSN 1863-8341<br />
Editorial<br />
Liebe Leserinnen und Leser,<br />
mit dieser Ausgabe än<strong>der</strong>n wir unser wie man mo<strong>der</strong>n sagt<br />
„outfi t“ – hin zu einer noch besseren Lesbarkeit <strong>der</strong> medtro-<br />
pole. Unser Veröffentlichungsformat haben wir den Bedürf-<br />
nissen von Leserinnen und Lesern angepasst, die uns durch<br />
viele Zuschriften dazu ermuntert haben. Viele fragten, ob<br />
es denn nicht noch pragmatischer, knapper, klarer und<br />
übersichtlicher ginge. Diese Anregung haben wir mit dieser<br />
Ausgabe aufgegriffen. Wir sind gespannt, wie Sie das Resul-<br />
tat bewerten. Das Konzept, zertifi zierte Fortbildung anzubieten, haben wir nicht<br />
aufgegeben, son<strong>der</strong>n konzentriert auf einen Artikel, in dem beson<strong>der</strong>s praxisre-<br />
levante Fragestellungen bearbeitet werden. Den zugehörigen Fragebogen – auch<br />
eine Anregung aus <strong>der</strong> Leserschaft – fi nden Sie von nun an nicht nur im Internet,<br />
son<strong>der</strong>n auch in <strong>der</strong> Fortbildungsbeilage im Heft.<br />
Ausgabe 11 von medtropole ist mit Themen aus den operativen und konserva-<br />
tiven Fächern bestückt wie auch aus <strong>der</strong> Psychiatrie: Neben herausragenden Ar-<br />
tikeln über neue herzchirurgische Verfahren und Interventionstechniken aus <strong>der</strong><br />
Kardiologie berichten wir über ein beson<strong>der</strong>s wichtiges und auch die Ärzteschaft<br />
betreffendes Problem, das in den Bereich <strong>der</strong> psychotherapeutischen Medizin<br />
reicht: Die Berufsbelastung im ärztlichen Beruf, aber auch in vielen an<strong>der</strong>en<br />
Bereichen hat heute ein Ausmaß erreicht, dass die Erholungsfähigkeit leidet und<br />
darüber Störbil<strong>der</strong> entstehen. Darüber zu berichten, ist uns beson<strong>der</strong>s wichtig.<br />
Großen Wert legen wir auch darauf, dass sich <strong>Asklepios</strong> in Hamburg dafür en-<br />
gagiert, weiter den Hamburger Preis für Persönlichkeitsstörungen zu stiften.<br />
Über die Einsendungen sind wir dieses Jahr beson<strong>der</strong>s glücklich gewesen und<br />
berichten in diesem Heft über die Preisträger.<br />
So entstand eine breite Themenpalette für das neue Heft. Sie zeigt, in welchem<br />
Ausmaß die Medizin sich gegenwärtig weiterentwickelt und dabei Gebiete er-<br />
obert, von denen man lange Zeit dachte, hier werde <strong>der</strong> therapeutische Fort-<br />
schritt auf sich warten lassen. Zögern Sie nicht, mit unseren Experten Kontakt<br />
aufzunehmen. Wir freuen uns darüber und wünschen uns weiter einen regen<br />
Austausch mit Ihnen!<br />
Mit freundlichen Grüßen<br />
Ihr<br />
Dr. med. Jörg Weidenhammer<br />
Geschäftsführer Medizin und Qualitätsmanagement<br />
<strong>Asklepios</strong> Kliniken Hamburg GmbH
Inhalt<br />
452 | ONKOLOGIE<br />
Kontrastmittel-Sonographie <strong>der</strong> Leber –<br />
sensibel und spezifisch<br />
454 | VISZERALCHIRURGIE<br />
Die mo<strong>der</strong>ne Behandlung des Rektumkarzinoms<br />
456 | UROLOGIE<br />
Rekonstruktion von Harnröhrenstrikturen<br />
458 | HERZCHIRURGIE<br />
Mo<strong>der</strong>ne Konzepte <strong>der</strong> Aortenklappenchirurgie<br />
461 | MUND-, KIEFER- UND GESICHTSCHIRURGIE<br />
Kin<strong>der</strong> mit Lippen-, Kiefer-, Gaumenspalten im Kopfzentrum<br />
464 | GYNÄKOLOGIE<br />
Die laparoskopische Descensuschirurgie<br />
466 | PSYCHIATRIE UND PSYCHOTHERAPIE<br />
Burnout – das Laster <strong>der</strong> Mo<strong>der</strong>ne<br />
468 | UNFALLCHIRURGIE<br />
Diagnostik und Therapie von Halswirbelsäulenverletzungen<br />
472 | KARDIOLOGIE<br />
Vorhofflimmern und <strong>Antikoagulation</strong> – Reveal ® XT<br />
474 | LABORMEDIZIN / ANGIOLOGIE (CME)<br />
„Bridging“ – <strong>Überbrückung</strong> <strong>der</strong> <strong>oralen</strong> <strong>Antikoagulation</strong><br />
478 | AKTUELLES<br />
2. Hamburg-Preis Persönlichkeitsstörungen ging nach<br />
Freiburg, Chicago und Köln<br />
479 | PERSONALIA<br />
PD Dr. Christoph Terborg<br />
PD Dr. Christian Heinrich Flamme<br />
S. 458<br />
S. 461 468<br />
S. 472
Medtropole | Ausgabe Oktober 2007<br />
Kontrastmittel-Sonographie <strong>der</strong> Leber –<br />
sensibel und spezifisch<br />
Dr. Axel Stang, Dr. Handan Keles, Dr. Cay-Uwe von Seydewitz, Dr. Dietrich Braumann<br />
Die Sonographie spielt in <strong>der</strong> Diagnostik von Lebererkrankungen eine entscheidende Rolle. In etwa fünf Prozent<br />
aller Abdomensonographien werden Leberherde entdeckt – als Zufallsbefund o<strong>der</strong> im Rahmen einer gezielten<br />
Metastasensuche. Bei typischem Befund – etwa einer Zyste o<strong>der</strong> einem Hämangiom – ist durch die B-Bild-Sonographie<br />
eine definitive Diagnose möglich. Dennoch bleiben 40 Prozent <strong>der</strong> fokalen Leberläsionen unklar. Trotz<br />
deutlicher Fortschritte in <strong>der</strong> sonographischen Bildqualität werden 40–50 Prozent aller Lebermetastasen nicht<br />
entdeckt. Das gilt speziell für den Nachweis von kleinen (< 1 cm) Lebermetastasen. [1]<br />
Der Einsatz von Ultraschallkontrastmitteln<br />
steigert die Qualität <strong>der</strong> sonographischen<br />
Befun<strong>der</strong>hebung – analog zur Kontrastmittelgabe<br />
in den Schnittbildverfahren CT<br />
und MRT. [2,3] Die eingesetzten Ultraschallkontrastmittel<br />
sind kleine Gasbläschen<br />
in <strong>der</strong> Größe von Erythrozyten.<br />
Nach intravenöser Injektion zirkulieren<br />
sie fünf bis zehn Minuten in <strong>der</strong> Blutbahn,<br />
anschließend werden sie über die Lunge<br />
abgeatmet. Neue Ultraschalltechniken ermöglichen<br />
die kontinuierliche Darstellung<br />
<strong>der</strong> zirkulierenden Mikrobläschen und damit<br />
die Beurteilung <strong>der</strong> Mikrozirkulation<br />
von Organen und Tumoren. [1] Ein Vorteil<br />
<strong>der</strong> Sonographie ist die Echtzeitdarstellung<br />
des dynamischen Kontrastmittelverhaltens.<br />
Die Kontrastmittel-Sonographie ersetzt<br />
nicht die Schnittbilddiagnostik, reduziert<br />
aber diagnostische Kaskaden. Leitlinien für<br />
den Einsatz von Ultraschallkontrastmitteln<br />
hat die EFSUMB (European Fe<strong>der</strong>ation of<br />
Societies for Ultrasound in Medicine and<br />
Biology) herausgegeben. [4]<br />
Die Kontrastmittel-Sonographie verbessert<br />
die sonographische Erkennung und Diagnose<br />
von Lebertumoren beachtlich. [5,6]<br />
Die richtige Tumorartdiagnose aller Leberherde<br />
liegt bei 90 Prozent (Basis-Sonogra-<br />
452<br />
hie 60 Prozent, Zugewinn 30 Prozent). Der<br />
Nachweis von Lebermetastasen liegt bei<br />
über 90 Prozent (Basis-Sonographie 50–60<br />
Prozent, Zugewinn 40 Prozent). Die Treffsicherheit<br />
<strong>der</strong> kontrastmittelverstärkten<br />
Ultraschalldiagnostik <strong>der</strong> Leber ist mit den<br />
Ergebnissen <strong>der</strong> kontrastmittelgestützten<br />
CT und MRT vergleichbar. In Zweifelsfällen<br />
kann die Diagnostik unmittelbar um<br />
die ultraschallgezielte Punktion zur Histologiegewinnung<br />
erweitert werden.<br />
Die Kontrastmittel-Sonographie verbessert<br />
auch die Präzision und Sicherheit ultraschallgezielter<br />
Interventionen. Die kontrastmittelgestützte<br />
Punktion erhöht die<br />
Präzision für die Fälle, in denen Tumore in<br />
<strong>der</strong> Basis-Sonographie nicht klar erkennbar<br />
sind. Bei großen Tumoren mit nekrotischen<br />
Arealen erlaubt diese Technik die gezielte<br />
Probeentnahme aus vitalen Tumoranteilen.<br />
Für ablative Verfahren (Radiofrequenzablation)<br />
bietet die Kontrastmittel-Sonographie<br />
die Option des Therapiemonitorings nach<br />
Tumorablation. Vitale Rest-Tumoranteile<br />
können erkannt und direkt behandelt<br />
werden. [7]<br />
Alle zugelassenen Ultraschallkontrastmittel<br />
sind nahezu nebenwirkungsfrei.<br />
Als Kontraindikationen gelten: schwere<br />
pulmonale o<strong>der</strong> arterielle Hypertension,<br />
schwere Herzinsuffizienz, akutes Koronarsyndrom,<br />
Schwangerschaft und Stillzeit.<br />
Anaphylaktische Reaktionen sind eine<br />
Rarität. Schilddrüsenüberfunktion o<strong>der</strong><br />
Niereninsuffizienz stellen keine Kontraindikationen<br />
dar. Für den Patienten steht somit<br />
eine effektive und sichere bildgebende<br />
Methode zur Verfügung, die in etwa 90<br />
Prozent <strong>der</strong> Fälle eine definitive Diagnose<br />
von Leberherden ermöglicht.<br />
Fazit<br />
Die Qualität <strong>der</strong> diagnostischen und interventionellen<br />
Sonographie wird durch den<br />
Einsatz von Ultraschallkontrastmitteln<br />
gesteigert. Die Diagnose unklarer Leberherde,<br />
<strong>der</strong> Nachweis von Lebermetastasen<br />
und die Präzision ultraschallgezielter Interventionen<br />
(z. B. Radiofrequenzablation)<br />
werden erheblich verbessert. Die notwendige<br />
Ausbildung und Qualität <strong>der</strong> Untersucher<br />
wird durch das Mehrstufenmodell<br />
<strong>der</strong> DEGUM (Deutsche Gesellschaft für<br />
Ultraschall in <strong>der</strong> Medizin) gewährleistet.
Literatur<br />
[1] Stang A, Keles H, von Seydewitz C, Hentschke S,<br />
Braumann D. Kontrastmittel in <strong>der</strong> Abdomensonographie:<br />
Aktueller Stand und Perspektiven. Dtsch Med Wochenschr<br />
2006; 131: 1813-18.<br />
[2] Spangenberg HC, Thimme R, Blum HE. Der Leber-<br />
rundherd. Dtsch Ärztebl 2007; 104(33): A2279-88.<br />
[3] Boozari B, Lotz J, Galanski M, Gebel M. Bildgebende<br />
Diagnostik von Lebertumoren: Aktueller Stand. Internist<br />
2007; 48: 8–20.<br />
[4] EFSUMB Study Group. Guidelines for the use of<br />
contrast agents in ultrasound. Ultraschall in Med 2004; 25:<br />
249-56.<br />
Abb. 1: Hämangiom (a) Basis-Sonographie, kaum erkenn-<br />
barer Leberherd (b, c), nach 57 und 117 Sekunden zuneh-<br />
mende Kontrastmittelfüllung (Irisblendenphänomen)<br />
[5] Quaia E, Callida F, Bertolotto M et al. Characterization<br />
of focal liver lesions with contrast specific US modes and<br />
a sulfur hexafluorid-filled microbubble contrast agent:<br />
diagnostic performance and confidence. Radiology 2004;<br />
232: 420-30.<br />
[6] Bryant TH, Blomley MJ, Albrecht T et al. Liver phase<br />
uptake of a liver specific microbubble improves characte-<br />
risation of liver lesions: a prospective multicenter study.<br />
Radiology 2004; 232: 799–809.<br />
[7] Stang A, Keles H, von Seydewitz C, Teichmann W,<br />
Malzfedt E, Braumann D. Percutanous and intraoperative<br />
ultrasound-guided radiofrequency ablation of hepatic<br />
tumors. Ultraschall in Med 2007; 28: 181-8.<br />
Abb. 2: Lebermetastase (a) Basis-Sonographie, echoreicher<br />
Leberherd (b, c), nach 23 und 115 Sekunden zunehmende<br />
Kontrastmittelaussparung<br />
Kontakt<br />
Dr. Axel Stang<br />
2. Medizinische Abteilung – Schwerpunkt<br />
Hämatologie und Onkologie<br />
<strong>Asklepios</strong> Klinik Altona<br />
Paul-Ehrlich-Straße 1, 22763 Hamburg<br />
Tel. (0 40) 18 18-81 13 08<br />
Fax (0 40) 18 18-81 49 04<br />
E-Mail: a.stang@asklepios.com<br />
Onkologie<br />
453
Medtropole | Ausgabe Oktober 2007<br />
Die mo<strong>der</strong>ne Behandlung<br />
des Rektumkarzinoms<br />
Prof. Dr. Eberhard Gross<br />
Die Heilungsaussichten des Rektumkar-<br />
zinoms sind nicht schlechter als die des<br />
Colonkarzinoms. So werden 65 bis 75 Pro-<br />
zent <strong>der</strong> Patienten nach kurativer Opera-<br />
tion geheilt, wenn bei <strong>der</strong> Behandlung die<br />
Kenntnisse <strong>der</strong> Tumorausbreitung berück-<br />
sichtigt werden. [4] Dabei ist es erstes Be-<br />
handlungsziel, ein lokales Rezidiv zu ver-<br />
meiden. Das lokale, in <strong>der</strong> Regel pelvine<br />
Rezidiv ist selten kurabel und begrenzt<br />
damit das Leben. Darüber hinaus verur-<br />
sacht es Schmerzen und schwere lokale<br />
Komplikationen, die einer aufwendigen<br />
Behandlung bedürfen. Gegenüber dem<br />
Colonkarzinom tangiert die Behandlung<br />
des Rektumkarzinoms auch immer Fragen<br />
<strong>der</strong> Lebensqualität: Lässt sich die Stuhl-<br />
kontinenz erhalten, kann eine dauerhafte<br />
Colostomie umgangen werden und lassen<br />
sich Störungen <strong>der</strong> Harnblasen- und Sexu-<br />
alfunktion verhin<strong>der</strong>n?<br />
Die mo<strong>der</strong>ne Rektumkarzinomchirurgie<br />
basiert auf zwei Charakteristiken des lo-<br />
kalen Tumorwachstums: Das Karzinom<br />
breitet sich zum einen im Mesorektum<br />
454<br />
(Abb. 1) kontinuierlich und diskontinuier-<br />
lich sowohl quer zur Darmachse als auch<br />
in Richtung <strong>der</strong> Darmachse bis zu fünf<br />
Zentimeter unterhalb des makroskopisch<br />
sichtbaren kaudalen Tumorrandes aus. [5]<br />
Zum an<strong>der</strong>en wächst <strong>der</strong> Tumor in <strong>der</strong><br />
Darmwand selbst selten über den sicht-<br />
baren Rand hinaus, und wenn, dann nur in<br />
einer Ausdehnung von einem Zentimeter.<br />
Daraus folgt, dass einerseits das Mesorek-<br />
tum bei Tumoren im mittleren und unteren<br />
Rektumdrittel, also bis zu einer Höhe von<br />
zwölf Zentimetern ab ano, vollständig ent-<br />
fernt werden muss und dass an<strong>der</strong>erseits<br />
<strong>der</strong> Anus immer dann erhalten werden<br />
kann, wenn <strong>der</strong> Tumor den Schließmus-<br />
kel nicht befallen hat, da bei Tumoren<br />
unmittelbar oberhalb des Analkanals ein<br />
Sicherheitsabstand von einem Zentimeter<br />
ausreicht (Abb. 2). Dieser Sicherheits-<br />
abstand erlaubt, bei über 90 Prozent <strong>der</strong><br />
Patienten auf einen dauerhaften künst-<br />
lichen Darmausgang zu verzichten, ohne<br />
die Chance auf eine Heilung zu gefährden.<br />
Selbst bei sehr tief sitzenden Tumoren,<br />
wie solchen in <strong>der</strong> Übergangszone vom<br />
Rektum zum Analkanal, kann durch eine<br />
sogenannte intersphinktäre Resektion die<br />
Kontinenz erhalten werden.<br />
Abb. 1: Charakteristische Ausbreitung<br />
des Rektumkarzinoms<br />
Das colorektale Karzinom gehört zu den häufigsten Krebserkrankungen in den Län<strong>der</strong>n mit westlicher Zivilisation.<br />
Bei den Frauen steht es nach dem Mammakarzinom an zweiter Stelle und bei Männern an dritter Stelle nach dem<br />
Bronchial- und Prostatakarzinom. Etwa 30 Prozent <strong>der</strong> colorektalen Karzinome entstehen im Rektum.<br />
Die totale Exzision des Mesorektums<br />
(TME) bedeutet immer auch die weitge-<br />
hende o<strong>der</strong> totale Resektion des Rektums<br />
selbst. Wird die Darmkontinuität im Sinne<br />
einer colorektalen o<strong>der</strong> coloanalen Anas-<br />
tomose wie<strong>der</strong> hergestellt, leiden etwa<br />
50 Prozent <strong>der</strong> Patienten an Kontinenz-<br />
störungen. Diese lassen sich durch einen<br />
Rektumersatz wie den Colon-J-Pouch o<strong>der</strong><br />
Coloplastiepouch nicht immer vermeiden,<br />
in <strong>der</strong> Regel aber deutlich vermin<strong>der</strong>n.<br />
Bei <strong>der</strong> TME sollte daher immer die Kontinenz<br />
mit einem Colonpouch wie<strong>der</strong>hergestellt<br />
werden. [3]<br />
Die Einführung <strong>der</strong> TME in die Rektumkarzinomchirurgie<br />
vermin<strong>der</strong>te das Risiko<br />
des lokalen Rezidivs so weit, dass durch<br />
die Operation allein die Raten an Lokalrezidiven<br />
von 20 bis 30 Prozent und zum<br />
Teil darüber auf unter zehn Prozent und<br />
zum Teil sogar unter fünf Prozent gesenkt<br />
werden konnten.
Prostata<br />
Samenblasen<br />
Mesorektale<br />
Faszie<br />
Tumor<br />
Abb. 2: Resektion des Rektumkarzinoms unter Erhalt des Anus<br />
Der Erfolg <strong>der</strong> TME hängt wesentlich von<br />
<strong>der</strong> operativen Präzision ab. Diese wird<br />
daher von den Pathologen im Sinne einer<br />
Qualitätskontrolle beurteilt. Neben <strong>der</strong><br />
operativen Präzision wird die Heilungs-<br />
chance naturgemäß auch davon bestimmt,<br />
wie weit <strong>der</strong> Tumor in das Mesorektum<br />
eingewachsen ist. Das Lokalrezidivrisiko<br />
ist beson<strong>der</strong>s hoch, wenn <strong>der</strong> Tumor 1 bis<br />
2 mm an den flächigen, zirkumferentiellen<br />
Resektionsrand des Mesorektums heranreicht<br />
o<strong>der</strong> diesen überschritten hat. [7]<br />
Auch die Radiochemotherapie hat ihren<br />
Platz in <strong>der</strong> Behandlung des Rektumkarzinoms.<br />
Sie wird eingesetzt, wenn das Risiko<br />
eines Lokalrezidivs trotz TME als hoch<br />
eingestuft wird.<br />
Dabei ist die präoperative (neoadjuvante)<br />
Radiochemotherapie nach <strong>der</strong> deutschen<br />
Rektumkarzinomstudie <strong>der</strong> postoperativen<br />
(adjuvanten) vorzuziehen. [8] Sie ist<br />
nicht nur effektiver, son<strong>der</strong>n geht auch mit<br />
besseren funktionellen Ergebnissen einher.<br />
Mit <strong>der</strong> Magnetresonanztomographie<br />
(MRT) kann die lokale Tumorausdehnung<br />
sehr präzise klassifiziert werden (Abb.<br />
3). Die MRT ist damit für die Indikationsstellung<br />
zur neoadjuvanten Radiochemotherapie<br />
unentbehrlich. [2] Die in unmittelbarer<br />
Nachbarschaft des Mesorektums<br />
Mesorektum<br />
verlaufenden autonomen Nerven steuern<br />
die Harnblasen- und Sexualfunktion. Störungen<br />
<strong>der</strong> Harnblasenfunktion, überwiegend<br />
vorübergehen<strong>der</strong> Natur, und dauerhafte<br />
Störungen <strong>der</strong> Sexualfunktion sind<br />
typische und häufige Komplikationen <strong>der</strong><br />
Rektumkarzinomchirurgie. [6] Mithilfe einer<br />
neuen Dissektionstechnik, <strong>der</strong> Hydrojetdissektion,<br />
lassen sich mit einem kapillären<br />
Hochduckwasserstrahl verschiedene<br />
Gewebsarten präzise trennen. Damit werden<br />
die Nerven sicher identifiziert und geschont.<br />
[1] Die mo<strong>der</strong>ne Behandlung des<br />
Rektumkarzinoms führt nicht nur zu einer<br />
besseren Heilungsrate, son<strong>der</strong>n erlaubt<br />
auch vielen Patienten nach <strong>der</strong> Behandlung<br />
ein weitgehend normales Leben.<br />
Literatur<br />
Nervenfasern<br />
[1] Arndt A, Gross E. Die Hydrojetdissektion zur Schonung<br />
<strong>der</strong> autonomen Nerven bei <strong>der</strong> TAR und TME.<br />
Vortrag Kongress <strong>der</strong> Dt Ges. f Chir München 2005.<br />
[2] Brown G, Radcliffe AG, Newscombe RG, Dallimore<br />
NS, Bourne MW, Williams GT. Preoperative assessment of<br />
prognostic factors in rectal cancer using high-resolution<br />
magnetic resonance imaging. Br J Surg 2003; 90: 1628-36.<br />
[3] Gross E, Möslein G. Pouchanlage und an<strong>der</strong>e Maßnahmen<br />
zur Verbesserung <strong>der</strong> Kontinenz nach TME. Zentralb<br />
Chir, im Druck.<br />
[4] Havenga K, Enker WE, Norstein J, Moriya Y, Heald<br />
RJ, van Houwelingen HC, van <strong>der</strong> Velde CJ. Improved<br />
survival and local control after total mesorectal excision or<br />
Abb. 3: MRT zur präzisen Klassifizierung<br />
<strong>der</strong> lokalen Tumorausdehnung<br />
D3 lymphadenectomy in the treatment of primary rectal<br />
cancer – an international analysis of 1411 patients. Eur J<br />
Surg Oncol 1999; 25: 368-74.<br />
[5] Heald RJ, Husband EM, Ryall RD. The mesorectum in<br />
rectal cancer surgery-clou to pelvic recurrence. Br J Surg<br />
1982; 69: 613-6.<br />
[6] Nesbakken A, Nygaard K, Bull-Njaa T, Carlson E, Eri<br />
LM. Blad<strong>der</strong> and sexual function after mesorectal excision<br />
for rectal cancer. Br J Surg 2000; 87: 206-10.<br />
[7] Quirke P, Durdey P, Dixon MF, Williamson NS. Local<br />
recurrence of rectal adenocarcinoma due to inadequate<br />
surgical resection-histopathological study of lateral tumor<br />
spread and surgical excision. Lancet 1986 ii 996-9.<br />
[8] Sauer R. et al. Preoperative versus postoperative chemoradiotherapy<br />
for rectal cancer. New Engl J Med 2004;<br />
351: 1731-40.<br />
Kontakt<br />
Prof. Dr. Eberhard Gross<br />
I. Chirurgische Abteilung –<br />
Allgemein- und Viszeralchirurgie<br />
<strong>Asklepios</strong> Klinik Barmbek<br />
Rübenkamp 220, 22291 Hamburg<br />
Tel. (0 40) 18 18-82 28 11<br />
Fax (0 40) 18 18-82 28 19<br />
E-Mail: e.gross@asklepios.com<br />
Viszeralchirurgie<br />
455
Medtropole | Ausgabe Oktober 2007<br />
Rekonstruktion von<br />
Harnröhrenstrikturen<br />
Dr. Kilian Röd<strong>der</strong>, Dr. Roland Dahlem, Prof. Dr. Margit Fisch<br />
Diagnostik<br />
Bei <strong>der</strong> Anamnese ist beson<strong>der</strong>s auf die<br />
Dauer <strong>der</strong> Beschwerden, Verletzungen und<br />
stattgehabte Infektionen zu achten. Die<br />
Sonographie gibt Auskunft über die Rest-<br />
harnmenge, den Zustand <strong>der</strong> Harnblase,<br />
hier vor allem Blasenwanddicke und die<br />
Morphologie <strong>der</strong> Nieren. Zur Lokalisation<br />
<strong>der</strong> Striktur ist eine retrograde Urethrogra-<br />
phie notwendig. In Kombination mit einem<br />
Miktionszysturethrogramm lässt sich fast<br />
jede Striktur hinreichend bezüglich Loka-<br />
lisation und Länge beurteilen (s. Abb. 2).<br />
Ist eine exakte Beschreibung dennoch nicht<br />
sicher möglich, sind Harnröhrensonogra-<br />
phie und Urethroskopie indiziert.<br />
Allgemeines zum operativen Verfahren<br />
bei Harnröhrenstrikturen – Urethrotomia<br />
interna<br />
Seit ihrer Einführung 1973 ist die Schlit-<br />
zung unter Sicht bei 12:00 Uhr nach Sachse<br />
456<br />
ein etabliertes Verfahren zur Therapie kurz-<br />
streckiger Harnröhrenstrikturen. Entschei-<br />
dend ist die komplette Inzision <strong>der</strong> Strik-<br />
tur, was bei kurzstreckigen Engen oft mit<br />
einem Schnitt, bei längerstreckigen nur mit<br />
vielen Schnitten gelingen kann. 50 – 60 Pro-<br />
zent <strong>der</strong> Patienten benötigen anschließend<br />
keinen weiteren Eingriff. Tritt die Striktur<br />
wie<strong>der</strong> auf, sinkt <strong>der</strong> Anteil <strong>der</strong> Patienten,<br />
die mit einer erneuten Schlitzung geheilt<br />
werden können. Nach einem, spätestens<br />
aber beim zweiten Rezidiv nach Urethro-<br />
tomia interna sollte eine offene Operation<br />
erfolgen.<br />
Strikturresektion mit direkter<br />
End-zu-End-Anastomose<br />
Dieses Verfahren mit perinealem Zugangs-<br />
weg kommt vor allem bei bis zu 2 cm<br />
langen hinteren (bulbären o<strong>der</strong> membra-<br />
nösen) Harnröhrenengen zum Einsatz.<br />
Längere zu resezierende o<strong>der</strong> penile<br />
Strikturen lassen sich wegen zu großer<br />
Abb. 1: Verschiedene Stadien vor<strong>der</strong>er Harnröhrenstrikturen<br />
(Sagittalschnitte).<br />
A. Schleimhautfalte<br />
B. Ringförmige Enge<br />
C. Beginnende Spongiofibrose<br />
D. Komplette Spongiofibrose<br />
E. Begleitende entzündliche Umgebungsreaktion<br />
F. Komplexe Striktur (hier mit urethrokutaner Fistelbildung)<br />
Harnröhrenstrikturen können angeboren o<strong>der</strong> – deutlich häufiger – erworben sein. Neben postinfektiösen Ursa-<br />
chen spielen Traumata und vor allem iatrogene Ursachen (z. B. Kathetereinlage, Spiegelung <strong>der</strong> Harnröhre, trans-<br />
urethrale Blasen- o<strong>der</strong> Prostataresektion) eine bedeutende Rolle. In manchen Fällen bleibt die Ursache unklar.<br />
Leitsymptome sind in <strong>der</strong> Regel Miktionsbeschwerden wie ein abgeschwächter Harnstrahl (Uroflow < 10 ml/s),<br />
Restharnbildung o<strong>der</strong> ein fächerförmiger Strahl. Die Störung kann bis hin zum akuten Harnverhalt führen. Beste-<br />
hen solche Störungen über längere Zeit, kann es zu chronischen Verän<strong>der</strong>ungen wie Divertikelbildung in <strong>der</strong> Blase<br />
kommen. Auch Blasensteine, rezidivierende Harnwegsinfekte und Epididymitiden sind häufig.<br />
Spannungsbildung <strong>der</strong> Anastomose und<br />
nachfolgen<strong>der</strong> Penisverkrümmung mit<br />
diesem Verfahren nicht erfolgsverspre-<br />
chend operieren. Bei richtiger Indikati-<br />
onsstellung liegt die Erfolgsrate dieses<br />
Verfahrens bei mehr als 85 Prozent über<br />
10 Jahre. [3]<br />
Freie Transplantate (Mundschleimhaut)<br />
Mundschleimhaut wurde erstmals 1894<br />
und im Folgenden 1941 für die Harnröh-<br />
renrekonstruktion verwendet. Seit Beginn<br />
<strong>der</strong> 90er-Jahre erlebt die „Buccal-mucosa-<br />
Urethroplastik“ zunehmende Verbreitung.<br />
Die Zehnjahresdaten zum freien Mund-<br />
schleimhauttransplantat zeigen Erfolgsraten<br />
von bis zu 85 Prozent. [4]<br />
Meshgraft-Urethroplastik<br />
Die Meshgraft-Urethroplastik findet bei<br />
komplexen sowie bei komplizierten und<br />
rezidivierenden Harnröhrenstrikturen
Anwendung. [7] Dabei wird etwa 0,3 mm<br />
starke Spalthaut beidseits neben die längs<br />
eröffnete Harnröhre transplantiert. Nach<br />
völliger Epithelisation des frei transplan-<br />
tierten Meshgrafts wird aus dem Epithel-<br />
gewinn nach etwa drei Monaten in einer<br />
zweiten Sitzung eine neue Harnröhre<br />
gebildet.<br />
Differenzierte operative Therapie /<br />
Strategie<br />
Wissen über die Lokalisation und Länge<br />
<strong>der</strong> Striktur, den Grad <strong>der</strong> Spongiofibrose<br />
sowie die Anzahl und Art eventueller Vor-<br />
operationen ist nötig, um eine adäquate<br />
operative Strategie zu entwickeln. [6]<br />
Wichtige Faktoren für eine erfolgreiche<br />
Harnröhrenrekonstruktion sind geringe<br />
Gewebetraumatisierung, gute Visuali-<br />
sation <strong>der</strong> Strukturen (ggf. Lupenbrille),<br />
passende Wahl des Nahtmaterials (mono-<br />
fil-absorbierbar) sowie adäquates Instru-<br />
mentarium inklusive Retraktor (z. B.<br />
Scott-Sperrer).<br />
Eine offene Harnröhrenrekonstruktion<br />
ist meist notwendig bei narbigen kurz-<br />
streckigen Strikturen, längerstreckigen<br />
Strikturen sowie Strikturrezidiven. Die<br />
Wahl des Verfahrens ist abhängig von<br />
Lokalisation und Länge <strong>der</strong> Stenose sowie<br />
lokalen Konditionen. [5] Vor einer ge-<br />
planten Urethroplastik sollte 8–12 Wochen<br />
keine Manipulation an <strong>der</strong> Harnröhre<br />
Abb. 3: Strikturresektion, Darstellung des<br />
hochgeklappten Corpus spongiosum und <strong>der</strong><br />
Harnröhre, Planung <strong>der</strong> End-zu-End-Anasto-<br />
mosierung<br />
vorgenommen worden sein (Bougierung,<br />
Katheterismus, Schlitzung). Daher sollte<br />
bei zunehmenden Miktionsproblemen<br />
eine frühzeitige Harnableitung über eine<br />
Cystostomie erfolgen.<br />
Membranöse Harnröhrenstrikturen ent-<br />
stehen meist nach Beckentraumata und<br />
sind oft eine Herausfor<strong>der</strong>ung für den<br />
operierenden Urologen, da hierbei das<br />
Impotenz- und bei inkompetentem Bla-<br />
senhals auch das Inkontinenzrisiko erhöht<br />
ist. Methode <strong>der</strong> Wahl ist die membranöse<br />
End-zu-End-Anastomose (Abb. 3). [6]<br />
Bei kurzstreckigen bulbären Strikturen<br />
(bis max. 2 cm) ist die End-zu-End-Anas-<br />
tomose indiziert. Hierbei erfolgt nach<br />
Längsinzision am Perineum die Längsein-<br />
schneidung <strong>der</strong> Harnröhre mit Visualisie-<br />
rung <strong>der</strong> Striktur. Das verengte Segment<br />
wird reseziert und die beiden Enden <strong>der</strong><br />
Harnröhre werden end-zu-end reanasto-<br />
mosiert. Bei längerstreckigen bulbären<br />
Engen ist die Rekonstruktion mit freiem<br />
Mundschleimhauttransplantat heute<br />
Standard.<br />
Bei penilen Engen ist ein gestielter Onlay-<br />
Lappen, z. B. aus Penishaut o<strong>der</strong> Vorhaut<br />
o<strong>der</strong> ein „Mundschleimhaut-Inlay“ indi-<br />
ziert, [1,2,3] bei komplexen langstreckigen<br />
Strikturen mit tiefgreifen<strong>der</strong> Spongiofibro-<br />
se o<strong>der</strong> bei häufig voroperierten Patienten<br />
eine Meshgraft-Urethroplastik. [6]<br />
Abb. 2: Kombiniertes retrogrades Urethrogramm (RUG) und<br />
Miktionszysturethrogramm (MCU)<br />
Literatur<br />
Urologie<br />
[1] Andrich DE, Mundy AR (2001). Substitution urethro-<br />
plasty with buccal mucosal free grafts. J Urol 165: 1131-4.<br />
[2] Barbagli G, Selli C, Tosto A, Palminteri E (1996). Dorsal<br />
free graft urethroplasty. J Urol 155: 123-6.<br />
[3] Filipas D, Fisch M, Fichtner J, Fitzpatrick J, Berg K,<br />
Storkel S, Hohenfellner R, Thüroff JW (1999). The histology<br />
and immunohistochemistry of free buccal mucosa and full-<br />
skin grafts after exposure to urine. Br J Urol 84: 108-11.<br />
[4] Kessler TM, Schreiter F, Kralidis G, Heitz M, Olianas R,<br />
Fisch M (2003). Long-term results of surgery for urethral<br />
stricture: a statistical analysis. J Urol 170: 840-4.<br />
[5] Schlossberg SM (2006). A current overview of the<br />
treatment of urethral strictures: etiology, epidemiology,<br />
pathophysiology, classification, and principles of repair.<br />
In: Schreiter F, Jordan GH (Hrsg.) Reconstructive urethral<br />
surgery. Springer, Berlin Heidelberg New York, S. 60-5.<br />
[6] Schreiter F, Noll F (1987). Meshgraft urethroplasty.<br />
World J Urol 5: 41-6.<br />
[7] Schreiter F, Schönberger R, Olianas R (2006). Recon-<br />
struction of the bulbar and membranous urethra. In:<br />
Schreiter F, Jordan G. H. (Hrsg.). Reconstructive urethral<br />
surgery. Springer, Berlin Heidelberg New York, S. 107-20.<br />
Kontakt<br />
Dr. Kilian Röd<strong>der</strong><br />
Urologisches Zentrum Hamburg-Harburg<br />
Eißendorfer Pferdeweg 52, 21075 Hamburg<br />
Tel. (0 40) 18 18-86 25 55<br />
Fax (0 40) 18 18-86 31 22<br />
E-Mail: k.roed<strong>der</strong>@asklepios.com<br />
457
Medtropole | Ausgabe Oktober 2007<br />
Mo<strong>der</strong>ne Konzepte <strong>der</strong><br />
Aortenklappenchirurgie<br />
Dr. Stephan Geidel, PD Dr. Michael Laß, Prof. Dr. Jörg Ostermeyer<br />
Pro Jahr werden in Deutschland mehr als 20.000 herzchirurgische Eingriffe im Bereich <strong>der</strong> Aortenklappe (AK) durch-<br />
geführt. [1] Etwa die Hälfte dieser Prozeduren sind komplexe Kombinationseingriffe (zusätzlich: z. B. Koronar-<br />
und/o<strong>der</strong> Mitralklappenchirurgie), die übrigen sogenannte isolierte AK-Operationen.<br />
Während die zahlenmäßige Bedeutung im-<br />
plantierter Homografts (= menschliches<br />
Klappenmaterial, bundesweit im Jahr 2005:<br />
n = 34) und <strong>der</strong> sogenannten Ross-Opera-<br />
tion (Pulmonalklappe in Aortenposition,<br />
2005: n = 125; Deutsches Ross-Register)<br />
verhältnismäßig gering geblieben ist (< 1<br />
Prozent), steigt <strong>der</strong> prozentuale Anteil ver-<br />
wendeter biologischer Klappenprothesen<br />
(porcin = „Schweineklappe“; bovin = „Rin-<br />
<strong>der</strong>perikardklappe“) kontinuierlich (2005:<br />
67 Prozent). Mechanische Kunstklappen<br />
werden immer seltener implantiert (30 Pro-<br />
zent). Die Gründe hierfür sind vielschich-<br />
tig und zum einen in <strong>der</strong> demografischen<br />
Entwicklung zu sehen: Je nach Region<br />
beträgt <strong>der</strong> Anteil <strong>der</strong> über 70-jährigen<br />
herzchirurgischen Patienten bereits zwi-<br />
schen 40–50 Prozent. Zum an<strong>der</strong>en ist von<br />
einer sehr langen Haltbarkeit (> 15 Jahre)<br />
und verbesserten hämodynamischen Be-<br />
dingungen biologischer Klappenprothese<br />
insbeson<strong>der</strong>e sogenannter Stentless- und<br />
Perikardklappen auszugehen, was die<br />
Implantation von Bioklappen (keine dau-<br />
erhafte <strong>Antikoagulation</strong>!) inzwischen auch<br />
bei jüngeren Patienten rechtfertigt. [2,3] Für<br />
einen Teil <strong>der</strong> Patienten kommen neuer-<br />
dings auch klappenerhaltende Verfahren<br />
(AK-Rekonstruktion) infrage. [2,4]<br />
Prä- und intraoperative Diagnostik<br />
Hinsichtlich <strong>der</strong> zugrunde liegenden Funk-<br />
tionsstörung werden AK-Fehler grund-<br />
sätzlich in Stenosen, Insuffizienzen und<br />
kombinierte Erkrankungen eingeteilt.<br />
Klinische Beschwerden (Dyspnoe, Angina<br />
458<br />
pectoris, Schwindelgefühl) treten in <strong>der</strong><br />
Regel spätestens bei einem Schweregrad<br />
III auf [2,5] und zeigen dann bereits eine<br />
als dringlich einzuschätzende Operations-<br />
indikation an. Die präoperative kardiale<br />
Diagnostik umfasst neben einer Elektro-<br />
und Echokardiographie auch die Herzka-<br />
theteruntersuchung. Die weitere präope-<br />
rative Diagnostik sollte, wenn es die Zeit<br />
erlaubt, eine Carotis-Doppleruntersuchung<br />
und eine Fokussuche (HNO-ärztliche und<br />
zahnärztliche Diagnostik) beinhalten. Bei<br />
zusätzlicher Erkrankung <strong>der</strong> Aorta ascen-<br />
dens, etwa einem Aneurysma o<strong>der</strong> einer<br />
chronischen Dissektion, sind eine Compu-<br />
ter- (CT) o<strong>der</strong> eine Magnetresonanztomo-<br />
graphie (MRT) zu for<strong>der</strong>n.<br />
Hinsichtlich <strong>der</strong> Ätiologie <strong>der</strong> AK-Fehler<br />
kommen vor allem post-rheumatische,<br />
degenerative und entzündliche Erkrankungen<br />
(Endokarditis) in Betracht, [2,5]<br />
wobei die Aortenklappe anatomisch pri-<br />
mär tricuspidal o<strong>der</strong> (in ganz seltenen<br />
Fällen) bicuspid angelegt sein kann (Abb.<br />
1). Einen eher seltenen Fall stellt die Pro-<br />
thesenendokarditis nach AK-Voroperation<br />
dar. Grundsätzlich muss bei jedem AK-<br />
chirurgischen Patienten das operative Ziel<br />
verfolgt werden, die Klappenfunktionsstö-<br />
rung vollständig zu beheben. Im Rahmen<br />
des AK-Eingriffs erfolgen außerdem alle<br />
weiteren notwendigen Maßnahmen (zum<br />
Beispiel Mitralklappenrekonstruktion, Ko-<br />
ronarrevaskularisation o<strong>der</strong> Ablationschi-<br />
rurgie bei Vorhofflimmern [VHF] [6-8] ).<br />
Die Prothesen-Implantation/-Rekonstruk-<br />
tion wird intraoperativ routinemäßig mit-<br />
tels transoesophagealer Echokardiographie<br />
(TEE) beurteilt.<br />
Der chirurgische Eingriff<br />
Die Aortenklappe wird üblicherweise nach<br />
medianer Sternotomie über eine supra-<br />
valvuläre Inzision <strong>der</strong> Aorta ascendens<br />
dargestellt. Die minimal-invasive AK-<br />
Chirurgie (partielle Sternotomie) nimmt<br />
mit nur 3,5 Prozent <strong>der</strong> isolierten Aorten-<br />
klappeneingriffe einen verhältnismäßig<br />
geringen Anteil ein. [1] Nach Anschluss<br />
<strong>der</strong> Extrakorp<strong>oralen</strong> Zirkulation (EKZ),<br />
Kardioplegiegabe (Myokardprotektion,<br />
z. B. kristalloide Bretschnei<strong>der</strong>-Lösung o<strong>der</strong><br />
Blutkardioplegie) erfolgen die Inzision<br />
<strong>der</strong> Aorta ascendens und anschließend die<br />
AK-Inspektion. Bei schwer verkalkten AK-<br />
Fehlern mit hochgradiger Stenose ist ein<br />
Klappenersatz Methode <strong>der</strong> Wahl, wobei<br />
die Implantation „kleiner“ Klappenpro-<br />
thesen möglichst vermieden wird. Durch<br />
sorgfältige Entkalkung des Klappenanulus<br />
und die Wahl von Prothesen mit beson<strong>der</strong>s<br />
gutem Öffnungs-/Schließungsverhalten (=<br />
niedriger Gradient, kein valvulärer Reflux,<br />
z. B. Stentless-Perikardklappe) soll ein<br />
möglichst optimales hämodynamisches Er-<br />
gebnis erzielt werden (Abb. 2). Dies hängt<br />
vor allem auch vom Konzept <strong>der</strong> assoziierten<br />
chirurgischen Maßnahmen ab. [6-8]<br />
Relevante Fortschritte <strong>der</strong> vergangenen<br />
Jahre sind vor allem in <strong>der</strong> Entwicklung<br />
mo<strong>der</strong>ner Bioklappenprothesen zu sehen:<br />
einfachere Implantation = kürzere OP-<br />
Zeiten bei Stentless-Klappen, verbesserte<br />
feingewebliche Vorbehandlung/Konservie-
Abb. 1: Verkalktes Aortenklappenvitium mit führen<strong>der</strong> Stenose (tricuspidale/bicuspide Anlage). Der intraoperative<br />
Befund mit stark eingeschränkter Gewebebeweglichkeit spricht für eine post-rheumatische Genese.<br />
Abb. 2: Stentless-Bioklappe vor und nach Implantation (Material: Rin<strong>der</strong>perikard). Die Implantation erfolgt in<br />
fortlaufen<strong>der</strong> Nahttechnik.<br />
rung des Klappenmaterials. Ein klappener-<br />
haltendes rekonstruktives Vorgehen kommt<br />
insbeson<strong>der</strong>e bei Patienten mit AK-Insuffi-<br />
zienz in Betracht. Ein bewährtes Verfahren<br />
stellt hier die sogenannte David-Operation<br />
dar (AK-Rekonstruktion, Ascendensersatz<br />
mittels Gefäßprothese und Koronarostien-<br />
implantation in die Gefäßprothese; Abb. 3).<br />
Die Aortenklappenrekonstruktion im Sinne<br />
einer Anulus-/Wurzelraffung im Rahmen<br />
primärer Aorta-ascendens-Operationen ist<br />
ebenfalls ein langjährig bewährtes Routine-<br />
verfahren (Abb. 4). Bei schweren Verkal-<br />
kungen des Anulus und <strong>der</strong> Aortenwurzel<br />
bleibt die Implantation von Klappenprothe-<br />
sen mit Stent Methode <strong>der</strong> Wahl (Abb. 5).<br />
Ergebnisse und Nachsorge<br />
Die Zahl <strong>der</strong> in unserer Klinik durchge-<br />
führten AK-Operationen beträgt <strong>der</strong>zeit<br />
etwa 300 Eingriffe pro Jahr. Bei fast 60<br />
Pro-zent <strong>der</strong> Patienten ist eine zusätzliche<br />
Rekonstruktion <strong>der</strong> Mitralklappe, eine<br />
Ablationsbehandlung bei Vorhofflimmern<br />
o<strong>der</strong> eine koronare Bypassoperation Teil<br />
<strong>der</strong> notwendigen chirurgischen Maßnah-<br />
men. Das Durchschnittsalter <strong>der</strong> Aorten-<br />
klappen-Patienten liegt <strong>der</strong>zeit bei fast 75<br />
Jahren, meist besteht bereits ein klinisches<br />
Stadium III–IV. Die Operationszeit beträgt<br />
im Durchschnitt etwas über drei Stunden,<br />
die Entlassung zur weiteren Rehabilitation<br />
ist meist schon nach 8–9 Tagen möglich.<br />
Die perioperative Letalität (< 30 Tage) bei<br />
isolierten AK-Operationen beträgt in un-<br />
serer Klinik 1,8 Prozent (2003–2007; Bun-<br />
desdurchschnitt: 3,6 Prozent [1] ), weitere<br />
Komplikationen (Wundinfektion, Schlag-<br />
anfall, Pneumonie) liegen zusammen unter<br />
fünf Prozent. Die Mehrzahl <strong>der</strong> Patienten<br />
ist schon kurz nach <strong>der</strong> Operation wie<strong>der</strong><br />
gut belastbar und beschwerdefrei. Das<br />
postoperative <strong>Antikoagulation</strong>sschema<br />
sieht bei stabilem Sinusrhythmus, Bioklap-<br />
penimplantation o<strong>der</strong> AK-Rekonstruktion<br />
eine Phenprocoumongabe für maximal drei<br />
Monate vor. Bei Risikopatienten kann <strong>der</strong><br />
INR-Level etwas höher liegen o<strong>der</strong> zu-<br />
sätzlich ASS gegeben werden, eine Dauer-<br />
antikoagulation wird nur in Einzelfällen<br />
durchgeführt.<br />
Fazit und Ausblick<br />
Zur chirurgischen Behandlung von Aor-<br />
tenklappenerkrankungen stehen inzwi-<br />
schen hoch standardisierte und bewährte<br />
herzchirurgische Konzepte zur Verfügung.<br />
Sie beinhalten die konsequente Mitversor-<br />
gung einer begleitenden relevanten Mi-<br />
tralklappenerkrankung, einer koronaren<br />
Herzkrankheit und/o<strong>der</strong> eines Vorhofflim-<br />
merns. Verlässliche Klappenersatz- und<br />
Rekonstruktionsmethoden haben zu einer<br />
Minimierung des operativen Risikos und<br />
verbesserten individuellen Langzeitergeb-<br />
nissen bei schweren Aortenklappenfehlern<br />
beigetragen. Künftig werden außerdem –<br />
möglicherweise sogar bei einem größeren<br />
Teil <strong>der</strong> Patienten mit isolierten AK-Erkran-<br />
kungen o<strong>der</strong> überdurchschnittlich hohem<br />
Risikoprofil für einen konventionellen Ein-<br />
griff – perkutane Klappen-Implantations-<br />
verfahren (Kathetertechnik) o<strong>der</strong> transa-<br />
pikale Prozeduren (chirurgische Implan-<br />
tation über eine Punktion <strong>der</strong> Herzspitze)<br />
durchgeführt werden können. [9]<br />
Literatur<br />
[1] Gummert JF, Funkat A, Beckmann A et al. Cardiac<br />
surgery in germany during 2005: A report on behalf of the<br />
german society for thoracic and cardiovascular surgery.<br />
Thorac Cardiov Surg 2006; 54: 362-71.<br />
[2] Kouchoukos NT, Blackstone EH, Doty DB et al. In:<br />
Kirklin JW/Barratt-Boyes B: Cardiac Surgery, Third Edition<br />
(Churchill Livingstone, Philadelphia, USA). Aortic valve<br />
disease. 2003: Volume 1: 554–656.<br />
[3] Repossini A, Kotelnikov I, Bouchikhi R et al. Single-su-<br />
ture line placement of a pericardial stentless valve. J Thorac<br />
Cardiovasc Surg 2005; I30: I265-9.<br />
Herzchirurgie<br />
[4] David TE, Feindel CM. An aortic valve-sparing operati-<br />
on for patients with aortic incompetence and aneurysm of<br />
459
Medtropole | Ausgabe Oktober 2007<br />
Abb. 3: David-Operation: Rekonstruktion <strong>der</strong> Aortenklappe mit Ersatz <strong>der</strong> Aorta ascendens durch eine Gefäßprothese<br />
und Implantation <strong>der</strong> Koronararterien.<br />
Abb. 4: AK-Rekonstruktion im Rahmen einer Aorta-ascendens-Operation bei Aneurysma und erheblicher Erweiterung<br />
<strong>der</strong> Aortenwurzel. Durch Raffung mittels einer Filzleistenmanschette wird wie<strong>der</strong> ein kompetenter Klappenschluss erzielt.<br />
Abb. 5: Bioklappe mit Stent vor und nach Implantation. Hier hat sich die Implantation in Einzelnahttechnik bewährt,<br />
da so eine bestmögliche Verankerung <strong>der</strong> Klappenprothese garantiert werden kann.<br />
460<br />
the ascending aorta. J Thorac Cardiovasc Surg 1992;<br />
103 (4): 617-21.<br />
[5] Ostermeyer J, Geidel S, Laß M. In: Berger M, Domschke<br />
W, Hohenberger W, Meinertz T, Reinhardt D, Possinger K.<br />
Therapie-Handbuch. Chirurgische Therapie erworbener<br />
Herzklappenfehler. Urban & Fischer München 2005; C9: 1–6.<br />
[6] Geidel S, Laß M, Ostermeyer J. Operative Techniken<br />
<strong>der</strong> rekonstruktiven Mitralklappenchirurgie. Hamburger<br />
Ärzteblatt 2005; 2: 60-4.<br />
[7] Geidel S, Ostermeyer J, Laß M et al. Permanent atrial<br />
fibrillation ablation surgery in CABG and aortic valve pati-<br />
ents is at least as effective as in mitral valve disease. Thorac<br />
Cardiovasc Surg 2006; 54: 91-5.<br />
[8] Geidel S, Ostermeyer J. In: Berger M, Domschke W,<br />
Hohenberger W, Meinertz T, Possinger K, Reinhardt D.<br />
Therapie-Handbuch. Koronare Herzkrankheit: Chirur-<br />
gische Therapie. Urban & Fischer München, Jena 2007;<br />
C1.2: 1–13.<br />
[9] Walther T, Falk V, Kempfert J et al. Transapical minimal-<br />
ly invasive aortic valve implantation. Thorac Cardiovasc<br />
Surg 2007; 55, Suppl. 1, S. 37. [Presented at the 36th<br />
Annual Meeting, German Society of Thoracic, Cardiac and<br />
Vascular Surgery; Hamburg 11.-14.02.2007.]<br />
Kontakt<br />
Dr. Stephan Geidel<br />
PD Dr. Michael Laß<br />
Prof. Dr. Jörg Ostermeyer<br />
Hanseatisches Herzzentrum Hamburg<br />
Abteilung für Herzchirurgie<br />
<strong>Asklepios</strong> Klinik St. Georg<br />
Lohmühlenstraße 5, 20099 Hamburg<br />
Tel. (0 40) 18 18-85 41 50/41 51 (Sekretariat)<br />
Tel. (0 40) 18 18-85 22 61 (Normalstation)<br />
Tel. (0 40) 18 18-85 22 62 (Intensivstation)<br />
Tel. (0 40) 18 18-85 22 85 (Privatstation)<br />
Fax (0 40) 18 18-85 41 84<br />
E-Mail: s.geidel@asklepios.com
Abb. 5: LKG-Operation unter dem OP-Mikroskop in <strong>der</strong> <strong>Asklepios</strong> Klinik Nord (Kopfzentrum)<br />
Kin<strong>der</strong> mit Lippen-, Kiefer-,<br />
Gaumenspalten im Kopfzentrum<br />
Prof. Dr. Dr. Thomas Kreusch<br />
Lippen-, Kiefer-, Gaumenspalten sind eine <strong>der</strong> häufigsten Fehlbildungen bei Kin<strong>der</strong>n und treten mit einer Spaltbil-<br />
dung auf 500 Neugeborene auf. [1] Damit werden allein im Hamburger Raum pro Jahr fast 40 Kin<strong>der</strong> mit Lippen-,<br />
Kiefer-, Gaumenspalten geboren.<br />
Das Ausmaß <strong>der</strong> Spaltbildung kann variabel<br />
sein, es reicht von <strong>der</strong> Lippenkerbe o<strong>der</strong> <strong>der</strong><br />
gespaltenen Uvula bis zur doppelseitigen<br />
breiten Lippen-, Kiefer-, Gaumenspalte.<br />
Dabei ist die Lippe in ihrer Kontinuität unterbrochen,<br />
<strong>der</strong> harte und weiche Gaumen<br />
sowie <strong>der</strong> Alveolarfortsatz sind gespalten.<br />
Eine räumliche Trennung zwischen Mundund<br />
Nasenhöhle ist aufgehoben, die Zunge<br />
kann sich in die Spalte einlagern.<br />
Die Probleme für ein Spaltkind sind vielfältig:<br />
Ist <strong>der</strong> Gaumen betroffen, kann das Kind<br />
keinen Unterdruck aufbauen, um an <strong>der</strong><br />
Brust zu saugen – eine normale Ernährung<br />
ist oft nicht möglich.<br />
Durch Spalten, die den weichen Gaumen<br />
betreffen, kommt es zu einer Belüftungs-<br />
störung des Mittelohres. Chronische<br />
Mittelohrergüsse und daraus folgende<br />
Hörstörungen drohen.<br />
Die Sprachfunktion ist durch einen nicht<br />
möglichen velopharyngealen Abschluss<br />
beeinträchtigt.<br />
Es kann zu Zahn- und Kieferfehlstel-<br />
lungen kommen, seitliche Schneide-<br />
zähne können nicht angelegt sein.<br />
Hinzu kommt die ästhetische Beeinträch-<br />
tigung.<br />
Der Vielzahl <strong>der</strong> Beeinträchtigungen ent-<br />
sprechend, sollen Kin<strong>der</strong> mit LKG-Spalten<br />
in einem Spaltzentrum wie dem Kopfzen-<br />
trum <strong>der</strong> <strong>Asklepios</strong> Klinik Nord betreut<br />
werden, um alle Folgen <strong>der</strong> Spaltbildung<br />
gut zu korrigieren.<br />
Häufig wird eine LKG-Spalte bereits bei<br />
<strong>der</strong> Ultraschalluntersuchung in <strong>der</strong> 20.<br />
Herzchirurgie | Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie<br />
Schwangerschaftswoche erkannt. Natürlich<br />
erschrecken die Eltern zunächst über<br />
so eine Diagnose, aber sie bekommen<br />
sofort einen Termin in <strong>der</strong> Abteilung für<br />
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie. Hier<br />
werden sie ausführlich über die Fehlbildung<br />
aufgeklärt und über die Behandlungsschritte<br />
informiert, sodass ihnen die<br />
großen Sorgen um ihr ungeborenes Kind<br />
abgenommen werden. Auf Bil<strong>der</strong>n hier<br />
operierter Kin<strong>der</strong> erkennen sie, dass sich<br />
LKG-Spalten gut korrigieren lassen.<br />
Die Geburt von Kin<strong>der</strong>n mit Lippen-, Kiefer-,<br />
Gaumenspalten verläuft völlig normal<br />
und wird durch die Spalte nicht beeinflusst.<br />
Direkt nach <strong>der</strong> Geburt besucht <strong>der</strong> Mund-,<br />
Kiefer-, Gesichtschirurg die Mutter und das<br />
Neugeborene, untersucht das Kind gründ-<br />
461
Medtropole | Ausgabe Oktober 2007<br />
Abb. 1: Breite LKG-Spalte präoperativ Abb. 2: Breite LKG-Spalte postoperativ<br />
lich und stellt die endgültige Diagnose.<br />
Gemeinsam mit <strong>der</strong> Stillberaterin, die die<br />
Mutter bereits vor <strong>der</strong> Geburt beim ersten<br />
Gespräch kennengelernt hat, wird entschie-<br />
den, ob eine kleine Trinkplatte angefertigt<br />
werden muss. Damit wird in vielen Fällen<br />
auch bei Spaltkin<strong>der</strong>n die Ernährung an<br />
<strong>der</strong> Brust möglich. Gerade für Kin<strong>der</strong><br />
mit Lippen-, Kiefer-, Gaumenspalten ist<br />
die Ernährung mit Muttermilch wichtig,<br />
um eine möglichst gute Immunsituation<br />
aufzubauen.<br />
Nachdem die Kin<strong>der</strong>ärzte das Kind auf<br />
eventuelle weitere Fehlbildungen unter-<br />
sucht haben, übernimmt die Spaltsprech-<br />
stunde <strong>der</strong> Abteilung für Mund-, Kiefer-<br />
und Gesichtschirurgie nach Entlassung aus<br />
<strong>der</strong> Geburtsabteilung die weitere Betreu-<br />
ung. Dazu gehören weitere Beratungen<br />
und gegebenenfalls Kontrollen des Trink-<br />
plättchens.<br />
Um den dritten Lebensmonat herum er-<br />
folgt <strong>der</strong> Verschluss <strong>der</strong> Lippe als erster<br />
462<br />
operativer Eingriff. Vor <strong>der</strong> Operation<br />
inspiziert <strong>der</strong> HNO-Arzt in <strong>der</strong> gleichen<br />
Narkose die Trommelfelle und legt bei Be-<br />
darf kleine Drainageröhrchen ein. Danach<br />
operiert <strong>der</strong> MKG-Chirurg die Lippe unter<br />
dem Mikroskop und stellt sie durch Verla-<br />
gern <strong>der</strong> nicht verschlossenen Muskel- und<br />
Hautanteile in ihrer ursprünglichen Form<br />
wie<strong>der</strong> her. Gleichzeitig wird eine primäre<br />
Korrektur <strong>der</strong> Nase durchgeführt.<br />
Zwischen dem neunten und dem zwölften<br />
Monat erfolgt <strong>der</strong> Verschluss des Gaumens.<br />
In vielen Fällen können harter und weicher<br />
Gaumen gemeinsam verschlossen werden,<br />
sodass danach wesentliche Teile <strong>der</strong> Spalte<br />
endgültig verschlossen sind. Bei allen Ope-<br />
rationen von LKG-Kin<strong>der</strong>n wird immer<br />
ein Elternteil mit aufgenommen, damit<br />
die kleinen Patienten möglichst wenig<br />
aus ihrem normalen Rhythmus und ihrer<br />
normalen Umgebung herausgenommen<br />
werden.<br />
Bei Spaltbildungen, die den zahntra-<br />
genden Kieferteil umfassen, erfolgt um<br />
den zehnten Geburtstag <strong>der</strong> Verschluss <strong>der</strong><br />
Kieferspalte mit Knochen vom Becken-<br />
kamm. Damit wird sichergestellt, dass sich<br />
auch <strong>der</strong> Eckzahn, <strong>der</strong> häufig nicht normal<br />
durchbricht, in die Zahnreihe einstellen<br />
kann. In den meisten Fällen ist nach Wachs-<br />
tumsabschluss noch eine Nasenkorrektur<br />
erfor<strong>der</strong>lich, zum Beispiel die Korrektur<br />
<strong>der</strong> Nase auf Symmetrie, eine Verlängerung<br />
des Nasenstegs o<strong>der</strong> die Begradigung <strong>der</strong><br />
Nasenscheidewand.<br />
Alle operativen Eingriffe werden so geplant,<br />
dass das Wachstum möglichst wenig<br />
durch Narbenbildung beeinträchtigt wird.<br />
Zugleich soll <strong>der</strong> Verschluss <strong>der</strong> Spalte früh<br />
erfolgen, damit die ästhetische und funktionelle<br />
Rehabilitation möglichst perfekt<br />
gelingt.<br />
Alle Kin<strong>der</strong> werden in <strong>der</strong> Spaltsprechstunde<br />
durch das interdisziplinäre Team<br />
bis zum 18. Geburtstag regelmäßig betreut.<br />
Zwischen den jährlichen Kontrolluntersuchungen<br />
werden bei Bedarf weitere Kontrollen<br />
vereinbart. Alle Probleme und be-
Abb. 3: Doppelseitige LKG-Spalte präoperativ Abb. 4: Doppelseitige LKG-Spalte postoperativ<br />
handlungsbedürftigen Befunde, die mit <strong>der</strong><br />
LKG-Spalte zusammenhängen, werden<br />
hier in <strong>der</strong> Sprechstunde behandelt o<strong>der</strong><br />
die Behandlung wird organisiert.<br />
Eine erste logopädische Befun<strong>der</strong>hebung<br />
erfolgt bereits ab dem ersten Geburtstag.<br />
Bei Bedarf wird den Eltern <strong>der</strong> Kontakt<br />
zu mit Spaltkin<strong>der</strong>n erfahrenen Logo-<br />
päden vermittelt. Die kieferorthopä-<br />
dische Betreuung erfolgt ebenfalls durch<br />
Kieferorthopäden in Wohnortnähe <strong>der</strong><br />
Kin<strong>der</strong>. Alle mitbehandelnden Ärzte und<br />
Therapeuten werden mit regelmäßigen<br />
Arztbriefen über das weitere Vorgehen<br />
informiert.<br />
Auch erwachsene Patienten mit Lippen-,<br />
Kiefer-, Gaumenspalten können sich<br />
je<strong>der</strong>zeit im Kopfzentrum <strong>der</strong> <strong>Asklepios</strong><br />
Klinik Nord vorstellen. Die Behandlung<br />
von Lippen-, Kiefer-, Gaumenspalten ist<br />
eine gesetzliche Leistung <strong>der</strong> Krankenkas-<br />
sen, in diesem Fall übernehmen sie sogar<br />
die Kosten von Zahnimplantaten.<br />
Fazit<br />
Erfolgt die Behandlung <strong>der</strong>artiger Fehl-<br />
bildungen konsequent und frühzeitig in<br />
einem dafür ausgerüsteten Behandlungs-<br />
team, entwickeln sich Gesichtsweichteile<br />
und Kiefer normal, die Sprache ist in den<br />
meisten Fällen ungestört und das Hörver-<br />
mögen ist bei regelmäßiger Betreuung<br />
durch den Hals-, Nasen-, Ohrenarzt nor-<br />
mal. Das Problem <strong>der</strong> Lippen-, Kiefer-,<br />
Gaumenspalten ist aus dem öffentlichen<br />
Bewusstsein ein wenig verschwunden,<br />
weil die früher häufig durch von außen er-<br />
kennbare Narben und Funktionsstörungen<br />
entstellten Patienten durch frühzeitige<br />
perfekte Behandlung heute kaum noch<br />
zu erkennen sind. Obwohl die Häufigkeit<br />
von Lippen-, Kiefer-, Gaumenspalten<br />
weiter zunimmt, sind diese Fehlbildungen<br />
immer besser zu behandeln – solange die<br />
Betreuung in einem dafür ausgerüsteten<br />
Zentrum erfolgt.<br />
Literatur<br />
Kontakt<br />
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie<br />
[1] Hagberg C, Larson O, Milerad J. Incidence of Cleft<br />
Lip and Palate and risk of additional malformations, Cleft<br />
Palate Craniofacial J 1997; 35(1): 40-5.<br />
[2] Hausamen JE, Machtens E, Reuther J. Mund-, Kiefer-,<br />
Gesichtschirurgie. Berlin: Springer 1995.<br />
[3] Kreusch Th. Aktuelles Behandlungskonzept <strong>der</strong><br />
Lippen-, Kiefer-, Gaumenspalten. Chir Praxis 1999; 56:<br />
121-35.<br />
Prof. Dr. Dr. Thomas Kreusch<br />
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie,<br />
Plastische Operationen<br />
<strong>Asklepios</strong> Klinik Nord – Heidberg<br />
Tangstedter Landstraße 400<br />
22417 Hamburg<br />
Tel. (0 40) 18 18-87 34 91<br />
Fax (0 40) 18 18-87 37 67<br />
E-Mail: t.kreusch@asklepios.com<br />
463
Medtropole | Ausgabe Oktober 2007<br />
Abb. 1: Descensus vornehmlich des ventralen Kompart-<br />
ments<br />
Die laparoskopische<br />
Descensuschirurgie<br />
Dr. Christiane Thein<br />
Die Descensuschirurgie gewinnt durch die demografische Entwicklung erheblich an Bedeutung, da die Senkungs-<br />
problematik vor allem das höhere Lebensalter betrifft. Es ist davon auszugehen, dass 6,4 Prozent aller Frauen über<br />
60 Jahre aufgrund einer Descensusproblematik operiert werden. Die Ursachen des Descensus sind vielfältig, ein<br />
disponieren<strong>der</strong> Faktor ist <strong>der</strong> erhöhte intraabdominale Druck bei chronischen Atemwegserkrankungen wie auch<br />
bei Adipositas, aber auch eine genetisch bedingte o<strong>der</strong> eine aufgrund des Östrogendefizites im Alter bestehende<br />
Bindegewebsschwäche spielt eine wichtige Rolle.<br />
Die durch die Möglichkeiten <strong>der</strong> mo<strong>der</strong>-<br />
nen Medizin gesteigerte Lebensaktivität<br />
lässt die früher beliebte Pessartherapie<br />
immer mehr in den Hintergrund bzw. in<br />
das höhere Alter zurücktreten. Wichtige<br />
Argumente bei <strong>der</strong> Wahl eines operativen<br />
Verfahrens sind somit auch die Dauer des<br />
stationären Aufenthaltes und <strong>der</strong> postope-<br />
rativen subjektiven Beeinträchtigung <strong>der</strong><br />
Patientin. Hier liegt <strong>der</strong> Schwerpunkt <strong>der</strong><br />
laparoskopischen Verfahren.<br />
Zur Korrektur eines apikalen o<strong>der</strong> posteri-<br />
oren Descensus <strong>der</strong> Vaginalwand stünden<br />
neben <strong>der</strong> laparoskopischen Sacropexie die<br />
abdominale Sacropexie, die vaginale sacro-<br />
spinale Fixation nach Amreich-Richter o<strong>der</strong><br />
die Verankerung des Vaginalstumpfes an<br />
<strong>der</strong> vor<strong>der</strong>en Bauchwand über Faszien-<br />
streifen nach Williams und Richardson zur<br />
464<br />
Abb. 2: Präsentation des Promontorium Abb. 3: Das Lig. sacrouterinum als Leitstruktur <strong>der</strong><br />
Verfügung (Tab. 1). Eine weitere Möglich-<br />
keit bietet die infracoccygeale Sacrope-<br />
xie nach Petros mit Verwendung eines<br />
PDF-Bandes. Die abdominalen Verfahren<br />
sind durch die Laparotomiewunde stets<br />
mit entsprechendem Diskomfort für die<br />
Patientin verbunden. Sie bieten sich bei<br />
Kombinationseingriffen mit ausgedehnter<br />
Beckenbodenrekonstruktion an. Ebenso<br />
ermöglicht die vaginale Vorgehensweise<br />
nach Amreich-Richter weitergehende<br />
rekonstruktive Eingriffe, die häufig doch<br />
erfor<strong>der</strong>lich sind. Sie hat aber bei einsei-<br />
tiger Fixation des Vaginalstumpfes den<br />
Nachteil, dass die Vagina zur fixierten<br />
Seite abweicht. Hier würden die beidsei-<br />
tige Fixation o<strong>der</strong> die infracoccygeale Sa-<br />
cropexie Alternativen bieten. Die Fixation<br />
des Vaginalstumpfes nach Williams und<br />
Richardson bewirkt dagegen eine unphy-<br />
Präparation<br />
siologische Verlagerung des Apex vaginae<br />
nach ventral. Wir haben deshalb und we-<br />
gen <strong>der</strong> komplikationsträchtigen extrape-<br />
ritonealen Verlagerung <strong>der</strong> Faszienstreifen<br />
diese Form <strong>der</strong> Korrektur sowohl apikaler<br />
Defekte als auch Enterocelenkorrektur<br />
gänzlich verlassen.<br />
Die laparoskopische Sacropexie beschrie-<br />
ben Nezhat et al. erstmalig 1994. [1] Ihre<br />
Vorgehensweise bestand in <strong>der</strong> Anheftung<br />
eines alloplastischen Streifens an den Vagi-<br />
nalstumpf über nicht resorbierbare Fäden<br />
und Anheftung des cranialen Streifenendes<br />
an <strong>der</strong> Faszie des Os sacrum mit Klammer-<br />
o<strong>der</strong> konventioneller Naht. In dieser Serie<br />
wurden allerdings auch vor<strong>der</strong>e und hin-<br />
tere Kolporrhaphien als unterstützende<br />
Maßnahmen durchgeführt. Hier liegt auch<br />
das Problem <strong>der</strong> alleinigen sacrospinalen
Abb. 4: Physiologische Zugrichtung auf die Vagina bei<br />
sacrospinaler Fixation<br />
Fixation: das Auftreten von Rectocelen im<br />
weiteren Verlauf. Die laparoskopische Rec-<br />
tocelenbehandlung beschrieben Lyons und<br />
Winer 1997 mit Einlage eines Polyglaktinnetzes<br />
an <strong>der</strong> Scheidenhinterwand. [2]<br />
Eine weitere Lösung beschrieben Cutner<br />
und Spiteri mit <strong>der</strong> laparoskopischen Ap-<br />
plikation eines zusätzlichen resorbierbaren<br />
Meshes an <strong>der</strong> Vaginalhinterwand. [3] Wir<br />
bevorzugen das breitflächige Eröffnen des<br />
Peritoneums an <strong>der</strong> Scheidenhinterwand<br />
und das tiefe Ansetzen des Meshes mit<br />
Weiterführung bis zum Promontorium,<br />
um nicht ein weiteres Mesh einbringen zu<br />
müssen.<br />
Verfahren<br />
Die Lagerung <strong>der</strong> Patientin erfolgt in typi-<br />
scher Weise nach Trendelenburg. Ein umbi-<br />
likaler Trokar, ein 10-mm- und zwei 5-mm-<br />
Unterbauchtrokare werden eingebracht.<br />
Zur intraoperativen Darstellung und Prä-<br />
sentation des Scheidenstumpfes wird ein<br />
Manipulator in die Vagina appliziert. Das<br />
Peritoneum wird caudal des Ligamentum<br />
sacrouterinum breitflächig gespalten und<br />
das Promontorium dargestellt. Zunächst<br />
wird das Netz an <strong>der</strong> Scheidenhinterwand<br />
mit mehreren Nähten fixiert – durch ein<br />
Beckenbodendefekt<br />
Apikaler Defekt<br />
Lateraler Defekt ventral<br />
Zentraler Defekt ventral<br />
Defekt dorsal<br />
Tabelle 1<br />
tieferes Präparieren und schließlich auch<br />
Ansetzen des Meshes kann ein Descensus<br />
des posterioren Kompartments mitthe-<br />
rapiert werden – anschließend folgt die<br />
Annäherung des Vaginalstumpfes an das<br />
Promontorium. Die Fixierung wird hier<br />
mit Titanspiralklammern vorgenommen.<br />
Die konventionelle Annaht ist ebenfalls<br />
möglich, aber technisch erheblich aufwen-<br />
diger. Um einen theoretisch denkbaren<br />
mechanischen Ileus zu vermeiden folgt<br />
<strong>der</strong> Verschluss des Peritoneums, <strong>der</strong> aber<br />
nach Cutner und Spiteri nicht unbedingt<br />
erfor<strong>der</strong>lich sein soll.<br />
Die endgültige Fixierung des Netzstreifens<br />
darf nicht unter Spannung erfolgen. Es<br />
könnte sonst zum Ausreißen des Netzes<br />
o<strong>der</strong> zur Arrosion des Materials in die Va-<br />
gina kommen. Im Wesentlichen folgt die<br />
laparoskopische Technik somit dem kon-<br />
ventionellen Verfahren <strong>der</strong> abdominalen<br />
Sakropexie.<br />
Fazit<br />
Der Vorteil <strong>der</strong> laparoskopischen Sacro-<br />
pexie liegt klar auf <strong>der</strong> Seite des Pati-<br />
entenkomforts mit kurzem stationärem<br />
Aufenthalt und guter postoperativer<br />
Klinischer Aspekt<br />
Rekonvaleszenz bei einem ausgewählten<br />
Descensus uteri /<br />
Scheidenstumpfdescensus<br />
Traktionscystocele<br />
Pulsionscystocele<br />
Entero-Rectocele<br />
Gynäkologie<br />
Patientengut. Die möglichen Komplika-<br />
tionen entsprechen dem abdominalen<br />
Vorgehen mit Blutungen aus den para-<br />
sakralen Venenplexus, Periostschmerzen<br />
sowie Verletzung <strong>der</strong> Iliakalgefäße und<br />
des rechten Ureters.<br />
Literatur<br />
[1] Nehzat CH, Nezhat F, Nezhat CR. Laparoscopic sacral<br />
colpopexy for vaginal fault prolapse. Obstet Gynecol 1994;<br />
84: 885-8.<br />
[2] Lyons TL, Winer WK. Laparoscopic rectocele repair<br />
using polyglactin mesh. J Am Assoc Gynecol Laparosc<br />
1997; 4/3: 381-4.<br />
[3] Cutner A, Spiteri M. The use of submucosal small inte-<br />
stinal mesh in laparoscopic sacrocolpopexy and posterior<br />
vaginal repair. Gynecol surg 2005; 2: 187-9.<br />
Kontakt<br />
Hausinterne Therapie<br />
Sacrospinale Fixation /<br />
Infracoccygeale Sacropexie<br />
Lateral repair<br />
Anteriores mesh<br />
Anteriore Kolporrhaphie<br />
Hoher Douglasverschluss<br />
Posteriore Kolporrhaphie<br />
Dr. Christiane Thein<br />
Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe<br />
<strong>Asklepios</strong> Klinik Wandsbek<br />
Alphonsstraße 14, 22043 Hamburg<br />
Tel. (0 40) 18 18-83 14 63<br />
Fax (0 40) 18 18-83 16 33<br />
E-Mail: c.thein@asklepios.com<br />
465
Medtropole | Ausgabe Oktober 2007<br />
Burnout – das Laster <strong>der</strong> Mo<strong>der</strong>ne<br />
Prof. Dr. Michael Sadre Chirazi-Stark<br />
Daten <strong>der</strong> Krankenkassen zeigen eine extreme Zunahme [1] psychischer Erkrankungen vor allem bei Menschen<br />
zwischen dreißig und fünfzig, die auf <strong>der</strong> Höhe ihrer körperlichen Kräfte stehen und ihre Leistungsfähigkeit und<br />
Belastbarkeit viele Jahre bewiesen haben.<br />
Nach sechs Jahren spürte Herr K., Mana-<br />
ger, die ersten Symptome. Rückblickend<br />
fiel ihm auf, dass es im Urlaub immer län-<br />
ger dauerte, bis er abschalten konnte. Nach<br />
längerem Joggen und anschließen<strong>der</strong> Sau-<br />
na spürte er eines Tages plötzliches Herz-<br />
rasen: das erste somatische Warnzeichen.<br />
Der Notarzt konnte kardiologisch keinen<br />
auffälligen Befund erheben. Später erlitt K.<br />
Schwindelanfälle, manchmal wurden seine<br />
Arme taub, nachts suchten ihn Schwitz-<br />
attacken heim. Sein Leben setzte er wie<br />
gewohnt fort: Sorge um seine Frau, die seit<br />
Jahren immer wie<strong>der</strong> lebensbedrohliche<br />
Darmkoliken entwickelte, um seine beiden<br />
Töchter – die jüngere leidet an einem Auf-<br />
merksamkeitsdefizit-Syndrom – und vor<br />
allem um Job und Karriere. Er arbeitete<br />
rastlos, nahm regelmäßig Akten mit nach<br />
Hause, arbeitete fast bis Mitternacht und<br />
stand um fünf Uhr wie<strong>der</strong> auf. Nach einem<br />
Urlaub in Kalifornien, in dem er sich nicht<br />
erholt gefühlt hatte, erkrankte plötzlich<br />
seine Frau schwer, musste sofort operiert<br />
werden. Da kippte er und beschrieb ein<br />
Gefühl von Ausgeliefertsein, Angst, totaler<br />
Erschöpfung, das nicht mehr wich. Auch<br />
als seine Frau wie<strong>der</strong> zu Hause war, bekam<br />
er sich nicht mehr „in den Griff“. Eines<br />
Morgens schaffte er es nicht mehr, sich<br />
die Zähne zu putzen. Der Hausarzt wies<br />
ihn in die psychiatrische Klinik ein unter<br />
<strong>der</strong> Diagnose eines schweren depressiven<br />
Syndroms mit latenter Suizidalität.<br />
466<br />
Soziologen nennen den biografischen Ab-<br />
schnitt zwischen dem Ende <strong>der</strong> Ausbil-<br />
dung und <strong>der</strong> Lebensmitte griffig „Rush-<br />
hour des Lebens“. In dieser Zeit dränge<br />
sich alles zusammen: Familiengründung,<br />
Kin<strong>der</strong>betreuung und Berufseinstieg, dazu<br />
häufig <strong>der</strong> Erwerb eines Eigenheims und<br />
die Sorge um alt gewordene Eltern. Die<br />
Tücke dieser Lebensphase: eigentlich Unvereinbares<br />
müsse vereint werden. [4]<br />
Der Psychoanalytiker Herbert Freuden-<br />
berger prägte 1974 in einem Aufsatz den<br />
Begriff „Burnout“, <strong>der</strong> in den USA in kür-<br />
zester Zeit populär wurde. Es handelt<br />
sich nicht um eine gewöhnliche Arbeits-<br />
müdigkeit, son<strong>der</strong>n um einen Zustand<br />
wechselhafter Gefühle <strong>der</strong> Erschöpfung<br />
und Anspannung. [1] Der Begriff Burnout<br />
beschreibt etwas, das die klassische psychi-<br />
atrische Nomenklatur nicht vorhält, in <strong>der</strong><br />
er als Diagnose nicht existiert. Dort spricht<br />
man von einer „Anpassungsstörung“, „Be-<br />
lastungsstörung“ o<strong>der</strong> „depressiven Stö-<br />
rung“. Aber in dieser Terminologie hat im-<br />
mer <strong>der</strong> Patient Schuld – er ist ‚„gestört“.<br />
Burnout dagegen vermittelt das Gefühl,<br />
Ursache seien die Umstände, er klingt nach<br />
kollektivem Schicksal. [7,5] Das entlastet.<br />
Pathogenese<br />
Burnout beginnt mit Überaktivität, „über-<br />
triebenem“ Engagement, Hyperaktivität,<br />
einem Gefühl <strong>der</strong> Unentbehrlichkeit, Ver-<br />
leugnung eigener Bedürfnisse und das<br />
gesteigerte Engagement wird von Erschöp-<br />
fungssymptomen wie chronischer Mü-<br />
digkeit und Energiemangel begleitet. Der<br />
überaktiven Phase folgen ein emotionaler,<br />
geistiger und verhaltensmäßiger Rückzug<br />
von <strong>der</strong> Arbeit und <strong>der</strong> sozialen Umwelt<br />
allgemein. Emotional beschreiben Betrof-<br />
fene den Verlust positiver Gefühle, eine<br />
emotionale Distanzierung, die Stereoty-<br />
pisierung an<strong>der</strong>er Personen, Schuldzuwei-<br />
sung auf an<strong>der</strong>e, ein allgemeines Gefühl<br />
abzustumpfen und härter/zynischer zu<br />
werden. Die Folge sind Kontaktverlust,<br />
Verlust von Idealismus, eine negative Ein-<br />
stellung zur Arbeit und erhöhte Ansprü-<br />
che als Folge <strong>der</strong> „inneren Kündigung“.<br />
Dann folgen ein tatsächlicher Abbau <strong>der</strong><br />
Leistungsfähigkeit, <strong>der</strong> Konzentration, <strong>der</strong><br />
Motivation und <strong>der</strong> Kreativität. Konzen-<br />
trationsschwächen bei <strong>der</strong> Arbeit führen<br />
zur Desorganisation, zu unsystematischer<br />
Arbeitsplanung, Entscheidungsunfähigkeit<br />
und insgesamt verringerter Initiative, da-<br />
mit Fehlen von Erneuerungsvorschlägen,<br />
einer verringerten Flexibilität. Letztlich<br />
entsteht ein rigides Schwarz-Weiß-Denken,<br />
Dienst nach Vorschrift und Wi<strong>der</strong>stand ge-<br />
gen Verän<strong>der</strong>ungen aller Art.<br />
Schließlich droht eine ausgeprägte de-<br />
pressive Reaktion mit Verzweiflung, ver-<br />
stärkten Hilflosigkeitsgefühlen bis hin zu
Wie erkenne ich Burnout?<br />
Psychosomatische Reaktionen<br />
Unfähigkeit zur Entspannung in <strong>der</strong><br />
Freizeit<br />
Schlafstörungen<br />
Muskelverspannungen<br />
Kopfschmerzen<br />
Magen-Darm-Beschwerden<br />
Vegetative Folgen (Herzklopfen,<br />
erhöhter Blutdruck)<br />
Engegefühl in <strong>der</strong> Brust<br />
Reduzierte Immunabwehr<br />
existenzieller Verzweiflung, allgemeiner<br />
Hoffnungslosigkeit und dem Gefühl <strong>der</strong><br />
Sinnlosigkeit des Lebens. [3]<br />
Wer ist gefährdet?<br />
Gefährdet sind Personen mit fast immer<br />
Mehrfachbelastungen, Tätigkeiten mit<br />
hohem Zeit-, Kosten- und Termindruck bei<br />
gleichzeitig „schlechtem Arbeitsklima“,<br />
sowie mit Berufen, die in <strong>der</strong> Gesellschaft<br />
relativ geringe Anerkennung finden<br />
(z. B. sozialen, pflegerischen o<strong>der</strong> päda-<br />
gogischen Berufen).<br />
Ursachen<br />
Beim Burnout lassen sich persönliche Ur-<br />
sachen unterscheiden wie ungünstiges<br />
Stressmanagement, hohe Erwartungen und<br />
Ansprüche an sich selbst, starke Emotiona-<br />
lität, labiles Selbstwertgefühl, ausgeprägter<br />
Wunsch nach Anerkennung, unrealistische<br />
Situationswahrnehmung.<br />
Zu den sozialen und organisationspsy-<br />
chologischen Ursachen gehören unklare<br />
Erfolgskriterien, fehlendes Feedback, we-<br />
nig Anerkennung, Mangel an Autonomie,<br />
Handlungs- und Entfaltungsspielraum,<br />
Überfor<strong>der</strong>ung und Zeitdruck, negatives<br />
Betriebsklima, allgemeine Unzufrieden-<br />
heit, gleichförmige Routine und wenig<br />
soziale Unterstützung.<br />
Behandlungsansätze<br />
Die Behandlungsansätze richten sich da-<br />
nach, welche Problematik im Vor<strong>der</strong>grund<br />
steht. Dabei reichen die Interventionen von<br />
Folgen des Burnout<br />
sozialer Beratung bis zur Notwendigkeit<br />
einer fundierten Psychotherapie und Psy-<br />
chopharmakatherapie.<br />
Arbeitsplatz: Kreative und herausfor<strong>der</strong>n-<br />
de Arbeitsmilieus suchen, Verantwortung<br />
übernehmen, Begeisterung (wie<strong>der</strong>) her-<br />
stellen, Coaching für effektivere Arbeits-<br />
abläufe.<br />
Stress: Stressmanagement entwickeln,<br />
Überlastungszeichen erkennen, Balance<br />
zwischen Spannung und Entspannung<br />
herstellen, Hobbys pflegen.<br />
Persönlichkeit: Mentale Einstellungen zu<br />
Arbeit und Leistung klären, Motive für<br />
persönliches Engagement analysieren,<br />
Kränkbarkeiten bearbeiten, Gratifikationen<br />
und Anerkennung außerhalb des Berufs<br />
suchen.<br />
Stationäre, teilstationäre und ambulante<br />
therapeutische Angebote im <strong>Asklepios</strong><br />
Westklinikum Hamburg bieten die Abtei-<br />
lung für Psychosomatik (Chefarzt: Prof.<br />
Dr. Dr. Stephan Ahrens), wenn somatische<br />
Komplikationen im Vor<strong>der</strong>grund stehen,<br />
und die Abteilung für Psychiatrie und<br />
Psychotherapie (Chefarzt: Prof. Dr. Micha-<br />
el Sadre Chirazi-Stark), wenn latente bis<br />
akute Suizidalität das Erleben bestimmt.<br />
Literatur<br />
Verflachen <strong>der</strong> Freizeitaktivitäten:<br />
TV-Konsum<br />
Alkohol- und Zigarettenkonsum<br />
Missbrauch von Beruhigungs-<br />
mitteln<br />
Gestörtes Essverhalten<br />
Ehe- und Familienprobleme<br />
Häufiger Arbeitsplatzwechsel<br />
o<strong>der</strong> Ausstieg aus dem Beruf<br />
[1] Bauer J, Häfner St, Kächele H, Wirsching M, Dahl-<br />
ben<strong>der</strong> R. Burn-out und Wie<strong>der</strong>gewinnung seelischer<br />
Gesundheit am Arbeitsplatz. Psychother Psych Med 2003;<br />
53(5): 213-22.<br />
[2] Cohen DJ, Tallia AF, Crabtree BF, Young DM. Imple-<br />
menting health behavior change in primary care: lessons<br />
Psychiatrie und Psychotherapie<br />
from prescription for health. Annals of family medicine.<br />
2005; 3(0): S. 12-9.<br />
[3] De Vente W, Olff M, Van Amsterdam JGC, Kamphuis<br />
JH, Emmelkamp PMG. Physiological differences between<br />
burnout patients and healthy controls: blood pressure,<br />
heart rate, and cortisol responses. Occupational and envi-<br />
ronmental medicine. 2003; 60(0): i54–61.<br />
[4] Hillert & Marwitz. Die Burnout Epidemie o<strong>der</strong>: Brennt<br />
die Leistungsgesellschaft aus? Beck Verlag, 2007.<br />
[5] Reime B, Steiner I. Ausgebrannt o<strong>der</strong> depressiv? PPmP<br />
Psychother Psychosom med Psychol 2001; 51(8): 304-7.<br />
[6] Stark & Sandmeyer. Wenn die Seele SOS funkt. Fitness-<br />
kur gegen Stress und Überlastung. rororo Taschenbuch, 2004.<br />
[7] Weber A; Jaekel-Reinhard A. Burnout syndrome:<br />
a disease of mo<strong>der</strong>n societies? Occupational medicine<br />
(Oxford, England) 2000; 50(7): 512-7.<br />
Kontakt<br />
Prof. Dr. Michael Sadre Chirazi-Stark<br />
Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie<br />
<strong>Asklepios</strong> Westklinikum Hamburg<br />
Suurheid 20, 22559 Hamburg<br />
Tel. (0 40) 18 18-28 65<br />
Fax (0 40) 18 18-28 20<br />
E-Mail: m.stark@asklepios.com<br />
Prof. Dr. Dr. Stephan Ahrens<br />
Abteilung für Psychosomatische Medizin<br />
Tel. (0 40) 18 18-25 00<br />
E-Mail: s.ahrens@asklepios.com<br />
Weitere Informationen:<br />
www.burnon.de<br />
www.prof-stark.de<br />
www.tagesklinik-ulmenhof.de<br />
467
Medtropole | Ausgabe Oktober 2007<br />
Abb. 1: Inkompl. Kopfluxation nach dorsal Abb. 3: CT-Kontrolle nach Reposition<br />
Diagnostik und Therapie von<br />
Halswirbelsäulenverletzungen<br />
Dr. Norbert Hennig, Dr. Jürgen Ma<strong>der</strong>t<br />
Frakturen und Instabilitäten <strong>der</strong> Halswirbelsäule sind seltene, jedoch mit einer hohen neurologischen Komplika-<br />
tionsrate einhergehende schwerwiegende Verletzungen, die eine auf das einzelne Verletzungsmuster abgestimmte<br />
spezielle Therapie erfor<strong>der</strong>n. Circa 60 Prozent aller Querschnittslähmungen betreffen Menschen im Alter zwischen<br />
15 und 30 Jahren. Während 15–20 Prozent aller BWS-/LWS-Verletzungen neurologische Ausfallserscheinungen<br />
aufweisen, liegt die Rate im Bereich <strong>der</strong> Halswirbelsäule bei 40 Prozent. Im Chirurgisch-Traumatologischen Zen-<br />
trum <strong>der</strong> <strong>Asklepios</strong> Klinik St. Georg werden pro Jahr rund 1.000 Wirbelsäuleneingriffe bei traumatologischen und<br />
degenerativen Krankheitsbil<strong>der</strong>n durchgeführt, <strong>der</strong> Anteil verletzungsbedingter Frakturen o<strong>der</strong> Instabilitäten <strong>der</strong><br />
HWS liegt hier bei etwa drei bis vier Prozent (30–40/Jahr).<br />
Erste Hilfe<br />
Bei Verdacht auf eine HWS-Verletzung<br />
sind brüske Manöver und starke Bewe-<br />
gungsausschläge <strong>der</strong> HWS zu vermeiden.<br />
Angestrebt wird eine „In-Line“-Lage-<br />
rung: Die HWS sollte in anatomischer<br />
Achse gelagert und dann mit einer festen<br />
Stütze („Stiff-Neck“) stabilisiert werden.<br />
Kontraindikationen sind Spasmus <strong>der</strong><br />
Nackenmuskulatur sowie Zunahme von<br />
Schmerzen o<strong>der</strong> neurologischen Ausfällen.<br />
Bei Beachtung dieser Maßnahmen kommt<br />
468<br />
es in <strong>der</strong> Regel zu keiner Zunahme <strong>der</strong><br />
WS-Pathologie.<br />
Verletzungsarten<br />
Zu unterscheiden sind Verletzungen <strong>der</strong><br />
oberen (C0–C2) und unteren (C3–C7)<br />
HWS. Während die Wirbel HWK-3 bis<br />
LWK-5 die gleiche anatomische Grund-<br />
struktur aufweisen, zeigen HWK-1 und<br />
-2 Beson<strong>der</strong>heiten. So fehlt zum Beispiel<br />
bei Atlas und Axis <strong>der</strong> Wirbelkörper, <strong>der</strong><br />
Axis hat einen zahnartigen Fortsatz (Dens)<br />
etc., was sich auch im Verletzungsmuster<br />
nie<strong>der</strong>schlägt.<br />
Die Frakturklassifikation <strong>der</strong> unteren HWS<br />
orientiert sich an <strong>der</strong> Einteilung von Verlet-<br />
zungen <strong>der</strong> BWS und LWS nach Magerl et<br />
al. [1] (A = Kompressionsverletzungen, B<br />
= Distraktionsverletzungen, C = Rotati-<br />
onsverletzungen), die an <strong>der</strong> oberen HWS<br />
wird individuell auf die Höhe bezogen.<br />
Typische Verletzungen <strong>der</strong> oberen HWS:<br />
Luxation des Kopfes (atlanto-occipitale
Abb. 2: Behandlung im Halo-Fixateur Abb. 4: Pathologische HWK-2 Fraktur Abb. 5: Distraktionsspondylodese<br />
Dislokation, meist letal)<br />
Fraktur des Atlas inkl. Berstungsbruch<br />
(= Jefferson-Fraktur)<br />
Fraktur des Dens axis (Einteilung nach<br />
An<strong>der</strong>son/D’Alonzo) [2]<br />
HWK-2-Bogenfraktur inkl. Segment-<br />
instabilität (= Hangman-fracture besser<br />
Hanged-man-fracture, Einteilung nach<br />
Effendi)<br />
Während bei jüngeren Patienten typi-<br />
scherweise Verkehrsunfälle bzw. Rasanz-<br />
traumen für Verletzungen <strong>der</strong> HWS<br />
verantwortlich sind, finden sich im Alter<br />
bei bereits bestehenden degenerativen<br />
Vorschäden oft Bagatelltraumen als Ursa-<br />
che von Verletzungen, häufig begleitet mit<br />
neurologischen Ausfällen und im oberen<br />
HWS-Bereich angesiedelt (Densfraktur =<br />
häufigste isolierte HWS-Frakturen bei Pat.<br />
> 70 Jahre).<br />
Symptome und Diagnostik<br />
Wesentlich für die Einschätzung <strong>der</strong> Ver-<br />
letzungsschwere sind Anamnese bzw.<br />
Unfallhergang, <strong>der</strong> klinische Befund und<br />
die bildgebende Diagnostik.<br />
Bei sedierten polytraumatisierten Patienten<br />
fehlen häufig klinische Zeichen, damit ist<br />
die Gefahr einer nicht erkannten Instabili-<br />
tät mit möglicherweise schwerwiegenden<br />
Folgen gegeben. Hier gilt <strong>der</strong> Grundsatz: je<br />
vigilanzgemin<strong>der</strong>ter <strong>der</strong> Verletzte ist, desto<br />
mehr bildgebende Diagnostik ist indiziert.<br />
Bei jedem Verdacht auf eine Verletzung<br />
<strong>der</strong> Halswirbelsäule muss daher eine ab-<br />
gestufte Diagnostik erfolgen. Neben <strong>der</strong><br />
Anamnese wird eine gründliche Unter-<br />
suchung <strong>der</strong> HWS durchgeführt, wobei<br />
auf Prellmarken, Abschürfungen geachtet<br />
wird. Kann ein vigilanter Patient be-<br />
schwerdefrei bzw. -arm die HWS bewegen,<br />
ist die Gefahr einer Verletzung gering. Zur<br />
Untersuchung gehört weiter das Auslö-<br />
sen von Schmerzen bei Druck, passivem<br />
Nachbewegen, Stauchung und Rotation.<br />
Eine neurologische Untersuchung mit<br />
Kraftgradmessungen und Sensibilitätsprü-<br />
fung ist selbstverständlich. Im Regelfall<br />
erfolgt als weitere diagnostische Stufe das<br />
Röntgen nativ: HWS ap und seitlich sowie<br />
Unfallchirurgie<br />
Dens-Zielaufnahme. Die klassische Ver-<br />
letzungshöhe <strong>der</strong> HWS ist <strong>der</strong> Übergang<br />
vom flexibel zum starren WS-Abschnitt<br />
also HWK 6–7, <strong>der</strong> allerdings auf den Rö-<br />
Aufnahmen auch dargestellt sein sollte.<br />
Zeigen diese Rö-Bil<strong>der</strong> keine Frakturzei-<br />
chen, keine WK-Verschiebungen, ist <strong>der</strong><br />
Weichteilschatten normal, dann muss noch<br />
die discoligamentäre Instabilität mittels<br />
Funktionsaufnahmen ausgeschlossen wer-<br />
den. Das CT ist Röntgen mit feineren Mit-<br />
teln und an<strong>der</strong>er Ebene und natürlich die<br />
eigentliche Grundlage zur Beurteilung von<br />
Frakturen und Luxationen. Das MR bleibt<br />
unklaren neurologischen Ausfällen, dem<br />
Screening (z. B. Alter <strong>der</strong> Fraktur) und mit<br />
Vorsicht auch Bandrupturen vorbehalten.<br />
Therapiegrundsätze<br />
Das Ziel <strong>der</strong> Therapie bei HWS-Verlet-<br />
zungen besteht in <strong>der</strong><br />
1. Reposition von Fraktur o<strong>der</strong> Luxation<br />
2. Behandlung bzw. Prophylaxe neurologischer<br />
Komplikationen (Dekompression)<br />
3. Stabilisierung bzw. dauerhaften Fusion<br />
469
Medtropole | Ausgabe Oktober 2007<br />
Abb. 6: HWK-2-Bogenfraktur mit erheblicher<br />
Dislokation<br />
Abb. 10: HWK-5-Fraktur mit Bandscheibenzerreißung Abb. 7: Dorsale Fusion über Knochenspan und transartikuläre Verschraubung<br />
des instabilen HWS-Segments.<br />
Eine konservative Behandlung ist gerecht-<br />
fertigt bei stabilen Frakturformen bzw.<br />
Frakturen mit <strong>der</strong> Möglichkeit <strong>der</strong> konse-<br />
quenten äußeren Ruhigstellung im sog.<br />
Stiff-Neck o<strong>der</strong> Halo-Fixateur, häufig<br />
möglich bei Verletzungen im oberen HWS-<br />
Bereich.<br />
Konservative Therapie ist im Regelfall<br />
angezeigt bei<br />
470<br />
Frakturen <strong>der</strong> occipitalen Condylen ohne<br />
Instabilität<br />
Inkompletten Kopfluxationen<br />
(atlanto-occipitale Luxation)<br />
Nicht verschobenen, einfachen Atlas-<br />
bogenfrakturen<br />
Frakturen des Dens im Bogenbereich<br />
(Typ III) o<strong>der</strong> Spitze (Typ I nach An<strong>der</strong>-<br />
son/D’Alonzo)<br />
N0icht dislozierten HWK-2-Bogenfrakturen<br />
(Typ I nach Effendi) [3]<br />
Deckplattenimpressionen sowie isolier-<br />
ten Quer- und Dornfortsatzfrakturen <strong>der</strong><br />
unteren HWS<br />
Indikationen zur operativen Therapie<br />
bestehen bei<br />
Kompletten atlanto-occipitalen Luxa-<br />
tionen<br />
Densfrakturen im Bereich <strong>der</strong> Basis (Typ<br />
II nach An<strong>der</strong>son/D’Alonzo) [2]<br />
Berstungsbrücken des Atlas (= Jefferson-<br />
Fraktur)<br />
HWK-2-Bogenfrakturen mit Dislokation<br />
vor allem des ventralen Bogenanteils<br />
(Typ II u. III nach Effendi) [3]<br />
Discoligamentären Instabilitäten<br />
Frakturen mit Hinterkantenbeteiligung<br />
und/o<strong>der</strong> Bandscheibenzerreißung <strong>der</strong><br />
unteren HWS<br />
Bei offenen Verletzungen, hochgradigen<br />
Instabilitäten und zunehmenden neurolo-<br />
gischen Ausfällen o<strong>der</strong> Ausfällen im Inter-<br />
vall ist die sofortige Versorgung indiziert.<br />
Ein geringer Zeitaufschub ist möglich bei<br />
Verletzungen ohne neurologische Ausfälle<br />
und möglicher Reposition bei sicherer<br />
Retention z. B. im Stiff-Neck.<br />
Operationstechniken<br />
Abhängig von den verschiedenen Fraktur-<br />
bzw. Instabilitätstypen haben sich für die<br />
einzelnen Indikationen spezielle Operati-<br />
onsmethoden etabliert.<br />
Bei <strong>der</strong> inkompletten Kopfluxation bietet<br />
sich die Versorgung mit dem Halo-Fixa-<br />
teur an (Abb. 1–3), bei <strong>der</strong> kompletten und<br />
damit hochinstabilen Luxation („<strong>der</strong> Kopf<br />
ist abgerissen“) die dorsale kurzstreckige<br />
Spondylodese. Atlasberstungsfrakturen<br />
mit Dislokation (Jefferson-Fraktur), bei<br />
denen die eingeleitete axiale Kraft die<br />
Kondylen nach lateral verschiebt, können<br />
mit einem Halo-Fixateur versorgt werden,<br />
einer winkelstabilen Distraktionsspondylo-<br />
dese (Abb. 4 + 5) o<strong>der</strong> einer transarti-<br />
kulären Verschraubung HWK 1/2 mit<br />
dorsaler Fusion durch einem Knochenspan<br />
und Drahtschlinge (Abb. 6 + 7). Bei <strong>der</strong><br />
Densfraktur stellt die ventrale direkte<br />
Verschraubung die Standardmethode<br />
beim Typ II dar, bei älteren Patienten mit<br />
hochgradiger Osteoporose bevorzugen<br />
wir in <strong>der</strong> <strong>Asklepios</strong> Klinik St. Georg die
transartikuläre Verschraubung C1/C2<br />
über den wenig belastenden ventralen<br />
Zugang (Abb. 8 + 9). Bei <strong>der</strong> dislozierten<br />
HWK-2-Bogenfraktur (Typ II u. III n. Ef-<br />
fendi), Frakturen und discoligamentären<br />
Instabilitäten in allen möglichen Kombi-<br />
nationen <strong>der</strong> unteren HWS hat sich seit<br />
Jahren die Reposition mit winkelstabiler<br />
Plattenspondylodese und corticospon-<br />
giöser Span-Implantation (Abb. 10 + 11)<br />
über einen ventralen Zugang etabliert,<br />
wobei grobe Instabilitäten insbeson<strong>der</strong>e<br />
mit dorsaler Gelenkverhakung zum Teil<br />
ein kombiniertes ventrales und dorsales<br />
Vorgehen erfor<strong>der</strong>lich machen.<br />
Fazit<br />
Frakturen beziehungsweise instabile Verlet-<br />
zungen <strong>der</strong> Halswirbelsäule sind schwer-<br />
wiegende Verletzungen, bei denen insbe-<br />
son<strong>der</strong>e bei unklarer Anamnese und Klinik<br />
o<strong>der</strong> beim mehrfachverletzten Patienten<br />
die Gefahr einer Fehleinschätzung gegeben<br />
ist. Deshalb ist eine weitgehende Diagnos-<br />
tik unerlässlich. Für die verschiedenen<br />
Abb. 11: Ventrale Plattenspondylodese mit Knochenspan<br />
Verletzungsformen an oberer und unterer<br />
Halswirbelsäule ist die richtige Interpre-<br />
tation <strong>der</strong> klinischen und radiologischen<br />
Befunde von entscheiden<strong>der</strong> Bedeutung,<br />
um das weitere Vorgehen zu planen.<br />
Neben den üblichen Standardtherapien<br />
empfiehlt sich häufig auch ein individuell<br />
angepasstes Vorgehen zum Beispiel in Zu-<br />
sammenarbeit mit <strong>der</strong> neurochirurgischen<br />
Abteilung des Hauses. Die definitive Ver-<br />
sorgung schwerwiegen<strong>der</strong> Verletzungen<br />
<strong>der</strong> Halswirbelsäule sollte daher möglichst<br />
spezialisierten Zentren vorbehalten bleiben,<br />
wobei <strong>der</strong> Primärdiagnostik und Versor-<br />
gung im erstbehandelnden Krankenhaus<br />
bereits eine entscheidende Rolle zukommt.<br />
Literatur<br />
[1] Magerl F, Aebi M. A comprehensive classsification of<br />
thoracic and lumbar injuries in: Aebi M, Thalgott JS, Webb<br />
JK. AO ASIF Principles in Spine Surgery. Springer-Verlag<br />
1998.<br />
[2] An<strong>der</strong>son LD, D‘Alonzo RT. Fractures of the odontoid<br />
process of the axis. J Bone Jt Surg 1974; 56A: 1663-74.<br />
[3] Effendi BD, Roy D, Corsinsh B, Dussault RG, Lauring<br />
CA. Fractures of the ring of the axis: a classification based<br />
Kontakt<br />
Dr. Norbert Hennig<br />
Unfallchirurgie<br />
on the analysis of 131 cases. J Bone Jt Surg 1981; 63B:<br />
319-27.<br />
Abb. 8: Dislozierte Denzbasis-Fraktur<br />
Abb. 9: Ventrale transartikuläre Schrauben-<br />
osteosynthese<br />
[4] Blauth M. Obere und untere HWS in Tscherne H, Blau-<br />
th M. Unfallchirurgie Wirbelsäule. Springer-Verlag 1998.<br />
[5] Bühren V. Frakturen und Instabilitäten <strong>der</strong> Halswirbel-<br />
säule. Unfallchirurg 2002; 73; 1049-66.<br />
Chirugisch-Traumatologisches Zentrum<br />
Abt. für Unfall- und Wie<strong>der</strong>herstellungs-<br />
chirurgie / Ltg. Prof. Dr. C. Eggers<br />
<strong>Asklepios</strong> Klinik St. Georg<br />
Lohmühlenstraße 5, 20099 Hamburg<br />
Tel. (0 40) 18 18-85 42 95<br />
Tel. (0 40) 18 18-85 37 70<br />
E-Mail: n.hennig@asklepios.com<br />
471
Medtropole | Ausgabe Oktober 2007<br />
Vorhofflimmern und<br />
<strong>Antikoagulation</strong> – Reveal ® XT<br />
Dr. Christian Frerker, Dr. K. R. Julian Chun, Dr. Carsten Tack, Prof. Dr. Karl-Heinz Kuck<br />
Vorhofflimmern ist die <strong>der</strong>zeit häufigste anhaltende Herzrhythmusstörung – mit steigen<strong>der</strong> Prävalenz im Alter.<br />
Nach Schätzungen sind gegenwärtig rund 4,5 Millionen EU-Bürger an Vorhofflimmern erkrankt [1] , wobei sich<br />
diese Zahl in den nächsten Jahren durch den demografischen Wandel noch deutlich erhöhen wird.<br />
Die Behandlung des Vorhofflimmerns ge-<br />
staltet sich oft schwierig, da einige Pati-<br />
enten einzelne Phasen nicht wahrnehmen<br />
und somit asymptomatisch bleiben. Eines<br />
<strong>der</strong> Hauptrisiken dieser Herzrhythmusstö-<br />
rung ist jedoch das bis zu siebenfach er-<br />
höhte Schlaganfallrisiko [1] , demzufolge<br />
immer wie<strong>der</strong> die Frage <strong>der</strong> <strong>oralen</strong> Anti-<br />
koagulation mit den entsprechenden Risi-<br />
ken und Compliancefragen kontrovers<br />
diskutiert wird.<br />
Gerade in <strong>der</strong> nie<strong>der</strong>gelassenen ärztlichen<br />
Betreuung <strong>der</strong> betroffenen Patienten, zum<br />
Beispiel vor Zahnarztbesuchen o<strong>der</strong> Ope-<br />
rationen, kristallisiert sich die systemische<br />
<strong>Antikoagulation</strong> bei Vorhofflimmern als<br />
ein nicht unerhebliches Problem heraus.<br />
Viele Patienten sind durch ihr Vorhofflim-<br />
mern in ihrer Lebensqualität und allgemei-<br />
nen Belastbarkeit so stark eingeschränkt,<br />
dass das Wie<strong>der</strong>erlangen und Aufrecht-<br />
erhalten des Sinusrhythmus für sie einen<br />
deutlichen Gewinn an Lebensqualität be-<br />
deutet. [2]<br />
Die medikamentöse antiarrhythmische<br />
Therapie ist nur in rund 50 Prozent <strong>der</strong><br />
Fälle erfolgreich, zudem sind dabei die<br />
dauerhafte Einnahme von Medikamen-<br />
ten und mögliche Nebenwirkungen zu<br />
berücksichtigen. Als kurative Option ist<br />
die interventionelle Katheterablation im<br />
Therapiemanagement des Vorhofflim-<br />
merns nach internationalen Leitlinien <strong>der</strong><br />
fachkardiologischen Gesellschaften bereits<br />
nach einem frustranen antiarrhythmischen<br />
medikamentösen Versuch möglich. [1,3,4]<br />
Zunehmend lehnen – vor allem jüngere –<br />
Patienten eine dauerhafte antiarrhyth-<br />
472<br />
mische Medikamenteneinnahme ab und<br />
entscheiden sich für eine primäre Kathe-<br />
terablation.<br />
Die kurative Katheterablation von Vorhof-<br />
flimmern hat in den vergangenen Jahren<br />
entscheidende Fortschritte bezüglich re-<br />
produzierbarer und effektiver Therapie-<br />
strategien gemacht. [5] Neben <strong>der</strong> etablier-<br />
ten Hochfrequenzstromablation stehen<br />
heute neue Ablationsenergien wie zum<br />
Beispiel die Laser- und Ultraschallenergie<br />
o<strong>der</strong> die Kryothermie zur Verfügung. Die<br />
Abteilung für Kardiologie <strong>der</strong> <strong>Asklepios</strong><br />
Klinik St. Georg hat sich auf die Behand-<br />
lung von Vorhofflimmern spezialisiert.<br />
Hier wurde allein im Jahr 2006 bei 750<br />
Patienten eine primäre Katheterablation<br />
durchgeführt.<br />
Nachweis <strong>der</strong> effektiven Rhythmuskontrolle<br />
durch primäre Katheterablation<br />
Bislang standen zur postinterventionellen<br />
Erfolgskontrolle im Hinblick auf den Er-<br />
halt des Sinusrhythmus o<strong>der</strong> des erneuten<br />
Auftretens von Vorhofflimmer-Phasen nur<br />
begrenzte Möglichkeiten wie tägliche Tele-<br />
o<strong>der</strong> Langzeit-EKG-Aufzeichnungen zur<br />
Verfügung. [6] Diese Verfahren erfor<strong>der</strong>n je-<br />
doch nach wie vor eine nicht unerhebliche<br />
Compliance <strong>der</strong> Patienten. Eine kontinu-<br />
ierliche Überwachung des Herzrhythmus<br />
war bisher nicht möglich.<br />
Dabei gibt es Hinweise, dass vor erstma-<br />
liger Katheterablation symptomatische<br />
Patienten nach dem Eingriff das Auftreten<br />
erneuter Phasen von Vorhofflimmern nicht<br />
mehr bemerken und somit nunmehr als<br />
asymptomatisch gelten. [6,7] Ebenso pro-<br />
blematisch sind unbemerkt auftretende<br />
Phasen während des Schlafens. Der Nach-<br />
weis des kontinuierlichen Sinusrhythmus<br />
ist deshalb gerade zur Frage <strong>der</strong> Notwen-<br />
digkeit einer weiteren <strong>Antikoagulation</strong> von<br />
entscheiden<strong>der</strong> Bedeutung.<br />
Um die Limitationen <strong>der</strong> herkömmlichen<br />
Geräte zu überwinden, wurde ein implan-<br />
tierbarer EKG-Rekor<strong>der</strong> (Cardiac Mo-<br />
nitor Reveal ® XT, Medtronic) entwickelt.<br />
Während bisher zur Verfügung stehende<br />
implantierbare EKG-Rekor<strong>der</strong> den Herz-<br />
rhythmus auf Basis <strong>der</strong> R-Zacken über-<br />
wachten, was zur Diagnostik von Syn-<br />
kopen auf dem Boden von Pausen o<strong>der</strong><br />
schnellen, regelmäßigen Tachykardien<br />
ausreichte, zeichnet das neue Gerät nun<br />
zusätzlich die elektrische Erregung <strong>der</strong><br />
Vorhöfe auf. Dies erlaubt erstmals die zu-<br />
verlässige Erkennung von Vorhofflimmern<br />
und damit die frühzeitige Identifizierung<br />
asymptomatischer Patienten. Das wenige<br />
Zentimeter große Gerät wird in lokaler<br />
Betäubung unter <strong>der</strong> Haut implantiert<br />
und kann auch vom Patienten selbst be-<br />
dient werden („Patient Assistant“). So<br />
können spürbare symptomatische Phasen<br />
markiert und in den Langzeitspeicher ab-<br />
gelegt werden. Die Speicherkapazität liegt<br />
bei bis zu drei Jahren.<br />
Der EKG-Rekor<strong>der</strong> kann individuell vom<br />
Implantationszentrum programmiert<br />
werden, sodass Anzahl und Dauer von<br />
Vorhofflimmer-Episoden auch unabhängig<br />
vom subjektiven Empfinden des Patienten<br />
dokumentiert werden. Das ermöglicht die
Niedrige RF<br />
Frauen<br />
Alter < 74 Jahre<br />
KHK<br />
Hyperthyreose<br />
Kein RF<br />
Ein mittlerer RF<br />
Mittlere RF<br />
Alter ≥ 75 Jahre<br />
Arterielle Hypertonie<br />
Herzinsuffizienz<br />
LVEF ≤ 35 %<br />
Ein hoher RF o<strong>der</strong> mehr<br />
als ein mittlerer RF<br />
Diabetes mellitus<br />
Hohe RF<br />
Früherer Apoplex, TIA,<br />
Embolie<br />
Mitralklappenstenose<br />
Vorhandensein einer<br />
künstlichen Herzklappe<br />
Tabelle 1: Aktuelle Empfehlung zur <strong>Antikoagulation</strong> bei Patienten mit Vorhofflimmern<br />
in Abhängigkeit von Risikofaktoren (RF)(1). International normalized ratio (INR);<br />
linksventrikuläre Ejektionsfraktion (LVEF); transitorische ischämische Attacke (TIA);<br />
koronare Herzerkrankung (KHK)<br />
Abb. 3: Reveal ® XT<br />
ASS 300<br />
ASS 300 o<strong>der</strong> orale<br />
Entscheidung über die Fortführung einer<br />
antiarrhythmischen Therapie und Antikoa-<br />
gulation anhand objektiver Kriterien.<br />
Literatur<br />
[1] Fuster V, Ryden LE, Cannom DS et al. ACC/AHA/ESC<br />
2006 Guidelines for the Management of Patients with<br />
Atrial Fibrillation: a report of the American College of Car-<br />
diology/American Heart Association Task Force on Practice<br />
Guidelines and the European Society of Cardiology Com-<br />
mittee for Practice Guidelines (Writing Committee to Re-<br />
vise the 2001 Guidelines for the Management of Patients<br />
With Atrial Fibrillation): developed in collaboration with<br />
the European Heart Rhythm Association and the Heart<br />
Rhythm Society. Circulation 2006; 114(7): e257-e354.<br />
[2] Singh BN, Singh SN, Reda DJn et al. Amiodarone<br />
versus sotalol for atrial fibrillation. N Engl J Med 2005;<br />
352(18): 1861-72.<br />
[3] Ouyang F, Ernst S, Chun J et al. Electrophysiological<br />
<strong>Antikoagulation</strong> (INR 2–2)<br />
Orale <strong>Antikoagulation</strong> (INR 2–3)<br />
Abb. 4: Patient Assistent zum Reveal ® XT<br />
Parameter<br />
Volumen<br />
Gewicht<br />
Abmes-<br />
sungen<br />
H x B x T<br />
Abstand<br />
zwischen<br />
Elektroden<br />
Batterie<br />
EKG-Ver-<br />
stärkung<br />
Wert<br />
9 cm 3<br />
15 g<br />
62 mm x 19<br />
mm x 8 mm<br />
40 mm<br />
Lithiumthio-<br />
nylchlorid<br />
50 x<br />
Tabelle 2: Technische Daten des<br />
Reveal ® XT<br />
findings during ablation of persistent atrial fibrillation<br />
with electroanatomic mapping and double Lasso catheter<br />
technique. Circulation 2005; 112(20): 3038-48.<br />
[4] Ouyang F, Bansch D, Ernst S, Schaumann A et al. Com-<br />
plete isolation of left atrium surrounding the pulmonary<br />
veins: new insights from the double-Lasso technique in<br />
paroxysmal atrial fibrillation. Circulation 2004; 110(15):<br />
2090-6.<br />
[5] Ernst S, Kuck KH. [Current status of catheter ablation<br />
for atrial fibrillation.] Herz 2006; 31(2): 113-7.<br />
[6] Senatore G, Stabile G, Bertaglia E et al. Role of tran-<br />
stelephonic electrocardiographic monitoring in detecting<br />
short-term arrhythmia recurrences after radiofrequency<br />
ablation in patients with atrial fibrillation. J Am Coll Cardi-<br />
ol 2005; 45(6): 873-6.<br />
[7] Hindricks G, Piorkowski C, Tanner H et al. Percep-<br />
tion of atrial fibrillation before and after radiofrequency<br />
catheter ablation: relevance of asymptomatic arrhythmia<br />
recurrence. Circulation 2005; 112(3): 307-13.<br />
Kontakt<br />
Dr. Christian Frerker<br />
Hanseatisches Herzzentrum Hamburg<br />
Abteilung für Kardiologie<br />
<strong>Asklepios</strong> Klinik St. Georg<br />
Lohmühlenstraße 5, 20099 Hamburg<br />
Tel. (0 40) 18 18-85 23 05<br />
Fax (0 40) 18 18-85 44 44<br />
E-Mail: c.frerker@asklepios.com<br />
Vorhofflimmer-Ambulanz:<br />
Tel. (0 40) 18 18-85 36 16<br />
Fax (0 40) 18 18-85 44 35<br />
ICD-/Herzschrittmacher-Ambulanz:<br />
Tel. (0 40) 18 18-85 20 30<br />
Fax (0 40) 18 18-85 20 49<br />
Kardiologie<br />
Abb. 5: Reveal ® -XT-Größenvergleich zur Tele-EKG-Karte und zum Langzeit-EKG<br />
gegenüber Kugelschreiber<br />
Abb. 1: Kosmetisches Ergebnis (feminin)<br />
sechs Wochen nach <strong>der</strong> Implantation<br />
Abb. 2: Kosmetisches Ergebnis (maskulin)<br />
sechs Wochen nach <strong>der</strong> Implantation<br />
473
Medtropole | Ausgabe Oktober 2007<br />
„Bridging“ – <strong>Überbrückung</strong> <strong>der</strong><br />
<strong>oralen</strong> <strong>Antikoagulation</strong><br />
Dr. Hala El Abd-Müller, Dr. Björn-Michael Schulenburg<br />
Unter Bridging versteht man die überbrückende Behandlung mit einem alternativen Antikoagulans während einer<br />
Unterbrechung <strong>der</strong> <strong>oralen</strong> <strong>Antikoagulation</strong> (OAK). Dies ist vor elektiven, interventionellen o<strong>der</strong> operativen Ein-<br />
griffen notwendig. In <strong>der</strong> Regel werden Heparin (UFH) o<strong>der</strong> nie<strong>der</strong>molekulare Heparine (NMH) verabreicht.<br />
Indikationen zur <strong>oralen</strong> <strong>Antikoagulation</strong>:<br />
Vorhofflimmern (VHF)<br />
VHF + Herzfehler/Kardiomyopathie<br />
Mechanische Herzklappen (MH)<br />
474<br />
Mechanische Aortenklappe (AKE)<br />
Mechanische Mitralklappe (MKE)<br />
Venöse Thromboembolie<br />
Bein-/Armvenenthrombose<br />
Lungenembolie<br />
Arterielle Thrombembolien<br />
Schlaganfall/TIA + VHF<br />
Intestinale und periphere Embolie<br />
+ VHF<br />
Periphere Bypassverschlusspro-<br />
phylaxe<br />
Persistierendes Lupus-Antikoagulanz<br />
Thrombophilie-Patienten mit Mehr-<br />
fachrezidiv<br />
Der Nutzen einer <strong>oralen</strong> <strong>Antikoagulation</strong><br />
mit Vitamin-K-Antagonisten bei Erkran-<br />
kungen mit einem thromboembolischen<br />
Risiko im arteriellen o<strong>der</strong> venösen System<br />
ist lange bekannt (Kasten 1).<br />
Etwa 700.000 Patienten in Deutschland<br />
nehmen Vitamin-K-Antagonisten ein.<br />
Für einen elektiven Eingriff muss auf-<br />
grund des Blutungsrisikos häufig die OAK<br />
vorübergehend unterbrochen werden.<br />
Nach Unterschreiten des therapeutischen<br />
INR-Bereichs (< 2) werden die Patienten<br />
auf ein kurz wirksames, gut steuerbares<br />
Antikoagulans wie UFH o<strong>der</strong> NMH um-<br />
gestellt. Dabei entsteht in <strong>der</strong> Phase um<br />
den OP-Termin bei Phenprocoumon eine<br />
ca. zehntägige Periode suboptimaler<br />
Kasten 1<br />
<strong>Antikoagulation</strong> mit erhöhten thrombo-<br />
embolischen Risiken. Eine gut steuerbare<br />
alternative <strong>Überbrückung</strong> („Bridging“) <strong>der</strong><br />
unterbrochenen <strong>Antikoagulation</strong>stherapie<br />
wird somit erfor<strong>der</strong>lich. Das intravenöse<br />
UFH mit Dosisanpassung anhand <strong>der</strong><br />
aPTT galt bis vor einigen Jahren als Stan-<br />
dard beim Bridging. Dieses traditionelle<br />
Konzept hat aber Nachteile:<br />
Durchführung nur unter stationären<br />
Bedingungen, daher kostenintensiv<br />
Bewegungseinschränkung <strong>der</strong><br />
Patienten (prothrombogen)<br />
Erhöhtes Risiko <strong>der</strong> Heparin-Induzier-<br />
ten Thrombozytopenie Typ II (HIT II)<br />
gegenüber <strong>der</strong> NMH<br />
Tägliche Kontrolle <strong>der</strong> aPTT<br />
Daher werden seit Mitte <strong>der</strong> 90er-Jahre<br />
vermehrt NMH eingesetzt, die in <strong>der</strong> Be-<br />
handlung <strong>der</strong> venösen Thromboembolien<br />
zumindest eine Gleichwertigkeit mit dem<br />
UFH gezeigt haben. Voraussetzung ist eine<br />
normale Nierenfunktion.<br />
Vorteile:<br />
Ambulante prästationäre Behandlung,<br />
daher Senkung <strong>der</strong> Kosten<br />
Subkutane Verabreichung<br />
Günstigere Bioverfügbarkeit<br />
Schnelles Erreichen des therapeuti-<br />
schen Spiegels<br />
Laborkontrolle nicht erfor<strong>der</strong>lich<br />
Vermin<strong>der</strong>tes Risiko <strong>der</strong> HIT II gegen-<br />
über UFH (< 0,5 %)<br />
Beim Einsatz <strong>der</strong> NMH zur Bridging-An-<br />
tikoagulation ergeben sich juristische Fra-<br />
gen. Da keines <strong>der</strong> verfügbaren NMH für<br />
diese Indikation zugelassen ist, handelt es<br />
sich somit um eine Off-Label-Anwendung.<br />
Hieraus können haftungsrelevante Kon-<br />
sequenzen für den verordnenden Arzt im<br />
Falle von Blutungs- o<strong>der</strong> thromboembo-<br />
lischen Komplikationen entstehen. Weiter<br />
verweigert das SGB-V die Erstattung <strong>der</strong><br />
Medikamentenkosten, wenn eine alterna-<br />
tiv zugelassene Medikation existiert. Die<br />
Verwendung von UFH zur Bridging-Anti-<br />
koagulation ist durch die Altzulassung „zur<br />
Prophylaxe und Therapie arterieller und<br />
venöser Thrombosen und Embolien“ abge-<br />
sichert. UFH wurden allerdings nicht nach<br />
mo<strong>der</strong>nen Standards in Studien geprüft.<br />
Die Anzahl <strong>der</strong> für UFH dokumentierten<br />
Fälle in <strong>der</strong> Indikation des Bridging in <strong>der</strong><br />
gesamten Fachliteratur beträgt im Vergleich<br />
zu NMH nicht einmal ein Zehntel. Dagegen<br />
wurden mittlerweile mehr als 4.000 Bridg-<br />
ing-Episoden mit NMH veröffentlicht.<br />
An<strong>der</strong>erseits schreibt das SGB-V ein gene-<br />
relles Wirtschaftlichkeitsgebot vor, das nur<br />
durch die kürzere Liegedauer <strong>der</strong> Patienten<br />
in <strong>der</strong> Bridging-<strong>Antikoagulation</strong> mit NMH<br />
erreicht wird. [11] Bridging ist unter Berück-<br />
sichtigung des individuellen Patientenrisi-<br />
kos eine individuelle Entscheidung.<br />
Zu beachten sind:<br />
Abwägung zwischen Dringlichkeit und<br />
möglichen Blutungskomplikationen des<br />
Eingriffs<br />
Abwägung <strong>der</strong> Möglichkeiten <strong>der</strong> Blut-<br />
stillung gegen die thromboembolischen<br />
Risiken <strong>der</strong> Grun<strong>der</strong>krankung<br />
Nachsorge
Klinische Risikoabschätzung für<br />
thromboembolische Ereignisse<br />
Hohes Thromboembolierisiko<br />
(circa 10 %/Jahr und mehr ohne <strong>Antikoagulation</strong>)<br />
Tiefe Beinvenenthrombose o<strong>der</strong> Lungenembolie im zurückliegenden<br />
Monat<br />
Künstliche Herzklappen<br />
Arterielle Embolie im zurückliegenden Monat<br />
Vorhofflimmern mit Z. n. ischämischem Ereignis,<br />
schwerer Herzinsuffizienz, Thrombus im linken Vorhof<br />
o<strong>der</strong> dichtem Spontanechos<br />
Mittleres Thromboembolierisiko<br />
(circa 4 bis 10 %/Jahr ohne <strong>Antikoagulation</strong>)<br />
Idiopathische tiefe Beinvenenthrombose o<strong>der</strong> Lungenembolie innerhalb<br />
des ersten Jahres<br />
Vorhofflimmern mit begleitendem Diabetes mellitus,<br />
arterieller Hypertonie o<strong>der</strong> höherem Lebensalter<br />
Bioprothesen (erste 3 Monate)<br />
Niedriges Thromboembolierisiko<br />
(unter 4 %/Jahr ohne <strong>Antikoagulation</strong>)<br />
Sekundäre tiefe Beinvenenthrombose o<strong>der</strong> Lungenembolie innerhalb<br />
des ersten Jahres<br />
Idiopathisches Vorhofflimmern<br />
Bioprothesen (nach 3 Monaten)<br />
Nach Datenlage <strong>der</strong> Kohortenstudien ist das<br />
perioperative Blutungsrisiko von größerer<br />
Bedeutung. Hierdurch kann aufgrund <strong>der</strong><br />
notwendigen Korrektur des Gerinnungssy-<br />
stems das Thromboembolierisiko steigen.<br />
Notwendige Fragen vor <strong>der</strong> Umstellung:<br />
Muss weiter antikoaguliert werden?<br />
Vor Absetzen <strong>der</strong> OAK müssen Patienten<br />
mit hohem thromboembolischem Risiko<br />
identifiziert werden, bei denen die Fortfüh-<br />
rung <strong>der</strong> <strong>Antikoagulation</strong> zwingend erfor-<br />
<strong>der</strong>lich ist. Diese Entscheidung ist komplex,<br />
da das Risiko bei den einzelnen Grun<strong>der</strong>-<br />
krankungen unterschiedlich ist (Kasten 2).<br />
Hinzu kommt, dass sich in manchen Er-<br />
krankungen Untergruppen mit differentem<br />
Thromboembolierisiko – z. B. bei mecha-<br />
nischen Herzklappen – evaluieren lassen.<br />
Ebenso kann nach Komorbiditäten das<br />
Embolierisiko bei nichtvalvulärem Vorhof-<br />
flimmern nach dem sogenannten CHADS<br />
Score unterschieden werden (Kasten 3<br />
und 4). Eine überbrückende Antikoagulati-<br />
on scheint bei Patienten mit einem CHADS<br />
Kasten 2<br />
CHADS-Stroke-Risk-Index<br />
Basiert auf 1.733 Patienten / 2.121 Patientenjahren<br />
Individuelle Apoplex-<br />
Risikofaktoren 1 Punkt<br />
Herzinsuffizienz 1 Punkt<br />
Hypertonie 1 Punkt<br />
Alter > 75 1 Punkt<br />
Diabetes mellitus 1 Punkt<br />
Z. n. Insult 2 Punkte<br />
Gage et al., JAMA 2001<br />
Schlaganfallrisiko pro Jahr ohne <strong>Antikoagulation</strong>/ASS<br />
Rate<br />
Score < 3 fakultativ. Allerdings empfehlen<br />
die gemeinsamen Leitlinien <strong>der</strong> amerika-<br />
nischen und europäischen kardiologischen<br />
Fachgesellschaften die überbrückende<br />
<strong>Antikoagulation</strong> bei Unterbrechung <strong>der</strong><br />
OAK über sieben Tage. [10]<br />
Welche Heparindosis? Therapeutisch o<strong>der</strong> halb-<br />
therapeutisch?<br />
Die Studien-Analysen zum Einsatz <strong>der</strong><br />
Bridging-<strong>Antikoagulation</strong> wurden im the-<br />
rapeutischen Bereich für das UFH (aPTT-<br />
Verlängerung > 1,5–2x) und für den NMH<br />
(Anti-Xa-Spiegel kontrolliert) durchgeführt.<br />
Dieser Bereich wurde entsprechend den<br />
Empfehlungen <strong>der</strong> einzelnen NMH und<br />
im Vergleich <strong>der</strong> Heparine für die Akutthe-<br />
rapie <strong>der</strong> tiefen Beinvenenthrombose und<br />
Lungenembolie festgelegt. Hierbei ergab<br />
sich kein signifikanter Unterschied in den<br />
Komplikationsraten (Tab. 2, 3). Es ergeben<br />
sich aber Hinweise, dass sowohl Patienten<br />
mit neueren mechanischen Herzklappen<br />
als auch VHF mit <strong>der</strong> halbtherapeutischen<br />
Dosis prophylaktisch behandelt werden<br />
können. [6] Der optimale Zeitpunkt <strong>der</strong><br />
CHADS Score<br />
National Registry of AF Adjusted Stroke<br />
0 1,9 %<br />
1 2,8 %<br />
2 4,0 %<br />
3 5,9 %<br />
4 8,5 %<br />
5 12,5 %<br />
6 18,2 %<br />
Gage et al., JAMA 2001<br />
Labormedizin | Angiologie (CME)<br />
letzten präoperativen Heparingabe des<br />
Kasten 3<br />
Kasten 4<br />
NMH ist ebenfalls unterschiedlich. Ein ver-<br />
tretbarer Kompromiss zwischen thrombo-<br />
embolischem Risiko und Blutung, insbe-<br />
son<strong>der</strong>e in Anbetracht <strong>der</strong> rückenmarkna-<br />
hen Anästhesie, scheint eine letzte Gabe<br />
24 h präoperativ zu sein. Postoperativ muss<br />
im Sinne eines Blutungsassessments die<br />
Aufnahme <strong>der</strong> <strong>Antikoagulation</strong> angepasst<br />
werden. Ein früherer Beginn < 6h scheint<br />
das Blutungsrisiko zu erhöhen.<br />
Identifizierung von Patienten mit erhöhtem Risiko<br />
für periinterventionelle Blutungen<br />
Das Blutungsrisiko hängt von dem geplan-<br />
ten Eingriff und patientenindividuellen<br />
Risiken ab. Ebenso ist die Komedikation<br />
bzgl. Thrombozytenfunktionshemmern<br />
zu beachten. So können Interventionen<br />
bei geringem Blutungsrisiko unter einer<br />
<strong>Antikoagulation</strong> mit INR-Werten um 2<br />
durchgeführt werden (Zahnextraktionen,<br />
OPs im vor<strong>der</strong>en Augenabschnitt ohne<br />
Regionalanästhesie, diagnostische gastrointestinale<br />
Untersuchungen. [12]<br />
475
Medtropole | Ausgabe Oktober 2007<br />
Zum Beispiel<br />
Welcher Kompromiss zwischen thromboembo-<br />
lischem Schutz und Blutungsgefahr ist möglich?<br />
Ein überschaubarer Vorschlag zum Bridg-<br />
ing wurde von <strong>der</strong> BRAVE-Arbeitsgruppe<br />
gemacht (Kasten 5). Dieses Schema verei-<br />
nigt das individuelle thromboembolische<br />
Risiko mit dem <strong>der</strong> Blutungsgefahr.<br />
Gibt es aktuelle Leitlinien und wie ist die aktu-<br />
elle Studienlage?<br />
Keines <strong>der</strong> verfügbaren UFH o<strong>der</strong> NMH<br />
ist für die Indikation <strong>der</strong> überbrückenden<br />
<strong>Antikoagulation</strong> zugelassen. Eine aktuelle<br />
Leitlinie für ein in <strong>der</strong> Praxis anwendbares<br />
Schema zur überbrückenden Antikoagu-<br />
lation wurde von keiner Fachgesellschaft<br />
festgelegt. Gemeinsame Empfehlungen<br />
wurden von <strong>der</strong> European Society of<br />
Cardiology, www.escardio.org/know-<br />
ledge/guidelines, mit den amerikanischen<br />
Gesellschaften gegeben. Eine dieser Emp-<br />
fehlungen wurde von den American<br />
College of Chest Physicians (ACCP) bei<br />
ihrer siebten Konferenz 2004 weiterentwi-<br />
ckelt. [13] Sie ist unter www.guideline.gov<br />
zu finden.<br />
Studienlage<br />
Seit Jahren arbeiten viele Forscher an für<br />
die Praxis anwendbaren Therapieschemata<br />
[1-9] , doch ein einheitliches Schema liegt<br />
bislang nicht vor. In unserer Übersicht<br />
476<br />
Künstlicher Herzklappenersatz<br />
Frische Thrombose<br />
Vorhofflimmern und<br />
Zustand nach Embolie o<strong>der</strong><br />
Thrombus im linken Herzrohr/<br />
spontaner Echokontrast o<strong>der</strong><br />
Herzinsuffizienz<br />
Vorhofflimmern plus<br />
Alter > 75 Jahre<br />
Alter < 75 Jahre o<strong>der</strong> plus Diabetes<br />
mellitus o<strong>der</strong> arterielle Hypertonie<br />
BRAVE: Bonn Registry for<br />
Alternativ Periprocedural<br />
Anticoagulation to Prevent<br />
Vascular Events<br />
TE-Risiko<br />
Hoch<br />
Intermediär<br />
Eingriffe, die nicht oben<br />
genannten Interventionen<br />
zuzuordnen sind<br />
Nichtchirurgische<br />
Interventionen, inklusive<br />
Herzkatheteruntersuchungen<br />
Endoskopie<br />
Bronchoskopie<br />
Arthoskopie<br />
Dosierung<br />
Therapeutisch<br />
Halbtherapeutisch<br />
stellen wir einige Studien und ihre Ergeb-<br />
nisse vor. 1978 erschien eine kleine, offene<br />
Studie mit begrenzter Fallzahl von Katho-<br />
li [1] zur perioperativen Bridging-Therapie<br />
mit UFH. Erst 2000 präsentierte Mehra [2]<br />
erneut eine Studie mit demselben Thema.<br />
Die Fallzahl war genauso klein und die<br />
Bridging-Indikation war nicht spezifiziert.<br />
Das klassische Konzept aus Tabelle 1<br />
zeigte eine Thromboserate von 0 Prozent.<br />
Aufgrund <strong>der</strong> niedrigen Fallzahl ist ein<br />
thromboembolisches Risiko aber nicht<br />
auszuschließen. Die Blutungsrate lag bei<br />
insgesamt 8,5 Prozent, wobei die Anzahl<br />
leichter Blutungen überwog.<br />
Ab 2001 wurden mehrere Studien für ver-<br />
schiedene Indikationsbereiche mit hohen<br />
Patientenzahlen publiziert, die NMH (kör-<br />
pergewichtsadaptiert) als überbrückende<br />
<strong>Antikoagulation</strong> erhalten hatten.<br />
In den in Tabelle 2 dargestellten Studien<br />
lag die Thromboembolierate zwischen 0<br />
und 3,5 Prozent, die Rate schwerer Blu-<br />
tungen zwischen 0,2 und 6,7 Prozent.<br />
Zusätzlich gab es weitere klinische Ver-<br />
gleichsstudien zwischen UFH und NMH<br />
als Bridging-Therapie.<br />
Periinterventionell<br />
adaptiert<br />
Periinterventionell<br />
adaptiert<br />
Blutungsrisiko Nicht hoch<br />
Hoch<br />
Herzchirurgische Eingriffe<br />
Chirurgie großer Gefäße<br />
Große tumorchirurgische<br />
Eingriffe<br />
Operation an Niere/<br />
Prostata<br />
Hammerstingl C [14] Kasten 5<br />
Diese Vergleiche zeigen in Tabelle 3, dass<br />
die überbrückende <strong>Antikoagulation</strong> für die<br />
verschiedenen Krankheiten mit NMH min-<br />
destens so sicher und wirksam ist wie mit<br />
UFH. Das <strong>Antikoagulation</strong>s-Therapieziel<br />
ist mit NMH schneller erreicht und bleibt<br />
länger stabil. Die Verwendung von NMH<br />
ist wegen <strong>der</strong> Option des ambulanten Ein-<br />
satzes bei weitem kostengünstiger.<br />
Fazit:<br />
Patienten unter einer Dauertherapie mit<br />
OAK haben ein erhöhtes periinterventionel-<br />
les Risiko für Blutungen o<strong>der</strong> thromboem-<br />
bolische Ereignisse. Dieses muss anhand<br />
<strong>der</strong> individuellen und prozeduralen Risi-<br />
ken für den Einzelfall evaluiert werden.<br />
UFH und vermehrt NMH werden zur<br />
überbrückenden <strong>Antikoagulation</strong> emp-<br />
fohlen, wobei <strong>der</strong> Einsatz <strong>der</strong> NMH<br />
weitaus besser belegt ist.<br />
Nach aktuellem Studienstand bestehen<br />
keine übereinstimmenden Empfehlungen<br />
zum Dosisregime <strong>der</strong> NMH, meist wird<br />
die therapeutische Dosis ein o<strong>der</strong> zwei<br />
Mal täglich appliziert. Allerdings gibt es<br />
Hinweise, dass bei mo<strong>der</strong>nen Kunstherz-<br />
klappen in Aortenposition o<strong>der</strong> beim<br />
VHF auch die halbtherapeutische Dosis<br />
ausreichen kann.<br />
Bei vielen Eingriffen mit minimalem Blu-<br />
tungsrisiko durch den Eingriff muss die<br />
<strong>Antikoagulation</strong> mit OAK nicht unterbro-<br />
chen werden.<br />
Bei üblichen Blutungsrisiken und gerin-<br />
gem bis mäßigem Thromboembolierisiko<br />
sollte die orale <strong>Antikoagulation</strong> unterbro-<br />
chen werden. Nach dem Eingriff und ggf.<br />
auch zuvor ist die Anwendung fraktio-<br />
nierter Heparine in halbtherapeutischer<br />
Dosis zu erwägen.<br />
Bei hohem Thromboembolierisiko muss<br />
zur <strong>Überbrückung</strong> fraktioniertes Heparin<br />
in therapeutischer Dosierung gegeben<br />
werden. Für den Eingriff sollte die Hepa-<br />
rinantikoagulation so kurz wie möglich<br />
unterbrochen werden.<br />
Fraktionierte Heparine sind für das<br />
„Bridging“ nicht zugelassen. Es bedarf<br />
daher einer intensiven Aufklärung und<br />
Einwilligung des Patienten.
Tabelle 1<br />
Studie Indikation für<br />
Bridging<br />
Katho-<br />
li [1]<br />
Mehra [2]<br />
MH 13 x gr. OP<br />
13 x kl. OP<br />
Operation n Dosis Thrombo-<br />
embolien<br />
nicht spezif. Oralchirurgie 20 Bolus 80 U/kg<br />
i. v. dann<br />
18 U/kg/h<br />
i. v. dann aPTT<br />
gesteuert<br />
Blutungen<br />
gesamt<br />
Blutungen<br />
schwer<br />
39 0 3 1 2<br />
0 2 0 2<br />
Blutungen<br />
leicht<br />
Gesamt 59 0 5 (8,5 %) 1 (1,7 %) 4 (6,8 %)<br />
Tabelle 2<br />
Studie Indikation für<br />
Bridging<br />
Hammer-<br />
stingl [3]<br />
Kovacs [4]<br />
Douketis [5] MH/VHF<br />
Embolischer<br />
Insult<br />
Halbitter [6]<br />
Operation n Thrombo-<br />
embolien<br />
VHF/MH OP mit hoher (n = 34) u. niedriger<br />
(n = 166) Blutungsgefahr<br />
MH/VHF Herzkatheter Uro./Ortho-Chirurgie,<br />
Dentalchir./Endoskopie<br />
OP mit hoher (n = 108) u. niedriger<br />
(n = 542) Blutungsgefahr<br />
VTE/MH VHF Kathetereingriffe, Schrittmacherimplant,<br />
Endoskopien, Allg.<br />
Ortho.-, Cardiovasc.-Chir.<br />
Blutungen<br />
gesamt<br />
Blutungen<br />
schwer<br />
200 0 19 0 19<br />
224 8 (3,5 %) k. A. 15 (6,7 %) k. A.<br />
650 2 (0,3 %) 38 6 (0,9 %) 32<br />
286 3 (1,0 %) k. A. 5 (1,7 %) k. A.<br />
Blutungen<br />
leicht<br />
Gesamt 2002 17 (0,85 %) 86 (4,4 %) 37 (1,8 %) 81 (4,0 %)<br />
Tabelle 3<br />
Studie Patienten Ergebnisse<br />
Montalescot [7]<br />
Stellbrink [8]<br />
Herzklappenchirurgie<br />
UFH n = 106 / NMH n = 102<br />
Blutungen: 2 schwere in je<strong>der</strong> Gruppe<br />
VHF n = 496 Endpunkt Mortalität / schwere Blut. / Embolien: 2,8 % NMH vs.<br />
4,8 % UFH<br />
Omran VHF, Herzklappenersatz o. beides<br />
n = 68<br />
Spyropoulos [9]<br />
Zeit bis Erreichen effektiver <strong>Antikoagulation</strong> signif. kürzer unter NMH;<br />
Anteil <strong>der</strong> Tage mit effektiver <strong>Antikoagulation</strong> unter NMH signif. höher<br />
Künstliche Herzklappen n = 246 NMH genauso wirksam wie UFH mit kürzerer Hospitation<br />
Tabellen nach Bauersachs et al., DÄ 18 vom 04.05.2007 VTE: venöse Thromboembolie<br />
Literatur<br />
[1] Katholi RE, Nolan SP, Mcguire LB. The management of<br />
anticoagulation during noncardiac operations in patients<br />
with prosthetic heart valves. A prospective study. Am Heart<br />
J 1978; 96: 163-165.<br />
[2] Mehra P, Cottrell DA, Bestgen SC, Booth DF. Mana-<br />
gement of heparin therapy in the high risk, chronically<br />
anticoagulated, oral surgery patient: a review and a<br />
proposed nomogram. J Oral Maxillofac Surg 2000; 95:<br />
1717–1724.<br />
[3] Hammerstingl C, Schlang G, Bernhardt P, et al. Einsetz-<br />
barkeit nie<strong>der</strong>molekularer Heparine bei Umstellung einer<br />
<strong>oralen</strong> <strong>Antikoagulation</strong> vor Interventionen mit erhöhtem<br />
Blutungsrisiko: Das „Bonn-Register“ – Erfahrungen mit<br />
200 Patienten. Z. Kardiol 2004; 93 (Suppl): 281–282.<br />
[4] Kovacs MJ, Kearon C, Rodger M et al. Single-arm<br />
study of bridging therapy with low molecular-weight<br />
heparin for patients at risk of arterial embolism who<br />
require temporary interruption of warfarin. Circulation<br />
2004; 110: 1658–1663.<br />
[5] Douketis JD, Johnson Ja, Turpie AG. Low-molecu-<br />
lar-weight heparin as bridging anticoagulation during<br />
interruption of warfarin. Arch Intern Med 2004; 164:<br />
1319–1326.<br />
[6] Halbitter KW, Wawer A, Beyer J, et al. Bridging anti-<br />
coagulation for patients on long-term vitamin-K-anta-<br />
gonists. A prospective 1 year registry of 311 episodes. J<br />
Thromb Heamost 2005; 3: 2823–2825.<br />
[7] Montalescot G, Polle V, Collet JP et al. Low-mole-<br />
cular-weight Heparin after mechanical heart valve<br />
replacment. Circulation 2000: 101; 1083–1086.<br />
[8] Stellbrink C, Nixdorff U, Hofmann T et al. Safely<br />
and efficacy of enoxaparin compared with unfractio-<br />
nated heparin and oral anticoagulants for prevention<br />
of thromboembolic complications in cardioversion of<br />
nonvalvular arterial fibrillation: (ACE) trial. Circulation<br />
2004; 109: 997–1003.<br />
[9] Spyropulos A, Dunn A, Turpie A et al. Preoperative<br />
bridging therapy with unfractionated heparin or low-<br />
molecular-weight heparin in patients with mechanical<br />
Kontakt<br />
Labormedizin | Angiologie (CME)<br />
heart valves on long term oral anticoagulants: Results<br />
from the REGIMEN registry (Abstract A832). J Am Coll<br />
Cardiol 2005; 45: 352.<br />
[10] Bauersachs R., Schellong S, Haas S, et al. Überbrü-<br />
ckung <strong>der</strong> <strong>oralen</strong> <strong>Antikoagulation</strong> bei interventionellen<br />
Eingriffen. Deutsches Ärzteblatt, Jg. 104; Heft 18: 4. 5<br />
2007.<br />
[11] Doukatis J et al., <strong>Antikoagulation</strong> bei Patienten, die<br />
einer elektiven Operation unterzogen werden und einer<br />
temporären Unterbrechung <strong>der</strong> Vitamin K Antago-<br />
nisten-Therapie bedürfen: Ein praktischer Leitfaden<br />
für Kliniker. InnoMed Educational Service, Minerva<br />
Communications Group Inc. 2005.<br />
[12] Gastrointest. Endoscopy 2002; 55: 775–779.<br />
[13] The Seventh ACCP Conference on Antithrombotic<br />
and Thrombolytic Therapy: Evidence-Based Guidelines<br />
CHEST Volume 126/Number 3 Supplements / Septem-<br />
ber, 2004.<br />
[14] Hammerstingl C, Omran H. Nie<strong>der</strong>molekulare<br />
Heparine als Alternative beim Pausieren einer <strong>oralen</strong><br />
<strong>Antikoagulation</strong>. Der Bay Int 2006; 26 (4)<br />
Dr. med. Hala El Abd-Müller<br />
Spezialgerinnung<br />
MEDILYS c/o <strong>Asklepios</strong> Klinik Altona<br />
Tel. (0 40) 18 18-81 59 26<br />
Fax (0 40) 18 18-81 49 37<br />
E-Mail: h.el@asklepios.com<br />
Dr. Björn-Michael Schulenburg<br />
Sektion Angiologie/Gefäß Centrum<br />
Hamburg GCH<br />
Abteilung für Allgemein-, Gefäß- und<br />
Viszeralchirurgie<br />
<strong>Asklepios</strong> Klinik Harburg<br />
Tel. (0 40) 18 18-86 33 91<br />
Fax (0 40) 18 18-86 33 06<br />
E-Mail: b.schulenburg@asklepios.com<br />
477
Aktuelles<br />
Medtropole | Ausgabe Oktober 2007<br />
2. Hamburg-Preis<br />
Persönlichkeitsstörungen ging nach<br />
Freiburg, Chicago und Köln<br />
Zum Abschluss des 4. Hamburger Sym-<br />
posiums Persönlichkeitsstörungen „Von<br />
Duetten und Duellen“ wurde Anfang Sep-<br />
tember zum zweiten Mal <strong>der</strong> aus zwei<br />
Kategorien bestehende „Hamburg-Preis<br />
Persönlichkeitsstörungen“ verliehen. Mit<br />
einem Preisgeld von insgesamt 15.000<br />
Euro gehört er zu den bundesweit höchst-<br />
dotierten Wissenschaftspreisen in <strong>der</strong><br />
Psychiatrie. Den mit 10.000 Euro dotierten<br />
„Hamburger Preis Persönlichkeitsstörun-<br />
gen 2007“ erhielt eine Arbeitsgruppe aus<br />
Freiburg und Chicago, vertreten durch Dr.<br />
Nicolas Rüsch. Die mit 5.000 Euro dotierte<br />
„Hamburger Fellowship Persönlichkeits-<br />
störungen 2007“ ging an Dr. Maya K.<br />
Krischer aus Köln.<br />
Der von <strong>der</strong> Gesellschaft zur Erforschung<br />
und Therapie von Persönlichkeitsstö-<br />
rungen (GePs) e. V. und <strong>der</strong> <strong>Asklepios</strong><br />
Kliniken Hamburg GmbH ausgeschriebene<br />
Preis wird jährlich für herausragende<br />
Arbeiten auf dem Gebiet <strong>der</strong> Persönlich-<br />
keitsstörungen verliehen und soll vor<br />
allem die klinische Forschung för<strong>der</strong>n.<br />
478<br />
„Für die Grundlagenforschung gibt es<br />
genügend För<strong>der</strong>ung, dieser Preis soll<br />
direkt den Patienten zugute kommen und<br />
insbeson<strong>der</strong>e auch junge Forscher för<strong>der</strong>n“,<br />
so Kongresspräsident Dr. Birger Dulz. Eine<br />
fünfköpfige Preisjury unter dem Vorsitz<br />
von Prof. Dr. Stephan Doering (Münster)<br />
hatte die beiden Arbeiten aus zahlreichen<br />
Bewerbungen aus Deutschland, Öster-<br />
reich und <strong>der</strong> Schweiz ausgewählt. Dr.<br />
Jörg Weidenhammer, Geschäftsführer <strong>der</strong><br />
<strong>Asklepios</strong> Kliniken Hamburg GmbH, und<br />
Prof. Doering überreichten Preisgel<strong>der</strong> und<br />
Urkunden während des Abschlussplenums<br />
an die Preisträger.<br />
Die Arbeitsgruppe aus Dr. Nicolas Rüsch<br />
(Universitätsklinikum Freiburg), Prof. Dr.<br />
Klaus Lieb (Mainz), Dr. Ines Göttler (Frei-<br />
burg), PD Dr. Christiane Hermann (Mann-<br />
heim), Dr. Elisabeth Schramm, Dr. Harald<br />
Richter, Dr. Gitta A. Jacob (alle Freiburg),<br />
Patrick W. Corrigan, PSy.D. (Chicago) und<br />
Prof. Dr. Martin Bohus (Mannheim) wurde<br />
ausgezeichnet für ihre Arbeit „Scham und<br />
implizites Selbstkonzept bei Frauen mit<br />
Bor<strong>der</strong>line-Störung“. Scham ist ebenso<br />
(v. l.): Dr. Birger Dulz, Kongresspräsident und Präsident<br />
<strong>der</strong> Gesellschaft zur Erforschung und Therapie von Per-<br />
sönlichkeitsstörungen (GePs) e. V., Dr. Nicolas Rüsch,<br />
Träger des mit 10.000 Euro dotierten Hamburger Preises<br />
Persönlichkeitsstörungen 2007, Dr. Maya K. Krischer,<br />
Preisträgerin <strong>der</strong> mit 5.000 Euro dotierten Hamburger<br />
Fellowship Persönlichkeitsstörungen 2007, Prof. Dr.<br />
Stephan Doering, Vorsitzen<strong>der</strong> <strong>der</strong> Preisjury, und Dr.<br />
Jörg Weidenhammer, Geschäftsführer <strong>der</strong> <strong>Asklepios</strong><br />
Kliniken Hamburg GmbH<br />
wie Wut und Angst eine Schlüsselemoti-<br />
on <strong>der</strong> Bor<strong>der</strong>line-Störung. Die Autoren<br />
zeigten mit <strong>der</strong> ausgezeichneten Arbeit,<br />
dass Frauen mit Bor<strong>der</strong>line-Störungen<br />
weitaus mehr unter Schamgefühlen leiden<br />
als Patientinnen mit sozialer Phobie o<strong>der</strong><br />
gesunde Frauen. Sie fanden außerdem<br />
einen starken Zusammenhang zwischen<br />
hoher Scham und geringem Selbstwertge-<br />
fühl, niedriger Lebensqualität und einem<br />
hohen Maß an Ärger und Feindseligkeit.<br />
Damit liefert die im American Journal of<br />
Psychiatry publizierte Arbeit einen ersten<br />
empirischen Beleg für die zentrale Rolle<br />
<strong>der</strong> Scham bei Bor<strong>der</strong>line-Störungen. Dr.<br />
Maya K. Krischer aus Köln wurde für<br />
ihre Arbeit „Dimensionale Erfassung von<br />
Persönlichkeitspathologie bei delinquenten<br />
weiblichen und männlichen Jugendlichen“<br />
mit <strong>der</strong> „Hamburger Fellowship Persön-<br />
lichkeitsstörungen 2007“ geehrt. Die mit<br />
5.000 Euro dotierte Fellowship ist mit<br />
einem Studienaufenthalt in einem renom-<br />
mierten internationalen Institut verknüpft,<br />
das sich mit <strong>der</strong> Behandlung von Persön-<br />
lichkeitsstörungen befasst.
Personalia<br />
<strong>Asklepios</strong> Klinik Harburg:<br />
Neuer Chefarzt für Orthopädie und Unfallchirurgie<br />
Priv.-Doz. Dr. Christian Heinrich Flamme übernimmt als Nach-<br />
folger von Dr. Bernd-Joachim Rasch zum 1. November 2007 die<br />
bisherige Abteilung für Unfall- und Wie<strong>der</strong>herstellungschirurgie<br />
in <strong>der</strong> <strong>Asklepios</strong> Klinik Harburg. Flamme wurde in Hannover ge-<br />
boren, ist verheiratet und Vater dreier Kin<strong>der</strong>. Er studierte Human-<br />
medizin an <strong>der</strong> Medizinischen Hochschule Hannover, wo er auch<br />
promovierte. Seine AiP-Zeit absolvierte Flamme in <strong>der</strong> Unfallchi-<br />
rurgie des Nordstadtkrankenhauses Hannover, seine Weiterbil-<br />
dung zum Facharzt für Orthopädie, für Orthopädie-Rheumatolo-<br />
gie sowie Orthopädie und Unfallchirurgie in <strong>der</strong> Orthopädischen<br />
Klinik <strong>der</strong> MH Hannover im Annastift unter Prof. Dr. C. J. Wirth,<br />
wo er im Anschluss als Oberarzt und schließlich leiten<strong>der</strong> Ober-<br />
arzt weiterarbeitete. Anfang 2003 übernahm Flamme die Leitung<br />
<strong>der</strong> Sektion Wirbelsäulenchirurgie im Annastift. Er erwarb die Teil-<br />
gebietsbezeichnung „spezielle orthopädische Chirurgie“ sowie die<br />
Zusatzbezeichnungen Chirotherapie und Sportmedizin. In seiner<br />
Habilitationsschrift befasste sich Flamme mit „Biomechanischen<br />
Untersuchungen zur Primärstabilität von dorsalen und ventralen<br />
monosegmentalen Spondylodesen an <strong>der</strong> bovinen Lendenwir-<br />
belsäule“. Des Weiteren hat er sich klinisch und wissenschaftlich<br />
mit <strong>der</strong> mo<strong>der</strong>nen Endoprothetik <strong>der</strong> großen Gelenke einschließ-<br />
lich minimalinvasiver Techniken unter Verwendung mo<strong>der</strong>ner<br />
Prothesendesigns beschäftigt. In <strong>der</strong> AK Harburg wird Flamme mit<br />
seinem Team die Neuausrichtung <strong>der</strong> Abteilung hin zur Ortho-<br />
pädie und Unfallchirurgie betreiben und dabei insbeson<strong>der</strong>e die<br />
Schwerpunkte Endoprothetik und Revisionsendoprothetik sowie<br />
konservative und operative Wirbelsäulenbehandlungen stärken<br />
und die Zusammenarbeit mit den Nie<strong>der</strong>gelassenen intensivieren.<br />
Kontakt<br />
Priv.-Doz. Dr. Christian Flamme<br />
Abteilung für Orthopädie und Unfallchirurgie<br />
<strong>Asklepios</strong> Klinik Harburg<br />
Eißendorfer Pferdeweg 52, 21075 Hamburg<br />
Tel. (0 40) 18 18-86 25 31<br />
Fax (0 40) 18 18-86 30 80<br />
E-Mail: c.flamme@asklepios.com<br />
<strong>Asklepios</strong> Klinik St. Georg:<br />
Neuer Chefarzt <strong>der</strong> Abteilung für Neurologie<br />
Priv.-Doz. Dr. Christoph Terborg leitet als Nachfolger von Prof. Dr.<br />
Peter Vogel seit dem 1. Juli 2007 die Abteilung für Neurologie in<br />
<strong>der</strong> <strong>Asklepios</strong> Klinik St. Georg. Terborg wurde in Siegen (NRW)<br />
geboren und ist verheiratet. Er studierte Humanmedizin an <strong>der</strong><br />
Philipps-Universität Marburg, wo er am Institut für Anatomie<br />
mit „magna cum laude“ promovierte. Seine AiP-Zeit absolvierte<br />
Terborg an <strong>der</strong> Neurologischen Klinik mit Poliklinik <strong>der</strong> Philipps-<br />
Universität unter Prof. Dr. Gerhard Huffmann mit dem Schwer-<br />
punkt Elektrophysiologie. Während seiner Weiterbildung zum<br />
Facharzt für Neurologie arbeitete Terborg an <strong>der</strong> Neurologischen<br />
Klinik des Klinikums Minden unter Prof. Dr. Otto Busse und am<br />
Nie<strong>der</strong>sächsischen Landeskrankenhaus Osnabrück (Psychiatrie)<br />
unter Prof. Dr. Wolfgang Weig. Anschließend wechselte Terborg<br />
als Wissenschaftlicher Mitarbeiter an die Klinik für Neurologie<br />
<strong>der</strong> Friedrich-Schiller-Universität Jena unter Prof. Dr. Cornelius<br />
Weiller, wo er in den folgenden Jahren die Leitung des EMG- und<br />
EEG-Labors, später des Ultraschalllabors, <strong>der</strong> Intensivstation und<br />
<strong>der</strong> Stroke Unit übernahm und bis zum stellvertretenden und kom-<br />
missarischen Direktor <strong>der</strong> Abteilung aufstieg. Er hat sich intensiv<br />
mit <strong>der</strong> Diagnostik und Therapie neuromuskulärer Erkrankungen,<br />
Kopfschmerzen und Demenzen beschäftigt. 2005 habilitierte sich<br />
Terborg mit dem Thema „Optische Untersuchungen <strong>der</strong> zerebralen<br />
Hämodynamik mittels Nahinfrarot-Spektroskopie“. Er ist Mit-<br />
glied mehrerer Fachgesellschaften und Regionalbeauftragter <strong>der</strong><br />
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe. In St. Georg wird Terborg mit<br />
seinem Team die Schwerpunkte Schlaganfall und zerebrovaskuläre<br />
Risikofaktoren und zusammen mit <strong>der</strong> Klinik für Anästhesiologie<br />
eine neurologische Intensivstation aufbauen.<br />
Kontakt<br />
Priv.-Doz. Dr. Christoph Terborg<br />
Abteilung für Neurologie<br />
<strong>Asklepios</strong> Klinik St. Georg<br />
Lohmühlenstraße 5, 20099 Hamburg<br />
Tel. (0 40) 18 18-85 22 67 o<strong>der</strong> -22 68<br />
Fax (0 40) 18 18-85 41 85<br />
E-Mail: c.terborg@asklepios.com<br />
479
ISSN 1863-8341<br />
Kommt ein Mann<br />
zum Arzt ...<br />
www.medtropole.de